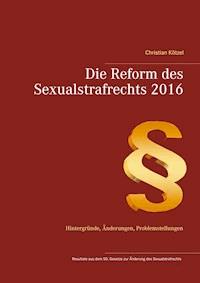
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Das Buch befasst sich mit den aktuellen Resultaten des 50. Gesetzes zur Änderung des Sexualstrafrechts Ende 2016. Dies war die größte Sexualstrafrechtsreform der letzten Jahre ("Nein-heißt-Nein"). Es werden (politische) Hintergründe, sowie die rechtlichen Neuerungen eingehend erörtert. Durch die Reform entstandene Problemstellungen werden diskutiert. Das Buch ist ein Auszug aus der Masterarbeit des Verfassers.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Hinführung
1. Einleitung
1.1 Thematische Hinführung
1.2 Forschungsstand
2. Einordnung in den historischen Kontext & bisherige Rechtsnorm
Hauptteil
4. (Politische) Ausgangslage zur aktuellen Änderung
4.1 Istanbul-Konvention
4.2 Schutzlücken
4.3 Mediale Aufmerksamkeit: Kölner Silvesternacht 2015/2016
5. Gesetzgebungsverfahren
5.1 Gesetzesvorschläge
5.2 Beratungen
5.3 Beschluss und Verkündung
6. Erfolgte Gesetzesänderungen / Synopse
6.1 § 177 StGB: Sexueller Übergriff; sexuelle Nötigung; Vergewaltigung
6.2 § 179 StGB: Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen (aufgehoben)
6.3 § 184i StGB: Sexuelle Belästigung
6.4 § 184j StGB: Straftaten aus Gruppen
6.5 § 240 StGB: Nötigung (in Teilen aufgehoben)
6.6 Sonstige Anpassungen
7. Problemstellungen
7.1 § 177 StGB
7.2 § 184i StGB
7.3 § 184j StGB
7.4 Diskrepanzen zu den §§ 174 ff.
7.5 Weitere (polizeiliche) Problemstellungen
7.6 Lösungsvorschläge
Schlussbetrachtung
8. Ergebnis
8.1 Zusammenfassung
8.2 Fazit
Literaturverzeichnis
Rechtsquellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anhang
Synopse
Vergleichende grafische Darstellung § 177 alt und neu
Eigene Vorschläge zur Optimierung der Gesetzesänderung
A. Hinführung
1. Einleitung
1.1 Thematische Hinführung
„‘Nein heißt Nein‘ […] ist ein Meilenstein für alle Frauen“1
Diese Worte sprach die rheinland-pfälzische Frauenministerin Anne Spiegel im Juli 2016 im rheinland-pfälzischen Landtag, nachdem sieben Tage zuvor der Deutsche Bundestag in zweiter und dritter Lesung das Gesetz zum besseren Schutz sexueller Selbstbestimmung verabschiedet hatte2.
Prinzipiell geht die Ausgangslage dieser Gesetzesänderung zurück auf die sog. Istanbul-Konvention des Europarates vom 11.05.2011, in welcher von den Vertragsstaaten gefordert wird alle Formen nicht einverständlicher sexueller Gewalt zu pönalisieren3 (siehe Kapitel 4.1).
Die deutsche Bundesregierung hat sich dieser Forderung, namentlich einer Änderung der §§ 177 ff. StGB, erst im Jahr 2015 angenähert, als das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ihr „einen Gesetzentwurf zur Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung vorgelegt“4 hat.
Nach den Ereignissen der Silvesternacht 2015 in Köln mit massenhaften Übergriffen auf Frauen wurde das Gesetzesvorhaben unter dem Druck von Frauenverbänden und der medialen Aufmerksamkeit dringlicher. Die große Koalition forderte zügig die Gesetze zu verschärfen, um Strafbarkeitslücken zu schließen, während die Opposition dem noch ablehnend gegenüberstand.5 Spätestens zum Zeitpunkt der medienwirksam inszenierten Gerichtsverhandlung im Falle des „Starlets“ Gina-Lisa Lohfink nahm die Debatte um eine Reform des Sexualstrafrechts rasant an Fahrt auf. So forderte u.a. der Bundesjustizminister Heiko Maas die Union auf, Widerstände gegen Reformen beiseite zu legen und Vertreter der Partei Bündnis 90/Die Grünen betonten, dass dieser Fall deutlich zeigt, dass mehr für den Schutz von (sexualisierter) Gewalt gegen Frauen getan werden muss.6
In der Folge gewann die mittlerweile breit angelegte öffentliche Debatte über sog. „Schutzlücken“ im aktuellen Sexualstrafrecht an Fahrt und trieb die politischen Akteure förmlich vor sich her. Frauen- sowie Menschenrechtsverbände meldeten sich ebenso zu Wort wie die juristische Fachwelt. Am Ende des Prozesses formierte sich ein Gesetz unter dem Grundsatz „Nein heißt Nein“. Dieser war im Gesetzesentwurf der Bundesregierung nicht vorgesehen, wurde aber in dem vergleichsweise rasch durchgeführten Gesetzgebungsverfahren letztendlich bevorzugt und fand Eingang in das am 09.11.2016 veröffentlichte Gesetz.7
Die Plenardebatten zum „50. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches“ endeten vor fast genau einem Jahr. Vor ca. 6 Monaten ist das Gesetz in Kraft getreten. Und mittlerweile wurden erste Straftäter nach dem neuen Recht verurteilt.8 Es ist Zeit, das Gesetz und seine Entstehung genauer zu betrachten. Handelt es sich um den von Politikern versprochenen „historischen Schritt“9 wie es die Bundestags-Abgeordnete der Partei Die Linke, Halina Wawzyniak, formulierte oder versprechen die neuen Regelungen „mehr, als sie am Ende halten können“10? Was hat sich denn genau geändert und wie bewerten fachlich versierte Juristen das neue Gesetzesgebilde? Im Folgenden wird eine Zusammenfassung über die (politischen) Hintergründe und die erfolgten Änderungen gegeben. Darüber hinaus soll auf einige aufgeworfene Problemstellungen eingegangen werden.
1.2 Forschungsstand
In den einschlägigen juristischen Fachzeitschriften gab es bislang nur wenige Meinungen zu dem Änderungsgesetz. Insbesondere im direkten Anschluss an den Bundestagsbeschluss bis zur Zeit des unmittelbaren In-Kraft-Tretens des neuen Gesetzes äußerten sich Experten durchaus kontrovers zu den neuen Normen. So bemängelt Müller, dass die Ergebnisse der eigens dafür eingesetzten Expertenkommission nicht abgewartet wurden. Er zieht das Fazit, dass mit „guter Intention […] in Eile ein Gesetz verabschiedet [wurde], das in einigen Formulierungen problematisch ist“11. Während die erfolgten Änderungen in Bezug auf den Verzicht der Nötigungselemente (§ 177 Abs. I 12) i.d.R. durchwegs positiv bewertet werden13, werden andere Vorschriften von den Autoren kritisch hinterfragt. Dies betrifft insbesondere den § 177 Abs. II (Probleme beim Strafrahmen im Verhältnis zu den §§ 174-174 c)14 oder den neu geschaffenen § 184j, welcher laut Renzikowski in ein „totales Strafrecht“15 führe und bei dem zu „hoffen [sei], dass das BVerfG diesem Wahn Einhalt gebietet“16.
Es gibt mittlerweile erste Urteile17. Diese sind jedoch erstinstanzlich. Insbesondere bei auslegungsbedürftigen Tatbeständen (siehe Kapitel 7) muss der Gang in weitere Instanzen abgewartet werden, um durch höchstrichterliche Rechtsprechung bzw. daran anschließende Diskussion in Fachzeitschriften eine Auseinandersetzung mit problembehafteten neuen Normen zu ermöglichen.
Fischer ist der erste und bislang einzige, der Anfang 2017 einen überarbeiteten StGB-Kommentar18 herausbrachte, welcher bereits das neue Sexualstrafrecht enthält.19 Bereits im Februar 2015 wurde vom BMJV eine „Reformkommission zur Überarbeitung des 13. Abschnitts des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches“ eingerichtet, welche den Abschnitt sinnvoll neuordnen, eventuelle Strafbarkeitslücken schließen und möglicherweise überholte Strafvorschriften hinterfragen soll. Bislang wurden jedoch noch keine Ergebnisse öffentlich, obwohl dies eigentlich bereits im Frühjahr 2016 geplant war.20 Auf Nachfrage im Mai 2017 gab das BMJV dem Autor bekannt, dass eine Veröffentlichung der Ergebnisse voraussichtlich Ende Juli 2017 zu erwarten ist21.
2. Einordnung in den historischen Kontext & bisherige Rechtsnorm
Seit Anbeginn unserer zivilisierten Menschheit setzte man sich bereits mit der „Vergewaltigung“ und der notwendigen Strafbarkeit auseinander. Bereits im Alten Testament finden sich Hinweise hierüber.22 Diese Taten wurden in der Folgezeit zwar als übles Unrecht angesehen, stellten jedoch primär einen Eingriff in das Besitz- und Verfügungsrecht des Mannes dar.23 Nehlsen belegt, dass zu Zeiten der Lex Salica im 5. und 6. Jahrhundert selbst „schwere Unrechtstaten wie […] Notzucht, Frauenraub […] mit einer Geldbuße belegt“24 wurden. Im späten Mittelalter reichte die Strafe dann bis hin zur Entmannung oder Enthauptung.25 Während des 13. Jahrhunderts ging man dazu über, dass eine solche Straftat nicht mehr nur gegen die Verfügungsehre des Mannes verstieß, sondern auch die Geschlechtsehre der Frau verletzte.26 Da jedoch in der damaligen Zeit nicht allen Frauen eine Geschlechtsehre zugebilligt wurde, kamen die Rechtsnormen nicht jeder Frau zuteil. Frauen mussten damals ihre Glaubwürdigkeit durch Klageschreie während der Straftat belegten.27 1532 wurde vom Regensburger Reichstag das erste einheitlich deutsche Strafgesetzbuch verkündet.28 In der Peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V. (Constitutio Criminalis Carolina) wird die „Notzucht“ als gewaltsame Schändung einer Frau verstanden: Wenn jemand einer unbescholtenen Ehefrau, Witwe oder Jungfrau mit Gewalt und gegen ihren Willen ihre jungfräuliche oder fräuliche Ehre nimmt, hat dieser Übeltäter das Leben verwirkt und soll, einem Räuber gleich, mit dem Schwert gerichtet werden.
(„Item so jemandt eyner vnuerleumbten ehefrawen, witwenn oder jungkfrawen mit gewalt vnd wider jren willen , jr jungfrewlich oder frewlich ehr neme, der selbig übelthetter hat das leben verwürckt vnd soll […] eynem rauber gleich mit dem schwert vom leben zum todt gericht werden.“29)
Es gab erstmals den fest geschriebenen Begriff der „Gewalt“. Man unterschied zwischen „‘wirklicher Gewalt‘ und den für nicht strafwürdig erachteten Gewaltformen der sog. ‚vis grata‘ (willkommene Gewalt) bzw. vis ‚haud ingrata‘ (nicht unwillkommene Gewalt) und verlangte eine nicht unerhebliche physische Kraftentfaltung sowie einen ernsthaften Widerstand des Opfers, der nicht nur ‚typisches‘ weibliches Zieren war“30.
Im Reichsstrafgesetzbuch von 1871 wurden Sexualdelikte erstmals im 13. Abschnitt als „Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit“31 aufgeführt. Zwar sind diese Straftaten auch heute noch immer im 13. Abschnitt des StGB geführt, jedoch war die Intention damals eine ganz andere. Im Vordergrund stand nicht die sexuelle Selbstbestimmung eines Einzelnen, sondern der Schutz „moralischer gesellschaftlicher Grundsätze auf geschlechtlichem Gebiet“32.
Die Normen für sexuelle Nötigung und Vergewaltigung waren in den §§ 176 ff. festgelegt33. Dort heißt es unter anderem:
„§ 176. Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer 1.mit Gewalt unzüchtige Handlungen an einer Frauensperson vornimmt oder dieselbe durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Duldung unzüchtiger Handlungen nöthigt […]“
Oppenhoff beschreibt in seiner Kommentierung zum RStGB, dass Gewalt als ein Mittel des Zwanges „zur Überwindung eines (ernstlich) geleisteten Widerstandes anzusehen“34 ist. Fehlt es am Widerstand der Frau, oder handelt es sich um ein „bloßes Widerstreben oder Sträuben (welches oft nicht ernstlich gemeint ist)“35, so ist die Straftat ausgeschlossen.
Hier findet sich also die „zwei-aktige“ Grundstruktur (gegen den Willen plus Gewaltanwendung) der Constitutio Criminalis Carolina wieder. Diese blieb in all den Jahrhunderten relativ unverändert erhalten und sollte spätestens im Jahr 2016 Gegenstand der politischen Debatte werden (siehe Kapitel 4).
Durch die 4. Reform des Strafrechts wurde 1973 der 13. Abschnitt des StGB grundlegend liberalisiert. Ein Grund hierfür war das sog. „Fanny-Hill-Urteil“, in welchem der BGH vermerkt: „Das Strafgesetz hat nicht die Aufgabe auf geschlechtlichem Gebiet einen moralischen Standard des erwachsenen Bürgers durchzusetzen, sondern es hat die Sozialordnung der Gemeinschaft von Störungen und groben Belästigungen zu schützen.“36
Insofern wurde mit dieser Reform auch das geschützte Rechtsgut verändert. Stand in früheren Zeiten die Sittlichkeit im Vordergrund (s.o.) so wurden die Straftaten nun als Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung deklariert.37 Diese ist ein Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, welches als Grundrecht von Art. 2 Abs. I GG in Verbindung mit Art. 1 Abs. I GG geschützt wird.38
Eine weitere wichtige Änderung in Bezug auf die Delikte der „sexuellen Nötigung“ und „Vergewaltigung“ war das 33. Strafrechtsänderungsgesetz aus dem Jahre 1997. Beide Handlungen wurden in einem Paragraphen zusammengefasst. Darüber hinaus wurde eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt, so dass nunmehr Frauen und auch Männer geschützt wurden. Zudem wurden erstmals Tathandlungen innerhalb einer Ehe tatbestandsmäßig, was grundlegend den Schutz von (in erster Linie) Frauen erhöhte.39
Im Jahr 2016 waren, sehr vereinfacht ausgedrückt, sexuelle Handlungen unter Strafe gestellt, welche durch Nötigung
mit Gewalt oder
durch Drohung einer Lebensgefahr oder
unter Ausnutzen einer schutzlosen Lage oder
unter Ausnutzen einer Widerstandslosigkeit erfolgten (vergleiche hierzu auch u.g. Schaubild) 40.
Als „Gewalt“ ist nach herrschender Meinung „physischer Zwang zur Überwindung eines Widerstandes“41 gefordert. Sie wird unterschieden in die „beeinflussende, willensbeugende Gewalt (vis compulsiva)“42 und die „überwältigende Gewalt (vis absoluta)“43.
1 Spiegel, 2016
2 Vgl. BT-Plenarprotokoll 18/183, 2016a, S. 18025 A
3 Vgl. Istanbul-Konvention ETS 210, 2011, S. 15
4 Bezjak, 2016, S. 557
5 Vgl. Kulms, 2016
6 Vgl. Focus, 2016 sowie Facebook Bündnis 90/Die Grünen, 2016
7 Vgl. BT-Dr. 18/8210, 2016 sowie 50. Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches - Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung, 2016, S. 2460
8 Vgl. Deck, 2017
9 Meiritz, 2016
10 Schulz, 2016
11 Müller, 2016, S. 3
12 Sofern keine anderweitige Erwähnung erfolgt, beziehen sich alle folgenden Paragraphen auf das StGB, und zwar in der neuen Fassung.
13 Vgl. u.a. Bezjak, 2016, S. 560, Renzikowski, 2016, S. 3553
14 Vgl. Renzikowski, 2016, S. 3556
15 Renzikowski, 2016, S. 3558
16 Ebd. S. 3558
17 Vgl. z.B. AG Bautzen, 2017
18 Vgl. Fischer, 2017
19 Stand: 10.06.2017
20 Vgl. BMJV, 2015a
21 Anm. d. Verf.: Die Ergebnisse wurden nach Abschluss dieser Arbeit am 19.07.2017 veröffentlicht. Sie bestätigen in vielen Punkten die in diesem Buch dargelegte Meinung des Autors.
22 Vgl. 5. Buch Mose - Kapitel 22, S. Vers 13 ff.
23 Vgl. Sick, 1993, S. 28
24 Nehlsen, 1983, S. 5
25 Vgl. Kieler, 2003, S. 7
26 Ebd. S. 36
27 Vgl. ebd. S. 9
28 Ebd. S. 9
29 Zitiert nach Radbruch, 1960, S. 79 f.
30 Kieler, 2003, S. 10
31 Oppenhoff, 1873, S. 299
32 Kieler, 2003, S. 15
33 Auszug aus dem RStGB
34 Vgl. Oppenhoff, 1873, S. 306, RNr 9
35 Ebd. S. 306, RNr 9
36 BGH, 1969, Ziffer 15
37 Vgl. Schmidt-Bens, 2016, Kapitel 5
38 BT-Dr. 18/8210, 2016, S. 7
39 Vgl. journascience.org
40 Auszug bisheriger Gesetzestext 13. Abschnitt
41 Fischer, 2017, S. 1710
42 Ebd. S. 1711
43 Ebd. S. 1711
B. Hauptteil
4. (Politische) Ausgangslage zur aktuellen Änderung
4.1 Istanbul-Konvention
1998 wurde eine Bulgarin (in Bulgarien) von drei Männern vergewaltigt. Da sie den kräftigeren Männern ohnmächtig gegenüberstand, verzichtete sie auf Gegenwehr. Da das bulgarische Recht vorsah, dass eine Straftat nur dann verwirklicht ist, wenn die sexuelle Handlung mittels Gewalt oder Drohung mit Gewalt durchgesetzt wird, gingen die Täter straffrei aus. Deshalb klagte die Geschädigte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieser stellte 2003 fest, dass Bulgarien gegen Art. 3 (Verbot der Folter) und 8 (Recht auf Achtung des Privatlebens) der EMRK verstoßen hatte. Bulgarien vernachlässige demzufolge seine Pflichten zum Schutz seiner Bürger vor jedweder Art sexueller Gewalt oder Nötigung mittels entsprechender Gesetze und Strafverfolgung.44 Somit wurde bereits durch dieses Urteil im Jahre 2003 für alle EU-Mitgliedsstaaten entschieden, dass diese verpflichtet sind sämtliche nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen unter Strafe zu stellen und entsprechend zu verfolgen und abzuurteilen, gerade auch dann, wenn das Opfer keinen physischen Widerstand leistet.45
Am 11.05.2011 unterzeichnete Deutschland das „Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“46 (Istanbul-Konvention). Im dortigen Art. 36 wird festgelegt, dass die Vertragsparteien aufgefordert sind, die „erforderlichen gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen [zu treffen], um sicherzustellen, dass […] nicht einverständliches, sexuell bestimmtes […] Eindringen in den Körper einer anderen Person […oder] sonstige nicht einverständliche sexuell bestimmte Handlungen“47 unter Strafe gestellt sind. Gleiches gilt für das Veranlassen einer Person zu Handlungen an Dritten.48 Die Istanbul-Konvention erfordert also zwei Dinge: Erstens sollen alle sexuellen Handlungen gegen den Willen einer Person unter Strafe gestellt werden. Zweitens wird von den Vertragsstaaten eine konsequente Strafverfolgung dieser Delikte erwartet.
In der Begründung eines 2014 erlassenen StÄG49 schreibt die Bundesregierung: „Ob und gegebenenfalls inwiefern aus Artikel 36 der Istanbul-Konvention gesetzgeberischer Handlungsbedarf im Hinblick auf die Strafbarkeit nicht einvernehmlicher sexueller Handlungen folgt, ist noch Gegenstand der Prüfung“50.





























