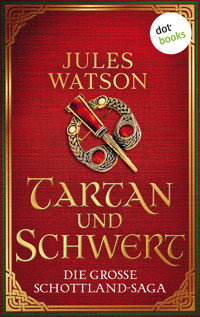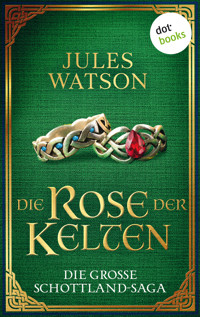
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Dalriada-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Kann sie Schottland aus der Asche auferstehen lassen? Der opulente historische Roman »Die Rose der Kelten« von Jules Watson als eBook bei dotbooks. Im vierten Jahrhundert nach Christus herrschen die Römer über Britannien: Nur ein kleiner Teil im Norden des Landes ist noch in der Hand schottischer Rebellen. Als sie von ihren römischen Herren verstoßen wird, bleibt eine keltische Sklavin schutzlos in dieser gefährlichen Region zurück. Minna hat kaum noch Hoffnung – bis der schottische König von ihren heilenden Fähigkeiten erfährt und sie an seinen Hof ruft. Schon bald wird Minna zu Cahirs engster Vertrauter: Sie soll für ihn einen lange verloren geglaubten Talisman finden, der den Schotten zum Sieg über die Römer verhelfen könnte. Ohne zu zögern, begibt Minna sich auf die gefährliche Reise – aber kann eine Frau allein wirklich die Wende bringen im jahrhundertelangen Freiheitskampf der Schotten? »Watsons Werk ist so originell wie eh und je; ihre Fans werden diese mitreißende Saga lieben!« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Roman »Die Rose der Kelten« von Jules Watson ist der dritte Teil ihrer Dalriada-Trilogie – ein Lesegenuss für die Fans von Marion Zimmer Bradley und »Outlander«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 889
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im vierten Jahrhundert nach Christus herrschen die Römer über Britannien: Nur ein kleiner Teil im Norden des Landes ist noch in der Hand schottischer Rebellen. Als sie von ihren römischen Herren verstoßen wird, bleibt eine keltische Sklavin schutzlos in dieser gefährlichen Region zurück. Minna hat kaum noch Hoffnung – bis der schottische König von ihren heilenden Fähigkeiten erfährt und sie an seinen Hof ruft. Schon bald wird Minna zu Cahirs engster Vertrauter: Sie soll für ihn einen lange verloren geglaubten Talisman finden, der den Schotten zum Sieg über die Römer verhelfen könnte. Ohne zu zögern, begibt Minna sich auf die gefährliche Reise – aber kann eine Frau allein wirklich die Wende bringen im jahrhundertelangen Freiheitskampf der Schotten?
»Watsons Werk ist so originell wie eh und je; ihre Fans werden diese mitreißende Saga lieben!« Publishers Weekly
Über die Autorin:
Jules Watson wurde 1970 als Tochter englischer Auswanderer in Perth geboren. Sie wuchs in Australien auf und lernte ihren späteren Ehemann Alistair, einen Schotten, bereits an der Highschool kennen. Nach ihrem Studium der Archäologie und PR arbeitete sie unter anderem in diesen Berufen, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Sie lebte viele Jahre lang abwechselnd in Australien und der UK, bis sie schließlich mit ihrem Mann in ein kleines schottisches Glen an der Westküste zog.
Die Website der Autorin: juleswatson.com
Von Jules Watson erscheinen bei dotbooks die drei Teile der Dalriada-Trilogie »Tartan und Schwert«, »Das keltische Amulett« und »Die Rose der Kelten«.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2007 unter dem Originaltitel »The Boar Stone« bei Orion, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe Jules Watson, 2007
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/O.S., Byjeng und adobeStock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-239-1
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Rose der Kelten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jules Watson
Die Rose der Kelten
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Nina Bader
dotbooks.
Erstes Buch
Zeit des Blätterfalls, anno domini 366
Kapitel 1
»Möge Christus euch in Liebe leiten«, schnaufte der alte Priester, dabei stützte er sich schwer auf den Sandsteinaltar.
Minna schnaubte verhalten. Es mochte ja Sabbat sein, ein heiliger Tag der Christen, weshalb sie jetzt auch in der Kapelle der Villa Aurelius standen, aber sie ahnte, dass das, was ihr bevorstand, mit Liebe wenig zu tun hatte.
Wir müssen eine Entscheidung treffen, hatte ihr Bruder Broc zu ihr gesagt. Über deine Zukunft, Minna. Seine Worte schwirrten wie Motten in ihrem Kopf herum. Über deine Zukunft. Über deine Zukunft. Über deine Zukunft.
Sie fing einen Blick von Severus auf, dem Aufseher auf Aurelius’ Landsitz. Er war ein kräftiger, untersetzter Mann mit braunem Haar, das von grauen Strähnen durchzogen wurde. Sein Gesicht war vom übermäßigen Alegenuss gerötet, aufgedunsen und von der Sonne gegerbt, da er sich den ganzen Tag auf den Feldern aufhielt, um die Sklaven zur Arbeit anzutreiben. Seine Hände wiesen vom Gebrauch der Peitsche harte Schwielen auf, und seine braunen Augen ruhten jetzt abschätzend auf Minna. Neben ihm stand Broc und beobachtete den seine Schwester musternden Severus. Seine mürrische Miene hellte sich dabei nicht auf.
Minna schnippte ihren schwarzen Zopf von ihrem klammen Nacken und straffte die Schultern. Sollten sie nur starren!
»Minna«, flüsterte der kleine Marcus und presste sein Gesicht gegen ihren Arm. »Dauert es noch lange?« Er war erst drei Jahre alt; seine helle Kinderstimme hallte in der schmucklosen Kapelle laut und vernehmlich wider.
Publius Aurelius und seine Frau drehten sich beide gleichzeitig um und blickten nicht ihren Sohn, sondern dessen Kindermädchen missbilligend an. Minna legte Marcus lächelnd einen Finger auf die Lippen. Sein zehnjähriger Bruder Lucius verdrehte die Augen, woraufhin Minna mahnend den Kopf schüttelte. Publius saß die Hand etwas zu locker, wenn es darum ging, seine Söhne mit dem Lederriemen zu züchtigen, und sie hatte gerade erst die ganze Nacht am Bett des fiebernden Marcus gewacht. Zum Glück schien es ihm heute morgen besser zu gehen.
Die heiße Sonnenzeit war in die Zeit des Blätterfalls übergegangen. In der Kapelle mit den frisch getünchten Wänden und dem neuen Mosaikfußboden war es kühl und dunkel, aber sie war so klein, dass die Gottesdienstteilnehmer eng aneinandergedrängt stehen mussten. Obwohl der Herr und die Herrin Christen waren, verehrten die meisten der einheimischen Arbeiter auf dem Landgut auch weiterhin die alten Götter und die Große Mutter und nahmen an dieser Zeremonie nur teil, weil ihnen keine andere Wahl blieb. Die Luft war erfüllt von säuerlichem Schweißgestank und dem schweren ägyptischen Parfüm der Herrin.
Die beiden Jungen verstummten, und der Priester fuhr mit seiner Predigt fort. Minna zupfte seufzend an ihrem kratzenden, an ihrer erhitzten Haut klebenden Kleid herum. So in Ruhe ihren Gedanken nachhängen konnte sie sonst nur, wenn der griechische Lehrer Nikodemes den Jungen Geschichten über die trojanischen und griechischen Kriege oder von übermütigen Göttern und eifersüchtigen Göttinnen erzählte. Die Kapellenwände waren mit roten und weißen Diamanten bemalt, die sie drei Mal zählte, bis sie bemerkte, dass die beiden Töchter der Köchin sie anstarrten. Ah ja, diese zwei hatte sie ganz vergessen. Sie konnte ihnen die Gedanken von den feisten Gesichtern ablesen. Welches Recht hatte sie, die Frau mit den ungewöhnlichen Augen und dem eigenartigen Gebaren, vor der Christusfigur zu stehen, wo sie doch als Heidin galt? Die Mädchen tuschelten hinter vorgehaltener Hand miteinander, und Minna wandte ihr brennendes Gesicht ab. Severus war hier der Einzige, der sie nicht für hellsichtig und nur zur Hälfte menschlich hielt. Was für eine Ironie des Schicksals!
»Amen«, krächzte der Priester endlich.
»Amen«, murmelte die kleine Gemeinde erleichtert. Minna stimmte nicht mit ein, sondern schielte sehnsüchtig zur Tür hinaus. Sie konnte den von den abgebrannten Stoppelfeldern aufsteigenden Rauch und den Duft reifer Äpfel riechen, der von den Obstgärten, wo die Sklaven sie in Fässer pflückten, zu ihr herüberwehte. Die Herrin Flavia hatte ihr befohlen, den Tag mit den Jungen außerhalb des Hauses zu verbringen. Sie konnte es kaum erwarten, endlich ins Freie zu kommen.
Schließlich schlang Publius seinen Umhang enger um sich und schritt eilig zur Tür hinaus. Als einer der reichen Landgutbesitzer in den fruchtbaren Tälern östlich der Stadt Eboracum gehörte er dem Rat an und musste häufig an wichtigen Besprechungen in der nahegelegenen Stadt Derventio teilnehmen.
Sowie er außer Sicht war, stürmten seine Söhne aus der Kapelle. Minna folgte ihnen und blinzelte in die Sonne, deren Strahlen von den weißen Wänden und den roten Dachziegeln der Villa zurückgeworfen wurden. Das Haupthaus und die beiden Nebenflügel umschlossen einen lichtdurchfluteten Hof, dahinter lockten die grünen Hügel.
Doch ehe sie den Jungen zurufen konnte, auf sie zu warten, schlossen sich Brocs Finger um ihr Handgelenk und zogen sie zur Seite. »Was ich gesagt habe, war ernst gemeint, kleine Schwester«, murmelte er. »Und ich dulde keinen Widerspruch.«
Er blickte über seine Schulter hinweg zu Severus, der gerade die Kapelle verließ. Der Aufseher tippte sich mit dem Griff seiner Peitsche gegen die Stirn. Er ließ Minna nicht aus den Augen, während er, an die Mauer gelehnt, auf Flavia wartete.
Minna entwand sich atemlos Brocs Griff. »Du weißt genau, dass ich...«
»Ich will nichts mehr hören!« Brocs rotes Haar war schweißverklebt. Obwohl Minna zwei Jahre jünger war als er, hatte sie ihm oft mit einer mütterlichen Geste die schweren Locken aus der Stirn gestrichen. Aber nicht heute. Als die anderen Diener in den Hof strömten, dämpfte Broc seine Stimme. »Du kannst nicht dein ganzes Leben lang als Kindermädchen arbeiten, Minna.«
»Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.«
»Du zählst schon achtzehn Sommer«, zischte er. Sein sommersprossiges Gesicht verhärtete sich vor Zorn. »Wir haben ohnehin schon zu viel Zeit verloren – weil ich dir bislang deinen Willen gelassen habe. Aber damit ist jetzt Schluss.«
Ihre Vorfahren waren Sklaven gewesen und von Publius’ Großvater freigelassen worden. Aber Brocs und Minnas Eltern waren sehr früh gestorben – die Mutter am Fieber, der Vater nach einem Reitunfall – und Minna konnte sich kaum noch an sie erinnern. Seither lebten die Geschwister zusammen mit ihrer Großmutter friedlich in einem kleinen Haus am Fluss. Warum sollte sich daran etwas ändern? Wie konnte Broc solche Andeutungen machen?
Minna hob herausfordernd den Kopf. »Ich bin glücklich mit dir und Mamo.«
»Mamo wird nicht ewig leben.«
»Du bist ja auch noch da.« Sie hielt Brocs Blick unverwandt stand.
Erst jetzt wurde ihnen bewusst, dass mehrere Leute sie neugierig anstarrten und versuchten, ihrer geflüsterten hitzigen Auseinandersetzung zu lauschen. Broc zerrte sie ärgerlich um die Hausecke, wo ein Tor den Hof von den Feldern trennte.
»Das wäre jetzt wirklich nicht nötig gewesen.« Minna rieb sich aufgebracht die Handgelenke. Aber irgendetwas im Gesicht ihres Bruders hinderte sie daran, noch mehr zu sagen.
»Ich werde dir verraten, warum uns keine Zeit mehr bleibt.« Die Sehnen an Brocs Armen traten deutlich hervor, und Minna wurde klar, dass sich in der letzten Zeit nicht nur sein Verhalten verändert hatte. Seine Schultern waren breiter geworden; er war kein Junge mehr, sondern ein erwachsener Mann. Ihr Magen krampfte sich zusammen, als Broc sich mit einem tiefen Atemzug für das wappnete, was er ihr zu eröffnen gedachte. »Ich bin in die Armee eingetreten. In drei Tagen breche ich auf, ich bin zum Wall abkommandiert.«
Jegliche Farbe wich aus Minnas Gesicht.
»Der Herr hat mir bereits seine Erlaubnis erteilt«, fuhr Broc hastig fort.
Sie sah, wie sich seine Lippen bewegten, vermochte aber seine Worte nicht zu erfassen. Endlich stieß sie tonlos hervor: »Aber du sollst doch eines Tages Verwalter werden, und ... du musst dich doch um mich und Mamo kümmern.«
»Ich werde nicht hier verschimmeln, bis ich alt und fett bin!« Minna zuckte angesichts dieses Ausbruches erschrocken zusammen, und er griff nach ihrer Hand. »Verstehst du denn nicht, was für eine große Ehre das für mich ist, Schwester? Ich bin bei den areani aufgenommen worden, bei den Kundschaftern, und dort nimmt man nur die besten Reiter.« In seinen Augen loderte eine Flamme auf, die durch Minna hindurchzudringen schien, als bestünden sie und dieses Feuer aus so unterschiedlicher Materie, dass es ihr nichts anhaben konnte.
»Und was soll aus uns werden?«, fragte sie, konnte jedoch nicht verhindern, dass ihre Stimme zitterte. »Du willst Mamo und mich einfach im Stich lassen?«
»Ich kann mich durch euch nicht von meinen Plänen abhalten lassen; du bist meine Schwester, nicht mein Kind. Es wird Zeit, dass sich ein anderer Mann deiner annimmt. Als dein rechtmäßiger Gatte.«
Minna entzog ihrem Bruder langsam ihre Hand. Sie hatte sich an den irrwitzigen Traum geklammert, ihr Leben würde ewig so weitergehen wie bisher: Mamos Geschichten abends am Feuer, nachmittägliche Ausflüge mit Marcus und Lucius. Sie brauchte sich ja nur anzusehen – ihre Sandalen waren schlammverschmiert, ihr Kleid mit Grasflecken übersät. Sie hatte ganz in ihrer eigenen Welt versunken ihre Tage verbracht, und nun war sie unsanft in die Wirklichkeit zurückgeholt worden. »Ich denke, es gibt keinen Bewerber um meine Hand, nicht wahr, Bruder? Wegen meines – wie sagen alle doch immer? –, meines merkwürdigen Verhaltens.«
»Was erwartest du denn, wenn du dauernd diese Wachträume hast, wie du sie nennst, mit leerem Blick vor dich hin starrst und wirres Zeug redest? Die Leute erfahren davon. Wie oft habe ich dich gebeten, ein schicklicheres Benehmen an den Tag zu legen, aber du hast ja nie auf mich gehört.«
Minna rang nach Atem und ballte die Fäuste, aber Broc sprach schon weiter. »Und nun hat sich tatsächlich ein Mann erboten, dich zur Frau zu nehmen – nur ein Einziger. Und du wirst ihn heiraten.«
»Nein.« Ihre Stimme drohte zu versagen. »Nein.«
Broc verschränkte die Arme vor der Brust. »Oh doch. Severus hat den einträglichsten Posten auf dem Gut. Er wird geachtet und respektiert. Und er hat sich nicht von all dem Gerede über dich abschrecken lassen, also muss er ein vernünftiger Mann sein.«
Vernünftig. Severus atmete schwer durch die Nase, wenn Minna in seiner Nähe war. Warum nur fand er sie nicht ebenso abstoßend, wie all die anderen Arbeiter es taten? Dann flammte die Erkenntnis wie ein Blitz in ihr auf. Severus betrachtete sich als einen Mann, der in der Welt stetig vorankam. Er sammelte angeschlagenes Geschirr, angelaufene Bronzetöpfe und zerbrochene Fliesen aus reichen Häusern, um sein eigenes damit auszustatten. Normalerweise hätte sie spöttisch darüber gelächelt, hätte sie jetzt nicht gewusst, was diese Marotte zu bedeuten hatte: Er mochte seltsame, ausgefallene Dinge, die sonst niemand besaß. Ungewöhnliche Dinge. Solche Dinge wie sie.
»Nein«, stieß sie gepresst hervor. »Nicht ihn. Ich werde ihn nicht heiraten.«
Broc setzte zu einer zornigen Erwiderung an, aber Minna machte sich von ihm los und stolzierte davon, ohne weiter auf ihn zu achten. Ihr Hals schmerzte, und in ihren Augen brannten Tränen, die sie unwillig unterdrückte.
Die Jungen schaukelten auf dem Tor zu den Feldern. Als Lucius ihr bestürztes Gesicht sah, grinste er, wobei er ein paar Zahnlücken entblößte. »Denk doch nur, Minna ... wir haben einen ganzen Tag für uns allein. Weit weg von all den anderen.«
»Von all den anderen«, echote der pummelige kleine Marcus.
Minna hob ihr Gesicht seufzend der Sonne entgegen. Die Bäume, das Gras und die Vögel maßten sich wenigstens nicht an, über sie zu urteilen. »Dann lasst uns gehen«, sagte sie heiser. »Je eher, desto besser.«
Oben im Hochmoor verrauchte ihre Wut allmählich, und sie begann, ihre Lage klar und logisch einzuschätzen. Hinter einer windgepeitschten Heideebene lagen die Überreste einer verlassenen römischen Festung. Minna setzte sich in einen alten Graben und starrte blicklos über die an eine Flickendecke erinnernden Felder und Weiden hinweg. Eine Hummel prallte gegen ihre Wange. Von den Obstgärten drangen die Rufe der Arbeiter zu ihr empor. Hier oben herrschte tiefer Frieden, doch unter ihr hob sich die weiße Villa Aurelius drohend von dem grünen Land ab. Severus gehörte zu der Welt dort unten. Minnas Herz machte einen Satz, und sie schloss die Augen.
Als Frau verfügte sie über keinerlei Rechte. In den Adern ihrer Familie floss sowohl einheimisches als auch römisches Blut, aber die Römer herrschten jetzt in diesem Land. Und ihr Gesetz schrieb vor, dass Minna sich einem Mann unterordnen musste: einem Vater, Bruder oder Ehegemahl. Einen anderen Weg oder eine andere Wahl gab es nicht.
Die Hälfte der Mädchen auf dem Landgut hatte ein Auge auf Severus geworfen, das wusste sie. Er war Witwer in gesicherter Position und genoss Publius’ Vertrauen. Obwohl er ein vom Wetter gegerbtes Gesicht hatte, konnte man ihn nicht direkt als hässlich bezeichnen. Er war ein guter Fang, behaupteten die alten Vetteln und die jungen Frauen. Ein guter Fang, wie ein fetter Fisch, der eine reichliche Mahlzeit ergab.
Ihre Gedanken wandten sich der ehelichen Vereinigung zu. Seit sie ein Kind war, war sie von jedem Mann auf dem Anwesen gemieden oder mit Verachtung behandelt worden, sodass es ihr nicht schwergefallen war, die Gefühle zu unterdrücken, die sich mit ihrer ersten Mondblutung eingestellt hatten. Jetzt löste der Gedanke eines wie ein Schwein über ihr grunzenden und schwitzenden Mannes überhaupt keine Empfindung in ihr aus, und darunter litt sie am meisten, denn sie wollte etwas fühlen; wollte leben.
Die altvertraute Angst stieg wieder in ihr auf und würgte sie in der Kehle. Sie kämpfte dagegen an, bis die Furcht mit einem Mal in Entschlossenheit umschlug und sie die Augen wieder öffnete.
Was auch immer sie sich einredete und was Broc auch sagen mochte, etwas in Minna widersetzte sich mit aller Kraft dem Weg, den er für sie vorgesehen hatte. Sie konnte ihn nicht gehen, wenn sie am Leben bleiben wollte, erkannte sie mit plötzlich aufwallender Leidenschaft und setzte sich ruckartig auf. Sie konnte nicht zurückgehen und sich in alles fügen, was von ihr verlangt wurde, denn dann würde sie nie wieder sie selbst sein.
»Ho!«, brüllte Lucius auf dem Erdwall über ihr. »Ich bin ein Soldat, und ich bin gekommen, um dich zu töten, Barbar!« Er zielte mit einem Haselnussschössling, der ihm als Speer diente, auf sie.
Sie rang sich ein Lächeln ab. »Bitte verschont mich, tapferer Soldat.«
»Dich verschonen? Du bist ein Wilder, ein Feind! Hüte dich, dein Ende ist nah!«
»Dein Ende ist nah!«, kreischte auch Marcus, und dann stürzten sich die beiden Jungen lachend und johlend auf Minna, und sie rangen miteinander, bis sie alle völlig außer Atem im Farnkraut lagen.
Minna schob ihre Zöpfe zurück und strich ihr Kleid glatt. »Warum muss ich immer der Feind sein?«, japste sie.
»Weil du so blass bist und so seltsam aussiehst«, erwiderte Lucius grinsend.
»Vielen Dank, Lucius.«
Marcus warf sich über ihre Beine. Seine Tunika rutschte hoch und gab sein rundes Bäuchlein frei. »Die Leute sagen, du hättest eigenartige Augen, aber ich finde, sie sehen aus wie Wasser.«
Lucius wiegte sich auf allen vieren hin und her. »Und sie sagen, dein Gesicht wäre zu schmal und deine Augen zu groß und deine Haut zu weiß zu deinem schwarzen Haar, und du würdest unnatürlich aussehen«, zählte er stolz auf.
Minnas Lächeln erstarb. Sie wusste, dass auch Broc so dachte. Ihre Aussichten, einen Mann zu finden, wären viel größer, pflegte er zu sagen, wenn sie ihr Haar nicht so streng zurückkämmen und so ihre kantigen Züge betonen und wenn sie ihre Tunika mit einem Gürtel zusammenhalten würde, um ihrem Körper weibliche Formen zu verleihen. Aber gegen ihre außergewöhnlichen, unheimlich anmutenden blassgrünen, von einem schwarzen Ring umgebenen Augen, die glühten wie die einer Katze, konnte sie nichts ausrichten, das wusste sie.
»Aber ...«, fuhr Lucius, dessen Grinsen verblasst war, hastig fort, »wir finden dich hübsch, so hübsch wie das Bild von Minerva an Mamas Wand. Und wie die Statue dieser römischen Dame in Papas Arbeitszimmer.«
Marcus schlang ihr die Arme um den Hals. »Sei nicht traurig«, lispelte er. »Wir lassen dich auch mit uns Soldaten spielen.«
Minna räusperte sich und schob Marcus von ihrem Schoß. »Aber ich kann doch gar kein Soldat sein, weil ich ein Mädchen bin.«
»Nein, du kannst kein Soldat sein, weil du Barbarenblut in dir hast«, neckte Lucius sie.
»Das Blut des Parisiervolkes, das in diesen Hügeln gelebt hat«, berichtigte sie den Jungen. Sie war stolz darauf, denn es war auch Mamos Blut – auch wenn Broc jeden einzelnen Tropfen davon hasste, weil er meinte, es würde sein reines römisches Blut besudeln, und er trachtete danach, sich in jeder Hinsicht als reiner Römer zu präsentieren. Das Blut seiner Vorfahren war für ihn das Blut der Vertriebenen, Entrechteten und Geknechteten. Er verabscheute es, in die Vergangenheit statt in die Zukunft zu blicken, und die Abende, an denen Mamo und Minna am Feuer saßen und sich die alten Geschichten erzählten, trieben ihn oft fast zum Wahnsinn.
»Ich bin nicht mit den wilden Männern hinter dem Wall in Alba verwandt«, erklärte sie den Jungen mit fester Stimme. »Und wenn ihr euren Eltern gegenüber so etwas behauptet, bleibt ihnen das Herz stehen.« Alle hier betrachteten die Völker Albas als wilde, blutrünstige Barbaren, und als Mamo protestiert und eingewandt hatte, dass die Parisier von derselben uralten Blutslinie abstammten, hatte Broc sie eine Närrin gescholten. Nun, jetzt würde er den Barbaren des Nordens ja selbst gegenübertreten müssen – nur durch eine Speerlänge von ihnen getrennt.
Lucius stöberte im Farngestrüpp herum. »Minna ist eine Barbarin«, sang er.
»Barbarin, Barbarin«, stimmte Marcus mit ein und hüpfte von einem Fuß auf den anderen.
»Und sie frisst kleine Kinder!«
»Lucius!«, wies Minna ihn entgeistert zurecht. »Wo hast du das denn gehört?«
Lucius betrachtete schuldbewusst seine Füße. »Ein Soldat in der Stadt hat das gesagt. Über die Männer hinter dem Wall.«
»Hmm ... na schön, aber lass das ja nicht deine Mutter hören.« Minna musterte Marcus, dessen Wangen sich gerötet hatten. »Komm, kletter auf meinen Rücken. Du warst lange genug in der Sonne.«
In dem Haselgehölz am Strom war es angenehm kühl. Minna rieb die Wange an ihrer Schulter und suchte in den Taschen ihres Kleides nach den Resten ihrer Mittagsmahlzeit – einem Apfel und einem Kanten Brot.
Zu Ehren Mamos und des alten Blutes würde sie beim kleinen Schrein der Göttin des Flusses ein Ernteopfer darbringen. Und außerdem hatte sie etwas von der Göttin zu erbitten.
Der Fluss bildete zwischen den Bäumen einen See mit einem Bett aus braunen Kieseln, und am Ufer dieses Sees erhob sich ein Steinhügel. Zwischen den Steinen steckte die Erntepuppe des letzten Jahres; sie war mit ausgeblichenen roten Bändern geschmückt, und zwischen den Ritzen der Steine lugten verwelkte Blumen hervor.
Die Jungen tollten umher, während Minna die welken Blumen entfernte und auf einer sonnigen Lichtung Gänseblümchen pflückte. »Mutter«, murmelte sie mit gesenktem Kopf, wie Mamo es sie gelehrt hatte. »Nimm mein Opfer an und schenke mir deinen Segen. Möge dein Auge immer wohlwollend auf uns allen ruhen.«
Bitte schenk vor allem mir deine Gunst. Nur dieses eine Mal, dann werde ich dich nie wieder um etwas bitten. Sie sah Severus’ wissend lachendes Gesicht vor sich und presste verzweifelt die Finger gegen die Augen.
Mamo sagte, an diesem Ort hätte die Göttin schon zu ihr gesprochen, aber Minna war etwas Derartiges noch nie widerfahren. Als Kind hatte sie stundenlang hier gesessen und in die Stille gelauscht, als könne die Göttin sich jeden Moment aus dem Schatten der Bäume lösen und ihr etwas ins Ohr flüstern. In Mamos Geschichten sprachen die alten Götter oft zu den Sterblichen. Minna wartete bis heute noch darauf. Stattdessen wurde sie nur von Wachträumen heimgesucht ...
Sie überfielen sie, wenn sie zu lange in das Feuer, das Wasser oder die Wolken blickte, und sie plagten sie im Schlaf, wenn sie – anders als ihre gewöhnlichen Träume – mit einer gespenstischen Macht von ihr Besitz ergriffen. Und danach vermochte sie sich niemals genau an die Einzelheiten zu erinnern.
Die Träume hinterließen in ihr nur einen Widerhall von Dunkelheit und Furcht. Und Tod – immer eine Vorahnung drohenden Todes.
An diesem Abend knisterte die Luft in dem kleinen Haus am Fluss vor Spannung. Mamo, die in ihrem Bett an der Wand saß und nähte, sah Minna und Broc mit gerunzelter Stirn an.
»Was ist geschehen?«, fragte sie.
Broc machte Anstalten, den Mund zu öffnen, doch Minna brachte ihn mit einem eisigen Blick zum Schweigen. »Nichts«, erwiderte sie kurz angebunden. »Nichts, weswegen du dir Gedanken machen müsstest, Mamo.«
Broc betrachtete Mamos eingefallenes Gesicht, die zittrigen Hände, die die beinerne Nadel durch das Wollhemd zogen, und schluckte die Worte hinunter, die ihm auf der Zunge lagen. Sie durften Mamo nicht aufregen. Nach dem Fieber, an dem sie im Sommer gelitten hatte, war sie nicht wieder zu Kräften gekommen.
Mamo hustete. Eine knorrige Hand griff nach dem Stapel von Brocs Strümpfen, die gestopft werden mussten, aber Minna sprang sofort auf und drückte die alte Frau sacht in die Kissen zurück. »Lass das jetzt, Mamo, und ruh dich aus.«
Mamo schnalzte ob dieser Fürsorge mit der Zunge, aber Minna wusste, dass sie guten Grund hatte, sich Sorgen zu machen. Ihre Großmutter hatte ihr die mandelförmigen Augen, die hohen Wangenknochen und das spitze Kinn vererbt, aber jetzt waren ihre Züge verhärmt, die Wangen hohl und die Finger so geschwollen, dass sie Knoten an einer alten Eiche glichen. Doch noch immer saß sie kerzengerade gegen ihre Kissen gelehnt in ihrem Bett, trug ihr weißes Haar zu sechs Parisierzöpfen geflochten, und ihre gebrechliche Gestalt strahlte Stolz und Würde aus.
Minna wurde das Herz schwer, als sie sich abwandte und ihr Kopf die an den Dachbalken befestigten Büschel getrockneter Blätter und Wurzeln streifte. Mamo selbst hatte sie in der Kräuterheilkunde unterwiesen, und sie bereitete seit Monaten stärkende Tränke für ihre Großmutter zu. Minna konnte sich nicht damit abfinden, dass all ihre Arzneien keine Wirkung zeigten.
Broc stürzte mit mürrischem Gesicht sein Ale hinunter. Minna kehrte ihm den Rücken zu und begann, in dem über dem Feuer brodelnden Kessel mit Linsen und Hammelfleisch zu rühren. Sollte ihr Bruder doch denken, sie würde sich klaglos in ihr Los fügen; sollte er doch ausziehen, um wie ein kleiner Junge nach Abenteuern zu suchen. Mamo würde sicher einen Weg finden, um ihr zu helfen. Sie würde sich mit Minna beraten und Pläne schmieden, wie sie es immer getan hatte.
Und was Minna selbst betraf, so hatte Mamo stets gesagt, ihr Verstand sei so scharf wie ein Dorn und arbeite so schnell wie ein reißender Strom dahinfloss. Aber sie hatte diesen Verstand in diesem Sommer verdorren lassen; war in einem Nebel aus Träumen umhergegangen. Nun, damit hatte es jetzt ein Ende. Während sie in dem sämigen Eintopf rührte, schwor sie sich, nie wieder so töricht zu sein.
Minna blinzelte, als ein Schatten die Sterne verdunkelte.
Ihr Bett stand in dem kleinen Hinterzimmer des Hauses, das auf die Hügel hinausging, und ihr wurde bewusst, dass sie mit untergeschlagenen Beinen auf der Matratze saß und die Tür weit offen stand. Sie hatte wieder einen Wachtraum gehabt.
Ohne auf den vertrauten Schmerz in ihrer Magengegend zu achten, blickte sie auf und sah Broc. »Was ... was habe ich gesagt?«
Broc lehnte am Türrahmen und starrte in die Nacht hinaus. »Woher bei Christus soll ich das wissen?«
Minnas Herz hämmerte, Schweiß stand auf ihrer Stirn. »Habe ich geschrien?«
»Ein Mal. Deswegen bin ich gekommen, um nach dir zu sehen. Dann hast du völligen Unsinn gefaselt. Ich konnte kein Wort verstehen.« Unüberhörbarer Widerwillen schwang in seiner Stimme mit. »Mamo hat dir mit all diesen alten Geschichten wirklich den Kopf verdreht. Kein Wunder, dass du Albträume hast, Minna.«
Sie schlang die Arme um die Knie. »Ich kann gegen die Visionen nichts ausrichten. Zu Mamo kommen sie auch.«
Doch ihre Großmutter war dankbar für diese Gabe – das Gesicht, wie sie es nannte –, hielt sie in Ehren, und ihre Träume waren niemals Furcht einflößend. Ergib dich ihnen, pflegte Mamo zu sagen. Es muss einen Grund dafür geben, dass die Göttin auf diese Weise zu dir spricht. Aber Minna setzte sich gegen die Träume zur Wehr, weil die Leute sie deswegen hassten und fürchteten. Und weil sie sie nicht kontrollieren konnte, so sehr sie sich auch bemühte. Sie glaubte auch nicht, dass irgendeine Göttin ihr bewusst solchen Schmerz zufügen würde, und in ihren dunkelsten Stunden fragte sie sich manchmal, ob die Christen nicht Recht hatten, wenn sie behaupteten, derlei Dinge seien heidnisch und Teufelswerk.
»Mamo hat das Gesicht nie in Gegenwart anderer gerufen«, wandte Broc ein. »Außerdem ist sie alt, und sie ist eine Kräuterkundige. Die Leute holen ihren Rat ein. Aber vor dir haben sie Angst. Severus ist der Einzige ...«
»Sprich nicht weiter.« Minna zog fröstelnd die Schultern hoch.
Broc kauerte sich vor ihr auf den Boden und hob einen Finger. »Die Heirat ist eine beschlossene Sache, Schwester. Ich muss meine Pflicht erfüllen und dich mit einer Mitgift ausstatten, auch wenn sie noch so bescheiden ausfällt, damit der Ehekontrakt vor dem Gesetz Bestand hat. Aber das muss bis zum nächsten Monat warten, wenn ich meinen ersten Sold ausbezahlt bekomme. Doch ich habe Severus deine Hand versprochen, und der Herr hat seine Zustimmung dazu erteilt. Ich werde es Mamo morgen sagen.«
Minna starrte stumm ins Dunkel.
»Einen Rat will ich dir noch geben. Versuche, von der Herrin Flavia zu lernen; fang an, dich wie eine Dame zu kleiden, dich wie eine zu benehmen und wie eine zu sprechen. Hör auf, mit hochgebundenen Röcken über die Felder zu laufen. Du bist kein Kind mehr, sondern eine erwachsene Frau. Vergiss Mamos Geschichten und versuche, deine ... Anfälle unter Kontrolle zu bringen. Dann werden dich die Leute vielleicht akzeptieren.«
Minna betrachtete ihren Bruder forschend. Sie dachte daran, wie sie als Kinder zusammen im Heidekraut gespielt hatten und er sie immer in Schutz genommen hatte, wenn andere sie verhöhnten. Aber jetzt wurde ihr klar, dass Broc nach all den Jahren immer noch keine Ahnung hatte, wie es wirklich in ihr aussah – nicht, wenn er sich ernsthaft einbildete, sie könnte jemals so werden wie Flavia.
»Lass diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen«, drängte er. »Versuch dich zu ändern, Minna. Versuch es wenigstens.«
Minnas Herz wurde mit einem Mal schwer wie ein Stein. Sie wandte sich ab und heftete den Blick auf die am Himmel glitzernden Sterne. »Ja, Bruder«, stimmte sie zu, denn jetzt wusste sie, dass er nie merken würde, wann sie log.
Zwei Tage später brach Broc zum Wall auf.
Kapitel 2
»Es sieht aus, als würde ein Sturm aufziehen, Mamo«, warnte Minna. Sie stand in der Tür und lehnte den Kopf gegen die kühle Steinwand.
Der Himmel über den stoppeligen Feldern hatte sich verdunkelt; die Luft lag wie eine feuchte Decke über den staubigen Furchen, denen der Duft umgepflügter Erde und zertretenen Getreides entstieg. Kein Windhauch ließ die Blätter oder das braune Gras rascheln, das hoch auf den Weiden stand und zum Hindurchlaufen einlud. Vor vier Wochen wäre Minna dieser Einladung vielleicht gefolgt – vor Brocs Aufbruch, dem darauf folgenden täglichen Kampf, Severus aus dem Weg zu gehen, und bevor Mamos Husten sich zu einem hartnäckigen Fieber ausgewachsen hatte.
Und von Broc war keine einzige Nachricht gekommen – als ob er sie bereits aus seinem Gedächtnis getilgt hatte, dachte Minna bitter –, bislang war die versprochene Mitgift noch nicht eingetroffen. Das zumindest erfüllte sie mit Erleichterung.
»Sind die Früchte schon eingebracht?«, erkundigte sich Mamo schwach vom Bett her.
»Fast. Morgen werden die letzten gepflückt.«
»Die Große Mutter hat uns einen guten Sommer und eine reiche Ernte geschenkt.« Mamo erlitt plötzlich einen quälenden Hustenanfall. Ihre Brust war mit Schleim zugesetzt wie der kleine Fluss draußen mit Blättern.
Minna klopfte ihr Kissen auf und griff nach dem auf einem Stuhl bereitstehenden Holzbecher. »Trink noch einen Schluck Huflattichsud, Mamo.«
»Wenn ich noch mehr davon trinke, färbe ich mich grün, und mir wachsen Wurzeln.« Mamos Rippen zeichneten sich scharf unter der Haut der eingesunkenen Brust ab, aber ihren Sinn für Humor hatte sie nicht verloren.
»Aber dafür treibst du dann hübsche Blüten.« Minna hielt den Becher an Mamos Lippen und biss sich auf ihre eigenen.
Sie hatte jeden Trank gebraut, den sie kannte, um Mamos Fieber zu senken und ihre Beschwerden zu lindern. Spät abends hatte sie sich, den rasselnden Atemzügen ihrer Großmutter lauschend, alles ins Gedächtnis gerufen, was sie über Kräuterheilkunde wusste. Im Moment erwärmte sie einen Leinsamenumschlag am Feuer, und sie hatte einen der Fuhrmänner gebeten, die einzige Halskette, die sie besaß, in Eboracum gegen aus Griechenland importierte getrocknete Asternwurzeln einzutauschen. Einige würde sie auskochen, andere in einer Schale mit heißem Wasser einweichen, damit Mamo den Dampf einatmen konnte.
Jeden Tag stürzte sie sich, nachdem sie ihren Pflichten als Betreuerin der beiden Jungen nachgekommen war, in die Hausarbeit; sie knetete Teig, buk Brot, sammelte Eier ein und hackte Feuerholz, aber so sehr sie sich auch dagegen sträubte, sie konnte die Augen nicht davor verschließen, dass Mamo immer schwächer wurde. Der Lebensfunke in ihr erlosch allmählich.
Minna tupfte etwas verschütteten Tee vom Kinn ihrer Großmutter. Obwohl sie vom Fieber geschüttelt wurde, maß die alte Frau sie mit einem eindringlichen Blick. »Kind, dir ist klar, dass ich nicht im Stande bin, das Ernteritual zu zelebrieren?«
Minna nahm den dampfenden Kessel vom Feuer. »Die Asternwurzeln werden dir helfen. Morgen Abend bist du wieder auf den Beinen.«
»Nein.« Ein paar weiße Haare hatten sich aus Mamos Zöpfen gelöst und umspielten ihr Gesicht mit der fast durchscheinenden Haut. »Ich bin zu krank.«
Minna starrte die vom Kessel aufsteigenden Dampfschwaden an. Ihre Kehle war wie zugeschnürt.
»Du bist so gewachsen«, stellte Mamo plötzlich fest.
Minna rang sich ein schiefes Lächeln ab. »Wie meinst du das?« Sie tippte mit einem Finger gegen ihre schmale Hüfte. »In die Breite müsste ich wachsen.«
Die vogelgleichen scharfen Augen flackerten nicht. »Ich meine nicht, dass du körperlich gewachsen bist.«
»Ich bin nicht du«, stellte Minna ruhig fest. »Und ich werde auch nie wie du sein.«
»Das ist auch gar nicht nötig. Du bist es, die die Welt braucht.«
Minna zwinkerte und betrachtete angelegentlich die Wand.
»Ich stehe den Gang über die Felder nicht durch.«
»Du kannst in einem Karren sitzen.« Minna ließ sich neben dem Bett auf die Knie sinken. Die Luft im Raum war stickig; die Vorboten des aufkommenden Sturmes kündigten sich an. Mamos papierdünne Haut fühlte sich feucht und klamm an. »Ich halte dich fest.« Wieder bildete sich ein Kloß in ihrer Kehle. »Dir kann nichts geschehen, ich stütze dich die ganze Zeit lang.«
Mamos geschwollene Finger krümmten sich zu Klauen. »Nein, du musst diese Aufgabe für mich übernehmen. Du kennst die rituellen Beschwörungen.«
Göttin des Lichts. Herrin der Wälder. Spenderin des Lebens. Botin des Todes. Oh ja, sie kannte die Worte nur zu gut.
Mamo presste eine Hand gegen ihre sich mühsam hebende und senkende Brust. »Wenn wir nicht zu unserer Großen Mutter sprechen, woher soll sie dann wissen, wie sehr wir sie brauchen? Woher soll sie wissen, wann sie Sonne und Regen schicken muss? Wenn wir schweigen, könnte sie uns vergessen.« Erschöpft sank sie in die Kissen zurück und hustete.
»Ruh dich jetzt aus, Mamo, und reg dich nicht auf. Ich werde tun, was du von mir verlangst.«
Als die alte Frau endlich eingeschlafen war, rieb Minna ihre Füße mit mit Senf vermischtem Bienenwachs ein, um ihr Blut zu wärmen und das Fieber zu senken, und sie streute reinigende Kräuter in das Feuer. Die Heilerin in ihr – sorgsam ausgebildet, kühl und logisch denkend – überprüfte immer wieder die Kraft von Mamos pfeifenden Atemzügen, während die Stunden verstrichen. Doch Minnas eigenes Kinn sackte immer tiefer auf ihre Brust, und ihre Augen hingen wie gebannt am ausgefransten Saum der Bettdecke.
Das Feuer brannte herunter. Sie erhob sich, um Haselzweige nachzulegen. Als sie zum Bett zurückkehrte, standen Mamos Augen offen, waren aber von jenem Schleier überzogen, der mit den Wachträumen, dem Gesicht, einhergingen. »Wer bist du?«, fragte ihre Großmutter, dabei zupfte sie unruhig an der Decke herum.
»Ich bin es, Mamo, Minna.« Sie waren beide in den Schein der Flammen getaucht; die rußgeschwärzte Feuerstelle, die Töpfe, Tiegel, Körbe und Hausgeräte an den Haken an der Wand lagen im Schatten verborgen.
Mamos Augen wanderten zu dem Flämmchen der Öllampe. »Ah, du bist ein Juwel«, verkündete sie in einem leisen Singsang. »Ein inmitten der Menschen verborgenes Juwel, lange begraben, lange vergessen. Aber nicht für immer, nicht für immer, mein Liebes.«
Minna küsste ihre Großmutter inbrünstig auf die Brauen – auf das wahre oder geistige Auge, wie Mamo die heilige Stelle in der Mitte der Stirn nannte. Als Minna ein Kind gewesen war, hatte Mamo sie oft angewiesen, die Augen zu schließen und zu versuchen, mit ihren Gedanken zu sehen. Deine Augen können sich täuschen, pflegte sie zu sagen und dabei gegen Minnas Brauen zu tippen. Dein geistiges Auge nie.
Jetzt legte sie ihre Wange gegen Mamos Stirn und holte tief Atem; nicht willens, den Kontakt zu unterbrechen. Was sah Mamo in diesem Moment? Minna wagte sie nicht zu fragen. Heute Nacht würde sie auch ihr eigenes geistiges Auge nicht öffnen, sie hatte Angst vor dem, was es ihr zeigen könnte.
Dann regte sich Mamo unter ihren Händen. »Minna, du musst den ganzen Honig nehmen.«
Minna hob den Kopf und fuhr sich mit dem Handrücken über das Gesicht. »Was sagst du, Mamo?«
Mamos flackernder Blick schweifte über die Wand, als sähe sie dort etwas, was Minna nicht sah. »Geh mit dem restlichen Honig in die Stadt und bring den verschlagenen alten Gauner Craccus dazu, ihn dir abzukaufen. Wir brauchen Stoff für eine neue Tunika für Broc – er wächst so schnell. Aber verlange mindestens fünf nummi pro Topf, Kind, kein Honig kann sich im Geschmack mit unserem messen. Sag das Craccus.«
Minna umklammerte die kalte Hand ihrer Großmutter. »Ja, Mamo. Ich bringe den Honig in die Stadt.« Blicklos starrte sie in den Schatten.
Der Große Eber! Der Große Eber! Männer kämpften in aufwirbelnden Staubwolken miteinander; die Luft war erfüllt vom Gestank nach Blut und aufgeschlitzten Eingeweiden ... Schwerter blitzten auf, sausten nieder ... Minna schrak neben Mamos Pritsche hoch, die unverständlichen Schreie drängten wieder über ihre Lippen. Die Schmerzen setzten ein ... nacktes Entsetzen bemächtigte sich ihrer, und dann war Mamo da, beruhigte sie. Dir passiert nichts, mein Kleines. Alles wird wieder gut. Ganz ruhig. Alles ist gut.
Minna sackte in sich zusammen. Mamo weckte sie immer aus ihren Albträumen auf und nahm ihr Gesicht zwischen ihre warmen Hände. Minna spürte, wie ihr Tränen über die Wangen rannen. Mamos ureigener Duft stieg ihr in die Nase, wilder Thymian aus dem Moor. Hinter ihren Lidern blitzte ein Licht auf, ein kleiner Funke, der sich zum dunklen Himmel emporschraubte ...
Das Licht ... Göttin des Lichts. Spenderin des Lebens.
Botin des Todes.
Ein zweiter Schrei entrang sich ihrer Kehle, dann war sie hellwach, rappelte sich hoch und stieß dabei die Lampe um. Eine kleine Ölpfütze ergoss sich auf den Lehmboden, die Flamme erlosch. Einen Moment lang war sie wie geblendet, ein blaues Licht brannte hinter ihren Lidern. Die Worte, die sie hervorgestoßen hatte, verblassten bereits, in ihrem Kopf überschlugen sich die Bilder, verschwanden wieder und hinterließen in ihrem Mund nur den Geschmack nach Blut.
Alles im Haus war still. Das Haus barg kein Leben mehr.
Sie begann zu schwanken, ihre Beine gaben unter ihr nach, und sie sank neben dem Bett zu Boden. Das Feuer war bis auf die Kohlen heruntergebrannt, sein sanfter Glanz lag auf Mamos Wangen und Lidern, glättete die Spuren des Alters; ließ die Schönheit, die sie in ihrer Jugend besessen hatte, erahnen. Mamo war fort. Ihr Lebenslicht war erloschen.
Einen nicht enden wollenden Moment lang schwebte Minna über einem gähnenden schwarzen Abgrund, ehe eine gnädige Benommenheit einsetzte und den Schmerz betäubte. Sie durfte nichts empfinden. Sie durfte nicht denken. Sie griff nach Mamos Hand und hielt sie fest, obwohl sie bereits kalt war.
Da ihre Seele immer noch in den Wachträumen gefangen war, spürte Minna, wie die Dachbalken flüsternd zum Leben erwachten. Die Luft flimmerte; erfüllt von der körperlosen Gegenwart der Anderen, der Geister, mit denen Mamo oft wispernd gesprochen hatte, wenn sie Teig knetete.
Sie riefen Minna etwas zu, suchten ihren Schmerz mit weichen Fingern und silbrigen Stimmen zu lindern. Aber Minna verscheuchte sie und starrte mit trockenen Augen in die Dunkelheit, während die Kohlen verglühten.
Einen Tag und eine Nacht wich sie nicht von Mamos Seite. Die Stimmen murmelten noch immer zwischen den Balken, aber sie achtete nicht darauf.
Die Nachricht von Mamos Tod verbreitete sich auf dem Gut. Flavia kam, um Minna zu überreden, den Leichnam für die Bestattung freizugeben. Als Minna keine Antwort gab, warf die Herrin die Hände in die Luft und ließ sie mit ihrer Trauer allein. Ansonsten ließ sich niemand blicken.
Warum, erfuhr sie erst, als sich Marcus und Lucius über das Verbot ihrer Mutter hinwegsetzten und sich in das stille Haus am Fluss schlichen. Marcus kroch auf ihren Schoß, während sich Lucius neben ihrem Stuhl niederkauerte und sie mit seinen dunklen Augen fixierte.
»Minna«, wagte Marcus endlich einen Vorstoß. »Warum sagen alle diese schlimmen Dinge über dich? Das macht mir Angst.«
Minna erwiderte nichts darauf, sondern sah stattdessen Lucius an. »Sie sagen, du bist eine Todesfee, eine Teufelin«, flüsterte der Junge. »Sie sagen, du hättest deine Mamo auf dem Gewissen; die Tränke, die du ihr eingeflößt hast, hätten zu ihrem Tod geführt.« Seine Stimme brach. »Sie sagen, du ... du hättest deine Mamo umgebracht.«
Minna drehte sich um und betrachtete das reglose Gesicht ihrer Großmutter, dabei strichen ihre Finger über Marcus’ feines Haar.
Als die Abenddämmerung ein zweites Mal hereinbrach, stand Minna auf dem Friedhof neben einer frisch ausgehobenen Grube. Eichenlaub tanzte im kalten Wind um sie herum. Einsamkeit hüllte sie ein, wie das Leichentuch Mamos zerbrechlichen Körper einhüllte.
Alle starrten sie misstrauisch und feindselig an, während der Priester hastig ein paar Worte murmelte. Aber Minna sah nur einen einzigen Mann, zu dem die Anderen respektvollen Abstand hielten und dessen Augen sich wie glühende Kohlen in ihre Haut zu brennen schienen. Neben ihm stand Publius Aurelius, sein Gesicht wirkte noch strenger und unnahbarer als sonst. Sie konnte bitten und betteln, ohne dass seine Züge auch nur eine Spur weicher geworden wären. Und ihr einziger Schutzschild – Mamo – war fort.
Die Menge glich einer Anordnung von Statuen im Forum: Minna am Ende, Severus mit der Herrin in der Mitte, und am anderen Ende eine Schar hartgesichtiger Menschen, die ihr bis zum letzten Tag ihres Lebens nichts als Argwohn und Verachtung entgegenbringen würden. Und sie sah dieses Leben deutlich vor sich, einen endlosen schnurgeraden Weg, und mit jedem Schritt auf diesem Weg würde sie allmählich schrumpfen und vergehen, bis nichts mehr von ihr übrig war.
Durch ständige Herabsetzung verdorrt. Durch Abneigung und Hass ausgeblutet. Eine trockene Hülle, die schließlich unter dem Gewicht von Severus’ Körper auf dem ihren zu Staub zermahlen werden würde.
Kapitel 3
Minna beobachtete im Licht der flackernden Lampe ihre Hände, die sich gegen ihren Willen bewegten, als wären sie gar kein Teil ihres Körpers.
Auf dem Tisch aus Eichenholz lag ein Lederbündel, sie hatte keine Ahnung, wer es unter dem Bett hervorgezogen hatte. Daneben sah sie ein Stück Käse, Brot und kaltes Huhn. Ein zweites Paar Stiefel. Ihre geröteten, wund gescheuerten Finger falteten eine wollene Hose zusammen, dann griffen sie nach ihrem Umhang.
In einer Ecke des Raumes erklang eine leise, fast unhörbare Klage. Sie zeugte von tiefem Kummer, ließ die Luft knistern und die Flamme der Lampe erzittern. Minna rann ein Schauer über den Rücken. »Ich höre euch nicht zu«, flüsterte sie.
Plötzlich hielt sie ein Fleischmesser in der Hand, verstaute es in dem Bündel. Steifbeinig stakste sie zur Feuerstelle, hob einen lockeren Stein hoch, legte ein kleines Loch im Boden frei und entnahm ihm einen Beutel mit Münzen. Mamos Münzen. Ihr Herz machte einen kleinen Satz in ihrer Brust, schien zu zappeln wie ein Fisch an einer Angel.
Der Honig. Sie durfte den Honig nicht vergessen. Fünf Töpfe – einer, zwei, drei, vier, fünf – wurden sicher in dem Bündel verpackt, damit sie nicht zerbrechen konnten. Dann schob sie ihre nahezu gefühllosen Arme durch die Riemen und lud sich das Bündel auf den Rücken. An der Tür blieb sie noch einmal stehen.
Ihr Schmerz flatterte durch den Raum wie eine verirrte Motte, prallte gegen die Dachbalken, schwirrte um die Öllampe herum. Mamo am Feuer. Mamo, die Gerstenkuchen buk. Mamos kühle Hand, die über den Rücken der um den Tisch herumlaufenden Minna strich.
Minna wandte sich ab. Draußen hing der Mond wie eine schiefe Sichel am Himmel; ein fahler Nebel waberte über den Fluss. Die Kälte bohrte sich wie tausende eisiger Nadeln in ihre Haut. Der Duft ihrer Heimat, der Heufelder und der sumpfigen Uferbänke hüllte sie ein. Sie verschloss ihre Nase und ihren Geist davor.
Aber ein unaufhörlich an ihr nagendes Gefühl vermochte sie nicht zu unterdrücken. Obwohl sie befürchten musste, entdeckt zu werden, schlich sie sich in das Schulzimmer, einen kleinen Schuppen im Hof der Villa. In dem muffigen Raum tastete sie nach einer Wachstafel und trat damit an die vom Mondlicht erleuchtete Türschwelle. Ich muss fortgehen, kratzte sie in lateinischen Buchstaben eine Nachricht für ihre Schützlinge in das weiche Wachs. Aber nicht euretwegen. Passt gut aufeinander auf. Eure Barbarin.
Dann huschte sie in die Dunkelheit hinaus, hielt sich am Rand der Felder, bis sie außer Sicht der Häuser war, und trat dann auf die Straße, die sich wie ein silbriges Band über die Hügel wand. Ihr Atem bildete kleine Wölkchen vor ihrem Mund. Am Tor des Landgutes blieb sie stehen und starrte auf die tiefen Furchen, die die Räder der Ochsenkarren in den Lehm gegraben hatten.
Was tat sie hier? Warum war sie hier?
Ach ja, der Honig. Sie musste den Honig in Eboracum verkaufen, wie Mamo es ihr aufgetragen hatte.
Bei Tageslicht wurde Minna von einem Bauern mitgenommen, der mit einem Karren voller an den Füßen zusammengebundener Hühner auf dem Weg in die Stadt war. Als der Karren über den unebenen Pfad rumpelte, der von der Küste nach Eboracum führte, und endlich den letzten Hügel überwunden hatte, sprang sie unbemerkt ab und blieb auf der Straße stehen, ihr Bündel fest an ihre Brust gedrückt.
Eboracum erstreckte sich vor ihr; die fast nördlichste Stadt der römischen Provinz Britannien; Hauptsitz des Fullofaudes, des großen Dux Britanniarum, des Kommandanten der auf dem Wall stationierten Truppen. Der Titel war so eindrucksvoll wie die weißen Gebäude, die hoch in den Himmel ragenden Säulen und die Segelschiffe auf dem Fluss. Dux Fullofaudes. Eboracum. Britannia. Sie wiederholte die Worte stumm, obwohl sie bedeutungslos in der leeren, dunklen Gruft ihres Geistes verhallten.
Dann drehte der Wind plötzlich, und der Gestank der Stadt schlug ihr entgegen, traf sie wie ein Schlag. Der beißende Salzgeruch des Kais kämpfte gegen den Duft frisch gebackenen Brotes und gerösteten Fleisches an, der Gestank der Kloaken und Gerbergruben gegen die Wolke wohlriechender Gewürze, die vom Meer herüberwehte und selbst hier noch zu spüren war. Urin und Torfrauch, Maultiermist und frisch geschlagenes Holz; eine Mischung, die an geschäftiges Handelstreiben, an die Häfen von Gallien, Ägypten und Rom denken ließ. Sie drohte, sie aus ihrer lähmenden Benommenheit zu reißen, sie in die Welt von Kaufleuten und Ladenbesitzern zurückzubringen. Eine Welt von Dieben, Halsabschneidern und Huren. Eine von Kummer und Leid beherrschte Welt.
Aber sie wusste nicht, wo sie sonst hingehen könnte.
Minna stolperte die Straßen entlang, auf die Stadtmauern zu, und wurde von der Menschenmenge aufgesogen, die durch die mächtigen Holztore strömte. In den schmalen Gassen der Stadt herrschte ein unvorstellbares Chaos.
An der Nordseite des Abus stand die steinerne Festung der Soldaten, von deren Mauern Trompetenfanfaren erschollen. Auf der südlichen Seite lag die eigentliche Stadt. Hier riefen Händler ihre Waren aus, Kinder kreischten, Zimmerleute hämmerten auf Holz ein, bis Minnas Ohren dröhnten. Die weiß getünchten prächtigen Häuser der Reichen warfen ihre Schatten über die gepflasterten Straßen und blendeten die blasse Herbstsonne aus. Läden mit weit geöffneten Türen säumten die Gassen; an zahlreichen Ständen wurden Früchte, Brot, Fleisch, bereits gerupfte Hühner, Bronzegefäße, Weihrauch und Tonschalen feilgeboten. Eine bunte Käuferschar drängte sich darum und feilschte in allen möglichen exotischen Sprachen mit den Händlern.
Minna wanderte ziellos umher, wurde von der Menge hierhin und dorthin gespült. Sie stieß gegen die hölzerne Bude eines Fleischers, von der ein Schafskopf sie mit glasigen Augen anglotzte. »Heda, Mädchen!«, herrschte der Fleischer sie an. »Wenn du den herunterwirfst, musst du ihn bezahlen.«
Minna floh vor seinem finsteren Blick auf die Straße zurück. »Aus dem Weg!«, zischte ein Sklave, der einen Karren zog, in dem eine parfümierte Dame saß und sich einen Schleier vor das Gesicht hielt. Minna fuhr herum, als sich ein Mann mit einem Tablett voller Brotlaibe an ihr vorbeidrängte, und presste sich nach Atem ringend mit dem Rücken gegen die Wand eines nahegelegenen Ladens. Ein paar Soldaten schlenderten vorbei; ihre harten Augen unter den Helmen glitten abschätzend über ihren Körper. Minna flüchtete sich in eine Gasse, wo sie beinahe vom Inhalt eines Nachttopfes getroffen worden wäre, den jemand aus einem Fenster kippte.
Lange stand sie wie betäubt vor Craccus’ Laden, ehe ihr bewusst wurde, wo sie war. Die Gasse war jetzt in Schatten getaucht. Ihr Kopf schmerzte vom Lärm und der Sonne. Craccus, ein korpulenter, fröhlicher Mann, öffnete die Tür. »Ah, das kleine Mädchen aus der Villa. Komm nur herein. Bringst du wieder Honig von deiner Großmutter?« Wie aus weiter Ferne sah sie sich die Töpfe nacheinander aus dem Bündel nehmen und auf die Ladentheke stellen. Die schale Luft roch nach Pfeffer, wildem Knoblauch, possum, Koriander und Fischsauce. Ohne dass sie etwas sagen musste, gab ihr Craccus sechs nummi pro Topf.
Siehst du, Mamo, dachte sie, als sie wieder in die jetzt dämmrige Gasse hinaustrat, ich habe sogar mehr als fünf nummi bekommen. Die dreißig Münzen waren so kalt, dass sie in ihrer Hand brannten.
Es war schon spät, und ihr Magen knurrte, also erstand sie für drei nummi eine mit Kräutern gewürzte Hammelfleischpastete, die hinter einer Fleischerbude auf einem Rost brutzelte. Dann wurde sie erneut von der Menschenmenge mitgerissen, bis sie sich auf dem Marktplatz wiederfand.
Dort hatte eine Schar Schaulustiger einen Kreis gebildet; sie johlten, klatschten in die Hände und überschütteten die Schausteller in ihrer Mitte mit Bronzestücken. Minna drängte sich am Rand der Menge entlang, bis sie auf einen freien Platz auf den noch sonnenwarmen Stufen des Marktes stieß. Sie setzte sich, biss geistesabwesend ein Stück von der Pastete ab und schob es in ihren ausgetrockneten Mund.
Zwischen den Beinen der Zuschauer hindurch erhaschte sie einen Blick auf herumhüpfende braune Körper: Akrobaten. Die jungen Männer trugen außer ledernen Lendentüchern nichts am Leib und hatten sich mit Öl eingerieben, sodass ihre Haut glänzte. Sich gegenseitig anfeuernd schlugen sie Räder, sprangen einander auf die Schultern und vollführten noch andere waghalsige Kunststücke. Ihre Haare waren schweißverklebt.
Minna wischte sich die Hände ab und stieg die Stufen empor, um besser sehen zu können. Sie müssen wirklich gut sein, dachte sie. Für derartige Unterhaltung waren Städte da, deswegen mussten sie hierhergekommen sein. Weswegen war sie doch gleich noch hier?
Die Akrobaten jonglierten jetzt, warfen Früchte in die Luft, schlugen Salti und fingen sie wieder auf. Die Menge jubelte ihnen begeistert zu.
Ein schwarzhaariger junger Mann tänzelte auf Minna zu und begann direkt vor ihr zu jonglieren. Sie erstarrte, als sie spürte, wie sich die Blicke der Zuschauer auf sie hefteten, und sah zu dem grinsenden Jungen mit der sonnengebräunten Haut und den strahlend blauen Augen auf. Seine Kameraden arbeiteten mit Äpfeln, aber er hielt ein paar Feigen in der Hand – schwieriger zu jonglieren und überdies sehr teuer. Ihr ging etwas durch den Kopf, was sie oft zu Lucius gesagt hatte, um ihn zu necken. Aufschneider. Ein hysterisches Kichern stieg in ihrer Kehle auf; ein Schmerz, der sich in einem Tränenstrom Luft zu machen drohte.
Der Akrobat lächelte breit, wobei er weiße, blitzende Zähne entblößte, und schleuderte die Feigen in die Luft. Seine schwarzen Locken flogen, als er einen Salto rückwärts schlug und die Früchte geschickt wieder auffing. Die Zuschauer lachten.
Aber Minna wurde plötzlich von der Sonne geblendet, und das Gelächter der Menge verwandelte sich in einen Mückenschwarm, der um ihren Kopf schwirrte. Sie musste machen, dass sie hier fortkam. Sie sprang auf, doch in diesem Moment schoss der junge Mann auf sie zu und schickte mit einer raschen Drehung des Handgelenks augenzwinkernd eine Feige genau in ihre Richtung.
Minna konnte keinen klaren Gedanken fassen, geschweige denn reagieren. Instinktiv duckte sie sich, um die Feige aufzufangen, aber sie entglitt ihren Fingern. Sie bückte sich danach, weil es ihr missfiel, so teure Früchte auf den schmutzigen Steinen liegen zu sehen. Mamo hat gern Feigen gegessen. Ist nicht in irgendeiner Geschichte jemand von Feigen wieder gesund geworden? Vielleicht geht es Mamo bald besser.
Wieder brandete schallendes Gelächter auf und riss Minna in die Wirklichkeit zurück. Langsam richtete sie sich auf.
»Euch fehlt etwas Übung, junge Frau.« Der Akrobat hatte die Hände in die schmalen Hüften gestemmt, seine blauen Augen glitzerten, seine Lippen hatten sich zu einem spöttischen Grinsen verzogen, das sie traf wie ein glühender Pfeil. Sie hieß den in ihr aufflammenden Zorn freudig willkommen. Zorn ... ja, wenn sie zornig war, war sie sicher.
»Na kommt schon.« Der junge Akrobat streckte eine Hand aus. »Werft mir meine Feige zu ... oder bringt sie mir, dann erteile ich Euch allen Unterricht, den Ihr braucht.« Die Männer in der Zuschauermenge kicherten lüstern.
Minna zögerte nur einen Augenblick, dann ließ sie die Feige zu Boden fallen und trat darauf. Dunkelroter Saft und Kerne ergossen sich über die schmutzigen Steine.
Das Grinsen des jungen Mannes verblasste, das Gejohle der Menge wurde noch lauter, und Minna wandte sich ab.
Die Dämmerung brach herein, und mit ihr kam ein schneidender Wind auf. Die Menge zerstreute sich, die Händler packten ihre Waren zusammen, Fensterläden wurden geschlossen, Lampen im Inneren der Häuser entzündet. Die letzten Nachzügler eilten mit gesenkten Köpfen an Minna vorbei, der Wind wehte Unrat und herabgefallene Blätter um ihre Füße. Soldaten marschierten in genagelten Stiefeln durch die Straßen und spähten wachsam in alle Richtungen.
Als sich die Gassen allmählich leerten, begann Minnas Herz schneller zu schlagen. Aber erst als auf den Mauern die Hörner erschollen, wurde ihr klar, dass sie die Ausgangssperre vergessen hatte. Die Soldaten riefen immer wieder: »Die Tore werden gleich geschlossen! Beendet eure Geschäfte in der Stadt! Die Tore werden geschlossen!«
Sie durfte nicht in der Stadt bleiben. Dieser eine alles beherrschende Gedanke durchdrang ihren vor Kummer benebelten Verstand. Hier war sie nicht sicher. Sie hob ihr Gesicht der untergehenden Sonne entgegen. Draußen am Fluss vor den Toren konnte sie die Nacht verbringen, dort gab es Erlen- und Haselhaine, und Büsche säumten die Ufer.
Ihre Füße machten sich wie von selbst auf den Weg dorthin.
Nach dem hektischen Treiben in der Stadt erschien ihr das Wäldchen am Flussufer still und kühl. Unter einem lavendelfarbenen Himmel überzogen die letzten Sonnenstrahlen das welke Gras mit einem goldenen Schimmer. Noch andere Menschen hatten gemeinsam mit Minna das Tor passiert und begaben sich nun auf den Heimweg. Einer nach dem anderen verschwand, bis sie alleine war.
Sie blieb stehen, um sich Schweiß von den Wangen zu wischen. Unwillkürlich musste sie an den Fluss denken, der sich klar und sprudelnd von den östlichen Hügeln oberhalb der Stadt ins Tal ergoss. Ihre Hügel, ihr Fluss. Ehe sie es sich versah, trugen ihre Füße sie zum Ufer hinunter, bis sie endlich am Wasserrand zu Boden sank. Ihre Brust hob und senkte sich heftig, als sie ihr Bündel ablegte und die Hände in das Wasser tauchte.
Minna spritzte sich das eiskalte Wasser ins Gesicht und schüttete eine Hand voll über ihren Kopf, sodass es an ihrem Nacken herabrann, dann trank sie ein paar große Schlucke, um den Druck in ihrer Brust zu lindern. Danach saß sie tropfend und am ganzen Leib zitternd am Ufer und blickte über das dunkle Wasser hinweg.
»Hast du vor, dich zu ertränken?«, fragte auf einmal eine gedehnte Stimme.
Kapitel 4
Minna gefror das Blut in den Adern.
»Aber so geht das nicht, Süße. Spring einfach hinein. Mit deinen Sachen und allem.«
Langsam drehte sie sich um. Der Sprecher lag im Gras; eine lange, schlanke Gestalt in einer ausgeblichenen roten Tunika. Ein leiser Abglanz ihres früheren Zornes wallte in ihr auf. »Wovon redest du eigentlich?«
»Vom Ertränken. Das sollte man mit etwas Stil tun. Zum Beispiel von einer Brücke springen.« Der junge Mann stützte sich auf einen Ellbogen, und jetzt konnte sie sehen, dass er groß und schlank war und einen schwarzen Lockenkopf hatte. Wasser rann über ihre Wangen, während sie ihn anstarrte.
Er blinzelte, legte den Kopf schief und richtete sich dann mit einem Mal auf. »Na, wenn das nicht die kleine Tigerin ist! Kein Wunder, dass du mich anknurrst.«
Minna rappelte sich auf. Ein kleiner Funke glomm in ihr auf und bewirkte, dass sie sich wieder lebendig fühlte. »Du!«
Der junge Akrobat grinste. »Genau. Ich.«
»Du hast mich vorhin zum Narren gemacht!«
Der junge Mann sprang anmutig auf und verneigte sich theatralisch. »Ich bin ein Akrobat, ein Schauspieler, ein Unterhalter. So etwas gehört zu meinem Beruf.« Ihr fiel auf, dass sein Lächeln seine ebenso eindringlich wie wachsam auf ihr ruhenden Augen nicht erreichte. »Und du hast meine Feige zertreten.«
»Das war das Mindeste, was ich tun konnte, nachdem du mich zum Gespött der Leute gemacht hast.«
»Du bist aber wirklich eine entsetzlich schlechte Fängerin.« Er neigte den Kopf zur anderen Seite und blickte zum Wasser. »Und vermutlich eine genauso schlechte Schwimmerin.«
Minna zupfte an ihrer Tunika herum, weil ihr plötzlich bewusst wurde, dass sie an ihrer Haut klebte. Ihr Gesicht brannte vor Verlegenheit, und der Nebel, der sie umgab, lichtete sich ein wenig. »Ich hatte nicht die Absicht, mich zu ertränken.«
»Genau diesen Eindruck hast du aber sehr glaubhaft erweckt.«
Sie schlich langsam auf die sich gelblich verfärbenden Erlen zu, dabei überschlugen sich die Gedanken in ihrem Kopf. »Danke für dein Hilfsangebot«, erwiderte sie kühl. »Aber ich habe keinen Bedarf dafür.«
»Ach, wirklich nicht?« Die blauen Augen wanderten über ihre staubige Männerkleidung und das Bündel mit dem Winterumhang und dem Bettzeug. »Du weißt doch sicherlich, dass sich anständige Mädchen nicht an diesem Teil des Flusses herumtreiben sollten, wenn sich die Schaustellertruppe in der Stadt aufhält.« Er deutete mit einer Hand über seine Schulter. »Dort drüben liegt unser Lager. Aber das ist kein Ort für hübsche Mädchen. Es sei denn ...« Er hob viel sagend eine Braue. »Es sei denn, du bist doch ein Junge, ein Straßenbengel, der sich vor den Wachposten verbirgt – oder ein entlaufener Sklave.«
»Darauf zu antworten wäre unter meiner Würde.« Minna machte auf dem Absatz kehrt.
Ein scharfer Pfiff gellte in ihrem Ohr, und der junge Mann war mit einem Satz an ihrer Seite. »Bei Jupiter und Mars! Die Tigerin zeigt schon wieder ihre Krallen.«
Minna blieb stehen. »Warum nennst du mich so?«, wollte sie wissen. »Willst du mich beleidigen?«
Der Junge wirkte erst verwirrt, dann belustigt. Er hob die Hände und spreizte die Finger. »Ein Tiger«, erklärte er übertrieben geduldig, »ist ein Tier, mit dem die Gladiatoren in Rom kämpfen. Eine große, wilde Katze mit Streifen.«
»Und wieso vergleichst du mich mit dieser Kreatur?«
»Nun ja.« Der junge Mann trat um eine Birke herum und lehnte sich mit dem Ellbogen gegen den Stamm. »Sie hat scharfe Zähne, Klauen und glühende Augen – so wie deine geglüht haben, als ich dir die Feige zuwarf.«
Sie drehte sich um, als er sie umkreiste. »Woher weißt du von so einem Tier? Das hast du dir doch ausgedacht.«
»Das stimmt nicht.«
»Willst du mir weismachen, du wärst in Rom gewesen?«
»Ein Mal. Und da habe ich einen weißen Tiger in der Arena gesehen, mit silbernen Streifen und hellen, eisigen Augen statt gelben. Augen wie deine.«
Sie wurde von einer so belebenden Welle der Wut erfasst, dass sie kaum noch einen klaren Gedanken fassen konnte. »Ich glaube nicht, dass so ein Geschöpf wirklich existiert. Du bist nichts als ein unverschämter Bursche ohne ... ohne Hirn und Manieren!«
Der Ausbruch amüsierte den Akrobaten, und als Minna weiter durch das Flussgras stapfte, blieb er beharrlich an ihrer Seite. »Möchtest du denn nicht meinen Namen wissen?«
Minna schüttelte heftig den Kopf.
»Ich heiße Cian.«
Er vertrat ihr den Weg, sodass sie ihn zum ersten Mal richtig anschauen musste. Sein Haar war so schwarz und seine Haut so dunkel, dass man ihn auf den ersten Blick für einen Ägypter oder Griechen hätte halten können. Aber seine Augen waren blau und seine Züge nicht so scharf geschnitten wie die der Männer des Ostens. Er hatte ein schmales Kinn, leicht schräg stehende Wangenknochen und einen zynischen Mund. Trotz seiner Größe war er so schlank wie ein Junge, und er strahlte etwas seltsam Unkörperliches aus; so, als sei er kaum mit der Erde verbunden. Im Gegensatz zu seinem exotischen Äußeren trug er das Haar so kurz geschnitten wie ein Römer.
»Woher kommst du?«, fragte sie mürrisch, aber gegen ihren Willen war ihr Interesse geweckt.
Cian verbeugte sich erneut. »Von überallher«, verkündete er großspurig. »Unsere Truppe zieht den größten Teil des Jahres über Land und bereist alle Städte. In Eboracum sind wir zu lange geblieben, aber die Leute haben uns mit Münzen überschüttet, da fiel es schwer, die Stadt zu verlassen.« Er schnaubte verächtlich. »Die Bauerntölpel müssen eine gute Ernte gehabt haben.«
Minnas Lippen verzogen sich leicht. »Die Ernte war in der Tat sehr gut.«