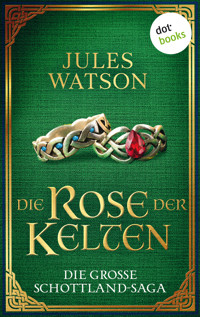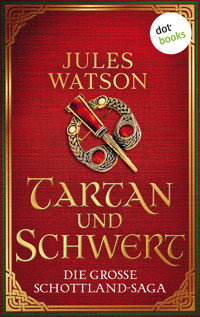
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Dalriada-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Sie sind die letzte Hoffnung Schottlands: Die opulente historische Saga »Tartan und Schwert« von Jules Watson jetzt als eBook bei dotbooks. Schottland im Jahr 79 nach Christus: Immer wieder fallen die Römer aus England heraus in den Norden ein, um auch den letzten Widerstand auf der Insel zu brechen. Einzig die Heirat zwischen der schottischen Prinzessin Rhiann und dem irischen Krieger Eremon könnte die zerstrittenen keltischen Stämme für den Kampf gegen die Römer einen. Doch eine Ehe aus Pflichtgefühl, die niemals vollzogen wurde, reicht nicht aus, um die Stammesführer von ihrem Bund zu überzeugen – sie fordern einen Erben. Nur wenn es Eremon gelingt, Rhianns Vertrauen zu gewinnen und ihr Herz zu erobern, wird es eine Zukunft für ihr Land geben. Aber kann er es schaffen, die Mauern, die Rhiann um ihr Herz aufgebaut hat, niederzureißen? Ein opulentes historisches Epos der Keltenzeit und eine mitreißende Liebesgeschichte! »Geschickt verwebt Watson in ihrem großartigen historischen Romandebüt historische Fakten und die damalige Sagenwelt, Abenteuer und Romantik.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der faszinierende Kelten-Roman »Tartan und Schwert« von Jules Watson ist der erste Teil ihrer Dalriada-Trilogie – ein Lesegenuss für die Fans von Marion Zimmer Bradley und »Outlander«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1039
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Schottland im Jahr 79 nach Christus: Immer wieder fallen die Römer aus England heraus in den Norden ein, um auch den letzten Widerstand auf der Insel zu brechen. Einzig die Heirat zwischen der schottischen Prinzessin Rhiann und dem irischen Krieger Eremon könnte die zerstrittenen keltischen Stämme für den Kampf gegen die Römer einen. Doch eine Ehe aus Pflichtgefühl, die niemals vollzogen wurde, reicht nicht aus, um die Stammesführer von ihrem Bund zu überzeugen – sie fordern einen Erben. Nur wenn es Eremon gelingt, Rhianns Vertrauen zu gewinnen und ihr Herz zu erobern, wird es eine Zukunft für ihr Land geben. Aber kann er es schaffen, die Mauern, die Rhiann um ihr Herz aufgebaut hat, niederzureißen?
Ein opulentes historisches Epos der Keltenzeit und eine mitreißende Liebesgeschichte!
»Geschickt verwebt Watson in ihrem großartigen historischen Romandebüt historische Fakten und die damalige Sagenwelt, Abenteuer und Romantik.« Publishers Weekly
Über die Autorin:
Jules Watson wurde 1970 als Tochter englischer Auswanderer in Perth geboren. Sie wuchs in Australien auf und lernte ihren späteren Ehemann Alistair, einen Schotten, bereits an der Highschool kennen. Nach ihrem Studium der Archäologie und PR arbeitete sie unter anderem in diesen Berufen, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Sie lebte viele Jahre lang abwechselnd in Australien und der UK, bis sie schließlich mit ihrem Mann in ein kleines schottisches Glen an der Westküste zog.
Jules Watson veröffentlichte bei dotbooks bereits »Tartan und Schwert«, »Das keltische Amulett« und »Die Rose der Kelten«.
Die Website der Autorin: juleswatson.com
***
eBook-Neuausgabe Juni 2022
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »The White Mare« bei Orion, an imprint of Orion Publishing Group Ltd, London.
Copyright © der englischen Originalausgabe by Jules Watson 2004
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2004 by Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/ O.S. und sellingantiques
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-087-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Tartan und Schwert« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Jules Watson
Tartan und Schwert
Historischer Roman – Die große Schottland-Saga
Aus dem Englischen von Nina Bader
dotbooks.
Prolog
Linnet
Sie war das Kind meines Herzens, wenn auch nicht meines Körpers.
Ich erinnere mich, wie sie einst mit wehendem, bernsteinfarbenem Haar den Bergpfad empor auf mich zugerannt kam, das Gesicht vom Schluchzen verzerrt. Damals machte ich mir Sorgen um sie, ich fragte mich, wie die eifersüchtigen Hänseleien der anderen Kinder zu so einem Tränenausbruch hatten führen können. Ich fürchtete, sie könne schwach sein, zu schwach, um das zu überleben, was ihr bevorstand, denn es war sowohl meine Gabe als mein Fluch, einen Teil ihrer Zukunft vorhersehen zu können.
Blut, das über nassen Sand spritzt.
Ein grünäugiger Mann im Bug eines Schiffes.
Die See, die über ihrem Kopf zusammenschlägt.
Und endlich die Schreie von Frauen,
die zwischen den Toten auf einem
Schlachtfeld umherirren.
Ich wusste, dass sie einer großen Bestimmung folgen musste, nicht aber, was das Schicksal genau für sie bereithalten würde. Wir Priesterinnen brüsten uns immer mit unserer Sehergabe, aber die Wahrheit ist, dass sich die Zukunft uns nur selten und nie ganz klar darbietet.
Ich behielt das Mädchen von dem Tag an im Auge, da meine ältere Schwester ihr das Leben schenkte und selbst bei der Geburt starb. Ich erinnere mich, wie ihr Händchen einen meiner Finger umschloss, ihre milchigen Augen schon mein Gesicht suchten, als der rotgoldene Haarschopf noch feucht vom Mutterschoß war ... ah, dies sind die träumerischen Grübeleien einer Mutter.
Doch schon an diesem Tag erkannte ich, dass sie eine der Vielgeborenen war, jener Menschen, die immer wieder auf diese Welt zurückkommen, um ein neues Leben zu leben. Und dass ihr aus diesem Grund große Gaben beschieden waren, sie aber auch großes Leid würde ertragen müssen.
Helfen konnte ich ihr nicht. Sie musste aus eigener Kraft innere Stärke entwickeln. Und das tat sie. Wie ein wilder Lachs kämpfte sie gegen die Ströme aus Missgunst, Eifersucht und Ehrfurcht an, die ihr entgegenschlugen. Als sie heranwuchs, fand auch ihr Gesicht zu seiner endgültigen Form; verlor die Weichheit, die mich einst so beunruhigt hatte.
Ich bemerkte auch, dass sie nie mehr weinte – und in meinem Priesterinnenherz empfand ich darüber eine große Erleichterung.
Aber mein Mutterherz weinte um sie.
Ich durfte mit ihr nicht über ihre Zukunft sprechen – das Blut, den Mann im Boot, die Schlacht. Es war nicht meine Aufgabe, ihren Lebensweg vorherzubestimmen, sondern ich musste ihren Mut und Verstand schulen, sodass sie diesen Weg selber finden konnte.
Während jener Zeit, da wir nur Garnfäden im Webstuhl der Großen Mutter sind, haben wir noch eine Wahl. Ich liebte sie mehr als mein eigenes Leben, daher wollte ich sie selbst wählen lassen, welchen Weg sie einschlug. Vielleicht hätte ich anders gehandelt, wenn ich geahnt hätte, welche Qualen sie auf diesem Weg würde erleiden müssen.
Nur an einem hielt ich mich unbeirrt fest: an dem Wissen, dass sie irgendwie das Bindeglied zu unserer Freiheit sein würde, obwohl ich in der Zukunft gesehen hatte, dass den Völkern von Alba viele schwere Jahre bevorstanden.
Viele Dinge können den Lauf der Geschichte verändern.
Ein Wort.
Die Klinge eines Schwertes.
Ein Mädchen, das mit wehendem, bernsteinfarbenem Haar einen Bergpfad emporläuft.
Kapitel 1
Zeit des Blätterfalls, anno domini 79
Das Baby glitt in einem Schwall von Blut in Rhianns Hände.
Die Mutter stieß einen letzten Schrei des Triumphs und der Qual aus und glitt an dem Dachpfosten, an dem sie sich abgestützt hatte, auf den Boden hinunter. Rhiann, die vor ihr kniete, bemühte sich, den glitschigen kleinen Körper sicher zu halten. Der Schein des Feuers im Kamin fiel auf die wächserne, blutverschmierte Haut des Neugeborenen, und unter den Büscheln dunklen Haares spürte sie die zarten Knochen des Schädels unter ihren Fingern.
»In die Arme deiner Mutter bist du gesunken. Die Familie heißt dich willkommen, der Stamm heißt dich willkommen, die Welt heißt dich willkommen. Mögest du stets in Sicherheit leben.« Atemlos murmelte Rhiann die rituellen Worte; die Ferse der Mutter bohrte sich schmerzhaft in ihre Rippen.
Das Kind noch immer in den Armen haltend, nickte sie der alten Tante zu, die die Mutter zu einer Lagerstatt aus Farn neben dem Feuer führte. Dankbar richtete sich Rhiann auf und schob mit der Schulter ihr Haar zurück.
Die Mutter stützte sich keuchend auf die Ellbogen. »Was ist es?«
»Ein Junge.«
»Der Göttin sei Dank.« Sie ließ sich wieder zurücksinken.
Als die Nabelschnur nicht mehr pulsierte, legte Rhiann das Baby behutsam auf das Lager und nahm ihr Priesterinnenmesser aus dem Beutel an ihrem Gürtel. »Große Mutter, lass dieses Kind sich von dir nähren, wie es sich von diesem Leib genährt hat. Lass sein Blut dein Blut sein. Lass seinen Atem dein Atem sein. So möge es geschehen!« Sie durchtrennte die Nabelschnur und band sie geschickt mit Flachs ab, dann hüllte sie das Baby in ein Leinentuch und drehte sein Gesicht zum Feuer hin.
»Was seht Ihr, Herrin?«
Alle Mütter stellten Priesterinnen diese Frage. Und was sollten sie darauf antworten? Dieser Junge gehört nicht der Kriegerklasse an, also wird er wenigstens nicht durch das Schwert sterben.
»Was wird einmal aus ihm werden?«, quäkte die alte Tante.
Rhiann wandte sich lächelnd zu ihr um. »Ich sehe ihn viele Jahre lang zusammen mit seinem Pa Netze voller fetter Fische einholen.« Sie bettete das Kind auf die Brust seiner Mutter und strich zärtlich über das flaumige Köpfchen.
»Bald werdet Ihr selber eines haben«, krächzte die Tante, als sie ihr einen alten Lumpen reichte. »Man wird bei der Wahl des Freiers nicht wählerisch sein, heißt es. Nicht jetzt, wo der König so krank ist.«
»Still!«, zischte die Frau auf dem Farnlager zornig.
Rhiann rang sich ein Lächeln ab und säuberte ihre Hände. »Trink zweimal täglich einen Sud von aufgebrühtem Waldmeister«, mahnte sie die junge Mutter. »Das wird den Milchfluss anregen.«
»Danke, Herrin.«
»Ich muss gehen. Alle guten Wünsche für dich und das Baby.«
Die Frau drückte ihr Kind an sich. »Und für Euch, Herrin.«
Draußen vor der kleinen Hütte vertrieb eine frische Morgenbrise den Gestank nach Fisch und Mist. Rhiann holte tief Atem und versuchte, die Worte der alten Frau zu verdrängen, als sie sich über das Gatter des Kuhpferches beugte, um ihre verkrampften Rückenmuskeln zu lockern. Die knochige Kuh muhte und rieb die Flanke an ihrer Hand. Unwillkürlich musste Rhiann lächeln.
Viele Edelleute von Dunadd hätten verächtlich auf diesen Hof herabgeblickt; auf das Torfdach der Hütte, den Zaun aus Treibholz und die algenverkrusteten Fischernetze. Rhiann fand, dass ein tiefer Frieden von dem Hof und dem kleinen farnüberwucherten Tal ausging, in dem er lag. Salzwasserduft und der leise Gesang der Fischer wehten über die Bucht. Der Tag hatte für alle gut begonnen und würde im selben Rhythmus verlaufen wie alle anderen Tage auch. Ein solches Leben erschien ihr ausgesprochen verlockend. Es verlief ruhig. Ereignislos. Vorhersehbar.
Plötzlich kam eine winzige Gestalt um die Hausecke geschossen und prallte gegen ihre Beine. Sie bückte sich und schwang den kleinen Jungen hoch in die Luft. »Wer ist denn dieser große wilde Eber, der mich umzurennen versucht?«
Das Kind starrte vor Schmutz; sie konnte nicht erkennen, wo der Saum seines zerlumpten Kittels endete und das Gesicht anfing. Er bohrte seine schmuddeligen Füßchen in Rhianns Oberschenkel, und sie kitzelte ihn, bis er vor Wonne quiekte.
Dann kam die Schwester des Jungen angelaufen, nahm ihn Rhiann verlegen ab und stellte ihn auf den Boden. »Ronan, du Nichtsnutz! Verzeiht, Herrin ... Euer Gewand ...«
»Eithne«, Rhiann blickte an sich hinab. »Ich war sowieso nicht gerade sauber ... dafür hat dein neuer Bruder gesorgt. Ich sehe vermutlich wie eine Vogelscheuche aus.«
»Ein Bruder!« Eithne verdeckte ihr schüchternes Lächeln mit einer Hand. »Pa wird sich freuen. Und Ihr seht gut aus, Herrin«, fügte sie höflich hinzu.
»Hübsch«, piepste der Junge. »Sie meint, dass Ihr hübsch seid.«
Eithne blickte zu Boden und zwickte ihren Bruder in die Hand. Sie war ebenso dunkel wie der Kleine, hatte schwarze Augen und scharfe Knochen wie ein Vögelchen. In den Adern der beiden Kinder floss das Blut des Alten Volkes; der Menschen, die in Alba gelebt hatten, bevor Rhianns hoch gewachsene, rothaarige Vorfahren gekommen waren. Gewöhnliches Blut, wie alle wussten.
Gerade jetzt wäre Rhiann selbst nur zu gerne klein, dunkel und gewöhnlich gewesen. Das Leben wäre dann viel leichter für sie.
»Danke, dass Ihr das Baby auf die Welt geholt habt. Und den weiten Weg auf Euch genommen habt.« Eithne warf Rhiann einen verstohlenen Blick zu. »Noch dazu, wo der König so krank ist.«
Bei diesen Worten drohte sich Rhianns Magen umzudrehen, doch wieder bezwang sie sich. »Als deine Mutter mir sagte, sie wäre in guter Hoffnung, versprach ich ihr, ihr bei der Geburt beizustehen, Eithne. Und mein Onkel ist in guten Händen. Meine Tante pflegt ihn.«
»Möge die Göttin ihn wieder gesund werden lassen.« Eithne holte etwas aus den Falten ihres geflickten Kleides und reichte es Rhiann. Es war eine roh gearbeitete, verbeulte Brosche in Form eines Hirschkopfes. »Pa hat mir aufgetragen, Euch dies zu geben. Es ist gutes Kupfer – er hat sie am Strand gefunden.«
Rhiann presste die Brosche kurz gegen ihre Stirn, ehe sie sie widerwillig einsteckte. Es war Sitte, die Priesterin für ihre Dienste zu bezahlen, auch wenn die Familie noch so arm war. Aber bei der Göttin, sie besaß nun wirklich genug Broschen!
Das am Ende des Zaunes angebundene Pferd, eine zierliche Stute von der Farbe winterlichen Nebels, wieherte laut. Rhiann lächelte Eithne zu. »Meine Liath ruft mich. Richte deinem Vater meine besten Wünsche aus und danke ihm in meinem Namen für die Brosche.«
Sie legte ihren Schaffellumhang an und schlang ihn eng um sich. Dann straffte sie sich und griff nach ihrem Bündel. Es war an der Zeit, in ihr eigenes Haus zurückzukehren.
Der landeinwärts führende Pfad war in dichten Nebel gehüllt, der über die Wiesen und den Fluss Add in seinem Bett hinwegwaberte und Rhianns Gesicht benetzte. Herabgefallene Erlenblätter dämpften Liath’ Hufschlag. Sonst war alles still.
Ein Nebel wie dieser verbarg viele Pforten zur Schattenwelt. Vielleicht war sie just in diesem Moment von bösen Geistern umzingelt, die sie mit sich ziehen würden, die sie aus der feuchten diesseitigen Welt in ihr Reich verschleppten. Rhiann spreizte die Finger und hob eine Hand in der Hoffnung, so die Geister zu beschwören, sie holen zu kommen ...
Aber sie bekam nur einen Zweig zu fassen, und eiskalte Tautropfen fielen auf ihren Nacken. Seufzend wischte sie sie weg. Pforten und Geister! Hier gab es nur verrottende Blätter, Nebel, Nässe und lange Nächte, die den Menschen bevorstanden.
Der Pfad wand sich eine Anhöhe empor, und als sie in milchiges Tageslicht eintauchte, zügelte sie ihr Pferd. Vor ihr erstreckte sich ein weitläufiges Moorgebiet unter einer Nebeldecke, das sich bis zu einer einsamen Felsenklippe hinzog. Darauf erhob sich Dunadd, das dun, die Festung ihres Stammes, die über den Add blickte. Auf dem Gipfel lag der Hof des Königs, wo ihr kranker Onkel dahinsiechte. Die Pfeiler des Druidenheiligtums ragten wie schwarze Finger gen Himmel. Erschauernd trieb Rhiann Liath weiter.
Dunadds Edelleute lebten auf diesem Felsen, hoch über dem Dorf, das sich, umgeben von einer Eichenholzpalisade, an dessen Fuß entlangzog. Als Rhiann das Tor erreichte, kam der Wächter von seinem Turm herunter, um den Querbalken zu entfernen. Er half ihr vom Pferd und bedachte sie dann mit einem argwöhnischen Nicken.
Alle betrachteten sie jetzt wachsam, erwartungsvoll und voller Argwohn.
Das Dorf erwachte gerade erst zum Leben. Hunde bellten, und die ersten Flüche, das erste Kindergeschrei waren hinter den Türbehängen aus Tierfellen zu hören. Rhiann führte Liath durch das Gewirr runder Hütten, Scheunen und Kornspeicher zu den Ställen. Dort warf sie einem gähnenden Stalljungen die Zügel zu, eilte den Pfad zum Mondtor hoch, das den Zugang zu dem Felsen bildete, und ließ das Dorf und den Nebel hinter sich.
»Herrin! Herrin!«
Ihre Dienerin Brica kam auf sie zu. Die geschnitzte Mondgöttin auf dem Tor warf einen Schatten über ihr schmales, scharf geschnittenes Gesicht. Sie nahm Rhiann den Umhang ab und schnalzte missbilligend mit der Zunge, als sie den Schlamm darauf sah, der unter Liath’ Hufen aufgespritzt war. »Ich weiß nicht, wie es um den König steht, Herrin – Lady Linnet war noch nicht zurück, als ich das Haus verlassen habe. Geht es Euch gut? Hat Euch irgendetwas erschreckt? Ihr seht so blass aus.«
»Mir geht es gut!«, wehrte Rhiann die bohrenden Fragen ab, die sie in den stechenden schwarzen Augen las.
Brica war ebenfalls vom Alten Blut und auf der Heiligen Insel aufgewachsen, wo Rhiann zur Priesterin ausgebildet worden war. Als Rhiann letztes Jahr nach ihrer Aufnahme in die Schwesternschaft die Insel überstürzt verlassen hatte, hatte ihr die Priesterinnenälteste Brica als Dienerin mitgegeben. Warum, wusste Rhiann nicht, denn sie und die kleine, magere Frau hatten nie große Zuneigung füreinander empfunden.
»Ich muss mich gründlich waschen.« Rhiann streckte die Hände aus. »Ist genug Wasser da?«
»Eure Tante hat alles verbraucht, um Tränke für den König zu bereiten. Ich werde sofort zum Brunnen gehen.« Brica gab Rhiann ihren Umhang zurück und eilte davon, dabei raffte sie ihre Röcke, um den Saum nicht mit Schlamm zu beschmutzen.
Rhiann verlangsamte ihre Schritte, als sie an den Häusern vorbeikam, die von den Angehörigen des Königs bewohnt wurden. Hier herrschte angespannte Stille, die nur vom steten Tröpfeln des Taus zerrissen wurde, der von den geschnitzten Türpfosten fiel. Die Dienstboten schlichen auf leisen Sohlen und mit gesenktem Blick zum Brunnen oder zum Kuhstall, um Milch zu holen. Irgendwo begann ein Baby zu greinen und wurde sofort zum Schweigen gebracht.
Rhianns Herz hämmerte mit einem Mal schmerzhaft gegen ihre Rippen.
Schließlich ragte der große Bogen des Pferdetores vor ihr auf, der zum Gipfel der Felsenfestung führte. Rhiann spähte zwischen den Beinen des geschnitzten Hengstes hindurch und sah von dem kleinen Druidentempel am Felsrand blauen Rauch aufsteigen. Zwischen Tor und Tempel lag das Haus des Königs, ein großes, rundes Gebäude mit einem bis zum Boden reichenden Strohdach. Nichts rührte sich dort.
Auf der Dachspitze wehte das königliche Banner mit dem Emblem ihres Stammes, der Epidier – des Pferdevolkes. Es zeigte die weiße Stute der Pferdegöttin Rhiannon auf karmesinrotem Grund.
An diesem Morgen jedoch war die Brise so schwach wie das fahle Sonnenlicht, und das Banner hing schlapp wie ein blutiger Lumpen an seinem Pfahl.
Rhiann lebte am Rand des Felsens, von ihrer Tür aus konnte sie über das Moor blicken. Wenn der Wind von Süden kam, trug er nur die Schreie der Vögel und das Flattern ihrer Flügel zu ihr herüber. Manchmal konnte sie so tun, als wäre sie Linnet, ihre Tante, die nur in Gesellschaft von Ziegen und einer treuen Dienerin allein für sich auf einem Berg wohnte.
Als Rhiann ihr Türfell hob, sah sie Linnet zusammengesunken auf einem Stuhl neben dem Feuer sitzen. Ihr rostbraunes Haar, in dem sich noch keine Spur von Grau zeigte, wirkte stumpf, ein paar Strähnen hatten sich aus den Zöpfen gelöst, und als sie den Kopf hob, sah Rhiann, dass das blasse, ruhige Oval von Sorgenfalten durchzogen war. Die Frauen aus Rhianns Geschlecht hatten kräftige, ausgeprägte Züge und lange, schmale Nasen, doch wenn sie erschöpft und von Sorgen geplagt waren, fielen ihre Gesichter ein, so wie das von Linnet jetzt. »Es sieht nicht gut aus, Kind.«
Rhianns Beine drohten unter ihr nachzugeben, und sie sank, den Umhang auf dem Schoß, auf einen niedrigen Schemel. »Ich dachte, du könntest ihn heilen, nachdem meine Kunst versagt hat. Ich war mir sicher. Ich war mir so sicher!«
Linnet seufzte. Schatten verdunkelten ihre grauen Augen. »Ich kann ihm noch eine Dosis Misteltrank geben, dann werden wir sehen, ob sich der Herzschlag verlangsamt.«
»Dann gehe ich jetzt zu ihm ... ich werde alles versuchen, um...«
»Nein.« Linnet schüttelte den Kopf. »Ich kehre gleich zu ihm zurück. Ich wollte nur sehen, ob du schon wieder da bist.«
Rhiann sprang auf. Der Umhang fiel auf den Lehmboden. »Ich begleite dich. Wenn wir beide die Große Mutter anflehen...«
»Nein«, wiederholte Linnet, erhob sich und musterte die Bronzekessel, die an dem Dachbalken hingen. Dahinter schimmerten glasierte Krüge, Schalen und geflochtene Körbe auf einem Brett an der Wand. »Bleib hier und braue mir frischen Mädesüßtrank.«
»Du versuchst, mich abzulenken.« Rhianns Atem ging schwer.
Linnet zwang sich zu einem müden Lächeln. »Gut, du hast mich ertappt. Trotzdem werde ich allein gehen. Ich bin die älteste Priesterin.«
»Aber ich bin die Ban Cré! Es ist meine Pflicht, an der Seite des Königs auszuharren!«
»Brude ist mein Bruder.«
»Doch du liebst ihn genauso wenig wie ich!« Rhiann biss sich auf die Lippe, denn die Worte waren ihr entschlüpft, ehe sie sie zurückhalten konnte. Das passierte ihr häufig.
Linnet legte eine Hand an Rhianns Wange und sah sie eindringlich an. »Das ist richtig, möge die Göttin mir verzeihen. Aber ich möchte dir so viel Leid ersparen wie möglich. Bald wird das nicht mehr in meiner Macht stehen.«
Hitziger Widerspruch drängte sich auf Rhianns Lippen. Ein Teil von ihr wollte vor dem Krankenlager des Königs davonlaufen, ein anderer Teil verzweifelt um sein Leben kämpfen. Aber nicht aus Liebe, möge die Göttin ihr vergeben. Nein, um das abzuwenden, was unausweichlich auf sie zukam, wenn Linnet, wie sie selbst gesagt hatte, sie nicht mehr vor Leid schützen konnte.
Endlich gab sie erschöpft nach, denn hinter Linnets sanfter Stimme und ihren liebevollen Worten verbarg sich ein eiserner Wille. Das war noch eine Gemeinsamkeit, die sie beide teilten, doch eine von ihnen musste stets zurückstecken, und diesmal war das Rhiann.
Nachdem Linnet gegangen war, schleppte sich Rhiann zu dem Stuhl, setzte sich vor das Feuer und beobachtete, wie das Blut unter der blassen Haut ihres Handgelenkes pochte. Dasselbe Blut, das schon ihr ganzes Leben lang durch ihre Adern rann. Wie konnte der Tod eines einzigen Mannes es bedeutender, wertvoller machen?
Besonderes Blut.
Die Worte schmeckten bitter auf ihrer Zunge. Denn in Alba ging der Königsthron nicht vom Vater auf den Sohn über. Seine weiblichen Verwandten, seine Schwestern und Nichten, gaben das Blut weiter. Aber der königliche Clan, der seit sechs Generationen regierte, verfügte über keinen Erben mehr, daher bestand die Gefahr, dass er von rivalisierenden Clans angegriffen wurde, die selbst den neuen König stellen wollten. Nur Rhiann konnte noch einen Sohn von königlichem Geblüt gebären, denn Linnet hatte schon vor langer Zeit einen Verzichtsschwur geleistet und war inzwischen über das gebärfähige Alter hinaus.
Solange ihr Onkel bei guter Gesundheit gewesen war, hatte Rhiann die Angst, eines Tages zu einer Heirat gezwungen zu werden, unterdrücken können. Aber nun, da der Tod des Königs näher rückte, würde dieser unheilvolle Tag nicht mehr lange auf sich warten lassen. Es gab keinen lebenden Erben mehr. Nur noch ihren Schoß.
Ihr besonderes Blut.
Bei Einbruch der Dämmerung kehrte Linnet zurück. »Ich habe ihm mehr von dem Trank eingeflößt, und trotzdem schlägt sein Herz unregelmäßig. Aber ich wage nicht, ihm noch mehr zu geben.« Müde rieb sie sich über die Augen. »Ich habe alles getan, was in meiner Macht steht, Tochter.«
Rhiann presste ihre zitternden Finger gegen die Wangen. »Aber er muss doch die Krankheit besiegen können, Tante! Bei der Göttin, er ist stark wie ein Pferd. Kämpfen, essen, trinken – das war sein Leben!«
»Vielleicht hat das viele Essen und Kämpfen sein Herz geschädigt«, erklärte Linnet mit einem leisen Lächeln. »Manchmal lodert die Seele heller, als es der Körper ertragen kann, und verbrennt ihn von innen her. Das habe ich schon öfter erlebt.«
Ein Birkenholzscheit im Feuer knackte, Funken sprühten, Ascheflocken schwebten zum Strohdach empor. Rhiann drehte sich zu den Flammen um und schlang die Arme um ihren dünnen Oberkörper. Wurde sie vom Tod verfolgt? Zählte sie zu jenen Unglücklichen, die die bösen Moorgeister heimsuchten? Ihre Geburt hatte ihre Mutter das Leben gekostet, ihr Vater war ihr fünf Jahre später in die Schattenwelt gefolgt. Und dann ... dann war der nächste Verlust gekommen ... die anderen Toten vor einem Jahr, auf der Heiligen Insel ...
Die Kraft von Linnets Blick holte sie in die Gegenwart zurück. Dank des geheimnisvollen Bandes, das zwischen Priesterinnen bestand, spürte Rhiann die Last von Linnets Sorgen schwer auf ihren eigenen Schultern. Sie kannte den Grund dafür. Sie wusste, was Linnet dachte.
Einst war Rhiann das Abbild ihrer Mutter gewesen, und die Barden hatten ihre Schönheit besungen. Sie hatten dasselbe Haar und dieselben Augen gehabt – bernsteinfarben und violett in den Liedern der Barden, hellbraun und blau Rhianns Ansicht nach. Der Bronzespiegel ihrer Mutter lag tief auf dem Grund ihrer geschnitzten Truhe verborgen. Rhianns Finger hatten ertastet, wie hohl ihre Wangen waren und wie stark die Knochen an Hals und Brust hervorstachen. Sie brauchte keinen Spiegel, der ihr verriet, dass sie ihrer Mutter schon lange nicht mehr glich. Ihr breiter Mund verlief wie eine klaffende Wunde über das ausgemergelte Gesicht, die lange Nase ähnelte einem spitzen Schnabel. Linnets Züge zeigten Spuren der Strapazen, die ihr jeder neue Tag brachte, Rhianns spiegelten die Pein wider, die sie Nacht für Nacht durchlitt. Scham und Kummer konnten das Fleisch eines Menschen dahinschwinden lassen, das wusste jeder Heiler. So verhielt es sich auch bei ihr.
Sie hörte Leinenröcke rascheln, und dann strichen Linnets warme Hände über ihr Haar. Ein Kloß bildete sich in Rhianns Kehle. Doch sie durfte ihren Gefühlen keinesfalls freien Lauf lassen, weil sie fürchtete, die Tränenflut würde dann nie wieder versiegen. Sie zog die Schultern hoch und kämpfte gegen das Brennen hinter ihren Augen an. Nach einem Moment zog Linnet seufzend die Hand zurück.
»Es muss doch etwas geben, was wir tun können, Tante!« Rhiann wandte sich, die Fäuste in die Hüften gestemmt, zu ihr um. »Kälte verlangsamt den Blutfluss ... auf den Gipfeln gibt es schon Eis ...«
Linnet schüttelte den Kopf und tastete nach dem Mondsteinamulett auf ihrer Brust. »Ich habe alles für ihn getan, was ich konnte. Sein Leben liegt jetzt in den Händen der Göttin. Nur sie allein kennt die Irrwege des Schicksals, Tochter.«
Obwohl Linnet wusste, was diese Worte für Rhiann bedeuteten, unternahm sie keinen Versuch, sie zu trösten, das hatte sie schon seit dem Ausbruch der Krankheit des Königs nicht mehr getan. Ein altvertrauter Schmerz durchzuckte Rhianns Brust.
Und dann hörten sie es. Vom Gipfel des Felsens hallte ein gellender Schrei zu ihnen herüber; ein einsamer, gequälter Klagelaut, der an den Ruf der Brachvögel erinnerte. Er kam aus den Gemächern des Königs. Brudes Frau hatte ihn ausgestoßen. Die anderen Frauen des Haushaltes fielen in das Gejammer ein, Schrei um Schrei erfüllte die Luft, ein jeder so scharf, dass er sich direkt in Rhianns Herz zu bohren schien.
Sie fing Linnets Blick auf. Der König war tot.
Die nächsten Stunden verschwammen in einem Meer aus rituellen Klageliedern, den entsetzen Gesichtern der Menschen, die sich in den Gemächern des Königs drängten, und den Tränen seiner Töchter, die Rhianns Hals benetzten. Endlich befahl ihr Linnet, zu Bett zu gehen. Rhiann vermochte kaum noch einen Fuß vor den anderen zu setzen, und als sie ihr vom fahlen Sternenlicht beschienenes Haus erreicht hatte, schickte sie Brica fort und kroch auf ihre Lagerstatt.
Dort vergrub sie das Gesicht in der Decke aus Hirschfell und versuchte, im Schlaf Vergessen zu finden.
Doch ihre Gedanken kamen nicht zur Ruhe. Von nun an würden sie die Augen aller Bewohner von Dunadd auf Schritt und Tritt verfolgen. Sie biss sich auf die Lippe, um sich daran zu hindern, laut den Umstand zu verfluchen, dass sie eine Frau war. Wäre sie doch nur als Mann zur Welt gekommen! Dann würden die Stammesältesten kaum Interesse an ihrer Person zeigen. Würde sie doch nur zu einem der Stämme im Süden gehören, der Gegend, die die römischen Invasoren Britannien nannten! Dort flehten die Könige ihre Götter um Söhne an und zeugten ein Kind nach dem anderen. Niemand scherte sich dort um die Schwestern und Nichten ihrer Herrscher.
Seufzend rollte sie sich auf die Seite und beobachtete durch den Wandschirm aus Flechtwerk vor ihrem Bett die Funken des Feuers. Wäre sie doch nur in die Familie eines Fischers oder eines Bauern hineingeboren worden ...
Hör auf zu grübeln, befahl sie sich. Versuch jetzt zu schlafen.
Doch der Schlaf würde ihr keinen Frieden bringen, nicht in dieser Nacht. Als Heilerin hätte sie wissen müssen, dass dieser neue Schmerz auch die alten Wunden wieder aufreißen würde; die furchtbaren Bilder erneut heraufbeschwören würde, die sie seit dem letzten Jahr fortwährend quälten und an ihrem Fleisch zehrten. Sie hätte sich einen Trank brauen sollen, um die Visionen zu verscheuchen.
Aber das hatte sie versäumt.
Und so setzten in der dunkelsten Stunde vor der Morgendämmerung die Träume ein. Zuerst sah sie ihren Onkel auf seinem Pferd sitzen; sah sich selbst, wie sie sich an seine Zügel hängte und ihn anflehte, sie doch mitzunehmen. Aber er hatte das Visier seines Helms über die Augen gezogen, trieb seinen Hengst an und jagte davon, mitten im Galopp verwandelte sich sein Pferd in eine Möwe.
Rhiann versuchte, ihm nachzulaufen, denn irgendetwas verfolgte sie, kam rasch näher ... doch ihre Beine schienen in einem Sumpf gefangen zu sein, sie stolperte und versank schluchzend im Moor ... und dann war da plötzlich Linnet, sie saß vor einem Feuer und spann; spann unaufhörlich, die Wolle bildete zu ihren Füßen schon einen riesigen scharlachroten See ... mit einem Mal krochen aus den Strängen Tentakel heraus und schlangen sich um Rhianns Beine ...
Von einem Moment zum anderen verschwanden die wirren Bilder. Eine Tür schien sich in der Luft vor ihr aufzutun, eine salzige Brise wehte ihr ins Gesicht. Sie atmete die Luft der Heiligen Insel ein. Sie war dorthin zurückgekehrt.
Ein Teil von ihr begriff, was auf der anderen Seite der Tür lauerte, und versuchte verzweifelt, sich aus dem Traum zu lösen, doch es war zu spät. Viel zu spät. Die Erinnerungen ergriffen von ihr Besitz und zwangen sie, die grauenvollen Ereignisse noch einmal zu durchleben ...
... Muscheln knirschen unter ihren Füßen.
Ein dichter Sprühnebel hängt über der Küste. Rote Segel und spitze Schiffsbuge, die sich schwarz gegen das Sonnenlicht abheben, halten auf das Ufer zu. Ein beißender Geruch nach Rauch liegt in der Luft.
Geräusche kommen näher. Schwerter, die klirrend aufeinander treffen. Speere, die durch die Luft schwirren. Der dumpfe Aufschlag von eisernen Spitzen, die sich in warmes Fleisch bohren.
Dort steht ihr Ziehvater Kell und versucht, mit erhobenem Schild eine Schar Männer aus dem Norden abzuwehren. Ihre Augen funkeln blutrünstig. Und dann rollt Kells abgeschlagener Kopf in die Gischt. Ein Auge starrt ins Leere, blicklos zurück auf sein Heim gerichtet.
Dort hinten taumelt ihr kleiner Bruder Talen über den Sand, eine Hand gegen seinen Bauch gepresst. Blasses Gedärm quillt zwischen seinen Fingern hervor. Mit der anderen Hand hält er noch immer sein erstes Schwert umklammert. Und da ... eine Frau stürmt auf den Jungen zu; ihre Ziehmutter Elavra, deren angsterfüllte Schreie von plumpen Händen erstickt werden, die sich um ihren schlanken Hals legen ...
Dort drüben ... dort windet sich ihre Schwester Marda verzweifelt unter einem grunzenden Mann. Seetang hat sich in ihrem kupferfarbenen Haar verfangen ...
Schließlich sieht sie nichts mehr, der Göttin sei Dank, nichts mehr, nur noch ihre eigenen Hände, fahl wie die Bäuche toter Fische auf dem dunklen Felsgestein, als sie schluchzend davonriecht. Lauf, Rhiann! Lauf! Weg von dem heißen, kupfrigen Blutgestank, weg von den knisternden Flammen, weg von dem Wutgebrüll.
Rhianns Lider flatterten, als sie sich auf ihrem Lager wälzte und versuchte, sich aus dem Traum zu befreien. Dieses unmenschliche Gebrüll! Sie kämpfte darum, das Bewusstsein wieder zu erlangen, unterdrückte den Schrei, der sich ihr entringen wollte, schlug mühsam die Augen auf und zwinkerte ein paar Mal benommen.
Die gleißende Helligkeit des Traumes war verflogen, stattdessen warf das heruntergebrannte Feuer tanzende Schatten an die Lehmwände. Sie konnte ihre Beine nicht bewegen, sie hatten sich in der Decke verfangen ... ihr wurde übel, und der Mageninhalt stieg ihr in die Kehle wie an jenem Tag am Strand.
Der Tag des Überfalls ... ja ... diese Nacht vor einem Jahr ...
Sie schlug eine Hand vor den Mund und begann zu würgen. Die Übelkeit schlug wie eine Welle über ihr zusammen und ebbte dann langsam ab. Einen Moment lang blieb sie nach Atem ringend still liegen. Ihre Familie ... ihre geliebte Ziehfamilie ... war vor einem Jahr auf grausame Weise ausgelöscht worden. Tagsüber kam es ihr so vor, als läge dieser Tag eine Ewigkeit zurück; in ihren Träumen standen ihr die Ereignisse so deutlich vor Augen, als sei alles erst gestern geschehen.
Kinder von Edelleuten wurden sehr jung zu Ziehfamilien gegeben, um die Familienbande zu stärken, nicht selten galten ihnen deswegen die Zieheltern mehr als die Blutsverwandten. Rhiann, die außer Linnet niemanden mehr hatte, hatte ein besonders inniges Verhältnis zu ihrer Ziehfamilie gehabt. Kell und Elavra hatten sie bei sich aufgenommen, als sie mit ihrer Ausbildung auf der Heiligen Insel begonnen hatte, sie hatten sie zur Edelfrau und Priesterin erzogen. Aber dann war die gesamte Familie zwischen einem einzigen Sonnenauf- und -untergang getötet worden. In einer so unvorstellbar kurzen Zeit.
Nachdem sie ein paar Mal tief durchgeatmet hatte, befreite Rhiann ihre Beine aus dem Deckengewirr und rollte sich, die Hände zu Fäusten geballt, zu einem Ball zusammen. Obwohl das Blut in ihren Adern rauschte, konnte sie in dem Alkoven neben dem ihren Linnets leise Atemzüge hören: ein schwaches, unschuldiges, vertrautes Geräusch.
So lebendig.
Eine Träne rann in Rhianns Ohr, und sie wischte sie ungehalten fort. Nein, sie durfte nicht weinen. Wenn Linnet auch nur einen einzigen Schluchzer hörte, würde sie Rhianns Wangen streicheln, ihre Hände halten und den ganzen Schmerz ans Licht bringen. So sehr sich Rhiann auch danach sehnte, sich in Linnets Arme zu kuscheln, wie sie es als Kind oft getan hatte – war sie doch nicht im Stande, ihre Qual mit jemandem zu teilen. Niemals.
Es war besser, allein mit allem fertig zu werden. Also schwieg sie. Auch Linnet gab keinen Laut von sich.
Es dauerte lange, bis sich ihr wild pochendes Herz wieder beruhigt hatte. Noch immer peinigten sie die Bilder der furchtbaren Ereignisse. Sie versuchte sie zu verdrängen und konzentrierte sich darauf, ruhig und gleichmäßig weiterzuatmen. Ein, aus. Ein, aus. Denk an gar nichts. Lass dich in eine große Leere fallen.
Eine Weile gelang ihr das auch. Aber die Erinnerungen waren immer noch da. Lauerten ganz am Rand ihres Bewusstseins. Sie hob den Kopf.
Seit dem Überfall hatte Rhiann ihr Gesicht, ihre Fähigkeit, Visionen zu empfangen und mit der Geisterwelt in Verbindung zu treten, nahezu vollständig eingebüßt. So wie das Blut ihrer Familie im Sand versickert war, so war auch ihre Macht geschwunden. Ein Jahr lang war sie blind durch jeden neuen Tag gestolpert. Innerlich fühlte sie sich tot und leer. Alles in ihr schien für immer erstorben zu sein.
Aber jetzt spürte sie, wie der Hauch einer Empfindung in ihr aufflackerte. Flüsterten die Geister der Schattenwelt ihr Trostworte zu?
Das Flüstern schwoll zu einem Murmeln an. Und dann ertönte in der Ferne ein langgezogenes Heulen, und der Wind begann unvermutet, mit eisernen Fäusten auf das kleine Haus einzuhämmern. Rhiann sank entmutigt auf ihre Felle zurück. Es war nur ein Sturm aufgezogen, sonst nichts. Keine Vision aus der Schattenwelt war ihr zu Hilfe geeilt. Stürme wie dieser kamen zu dieser Jahreszeit häufig auf; unverhofft und machtvoll fegten sie von der See her über die Moore und den einsamen Felsen hinweg.
Innerhalb von drei Herzschlägen tobte er um Rhianns Haus. Heftige Böen zerrten wie von Sinnen an dem Strohdach, und das Türfell blähte sich knarrend und knackend in seinen Angeln.
Durch einen Spalt in ihrem Fellkokon starrte Rhiann zur Decke empor. Der Himmel weinte um den toten Brude, König der Epidier, um sein Volk und sein Land.
Aber nicht um sie. Niemand würde je um sie weinen.
Kapitel 2
Weit draußen auf der dunklen, tobenden See vor Albas Küste zuckte ein gleißender Blitz über den Himmel und tauchte das Boot, das auf den Wellen tanzte, und die Männer, die darin um ihr Leben kämpften, in ein gespenstisches Licht. »Bei den Eiern des Großen Ebers!«, brüllte ihr Anführer Eremon mac Ferdiad verzweifelt. »Haltet euch fest! Passt auf ... jetzt, bei allen Göttern, jetzt!«
Sein Warnruf ging in dem donnernden Getöse unter, mit dem ein weiterer Brecher über den Bug des Bootes hinwegbrandete. Eremon stemmte die Füße mit aller Kraft gegen die Planken des Rumpfes. Als die aufschäumende Gischt wieder in sich zusammengefallen war, wischte er sich Salzwasser aus den Augen.
Angsterfüllt zählte er erneut seine Männer durch. Im schwachen Licht des hinter den Wolken verborgenen Mondes konnte er nicht genau erkennen, wer wer war – mit Ausnahme seines Ziehbruders Conaire natürlich, dessen massige Gestalt unverwechselbar war. Erleichtert stellte er fest, dass keiner seiner zwanzig Männer über Bord gespült worden war. Auch der Fischer, den sie als Führer mit an Bord genommen hatten, kauerte noch an seinem Platz, und sogar Eremons Wolfshund Cù lag immer noch zitternd vor den Füßen seines Herrn.
Eremons Pulsschlag verlangsamte sich, und er spürte, wie sich sein Magen von neuem hob. Nicht schon wieder...
Er beugte sich über die Seite und erbrach grüne Galle in die aufgewühlte See. Die Männer um ihn herum folgten seinem Beispiel; die meisten machten sich nicht einmal mehr die Mühe, den Kopf von der Ruderbank zu heben. Der junge Rori schien trotz seiner geringen Körpergröße einen Magen wie ein Sack zu haben, denn ein ganzer Strom von Erbrochenem quoll aus seinem Mund und verfehlte Eremons Füße nur knapp.
So viel zur Wahrung prinzlicher Würde. Eremon wischte sich mit der Hand über den Mund. Der Gestank von Urin und der Anblick von Blut machten ihm nichts aus; das gehörte zu einer Schlacht und dem Leben eines Kriegers untrennbar dazu. Auch große Mengen Wein und Ale vertrug er ohne Probleme. Aber das hier? Das hier war eine andere Welt. Dieses eine Mal konnte sein eiserner Wille seinen Körper nicht beherrschen, so sehr er sich auch bemühte.
Die nächste Welle türmte sich vor ihnen auf, und Eremon befahl den Männern, mit dem Ausschöpfen des Wassers fortzufahren und zu rudern, was das Zeug hielt. Er war kein Seemann, er hatte bislang kaum je in einem Boot gesessen, aber sein Instinkt sagte ihm, dass sie direkt auf diese Brecher zuhalten mussten, wenn sie verhindern wollten, dass das Boot kenterte.
Absurderweise fiel ihm in diesem Moment ein Satz aus einer alten Legende ein, die der Druide seines Vaters ihm einmal erzählt hatte. Wenn die Götter lächeln, erstrahlt die Sonne; wenn ihre Schwerter aufblitzen, stirbt ein König; wenn sie die Stirn runzeln, zerreißen Blitz und Donner den Himmel.
Ha! Götter!
Gischt schäumte um seine Füße, und Eremon schüttelte sich mit einer heftigen Kopfbewegung das Haar aus den Augen. Wenn der alte Druide Recht hatte, dann wusste er jetzt, was ihnen allen bevorstand, denn nur ein zorniger Gott konnte einen solchen Sturm schicken, der das ruhige Wasser in ein tosendes Inferno verwandelte.
Sogar der Fischer klammerte sich verzweifelt an seiner Ruderpinne fest. Seine Augen waren glasig vor Entsetzen. Eremon empfand einen Anflug von Schuldgefühl. Der Mann hatte bislang lediglich curraghs gesegelt, diese kleinen Boote aus Tierhaut glitten mühelos über solche Wellen hinweg. Aber ihr Boot war größer und schwerer, der Rumpf bestand aus Holzplanken, nicht aus Häuten, es war zu jeder Seite mit zehn Rudern ausgestattet und fuhr unter voll getakelten Segeln. Überdies leistete der Fischer ihnen nur äußerst widerwillig Lotsendienste, denn er war mit Gewalt an Bord des gestohlenen Bootes geschleift worden.
Wenn Eremon geahnt hätte, in was für ein Unwetter sie hineinsegelten, hätte er den Mann vielleicht verschont. Aber der Tag, an dem sie unter einem Pfeilhagel aus Erin geflohen waren, war sonnig und windstill gewesen. Erst am Tag darauf hatte sich der Himmel verdunkelt, Wind war aufgekommen, und der Fischer hatte mit bedenklich gerunzelter Stirn auf die bedrohliche Wolkenbank gedeutet, die sich im Süden zusammenballte.
Die Sturmfront war mit aller Gewalt über sie hereingebrochen; Wind, Wellen und Regen hatten sich in ein entfesseltes Ungeheuer verwandelt, das sie wütend ansprang, das Boot packte und zwischen seinen Kiefern hin- und herschüttelte. Die Männer bemerkten kaum noch, wann der Tag in die Nacht überging, da sie ohnehin nichts mehr um sich herum erkennen konnten. Ihre Welt beschränkte sich nur noch auf Geräusche und andere Sinneswahrnehmungen: das Heulen des Windes, die kalten Regenschwaden, den salzigen Geschmack der Gischt auf ihren Lippen, das Knarren der Takelage, die durch das ewige Rudern entstandenen aufplatzenden Blasen an ihren Händen.
Jetzt schien sich das Sternrad Richtung Morgen zu drehen. Der gesamte Himmel war wolkenverhangen, der gelblich schimmernde Mond schien wie das boshafte, erbarmungslose Auge eines Gottes auf Eremon hinabzustarren. War es Hawen, der Große Eber, der Schutzpatron seines Stammes? Dagda, der Himmelsgott? Nein, wohl eher Manannán, der Herr der Meere und Beschützer Erins. Vielleicht war Manannán ergrimmt, weil Eremon sein Land im Stich gelassen hatte.
Dann nimm nur mich!, rief er dem Auge stumm zu. Verschone meine Männer!
Er erhielt keine Antwort. Weder flaute der Wind ab, noch ließ der Seegang nach. Die nächste Welle erfasste das Boot, ein Wasserschwall drang in Eremons Mund und verstopfte seine Nase. Prustend und schnaubend rang er nach Luft und klammerte sich am Ruderholz fest, bis die Woge das Boot wieder freigab.
Cù presste sich so dicht gegen die Planken, wie es ihm möglich war, die schlanken Läufe breit gespreizt, als wolle er sich am Holz festkrallen. Eremon tätschelte den zottigen Kopf und spürte, wie der Hund ihm dankbar die Hand leckte. Dann drehte er sich zu Conaire um. Dieser ruderte unentwegt; seine dicken, sehnigen Arme bewegten die Holzstange mit solcher Kraft vor und zurück, als wäre er noch genauso frisch und ausgeruht wie vor zwei Tagen. Allerdings war Conaire der Einzige, der von der Seekrankheit verschont geblieben war.
Eremon zwang sich zu einem Grinsen, und obwohl Conaires weiße Zähne zur Antwort im Dämmerlicht aufblitzten, stand in seinen Augen etwas anderes zu lesen. Erschrocken begriff Eremon, dass sein Ziehbruder Angst hatte.
Er beugte sich wieder über seine eigene Ruderstange. Das war ein schlechtes Zeichen. Conaire hatte sein ganzes Leben lang vor nichts und niemandem Angst gehabt – vor keinem Menschen und vor keinem Tier. Er stellte sich jedem Kampf, jeder Herausforderung mit einem unbekümmerten Lachen auf den Lippen. Aber auch Conaire war noch nie zuvor auf dem Wasser gewesen. Er glaubt nicht, dass wir es schaffen, dachte Eremon verzagt.
Dann hämmerte die nächste Welle auf das Boot ein. Die Männer hielten sich an ihren Rudern fest, wie er es ihnen befohlen hatte, nur Aedan, der junge Barde, wollte seine kostbare Harfe nicht loslassen. Doch dieser Brecher war der bislang größte, er fegte Aedan von seiner Bank und riss ihn wie ein Stück Treibholz mit sich. Einen nicht enden wollenden Moment lang hing er im Heck des Bootes hilflos halb über Bord. Sein Hilfeschrei wurde vom Wind davongetragen.
Eremon stieß Cù weg und sprang über die Ruderbänke hinweg, ohne darauf zu achten, dass er dabei auf seine Männer trat. Conaire war schon bei Aedan angelangt und hielt ihn fest. Gemeinsam zerrten Eremon und er an den Beinen des Barden, bis das Wasser ihn freigab und er zu ihren Füßen zusammensackte. Keuchend starrte Conaire mit leerem Blick durch seine tropfnassen Haare hindurch auf einen Punkt hinter Eremons Schulter. Eremon holte tief Atem und drehte sich um.
Der von Sturm und Wellen gebeutelte Mast war nun doch umgeknickt, Segel und Takelage flatterten nutzlos im Wind. Eremon stieß die Luft zischend wieder aus. Seine Verzweiflung wuchs. Wann hatte diese Tortur ein Ende? Dann blickte er über die Trümmer hinweg auf die zwanzig Augenpaare, die alle Rat suchend auf ihm ruhten.
Auf Rori, dessen rotes Haar ihm am Kopf klebte und der das Kinn tapfer vorgeschoben hatte, obwohl seine Unterlippe bebte.
Auf den grauäugigen Aedan, der seine Harfe an sich drückte, während er von Würgekrämpfen geschüttelt wurde.
Auf den stämmigen Finan, der schon in Schlachten gekämpft hatte, als Eremon ein Baby an der Mutterbrust gewesen war, und der jetzt die Ruderpinne umklammerte, die der völlig verängstigte Fischer im Stich gelassen hatte.
Der Rest von Eremons Kriegerschar kauerte geduckt auf den Ruderbänken. Einige waren noch junge Männer, die sich ihrem Prinzen angeschlossen hatten, weil sie auf Heldenruhm hofften; andere, Veteranen wie Finan, hielten seinem verstorbenen Vater Ferdiad von Dalriada die Treue.
Sie folgten Eremon, obgleich dieser selbst erst zwanzig Sommer zählte, weil sie an ihn glaubten. Sie waren überzeugt, dass er den Königsthron von seinem verräterischen Onkel zurückerobern würde, der ihn Eremon mit dem Schwert und lügnerischer Zunge entrissen hatte. Alles, was Eremon hatte retten können, waren diese zwanzig Männer und ein paar Juwelen und Waffen. Sie hatten nach dem letzten Überraschungsangriff nur mit knapper Not von Erins Küste fliehen können.
Nun wird uns der Tod trotzdem ereilen ...
»Lange können wir so nicht weitermachen!«, brüllte Conaire ihm über das Heulen des Sturmes hinweg ins Ohr. »Wir müssen aufhören zu rudern, sonst sind wir morgen früh Fischfutter!«
Eremon zwinkerte ein paar Wassertropfen weg. Conaires Rat klang vernünftig, aber er wusste, dass sie sich nicht auf den Wellen halten konnten, wenn sie mit dem Rudern innehielten, denn dann würde das Boot vermutlich umschlagen. Unschlüssig nagte er auf seiner Unterlippe herum. Er musste eine Entscheidung treffen und zwar schnell.
Mehr zu seiner eigenen als zu Conaires Beruhigung packte er seinen Ziehbruder bei der Schulter. »Wir haben schon zahlreiche Kämpfe bestritten, und diesen hier werden wir auch gewinnen!«, schrie er. »Rudert! Rudert, sage ich!«
Conaire verzog das Gesicht, doch ehe er antworten konnte, hörten sie plötzlich ein ohrenbetäubendes Brausen. Beide Männer blickten auf und sahen einen weiß gekräuselten Wellenkamm, der sich anschickte, todbringend auf sie zuzurollen. Sie bekamen den Mast gerade noch zu fassen, ehe er vollends abbrach, und nachdem die aufstiebende Gischt wieder verflogen war, zappelte diesmal Finan wie ein Käfer auf dem Rücken.
Die Ruderpinne wurde von einem Windstoß erfasst, das Boot gierte, und die See, die nur auf diese Gelegenheit gewartet zu haben schien, packte es und wirbelte es wild um die eigene Achse. Dann neigte es sich zur Seite, und als die nächste Welle unter dem Rumpf anschwoll, blickten die Männer vor Entsetzen wie gelähmt in die schwarzen Abgründe, die sich vor ihnen auftaten. Einen endlosen Moment lang hielt sich das Boot wacker auf der Wellenkante, während sich jeder an Bord für den langen Sturz und den unausweichlichen Aufprall auf den eisigen Fluten wappnete.
Dann lockerte die Welle ihren Griff, das Boot richtete sich auf und glitt in das Wellental hinab. Finan war auf den Beinen, ehe Eremon das Heck erreichte, und gemeinsam rissen sie das Ruder herum und brachten den Bug wieder in die richtige Position.
»An die Ruder!«, donnerte Eremon. Seine Brust hob und senkte sich heftig. Das Entsetzen, das ihn erfasst hatte, war so groß, dass er darüber seinen rebellierenden Magen vollkommen vergaß. »Diarmuid, Fergus und Colum, schöpft das Wasser aus dem Boot – und ihr anderen rudert, als wären alle Kreaturen der Schattenwelt hinter euch her! Nach Alba!«
Alba mit seinen Küsten, Mooren, Tälern und Bergen. Obwohl sie nach Norden abgetrieben worden waren, statt Kurs Richtung Osten zu nehmen, wusste er, dass sie dem Ziel nahe waren. Aber er konnte jetzt keinen Gedanken daran verschwenden, was sie dort erwarten mochte.
Es gab nur das Hier und Jetzt: Wind, Regen, Dunkelheit und die hungrige See.
Kapitel 3
»Die Bestattungsfeierlichkeiten finden in zwei Tagen in der Morgendämmerung statt.«
Rhiann spürte, wie Linnet neben ihr bei den knappen Worten des obersten Druiden erstarrte. Das Dach des Druidentempels war offen, vom wolkenverhangenen Himmel fiel dämmriges Licht auf den regennassen Boden zwischen den mächtigen Eichenholzpfeilern. Aber das Gesicht Gelerts, des obersten Druiden, lag im Schatten verborgen.
Er hatte gerade ein Opfer für König Brudes Seele dargebracht. Blut verschmierte seine knorrigen Hände und besudelte sein Gewand. Die anderen Druiden bildeten einen Halbkreis vor dem steinernen Altar, auf dem ein Jährlingskalb lag. Am Fuß eines jeden Eichenpfeilers kauerte eine holzgeschnitzte, mit Ocker bemalte und mit verwelkten Blumenkränzen geschmückte Götterstatue und starrte mit leeren Augen ins Nichts. Der Boden vor ihnen war mit vertrockneten Blütenblättern übersät.
»Wir brauchen aber noch Zeit, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.« Linnets Stimme stand der des Druiden an Kälte in nichts nach.
Gelert tauchte die Hände in eine Bronzeschale mit Wasser, die ihm ein junger Novize hinhielt. »Es ist bereits alles vorbereitet. Die Edelleute werden in zwei Tagen vor dem ersten Tageslicht zur Insel der Hirsche aufbrechen. Wir werden den König dort vor Sonnenaufgang verbrennen.«
»Ich sehe, dass du trotz deiner Trauer keine Zeit verlierst, Gelert.«
Der Druide entließ den Novizen mit einer Handbewegung und trat ins Sonnenlicht hinaus. Rhiann stockte der Atem. Das geschah immer, wenn Gelert in ihrer Nähe war. Die verblassten Tätowierungen auf den Wangen des alten Mannes wurden von den Furchen verzerrt, die sein Gesicht durchzogen. Das Fleisch der Nasenflügel war eingesunken, sein Kopf glich einem Totenschädel. Glattes weißes Haar fiel ihm strähnig auf die Schultern. Am stärksten stießen Rhiann aber seine Augen ab, vor allem dann, wenn sie mit einem schwer zu deutenden Ausdruck auf ihre Person gerichtet waren. Die Wimpern waren fast vollständig ausgefallen, und die Iris schimmerte so gelblich wie die einer Eule.
»Wozu trauern?« Gelert zuckte die Achseln. »Ich wusste, dass er sterben würde. Ich habe es ihm angesehen. Im Gegensatz zu dir habe ich wenig Zeit, nach Frauenart in Trauer zu versinken.« Ein anderer Novize reichte ihm einen Umhang aus Wolfsfell. Gelert schlang ihn um seine knochigen Schultern. »Ich muss mich um wichtigere Angelegenheiten kümmern.«
Linnet verbarg die Hände in den Ärmeln ihres Gewandes. »Zum Beispiel um die Römer, die im Süden unseres Landes ihr Unwesen treiben? Wir alle wissen doch, dass sie nicht bis nach Alba vordringen werden.«
Rhiann schrak zusammen. Sie war so tief in ihrem eigenen Elend versunken gewesen, dass sie den Gerüchten über die Römer keinerlei Beachtung geschenkt hatte. Die Invasoren hielten die Inseln Britanniens schon seit fast vierzig Jahren besetzt, und obwohl sie gelegentlich Vorstöße Richtung Norden unternahmen, schienen sie sich damit zufrieden zu geben, ihre neue Provinz nach und nach auszubluten. Aber Alba? Dieser Teil des Landes war zu rau und zerklüftet, und die Stämme waren zu kriegerisch. Das hatte Rhiann an den Feuern gehört, seit sie ein kleines Kind war. Jeder wusste, dass Alba vor den Römern nichts zu befürchten hatte.
Gelert verzog die Lippen zu einem höhnischen Lächeln. »Ich hatte auch nicht erwartet, dass Frauen etwas von derartigen Dingen verstehen. Deswegen sollten sie sie auch lieber den Männern überlassen.«
Rhiann wusste, dass Linnet ihn nicht wegen seiner Unverschämtheit zurechtweisen würde, denn Gelert sprach stets in diesem Ton mit ihrer Tante. Seinen Hass auf die Schwestern – die Dienerinnen der Göttin – hatte Rhiann schon ihr ganzes Leben lang ertragen müssen. Die Druiden gingen mehr und mehr dazu über, nur noch ihre Schwert-, Donner- und Himmelsgötter zu verehren, obwohl die meisten von ihnen der Göttin noch die gebührende Ehre erwiesen. Nicht so Gelert. Er hätte die gesamte Schwesternschaft am liebsten ein für alle Mal von Albas Antlitz getilgt. In seinen Augen war die Große Mutter Rhiannon, nach der Rhiann benannt worden war, nur die unbedeutende Gemahlin eines Gottes.
Ein Grund mehr für Rhiann, nicht länger untätig dazustehen und zu gaffen wie ein kleines Kind. Sie war gleichfalls eine Priesterin und musste wie eine solche handeln. »Welche Symbole sollen das Totenboot des Königs schmücken?«, warf sie ein und lenkte so das Gespräch auf das eigentliche Thema zurück.
Gelert wandte sich zu ihr um. Seine gelben Augen glühten; eine bösartige Macht lag darin. »Es ist alles geregelt. Während du das Balg dieses Fischers auf die Welt geholt hast, haben meine Brüder und ich die letzte Reise des Königs vorbereitet. Du brauchst uns nur noch mit deiner Gegenwart zu beehren. Es sei denn, du erhebst Einwände?«
Rhiann gab keine Antwort, sondern hob nur das Kinn.
Gelert lächelte ohne jede Wärme. »Ah ja, unsere stolze Ban Cré, unsere Mutter des Landes. Unsere Inkarnation der Göttin, unsere Hohepriesterin.« Es gelang ihm immer, ihre Titel mit einer unüberhörbaren Verachtung auszusprechen. »Wir wären alle sehr enttäuscht, wenn du deinem Verwandten diesen Respekt nicht zollen würdest.«
»Natürlich werden wir kommen!«, herrschte Linnet ihn an. »Im Gegensatz zu dir wissen wir, was wir den Toten schuldig sind, die wir geliebt haben.«
Das kam in Rhianns Fall einer Lüge bedenklich nahe, aber sie hatte zumindest alles versucht, um das Leben ihres Onkels zu retten. Gelert hatte nichts dergleichen getan. Nachdem der König erkrankt war, hatte der Druide scheinbar sofort Vorkehrungen für dessen Bestattung getroffen. Er hatte es noch nicht einmal für nötig gehalten, damit zu warten, bis die Seele den Körper verlassen hatte.
Rhiann dachte über diesen Umstand nach, als sie gemeinsam mit Linnet das Heiligtum verließ. Sie hatte gewusst, dass Gelert nicht um seinen König trauerte, aber sie hatte ein größeres Maß an Respekt erwartet.
Linnet legte ihr einen Arm um die Taille. »Lass dich von ihm nicht aus der Fassung bringen, Tochter. Seine Worte entströmen nicht der Wahren Quelle.«
»Er hat mich nicht aus der Fassung gebracht«, log Rhiann.
Aber die Erinnerung an den Ausdruck in Gelerts gelben Eulenaugen ließ sie den ganzen Tag nicht los.
Die bodhran-Trommeln setzten bei Einbruch der Dämmerung ein, hallten donnernd vom Gipfel Dunadds herab und vermischten sich mit den Klängen der Flöten aus Tierknochen und der Hörner.
Die Druiden hielten ihre eigenen Rituale für den Leichnam des Königs ab, denn er hatte ihre Götter verehrt und hatte der Großen Mutter nur wenig Beachtung geschenkt. Daher nahmen Linnet und Rhiann an der Zeremonie auch nicht teil. Rhiann hatte für die Magie der Druiden ohnehin nicht viel übrig, das lag vielleicht daran, dass diese Magie für sie untrennbar mit Gelert und seiner dunklen Seele verbunden war.
Sie und Linnet saßen vor dem Feuer und verzehrten ihr Abendessen, während draußen das Singen und Wehklagen seinen Fortgang nahm. Nun, da die lange Dunkelheit näher rückte, waren bereits die ersten Schafböcke geschlachtet worden, und der dicke, nahrhafte Eintopf wärmte Rhianns Magen, obwohl sie die Bissen nur mühsam herunterbrachte.
An diesem Tag hatte Brica die alten Binsen, die den Lehmboden bedeckten, durch frische ersetzt, und das Haus duftete angenehm nach Kräutern und den Torfballen, die im Kamin flackerten.
Rhiann musste an die Gemächer des Königs denken, in denen es stets nach Blut und halb garem Fleisch roch und wo die Wände mit glänzenden Speeren und Schilden bedeckt waren. Die Lehmmauern ihres aus einem einzigen Raum bestehenden Rundhauses schmückten die Wandbehänge, die ihre Mutter eigenhändig gewebt hatte. Gebündelte Kräuter und Netze mit Wurzeln hingen von den Balken herab. Vor dem Feuer lag eine Tasche aus Hirschleder, an der gerade genäht wurde, neben der Tür lehnten einige schlammverschmierte Stöcke, die ihr zum Ausgraben der Wurzeln dienten, darüber hingen Webscheren und Messer, deren Klingen in heiligen Quellen geweiht worden waren, zum Schneiden von Kräutern. Auf einem niedrigen Regal reihten sich kleine hölzerne Statuen der Großen Mutter.
Im ganzen Haus war kein Jagdspeer und kein Schild zu finden; kein Zaumzeug wartete darauf, geflickt zu werden, keine halb fertig gestellten bracae-Hosen lagen auf dem Webstuhl neben der Tür.
Aber wie lange würde das noch so bleiben? Bald würde ein Mann in ihr Heim eindringen. Und in sie selbst.
Kapitel 4
Noch immer jagten tief hängende Wolkenfetzen über den Himmel hinweg, der im Morgengrauen die Farbe kalter Asche angenommen hatte. Eremon saß alleine im Bug des Bootes.
Eremon, Sohn des Ferdiad. Rechtmäßiger König des Volkes von Dalriada in Erin.
Eremons Mundwinkel verzogen sich bitter. König über nichts und niemanden traf es besser. Dann wanderte sein Blick zu seinen im Heck zusammengedrängten Männern. Immerhin war er König von zwanzig treuen Gefährten.
Er blinzelte über die Wellen hinweg, die jetzt leise plätschernd gegen den Rumpf des Bootes schlugen und es auf die Küste zutrieben. Der Sturm lag einen Tag und eine Nacht zurück, und jetzt war klar, dass sie sich irgendwo im Norden der Küste von Alba befanden und nicht auf die offene See hinausgeweht worden waren.
Der Westwind brachte einen beißenden Salzgeruch mit sich, aber in der windstillen Stunde vor Einbruch der Dämmerung hatte Eremon auch den Geruch nach feuchten Kiefern und nasser Erde wahrgenommen. Ganz in ihrer Nähe musste Land sein.
Geistesabwesend kraulte er Cùs Ohren. Er fühlte sich zu mutlos und verzagt, um neue Hoffnung zu schöpfen. Plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf, und er richtete sich auf. Obwohl sein Schicksal und das seiner Männer besiegelt schien, hatten sie den Sturm überlebt und steuerten Land an. Vielleicht hatte Manannán dieses Unwetter geschickt, um ihn, Eremon, auf die Probe zu stellen; sich davon zu überzeugen, dass er würdig und fähig war, den Thron seines Vaters zurückzuerobern und über Dalriada zu herrschen. Vielleicht konnte er doch noch die Gunst der Götter gewinnen.
Eremons Hand blieb still auf Cùs warmem Kopf liegen, seine Augen begannen zu leuchten. Der Sturm war demnach die erste Prüfung gewesen – weitere würden folgen. Und er würde jede einzelne davon bestehen, bis er nach Erin zurückkehren konnte, um seinen Onkel, den Thronräuber Donn Braunbart, zu töten. Einen Moment lang malte er sich genüsslich aus, wie sein Schwert aufblitzte und sich in die Kehle seines um Gnade winselnden Onkels fraß.
»He, wach auf!« Conaire wedelte mit einer Hand vor Eremons Augen herum, dann hockte er sich neben ihm nieder und reichte ihm ein Stück feuchtes Brot. Cù klopfte mit dem Schwanz auf das Deck, hob den Kopf, schnupperte und rollte sich dann wieder erschöpft zusammen.
Eremon streichelte ihn nachdenklich, dabei beäugte er das bröckelige Brot mit plötzlich aufkeimendem nagendem Hunger. Immerhin hatte er seit zwei Tagen nichts mehr in den Magen bekommen. Er brach ein Stück ab, schob es in den Mund und kaute schweigend.
»Ich hatte nicht mehr zu hoffen gewagt, dass wir diesen Sturm überstehen«, bemerkte Conaire. Er zögerte, dann knurrte er: »Du hattest Recht, was das Rudern betraf.«
Eremon schnaubte und entfernte ein paar Gerstenkörner, die zwischen seinen Zähnen klebten. Das Unwetter bestand in seiner Erinnerung nur noch aus einem verschwommenen Nebel aus Wind, Regen und nacktem Entsetzen. Er wusste, dass sie der Grenze zur Schattenwelt bedenklich nahe gekommen waren, und obwohl die Druiden stets behaupteten, dass diese Welt keinerlei Schrecken barg, war ihm erst an der Schwelle des Todes klar geworden, wie sehr er am Leben hing. Er musterte Conaire verstohlen. Sein Ziehbruder würde sich schwerlich mit solchen Gedanken herumschlagen.
Dann sah er zu seinen Männern hinüber, die ihre Brotrationen verzehrten. Sie waren durchnässt, erschöpft und mit Schrammen und Prellungen übersät, aber sie hatten den Sturm weitgehend unversehrt überstanden. Dafür sollte er den Göttern dankbar sein und es dabei belassen. Er wandte sich an Conaire. Ein mutwilliger Funke tanzte in seinen Augen. »Du gibst aus freien Stücken zu, dass ich Recht hatte? Dir muss der Mast auf den Kopf gefallen sein.«
Conaire grinste nur und streckte seine langen Beine auf den Planken aus.
Die beiden Männer gaben ein ungewöhnliches Paar ab. Conaire war schon als Kind ein Hüne mit Haar von der Farbe reifer Gerste und den großen blauen Augen seines Volkes gewesen. Neben ihm war sich Eremon stets zu dunkel und zu mager vorgekommen. Seine eigenen Augen schimmerten seegrün – ein Erbe seiner walisischen Mutter, genau wie sein dunkelbraunes Haar, das einem Nerzpelz glich. Beides unterschied ihn von anderen Menschen, obwohl er es hasste, anders zu sein.
Als Junge hatte Conaire seine übersprudelnde Lebensfreude kaum bezähmen können. Eremons Wesen war eine solche Ausgelassenheit fremd, umso mehr, als ihm bewusst wurde, dass er ein Prinz war und eines Tages König sein würde. Conaires Vater war nur ein Viehbauer, und Conaire fiel es nicht schwer, seine Erwartungen zu erfüllen: keinem Kampf aus dem Weg zu gehen, immer einen zotigen Scherz auf den Lippen zu führen, zahllose Humpen Ale zu vertragen und sich mit einer Frau zu vergnügen, sobald er körperlich dazu im Stande war – was in Conaires Fall schon vor seinem elften Geburtstag der Fall gewesen war.
Aber Conaire verfügte über eine Eigenschaft, die sein derber, grobschlächtiger Vater nicht unbedingt gutgeheißen hätte – er spürte es stets, wenn Eremon trüben Gedanken nachhing. Deswegen klopfte er sich jetzt auch ein paar Krümel von den Schenkeln und schlug Eremon dann kameradschaftlich auf die Schulter. »Wann bekommen wir denn endlich wieder festen Boden unter die Füße, Bruder? Meine Eier verfärben sich allmählich blau!«
Der Schlag war so kräftig, dass Eremon sich verschluckte und hustend nach Luft rang. Als er wieder zu Atem gekommen war, war der dumpfe Schmerz über den Verrat seines Onkels und den Verlust seiner Heimat verflogen. Mit Donn würde er später abrechnen. Zuerst musste er sich um wichtigere Dinge kümmern.
Er räusperte sich. »Vielleicht sollten wir erst einmal herauszufinden versuchen, wo wir uns genau befinden.«
»Stimmt.« Conaire sprang über die Ruderbank hinweg und war mit drei Sätzen bei dem Fischer angelangt, der missmutig an einem Stück Brot knabberte.
Eremon registrierte nicht zum ersten Mal, wie behände sich sein Bruder trotz seiner Statur bewegte. Manchmal, nur manchmal wünschte er sich, er wäre wie Conaire. Dann könnte er den Befehlen eines anderen Mannes Folge leisten, statt selbst welche erteilen zu müssen; er könnte hinter dem Banner eines anderen in die Schlacht ziehen und sich auf den Kampf konzentrieren, ohne einen Gedanken an Strategie und Taktik verschwenden zu müssen. Ah, sich einfach nur in der Hitze der Schlacht zu verlieren ...