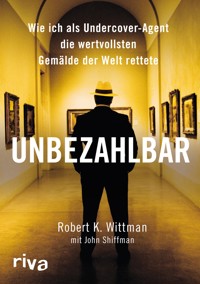15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Tagebücher des Vordenkers der NSDAP
Einst waren sie wichtiges Belastungsmaterial in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen: die Tagebücher des NS-Chefideologen und Reichsministers Alfred Rosenberg. Jahrzehntelang galt dieses Schlüsseldokument zum Verständnis des Nationalsozialismus als verschollen. Bis der Hauptarchivar des US Holocaust Memorial Museum, der hartnäckig nach den Tagebüchern forschte, erstmals einen Hinweis auf den Verbleib der Dokumente erhielt: Allem Anschein nach hatte einer der Hauptankläger der Alliierten die Rosenberg-Papiere 1946 entwendet. Erst dank der Findigkeit des FBI-Ermittlers Robert K. Wittman werden an einem Frühlingsmorgen 2013 die 425 losen Seiten in der Handschrift Alfred Rosenbergs nach Washington, D. C., überstellt. Erstmals beschreibt Wittman die Jagd nach den Tagebüchern und analysiert die Schlüsselstellen zum Holocaust und zum Vernichtungskrieg im Osten – ein zeitgeschichtlicher Thriller, ein einzigartiges historisches Dokument.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Einst waren sie wichtiges Belastungsmaterial in den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen: die Tagebücher des NS-Chefideologen und Reichsministers Alfred Rosenberg. Jahrzehntelang galt dieses Schlüsseldokument zum Verständnis des Nationalsozialismus als verschollen. Bis der Hauptarchivar des US Holocaust Memorial Museum, der hartnäckig nach den Tagebüchern forschte, erstmals einen Hinweis auf den Verbleib der Dokumente erhielt: Allem Anschein nach hatte einer der Hauptankläger der Alliierten die Rosenberg-Papiere 1946 entwendet. Erst dank der Findigkeit des FBI-Ermittlers Robert K. Wittman werden an einem Frühlingsmorgen 2013 die 425 losen Seiten in der Handschrift Alfred Rosenbergs nach Washington, D. C., überstellt. Erstmals beschreibt Wittman die Jagd nach den Tagebüchern und analysiert die Schlüsselstellen zum Holocaust und zum Vernichtungskrieg im Osten – ein zeitgeschichtlicher Thriller, ein einzigartiges historisches Dokument.
Die Autoren
Robert Wittman, geboren 1955, war von 1988 bis 2008 verdeckter Ermittler beim FBI und gründete dort die erste Sondereinheit für Fälle von Kunstkriminalität. Im Laufe seiner Karriere konnte Wittman zahlreiche kunst- und kulturhistorisch bedeutsame Objekte ihren Eigentümern zuführen, darunter auch ein Original der amerikanischen Verfassungsurkunde Bill of Rights. Wittman ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von Philadelphia, USA.
David Kinney schreibt als Journalist regelmäßig für die New York Times, den Boston Globe und die Washington Post. Im Jahr 2005 war er einer der Pulitzer-Preisträger. Kinney lebt bei Philadelphia, USA.
Robert K. Wittman
David Kinney
Die Rosenberg-Papiere
Die Suche nach den verschollenen Tagebüchern von Hitlers Chefideologen Alfred Rosenberg
Aus dem Amerikanischen von Martin Bayer und Karin Schuler
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Die Verlagsgruppe Random House weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags für externe Links ist stets ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel The Devil’s Diary. Alfred Rosenberg and the Stolen Secrets of the Third Reich bei HarperCollins, New York.
Copyright © 2016 by Robert K. Wittman and David Kinney, published by arrangement with Harper, an imprint of HarperCollins Publishers, LLC
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Fotos von © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-16443-0V001
www.heyne.de
INHALT
Prolog: Das Kellergewölbe
Verschollen und gefunden: 1949–2013
1. Der Kreuzritter
2. »Alles weg«
3. »Der Blick auf die Denkweise einer finsteren Seele«
Leben in der Schwebe: 1918–1939
4. »Stiefkinder des Schicksals«
5. »Die meistgehaßte Zeitung im Land!«
6. Die Nacht bricht herein
7. »Rosenbergs Weg«
8. Das Tagebuch
9. »Schlaue Planung und glückliche Zufälle«
10. »… dass die Zeiten für mich noch nicht reif sind«
11. Exil in der Toskana
12. »Ich hatte das Herz der alten Partei gewonnen«
13. Flucht
Im Krieg: 1939–1946
14. »Die Last der kommenden Dinge«
15. Neuanfang
16. Diebe in Paris
17. »Rosenberg, jetzt ist Ihre große Stunde gekommen«
18. »Sonderaufgaben«
19. »Unser besonders tragisches Schicksal«
20. Die Nazis nebenan
21. Das Chaostministerium
22. »Eine Ruine«
23. »Loyal bis zum Ende«
Epilog
Anhang
Dank
Auswahlbibliografie
Archivmaterial
Aufsätze
Bücher
Anmerkungen
Nationalsozialistische Anhänger begrüßen Alfred Rosenberg (in der Bildmitte die Hand hebend) in Heiligenstadt, Thüringen, 1935.
(ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)
PROLOG: DAS KELLERGEWÖLBE
Hoch ragt das Kloster Banz über einer bezaubernden bayerischen Hügellandschaft auf, die so schön ist, dass man sie »Gottesgarten« nennt.
Von den Dörfern und Höfen am in der Ebene mäandernden Fluss wandern die Blicke unwillkürlich immer wieder zu Kloster Banz hinauf. Die ausladenden Steinmauern schimmern im Sonnenlicht golden, und zwei sich grazil verjüngende Türme mit kupferverkleideten Dächern erheben sich über seiner Barockkirche. Das Gebäude blickt auf eine mehr als tausendjährige Geschichte zurück: als Handelsposten, als befestigte Burg, die verschiedenen feindlichen Heeren standhielt, als Benediktinerkloster. Es war in Kriegen geplündert und zerstört und für die Wittelsbacher aufwendig wieder aufgebaut worden. Es hatte Könige und Herzöge beherbergt. Einmal hatte sogar Kaiser Wilhelm II., der letzte deutsche Kaiser, den reich geschmückten Sälen die Ehre gegeben. Jetzt, im Frühjahr 1945, diente das Gemäuer als Depot des Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg, der das besetzte Europa ausgeplündert hatte.
Als die Niederlage nach sechs langen Kriegsjahren nicht länger aufzuhalten war, hatten die Nationalsozialisten überall in Deutschland zahllose Akten vernichtet, bevor die Dokumente in die Hände der Alliierten fallen und gegen sie verwendet werden konnten. Doch es gab auch Bürokraten, die es nicht über sich brachten, ihre Papiere zu vernichten. Sie versteckten sie in Wäldern, Minen, Burgen und Schlössern wie diesem. Im ganzen Land stießen die Alliierten später auf riesige Geheimarchive: ausführliche interne Unterlagen, die Licht in die verworrene deutsche Bürokratie brachten, in die gnadenlose Kriegsstrategie des Militärs und in den wahnhaften Plan der Nationalsozialisten, Europa von »unerwünschten Elementen« zu säubern, endgültig und für immer.
In der zweiten Aprilwoche überrannte die 9. US-Panzerdivision der unter dem Oberbefehl von General George S. Patton stehenden 3. US-Armee die Region. Seit ihrem Rheinübergang ein paar Wochen zuvor stürmten die Männer durch den Westen des geschundenen Landes, aufgehalten nur durch zerstörte Brücken, improvisierte Straßensperren und vereinzelte Feuergefechte.1 Sie zogen an Städten vorbei, die durch alliierte Bomben dem Erdboden gleichgemacht worden waren, an hohläugigen Dorfbewohnern und Häusern, vor denen nicht mehr die Hakenkreuzfahne wehte, sondern weiße Laken und Kissenbezüge. Die Wehrmacht war praktisch verschwunden. Hitler hatte nur noch dreieinhalb Wochen zu leben.
In Banz stießen die einrückenden Amerikaner auf einen extravaganten Adligen mit Monokel und auf Hochglanz polierten Stiefeln. Kurt von Behr hatte den Krieg in Paris verbracht und dort nicht nur private Kunstsammlungen geplündert, sondern sich auch Möbel und Einrichtungsgegenstände mehrerer Zehntausend jüdischer Haushalte in Frankreich, Belgien und den Niederlanden angeeignet. Kurz vor der Befreiung von Paris flohen er und seine Frau mit dem geraubten Schatz in einem Konvoi von elf Autos und vier Umzugswagen in das bayerische Schloss Kloster Banz.2
Jetzt wollte von Behr verhandeln.
In der nahen Stadt Lichtenfels trat er an Samuel Haber, einen Offizier der Militärregierung, heran. Offenbar hatte sich von Behr an ein fürstliches Leben unter den kunstvoll ausgemalten Decken des Schlosses gewöhnt. Wenn Haber ihm die Erlaubnis gebe, dort zu bleiben, werde von Behr ihm ein Geheimversteck mit wichtigen NS-Unterlagen zeigen.3
Das begeisterte den Amerikaner. Informationen aus erster Hand waren heiß begehrt, die Kriegsverbrecherprozesse zeichneten sich ab, und so hatten die alliierten Truppen den Befehl, jedes deutsche Aktenstück, das sie aufspüren konnten, zu sichern. Pattons Armee hatte eine Aufklärungseinheit des militärischen Nachrichtendienstes G-2 mit dieser Aufgabe betraut.4 Allein im April bargen ihre Spezialteams dreißig Tonnen NS-Akten.
Angelo Cali, ein Leutnant der Einheit, fuhr also den Berg hinauf und durch die Schlosstore, um sich mit von Behr zu treffen.5 Der Nazi führte ihn fünf Stockwerke in den Berg hinein, wo versiegelt hinter einer falschen Betonmauer ein gewaltiger Schatz vertraulicher Unterlagen versteckt war. Die Akten füllten ein riesiges Kellergewölbe. Was nicht mehr hineingepasst hatte, lag aufgestapelt im Vorraum.
Nachdem er sein Geheimnis preisgegeben hatte, traf von Behr, dem offenbar klar geworden war, dass sein Schachzug ihn nicht vor den verheerenden Folgen der demütigenden Niederlage Deutschlands bewahren würde, seine Vorbereitungen, um die Bühne stilvoll zu verlassen. Er legte eine seiner extravaganten Uniformen an und begleitete seine Frau zu der Bibliothek des Klosters. Dort erhoben sie die mit französischem Champagner und Zyanid gefüllten Sektflöten und stießen auf das Ende an. »Die Episode besaß«, so schrieb eine amerikanische Korrespondentin, »all jene melodramatischen Elemente, an denen die NS-Funktionäre offenbar so großen Gefallen fanden.«
Soldaten fanden von Behr und seine Frau leblos in ihrer luxuriösen Heimstatt. Bei der Untersuchung der Todesumstände stießen sie auch auf die halb leere Flasche, die noch auf dem Tisch stand.
Das Paar hatte einen symbolträchtigen Jahrgang gewählt: 1918, das Jahr, in dem ihr geliebtes Heimatland nach dem Ende eines anderen Weltkriegs daniederlag.6
Die Papiere im Kellergewölbe gehörten Alfred Rosenberg, einem Gründungsmitglied der NSDAP, der zu Hitlers Chefideologen aufgestiegen war. Rosenberg war ein Zeuge der ersten Tage der Partei im Jahr 1919, als der Weltkriegsveteran Adolf Hitler seine ersten öffentlichen Auftritte absolvierte. 1933 war Rosenberg zur Stelle, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen und begannen, ihre Feinde zu vernichten. Er stand in der Arena und kämpfte, als die Nationalsozialisten ganz Deutschland nach ihrem Bilde neu schufen. Und er war bis zum Ende da, als das Kriegsglück sich wendete und die ganze Ideologie in sich zusammenbrach.
Bei der Sichtung des riesigen Konvoluts – 250 Bände amtlicher und persönlicher Korrespondenz – stießen die Ermittler auf einen besonderen Schatz: Rosenbergs persönliche Tagebücher.
Sie füllten handschriftlich mehr als 500 Seiten, darunter einige Einträge in einem gebundenen Notizbuch, die meisten aber auf losen Blättern. Sie setzten 1934, im zweiten Jahr der Hitler-Regierung, ein und endeten ein Jahrzehnt später, ein paar Monate vor Kriegsende. Unter den führenden Größen des Dritten Reiches hinterließen nur Rosenberg, Propagandaminister Joseph Goebbels und Hans Frank, der brutale Generalgouverneur des besetzten Polen, Tagebücher. Die anderen, Hitler eingeschlossen, nahmen ihre Geheimnisse mit ins Grab. Rosenbergs Tagebücher konnten, so hoffte man, aus der Perspektive eines Mannes, der ein Vierteljahrhundert lang in den obersten Rängen der NSDAP gewirkt hatte, Licht auf die Funktionsmechanismen des Dritten Reiches werfen.
Außerhalb Deutschlands war Rosenberg nie so bekannt wie Goebbels oder Heinrich Himmler, der führende Kopf der SS, oder auch Hermann Göring, Hitlers Wirtschaftschef und Kommandeur der Luftwaffe. Rosenberg musste sich mit Zähnen und Klauen gegen diese Giganten der Nazi-Bürokratie wehren, um jene Macht zu erringen, die er seiner Meinung nach verdiente. Aber er hatte vom Anfang bis zum Ende Hitlers Unterstützung. Sie stimmten in den grundlegenden Fragen völlig überein, und Rosenberg war Hitler stets treu ergeben. Dieser vertraute ihm immer wieder führende Positionen an, was Rosenbergs weitreichenden Einfluss sicherte. Seine Rivalen in Berlin hassten ihn, doch viele Parteimitglieder sahen in Rosenberg eine der wichtigsten politischen Gestalten Deutschlands: Er galt als ein großer Denker, der bei Hitler immer ein offenes Ohr fand.
Rosenberg war, wie sich später herausstellte, an nicht wenigen besonders berüchtigten Verbrechen Nazi-Deutschlands beteiligt.
Er organisierte den Diebstahl von Kunstwerken, Archiven und Bibliotheken von Paris bis Krakau und Kiew – jenes Beutegut, das die Männer der amerikanischen Monuments, Fine Arts, and Archives Section (MFAA) später in Deutschlands Schlössern und Salzstöcken aufspüren sollten.
1920 pflanzte Rosenberg Hitler die heimtückische Idee ein, dass eine jüdische Weltverschwörung hinter der kommunistischen Revolution in Russland stecke, und wiederholte sie immer wieder. Er war der wichtigste Verfechter einer Theorie, die Hitler zwei Jahrzehnte später nutzte, um Deutschlands verheerenden Krieg gegen die Sowjetunion zu rechtfertigen. Wenige Monate bevor die deutschen Truppen in der Sowjetunion einfielen, sprach Rosenberg davon, dass der Krieg eine »säubernde biologische Weltrevolution darstellt«.7 Während des Krieges, als die deutschen Armeen die Rote Armee bis kurz vor Moskau zurückgedrängt hatten, führte Rosenberg eine Besatzungsbehörde, die die baltischen Staaten, Weißrussland und die Ukraine terrorisierte, und sein Ministerium arbeitete mit Himmlers Völkermördern zusammen, die die Juden überall im Osten zu vernichten suchten.8
Nicht zuletzt legte Rosenberg auch die ideologischen Fundamente für den Holocaust. Sein fanatischer Antisemitismus war seit 1919 das Thema zahlloser Publikationen; als Chefredakteur der Parteizeitung Völkischer Beobachter und Autor von Artikeln, Pamphleten und Büchern verbreitete er die Hassbotschaft der Partei. 1933 wurde er außerdem »Beauftragter des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der NSDAP«. Sein theoretisches Hauptwerk Der Mythus des 20. Jahrhunderts hatte eine Auflage von mehr als einer Million Exemplaren und galt neben Hitlers Mein Kampf als zentraler Text der nationalsozialistischen Ideologie. In seinem dickleibigen Wälzer übernahm Rosenberg antiquierte Vorstellungen von Rasse und Weltgeschichte von anderen Pseudointellektuellen und verschmolz sie zu einem eigenwilligen politischen Glaubenssystem. Gauleiter der Partei berichteten, dass sie Tausende von Reden mit seinen Worten vor Augen gehalten hätten. »Hier fanden sie Richtung und Material zum Kampf gemeinsam«, rühmte sich Rosenberg in seinem Tagebuch.9 Rudolf Höß, Kommandant des Todeslagers Auschwitz, in dem über eine Million Menschen vernichtet wurden, sagte, vor allem die Worte dreier Männer hätten ihn psychologisch auf seine Mission vorbereitet: Hitler, Goebbels und Rosenberg.10
Im Dritten Reich konnte ein Ideologe die praktische Umsetzung seiner Philosophien erleben, und Rosenbergs Ideen zeitigten tödliche Folgen.
»Immer wieder fasst mich die Wut, wenn ich mir überlege, was dieses jüdische Parasitenvolk Deutschland angetan hat«, schrieb er 1936 in sein Tagebuch. »Jedenfalls habe ich aber eine Befriedigung: hier das meine zur Aufdeckung dieses Verrats beigetragen zu haben.«11 Rosenbergs Ideen legitimierten und begründeten die Ermordung von Millionen Menschen.
Im November 1945 trat in Nürnberg der Internationale Militärgerichtshof zusammen, um die berüchtigtsten überlebenden Nationalsozialisten wegen ihrer Kriegsverbrechen vor Gericht zu stellen – unter ihnen auch Rosenberg. Die Anklage beruhte auf der Unmenge deutscher Unterlagen, die den Alliierten bei Kriegsende in die Hände gefallen waren. Hans Fritzsche, der wegen seiner Funktion als Leiter der Rundfunkabteilung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda als Kriegsverbrecher vor Gericht stand, berichtete einem Gefängnispsychiater während des Prozesses, dass Rosenberg eine entscheidende Rolle bei der Bildung der philosophischen Vorstellungen Hitlers in den 1920er-Jahren gespielt habe, bevor die Nationalsozialisten an die Macht kamen. »Meiner Ansicht nach hatte er einen gewaltigen Einfluss auf Hitler, in der Zeit, als Hitler noch über dies und jenes nachdachte«, sagte Fritzsche, der in Nürnberg freigesprochen, von einer deutschen Spruchkammer im Rahmen der Entnazifizierung dann aber zu neun Jahren Arbeitslager verurteilt wurde. »Rosenbergs Bedeutung besteht darin, dass seine Ideen, die rein theoretischer Natur waren, in den Händen Hitlers Realität annahmen und konkret wurden. … Die Tragik dabei ist, dass Rosenbergs Fantasietheorien wirklich in die Tat umgesetzt wurden.«
Rosenberg, so sagte er, trage in mancher Hinsicht »von allen, die hier auf der Anklagebank sitzen, die Hauptschuld«.12
In Nürnberg bezeichnete Robert Jackson, der Hauptanklagevertreter der Amerikaner, Rosenberg als den »geistige[n] Priester der ›Herrenrasse‹«.13 Die Richter befanden ihn schuldig, und am 16. Oktober 1946 endete Rosenbergs Leben mitten in der Nacht in der Schlinge eines Stranges.
In späteren Jahrzehnten beugten sich Historiker, die versuchten, das Wie und Warum der größten Katastrophe des Jahrhunderts zu verstehen, über die umfangreichen Dokumente, die die Alliierten bei Kriegsende geborgen hatten. Forscher beschäftigten sich mit vertraulichen Militärberichten, ausführlichen Beuteinventaren, privaten Tagebüchern, Dokumenten, Abschriften von Telefongesprächen, schaurigen bürokratischen Notizen, in denen der Massenmord abgehandelt wurde. Nach dem Ende der Nürnberger Prozesse im Jahr 1949 schlossen die amerikanischen Ankläger ihre Büros, und alle beschlagnahmten deutschen Dokumente wurden per Schiff in eine alte Torpedofabrik am Ufer des Potomac in Arlington, Virginia, gebracht. Dort wurden sie für die Aufnahme ins amerikanische Nationalarchiv vorbereitet. Man fertigte Kopien an, und schließlich wurden die meisten Originale nach Deutschland zurückgegeben.
Der Hauptteil der geheimen Rosenberg-Tagebücher aber ging irgendwie verloren. Sie kamen nie in Washington an. Sie wurden nie in ihrer Gesamtheit abgeschrieben, übersetzt und ausgewertet. Wenige Jahre nachdem sie aus dem bayerischen Schlosskeller ans Licht gekommen waren, verschwanden die Tagebücher wieder.
VERSCHOLLEN UND GEFUNDEN
1949–2013
Robert Kempner im Nürnberger Justizpalast
(U.S. Holocaust Memorial Museum, courtesy of John W. Mosenthal)
1
Der Kreuzritter
Vier Jahre nach dem Ende des Krieges wartete in Gerichtssaal 600 des Nürnberger Justizpalastes ein Ankläger auf die Verkündung der letzten Urteile gegen die nationalsozialistischen Kriegsverbrecher, die von den Amerikanern vor Gericht gestellt worden waren. Für diese Verurteilungen hatte Robert Kempner alles gegeben.
Der neunundvierzigjährige Anwalt, kampflustig, hartnäckig, ein unermüdlicher Netzwerker mit einem Sinn für Intrigen, war immer mit hochgerecktem Kinn durchs Leben gegangen, als wolle er seine Gegner – und davon gab es viele – einladen, sich mit ihm anzulegen. Körperlich fiel er mit seinen 1,65 Metern und dem zurückweichenden Haaransatz zwar nicht besonders auf, doch Kempners Persönlichkeit polarisierte. Es war Ansichtssache, ob er nun charismatisch oder prahlerisch war, engagiert oder dogmatisch, ein Vorkämpfer der gerechten Sache oder ein kleiner Rüpel.
Kempner hatte fast zwanzig Jahre lang gegen Hitler und die Nazis gekämpft, die letzten vier Jahre in dieser Stadt, die durch die Megalomanie des »Führers« und die Bomben der Alliierten zerstört worden war. Sein Bemühen prägte seine einzigartige, persönliche Geschichte und war gleichzeitig ein universal gültiges Narrativ: der Kampf um sein Leben und gleichzeitig seine eigene Rolle in der globalen Auseinandersetzung seiner Zeit. Anfang der 1930er-Jahre, als Beamter im Reichsinnenministerium in Berlin, trat Kempner dafür ein, Hitler wegen Hochverrats vor Gericht zu stellen und die NSDAP zu verbieten. Nur wenige Tage nach der »Machtergreifung« im Jahr 1933 verlor Kempner – Jude, Sozialdemokrat und ein erklärter Gegner der Nationalsozialisten – seine Stelle. Nach kurzer Haft und Befragung durch die Gestapo im Jahr 1935 floh er nach Italien, dann nach Frankreich und schließlich in die Vereinigten Staaten, wo er seinen Feldzug gegen die Nazis fortsetzte. Unter Rückgriff auf eine Sammlung vertraulicher Dokumente und ein Netzwerk von Informanten half Kempner dem amerikanischen Justizministerium, NS-Täter ins Gefängnis zu bringen, und sammelte Informationen über das Dritte Reich für das Kriegsministerium, dessen Nachrichtendienst Office of Strategic Services und J. Edgar Hoovers Federal Bureau of Investigation (FBI).
Bei Kriegsende kehrte Kempner in sein Heimatland zurück und half, ebenjene Männer strafrechtlich zu verfolgen, die ihn entlassen, ihn als Juden verfolgt, ihm die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen und ihm nach dem Leben getrachtet hatten.
Nachdem Göring, Rosenberg und die anderen Größen des Dritten Reiches im Hauptkriegsverbrecherprozess verurteilt worden waren, war Kempner bei den zwölf Nachfolgeprozessen, die die Amerikaner gegen weitere 185 NS-Kriegsverbrecher anstrengten, in Nürnberg: Ärzte, die an Häftlingen in den Konzentrationslagern grausame Experimente durchgeführt hatten, Angehörige der SS, die Häftlinge zu Tode geschunden hatten, Firmenchefs, die von Zwangsarbeit profitiert hatten, Kommandeure der Einsatzgruppen, die in ganz Osteuropa während des Kriegs Zivilisten ermordet hatten, hohe Militärs, Minister und Regierungsbeamte.
Kempner persönlich leitete den vorletzten und längsten Prozess, den »Wilhelmstraßen-Prozess«, der so genannt wurde, weil die meisten Angeklagten führende Positionen in den Regierungsbüros der Ministerien in der Berliner Wilhelmstraße innegehabt hatten. Der bekannteste Angeklagte, Ernst von Weizsäcker, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, bahnte den Weg für den Einfall in die Tschechoslowakei, und man konnte ihm nachweisen, dass er persönlich den Transport von mehr als sechstausend Juden aus Frankreich ins Vernichtungslager Auschwitz genehmigt hatte.
Der berüchtigtste Übeltäter war der Chef des SS-Hauptamts und General der Waffen-SS Gottlob Berger, der für seine Brutalität bekannt war. Auf Bergers Initiative ging die Aufstellung des »SS-Sonderbataillons Dirlewanger« zurück, das zur Partisanenbekämpfung in Weißrussland eingesetzt wurde. »Lieber zwei Polen zuviel als einen zu wenig« zu erschießen, so beschrieb er einst den Grundsatz des Kommandos.14 Der Prozess lief seit Ende 1947 und ging jetzt, am 11. April 1949, endlich seinem Ende entgegen.15 Die drei amerikanischen Richter betraten den Saal, stiegen zur Richterbank empor und begannen, laut ihr Urteil zu verlesen. Es war insgesamt 800 Seiten lang; der Vortrag dauerte drei Tage. Auf der anderen Seite des Saals, bewacht von stocksteif dastehenden Militärpolizisten mit glitzernd silbernen Helmen, hörten die Angeklagten über Kopfhörer den Dolmetschern zu, die das Urteil ins Deutsche übersetzten. Am Ende waren neunzehn der einundzwanzig Angeklagten verurteilt – fünf von ihnen wegen des im Hauptkriegsverbrecherprozess entscheidenden Anklagepunkts des Verbrechens gegen den Frieden. Weizsäcker bekam sieben Jahre Gefängnis, Berger fünfundzwanzig und der Chef der Reichskanzlei Hans Heinrich Lammers zwanzig Jahre.
Für die Anklage war dies ein großer Sieg. Nachdem sie sich mehr als vier Jahre lang durch die Akten gewühlt und Hunderte von Zeugen befragt hatten, konnten sie einige der schlimmsten Verbrecher überführen und ins Gefängnis schicken. Sie hatten der Welt gezeigt, dass eine Mitschuld am Holocaust überall in der deutschen Regierung zu finden war. Sie hatten, wie Kempner es ausdrückte, »das gesamte verbrecherische Fresko« des Dritten Reiches gemalt16 und Nürnbergs Platz in der Geschichte als »einer Festung des Glaubens an das Völkerrecht« bestätigt.17 Sie waren erfolgreich für eine energische Verfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingetreten.
Die Urteile waren für Kempner der Höhepunkt seines langen Feldzugs gegen das NS-Regime.
Oder sie hätten es zumindest sein sollen.
In wenigen Jahren löste sich die Verheißung von Nürnberg in nichts auf.
Die Nürnberger Prozesse hatten von Beginn an ihre Gegner, in Deutschland wie in Amerika. Für die Kritiker stand nicht Gerechtigkeit, sondern Rachsucht im Mittelpunkt der Strafverfolgung, und Kempner, eine schroffe Persönlichkeit, die ausgesprochen aggressive Vernehmungen führte, wurde zu einem Symbol jener vermeintlichen Ungerechtigkeit. Ein typisches Beispiel war die scharfe Befragung des früheren NS-Diplomaten Friedrich Gaus, bei der Kempner drohte, den Zeugen für eine mögliche Anklage wegen Kriegsverbrechen den Russen auszuliefern. Einer seiner amerikanischen Kollegen als Ankläger nannte Kempners Taktik »dumm« und fürchtete, dass er »aus den gemeinen Kriminellen, die in Nürnberg vor Gericht stehen, Märtyrer machen« werde.18 Ein anderer Zeuge, den Kempner ins Kreuzverhör nahm, bezeichnete den Ankläger als »einen überaus Gestapo-ähnlichen Mann«.19
Im Jahr 1948 attackierte der protestantische Landesbischof von Württemberg, Theophil Wurm, Kempner. Wurm behauptete, bei den Gerichtsverfahren seien Ermittlungshäftlinge misshandelt und Unschuldige verurteilt worden. Kempner antwortete mit der Behauptung, all jene, die die Nürnberger Prozesse diskreditierten, seien in Wahrheit »Feinde des deutschen Volkes«.20 Die Auseinandersetzung wurde über die Presse geführt, und bald sah Kempner sich in deutschen Zeitungen an den Pranger gestellt. Er wurde als selbstgerechter jüdischer Exilant auf Rachefeldzug karikiert.21
Selbst der US-Senator Joseph McCarthy, zu dessen Wählerschaft in Wisconsin ziemlich viele Deutsch-Amerikaner zählten, mischte sich ein. Der Senator sprach sich gegen eine Anklage gegen Weizsäcker aus, weil dieser nach Auskunft seiner nicht näher benannten Quellen im Krieg ein wertvoller Undercover-Agent der Amerikaner gewesen sei. McCarthy sagte, die in Nürnberg geführten Prozesse behinderten die Geheimdiensttätigkeit der Vereinigten Staaten in Deutschland, und erklärte dem Senate Armed Services Committee, einem Ausschuss zur parlamentarischen Kontrolle des Kriegsministeriums, im Frühjahr 1949, er wolle den »absoluten Schwachsinn« rund um den Weizsäcker-Prozess gründlich untersuchen. »Ich finde, dieses Komitee sollte sehen, was für Idioten – und ich verwende diesen Ausdruck mit Bedacht – das Militärgericht dort drüben leiten.«22
Letztendlich verurteilten die alliierten Kriegsverbrechergerichte in Deutschland über zweitausend Angeklagte zu Gefängnisstrafen. Viele der von den Amerikanern verurteilten Kriegsverbrecher saßen im Gefängnis Landsberg am Lech, westlich von München, ein. Sehr viele Westdeutsche weigerten sich noch immer, die Legitimität der alliierten Gerichtshöfe anzuerkennen, und betrachteten diese Häftlinge nicht als Kriegsverbrecher, sondern vielmehr als Opfer gesetzwidriger alliierter Gerichte. Das Thema wurde nach der Gründung der Bundesrepublik zu einem wichtigen Streitpunkt, als Amerika, das in Korea Krieg führte und die sowjetischen Pläne in Europa mit wachsendem Unbehagen beobachtete, daran arbeitete, die Bundesrepublik zu einem loyalen und auch wieder bewaffneten Verbündeten zu machen.
Die Realitäten des Kalten Krieges sorgten bald dafür, dass die Leistungen der Ankläger in den Kriegsverbrecherprozessen zunichtegemacht wurden.
Nach einer Überprüfung der Urteile begnadigte der amerikanische Hochkommissar John McCloy 1951 nicht weniger als 89 der in Nürnberg Verurteilten und wandelte 21 der noch nicht vollstreckten 28 Todesurteile in Haftstrafen um. (Unter den sieben Hingerichteten waren auch zwei in den Dachauer Prozessen Verurteilte.) Es dauerte nicht lange und alle Angeklagten, die Kempner im Wilhelmstraßen-Prozess hinter Gitter gebracht hatte, waren wieder frei. Die Haftverkürzungen wurden zwar als Gnadenakte bezeichnet, doch die Deutschen hörten etwas anderes heraus: Die Amerikaner erkannten schließlich doch an, dass die Prozesse ungerecht gewesen waren. Kempner kritisierte die Entscheidung mit deutlichen Worten: »Heute möchte ich eine Warnung aussprechen, dass die vorzeitige Öffnung der Gefängnistore in Landsberg totalitäre subversive Kräfte gegen die Gesellschaft freisetzen wird, die eine Gefahr für die freie Welt darstellen.«23
Seine Warnung stieß auf taube Ohren. Die Amerikaner beugten sich dem politischen Pragmatismus, und bis 1958 waren fast alle Kriegsverbrecher wieder auf freiem Fuß.24
Doch Kempners Kampf war noch lange nicht vorüber. Vier Jahre lang hatte er sich intensiv mit dem Beweismaterial für die NS-Verbrechen beschäftigt und er wusste, dass die Welt selbst nach den Prozessen, die im hellen Scheinwerferlicht der internationalen Presse stattgefunden hatten, noch immer nicht die ganze Wahrheit kannte.
Wütend über die revisionistische Geschichtsschreibung, mit der die überlebenden Repräsentanten des NS-Regimes versuchten, sich die Geschichte Deutschlands unter den Nazis anzueignen, wandte er sich an die Presse. »Mit mehr oder weniger unverblümter Sehnsucht nach der Vergangenheit«, so schrieb Kempner in der New York Herald Tribune, »erzählen viele politische Autoren in Deutschland ihrem Volk, dass Deutschland es geschafft hätte, wenn der ›Führer‹ nicht ein wenig aus dem Ruder gelaufen wäre.«25 Er wollte davon nichts hören. Er beklagte die engelsgleichen Fotos von Hitler in der rechten Presse, die Behauptungen, die Generäle hätten Deutschland vor der Schande der Niederlage bewahren können, wenn Hitler sich nicht in militärische Angelegenheiten eingemischt hätte, die beschönigenden Bemühungen der Nazi-Diplomaten.
Er forderte die Veröffentlichung der Fakten, die in Nürnberg ans Licht gekommen waren, in Deutschland. »Dies ist der einzige Weg, die systematische Vergiftung des deutschen Denkens zu bekämpfen, die direkt unter unseren Augen in der jungen deutschen Republik vor sich geht.«
Kurz bevor er diese Worte niederschrieb, hatte der Ankläger allerdings etwas getan, das diesem Geist der Offenheit völlig widersprach. Kempner hatte nach den Nürnberger Prozessen wichtige deutsche Originaldokumente mit nach Hause genommen – und falls überhaupt Kopien dieser Originale existierten, wusste jedenfalls niemand mehr, wo sie sich befanden.
In seiner Funktion als Ankläger hatte Kempner das Recht, jedes Dokument, das er für die Vorbereitung seiner Anklage einsehen wollte, anzufordern. Bei mehr als einer Gelegenheit kamen Fragen zu seinem Umgang mit den Papieren auf. Am 11. September 1946 schrieb der Leiter der Archivabteilung in einer Aktennotiz, Kempners Büro habe fünf Dokumente ausgeliehen und sie nicht zurückgegeben. »Ich möchte hinzufügen, dass es durchaus nicht das erste Mal ist, dass diese Abteilung beträchtliche Mühe hatte, Dr. Kempner dazu zu bringen, ausgeliehene Bücher und Dokumente zurückzugeben.«26
Traurige Berühmtheit erlangte Kempner im Team der amerikanischen Ankläger im Jahr 1947 wegen seines Umgangs mit dem weitaus bekanntesten erhaltenen Holocaust-Dokument. Nicht lange nach seiner Rückkehr nach Nürnberg für die zweite Prozessrunde ließ Kempner seine Mitarbeiter die Akten des deutschen Außenministeriums sichten, die aus ihrem Versteck im Harz geborgen, nach Berlin gebracht und auf Mikrofilm gespeichert worden waren. Eines Tages stieß eine Hilfskraft auf ein fünfzehn Seiten langes Dokument, mit Schreibmaschine geschrieben und abgelegt. Es begann mit den Worten: »An der am 20.1.1942 in Berlin, Am Großen Wannsee Nr. 56/58, stattgefundenen Besprechung über die Endlösung der Judenfrage nahmen teil …« Das Protokoll der Wannsee-Konferenz dokumentierte ein Treffen unter der Leitung von Reinhard Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamts, bei dem die »Evakuierung der Juden nach dem Osten« besprochen wurde. 27
Ein paar Monate nach der Entdeckung des Protokolls stürmte Charles LaFollette in das Büro des amerikanischen Anklägers Benjamin Ferencz. »Diesen Hurensohn bringe ich um!« LaFollette war Ankläger in einem anderen der späteren Nürnberger Prozesse, bei dem es um Nazi-Richter und -Anwälte im Dienst des Reichsjustizministeriums ging. LaFollette hatte vom Protokoll der Wannsee-Konferenz gehört, aber Kempner wollte es nicht herausrücken. Es herrschte eine unterschwellige Rivalität zwischen den vielen Anklägern in Nürnberg, und Kempner wollte das brisante Dokument vermutlich in dem Prozess vorstellen, den er gerade vorbereitete.
Ferencz ging hinüber in Kempners Büro, um nachzuhaken. Kempner leugnete, irgendetwas zurückzuhalten. Aber Ferencz ließ nicht locker. Und schließlich, nach weiterem intensivem Nachfragen, öffnete Kempner die unterste Schublade seines Schreibtischs und fragte ganz unschuldig: »Meint er vielleicht das hier?«
LaFollette erkannte sofort, wie wichtig das Dokument für seinen Fall war: Das Reichsministerium der Justiz hatte einen Vertreter zu diesem entscheidenden Treffen geschickt. Sofort stürmte LaFollette los, um Telford Taylor, dem Chefankläger der Prozesse, den Zwischenfall zu melden und zu fordern, dieser möge »den Bastard feuern!« Ferencz folgte ihm und übernahm Kempners Verteidigung. Er erklärte Taylor, dass der Wilhelmstraßen-Prozess sicher scheitern werde, falls Kempner Nürnberg verlassen müsse. Außerdem habe Kempner das Dokument nur versehentlich zurückgehalten.
»Was niemand glaubte«, wie Ferencz in einem Brief an Kempner schrieb.28 Dennoch stellte sich Taylor hinter seinen Ankläger im Wilhelmstraßen-Prozess.
Kempner war nicht der Einzige in Nürnberg, der Originaldokumente der Nazis zum privaten Gebrauch einfach so zu den Akten nahm. Seit Kriegsende hatte man die erbeuteten Dokumente zwischen Military Document Centers hin und her geschickt, sie nach Paris, London und Washington geflogen, wo Geheimdiensteinheiten sich mit ihnen befassten, und sie für die Kriegsverbrecherprozesse nach Nürnberg gebracht. Während die Akten quer durch Europa reisten, fanden Souvenirjäger mehr als genug Möglichkeiten, Papiere mit NS-Briefköpfen zu stehlen, die unter dem allgegenwärtigen Parteigruß »Heil Hitler!« von irgendeiner Nazi-Größe unterschrieben worden waren. Die für die Aufbewahrung der Dokumente Verantwortlichen hatten dabei vor allem die Anklagevertretung in Nürnberg im Auge. Sie fürchteten, dass diejenigen, die Papiere anforderten, »eher durch private journalistische Instinkte beeinflusst waren als durch einen Wunsch, die Sache des Rechts voranzubringen«, wie es ein Offizier in einer Aktennotiz ausdrückte.29 Ein anderer Beobachter kam zu dem Schluss, die Archivabteilung der Anklage in Nürnberg tue kaum etwas, um den Fluss der Dokumente im Auge zu behalten.
So verschwand zum Beispiel ein Memorandum aus der Feder von Hitlers Militäradjutanten Friedrich Hoßbach, die sogenannte »Hoßbach-Niederschrift«, die zeigte, dass Hitler schon 1937 einen Angriffskrieg plante; die Ankläger mussten sich im Prozess auf eine notariell beglaubigte Abschrift stützen. Im September 1946 weigerten sich die Verwalter eines der Military Document Centers, weiter Originale an die Anklagevertreter in Nürnberg auszuleihen, weil sie fürchteten, dass sie die tausend Beweisstücke, die sie schon ausgehändigt hatten, nie wiederbekommen würden.
Während der Prozesse versank der Justizpalast in Nürnberg förmlich in Papier. Eine im April 1948 fertiggestellte Übersicht verzeichnete mehr als 1800 Kubikmeter »Verwaltungsakten, Pressenegative und -erklärungen, eine Filmsammlung, Tonmitschnitte aus den Gerichtssälen und von Befragungen, Bibliotheksbücher und andere Veröffentlichungen, Originaldokumente, Fotokopien, Abschriften von Dokumenten, Dokumentensammlungen, Gerichtsunterlagen, Häftlingsakten, Befragungsakten, Zusammenfassungen von Befragungsakten, Mitschriften aller Verhandlungen und Analysen der Mitarbeiter«.30
Die Flut war so gewaltig, dass die Zuständigen schon fürchteten, Originaldokumente könnten unabsichtlich im Müll landen. Es war, wie Kempner später in seinen Memoiren schrieb, »ein furchtbarer Wust« – und er nutzte das Chaos aus.
Er sagte, er habe Angst gehabt, dass womöglich brisante Dokumente nicht richtig archiviert würden, und so wollte er selbst ihren sinnvollen Einsatz sicherstellen. In seinen Memoiren räumte er ein, er habe, wenn »interessierte und clevere« Leute ihn während der Prozesse um wichtige Dokumente gebeten hätten, manchmal vielleicht die Akten auf dem Sofa in seinem Büro liegen gelassen und den Raum mit den Worten: »Ich will davon nichts wissen« verlassen.31
Es sei, so meinte er, besser, ein »wertvolles geschichtliches Gut« in den Händen eines vertrauenswürdigen Mitarbeiters, der sich mit dessen Inhalten beschäftigte, zu wissen als in den Händen von Regierungsbeamten, die es womöglich sogar vernichten ließen.
Alle erbeuteten deutschen Originaldokumente sollten eigentlich nach den Prozessen an die Military Document Centers zurückgegeben werden, doch Kempner wollte die von ihm gesammelten Unterlagen verwenden, um Artikel und Bücher über die Nazizeit zu schreiben. Am 8. April 1949, wenige Tage bevor die Urteile im Wilhelmstraßen-Prozess gesprochen wurden, sicherte sich der Ankläger einen kurzen, von Fred Niebergall, dem Direktor der Archivabteilung für die Anklagevertretung, unterschriebenen Brief: »Der Unterzeichnete autorisiert Dr. Robert M. W. Kempner, stellvertretender Hauptankläger, Abteilung politische Ministerien, nicht als geheim klassifiziertes Material der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse zu entnehmen und zu behalten, für Zwecke der Forschung und des Studiums, für Veröffentlichungen und für Vorträge.«32 Das war eine ungewöhnliche Ermächtigung. Später hatte ein Anwalt, der beim militärischen Nachrichtendienst arbeitete, ernste Zweifel, ob ein Mann in Niebergalls Position so etwas überhaupt unterschreiben hätte dürfen.
Exakt am selben Tag schickte Kempner einen Brief an den Verlag E. P. Dutton in New York mit einer grob umrissenen Zusammenfassung eines Buches über seine Befragungen in Nürnberg und über die Dokumente des deutschen Außenministeriums, dem er den vorläufigen Titel Hitler and His Diplomats gegeben hatte.33 Er hatte die Buchidee im Januar vorgestellt, und ein Lektor des Verlages hatte Interesse bekundet und um weitere Details gebeten.
Es sollte sich später herausstellen, dass es nur eine von vielen Ideen Kempners im Jahr 1949 war.
Jahrzehnte später versuchte er zu begründen, warum er Dokumente aus Nürnberg mitgenommen hatte: »Ich wusste eines: Wenn ich einmal darüber etwas schreiben wollte und deshalb erst lange mich an Archive hätte wenden müssen, so wären zwar nette Antworten eingetroffen, aber manche Sachen nicht zu finden gewesen. So aber hatte ich meine Unterlagen.«34
Als Rechtfertigung griff das viel zu kurz. Im Grunde wollte Kempner sich einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen Autoren sichern, die über die Nazizeit schrieben: Exklusivität.
Mit seiner Ermächtigung in der Hand ließ Kempner seine Nürnberger Unterlagen zusammenpacken und mit allem anderen, das er in seiner Zeit als Ankläger gesammelt hatte, über den Atlantik in sein Haus in der Nähe von Philadelphia bringen. Die Lieferung kam am 4. November 1949 am Bahnhof Lansdowne der Pennsylvania Railroad an: 23 Kisten mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,6 Tonnen.35
Hitler and His Diplomats wurde nie fertig. Offenbar wurde Kempner abgelenkt. Aber er fand andere Wege, Gerechtigkeit für die Schandtaten des Dritten Reiches zu suchen. Er eröffnete eine Kanzlei in Frankfurt am Main und begann, neben anderen anwaltlichen Tätigkeiten auch Fälle von Naziopfern zu übernehmen, die Entschädigungen forderten.36 Er vertrat Erich Maria Remarque, dessen Roman-Bestseller über den Ersten Weltkrieg, Im Westen nichts Neues, die Nazis verbrannt und verboten hatten. Er vertrat Emil Gumbel, einen bekannten Mathematikprofessor der Universität Heidelberg, der wegen seiner pazifistischen Haltung aus seiner Stellung gedrängt worden war. Er vertrat Juden und Katholiken und Angehörige des Widerstands und unterstützte auch die israelischen Ankläger im Eichmann-Prozess mit Beweismaterial.
Ein Jahrzehnt nach Ende der Nürnberger Prozesse begann die Verfolgung nationalsozialistischer Kriegsverbrecher aufs Neue. Ein Prozess in Ulm lenkte 1958 erneut die Aufmerksamkeit auf Grausamkeiten, von denen die Deutschen nichts mehr wissen wollten. Zehn Angehörige der Gestapo und anderer Polizeieinheiten wurden wegen Mordes an mehr als 5000 litauischen Juden während des Krieges verurteilt, ein Fall, der die Justizminister der Länder – die alarmiert feststellen mussten, dass viele Täter nach dem Krieg ihrer Strafe entgangen waren – dazu anregte, in Ludwigsburg eine Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen einzurichten.
Gleichzeitig brachten Ankläger außerhalb Deutschlands Fälle von großem öffentlichem Interesse vor Gericht. 1961 kehrte Kempner ins internationale Rampenlicht zurück, als er nach Jerusalem flog, um im Prozess gegen Adolf Eichmann auszusagen, den Mann, der die Deportation der Juden aus ganz Europa organisiert hatte. In mehreren prominenten Prozessen trat Kempner als Anwalt der Angehörigen der Opfer auf. Er vertrat den Vater von Anne Frank und die Schwester der Karmelitin Edith Stein in einem Fall gegen drei SS-Offiziere, denen die Ermordung Tausender holländischer Juden vorgeworfen wurde. Er vertrat die Witwe eines pazifistischen Journalisten, der 1933 von einem SA-Mann ermordet worden war. Er sprach für dreißigtausend Berliner Juden im Prozess gegen den Gestapo-Dienststellenleiter Otto Bovensiepen, der deren Deportation in den Osten organisiert hatte.
Kempner nutzte dieses neue Interesse an NS-Verbrechen für einen ganzen Schwung von Büchern über diese und andere bekannte Fälle für das deutsche Publikum.37 Er veröffentlichte Exzerpte seiner Befragungen in Nürnberg und 1983 seine Memoiren unter dem Titel Ankläger einer Epoche. Kempner war zwar seit 1945 naturalisierter Amerikaner, doch seine Bücher wurden nicht auf Englisch veröffentlicht, und er war in seinem Geburtsland immer bekannter als in Amerika.
Noch vier Jahrzehnte nach Nürnberg kämpfte er an vorderster Front. Nachdem die Deutsche Bank den Flick-Konzern gekauft hatte, brachte Kempner das Unternehmen dazu, über zwei Millionen Dollar Entschädigung an 1300 Juden zu zahlen, die im Krieg als Zwangsarbeiter in Schießpulverfabriken für ein Tochterunternehmen von Flick geschuftet hatten.
Der Kampf gegen die Nazis bestimmte Kempners Leben immer mehr. Er lehnte es kategorisch ab, die Welt vergessen zu lassen, was die NS-Verbrecher getan hatten. Wenn er hörte, ein früherer Nazi scheine doch gar kein so schlechter Mensch zu sein, öffnete er seine Akten, um das Gegenteil zu beweisen.
»Buchstäblich Tausende von Mördern laufen noch immer auf den Straßen Deutschlands und der Welt herum«, erklärte er einmal einem Reporter. »Wie viele Nazi-Verbrecher sind noch auf freiem Fuß? Urteilen Sie selbst.« In den Prozessen nach dem Krieg wurden nur ein paar Tausend Deutsche wegen Mordes verurteilt. »Können Sie mir erklären, wie etwa zweitausend Menschen es geschafft haben sollen, sechs bis acht Millionen zu ermorden? Es ist mathematisch unmöglich.«38
Noch dreißig, vierzig, fünfzig Jahre nach dem Ende des Dritten Reichs ließ er nicht locker. Es war ein Kampf, den er bis an sein Lebensende führen sollte.
Ungeachtet seiner ständigen Reisen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa, die durch die verschiedenen Gerichtsverfahren veranlasst waren, führte Kempner auch noch ein kompliziertes Familienleben. Seine Kanzlei befand sich zwar in Frankfurt, doch er war jetzt naturalisierter US-Bürger, und sein Erstwohnsitz war noch immer in Lansdowne, Pennsylvania, wo er sich während des Krieges niedergelassen hatte. Dort lebte er mit seiner zweiten Frau Ruth, einer Sozialarbeiterin und Autorin, seiner Schwiegermutter Marie Luise Hahn, seiner Sekretärin Margot Lipton und in den 1950er-Jahren mit seinem Sohn André.
Die Kempners hüteten ein Geheimnis: Die Mutter des Jungen war nicht Ruth Kempner – wie sie allen erzählten –, sondern Margot Lipton.39 Robert Kempner und die Sekretärin hatten im Jahr 1938 eine Affäre gehabt.
André wuchs in dem Glauben auf, er sei der Adoptivsohn der Kempners. In den Schulakten wurde Ruth Kempner als Mutter des Jungen geführt. Es war einfacher so. »Einfacher für Dr. Kempner«, wie Lipton sagte.40 André und sein älterer Bruder Lucian, Kempners Sohn mit seiner ersten Frau, erfuhren die Wahrheit erst viele Jahre später. Nicht, dass sie es nicht geahnt hätten: Bei Andrés Hochzeit in Schweden staunten alle darüber, dass sich Lipton und der Bräutigam so ähnlich sahen.
Die Söhne der Kempners hatten zu viel Respekt, um Fragen zu stellen. »Ich akzeptierte einfach, was mein Vater sagte«, erklärte Lucian, »und im Übrigen war es ja nicht meine Angelegenheit.«41
Was auch immer er wusste oder ahnte – André betete seinen Vater geradezu an. Nachdem er als Neunundzwanzigjähriger mit seiner Frau nach Schweden gezogen war, um dort einen Bauernhof zu bewirtschaften, schickte er seiner Familie regelmäßig Briefe in säuberlicher Handschrift. »Ich möchte dir nur dafür danken, Vater, dass Du der wunderbarste Papa für uns alle warst«, schrieb er, nachdem Kempner und Lipton ihn einmal besucht hatten. »Es ist nie leicht, Dir das zu sagen, wenn ich mit Dir zusammen bin, aber ich hoffe, Du wirst die Liebe und das Verständnis, die ich für Dich und Deine Arbeit empfinde, nie unterschätzen.«42
Vom Anfang der 1970er-Jahre an lebte Kempner ständig in Europa und teilte seine Zeit zwischen Frankreich und dem schweizerischen Locarno auf. Er erlitt einen Herzinfarkt – nicht lange nachdem eine Horde Neonazis vor seiner Kanzlei demonstriert hatte – und war zu schwach, um nach Amerika zu reisen. Ruth Kempner und Lipton, die noch immer in Pennsylvania lebten, besuchten ihn hin und wieder für ein paar Wochen, doch ansonsten stützte sich der Anwalt jetzt auf eine weitere, ihm treu ergebene Frau.
Jane Lester war Amerikanerin, aufgewachsen in Kane, Pennsylvania. 1938 folgte sie einer Klassenkameradin nach Deutschland, wo sie Juden, die auf eine Auswanderungsmöglichkeit hofften, Englisch beibrachte. Jahre später gab sie zu, dass sie furchtbar naiv gewesen sei. Sie hatte keine Ahnung, was Hitler seinen Feinden antat. In der »Kristallnacht« im Jahr 1938, als die Nazis plündernd und randalierend durch Deutschland zogen und Synagogen ebenso zerstörten wie jüdische Geschäfte und Wohnungen, schlief sie tief und fest. Am nächsten Tag war ihr zunächst nicht klar, warum die Schüler ihrer Sprachschule nicht kamen. Sie verließ Deutschland, arbeitete in einem Maklerbüro in Buffalo, wurde dann Schreibkraft in Washington – ein »government girl«, wie sie sich ausdrückte – beim Office of Strategic Services, dem Nachrichtendienst des amerikanischen Kriegsministeriums.
Eines Tages las sie 1945 in der Washington Post, dass Übersetzer für die Kriegsverbrecherprozesse in Nürnberg gebraucht würden, und daraufhin ging sie hinüber ins Pentagon, das damals noch im Bau war, und bewarb sich um diesen Job. Bald war sie wieder auf dem Weg nach Deutschland.
Den Anklagevertreter Robert Kempner kannte sie dem Namen nach; sie sah ihn im Grand Hotel in Nürnberg, wo sich alle, die mit dem Prozess zu tun hatten, abends aufhielten und zu Abend aßen. Und schließlich lernte sie ihn 1947 kennen, als er Personal für die späteren Prozesse suchte. Sie wurde seine Mitarbeiterin und begleitete ihn oft zu den Verhören, was die Angeklagten zu beunruhigen schien. »Sie wurden nicht klug aus mir«, sagte sie. »Es ging das Gerücht um, dass ich Psychologin sei.«
Ihr kam auch die zweifelhafte Ehre zu, das Protokoll der Wannsee-Konferenz für die amerikanischen Strafverfolger ins Englische zu übersetzen.
Später arbeitete Lester für den militärischen Nachrichtendienst im Camp King in Oberursel im Taunus. Nach Feierabend aber half sie Kempner beim Übersetzen seiner Korrespondenz und bei der Führung seiner Kanzlei. Daraus entwickelte sich eine Partnerschaft, die die nächsten vier Jahrzehnte überdauern sollte.
»Die letzten zwanzig Jahre seines Lebens war ich Tag und Nacht mit Robert Kempner zusammen«, sagte sie. »Ich war seine Krankenschwester, seine Fahrerin, seine Sekretärin.« Sie sagte es zwar nicht, aber sie war zeitweise auch seine Geliebte.
Kempner und die drei Frauen in seinem Leben verband bis zuletzt eine enge Freundschaft.
Lucian beschrieb die Situation Jahre später mit den Worten: »Alle waren eine große, glückliche Familie.«
Kempners Frau Ruth starb 1982. Gegen Ende seines Lebens wohnte er in einem Hotel außerhalb von Frankfurt, wo Lester und er in zwei Zimmern nebeneinander mit offener Verbindungstür schliefen. So war sie in der Nähe, falls es Kempner mitten in der Nacht schlecht gehen sollte. Robert und Lucian Kempner sprachen fast jeden Tag miteinander, und da der Vater am Telefon nicht gut verstand, hörte Lester immer mit und erzählte ihm später, was er womöglich überhört hatte.
Kempner starb am 15. August 1993 mit 93 Jahren. In jener Woche war Lipton aus Pennsylvania angereist, um bei ihm zu sein.
»Er starb in meinen Armen«, berichtete Lester. »Wir saßen da, jede an einer Seite in seinem Sterbezimmer.« Als der Arzt kam und ihn für tot erklärte, »waren wir furchtbar entsetzt, traurig und fassungslos«.43
Die Frauen riefen Lucian an, der mit seiner Frau aus München kam und alles Nötige regelte.
Das Ganze war nicht so einfach. In einem langen, mit Recherchen, Veröffentlichungen und Reisen gefüllten Leben hatte Kempner alles aufgehoben. Gemälde, Möbel, viele Tausend Bücher und riesige Papierstapel füllten seine Anwesen in Frankfurt am Main und Lansdowne, einem Vorort von Philadelphia. Er hatte zahllose Aktenordner mit persönlichen, beruflichen und juristischen Unterlagen geführt: Es fanden sich alte Pässe, Adressbücher, Schulhefte aus der Kindheit, benutzte Zugfahrkarten, Wasser- und Stromrechnungen, uralte Briefe, Fotos.
Lester fand Kempners Testament versteckt in einer Tasche in ihrem Hotelzimmer. Es war nur eine Seite, handgeschrieben mit dickem schwarzem Filzstift, kaum lesbar. Diesem Dokument zufolge hinterließ Kempner alles seinen beiden Söhnen Lucian und André.
Aber die Sache hatte einen Haken.
Robert Kempner neben Jane Lester, seiner Assistentin und Übersetzerin, während des Wilhelmstraßen-Prozesses 1948–49.
(ullstein bild/ullstein bild via Getty Images)
2
»Alles weg«
Zwei Jahre nach Kempners Tod suchte seine treue Mitarbeiterin Jane Lester noch immer nach einem Weg, sein Erbe lebendig zu halten.44 Sein Status als ehemaliger Ankläger in den Nürnberger Prozessen hatte Kempners Ansehen in Deutschland gefördert. In der Presse war er ebenso regelmäßig präsent gewesen wie in Fernsehsendungen über die Prozesse. In den Vereinigten Staaten jedoch war er praktisch unbekannt. Und das wollte Lester ändern.
Sie beschloss, Kontakt zu einem gewissen Herbert Richardson in Lewiston, New York, aufzunehmen, einem früheren Theologieprofessor, der einen kleinen wissenschaftlichen Verlag, die Edwin Mellen Press, führte. Kritiker qualifizierten Mellen als »Zuschussverlag« ab, eine Beleidigung, gegen die Richardson erfolglos ein Verleumdungsverfahren mit einem Streitwert von 15 Millionen Dollar gegen die Zeitschrift Lingua Franca anstrengte. Möglicherweise stieß Lester irgendwo in Kempners Unterlagen auf Richardsons Namen. Im Jahr 1981 hatte Kempner versucht, amerikanische Verleger für eine Neuauflage seiner Bücher zu interessieren, und dabei auch Mellen Press kontaktiert. Richardson hatte damals erklärt, sein kleines Unternehmen könne eine solche Edition nicht veranstalten.
»Das Problem ist allerdings, dass Ihre Bücher meiner Ansicht nach UNBEDINGT auf Englisch veröffentlicht und in ganz Nordamerika verbreitet werden sollten«, schrieb Richardson im April 1982. »Sie enthalten so wichtige Informationen, es wäre tragisch, wenn sie nicht bekannt werden. Aber was kann ich tun??? Ich bin ein kleiner Verleger und kann es eben nicht leisten.«45
13 Jahre später, als Lester bei ihm anrief, war Richardson immer noch interessiert. Lester übersetzte einen Teil der Kempner-Memoiren, und Mellen Press veröffentlichte sie 1996, genau fünfzig Jahre nach Ende des Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozesses.
Am 23. März 1996 nahm Richardson an einem Wiedersehenstreffen von Nürnberger Anklagevertretern in Washington, D.C., teil. Dort sprach er einen hochrangigen Historiker des United States Holocaust Memorial Museum an und erkundigte sich nach den Bedingungen für eine eventuelle Schenkung »einer kleinen Menge« von Kempners Unterlagen.46 Kempner hatte zwar alles seinen beiden Söhnen hinterlassen, die Papiere aber waren noch immer im Besitz seiner beiden früheren Assistentinnen, Lester in Deutschland und Lipton in Pennsylvania. Damals waren beide Frauen schon über 80 und standen einander immer noch sehr nahe.
Zwei Tage später arrangierte der Historiker ein Treffen von Richardson, Lester und Lipton mit Henry Mayer, dem Chefarchivar des Museums. Das Reden übernahm vor allem Lester, sie beschrieb Kempners Bedeutung und den unschätzbaren Wert der Papiere, die er hinterlassen hatte. Doch die Gespräche führten zu nichts. Mayer war erst zwei Jahre zuvor an das Museum gekommen und hatte mit einer Flut neuen Materials zu kämpfen. Er hatte mehr als genug zu tun, und nichts, was er an jenem Tag über diese Sammlung hörte, klang besonders dringlich. Niemand erwähnte die Rosenberg-Tagebücher.
Richardson hatte bald eine andere Idee: Er würde eine eigene Institution gründen, um die Dokumente unterzubringen.
Am 21. September 1996 leitete Richardson eine aufwendige Zeremonie zur Eröffnung des neuen »Robert Kempner Collegium« in Lewiston, New York, einer Grenzstadt oberhalb der Niagarafälle, in der Richardson ein Büro hatte.47 In schwarzem Talar und akademischem Ornat leitete er einen Eröffnungsgottesdienst, in dem er vor einer kleinen Gruppe von Freunden und Unterstützern des verstorbenen Anwalts, darunter Lester und ihre Familie, Lobeshymnen auf Kempner sang, »einen der mutigsten Kämpfer gegen einen Staat, der sich als gesetzmäßig ausgab, aber gesetzlos war«, wie er mit wohlmodulierter Stimme wie ein Priester von der Kanzel herab verkündete. »Robert Kempner stellte sein Leben in den Dienst der Gerechtigkeit, und versuchte jene Gesetze und jene Staaten zu bekämpfen, die nicht rechtmäßig, sondern rechtswidrig waren.« Das Kempner Collegium solle für die Idee kämpfen, dass die Moral das Gesetz aufhebe.
Bewegt erinnerte Richardson sich daran, wie er Teil von Kempners posthumen Freundeskreis wurde. Er sei ein erschöpfter alter Mann gewesen. Als Lester anrief und um seine Mithilfe bei der Veröffentlichung von Kempners Büchern auf Englisch bat, sei er plötzlich aus seiner Misere aufgeschreckt. »Ein Jahr später«, so erklärte Richardson seinen Zuhörern, »nachdem Jane mir zu neuen Projekten und Perspektiven verholfen hat, muss ich sagen: Sie ist ein Jungbrunnen!« Dann stieg er von der Kanzel herab und überreichte ihr ein gerahmtes Anerkennungsschreiben. »Die große Vorstellungskraft und überschäumende Energie von Jane Lester sind die spirituellen Waffen des edlen Ritters, der sich auf die Suche nach dem Gral macht, sich Gefahren aussetzt, Grenzen überschreitet, und nicht nur die Früchte, sondern auch die Widrigkeiten des Lebens gerne annimmt.« Richardson nannte sie eine »lebenslange Streiterin für die Gerechtigkeit«.
Dann bekamen die Besucher eine Führung durch den Verlag, und bei einem Mittagessen signierte Lester Exemplare der übersetzten Kempner-Memoiren für die Gäste. Danach kehrte die Gruppe zur Lesung einiger Abschnitte, die ein Schauspieler vortrug, noch einmal in die Kirche zurück.
Lipton durchschnitt das Band vor dem Eingang des kleinen weißen Hauses, vor dem ein großes Schild auf die neue Institution hinwies.
Doch die Regale in diesem Haus waren leer.
Die Frauen hatten die Unterlagen zwar in ihrer Obhut, rechtlich jedoch standen sie Robert Kempners Söhnen zu. Sie hatten noch nicht entschieden, was sie mit den Dokumenten in Lansdowne machen wollten. 1995 hatten sie wegen einer Schenkung der Akten aus Kempners Frankfurter Kanzlei mit dem deutschen Bundesarchiv verhandelt. Als Richardson sich in die Verhandlungen einmischen wollte, schickte ihr Anwalt ihm eine Unterlassungsaufforderung.
Unbeirrt davon unterbreitete Richardson Lucian Kempner drei Monate nach der Eröffnung des Robert Kempner Collegiums ein Angebot. Sein neues Zentrum werde sich der »Sammlung, Katalogisierung, Veröffentlichung und Erforschung von Robert Kempners Bibliothek und Papieren« widmen. Im Gegenzug sollte Lucian 20000 Dollar als Vorauszahlung erhalten, außerdem die Honorare aus der erneuten Veröffentlichung der Bücher seines Vaters und ein Ehrendiplom von Richardsons Institution. »Darf ich im Januar nach München kommen, um diese Vorschläge mit Ihnen zu besprechen?«
Lucian lehnte das Angebot ab.
Im Mai 1997 meldete sich Lester noch einmal wegen Kempners Unterlagen beim Holocaust Museum. Diesmal war Henry Mayer, der Chefarchivar des Museums, zu Verhandlungen bereit.
Mayers Großvater Heinrich Meier, ein Rinderzüchter in Oberlustadt bei Speyer, heute ein Teil von Lustadt, war von den Nazis aus seinem Beruf gedrängt worden. Bauern wurden unter Druck gesetzt, jüdische Viehhändler zu boykottieren, von denen sie seit Generationen ihre Tiere gekauft hatten.48 Wer dabei erwischt wurde, dass er bei einem jüdischen Händler kaufte, erhielt nur einen Bruchteil des üblichen Milchpreises. Demonstranten blockierten Versuche von Juden, ihr Vieh auf dem Markt zu verkaufen. Schließlich verweigerten Versicherungsgesellschaften Juden die Versicherung, die sie von Rechts wegen für ihr Vieh brauchten. Heinrich Meier hatte die Schikanen irgendwann satt. Er bestieg 1937 mit seiner Tochter und seinem Sohn den Luxusliner S.S. Washington mit Ziel New York. Dort hatten sich schon früher Verwandte niedergelassen, und er zog nach Flatbush, ganz in ihre Nähe. Außerdem sagte er sich endgültig von Deutschland los: Bei seiner Ankunft veränderte er die Schreibweise seines Nachnamens vom deutschen »Meier« in das englische May-er.
Die Mayers sprachen nie über den Holocaust. Henry Mayer wurde fünf Jahre nach Kriegsende geboren; er lernte sehr schnell, dass es streng verboten war, zu fragen, was mit den Juden im Dritten Reich geschehen war. »Das war immer etwas, das man nicht ansprach«, sagte er. »Man redete einfach nicht darüber.«49
Henry Mayer studierte amerikanische Geschichte an der University of Chicago und machte seinen Master an der University of Wisconsin. Eigentlich wollte er promovieren, doch er schaffte die Vorprüfung für das Doktorandenprogramm nicht, und während er sich auf den zweiten Versuch vorbereitete, kamen ihm Zweifel. Er schied aus dem Programm aus, zog nach Washington, D.C., und fand eine Anstellung beim amerikanischen Nationalarchiv. Die Arbeit dort war angenehm, aber irgendwann kam er an einen Punkt, an dem sein ganzes Leben aus der Inventarisierung von Unterlagen und dem Hin- und Hertragen von Material zu bestehen schien, und deshalb ergriff er die Chance, als er 1994 eine Stelle am neu eröffneten Holocaust Museum angeboten bekam.
Das United States Holocaust Memorial Museum zählt mehr als anderthalb Millionen Besucher jedes Jahr. Es will sie inspirieren, »Hass entgegenzutreten, Völkermord zu verhindern und für die Menschenwürde einzutreten«. Bevor sie mit dem Lift in die eigentliche Ausstellung gelangen, bekommen die Besucher Karten, auf denen ein einzelnes Opfer der NS-Verfolgung beschrieben ist. Der lange Rundgang führt sie an Bildern der Massaker vorbei, in einen Viehwaggon wie jene, in denen die Juden in die Vernichtungslager gebracht wurden, unter einem Schriftzug »arbeit macht frei« hindurch wie am Tor zum Stammlager Auschwitz und schließlich in einen mit viertausend Schuhen gefüllten Raum, die Häftlingen im Konzentrationslager Majdanek bei ihrer Ankunft abgenommen worden waren. Das Museum will historisches Wissen vermitteln, aber auch Fragen nach persönlicher Verantwortung aufwerfen: Was hättest du getan? Was wirst du tun, um heute die Ausbreitung von Hass zu unterbinden?
Die Sammlung ist allerdings weit größer als die Ausstellung selbst. Das Museum verfügt über umfassendes Material für Forschungen zum Holocaust: Dokumente, Fotos, Archivaufnahmen, Interviews mit Überlebenden und einzigartige Artefakte.
Als Sohn und Enkel deutscher Juden, die aus Deutschland vertrieben worden waren, interessierte sich Henry Mayer von vornherein für die Mission des Museums. Doch erst als er dort zu arbeiten begann, wurde ihm klar, wie stark der Holocaust auch seine Familiengeschichte beeinflusst hatte. Nicht wenige seiner Verwandten hatten nicht rechtzeitig aus Europa fliehen können.
Mayers Vorfahren, die Familien Meier und Frank, hatten seit Generationen in und um Karlsruhe herum gelebt. In den 1930er-Jahren flohen neben seinem Großvater noch andere Mitglieder der Familie in die Vereinigten Staaten, aber viele mussten auch zurückbleiben. Sie gehörten zu den etwa 6500 jüdischen Männern, Frauen und Kindern, die im Oktober 1940 aus Baden und der Saarpfalz deportiert wurden.
Die Transporte gingen in den Westen, wo sie in den Verantwortungsbereich des Vichy-Regimes gelangten, einer Marionettenregierung, die im unbesetzten Südfrankreich eingerichtet worden war, nachdem die Deutschen Frankreich besiegt und den Norden und Westen des Landes im Frühsommer besetzt hatten. Die Gestapo hatte die Juden ohne Vorwarnung deportiert; die Franzosen schickten die Züge von Avignon und Toulouse weiter in ein Internierungslager, das 1939 am Rande eines kleinen Dorfes namens Gurs in den Ausläufern der Pyrenäen für Kämpfer des Spanischen Bürgerkriegs errichtet worden war.
Die Züge mit den Juden hielten am nächstgelegenen Bahnhof, in Oloron-Sainte-Marie, und alle wurden auf offene Lastwagen verladen. Auf dem letzten Stück ihrer langen, bitteren Reise fiel der Regen in eisigen Sturzbächen. Fast 1200 Kilometer von zu Hause entfernt wurden die Häftlinge – nass, frierend, verstört – zu trostlosen Reihen baufälliger Baracken geführt. Ihr Gepäck blieb im Schlamm zurück.
Sozialarbeiter, die das von den Franzosen geführte Lager 1940 besuchten, fanden dort eine »unerträgliche Atmosphäre menschlicher Hoffnungslosigkeit« und »eine starke Todessehnsucht« unter den älteren Gefangenen vor; 40 Prozent der Deportierten waren über 60 Jahre alt. Auf dem von Stacheldraht umzäunten Gelände standen völlig überfüllte fensterlose Holzbaracken. Sie hatten keine Heizung, kein fließendes Wasser, keine Möbel. Überall waren Läuse, Ratten und Kakerlaken, Krankheiten breiteten sich aus. »Es regnete und regnete«, schrieb ein Gefangener. »Der Boden war ein einziger Morast. Man konnte ausrutschen und im Schlamm versinken.« Die Gefangenen teilten sich ein Paar hohe Stiefel, um durch den Sumpf auf die primitiven Toiletten zu kommen – Eimer in offenen Verschlägen ohne Dach und Tür. Über allem lag, wie eine Historikerin später schrieb, »der Geruch von Lehm gemischt mit dem Gestank von Urin«. Die Häftlinge bekamen Kaffee-Ersatz, dünne Suppe und Brot. Es gab nicht genug Trinkwasser, und der Hunger war gnadenlos. »Es bräuchte einen Meisterdichter wie Rimbaud«, schrieb der jüdische Professor A. Reich, der in Gurs inhaftiert war, »um all die Schattierungen des Leids zu schildern, die tausende und abertausende Menschen, Männer und Frauen jeden Alters, quälten.«50
Heinrich Meiers Cousins Elise und Salomon Frank überlebten im Lager das Ende des Jahres 1940 nicht; sie starben im kältesten Winter seit Langem.
Heinrichs Bruder Emmanuel Meier, seine Schwägerin Wilhelmina und seine Cousine Martha Mayer verbrachten fast zwei Jahre in den französischen Internierungslagern, bevor auch ihre Zeit kam. Im August 1942 wurden sie mit dem Zug nach Drancy, einem Vorort von Paris, gebracht, wo man ihnen auch ihre letzten Besitztümer abnahm. Am 14. August fuhren Busse sie bei Tagesanbruch zum Bahnhof, wo Wachen, die mit Maschinengewehren herumfuchtelten, sie für die Reise nach Osten mit »unbekanntem Ziel« in Viehwaggons pferchten. Sie fanden sich unter den Kranken und Älteren wieder und unter vielen jungen Waisenkindern, von denen manche erst zwei, drei oder vier Jahre alt waren.
Nach einigen Tagen erreichten Heinrichs Verwandte ihren Bestimmungsort, 1300 Kilometer östlich im besetzten Polen: Auschwitz.
Jahrzehnte später half Mayer am Holocaust Museum dabei, eine Dokumentensammlung von über 70 Millionen Seiten zu erschließen, zu organisieren und zu katalogisieren. Keine der Neuerwerbungen war aber so groß, so komplex – und letztendlich so historisch bedeutsam – wie Kempners Unterlagen.
Nachdem Lester sich 1997 gemeldet hatte, schrieb Mayer wegen der Dokumente einen Brief an Lucian und André Kempner. Sie waren begeistert, und bald nahm Lucian die Sache in die Hand. Seiner Ansicht nach war das Holocaust Museum der perfekte Ort für den Nachlass eines Mannes vom Format seines Vaters. »Sein Leben war der Kampf gegen den Nationalsozialismus.« Lucian teilte mit, dass die Papiere, um die es ging, sich in Lansdowne befänden und dass Margot Lipton dafür sorgen könne, dass das Museum sie inventarisiere.
Als Mayer und eine Gruppe von Wissenschaftlern im August 1997 aus Washington nach Pennsylvania fuhren, sah es noch so aus, als werde alles glatt über die Bühne gehen.
Sie fuhren zu dem geräumigen Haus, das die Kempners während des Krieges gekauft hatten. Es stand am Fuß eines Hügels, gegenüber einem Park in einer Biegung des Darby Creek. Zur verabredeten Zeit öffnete niemand die Tür. Ein paar Minuten später kam Lipton von einem Spaziergang zurück. Als Mayer sich vorstellte, wirkte sie überrascht. »Wer?« Dann fiel ihr das Treffen wieder ein, sie ließ sie herein und zeigte ihnen das Material.
Es war überall: in Kempners Büro links vom Eingang, im Zimmer zur Rechten, im Wintergarten, in zwei Zimmern im ersten Stock, im Keller. Ein Zimmer war ganz ohne Licht, und Lipton musste erst einmal Glühbirnen besorgen.
Einer der Männer war schon einmal im Haus gewesen. Als junger Wissenschaftler, damals noch keine 30 Jahre alt, hatte Jonathan Bush Kempner hier interviewt. In der Zwischenzeit hatte sich dort nicht viel verändert. »Es war ein totales Chaos«, sagte Bush, der später zu den Nazi-Fahndern im Office of Special Investigations des Justizministeriums gehörte, Justiziar am Holocaust Museum wurde und sich einen Ruf als Fachmann für NS-Kriegsverbrecherprozesse erwarb. »Ich habe nie so viele in ein einziges Haus gestopfte Kisten gesehen.« In allen Zimmern, die Lipton ihnen zeigte, standen die Kisten bis unter die Decke gestapelt. Jeder freie Platz war mit Akten bedeckt.
Die vier Männer waren überwältigt. Mayer weiß noch, dass er überlegte: Was machen wir denn jetzt? Wenn man Bush erzählt hätte, dass in dem Haus 2000 Kisten lagerten, hätte er keinen Zweifel daran gehabt. Ach du heilige Scheiße!, dachte er. Wie sollen wir das je alles sichten?
Sie bildeten zwei Teams und begannen mit der Katalogisierung. Die Zeit reichte gerade, um eine kleine Stichprobe des Materials durchzusehen und zu prüfen, ob Kempners Unterlagen überhaupt von Wert waren. Im Keller fanden sie fünf Regale voller Wörterbücher und Gesetzbücher aus der Zeit vor dem Dritten Reich. Auf vier Tischen standen fast 30 Kisten mit persönlichen Finanzdokumenten und juristischen Unterlagen. In den Aktenschränken seines Büros fanden sie Unmengen Ordner voller unsortierter Briefe und Berichte. Das Zimmer war so vollgestopft mit Möbeln und Kisten, dass sie nicht an die Papiere im Bücherschrank mit den Glastüren herankamen.
Das Ganze war ein furchtbares Durcheinander. Die Akten waren weder chronologisch noch thematisch geordnet. Die Männer mussten Zimmermannswerkzeug, Vitaminfläschchen und Körperlotionen wegräumen, um an Zeitungsausschnitte, Rechnungen, Fotos und Reiseführer heranzukommen. Sie mussten sich auf die unteren Kisten stellen, um die obersten zu erreichen. Unmöglich konnten sie alles sichten. Bush sagte: »Die meisten Kisten standen hinter zwei weiteren Reihen von Kisten unter sechs anderen Kisten.«
Was sie genauer anschauten, war zweifellos interessant und historisch bedeutsam. Bush öffnete eine Kiste und stieß überraschenderweise auf Unterlagen, die zeigten, dass Kempner, der Fluch der NS-Kriegsverbrecher, in einem Fall als Fürsprecher von Görings Witwe Emmy aufgetreten war. Bush sah Abschriften von Briefen an und von J. Edgar Hoover. Besonders verblüffte ihn der Umfang von Kempners Papieren zu den Kriegsverbrecherprozessen. Kopien dieses Materials waren wichtigen Bibliotheken überlassen worden, aber sie brauchten so viel Platz, dass selbst öffentliche Institutionen sie vernichtet hatten. Kempners Archiv war praktisch vollständig, wie Bush sagte: »Er hatte alles.«
Die Sammlung war, wie Mayer in seinem zusammenfassenden Bericht schrieb, »von enormem historischem Wert für die Erforschung des Holocaust«. Sie war aber auch »sehr stark gefährdet«. Einige Papiere im Wintergarten und im Keller hatten Schimmel angesetzt. Er empfahl, das Material sofort in ein Zwischenlager zu bringen, wo es gegen Insektenbefall behandelt und in neue Archivkartons umgepackt werden konnte.
Seinen Bericht übermittelte er Lucian, der ihn an Lester und Lipton weitergab. Und damit begann der Ärger. Lipton wollte sich von nichts trennen.
Hier kam die problematische Klausel aus Kempners Testament ins Spiel. Um sicherzustellen, dass Lipton nach seinem Tod versorgt sein würde, hatte Kempner festgelegt, dass sie das Recht hatte, auf Kosten seines Nachlasses in dem Haus in Lansdowne zu wohnen – mit allem, was darin war. Lucian und André akzeptierten dieses Ansinnen durchaus, doch gleichzeitig wollten sie auch die Dinge, die Kempner in Lansdowne zurückgelassen hatte, loswerden.
Nicht lange nachdem Mayer die Papiere im Haus inventarisiert hatte, kam ein Brief von Lipton: Sie würde das Material nicht kampflos herausgeben.
»Ihnen sind offenbar meine Rechte in dieser Angelegenheit nicht bekannt«, hieß es in dem Brief. Kempner habe Lipton das Recht gegeben, »alles in 112 Lansdowne Court zu behalten oder darüber zu verfügen«. Sie hatte nichts dagegen, dass das Museum Kempners Papiere archivierte – »letztendlich«. Aber sie wollte nicht in einem halb leeren Haus leben. »Sie können vielleicht nicht richtig einschätzen, dass ein älterer Mensch im Ruhestand oft einen gewissen Trost darin findet, von den Unterlagen, Büchern, Fotos und Gegenständen umgeben zu sein, die sein Lebenswerk verkörpern«, hieß es in dem Brief. Zudem sei es unsensibel von Mayer gewesen, sie nicht zu fragen, ob sie »etwas dagegen hätte, wenn Sie einen Lastwagen schicken und den größten Teil der Dinge aus meinem Heim wegkarren, wo ich über 50 Jahre gelebt habe und wo ich noch weitere 30 zu leben gedenke«. Offenbar hatte sie vor, weit über 100 Jahre alt zu werden.
Lipton erklärte Mayer, sie werde Lucian und das Museum vor Gericht bringen, falls sie ihre Pläne weiterverfolgten. »Ich erwarte postwendend Ihre Entschuldigung dafür, dass Sie es unterlassen haben, diese Angelegenheiten mit mir zu besprechen, und Ihr feierliches Versprechen, dass Sie nie wieder beabsichtigen werden, mein Heim ohne meine schriftliche Einladung und Zustimmung zu betreten und daraus irgendetwas zu entfernen.«