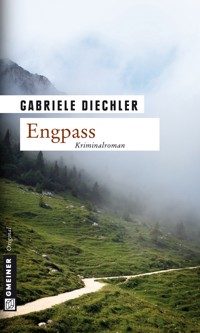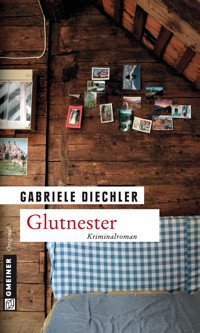10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kann man sich im falschen Moment verlieben?
Und überwindet Liebe jedes Hindernis?
Buchhändlerin Emma reist nach London, um ihren verstorbenen Eltern noch einmal nahe zu sein, denn diese hatten sich dort kennen- und lieben gelernt.
Schon am ersten Tag begegnet ihr die sympathische Witwe Ava. Die beiden Frauen freunden sich an, und Ava macht Emma das verlockende Angebot, in ihrem Anwesen auf der Roseninsel in Cornwall die Bibliothek auf den neuesten Stand zu bringen. Begeistert sagt Emma zu.
Völlig unerwartet trifft sie in dem Haus auf den Klippen auf Avas Sohn Ethan, der ihr gegenüber sehr abweisend ist. Dennoch fühlt Emma sich zu ihm hingezogen. Als sie herausfindet, was hinter Ethans kühler Fassade steckt, begreift sie, wie tief Liebe gehen kann – und steht plötzlich vor der größten Herausforderung ihres Lebens …
Ein warmherziger und gefühlvoller Roman über Glück und Hoffnungslosigkeit, Verlust und Liebe – all das, was ein Leben ausmacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gabriele Diechler
Die Roseninsel
Ein Cornwall-Roman
INSEL VERLAG
Dieser Roman ist meinen Lesern gewidmet, die mich immer wieder aufs Neue mit ihren Lebensgeschichten inspirieren. Ich bewundere den Mut, sich jeden Tag vom Leben überraschen zu lassen, und die Stärke, niemals aufzugeben.
Peggys Liebesliste:
Zuerst die Liebe, danach die Umstände …
Nach der Scheidung von Rory war ich fürs Erste mit dem Glück durch. Meine Arbeit, Mum und Dad, eine Handvoll Freunde, und meine Bücher … mehr war mir nicht geblieben. Bis zu dem Tag, an dem ich mit Hannes zusammenstieß.
Ihm zu begegnen, war wie ein Flug im Heißluftballon, hoch über allem, ganz nah am Himmel, frei und beschwingt. Ab da lag Magie über meinem Leben.
»Wie soll das gehen? Du hier und er in Köln?«, fragten meine Eltern, als sie merkten, dass es Hannes ernst war und mir auch. »Glaubst du, eine Engländerin findet in Deutschland einen Job in einer Buchhandlung? Dafür musst du perfekt Deutsch sprechen.« Sie sorgten sich, ich könnte zu viel riskieren. Mit Rory hatte ich schon mal danebengelegen. Doch bei Hannes sagte mein Gefühl laut und deutlich: Ja!
Mein Bruder Brian rief an und wollte wissen, was mir zum Begriff »Zuhause« einfalle. »Antworte spontan. Überleg nicht lange«, riet er mir.
Meine Antwort kam, ohne zu zögern: »Die Wärme, die mich erfüllt, wenn Hannes bei mir ist.«
Da wusste ich es: Die Liebe kommt immer zuerst, erst danach kommt alles andere.
1. Kapitel
London, vor dreiundvierzig Jahren
Die Sonne scheint warm auf sie hinab, als Peggy fröhlich mit einem Eimer mit Putzmitteln, der locker in ihrer Armbeuge schwingt, aus der Buchhandlung tritt.
Für einen kurzen Moment nimmt sie die Stimmung um sich herum auf. Das Taxi, das gemächlich vorbeirumpelt – mal wieder Stop-and-go in der Regent Street –, und die Frauen, die den Tisch mit zeitgenössischer Literatur, den sie heute Morgen hinausgestellt hat, nach Lesenachschub durchwühlen. Dahinter hat sie einen Spruch ans Fenster geklebt: Bücher spenden Liebe! Sie mag es, potenzielle Kunden für das Naheliegende zu sensibilisieren. Bücher sind mehr als nur gute Unterhaltung. Sie sind Nahrung für die Seele – Liebe eben.
Die Buchhandlung in der Regent Street ist ihr Universum, fast so etwas wie ihr Zuhause. Sie liebt dieses pulsierende Leben um sich herum, wenn Kunden nach Büchern suchen, nach all den Geschichten, mit denen sie jeden Tag verbringt. Das ist ihr Rhythmus, ihr Lebensatem.
Sie geht das Schaufenster ab, greift nach dem Fensterreiniger, sprüht ihn auf und beginnt mit ihrer Säuberungsaktion. Jeden Tag tappen Leute an die Scheibe, als könnten sie die Bücher in der Auslage zu fassen bekommen. Mit energischen Bewegungen kämpft sie gegen alle möglichen Flecken an, dabei beugt sie sich eine Spur zu weit vor und knallt mit dem Kopf gegen die Scheibe.
»Verflixt noch mal!« Sie greift sich an die Stirn, und kaum hat sie eine leichte Erhebung am Kopf ertastet, stößt sie schon mit dem Ellbogen gegen etwas hinter sich. Sie unterdrückt einen Fluch, dreht sich um. Ein Mann hält seine rechte Hand schützend vor den Brustkorb. Augenblicklich tritt ein schuldbewusster Ausdruck auf ihr Gesicht. »Das war keine Absicht«, entschuldigt sie sich. Sie riecht sein Aftershave, rauchig und herb.
»Halb so wild. Ich denke, ich überlebe es«, wiegelt der Mann ab. Geistesgegenwärtig weicht er nach rechts aus, um eine Kundin vorbeizulassen.
Sein ehrliches Lächeln beruhigt Peggy. Schnell wirft sie einen Blick ins Fenster, wo ihre Umrisse sich spiegeln. Mit ihrem Kopf ist alles in Ordnung, jedenfalls auf den ersten Blick.
»Das gibt höchstens eine kleine Beule«, erwidert der Mann. »Ansonsten sehen Sie perfekt aus …«, er zögert kurz, »… bis auf eine winzige Kleinigkeit«, fügt er schließlich hinzu.
Auf Peggys Stirn wächst eine Falte. Wenn etwas nicht stimmt, ist sie immer sofort irritiert. Vor allem, wenn sie einem attraktiven Mann gegenübersteht. »Was ist denn?«
»Darf ich?!« Der Fremde hebt den Finger und verharrt kurz vor ihrem Gesicht, und als Peggy schließlich nickt, fährt er mit dem Zeigefinger ihren Mundwinkel entlang.
»So, der Krümel ist weg. Jetzt sind Sie wie neu«, verspricht er.
Peggy verspürt ein Gefühl von menschlicher Nähe, das sie so noch nicht kennt. Sie hatte sich vorhin einen Keks in den Mund gesteckt, und noch nie ist sie so froh gewesen, einen Krümel am Mundwinkel zu haben.
Einen Moment starrt sie den Mann an. Er ist etwa eins fünfundachtzig groß, hat dichtes blondes Haar und graue Augen, die ausgesprochen freundlich wirken. Aber das Beste ist seine Stimme. Sie klingt melodisch, richtig einnehmend.
»Haben Sie vielleicht später Lust auf einen Spaziergang? In einer Stunde hätte ich frei.« Was redet sie da? Wird sie etwa rot? Wieso lädt sie einen fremden Mann ein? Das hat sie noch nie getan.
»Was für eine wunderbare Idee! Seit ich heute Morgen gestartet bin, habe ich mich bereits dreimal verirrt. Da trifft es sich doch hervorragend, Ihnen über den Weg gelaufen zu sein. Die Hilfe einer waschechten Londonerin kann ich nämlich gut gebrauchen. Ich bin übrigens Hannes Sandner. Aus Deutschland, Köln, um präzise zu sein.« Lächelnd hält der Mann ihr seine Hand hin.
Zögerlich stellt Peggy den Eimer mit den Putzmitteln ab und schlägt ein. »Peggy Pratt. Und nur, dass Sie es wissen …«, auf ihrem Gesicht liegt nun ein Anflug von Verlegenheit.
»… schon klar«, unterbricht der Mann sie, »Sie laden nur Männer ein, die sich verlaufen haben und dringend Hilfe brauchen. Reine Nächstenliebe also.«
In Peggy löst sich die Anspannung, die sie schon die ganze Zeit verspürt. Die Hand des Mannes fühlt sich gut an. Sein Griff ist fest und vertrauenerweckend. Irgendwie richtig. Außerdem spricht er fantastisch Englisch. Plötzlich fühlt sie sich beschwingt – wie ein Vogel, der nur die Flügel ausbreiten muss, um fortzufliegen.
2. Kapitel
London, Juni
Erin Bassets Abhandlung Zeig mir den Ort, wo die Liebe wohnt war lange Zeit das Lieblingsbuch ihrer Mutter.
Emma erinnerte sich noch gut daran, wie ihre Mutter sich zu Vater ans Bett setzte, um ihm mit leiser Stimme daraus vorzulesen. Es war wenige Wochen nach seinem Schlaganfall, und während Emma nun die Oxford Street hinablief, sah sie die Szene vor sich, als wäre es gestern gewesen. Ihre Mutter hatte nach Vaters Hand gegriffen, ihm aufmunternd zugelächelt und zu lesen begonnen … von Hoffnung und Mitgefühl und der Leichtigkeit der Liebe, die selbst in schwierigen Momenten aufblitzen konnte, wenn man wahrhaftig liebte. Hannes hatte stumm zu weinen begonnen. Emma hatte im Türrahmen gestanden und mit zugeschnürtem Hals beobachtet, wie ihre Mutter ihm das verschwitzte Haar aus der Stirn strich. Sie ging mit ihm um, als hätte sich nichts verändert. Als wäre er nicht auf sie angewiesen – als wäre alles wie immer.
»Weißt du, weshalb ich dich so liebe?«, hatte sie ihn flüsternd gefragt.
Er hatte noch nicht mal nicken können.
»Ich liebe dich, weil du in all den Jahren nie weggelaufen bist, egal, was passiert ist, und weil du ehrlich bist und keine Angst davor hast, dich verletzlich zu zeigen. Deshalb bin ich so glücklich mit dir.«
Angesichts seines Zustands – ihr Vater hatte damals kaum sprechen können und war halbseitig gelähmt – waren ihm diese Worte vermutlich wie das schönste Geschenk vorgekommen, das ein Mensch einem anderen machen konnte. Ihre Mutter besaß die Fähigkeit, über sich hinauszuwachsen, wenn das Leben es verlangte, das begriff Emma in diesem Moment. Und Emma hoffte, eines Tages wie sie zu sein.
Nach Peggys Tod, kein Jahr nach seinem Schlaganfall fiel Hannes in ein tiefes Loch. Emma nahm die Rolle ihrer Mutter ein und kümmerte sich um ihn, so gut sie konnte. Eine Serbin half ihr mit der Pflege.
Doch jeder Tag barg Tücken, und die Fortschritte, die Hannes machte, waren in seinen Augen nie groß genug. Es waren schwierige Jahre, und nach einem zweiten Schlaganfall wurde es noch herausfordernder.
Emma spürte, wie bedrückend die Gedanken an jene Zeit waren. Doch Gedanken ließen sich nicht einfach abstellen. Seit sie das Hotel nach dem Frühstück verlassen hatte, spulten sich die letzten Jahre mit ihrem Vater immer wieder vor ihrem geistigen Auge ab. Es war, als würde sie die wichtigsten Momente mit ihm noch einmal erleben.
Als es ihrem Vater gegen Ende sehr schlecht gegangen war – nach zwei Schlaganfällen und Pflegestufe IV musste sie täglich mit dem Schlimmsten rechnen –, hatte sie versucht, sich zu wappnen. Ohne Familie dazustehen wäre schlimm, aber sie käme klar. Doch obwohl sie sicher gewesen war, vorbereitet zu sein, hatte das Ableben ihres Vaters sie kalt erwischt.
Wie sehr dieser zweite Verlust ihr tatsächlich zu schaffen machen würde, hatte sie nicht ahnen können. Nach dem Tod ihres Vaters empfand sie nur noch ein Gefühl der Leere.
Eine Gruppe Japaner verstopfte den Weg. Emma wich den fotografierenden Touristen aus und sprang geistesgegenwärtig auf den Bürgersteig zurück, als das Hupen eines Busses hinter ihr erklang.
Immerhin hatte der Tod ihres Vaters sie nach England gebracht, redete sie sich gut zu. Noch einmal an die Orte zurückzukehren, an denen für ihre Eltern alles begonnen hatte, würde ihr helfen, einen Strich unter die Vergangenheit zu ziehen und sich auf das zu konzentrieren, was vor ihr lag.
Ein Pantomime gab für einen kurzen Moment seine starre Haltung auf und schenkte Emma ein Lächeln. Sie spürte, wie auch ihr Mund sich zu einem Lächeln verzog.
Freundlichkeit hatte auch ihr Vater vor über vierzig Jahren erfahren, als er von der Oxford in die Regent Street einbog und wenige Augenblicke später die Buchhandlung entdeckte, in der ihre Mutter zu jener Zeit arbeitete. Er war auf der Suche nach einem Buch gewesen, das er abends vorm Einschlafen lesen konnte.
In einer Familie wie ihrer aufzuwachsen, hatte Emma immer als großes Glück empfunden. Zu Hause hatten sie über alles sprechen können. Kein Thema war tabu. Wenn sie nicht über ihre Erlebnisse und Gefühle sprachen, tauschten sie sich über die Bücher aus, die sie lasen, überall in der Wohnung gab es welche: Sie standen in Regalen, stapelten sich auf Tischen und Sesseln, lagen sogar in der Küche, wo ihre Mutter sich manchmal über ein Buch beugte und noch schnell das Ende eines Kapitels las, während sie in einem Topf rührte. Es war ein Leben voller Geschichten, im Austausch von Wissen. Ein Leben, das sie geliebt hatte und das nun endgültig Vergangenheit war.
Von irgendwo drang das Heulen einer Polizeisirene. In London war wieder mal die Hölle los. Der Verkehr war mörderisch, und die Touristengruppen rollten sich, einer Karawane gleich, die Straßen hinunter. Emma bekam all das nur am Rande mit.
Erst vorhin hatte sie wieder daran denken müssen, wie ihr Vater jedes Jahr den Nachmittag wiederaufleben lassen hatte, an dem er und Peggy sich begegnet waren.
»Das erste Aufeinandertreffen mit deiner Mutter hat mein Herz so laut zum Schlagen gebracht, dass ich in Panik geraten bin, sie könnte es hören. War kein rühmlicher Beginn, aber ein unvergesslicher.«
Ihre Mutter hatte oft gesagt, niemand übertreibe so charmant wie ihr Mann und niemandem höre sie so gern dabei zu.
Emma hörte im Kopf die Stimme ihrer Mutter – beinahe als schlenderte Peggy neben ihr die Oxford Street entlang.
Das Fenster eines Cafés huschte an ihr vorbei. Emma hatte die Frau nur aus dem Augenwinkel wahrgenommen, doch nun verknüpfte sich deren Antlitz mit dem ihrer Mutter in jungen Jahren. Die gleichen Haare und eine ähnlich grazile Statur. Sie hastete zurück und blieb wie angewurzelt vor dem Café stehen. An einem Bistrotisch am Fenster saß eine Frau, die ihrer Mutter ähnlich sah, und küsste einen Mann. Die beiden wirkten sehr verliebt.
Solange sie denken konnte, war die Liebe ihrer Eltern für sie das Maß der Dinge, und mit dem Tod der beiden zerbrach auch ein Teil ihrer Sicherheit, ihres Lebens.
Emmas Knie gaben nach. Rasch holte sie ein Bonbon aus der Jackentasche, wickelte es aus dem Papier und steckte es sich in den Mund. Seit der Beerdigung ihres Vaters – dem absoluten Tiefpunkt ihres Lebens – aß sie kaum noch etwas. Vermutlich war sie unterzuckert.
Unwillig löste sie sich vom Anblick des jungen Paars und ging weiter. Alles, was ihr von ihren Eltern blieb, waren einige antike Möbel und Erinnerungsstücke, vor allem aber unzählige Bücher und Fotos glücklicher Momente, die sie als Familie miteinander geteilt hatten. Und natürlich das hellrote Notizbuch ihrer Mutter, das diese immer nur Meine Liebesliste genannt hatte.
Emma bog in die Regent Street, ließ einige Geschäfte hinter sich und blieb schließlich vor der Auslage der Buchhandlung stehen, in der ihre Mutter in jungen Jahren mehr als fünf Jahre gearbeitet hatte.
Von einem Plakat lächelte der Bestsellerautor Andrew Wilson unter buschigen Augenbrauen auf sie hinab.
Andrew hatte am Beginn seiner Karriere und auch später regelmäßig in der Buchhandlung ihrer Eltern gelesen, die sie einige Jahre nach der Hochzeit in der Ehrenstraße in Köln eröffnet hatten. Am liebsten hatte er im Lieblingssessel ihrer Mutter, neben dem Regal mit den Krimis, gelümmelt. Dort hatte er die Beine lang ausgestreckt, im Gesicht dieses wache Grinsen, das für ihn typisch war, und über Philosophie diskutiert.
Emma erinnerte sich an vieles aus dieser Zeit, besonders an den Tag ihres fünften Geburtstags. Andrew war auf Lesereise gewesen und hatte sich auch in Köln die Ehre gegeben. An jenem Abend hatte er nach ihrem Zeigefinger gegriffen und war damit über eine Seite des Buchs gefahren, das er gerade las. Dabei hatte er aufmunternd behauptet: »Emma, ist dir klar, dass du gerade liest?! Also los, erzähl mir, was auf dieser Seite steht.«
Die Worte kamen ohne die kleinste Regung über seine Lippen, und weil Andrew nicht die Spur eines Zweifels zeigte, begann Emma ungehemmt auf Englisch draufloszuplappern. Während sie ihm eine erfundene Geschichte erzählte, wirbelten ihre tapsigen, kleinen Finger wie aufgeschreckte Vögel durch die Luft. Das Buch rutschte zur Seite, doch Emma bekam es kaum mit, weil sie so aufgeregt war: »When I grow up I want to write books just like you. And then Mum und Dad can sell them in their store«, krähte sie.
Emma blinzelte gegen das Licht. Seit sie das letzte Mal vor dieser Buchhandlung gestanden hatte, hatte sich kaum etwas verändert. Noch immer wurde das Schaufenster auf die gleiche Weise dekoriert: mit den Werken eines Autors oder einer Autorin als Mittelpunkt, dahinter ein Plakat. Unaufgeregt und trotzdem ausgesprochen wirksam. Und noch immer waren die Scheiben blitzsauber.
Erneut blickte sie in Andrews Augen auf dem Plakat. »Hallo, Andrew«, murmelte sie.
Andrew hatte die Liebe ebenfalls gefunden, wenn auch erst im zweiten Anlauf. Seit über dreißig Jahren war er nun mit Philippa, einer Bühnenbildnerin, liiert. Mit Phil, wie Andrew seine Frau nannte, hatte er sich anfangs eine etwas heruntergekommene Wohnung in Hackney geteilt, doch als seine Bücher sich immer besser verkauften und in immer mehr Sprachen übersetzt wurden, konnten sie sich ein Haus in Weybridge, eine Dreiviertelstunde von London entfernt, leisten.
Emma blickte noch immer in die Auslage. Vor dieser Buchhandlung hatte sich das weitere Leben ihrer Eltern entschieden. Hier lag der Ursprung ihrer Familie.
Es war schön und schmerzhaft zugleich, daran zurückzudenken. Sie versuchte, den Druck auf ihrer Brust zu ignorieren. Manchmal waren Erinnerungen nur schwer auszuhalten. Sie wandte sich ab und überlegte, was sie als Nächstes tun sollte. Vielleicht würde ein Spaziergang ihr guttun? Der Green Park im Westen fiel ihr ein, den hatte sie oft besucht, ebenso die Kensington Gardens und den Hyde Park. Doch am liebsten ging sie in den St. James’s Park. Auf dem Weg von Big Ben zum Buckingham Palace durchquerten viele Touristen diesen Park, der das östliche Ende eines über zwei Meilen langen, nur durch einige wenige Straßen unterbrochenen Grünstreifens im Stadtzentrum bildete. Die meisten Touristen und auch die Einheimischen hielten sich beim See und dem Blumengarten mit dem Gärtnerhäuschen auf.
Emma liebte die Ruhe, die im Park herrschte. Dort könnte sie durchatmen – und vielleicht die Kraft finden, einen Blick in die Liebesliste ihrer Mutter zu werfen. Das dünne Büchlein hatte Peggy viel bedeutet.
Sie drehte um und suchte sich zwischen den Menschen ihren Weg. In letzter Zeit hatte sie kaum noch an Carsten gedacht, doch nun fiel ihr wieder die Geburtstagsparty ein, auf der sie ausgelassen mit ihm getanzt hatte. Bald darauf waren sie ein Paar geworden; doch als Carsten ein lukratives Angebot aus Hamburg bekam und sie überlegten, wie es mit ihnen weitergehen konnte, war ihnen schnell klar geworden, dass es weder für ihn die große Liebe war noch für sie selbst. Weshalb gelang es ihr nicht, wirklich zu lieben? Was machte sie bloß falsch? Dem wichtigsten Menschen seines Lebens zu begegnen, war offenbar ein Geschenk, das nicht jeder vom Leben bekam.
Emma eilte erneut an einer Reisegruppe vorbei, die den halben Bürgersteig und einen Teil der Fahrbahn versperrte. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als dem Menschen zu begegnen, mit dem sie durchs Leben gehen konnte: einem Mann, der ihr morgens beim Aufwachen die Haare aus dem Gesicht strich und ihr abends einen zärtlichen Gute-Nacht-Kuss gab. Nur hatte sie in ihren bisherigen Beziehungen weder bedingungslose Liebe empfunden noch sie von einem Mann erfahren.
Emma beschleunigte ihre Schritte. Im Geist sah sie bereits die riesigen Bäume des St. James’s Parks vor sich. Die Tierwelt rund um den Park Lake mit den Inseln Duck Island und West Island war einmalig. Man konnte Kraniche und Pelikane beobachten und Gänse und Enten. Als sie den Parkeingang erreichte, huschte ein Grauhörnchen an ihr vorbei, flitzte auf eine Buche und verschwand im Dickicht. Gemächlich steuerte sie eine Trauerweide an und hielt vor einer Bank. Dort nahm sie Platz, ließ ihre Handtasche von der Schulter gleiten und schaute auf die Wasserfontäne im See. Nach einer Weile griff sie nach ihrem Lederbeutel, begann das Innere abzutasten und fand zwischen Taschentüchern, Schminkbeutel, Haargummis und einer Tüte Bonbons schließlich, wonach sie suchte. Sie zog das Buch ihrer Mutter aus der Tasche, betrachtete den hellroten Leinenüberzug und schlug es auf.
Die Liebe kommt immer zuerst, erst danach kommen die Umstände.
»Wie schwierig die Umstände auch sein mögen, versuch, sie zu überwinden, nur dann weißt du, ob die Liebe stark genug ist«, hatte ihre Mutter zu ihr gesagt.
Für Carsten und sie waren die Umstände Grund genug gewesen, ihre Beziehung zu beenden. Von tragfähiger Liebe war keine Rede gewesen. Lag es daran, dass Carsten sie nie so angesehen hatte wie ihr Vater ihre Mutter?
Die Schatten der Trauerweide malten ein bizarres Muster auf das aufgeschlagene Buch in Emmas Händen. Wie hypnotisiert starrte sie auf die Buchstaben, bis sie vor ihren Augen verschwammen.
»Kein Grund, den Kopf hängen zu lassen, sondern eher, sich ins Zeug zu legen!« Das hatte Vater ihrer Mutter versprochen, als sein Urlaub in London zu Ende ging. Es folgten lange Briefe und unzählige Telefonate, in denen sie über ihre Träume, die Buchhandlung in der Regent Street und über Hannes’ Beruf als Sozialarbeiter, an dem ihm so viel lag, redeten.
Hannes’ grenzenlose Offenheit hatte Peggy begeistert. Diskussionen oder gar Zweifel gab es zwischen ihnen nicht. Beide waren sich von Anfang an einig, zusammenbleiben zu wollen. Dass Peggy acht Jahre älter und bereits geschieden war, war dabei genauso wenig ein Hindernis wie die Tatsache, dass sie alles hinter sich lassen musste, um in Köln neu zu beginnen. So entschlossen handelten nur Menschen, die einander wirklich liebten und auch an diese Liebe glaubten.
Emma blätterte durch das Buch. Die Umstände waren Peggy und Hannes egal gewesen, sie hatten alles getan, um ihre Liebe leben zu können.
Gefühle dieser Tiefe hatte Emma nie erlebt, auch deshalb war es höchste Zeit, sich darüber klar zu werden, wo ihre Ziele lagen. Zuversichtlich bleiben!, erinnerte sie sich. Früher oder später würde sie zu ihrer alten Ruhe zurückfinden, dann lägen ihre Ziele wieder deutlich vor ihr.
Sie schlug die nächste Seite um, und während sie las, bohrte sie die Schuhspitzen in den Kies. Peggy hatte dieses Buch immer als Landkarte der Liebe bezeichnet. Und es stimmte, das Buch spendete Hoffnung, dass jeder diese Liebe auf dem Weg seines Lebens finden konnte. Während Emma weiter darin blätterte, hatte sie das Gefühl, ein Teil ihrer Mutter sei noch immer da – ganz nah bei ihr. Sie überflog die letzten Seiten und dachte daran, wie gut es sich immer angefühlt hatte, das Gesicht gegen die angenehm warme Wange ihrer Mutter zu legen. Als sie bei der letzten Seite angekommen war, schlug sie das abgegriffene Büchlein zu und steckte es zurück in die Tasche, dabei wischte sie sich verschämt über die Augen.
Ob es schlimmer war, der Liebe noch nicht begegnet zu sein, oder sie zu verlieren, wie es ihrer besten Freundin Marie passiert war? Eine Gruppe Frauen kam des Weges. Sie hatten sich untergehakt, und ihr Lachen und Kichern war weithin zu hören. Wie glücklich die Frauen wirkten, voller Leben und Selbstvertrauen. Emma folgte ihnen mit dem Blick, schließlich stand sie auf und schob sich die Trageriemen ihrer Tasche über die Schulter. Das Wetter war prachtvoll – sonnig, aber nicht heiß –, sie würde eine Weile durch den Park bummeln und danach entscheiden, was sie als Nächstes tun wollte.
Im Moment war sie einfach nur froh, nicht in Köln zu sein. Seit kurzem arbeitete sie in der Filiale einer Buchhandelskette und geriet regelmäßig mit ihrer Chefin aneinander, etwa, wenn sie einer Kundin das neueste Buch einer unbekannten Autorin bestellte, anstatt ein Exemplar der vorrätigen Bestseller zu verkaufen.
Sie war schon im Begriff, den Frauen zu folgen, als sie ein irritierendes Geräusch in ihrem Rücken vernahm. Alarmiert drehte sie sich um …
3. Kapitel
Köln, April, sechs Wochen zuvor
»Kümmern Sie sich darum, dass genügend Bücher über den Ladentisch gehen. Zu planen, wie wir Kunden mittels Lesungen bespaßen, gehört nicht zu Ihren Aufgaben.«
Der Blick der Filialleiterin schweifte zu zwei von Emmas Kolleginnen. Sie standen bei den Reiseführern, wendeten sich jedoch ertappt ab, als sie merkten, dass sie beobachtet wurden. Lauschen war eine Sache, in einen Disput hineingezogen werden eine andere.
»Also noch einmal …«, der Blick der Filialleiterin wanderte zurück zu Emma, »konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, Frau Sandner! Ich hoffe, wir sind uns einig?«
Die Hände ihrer Chefin waren zur Faust geballt. Die Knöchel traten weiß hervor.
Wie kann man seine Hände nur derart malträtieren?
Emma nickte halbherzig. »Ja, natürlich!«, versprach sie, obwohl sie es gar nicht so meinte.
Der barsche Tonfall ihrer Chefin irritierte sie, seit sie vor etwas mehr als zwei Monaten in dieser Filiale zu arbeiten begonnen hatte. Doch sosehr sie sich auch bemühte, hier Fuß zu fassen, sie konnte es ihrer Chefin nicht recht machen.
»Klein beigeben ist das Beste, was du tun kannst«, hatte eine Kollegin ihr gleich am ersten Tag geraten, »alles andere macht keinen Sinn.«
Sie würde ihre Argumente hinunterschlucken, denn wenn sie sie vorbrächte, würde das Ganze garantiert in einer Konfrontation enden.
Emmas Gedanken schweiften ab, zu der Zeit, als sie noch in der familieneigenen Buchhandlung gearbeitet hatte, in die sie nach dem Schlaganfall ihres Vaters eingestiegen war. Eines Tages war ein Vertreter in die Buchhandlung gekommen und hatte geschwärmt, sie bliebe selbst dem interessiertesten Käufer kaum je eine Antwort schuldig.
Ihre Mutter hatte den Austausch zwischen Kunden und Autoren gefördert, deshalb bot die Buchhandlung Sandner regelmäßig Lesungen an. Emmas reges Interesse an Büchern war nicht zuletzt durch die vielen Begegnungen mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern gewachsen, bis irgendwann klar gewesen war, dass sie später mit Büchern arbeiten wollte. Zuerst hatte sie eine Lehre als Buchbinderin gemacht und gelernt, Bücher vollständig handwerklich herzustellen. Die Kunst des Buchbindens hatte sich dort entwickelt, wo Bücher geschrieben und eingesetzt wurden – im klerikalen Raum der Kirchen und Klöster. Es war spannend, in die Anfänge des bürgerlichen Buchbindens einzutauchen. Nach ihrer Lehre hatte sie ein Studium der Literaturwissenschaften begonnen.
Abends, wenn sie von der Uni heimkam und es sich auf der Couch gemütlich machte, las sie alles im englischen Original, was ihr in die Finger kam. Ihre Mutter hatte oft mit ihr über Dickens, Virginia Woolf und Daphne du Maurier gesprochen, die in Cornwall gelebt hatte. Peggy war in St. Just in Cornwall aufgewachsen, bevor die Familie später nach London umsiedelte. In London hatte ihre Mutter sich ständig in Buchhandlungen herumgetrieben. Und sich fest vorgenommen, später einmal selbst eine Buchhandlung zu eröffnen. Wie sehr hatte Emma zusammen mit ihrer Mutter jedes Frühjahr und jeden Herbst den Neuerscheinungen entgegengefiebert, besonders denen kleinerer Verlage, die abseits des Massengeschmacks publizierten.
Die Arbeits- und Sichtweise, mit der sie neuerdings konfrontiert wurde, war Emma gänzlich unbekannt. Bücher waren für sie mit Emotionen verbunden. Oft genug hatte sie für ein Buch gekämpft, damit es genügend Leser fand. Davon konnte hier keine Rede sein.
»Keine langen Verkaufsgespräche!«, hatte es erst letzte Woche geheißen, als sie einer Kundin Informationen zu einer jungen Autorin gegeben hatte, nach der diese gefragt hatte. Davor waren es die Tische mit den Lieblingsbüchern gewesen, die sie angeblich falsch bestückte. Mit stoischer Miene hatte sie die Bücher ausgetauscht, noch immer die Worte ihrer Chefin im Ohr: »Sie sollten den nächsten Kunden bereits im Visier haben, während Sie dem einen noch die Tüte mit den Büchern über den Tisch reichen. Das klingt vielleicht überspitzt, aber im Grunde stimmt es. Zeit ist Geld. Das dürfen wir alle nie vergessen.«
Emma war, als sei ihr Beruf über Nacht entzaubert worden. Was vorher gestrahlt hatte, war nun dumpf und fahl geworden. Das war der Preis, den sie dafür zahlte, einen sicheren Job zu haben. Arbeit, durch die sie ihre Miete zahlen und ihr Leben bestreiten konnte. Und hoffentlich irgendwann den Rest Schulden begleichen, der wegen der jahrelangen Arbeitsunfähigkeit ihres Vaters nach der Auflösung der Buchhandlung Sandner an ihr hängengeblieben war.
»Mit Geduld und einer dicken Haut kommst du überallhin, Emma!« Dickhäutigkeit und Langmut – diese Eigenschaften hatte ihre Mutter stets als Schutzschild gegen die Widrigkeiten des Lebens eingesetzt. Doch das Leben barg Herausforderungen, mit denen man nicht gerechnet hatte. Wenn sie heute Abend hier rauskäme, würde sie sich die Wut vom Wind wegpusten lassen … und zu Hause in einen Roman abtauchen, um auf andere Gedanken zu kommen. Danach ginge es ihr bestimmt besser.
Die Filialleiterin redete noch immer auf sie ein, doch Emma hörte ihr kaum zu. In den vergangenen Wochen hatte sie gelernt, die Zurechtweisungen ihrer Chefin wie ein Gewitter an sich vorüberziehen zu lassen. In der Mittagspause würde sie sich im Mitarbeiterraum einen Kaffee gönnen, um runterzukommen. Zeig Einsehen!, redete sie sich gut zu, doch das Gefühl der Ungerechtigkeit nagte heute stärker an ihr als sonst. Musste sie zu ihrer Ehrenrettung nicht zumindest das wichtigste Argument vorbringen? War sie sich das nicht schuldig? Und Andrew Wilson ebenso?
»Es geht nicht ums Honorar …«, hörte sie sich unvermittelt sagen. Der Satz machte ihr einen Strich durch die Rechnung, es gut sein zu lassen, doch sie konnte nicht anders.
»Ach ja?« Die Augenbrauen der Filialleiterin hoben sich unnatürlich. »Das wäre das erste Mal, dass ein Autor vom Kaliber eines Andrew Wilson nicht nach einem saftigen Honorar und einem entsprechenden Hotel verlangte. Lassen Sie es gut sein, Frau Sandner. Keine Lesungen in nächster Zeit … und auch sonst keine Extravaganzen … Ob Sie’s glauben oder nicht, auch ich war mal jung und enthusiastisch und habe darüber nachgedacht, das Sortiment zu erweitern. Für Kunden, die nach Büchern fragen, deren Verfasser noch keinem breiten Publikum bekannt sind, oder die sich für neuübersetzte Klassiker und gut recherchierte Reiseführer interessieren …«
Erst gestern hatte eine Kollegin Emma erzählt, ihr ginge langsam das Feuer für ihren Beruf aus. »Ewig dieselben Bestseller verkaufen nervt. Es ist zum Davonlaufen. Wenn ich den Job nicht so dringend bräuchte, würde ich kündigen.«
»Die Zeiten werden nun mal nicht besser«, Emmas Chefin presste die Lippen aufeinander, offenbar hatte sie sich mit den Gegebenheiten abgefunden. »Lernen Sie, sich an die Richtlinien unseres Unternehmens zu halten. Sonst haben Sie hier keine Zukunft.«
»Andrew Wilson ist bereit, kostenlos zu lesen!« Der Satz war schneller heraus, als Emma lieb war. »Als meine Eltern ihre Buchhandlung aufbauten und auch später, haben viele, die damals noch am Anfang ihrer Karriere standen, unter anderem Andrew Wilson, bei ihnen gelesen, oft mit einer warmen Mahlzeit im Anschluss.« Bei der Erinnerung an jene Abende machte Emmas Herz einen Satz. Jeder dieser Abende war etwas Besonderes gewesen, mit interessanten Gesprächen, Anekdoten und Gelächter. Bis spätnachts hatten sie die Gläser klingen lassen, um auf den Erfolg eines Buches anzustoßen.
»Sollen wir unseren Kunden in Zukunft etwa Schnittchen reichen? Wie in der guten alten Zeit?« Es klang süffisant. Und abwertend.
»Warum nicht?«, fasste Emma nach. Sie sah nicht gern zu, wie jemand kleingemacht wurde, auch sie selbst nicht. Diesmal würde sie einer Konfrontation nicht ausweichen. Wenn sie hier schon nichts bewegen konnte, so konnte sie wenigstens die Fakten auf den Tisch legen.
»Das Team würde gern etwas zu einer Lesung beisteuern, dessen bin ich mir sicher. Außerdem wird Kundenbindung immer wichtiger. Lesungen sind Emotionen pur. Und Emotionen binden Menschen an Orte.«
Die Hand ihrer Chefin schnellte in die Höhe. Eine Geste, die ihr Einhalt gebot.
»Sie tun ja gerade, als hätten wir erst gestern eröffnet und müssten um jeden Kunden buhlen. Wir sind ein großes Unternehmen, keine Nischenbuchhandlung.«
»Umso wichtiger ist es, unseren Kunden zu vermitteln, dass sie uns am Herzen liegen«, konterte Emma. »Niemand will nur sein Geld in einem Geschäft lassen, jeder möchte auch als Mensch wahrgenommen werden.«
Nach dem zweiten Schlaganfall ihres Vaters hatte Emma die Buchhandlung der Eltern mit nur einer Hilfskraft weitergeführt. Doch von Monat zu Monat war es schwieriger geworden, klarzukommen. Sie hatte für alles zu wenig Zeit gehabt: für die Pflege ihres Vaters, ihre Kunden, für die Messen und für die Steuern … vor allem aber hatte sie zu wenig Geld für Personal gehabt. Schließlich waren die finanziellen Sorgen erdrückend geworden, so hatte sie die Notbremse gezogen und den Laden geschlossen. Die Schließung der Buchhandlung war für sie lange ein Tabu gewesen, schließlich handelte es sich dabei um ein Stück Familiengeschichte. Als sie am letzten Tag die Tür hinter sich zuzog, war sie in Tränen ausgebrochen, obwohl sie sich vorgenommen hatte, Stärke zu zeigen.
Dass Andrew Wilson sich nun bereit erklärte, in der Filiale einer Buchhandelskette zu lesen – etwas, das er stets zu umgehen versuchte, weil er vor allem privat geführte Buchhandlungen unterstützte –, noch dazu ohne Bezahlung, zeigte Emma, dass auch für ihn das Menschliche zählte. Er wollte hier lesen, um ihr seine Wertschätzung zu zeigen. Das rührte sie.
»Deine Eltern haben an mich geglaubt, als ich ein Niemand war. Sie haben meine Bücher angepriesen, als wäre ich der Nächste, der den Literaturnobelpreis bekommt. So was vergisst man nicht, Emma!«, hatte Andrew am vergangenen Abend, als sie miteinander telefonierten, gesagt. Jemanden wie ihn für eine Lesung aus dem Hut zu zaubern, war keine Kleinigkeit. Doch das Ganze ging unglücklicherweise nach hinten los.
Emmas Handy meldete sich. Am Klingelton erkannte sie, dass es die Pflegerin ihres Vaters war. Auch das noch! So schlecht der Zeitpunkt für einen Anruf auch war, sie würde rangehen müssen.
Ungelenk zog sie ihr Handy aus der Hosentasche. Sie wusste, dass private Telefonate während der Arbeitszeit nicht gern gesehen waren, doch angesichts des Zustands ihres Vaters traute sie sich nicht, nicht erreichbar zu sein. »Entschuldigen Sie. Da muss ich rangehen«, sagte sie. »Es geht um meinen kranken Vater.«
»Und in Zukunft lassen Sie Ihr Handy im Spind«, ereiferte sich die Filialleiterin. »Wenn Sie hier jederzeit telefonieren, wollen andere das ebenfalls. Das kann ich nicht tolerieren.«
Emmas Nasenflügel bebten. Mit einem Gefühl der Beklommenheit nickte sie und verschwand in den Mitarbeiterraum. Dort nahm sie den Anruf entgegen.
Die Pflegerin klang gefasst, doch Emma hatte gelernt, die Gefühle der jungen Serbin herauszufiltern. Heute schwangen Angst und Unbehagen in ihrer Stimme mit.
»Geht es meinem Vater schlechter? Was ist denn los?«, fragte sie nach der Begrüßung. Inzwischen rechnete sie, wenn ihr Telefon außerhalb der vereinbarten Sprechzeiten zu Mittag klingelte, immer mit dem Schlimmsten.
»Frau Sandner, können Sie kommen?«
Die Angst war wie ein Knebel im Mund, der Emma nicht richtig atmen ließ. »Na ja, es ist gerade kein guter Zeitpunkt«, haspelte sie. »Ohne triftigen Grund kann ich, fürchte ich, nicht weg.«
Am anderen Ende herrschte eine Stille, die bedrohlicher war als Worte.
»Frau Sandner … tut mir schrecklich leid …«
Emma sank auf den erstbesten Stuhl und ließ die Stirn in die Hand sinken.
»O Gott! Sagen Sie mir bitte, was los ist«, stammelte sie.
»Ihr Vater …«, die Pause zwischen den Worten war unerträglich, »… er ist … gegangen …«
Emma hielt verzweifelt die Luft an. Wie früher, wenn sie als Kind auf der schmalen Mauer neben ihrem Haus balanciert war und das Gleichgewicht verloren hatte.
4. Kapitel
Tränen stiegen in Emma auf, als sie nach zwei Teelichtern griff, diese anzündete und zu den anderen Lichtern stellte, die Trauernde im Dom hinterlassen hatten.
Der Tod ihrer Mutter hatte sie damals tief erschüttert, doch nun auch noch den Vater zu verlieren, war, als öffne sich eine gerade erst vernarbte Wunde aufs Neue.
»Dein Leben liegt noch vor dir, Emma. Versprich mir, dass du etwas Schönes daraus machst.« Emma spürte, wie ihr die Kehle eng vor Tränen wurde, doch sie schluckte sie hinunter. Sie wollte nicht weinen, sie wollte stark sein.
An jenem Tag, als ihr Vater dies zu ihr sagte, war sie nach Hause gekommen und hatte nach ihm gesehen, er hatte einen seiner schwachen Arme um sie gelegt und sie, so fest er konnte, an sich gedrückt. Sein Griff war leicht wie der eines Kindes gewesen. Er hatte kaum noch Kraft gehabt. Das war nicht der Vater, den sie kannte. Der Mann, der Dogmen, welcher Art auch immer, ablehnte und ihr deshalb stets imponiert hatte. Als es ihm noch gutging, war ihr Vater von Zeit zu Zeit in den Dom gekommen, hatte sich in eine Bank gesetzt und Danke für alles Schöne in seinem Leben gesagt.
»Ein bisschen Ruhe ist wichtig, um sich an die Momente zu erinnern, die reich an Freude und Liebe sind«, lautete seine Devise. Dankbarkeit empfinden zu können, hatte ihm auch nach den Schlaganfällen dabei geholfen, durchzuhalten und nach dem Tod seiner Frau – wenn auch nur in bescheidenem Maße – wieder nach vorn zu blicken.
Emma starrte auf die glimmenden Teelichter, unfähig, sich abzuwenden und zu Marie zurückzugehen, die in einer der Bänke auf sie wartete.
Das Leben auskosten! Emmas Haar leuchtete rötlich im Schein der Kerzen, während sie darüber nachdachte, wann sie das letzte Mal ihr Leben ausgekostet hatte. Seit der Beerdigung ihres Vaters fühlte sie sich, als sei sie zur falschen Zeit am falschen Ort. Alles um sie herum schien sich aufzulösen.
Noch einmal schaute sie auf die brennenden Lichter, dann verließ sie das Seitenschiff Richtung Hauptaltar, dabei huschten ihre Augen suchend über die Bankreihen. In der dritten Reihe tuschelten zwei Frauen, einige Plätze von ihnen entfernt saß Marie und winkte Emma unauffällig zu.
Emma ging an einem Mann vorbei, der zwei Jungen an den Händen hielt und schweigend vor der Kanzel stand.
Marie war die schönste Frau, die sie kannte, mit einem Gesicht, das ohne Make-up auskam, und Augen, die stets zu lächeln schienen. Doch das Schönste an ihr war nicht ihr Äußeres, sondern ihre positive Ausstrahlung, mit der sie alle ansteckte.
Emma selbst war weniger optimistisch, zumindest in letzter Zeit, und empfand sich bei weitem nicht so schön wie Marie, ihre gewellten, roten langen Haare ausgenommen. Ihr Gesicht war weniger definiert, die Wimpern so hell, dass man sie kaum wahrnahm, und auch ihren zartrosa Lippen fehlte es an Kontur. Als Schülerin hatte sie zudem unter den Blicken der Jungen gelitten, die ihr selten ins Gesicht sahen, sondern immer nur in den Ausschnitt, doch inzwischen war sie selbstbewusst genug, um sich zu akzeptieren, wie sie war. Kein Gefühl der Frustration mehr, wenn sie sich durch die Sport-BHs wühlte, anstatt durch die mit Spitze, die sie viel verführerischer fand. Sie hatte sich mit ihren vollen Brüsten ausgesöhnt.
Inzwischen liebte sie auch ihre milchweiße Haut, die im Sommer zu Sommersprossen neigte.
Emma schlängelte sich an den Frauen vorbei zu Marie. Anfangs hatte sie sich sehnlichst gewünscht, ihr Vater möge sich erholen und zwischen die Bücherreihen zurückkehren. Die Buchhandlung war nicht nur Peggys, sondern auch Hannes’ Leben – sein Zuhause. Doch anstatt ins normale Leben zurückzufinden, war es zu einem zweiten Schlaganfall gekommen und davor zu Peggys unerwartetem Tod. Emma hatte ihre Mutter tot im Bett gefunden. Sie war einfach nicht mehr aufgewacht. Der Schock war groß. Emma hatte lange gebraucht, um den Anblick ihrer leblos daliegenden Mutter zu verwinden, und sie verstand, dass ihr Vater nach dem Tod seiner Frau nicht mehr die nötige Kraft fand, um wieder gesund zu werden. Jetzt war er ihr nachgefolgt.
»Danke fürs Warten«, flüsterte sie Marie leise zu. »Und fürs Verschieben deiner Termine.« Ihre Atemzüge kamen flach und zittrig, und sie legte die Hände an die Kirchenbank, um sich festzuhalten.
»Bei dir zu sein, ist tausendmal wichtiger, als irgendeinen Promi zu interviewen.« Marie strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und schenkte ihr einen zuversichtlichen Blick.
»Lieb, dass du das sagst … allerdings bist du nur im Nebenjob meine beste Freundin, im Hauptjob bist du eine zuverlässige Journalistin.« Einen Moment fixierte Emma die bunten Fenster des Doms. Warum war es nur so schwer, gegen die Trauer anzukämpfen, die hinter ihrem Brustbein brannte? Sie griff nach Maries Hand. »Weißt du, irgendwie hilft mir der Gedanke, dass Papa nun bei Mama ist. Es hat ihn so traurig gemacht, sie nicht mehr um sich zu haben.« Um Emmas Mund spielte ein wehmütiges Lächeln.
»Deine Eltern waren ein ganz besonderes Paar. Sich vorzustellen, sie wären wieder vereint, ist tröstlich.«
Marie hatte nicht immer ein feines Gespür für Zwischenmenschliches, zumindest nicht, wenn es um Männer ging. Aus diesem Grund hatte sie Emmas Eltern für deren Liebe bewundert. Wie oft hatte sie gesagt: »So innig wie die beiden wäre ich auch gern mit jemandem verbunden.« Sicher dachte sie auch jetzt darüber nach, wie schwierig es war, eine stabile, glückliche Beziehung zu führen. Seit dem Auszug ihres Mannes aus der gemeinsamen Wohnung hatte Familie für Marie eine neue Bedeutung bekommen. Nach dieser Erfahrung wusste sie, wie schmerzhaft Lebensbrüche waren.
Eine Weile saßen die Freundinnen schweigend nebeneinander, dann rutschten sie aus der Bank und gingen an einer Gruppe Touristen vorbei auf den Ausgang zu. Das Sonnenlicht blendete sie, als sie ins Freie traten.
Marie hielt ihr Gesicht dem Himmel entgegen und schnappte nach Luft. Nach dem kalten Weihrauchgeruch und der entrückten Stille im Dom tat es gut, Licht zu tanken.
»Ich bin so froh, dass du für mich da bist.« Emmas Wimpern klebten aneinander, bildeten dünne, dunkle Linien – manchmal gelang es ihr einfach nicht, die Tränen zurückzuhalten.
»Wir gehen miteinander durch dick und dünn. Schon vergessen?« Marie wischte Emma vorsichtig über die Augen.
»Wie könnte ich, du erinnerst mich ja bei jeder Gelegenheit daran. Und auch dafür bin ich dir dankbar.« Die beiden Frauen tauschten einen Blick, schließlich drückte Emma Marie einen liebevollen Kuss auf die Wange, löste sich von ihr und ging ein paar Schritte voraus.
Seit der Beerdigung ihres Vaters ging sie regelmäßig in den Dom und zündete Kerzen für ihre Eltern an, und noch kein einziges Mal hatte Marie es versäumt, sie zu begleiten. Einmal war sogar ihre Mutter mitgekommen. Sie war eine enge Freundin von Peggy gewesen. Die beiden Frauen hatten sich in der Buchhandlung Sandner kennengelernt und waren sich im Gespräch über Margaret Atwood nähergekommen; so war im Lauf der Zeit eine Freundschaft zwischen ihnen entstanden, in die schließlich auch ihre Partner und ihre beiden Mädchen miteinbezogen wurden.
Marie lief hinter Emma her und holte sie ein. Beherzt griff sie nach deren Arm. Zwischen Emmas Augenbrauen stand eine Falte, die Marie dort noch nie gesehen hatte. Sorgen schlugen aufs Gemüt und zeichneten sich im Gesicht ab, und Sorgen hatte Emma in letzter Zeit einige gehabt. Schon immer fühlte sie sich schuldig, wenn sie traurig oder überfordert war. Sie wollte niemanden belasten, da half alles reden nichts. Emma war einfach viel zu rücksichtsvoll.
»Weißt du was … du brauchst dringend Abstand. Ich habe zwar nur noch eine halbe Stunde, aber die nutzen wir. Komm, wir gehen ans Rheinufer, Schiffe schauen.« Wasser und Schiffe wirkten wohltuend auf Emma, sie liebte die Natur und die Stille, ganz im Gegensatz zu Marie, die die prickelnde Lebendigkeit vieler Menschen wie die Luft zum Atmen brauchte. Marie trug das Herz auf der Zunge, ließ sich gern über alles Mögliche aus und diskutierte oft bis spätnachts.
Gedankenverloren ging Emma neben ihrer Freundin durch die Straßen. Marie hatte recht, sicher halfen ihr einige Minuten am Wasser. Einfach nur dastehen, die Möwen und die Schiffe beobachten und abschalten. Als sie die Altstadt erreichten, lief Emma ans Ufer. Das grau-gekräuselte Wasser des Rheins schien nur auf sie zu warten.
Schweigend stand sie da und spürte, wie das Bedürfnis über Peter zu sprechen, in ihr wuchs. Sollte sie Marie vor einem zweiten Versuch mit deren Ex-Mann warnen? Marie probierte gern Dinge aus, um herauszufinden, was sie glücklich machte. Fehlschläge inklusive, denn die zählten für sie am Ende nicht mehr. Doch diesmal ging es um etwas Endgültiges, denn Peter wollte Marie zum zweiten Mal heiraten. Emma fixierte das gegenüberliegende Ufer, wo die Häuser in der Sonne funkelten, und dachte an die Zeit, als Marie Peter kennengelernt hatte.
Die Verbindung der beiden hatte mit einer Einladung zur Karnevalssitzung ins Gürzenich vor sechs Jahren begonnen. An jenem Abend hatte Marie sich praktisch Hals über Kopf in Peter verliebt. Er arbeitete im Justizministerium und spielte in seiner Freizeit in einer Band, was für Marie das Bild eines interessanten Mannes perfekt abrundete.
»Das Zusammensein mit Peter kommt mir wie eine Achterbahnfahrt vor«, hatte sie gleich nach dem ersten Date geschwärmt. Es war eine Beziehung wie im Rausch, denn Peter griff auf das gesamte Repertoire männlichen Werbens zurück: Er schenkte Marie Blumen, führte sie in angesagte Restaurants und überschüttete sie mit Aufmerksamkeit. Marie sonnte sich in dem Gefühl, eine neue Version ihrer selbst auszuprobieren: die der Frau, die nach Strich und Faden verwöhnt wurde und endlich den Richtigen gefunden hatte. Nach nur einem Jahr heirateten die beiden, doch nach vier Jahren waren sie bereits wieder geschieden. Der Grund waren Peters Impulsivität und seine krankhafte Eifersucht. Marie kannte es nicht, eingeschränkt zu werden, und war sprachlos, als Peter sie nach kurzer Zeit gängelte.
»Musst du dich unbedingt mit diesen Freundinnen treffen? Lass uns lieber zu zweit einen tollen Abend verbringen.« Anfangs hatte sie es für ein Zeichen übergroßer Liebe und Zuneigung gehalten und nachgegeben.
»Er hängt halt an mir und will mich immer um sich haben«, hatte sie argumentiert. Doch als Peter sie eines Abends bei einem Essen mit Freunden bloßstellte und ihr vorwarf, ihre Freunde ihm vorzuziehen, und als er sie schließlich anschrie und vor den Gästen wüst beschimpfte, wendete sich das Blatt. Emma überkam noch heute eine Welle der Abneigung, wenn sie an jenen Abend zurückdachte. Ein Leben im Käfig war für sie nicht vorstellbar – weder für sich selbst noch für Marie.
»Diese beschissene Eifersucht hat er doch gar nicht nötig. Ich liebe Peter, und das weiß er auch«, war Marie lange nicht müde geworden, zu behaupten.
Nach einem weiteren Zwischenfall kam es zu einer vorübergehenden Trennung, und als Peter eines Abends erneut ausrastete und Marie völlig aufgelöst allein in ihrer Wohnung zurückblieb, reichte sie die Scheidung ein. Das Ganze lag jetzt über ein Jahr zurück, und Emma hatte geglaubt, das Thema Peter sei für alle Zeiten durch. Doch vor einer Woche hatte Marie ihr gestanden, insgeheim auf das Ende von Peters Therapie hin gefiebert zu haben. Sie hatte sich, genau wie er, in die Hoffnung verstiegen, ihre Beziehung verdiene eine zweite Chance. Und nun hatte Peter seine Therapie beendet und behauptete, er habe seine Eifersucht ein für alle Mal überwunden, und warb um Marie wie ein Teenager. Er hatte ihr sogar schon den nächsten Heiratsantrag gemacht.
Emma wollte ihre Freundin glücklich sehen, doch sie hatte kein gutes Gefühl, was diesen zweiten Anlauf betraf.
»Ich fliege übrigens nach London«, sagte sie, während ein Frachtschiff an ihnen vorbeizog.
Marie sah den feinen blonden Flaum an Emmas Wangenknochen, die Härchen sahen im Licht fast golden aus. »Davon hast du mir gar nichts erzählt! Vielleicht hätte ich Lust gehabt, mitzukommen?«, sagte sie verwundert.
Emma versuchte, nicht allzu skeptisch zu klingen, trotzdem schwang in ihrer Stimme eine Mischung aus Sorge und Vorbehalt mit.
»Ich dachte, du willst Peter jetzt nicht allein lassen. Ihr seid doch gerade erst wieder zusammengekommen. Außerdem ist es ein spontaner Entschluss. Ein paar Tage London und danach Cornwall. Dass ich an der kornischen Küste war, ist ewig her.«
Marie blickte auf Emmas mit Sommersprossen übersätes Gesicht, schließlich wanderte ihr Blick zu den dunklen Augenringen, die mittlerweile nicht mehr verschwanden.
»Sei ehrlich, Emma«, verlangte sie, »du glaubst, Peter würde nicht wollen, dass ich mitkomme. Stimmt doch, oder?«
Es war ihnen nie unangenehm gewesen, miteinander zu schweigen, doch jetzt fühlte sich die Stille falsch an.
»Na ja … vielleicht hatte ich kurz diesen Gedanken«, gab Emma nach einem Moment des Abwägens zu. In der jetzigen Situation war es nicht einfach zu entscheiden, was sie sagte oder was sie besser verschwieg. In ihren Augen war Peter oberflächlich und kaschierte durch seine quirlige Art nur seine Unsicherheit. Doch Marie, die schon immer auf wohltuende Weise absichtslos war und Peter nun sogar einen Vertrauensvorschuss gab, durchschaute nicht, wie sehr er danach gierte gemocht zu werden. Wenn man, wie Marie, aufgrund seines Aussehens und seiner offenen Art vor allem Zustimmung kannte, setzte man sich selten damit auseinander, wie viel Unsicherheit andere Menschen empfinden konnten. Wie sollte sie Marie vor einem weiteren Fehler warnen, ohne sie gleichzeitig zu verunsichern?
»Du willst, dass ich dem folge, was mich glücklich macht, andererseits glaubst du nicht an eine zweite Chance. Und aus diesem Grund behältst du deine Vorbehalte für dich … Das bist typisch du, Emma. Immer alles zu Ende denken. Aber es gibt nun mal keine Garantie in einer Beziehung. Entweder man geht das Risiko ein oder nicht.«
Emma blickte zu Boden, Marie traf den Nagel auf den Kopf. »Wir haben doch erlebt, wozu Peter fähig ist«, sagte sie leise.
Marie hörte, wie sehr sie sich Mühe gab, nicht allzu beunruhigt zu klingen. Diese Erkenntnis traf sie erst recht: »Fähig war!«, stellte sie richtig. Mit einem Mal wirkte sie kämpferisch. »Gib Menschen doch die Chance, etwas besser zu machen.«
»Bitte nimm mir meine Angst nicht übel, Marie. Ich will nur, dass du nicht noch mal verletzt wirst.« Emma streckte die Hand nach Marie aus, die diese schließlich zögernd ergriff und kurz hielt. »Du weißt, dass ich in dir die Schwester sehe, nach der ich mich immer gesehnt habe. Ich will nur sichergehen, dass du alles bedenkst.«
»Wie kommst du eigentlich darauf, nach Cornwall zu reisen?«, fragte Marie nach einigen Sekunden.
Emma zuckte die Achseln. »Ich habe die Fotos meiner Eltern angesehen, auch von unserer Reise nach Cornwall, und da dachte ich, es wäre schön, noch einmal den Spuren der beiden zu folgen. Am Meer kann ich außerdem in Ruhe nachdenken … überlegen, wie es mit mir weitergehen soll.« Emma war froh, das Gespräch auf ihre Reise lenken zu können. Solange sie davon sprachen, befanden sie sich auf sicherem Terrain.
»Hast du schon einen Flug gebucht?«
»Ja. In vier Tagen geht’s los.« Erleichterung huschte über Emmas Gesicht, sich zu der Reise durchgerungen und bereits alles organisiert zu haben.
Marie schien die Neuigkeit erst verarbeiten zu müssen, doch schließlich fasste sie Emma an den Schultern und drehte sie zu sich herum. »Emma, mach dir keine Sorgen«, sie klang eindringlich, »Peter hat seine Eifersucht überwunden, das hat er mir versprochen. Er hat sich geändert. Ganz sicher!«
Emma fühlte sich, als füllten ihre Lungen sich nicht ausreichend mit Luft. »Wäre wunderbar, wenn’s stimmt«, sagte sie kleinlaut, dann setzte sie hinzu: »Ich wünsche dir doch alles Glück der Welt.« Könnte sie nur glauben, was Marie sagte?! Wie viel leichter wäre ihr dann zumute.
Einige Sekunden sahen die Freundinnen schweigend aufs Wasser, dann trat plötzlich ein Strahlen in Maries Augen. »Weißt du was? Vielleicht schaffe ich es, meinen Boss davon zu überzeugen, mich für eine Story nach London zu schicken? Ich könnte Porträts über Frauen schreiben, die es aus eigener Kraft geschafft haben – starke, unabhängige Frauen.« Marie lehnte den Kopf zurück und fasste ihre Idee gestenreich in Worte. »Was bedeutet es in einer schnelllebigen Stadt wie London, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen und sich selbst dabei nicht völlig zu verlieren? Eine Artikelreihe von Marie Fehring über Frauen, die jeden Tag um ihr Selbstwertgefühl, um Liebe und Selbstachtung kämpfen …« Marie war Feuer und Flamme, und Emma entspannte sich, weil Maries Enthusiasmus ein wenig Unbeschwertheit zurückbrachte. Vielleicht hatte Peter sich tatsächlich geändert und sie war nur zu skeptisch. Behauptete Marie nicht immer, in ihrem Beruf als Journalistin nichts weniger zu tun, als die menschliche Psyche zu enträtseln. Jeder ihrer Artikel war ein weiterer Baustein in ihrem Bemühen, Menschen zu analysieren, über sie zu lachen, auch sie zu enttarnen. Wer, wenn nicht sie, konnte am besten einschätzen, wie hoch der Bonus sein durfte, den sie Peter gab? Sollte sie zustimmen, dass Marie sie begleitete?
Emma überlegte, wie es wäre, Marie in England dabeizuhaben. Sicher hätten sie, trotz des traurigen Anlasses der Reise, eine Menge Spaß, denn Marie schaffte es immer, sie auf andere Gedanken zu bringen. Doch so angenehm die Bilder in ihrem Kopf auch waren, sie verspürte ein Gefühl des Unbehagens … nicht wegen Peter oder weil sie es sich übelnahm, Marie nicht gefragt zu haben, ob sie sie begleiten wollte; sie fühlte sich nicht wohl bei dem Gedanken, Marie mitzunehmen, weil ihr dann die Chance genommen wäre, sich eine Weile auf sich selbst zu besinnen. Wenigstens für kurze Zeit wollte sie alles hinter sich lassen: den Tod ihres Vaters, den Stress im Job, das Ende ihrer Beziehung zu Carsten. Vielleicht sähe sie in England Licht am Horizont? Wie man es schaffte, emotional wieder auf die Beine zu kommen, musste sie allein rausfinden. Nichts und niemand konnte einen darauf vorbereiten, völlig allein durchs Leben zu gehen.
»Du bist meine beste Freundin, Marie, und ich liebe es, Zeit mit dir zu verbringen, egal, ob in Köln oder auf Reisen.« Eine Windböe wirbelte Maries dunkle Mähne durcheinander. Emma strich ihr das Haar zurecht, dabei sah sie die Freundin nachdenklich an. »Aber ich muss eine Weile allein sein. Runterkommen und entscheiden, wie es beruflich weitergeht … und lernen, den Übergang zwischen glücklichen und unglücklichen Momenten zu meistern, die das Leben gerade für mich bereithält.«
Marie holte einen Haargummi aus ihrer Handtasche und fasste sich die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen. Im Hintergrund erklang das Tuten eines Frachtkahns.
»Ist das jetzt eine Abfuhr?«, warf sie enttäuscht ein. »Bist du sicher, dass du allein fliegen willst? Wäre es nicht wunderbar, wenn wir in London ein paar Tage zusammen hätten? Nur du und ich!« Sie zog den Gummi fest, sodass der Pferdeschwanz genau dort saß, wo sie ihn haben wollte.
»Logisch wäre das klasse«, sagte Emma. »Vor allem, weil du immer die besten Secondhand-Schnäppchen findest.« Bei dem Gedanken, wie Marie sie durch die Straßen Londons schleppte, um auch noch die letzte versteckte Boutique aufzustöbern, lachte Emma kurz auf. »Aber wie ich dich kenne, hättest du tausend verrückte Ideen, um mich auf andere Gedanken zu bringen, und genau das will ich nicht. Nicht jetzt! Vermutlich finde ich in England nur heraus, dass es das Beste ist, meinen jetzigen Job aufzugeben. Aber vielleicht kommt mir auch ein Geistesblitz, was ich als Nächstes tun will. Ich brauche Abstand, Marie. Und Lösungen finde ich nun mal am ehesten, wenn ich drauflos marschiere. Nur ich ganz allein.«
Ein Schwarm Möwen flog übers Wasser. Emma folgte den Vögeln mit dem Blick. Niemand bereitete einen darauf vor, wie viele Entscheidungen man im Leben treffen musste und wie unzuverlässig das vielzitierte Bauchgefühl manchmal war. Wie oft fühlte sie sich in letzter Zeit wieder als Kind, bereit, die Eltern einschreiten zu lassen, damit diese sie schützten. Normalerweise stand sie ihre Frau, doch an manchen Tagen wollte sie sich einfach nur verkriechen.
»Tja, wenn das so ist …«, Marie schien in Gedanken eine Möglichkeit durchzuspielen, »… werde ich dich eben per Telefon begleiten. Wir besprechen per Skype, wie es läuft … Apropos weitergehen, was passiert eigentlich mit der Liebesliste deiner Mutter?« Plötzlich trat ein sehnsuchtsvolles Lächeln auf ihr Gesicht. »Hast du mal daran gedacht, ein Buch daraus zu machen? Peggys Tipps sind voller Hoffnung. Und Hoffnung ist das, was wir Frauen heute am meisten benötigen.«
»Ich weiß nicht …«, sagte Emma zögerlich. »Die Texte sind sehr privat.«
»Genau deshalb berühren sie ja. Ergänze das Ganze durch kurze Storys aus deiner Sicht. Mutter und Tochter im Gespräch. Weißt du, Emma, ich habe deine Eltern immer um ihre Beziehung beneidet.« Marie dachte an die Zuneigung, die Emmas Eltern füreinander empfunden hatten, an die Blicke, die Hannes Peggy zugeworfen hatte, Blicke, die sagten: Du bist der wichtigste Mensch für mich und die tollste Partnerin. »… und manchmal habe ich Angst, nie eine Liebe wie ihre zu erleben. Sicher geht es vielen Frauen ähnlich, und all denen würden die Tipps deiner Mutter helfen.«
Emma drückte den Rücken durch und sah Marie mit einem herausfordernden Blick an. »Vielleicht hast du recht. Wir sollten uns nicht unterkriegen lassen. Es gibt Beziehungen wie die meiner Eltern.« Wie oft hatte ihr Vater ihrer Mutter etwas aus der Küche oder dem Wohnzimmer zugerufen, woraufhin Peggy mit diesem strahlenden Lächeln im Gesicht im Türrahmen erschienen war, um ihm zu antworten. Sogar der alltägliche Austausch hatte sie getragen. Kurze Gespräche, denen sie kleine liebevolle Gesten folgen ließen: ein Kompliment, ein nettes Wort, ein Streicheln der Wange …
»Romantische Liebe, Emma. Darum geht es. Um nichts weniger als das große Glück«, sagte Marie euphorisch.
»Bisher habe ich lediglich halbintakte Beziehungen zustande gebracht, aber die Freundschaft zu dir ist stabil. Das ist auch eine Form von Glück.«
Sie kannten sich seit der ersten Klasse und wussten, dass sie sich aufeinander verlassen konnten, auch wenn sie nicht immer dasselbe dachten oder ähnlich empfanden. So war es bis heute.
»Egal, wie es im Moment aussieht. Glaub an eine positive Zukunft, Emma. Ohne zu zweifeln.« Marie hielt ihrer Freundin die flache Hand entgegen, und Emma klatschte ab.
»Was würde ich nur ohne deinen Optimismus tun?«, murmelte sie.
»Vermutlich danach suchen«, antwortete Marie und drückte Emma einen Kuss auf die Wange.
Emma wurde warm ums Herz. Auch Freundschaft war ein Stückchen Liebe, und diese Liebe konnte ihr niemand nehmen.
5. Kapitel
London
Ethan bog in die Toreinfahrt. Der Backsteinbau, in dem seine Mutter seit über dreißig Jahren lebte, lag friedlich in der Spätnachmittagssonne. Wie immer freute er sich auf ein paar Stunden nur mit ihr.
Er steuerte seine schwarze Harley den rückwärtigen Teil des Hauses entlang und parkte am Ende des Grundstücks. Dort stieg er von seinem Motorrad, nahm den Helm ab und lugte über die Mauer in den baumbestandenen Garten. Gewöhnlich gönnte er sich einige Minuten im Grünen, ehe er ins Haus ging. Doch heute war er spät dran und verzichtete auf seine obligatorische Gartenrunde. Er eilte die Treppe zum Hintereingang hinauf.
Vorm Eingang wandte er sich dem Klingelschild zu und drückte auf den Messingknopf. Dabei hielt er sein Gesicht grinsend der Kamera entgegen: »Hi Mum! Hi Sally! Hi Jasper! Falls ihr mich vermisst habt … hier bin ich …« Ein Summen ertönte, Ethan drückte mit der Schulter gegen die Tür und trat ins rückwärtige Foyer. Immer wenn er in die Little St. James’s Street kam, dachte er an seine behütete Kindheit zurück: an die Nachmittage mit dem Kindermädchen, das ihn vergöttert hatte, und an die Stunden in der Küche, wenn Sally Sandwiches belegt und ihm und seinen Freunden viel zu große Kuchenstücke abgeschnitten hatte.
Ethan hörte das Getrappel von Hundefüßen. Jimmy, ein Mischling, den er eines Tages aufgelesen hatte, rannte auf ihn zu und sprang an ihm hoch. Ethan beugte sich zu ihm hinunter und streichelte ihn zärtlich.
»Jimmy, alles klar im Haus?«
Jimmy leckte ihm über die Hand und wedelte übermütig mit dem Schwanz. Ethan warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Er hatte eine Viertelstunde, um sich fertig zu machen, danach wäre es Zeit, seine Mutter ins Savoy auszuführen, um dort mit ihr und fünfundzwanzig Gästen ihren vierzigsten Hochzeitstag zu feiern. Fünfzehn Minuten, um zu duschen und sich umzuziehen.
»Sorry, Jimmy. Heute habe ich sehr wenig Zeit. Aber du darfst mitkommen und mir Gesellschaft leisten.«
Ethan schlüpfte aus den Lederstiefeln und hängte die Biker-Jacke an die Garderobe, dann rannte er, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, ins Obergeschoss.
»Mum?«, rief er auf halber Strecke nach oben. »Ich hoffe, du machst mich sprachlos, wenn ich dich gleich zu Gesicht bekomme.«
In der Galerie im ersten Stock schmückten unzählige Schwarzweißfotos die Wände. Viele der Schnappschüsse zeigten seine Eltern, doch mindestens die Hälfte zeigte ihn, von seiner Geburt bis heute.
»Mum? Bist du irgendwo hier oben?«, rief Ethan, als er an der Ahnengalerie, wie er die Fotos im Stillen nannte, vorbeimarschierte.
»Bin im Bad …«, hörte er die Stimme seiner Mutter.
»Okay«, er nickte seinem Spiegelbild zu, das ihm von der Wand entgegenblickte. »Das kann dauern«, sagte er zu Jimmy, der ihm gefolgt war. Seine Mutter verließ das Bad nicht eher, bis Make-up und Haare tipptopp waren, er musste sich in Geduld üben.
Er öffnete die Tür zu seinen privaten Räumen, schritt durch das Wohnzimmer und betrat den Ankleideraum. In Windeseile stieg er aus der Lederhose und zog sich den Pulli und das Shirt über den Kopf. Im Bad drehte er die Dusche auf und stellte sich unter den Wasserfall, dessen angenehm warmes Wasser auf ihn hinunterprasselte. Die letzten Tage hatte er kaum geschlafen, und auch heute würde es wieder spät werden. Er regulierte von warm auf kalt und genoss das Prickeln, als das eiskalte Wasser auf seine Haut traf. Die Kälte tat ihm gut, erfrischte ihn. Eine Minute hielt er durch, dann drehte er den Hahn zu und griff nach dem Handtuch.
Der Hochzeitstag seiner Eltern war ein Höhepunkt des Jahres. Schon zu Lebzeiten seines Vaters war das Ereignis mit einem Dinner im Savoy und einer anschließenden Partie Schach gefeiert worden. Wenn die Gäste nach dem Dinner nach Hause fuhren, war seine Mutter aus den Pumps geschlüpft, erleichtert, die Füße entspannen zu können, während sein Vater sich von der lästigen Fliege und dem Smokingjackett befreite. Mit zwei Gläsern Whisky und Eis hatte er sich in den Sessel vor dem Kamin geworfen und die Partie Schach für eröffnet erklärt.
Seit einigen Jahren vollzog Ethan nun dieses Ritual mit seiner Mutter. Wenn Ava nach dem Dinner mit ihm Schach spielte, konnte sie endlich ihr Gefühlskorsett ablegen. Dieses Korsett half ihr, den Alltag zu meistern und nicht zu vergessen, dass das Leben ihr viele schöne Jahre mit John geschenkt hatte. Jahre, für die sie dankbar war.
»Jeder sollte das Glück über die Trauer stellen, denn Glück zählt doppelt«, behauptete sie seit je. Es war leicht, diesen Satz auszusprechen, jedoch schwer, ihn zu leben, denn auch nach so vielen Jahren litt Ava noch immer darunter, John nicht mehr an ihrer Seite zu haben.
Ethan trat vor den Spiegel im Bad, um sich ein zweites Mal zu rasieren. Wie er seine Mutter kannte, würde sie auch heute keine Träne vergießen. Egal, wie schmerzlich dieser Tag für sie war, während des feudalen Dinners wäre sie die strahlende Gastgeberin, und erst wenn sie unter sich wären, würde er ihr ansehen, dass der Tag sie schmerzlich an den Verlust ihrer großen Liebe erinnerte.
Ethan ließ den elektrischen Rasierer über sein Kinn gleiten, über beide Wangen und die empfindliche Stelle unter der Nase. Als er fertig war, ging er in den Ankleideraum und suchte sein Smokinghemd. Während er das Hemd zuknöpfte, ignorierte er ein Gefühl von Unbehagen. Liberty, mit der er sich seit einigen Monaten traf, hatte ihn heute zweimal zu erreichen versucht, doch es hatte sich keine Lücke ergeben, um sie zurückzurufen. Er stieg in die Hose und band sich die Fliege, schlüpfte in das Smokingjackett, zog die Manschetten unter dem schwarzen Stoff hervor und trat hinaus auf den Gang. Im Haus herrschte eine Stille, die ihn jedes Mal vergessen ließ, dass er sich im Zentrum Londons befand. Die Wände des Hauses waren perfekt isoliert, die Zimmer mit Farben von Farrow & Ball gestrichen, und an den Fenstern hingen schwere Damastvorhänge einer englischen Traditionsmarke. Hier konnte man die Hektik des Alltags hinter sich lassen; hier befand man sich in einem abgeschirmten Universum.