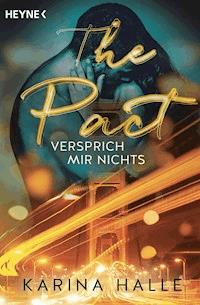9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Chaos-Queen meets Bodyguard Piper Evans ist Grundschullehrerin und eigentlich hochzufrieden mit ihrem beschaulichen Leben auf einer abgeschiedenen kanadischen Insel – bis der britische Kronprinz und seine Frau das Anwesen nebenan mieten. Prince Edward und die berühmte Sängerin Monica Red sind zwar ein Traumpaar, aber ihr düsterer Bodyguard Harrison Cole ist eher ein Albtraum. Gleich bei ihrem ersten Zusammentreffen beschließt er, dass Piper eine Gefahr für die royale Sicherheit ist. Als dann auch noch die Paparazzi vor ihrer Tür auftauchen, ist sie heillos überfordert. Und dass Harrison zwar abweisend, aber auch enorm attraktiv ist, macht das Chaos in Pipers Leben nicht unbedingt leichter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Sammlungen
Ähnliche
Karina Halle
Die Royals, ihr Bodyguard und ich
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für Taylor
Und für meine Eltern, Tuuli & Sven
Eins
Nicky Graves hat sich gerade in meine Handtasche übergeben.
Es ist meine eigene Schuld, wirklich. Ich wusste, dass er krank ist, auch wenn er mit dem Mut eines Achtjährigen versucht hat, so zu tun, als wäre nichts.
Als ich in seinem Alter war, genügte mir bereits eine lauwarme Stirn, um den ganzen Tag im Büro der Schulschwester zu hocken, bis meine Mutter mich abholte. Jede Ausrede war mir recht, um die Schule zu schwänzen.
Aber Nicky liebt die Schule (und da ich seine Klassenlehrerin bin, sollte ich mich an dieser Stelle geehrt fühlen), weshalb er so getan hat, als ginge es ihm gut, bis es ihm gar nicht mehr gut ging.
Ich habe es sogar in Zeitlupe mitverfolgt. Ich las den Kindern gerade eine Passage aus ihrem Lieblingsbuch ›Mercy Watson‹ vor, in der es darum ging, dass das Schwein Buttertoast liebt, als Nickys Gesicht eine kränklich grüne Farbe annahm. Seine Hand schoss hoch an seinen Mund, und noch bevor ich irgendetwas tun konnte, rannte er zum Abfalleimer neben meinem Pult. Was ja super gewesen wäre, wenn meine Handtasche nicht direkt neben dem Eimer gestanden hätte und Nicky genauso treffsicher wäre wie LeBron James.
»Tut mir leid, Miss Evans!«, heulte Nicky, während er neben meiner bis vor Kurzem noch sehr schönen Ledertasche stand, die ich vor ein paar Jahren in Mexiko gekauft habe, als ich dort mit meinem Ex, Joey, in Urlaub war. Aber irgendwie passt es auch, dass die Tasche jetzt nur noch ein einziger Kotzhaufen ist, denn genau als den hatte sich unsere Beziehung entpuppt. Metapher, die 101ste.
»Alles gut, Nicky«, sage ich zu ihm und versuche, ruhig zu klingen, obwohl der Panikpegel in der Klasse merklich steigt, während die Kinder »Ihhh!« und »Nicky hat gekotzt!« und »Ich kotz gleich!« durcheinanderschreien.
Ich werfe mein Buch hin und eile zu ihm, wobei ich angestrengt versuche, meinen Würgereflex zu unterdrücken. Das ist nicht unbedingt mein Lieblingspart an dem Job, und vermutlich bin ich die einzige Grundschullehrkraft, der immer noch so schnell übel wird. Ich schnappe mir eine ganze Box Kleenextücher, und irgendwie schaffe ich es, Nicky sauber zu putzen, erst die Schulschwester anzurufen und dann seine Mutter, damit sie ihn abholt, und die Klasse zu beruhigen.
Erst als die Schulglocke läutet, habe ich Zeit, mich um die vollgekotzte Tasche zu kümmern.
Ich starre sie an und frage mich, ob ich sie nicht einfach abschreiben und entsorgen sollte, als es an der Tür klopft. Es ist Cynthia Bautista, die Lehrerin der ersten Klasse, die ihren Kopf durch die Tür steckt, das Mitgefühl steht ihr deutlich ins Gesicht geschrieben. Sowie ein Hauch Ekel.
»Alles okay? Wie ich hörte, hattest du heute eine Spucki.«
Ich deute auf meine Tasche, die ich immer noch nicht angerührt habe. »Na ja, ich darf mir jetzt eine neue Tasche kaufen.«
Cynthia kommt rein, inspiziert sie und verzieht das Gesicht. »Oh. Shit.« Dann schlägt sie sich eine Hand vor den Mund und lacht los. »Tut mir leid. Das ist nicht lustig.«
»Keine Sorge, wenn es dir passiert wäre, würde ich jetzt auch lachen.«
Cynthia ist eine der wenigen aus dem Kollegium, mit denen ich befreundet bin. Dabei bin ich kein Mensch, mit dem schwer auszukommen ist – der Wunsch, Leuten zu gefallen, ist seit meiner Kindheit tief in mir verwurzelt –, aber es gibt einfach nicht viele Menschen, die verstehen, wie ich ticke, vor allem nicht dort, wo ich lebe, und erst recht nicht im Schulsystem. An der SSI Elementary herrschen strikte Regeln und eine strenge Hierarchie, und ich werde immer noch wie ein Neuling behandelt, obwohl ich schon einige Zeit hier lebe und arbeite. Man sagt, dass die meisten Leute, die es nach Salt Spring Island verschlägt, nur wenige Jahre hier durchhalten, aber wenn man ganze fünf schafft, dann wird man als »echter Insulaner« betrachtet. Ich bin jetzt fünf Jahre hier, und es ist mir nicht gelungen, irgendwen näher kennenzulernen. Offenbar glauben die Leute, dass ich eines schönen Tages zusammen mit der Flut wieder von hier verschwinde.
»Ich glaube, die musst du wegwerfen«, sagt Cynthia und rümpft die Nase. »War da irgendwas von Wert drin?«
Ich nicke. »Meine Brieftasche. Make-up. Ein Buch. Tic Tacs.«
Meine angstlösenden Medikamente, füge ich im Stillen hinzu. Aber das braucht Cynthia ja nicht zu wissen.
Dann fällt es mir wieder ein. »Oh warte. Vielleicht …« Ich gehe in die Hocke und stochere mit dem Finger vorsichtig gegen das Außenfach, in das ich, soweit ich mich erinnere, heute Morgen meine Bankkarte gesteckt habe, nachdem ich mir bei Salty Seas Coffee & Goods einen Kaffee geholt hatte. Meine Bankkarte und Kreditkarte scheinen von Nickys Mageninhalt unberührt zu sein. Leider sind das die einzigen Sachen, die noch zu retten sind.
»Mist.« Ich klatsche die Karten auf mein Pult und blicke Cynthia müde an. »Magst du mir einen Gefallen tun?«
»Zur Hölle, nein«, sagt sie und schüttelt rigoros den Kopf. Cynthia ist ziemlich hart im Nehmen. Sie ist mit zwanzig von den Philippinen hierher emigriert, hat eine schreckliche Scheidung hinter sich und erzieht ihre zehnjährige Tochter jetzt ganz allein. »Diese Tasche samt Inhalt ist für immer verloren. Du kannst dir einen neuen Führerschein besorgen. Und Make-up. Und Bücher. Und Tic Tacs.«
Sie hat recht. Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Es ist erst kurz nach drei, also noch genug Zeit, um zum Stadtbüro zu fahren und einen neuen Führerschein zu beantragen. Zum Glück liegt unsere Schule im Zentrum unserer winzigen Stadt, sodass alles in erreichbarer Nähe ist. »Ich fahre da besser jetzt gleich hin, bevor ich es wieder vergesse. Haben wir eigentlich eine Giftmülltonne?« Ich beäuge die Handtasche.
Cynthia sieht mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Du willst jetzt los, um einen neuen Führerschein zu beantragen? Bist du eigentlich heute schon mal draußen gewesen?«
Ich schüttele den Kopf. Während der Pausen und über Mittag bin ich an meinem Pult geblieben und habe mein Buch gelesen, in Vorbereitung auf die neue Folge meines Podcasts, die ich heute Abend aufnehmen möchte. Das Buch habe ich zwar schon gelesen, aber ich wollte es noch mal überfliegen, um die wesentlichen Punkte meiner Rezension noch etwas aufzumöbeln.
»Wieso? Was ist los?«
Diese Insel ist klein, und hier passiert nie viel. Vielleicht findet irgendwo eine Hippie-Demo gegen einen Mobilfunkmast statt oder so.
Cynthia reißt die Augen auf und sie bekommt diesen aufgeregten, wissenden Gesichtsausdruck. »Hast du’s nicht mitbekommen?«
Ich starre sie ausdruckslos an und verschränke meine Arme vor der Brust. Offenbar nicht. »Was?«
»Du weißt, wer Prince Edward und MRed sind?«
Ob ich weiß, wer Prince Edward und MRed, aka Monica Red, aka, Monica, die Duchess of Fairfax sind? »Cynthia, ich lebe auf einem Felsen, nicht darunter.«
»Na ja, anscheinend lebst du doch auch unter einem. Sie sind hier! Also, heute. Jetzt. Und sehen sich nach einer Immobilie um. Die ganze Insel steht kopf. Schon den ganzen Morgen lang treffen Paparazzi in Wasserflugzeugen ein, die Fähren sind brechend voll mit Schaulustigen. Die ganze Stadt ist quasi zum Erliegen gekommen.«
Mein müdes Gehirn kann nichts davon richtig begreifen.
Also, Prince Edward, der jüngere, stoische Sohn von Queen Beatrix und ihrem Ehemann Prince Albert, hat vor Kurzem eine grammydekorierte Sängerin namens MRed geheiratet und damit die Presse in helle Aufregung versetzt. Monica ist nicht nur schwarz, sie ist auch Amerikanerin und hat erfolgreich Karriere gemacht mit möglicherweise nicht ganz jugendfreien Songs, spärlich bekleideten Musikvideo-Auftritten, viralen Performances usw. Mit anderen Worten, die britische Presse behandelt die beiden absolut brutal, einschließlich Rassismus und Slut-Shaming, wo man nur hinsieht. Ich bin nun keineswegs glühender Fan der Royals, aber ich halte mich, was sie angeht, durchaus auf dem Laufenden (sie dominieren sowieso allerorts die Nachrichten), und in diesem Zusammenhang habe ich noch nie gesehen, dass die Medien Eddies älteren Bruder Prince Daniel attackieren, der noch Junggeselle und ein notorischer Schürzenjäger ist.
Auf jeden Fall wurde überall berichtet, dass Monica und Eddie das Vereinte Königreich aus ungenannten Gründen für ein Jahr verlassen würden. Als eine Art Sabbatjahr. Einige Leute spekulierten, sie würden nach Seattle gehen, um in der Nähe ihrer Eltern zu sein. Andere dachten an den Wintersportort Whistler, wo die königliche Familie früher, als Eddie und Daniel noch klein waren, immer die Winterferien verbracht hat. Wieder andere vermuteten Indien, wo das Paar oft Wohltätigkeitsarbeit leistet.
Nicht in einer Million Jahre wäre mir in den Sinn gekommen, dass sie sich auf dieser Insel in British Columbia, Kanada, niederlassen würden, ein kleines, aber exzentrisches Fleckchen zwischen Vancouver Island und dem Festland.
Ehrlich gesagt, ich kann es immer noch nicht glauben. Nichts davon erscheint richtig.
»Bist du sicher?«, frage ich Cynthia. »Vielleicht ist es ja auch nur irgendein Schauspieler oder so.« Unsere Insel ist bekannt dafür, der perfekte Rückzugsort für Eremiten zu sein (und ich kann das bestätigen – wenn ich nicht arbeiten müsste, würde ich das Haus wohl so gut wie nie verlassen). Es gibt hier viele bekannte Autoren, die sich in ihren Schreibateliers abrackern, und Ex-Musiker, die manchmal in der örtlichen Kneipe spielen, und ausnahmslos alle, von Barbra Streisand bin hin zu Raffi, hatten hier irgendwann mal ein Sommerhaus.
»Nein, es sind Eddie und Monica«, insistiert Cynthia. »Glaubst du mir etwa nicht? Dann geh in die Stadt, und du wirst von diesem Wahnsinn überrollt.«
Sie klingt völlig atemlos, als sie »Wahnsinn« sagt, und ihre Augen glänzen fiebrig. Es ist ziemlich offensichtlich, dass Cynthia das Ganze genießt. Unsere kleine, beschauliche Stadt ein Tummelplatz für Paparazzi? Das hört sich in meinen Ohren schrecklich an. Ich komme ja schon mit den Besuchermassen während der Sommerferien nicht klar, die übrigens nur noch zwei Wochen entfernt sind.
»Okay. Dann fahre ich jetzt einfach am besten nach Hause. Hoffentlich werde ich auf dem Weg nicht von der Polizei angehalten.«
»Keine Sorge, die haben alle Hände voll, das Chaos da draußen zu bändigen.« Sie sagt das mit einem schadenfrohen Grinsen und legt dabei die Fingerspitzen aneinander wie Mr Burns aus den Simpsons.
Wir verabschieden uns, und ich schnappe mir die Kotztasche und bringe sie ins Büro der Schulschwester, wo Judy (tagsüber Schulschwester und abends Kellnerin im Sitka Spruce Restaurant) noch beim Aufräumen ist. Sie zuckt nicht mal mit der Wimper und willigt ein, die Tasche für mich zu entsorgen, so als würde sie eine Leiche beseitigen. Mittlerweile fühlt es sich auch irgendwie so an, und ich verschwinde schnell, bevor sie ihre Meinung ändert.
Die Schule ist nach drei Uhr nachmittags vermutlich mein absoluter Lieblingsort. Normalerweise treiben sich zwar immer noch ein paar Schüler und Schülerinnen im Gebäude herum, um die Zeit totschlagen, bis sie abgeholt werden, aber heute ist es warm, sonnig und trocken (im Gegensatz zu der sonst üblichen nassen, trüben Kälte), sodass sich alle draußen aufhalten. Ich bin allein auf den Fluren und genieße es, nicht zu Hause zu sein, ohne Stress und Verantwortung, einfach nur für mich.
Langsam schlendere ich den Korridor hinunter, betrachte lächelnd die ausgestellten Kunstwerke der Kinder, dann trete ich durch die Tür nach draußen und gehe Richtung Parkplatz, wo mein Auto steht. Es ist ein 2000er Honda Civic mit Fließheck, den ich »Mülltonne« getauft habe (weil er silbern und verbeult ist) und dessen Sitze mit grünen flauschigen Schonbezügen bespannt sind, als Hommage an Oskar aus der Mülltonne. Fast jeder auf der Insel hat ein Elektroauto, und auch für mich steht eins definitiv ganz oben auf der Wunschliste (neben dem Ziel, Geld zu sparen), aber da ich mit nur einem Einkommen mich und meine Mutter durchbringen muss, ist ein neues Auto nur ein weiterer unerreichbarer Traum, zusammen mit der Weltreise und dass ich mich in jemanden verliebe, der es wirklich verdient hat.
Trotzdem, ich mag die gute alte Mülltonne. Ich könnte die Beulen ausbessern lassen, aber auf unserer Insel schert sich niemand um so was, und sie verbraucht nur sehr wenig Sprit. Am Rückspiegel baumeln zwei Plüschwürfel – hat mein Vater an einem Greifautomaten für mich abgeräumt, als ich zehn war, bevor er uns sitzen gelassen hat –, und mein Handschuhfach ist bis zum Rand vollgestopft mit Tic-Tac-Boxen, Fährtickets und wer weiß was sonst noch allem.
Ich steige ein, und obwohl ich nicht den Weg durch die Stadt nehme, weiß ich sofort, was Cynthia gemeint hat. An den Rändern der Hauptstraße, die Richtung Zentrum führt, sind die Autos in unordentlichen Reihen geparkt. Das ist höchst ungewöhnlich für einen Donnerstagnachmittag im Juni. Es sieht hier eher so aus wie samstags am Markttag während der Hochsaison im Sommer, nur noch krasser, und ich vermute, die Leute sind nicht hier, um sich das Biogemüse oder Hanfklamotten oder selbst gemachte Geldbeutel in Vulvaform anzusehen (ja, die sind jetzt Trend).
Ich schüttele den Kopf und biege von der Straße ab, heilfroh, dass ich mich heute mit nichts von alldem herumplagen muss. So richtig kann ich immer noch nicht glauben, dass die abtrünnigen Royals gerade hierhergekommen sein sollen. Ich meine, ich lebe wirklich gern hier, es ist fabelhaft und bezahlbar, und ich kann mein Einsiedlerdasein fristen, ohne dass es jemanden kümmert, aber ich wüsste nicht, wieso Prince Eddie und MRed sich zu diesem Ort hingezogen fühlen sollten. Also, ja klar, es ist herrlich und abgeschieden. Aber man steckt auch irgendwie fest.
Mein Haus steht an der Spitze einer Halbinsel namens Scott Point, die vermögendste und eingeschworenste Gemeinde der ganzen Insel.
Ich bin wie ein Splitter im schmalen Finger der Halbinsel, den man partout nicht loswird. Ja, uns gehört das Haus, in dem wir wohnen, ein bezauberndes Dreizimmerhaus mit Zedernschindeln, das früher das Dienstbotenquartier der Villa nebenan war, aber statt eines glänzenden Range Rovers oder Teslas fahre ich eben die Mülltonne (zum Hintergrund: die Mülltonne gehörte früher mal meiner Mutter, bis sie meinen Kia Soul geschrottet hat, aber egal … lange Geschichte), und meine Mutter und ich sind nicht besonders dicke mit unseren Nachbarn. Wir gehören nicht dazu, aber wir wurschteln uns so durch.
Doch die Landschaft ist wirklich atemberaubend. Es gibt nur eine einzige schmale Straße, die sich wie eine Arterie durch die Mitte der Halbinsel zieht und von immergrünen Erdbeerbäumen gesäumt wird, deren abblätternde, rote Rinde so dünn und zart wie japanisches Reispapier ist. Zu beiden Seiten stehen Häuser, umgeben von hohen Zäunen aus Zedernholz. Zwischen den Häusern hindurch kann man einen Blick aufs Meer erhaschen, auf dem die Sonne glitzert, dass man eine Gänsehaut bekommt. Das Glitzern zu dieser Tageszeit verspricht, dass der Sommer in vollem Gange ist, und der Sommer ist meine Jahreszeit der Träume.
Ich träume davon, mich mit einer Tasse Tee unten auf den Steg zu setzen und die Sonne zu genießen, als ich plötzlich scharf bremsen muss.
Statt der üblichen Rehe oder Wachtelfamilien, die die Straße überqueren, steht ein sehr großer, breitschultriger Mann in der Mitte des Weges und hält mir seine flache Hand entgegen.
Scheiße. In meiner Lunge fängt es an zu piksen, und mein Herz rast. Meine Angst hat keine Probleme damit, sich gleich ins Worst-Case-Szenario zu stürzen, nämlich dass meiner Mutter etwas zugestoßen ist, während ich bei der Arbeit war. Es gibt keinen Moment, in dem diese Angst nicht in meinem Hinterkopf lauert, und ich fürchte, mein schlimmster Albtraum ist eingetreten, als dieser sehr grimmig dreinblickende Fremde in einem dunklen Anzug hügelabwärts auf mich zumarschiert.
Mein Fenster ist bereits unten, und ich höre ihn in einem kratzigen britischen Akzent sagen: »Entschuldigung, Miss?« Er wirkt eher schroff als mitleidsvoll, was mich ein bisschen beruhigt.
»Ja, bitte? Was ist denn los?«, frage ich und versuche, nicht in Panik zu verfallen.
Jetzt aus der Nähe kann ich ihn mir genauer ansehen. Sein Anzug ist marineblau und sitzt perfekt, darunter trägt er ein gebügeltes weißes Hemd und eine dunkelgraue Krawatte.
Von Nahem ist er noch viel beeindruckender, gebaut wie eine Douglas-Fichte, irgendwie stämmig auf anmutige Weise. Mein Blick wandert vom breiten Brustkorb zu seinem Gesicht, das zur Schroffheit seiner Stimme passt. Er trägt eine Sonnenbrille, die mein eigenes verwirrtes Gesicht widerspiegelt (und mich feststellen lässt, dass meine Haare ein einziges blondes Rattennest sind, weil ich mit offenem Fenster gefahren bin). Sollten seine Augen zu der wie eingemeißelt wirkenden Furche zwischen seinen dunklen Augenbrauen passen, bin ich definitiv eingeschüchtert.
Irgendwie kommt er mir vage bekannt vor, aber ich kann ihn beim besten Willen nicht einordnen. Als würde er mich an einen berühmten Schauspieler erinnern oder so.
»Sie müssen umkehren«, erklärt er steif und wedelt mit der Hand.
»Aber ich wohne hier«, protestiere ich.
Die Furche zwischen seinen Augenbrauen wird tiefer, und sein Mund verzieht sich zu einem harten Strich. Mit diesem Mann ist nicht zu spaßen. Ruckartig deutet er mit seinem markanten, bärtigen Kinn die Straße hinunter. »Sie müssen auf der Stelle umkehren«, wiederholt er.
Ich blinzele ihn an. »Entschuldigung, aber wer sind Sie überhaupt? Ich werde nicht umkehren, ich wohne hier. Und wenn Sie mich nicht nach Hause zu meiner Mutter lassen, die übrigens an DPS und BAS leidet, wird sie vor lauter Sorge die Polizei rufen, wenn ich nicht auftauche. Verdammt, ich werde die Polizei anrufen und Sie anzeigen.«
Der Mann starrt mich an, und ich starre zurück auf mein erschöpftes Spiegelbild. Mein Blick schweift kurz ab, und ich bemerke, dass er abstehende Ohren hat, und sofort fühle ich mich etwas weniger eingeschüchtert.
Als er schließlich wieder spricht, rechne ich damit, dass er mich erneut auffordern wird umzudrehen, stattdessen fragt er: »Was ist DPS?«
Ich seufze. Es war nicht meine Absicht, die psychische Erkrankung meiner Mutter in die Sache mit reinzuziehen. Tatsächlich gibt es nur sehr wenige Menschen in meinem Umfeld, die genau wissen, was sie hat, und so fühlt sich die Tatsache, dass ich ihm – diesem sehr herrischen, groben unbekannten Briten im Anzug – die Wahrheit erzählt habe, falsch an.
»Das ist die Abkürzung für dependente Persönlichkeitsstörung. Und bevor Sie fragen, BAS bedeutet bipolare affektive Störung.«
Er reckt das Kinn, und ich bin nicht sicher, ob er es aus Trotz tut oder weil er mir weitere Fragen stellen will, deren Antworten er nachher genauso gut ergoogeln könnte. Dann sagt er mit leiser, rauer Stimme: »Wie lautet Ihre Adresse?«
Ich will sie ihm gerade nennen, doch dann zögere ich. »Moment mal, Sie haben mir noch nicht gesagt, wer Sie sind. Warum sollte ich einem Wildfremden meine Adresse verraten? Glauben Sie etwa, ich bin scharf darauf, mitten in der Nacht Ihre Visage an meinem Fenster zu sehen?«
Sein Runzeln verstärkt sich. »Sie denken, ich sei ein Spanner?«
»Keine Ahnung. Ich weiß ja nichts über Sie, noch nicht mal Ihren Namen.«
»Mein Name ist Harrison«, sagt er widerstrebend. »Harrison Cole, PSB. Und wenn Sie nicht beweisen können, dass Sie dort wohnen, wo Sie behaupten zu wohnen, werden Sie umkehren müssen. Ich habe schon den ganzen Tag lang Autos abgewiesen und kein Problem damit, mit Ihnen genauso zu verfahren.«
Wow. Was für ein Arschloch. Ich räuspere mich. »Tut mir leid, Harrison Cole … Ist das ein ausgedachter Name oder Ihr echter?«
Er grunzt daraufhin, und wenn sich seine Zornesfalte noch tiefer eingräbt, zerfällt sein Gesicht gleich in zwei Hälften.
Der kann mich mal mit seiner demonstrativ maskulinen, ruppigen Art. Ich rede einfach weiter. »Und da Sie mich gerade gefragt haben, wofür DPS steht, obwohl es Sie nicht das Geringste angeht, will ich jetzt auch wissen, was PSB bedeutet. Penetrant sturer Blödmann? Peinlich selbstgerechter Betonkopf?«
»Personenschutzbeamter«, brummt er. »Im Dienste Ihrer Majestät, der Queen.«
Ich blinzele, während sich in meinem Hirn Stück für Stück alles zusammenfügt. »Wie ein Bodyguard? Sind Sie … Oh mein Gott, sind Sie der Bodyguard von Eddie und MRed?«
Er sagt nichts, und das muss er auch nicht. Es dämmert mir – eine große helle Glühbirne leuchtet in meinem Kopf auf –, dass er mir nicht deshalb bekannt vorkommt, weil er mich an einen Schauspieler erinnert, sondern weil ich sein Gesicht in den Klatschseiten und Nachrichten gesehen habe. Meist irgendwo im Hintergrund, in der Nähe von Eddie und Monica. Er ist der Typ, der auf Twitter »Broody Bodyguard« und »Sexy Secret Agent« getauft wurde, und ich bin schon über einige Fanfics mit ihm gestolpert (und mit »gestolpert« meine ich, dass ich sie ganz bewusst verschlungen habe. Für meinen Podcast, versteht sich …).
Und jetzt steht er hier und erklärt mir, dass ich wegfahren soll. Was bedeutet, dass sich das royale Paar irgendwo in der Nähe befindet.
»Ich lasse Sie zu Ihrem Haus fahren, wenn Sie nachweisen können, dass Sie dort wohnen«, sagt er schließlich. »Zeigen Sie mir Ihren Führerschein.«
Oh … das.
Ach, verdammt.
Zwei
Ich starre den Sexy Secret Agent einen Moment lang an und überlege, ob er mir meine Kotzgeschichte glauben wird. »Ich … ich habe keinen«, sage ich schließlich.
Ich kann spüren, wie er mich fassungslos mustert. »Sie haben keinen Führerschein?«
»Ich weiß, ich weiß. Heute Morgen hatte ich noch einen, aber dann hat mir ein Schüler in die Handtasche gekotzt. Spucki-Nicky haben die Kinder ihn genannt. Aber es war meine eigene Schuld, um ehrlich zu sein.«
»Ein Junge hat was getan?« Dann schüttelt er den Kopf. »Klingt nach einer schlechten Ausrede.«
Er macht Witze, wenn er glaubt, dass das eine schlechte Ausrede ist. Ich bin bei der Arbeit an ›Der-Hund-hat-meine-Hausaufgaben-gefressen‹-Ausreden gewöhnt, und je haarsträubender sie sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie stimmen. Es sei denn, die Hausaufgaben wurden von Velociraptoren gefressen oder so.
»Ich meine es ernst«, erwidere ich. »Ich wollte mir eigentlich nach der Arbeit einen neuen machen lassen, aber die ganze Stadt steht kopf, weil … na ja, weil Sie hier sind.«
»Dann können Sie stattdessen bestimmt Ihre Versicherungspapiere vorzeigen«, sagt er ruhig und faltet die Hände vor seiner Körpermitte, mein Blick folgt der Bewegung. »Da müsste ja Ihre Adresse draufstehen.«
Schnell wende ich den Blick ab und öffne das Handschuhfach, aus dem ein ganzer Schwung leerer Tic-Tac-Boxen herauspurzelt.
»Äh«, mache ich, während ich die Plastikboxen und einen losen Blätterhaufen durchwühle und dabei über die Schulter zu dem PSB blicke, der mich mit hochgezogenen Augenbrauen beobachtet. Na, wenigstens runzelt er nicht die Stirn. »Tut mir leid. Einen Moment.«
»Das sind eine Menge Tic Tacs.« Pause. »Sie müssen einen sehr frischen Atem haben.«
Macht er … einen Scherz? Ob er überhaupt weiß, was ein Scherz ist?
Meine Finger schließen sich um die Kunststoffhülle mit den Versicherungspapieren, ich setze mich atemlos in meinen Sitz zurück und halte sie ihm hin. »Ich habe in der Tat frischen Atem. Ich esse sie, wenn ich Stress habe.«
Den zweiten Satz hätte ich mir vermutlich verkneifen können.
Er nimmt die Unterlagen entgegen und zieht das erste Blatt Papier aus der Hülle. Er studiert es eingehend, dann gibt er es mir zurück.
»Miss, das ist ein Brief an den Weihnachtsmann von einem Mädchen namens Chamomile.« Er nimmt sich das nächste Blatt vor wie ein Anwalt, der vernichtendes Beweismaterial bei einem Prozess präsentiert. »Und das ist ein Brief von einem Jungen namens Spruce, der sich eine Bongo-Trommel zu Weihnachten wünscht.«
»Was?« Ich reiße ihm die Papiere aus den Händen. Es sind Briefe von Chamomile, Spruce, Jet und Eunice. Mist. Jetzt weiß ich, wo ich die ganze Weihnachtspost hingepackt habe, die ich letztes Jahr versprochen hatte abzuschicken.
»Interessante Namen«, bemerkt er. »Ich bin mir noch nicht sicher, ob Sie Lehrerin oder die Anführerin einer Hippie-Kommune sind.«
»Definitiv Ersteres.« Ich lehne mich über die Beifahrerseite und fange wieder an, das Handschuhfach zu durchforsten. Da sind die Nachweise über die Tollwutimpfung meines Hundes Liza, zwei historische Liebesschmöker von Sarah MacLean, eine Million Kassenzettel. Einen kurzen Moment lang glaube ich, die Versicherungspapiere gefunden zu haben, doch dann stelle ich fest, dass das, was ich in der Hand halte, nur die Speisekarte unserer örtlichen Pastabar ist.
»Miss, tut mir leid, aber ich habe schon mit vielen Leuten wie Ihnen zu tun gehabt«, höre ich ihn sagen, während ich hektisch anfange, alles zu zerpflücken. »Sie erfinden irgendeine Ausrede, haben aber keinerlei Beweise zur Hand. Ich schließe daraus, dass Sie keine Fotografin oder Journalistin sind, sondern einfach nur ein Fan, aber so oder so, Sie müssen jetzt verschwinden, andernfalls rufe ich die Polizei.«
Ich setze mich aufrecht hin, mein Haar ist zerzaust, mein Gesicht puterrot und leicht verschwitzt. Mit zusammengekniffenen Augen starre ich seine Pilotenbrille an. »Was soll das heißen, Sie glauben nicht, dass ich eine Journalistin sein könnte?«
Er seufzt kraftlos und wedelt wieder mit der Hand. »Wenn Sie jetzt bitte so freundlich wären.« Dann hält er inne und entdeckt etwas in der Ferne. »Na endlich.«
Ich recke den Hals und sehe nach hinten. Es ist ein Polizeiwagen; der SUV unseres Polizeichefs Bert Collins kommt hinter mir zum Stehen.
»Gott sei Dank!«, entfährt es mir laut, sehr zur Überraschung von Agent Miesepeter.
Bert steigt aus dem SUV und schlendert zu uns herüber. »Tut mir leid, ich bin spät dran«, sagt er zu Mr Broody. »Ich wurde in der Stadt aufgehalten. Das ist das reinste Tollhaus!«
»Bert!«, rufe ich, bevor der PSB zu Wort kommen kann. Ich hänge mit meinem Oberkörper praktisch halb aus dem Fenster. »Hey!«
»Hallo, Piper«, sagt er, sein Schnurrbart bewegt sich, während er spricht. Bert hat einen Schnurrbart, bei dem sowohl Tom Selleck als auch Kenny Rogers vor Neid erblassen würden. Als hätte ihm jemand eine Schuhputzbürste an die Oberlippe geklebt.
»Bert, eins der Kinder hat heute in meine Tasche gekotzt, und meine Brieftasche war darin. Ich musste alles wegschmeißen. Ich wollte mir nach der Schule einen vorläufigen Führerschein machen lassen, aber in der Stadt war die Hölle los.« Ich werfe einen vielsagenden Blick auf Harrison, bevor ich weiterrede. »Und dieser Typ glaubt mir nicht, dass ich hier wohne.«
Bert verschränkt die Arme. »Du weißt genau, dass es für das Fahren ohne Führerschein Ärger geben kann.« Er seufzt und sieht Harrison wohlwollend an. »Aber ich kann für sie bürgen.«
»Ihre Versicherungspapiere hat sie auch nicht dabei«, platzt Harrison heraus.
Was soll das jetzt? Der Kerl haut mich voll in die Pfanne.
Bert sieht mich mit gerunzelter Stirn an, als wäre er maßlos enttäuscht von mir. Ich winde mich innerlich. »Stimmt das? Du fährst ohne gültigen Führerschein und ohne Versicherungspapiere durch die Gegend?«
Ich lächele ihn zaghaft an. »Ich war gerade dabei, nach den Papieren zu suchen, als du aufgetaucht bist. Einen Moment noch.«
Ich will mich gerade wieder auf meinen Kramhaufen stürzen, als Bert sagt: »Nein, schon gut. Ich vertraue dir, dass du sie noch findest.« Er sieht wieder Harrison an. »Alles in Ordnung, sie wohnt auf dem großen Anwesen am Ende der Straße.«
Harrisons Zornesfalte vertieft sich, eine Schlucht zwischen seinen Augenbrauen. »Aber das ist doch, wo … da steht doch die fragliche Immobilie. Uns wurde gesagt, dass sie leer steht, keine Mieter.«
»Sie wohnt in dem Gästehaus nebenan.«
Die Stirn des PSB schlägt Falten wie bei einem Shar-Pei.
»Es ist ein separates Grundstück«, erkläre ich. »Früher gehörte es mal zum Haupthaus und war das Wohnquartier der Dienstboten. Meine Mutter hat es vor fünf Jahren gekauft, als das Grundstück aufgeteilt wurde. Wir haben eine gemeinsame Auffahrt, aber damit hat es sich dann auch schon.«
Ich sehe seine Augen zwar nicht, aber ich spüre den Groll in ihnen angesichts der Tatsache, dass er sich eine Auffahrt mit mir teilen wird.
Oh. Moment mal.
Ich werde mir eine Auffahrt mit ihnen teilen.
Heiliger Bimbam.
Sie werden meine Nachbarn!
»Es ist noch nichts endgültig«, beeilt Harrison sich zu sagen, als er meine aufkeimende Aufregung bemerkt. »Ich weiß nicht mal, ob sie das Haus wirklich mieten wollen. Sie schauen es erst mal nur an.«
Bert zuckt mit einer Schulter. »Wenn nicht, gibt’s auf der Insel noch genügend andere Häuser, die ihnen gefallen könnten. Privatsphäre, Weite, Platz ohne Ende, das haben wir hier in Hülle und Fülle.« Er hält inne. »Andererseits … Meinen Sie wirklich, sie wollen hierherziehen? Also, nichts für ungut, aber dem heutigen Chaos in der Stadt nach zu urteilen, bin ich nicht sicher, ob unsere hübsche kleine Insel damit zurechtkäme.«
»Ich bin sicher, das ziehen sie bei ihrer Entscheidung mit in Betracht«, bemerkt Harrison auf eine Art, die stark vermuten lässt, dass sie es höchstwahrscheinlich nicht tun werden.
»Kann ich jetzt endlich nach Hause?«, frage ich.
»Natürlich«, sagt Bert, aber Harrison streckt wieder seine Hand in dieser »Stopp«-Geste aus. Meine Güte, hat der große Hände.
»Einen Moment, Miss Chamomile.«
»Piper«, sage ich mit Nachdruck. »Mein Name ist Piper. Chamomile heißt eine meiner Schülerinnen.« Er ist zweifellos in der Lage, sich meinen Namen zu merken, also macht er das nur, um mich zu nerven.
»Da Sie dieselbe Auffahrt benutzen, muss ich sichergehen, dass Sie nicht zum Haus rüberschleichen oder heimlich Fotos machen oder irgendwem einen Tipp geben … Wissen Sie was? Ich begleite Sie.«
Ich ziehe das Kinn zurück, was bestimmt wahnsinnig attraktiv aussieht. »Das werden Sie nicht tun.« Voller Empörung blicke ich Bert an. »Er soll mich nicht begleiten.«
Berts Schnurrbart zuckt mitleidig. »Die Royals sind nun mal Teil des Commonwealth, und die Royal Canadian Mounted Police ist für die Dauer ihres Besuchs für ihre Sicherheit zuständig. Ich kann dich begleiten, Piper, wenn dir das lieber ist. Aber wenn sie darauf bestehen, dich zu eskortieren, dann sind mir hier leider die Hände gebunden.«
»Nicht sie bestehen darauf. Er tut es.« Ich werfe einen Seitenblick auf Harrison.
Sein Gesicht ist wie versteinert. »Als Chef des Sicherheitsdienstes für den Duke und die Duchess of Fairfax treffe ich die Entscheidungen. Und mein Wort ist Gesetz.«
Uhhh. Wie dramatisch! Ich schiele zu Bert rüber, in der Erwartung, unter seinem Mundgestrüpp Anzeichen eines Grinsens zu erkennen, aber zu meinem Entsetzen starrt er Harrison ehrfurchtsvoll an.
Endlich wischt Bert sich den Fanboy-Ausdruck aus dem Gesicht und sieht zu mir. »Wie gesagt, ich kann dich gern begleiten, falls du dich mit diesem Gentleman unwohl fühlst.«
Na bravo. Jetzt klingt es so, als hätte ich Angst.
»Ich fühle mich absolut nicht unwohl mit diesem … Mann.« Ich deute halbherzig zu ihm rüber. »Andererseits, ich habe noch nie einen männlichen Begleitservice in Anspruch genommen, warum also nicht?«
Ich werfe Harrison ein übertrieben vergnügtes Lächeln zu, woraufhin er ein Brummen vernehmen lässt.
Mit einem tiefen Seufzen nickt er Bert zu. »Wären Sie so gut, die Straße abzuriegeln, während ich diese Frau begleite? Ohne einen Nachweis über die Wohnadresse darf niemand hier durch.«
»Kein Problem«, sagt Bert und lässt sich allen Ernstes dazu hinreißen, vor dem PSB zu salutieren.
Harrison nickt knapp, dann geht er zu meinem Erstaunen um die Schnauze des Autos herum und öffnet die Beifahrertür. Aus irgendeinem Grund dachte ich, er würde neben meinem Wagen herlaufen und mich … na ja, eben eskortieren. Nicht zu mir ins Auto steigen.
Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für diese Art von Intimität.
Doch dann hält er inne, halb draußen und halb im Auto, das viel zu klein erscheint für seine massige Statur, und beäugt das Durcheinander auf dem Sitz. Rasch klaube ich das ganze Zeug zusammen und werfe es hinten auf den Rücksitz.
Schließlich setzt er sich, wobei seine Knie gegen das Handschuhfach stoßen, was ziemlich ulkig aussieht.
»Unten an der Seite ist ein Hebel«, erkläre ich ihm. »Mit dem lässt sich der Sitz zurückstellen.«
Er ruckelt an dem Hebel, bis der Sitz mit Schwung ganz nach hinten rutscht.
RUMMS!
Für einen Kerl, der vermutlich ein krasses Training in saugefährlichen Situationen absolviert hat, wirkt er in dem flauschig grünen Sitz leicht neben der Spur.
Ich versuche, nicht zu lachen, zumal er so ernst aussieht, als er sich pflichtbewusst anschnallt.
Er schaut auf die Sitzbezüge und auf die Würfel.
»Interessante Ausstattung. Haben Sie Oscar aus der Mülltonne das Fell abgezogen?«
»So ungefähr«, erwidere ich. »Bestimmt sind Sie es gewohnt, in Bentleys und Co rumzufahren.«
Darauf sagt er nichts, sondern blickt einfach nur starr geradeaus. Ich schaue aus dem Fenster, in der Hoffnung auf ein paar warme Worte von Bert, aber er guckt genauso ernst drein und gibt mir mit einem knappen Nicken zu verstehen, dass ich losfahren soll.
Die Mülltonne hasst das Anfahren am Berg, und da wir genau am Fuß einer kleinen Anhöhe stehen, muss ich das Gaspedal voll durchdrücken, bis die Drehzahl hochjagt und der Wagen abgeht wie der Blitz.
Okay, er geht eher ab wie ein verwundetes Baby-Impala. Ein großer Satz nach vorn, gefolgt von ein paar lächerlichen Hüpfern, und vermutlich hat Harrison gut daran getan, sich anzuschnallen, denn so wie’s aussieht, kriegt er gerade ein Schleudertrauma verpasst.
»Tut mir leid«, rufe ich, als das Auto endlich losfährt und wir den Hügel hochtuckern. »Wir sind gleich da.«
Eigentlich sind es nur etwa dreißig Sekunden den kleinen Abhang hinunter bis zum Ende der hügeligen Halbinsel, aber mit diesem britischen Trumm von einem Mann neben mir im Auto fühlt es sich an wie eine Million Jahre. Er ist so breit, dass seine Schulter ab und zu gegen meine stößt, und ich spüre die Hitze, die sein Körper verströmt. Dass es draußen sehr warm ist und ich keine Klimaanlage habe, macht die Sache nicht besser. Außerdem weiß ich nicht, ob er es ist, der nach Balsam und Meeressalz riecht, oder die Luft da draußen.
Harrison schweigt beharrlich und fühlt sich sichtlich unwohl, was mich vielleicht einen Tick zu sehr freut. Das hat er nun davon, dass er mich zu meinem eigenen verdammten Haus eskortiert. Ich meine, erwecke ich den Eindruck, jemand zu sein, der nach Hause kommt, die Kamera rausholt und sich durch die verwucherten Scheinbeerenbüsche und den mannshohen Farn schlägt, nur um einen Blick auf sie zu erhaschen? Glaubt er, ich tauche vor ihrer Tür auf, spähe durch die Fenster und poste das Ganze in meinen Insta-Stories?
Anscheinend schon. Ich verstehe ja, dass er sie beschützen will, aber das hier scheint mir etwas übertrieben, vor allem, wo Bert sich für mich verbürgt hat. Obwohl der Polizeichef vorsichtshalber ruhig ein paar mehr schmeichelhafte Worte über mich hätte sagen können.
Die Straße endet in einer schmalen Sackgasse, die kaum genug Platz zum Wenden lässt, rechts und links davon brandet krachend der Ozean gegen seetangbewachsene Felsen. Bisher ist es noch ruhig in der Straße, was wohl bedeutet, dass Harrison gute Arbeit geleistet hat.
Die Auffahrt, die wir uns teilen, führt hinter dem Wendehammer eine weitere kleine Anhöhe hinauf und gabelt sich dann in zwei Richtungen. Ich fahre nach links und nehme die Zufahrt, die uns zu meinem Parkplatz neben der riesigen roten Zeder bringt. Von hier aus kann man ein kleines Stück der Sackgasse sehen, die herrschaftliche Villa aber nicht.
Es ist wirklich ein interessantes Anwesen. Obwohl es nahezu die gesamte Spitze der Halbinsel einnimmt und auf fast allen Seiten vom Ozean umgeben ist, wurde das Dienstbotenquartier (aka mein Haus) ausgerechnet zwischen hohen Zedern und Erdbeerbäumen errichtet. Es liegt auf der Schattenseite, und durch die dichten Bäume hindurch kann man nur spärliche Blicke aufs Meer erhaschen. Ich habe schon überlegt, ein paar zu fällen, um die Aussicht zu verbessern, aber meine Mutter ist extrem paranoid und glaubt, wenn ich das tue, können uns die Leute leichter ausspionieren, also lasse ich die Bäume einfach wachsen, und die Äste versperren uns weiter den Blick aufs Meer. Aber immerhin gibt es einen Pfad, der über wacklige Stufen hinunter zum Anleger führt. Der Steg da unten ist schief und steht manchmal unter Wasser, aber wenn ich mich nach Sonne und blauem Himmel sehne, ist es der perfekte Ort.
Es gibt zwar einen Zaun, der uns von der Straße trennt, aber es gibt kein Tor und auch keinen Zaun zwischen den beiden Grundstücken. Wir wissen einfach, wo die Grenze verläuft, und bleiben auf unserer Seite, obwohl die Villa schon seit unserem Einzug leer steht. Manchmal kommen Familien oder Paare dort unter, aber wir sehen oder treffen sie nie, und ich bin sicher, dass es Freunde des Besitzers sind und keine Airbnb-Gäste oder so.
Abgesehen davon habe ich immer noch keine Ahnung, wem das Haus gehört. In der Vergangenheit kursierten Gerüchte, es sei im Besitz der berühmt-berüchtigten Hearst-Familie, doch ich bezweifle, dass das stimmt. Aber wer auch immer die Eigentümer sind, sie müssen in irgendeiner Verbindung zu Eddie und Monica stehen.
»Also«, sage ich unschuldig und wende mich zu Harrison um, als ich den Motor ausstelle. »Wenn sie das Haus nur mieten und nicht kaufen wollen, von wem mieten sie es dann?«
Er sieht mich nicht an. »Zu dieser Auskunft bin ich nicht befugt.«
»Sind Eddie und Monica jetzt gerade im Haus?«
»Zu dieser Auskunft bin ich nicht befugt.«
Ich verdrehe die Augen. »Wozu sind Sie denn befugt?«
»Lediglich dazu, dafür zu sorgen, dass Sie den Fairfaxes keinen Schaden zufügen.«
Ich deute auf mein Haus. Es ist klein und idyllisch, mit einem Stückchen Garten vorne dran, den meine Mutter pflichtbewusst pflegt. Die meisten Pflanzen müssen im Schatten und Halbschatten wachsen, aber meine Mom hat einen grünen Daumen, und sogar die Zinnien gedeihen gut. »Sehen Sie, da wohne ich. Ich habe Sie also nicht belogen, und ich kann Ihnen hoch und heilig versprechen, dass ich den Fairfaxes nicht das Geringste antun werde. Ich bin Grundschullehrerin. Ich lese gern Liebesromane. Ich mag Tic Tacs. Ich habe einen Hund aus dem Tierheim. Meine Knochen tun weh, wenn eine Kaltfront aufzieht.«
Er mustert mich. »Was hat das damit zu tun?«
»Ich versuche nur, Ihnen klarzumachen, dass ich ein menschliches Wesen bin.«
»Ich habe nie gesagt, dass ich Sie für einen Roboter halte. Ich sage, ich muss sicherstellen, dass Sie keine Bedrohung darstellen. Und zu Ihrer Information: Tic Tacs waren die Lieblingsbonbons von Ted Bundy.«
»Aha, jetzt vergleichen Sie mich also schon mit einem der berüchtigtsten Serienmörder Amerikas.« Er öffnet die Tür und steigt aus. Das kommt mir wie eine typische Harrison-Reaktion vor, dabei kenne ich den Kerl gar nicht.
»Übrigens«, sage ich, während ich aussteige und ihn über das Autodach hinweg ansehe. »Tic Tacs sind keine Bonbons. Es sind Dragees.«
»Ich finde die Tatsache, dass Sie sie essen, wenn Sie Stress haben, besorgniserregend.«
»Und außerdem, hätte Ted Bundy wirklich Tic Tacs gegessen, hätte er sich an niemanden anschleichen können. Man hätte ihn kommen hören.«
»Das ändert gar nichts.«
Ich werfe frustriert die Arme in die Luft. »Na schön. Wollen Sie vielleicht meine Rektorin anrufen und ein Leumundszeugnis einholen, oder so? Der Polizeichef hat ja offenbar nicht gereicht.«
Er starrt mich an. Selbst im Schatten der Bäume nimmt er seine Sonnenbrille nicht ab. Langsam glaube ich, er behält sie auch beim Schlafen auf.
Egal. Mir reicht’s. Jede Aufregung, die der Gedanke, dass die Royals nebenan einziehen könnten, in mir ausgelöst hat, ist durch diesen sexy Mistkerl auf Machttrip zunichtegemacht.
Huch. Habe ich gerade sexy gesagt? Das war definitiv nicht so gemeint.
Ich grummele leise vor mich hin und gehe auf mein Haus zu. Dabei bemerke ich, dass das Licht in der Küche brennt, was bedeutet, dass meine Mutter wahrscheinlich wach ist. Ich wappne mich innerlich.
»Ich muss Sie bis an die Tür bringen«, sagt Harrison und knallt die Autotür so heftig zu, dass die Mülltonne bis ins Mark erzittert. Ich blicke über meine Schulter und sehe, dass er zielstrebig auf mich zuhält.
Ich blinzele ihn an und schüttele den Kopf, bevor ich mich umdrehe und zur Haustür stapfe, in der Hoffnung, dass meine Mutter nichts von alledem mitbekommt.
»Sie, Sir, sind ein Kontrollfreak«, erkläre ich.
»Es ist mein verdammter Job, ein Kontrollfreak zu sein«, faucht er.
Ich halte inne und sehe ihn an. Uah! Ganz schön defensiv. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass er Gefühle gezeigt hat.
Offenbar hat er auch gemerkt, wie er rüberkommt, denn es scheint, als würde er einen Schalter umlegen, und da ist es wieder, dieses leere, aber konzentrierte Steingesicht. Er räuspert sich und reckt sein markantes Kinn. »Kontrolle ist ein wichtiger Faktor in meinem Job.«
Schon klar, 007, eben hat’s noch ganz anders geklungen.
Ich gehe den gewundenen, zu beiden Seiten von prähistorisch anmutenden Funkien gesäumten Pfad entlang und bleibe unter dem Vordach der Eingangstreppe stehen, das von Efeu überrankt ist. »Okay, hier bin ich also vor meiner Haustür. Zufrieden? Oder verlangen Sie auch noch, mit reinzukommen, denn ich bin sicher, dass Sie dafür einen Durchsuchungsbefehl brauchen, und ich kann richtig laut schreien.«
Er mustert mich einen Moment lang, und ich schließe schon innerlich Wetten ab, dass er mir gleich irgendeinen Blödsinn erzählen wird, von wegen, er müsse mein Haus inspizieren, um sicherzugehen, dass ich keine Leichen in der Gefriertruhe habe, aber stattdessen nickt er nur.
»Das ist dann alles.«
Er wendet sich gerade zum Gehen um, als meine Mutter die Tür öffnet.
Ich erstarre.
Er erstarrt.
Der Kopf meiner Mutter lugt durch die schmale Öffnung, und sie beäugt uns beide misstrauisch. Ihre Haare sind völlig durcheinander, und ich zucke beschämt zusammen, bis mir einfällt, dass meine Haare ebenfalls durcheinander sind. Wie die Mutter, so die Tochter.
»Was machst du da? Warum kommst du so spät? Wer ist das?« Bei der letzten Frage verengen sich ihre Augen zu Schlitzen, und sie blickt Harrison giftig an.
Ich weiß, dass ich lügen muss. Meine Mutter leidet an paranoiden Wahnvorstellungen und misstraut Autoritäten. Wenn sie die Wahrheit über Harrison erfährt, wird sie ausflippen, und dann wird Harrison uns wirklich für eine Bedrohung halten.
»Mom«, sage ich rasch und zeige auf Harrison Cole. »Das ist Harrison Cole. Er ist, ähm, unser neuer Nachbar.«
Ich spüre seinen stirnrunzelnden Blick im Rücken, aber ich lächele tapfer weiter und hoffe, dass er mitspielt. Andererseits bezweifle ich, dass dieser Mann weiß, was »spielen« überhaupt ist. Wahrscheinlich hat er früher, als er klein war, die anderen Kinder auf dem Spielplatz beaufsichtigt.
»Harrison Ford?«, fragt sie.
»Harrison Cole«, antworte ich. Dann tue ich etwas Merkwürdiges – ich ziehe Harrison am Arm ein Stück nach vorn, damit er neben mir steht, und lasse ihn nicht wieder los. Ich halte seinen sehr starken, muskulösen Arm fest. Oje. Ich räuspere mich und reiße mich zusammen. »Er mietet vielleicht das Haus nebenan, also dachte ich mir, ich zeige ihm mal, wo wir wohnen.«
Man muss Harrison hoch anrechnen, dass er sich weder von mir losreißt noch meine kleine Notlüge richtigstellt.
Meine Mutter blickt auf meine Hand, die seinen Arm umklammert, und ein seltsamer, wissender Ausdruck huscht über ihr Gesicht. Ich weiß, was dieser Blick bedeutet. Sie glaubt, ich würde mich für diesen Mann interessieren, also sexuell, denn bislang scheint er genauso zu sein wie die anderen Idioten, zu denen ich mich bisher hingezogen gefühlt habe: gut aussehend, emotional gehemmt und sehr kontrollsüchtig.
»Okay«, sagt sie schließlich. »Willkommen in der Nachbarschaft. Wollen Sie reinkommen?«
»Nein«, sage ich schnell, und meine Stimme ist fast ein Kreischen. »Nein, nein. Alles gut.« Harrison macht den Mund auf, um etwas zu sagen, aber ich plappere weiter. »Er muss zurück; er wollte nur kurz Hallo sagen. Ich bin sicher, ihr werdet euch wiedersehen, wenn er die Villa mietet.«
Meine Mutter zuckt mit den Schultern, schlagartig desinteressiert. »Okay«, sagt sie und macht uns die Tür vor der Nase zu.
»Was war das?«, fragt Harrison nach einem kurzen Moment.
»Meinen Sie meine Mutter? So ist sie einfach. Nehmen Sie’s nicht persönlich.«
»Nein, ich meine, warum haben Sie gelogen? Warum haben Sie ihr nicht gesagt, wer ich bin?«
»Das ist eine lange Geschichte«, erwidere ich. Und eine, die ihn nichts angeht, aber ich will ihn nicht weiter vor den Kopf stoßen. Er hat seinen Teil getan, indem er den Mund gehalten hat, und das reicht mir. Wenn ich ihn nur nie wiedersehen muss. Aber ich ahne, dass das zu viel verlangt sein könnte. »Jedenfalls danke, dass Sie mitgespielt haben.«
»Es blieb mir ja nichts anderes übrig«, knurrt er.
Ich verschränke meine Arme und zucke mit den Schultern. »Trotz der einladenden Worte meiner Mutter trennen sich unsere Wege hier leider. Falls Sie mich noch weiter behelligen wollen, machen Sie’s am besten schriftlich.«
Er mustert mich einen Moment lang und atmet scharf durch die Nase aus. Dann nickt er knapp. »Ich werde mit Ihnen in Kontakt treten. Sollten der Herzog und die Herzogin die Villa mieten, müssen wir am Eingang der Auffahrt ein Sicherheitstor installieren, und dafür bräuchten wir bestimmt Ihr Einverständnis. Ich werde Ihnen die entsprechenden Formulare in den Briefkasten werfen.«
Dann dreht er sich um und geht den Weg hinunter, vorbei an der Mülltonne und den Zedern, bis ich ihn nicht mehr sehen kann.
Ich hole tief Luft und straffe die Schultern, dann öffne ich die Tür und gehe ins Haus.
Drei
Neuer Nachbar, ja?«, fragt meine Mutter aus der Küche, während ich im Flur meine Stiefel ausziehe.
Ich schlüpfe in meine Lammfellpantoffeln (Schritt eins der Runterkommphase nach der Arbeit) und tappe in die Küche, wo sie sich gerade durch Tütchen mit selbst getrockneten Kräutern wühlt, bevor sie welche in ein Sieb füllt, das in ihrer großen Teekanne hängt.
Die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld – überall Minze und Lavendel, ungewaschenes Geschirr, Kaffeepulverreste, verschüttete Hafermilch –, aber ich ignoriere es. Früher wäre mir bei dem Anblick der Kragen geplatzt, woraufhin wiederum meiner Mutter der Kragen geplatzt wäre; jetzt lasse ich es einfach immer schlimmer werden, und sobald sie zu Bett gegangen ist, räume ich auf, damit sie morgen alles wieder in Schutt und Asche legen kann.
Ich weiß, das klingt jetzt herzlos von mir, doch seit mein Vater uns verlassen hat, als ich vierzehn war, ist meine Mutter völlig abhängig von mir. Genau darum geht es bei der dependenten Persönlichkeitsstörung; und in Kombination mit ihrer Borderlinestörung bedeutet das, ich bin der einzige Mensch, den sie hat, damit sie ihr Leben auf die Reihe kriegt. Sie ist kein Fan von Ärzten, sie hasst es, Medikamente zu nehmen (ich sorge dafür, dass sie’s trotzdem tut), ich bin Einzelkind, und mein Vater hat eine neue Familie in Toronto (wir pflegen einen freundlichen Umgang und telefonieren ab und zu, aber er bietet mir keine Unterstützung an), also fällt alles auf mich zurück.
Ich bin daran gewöhnt. Das heißt aber nicht, dass es mir gefällt. Während ich mich um meine Mutter kümmere und ihr all die Fürsorge gebe, die sie braucht, bin ich gleichzeitig emotional abgekoppelt. Das muss ich sein, um meiner mentalen Gesundheit willen. Es hat mich Jahre der Therapie gekostet, um meine eigenen Probleme zu akzeptieren und die Bewältigungsstrategien, die ich während meiner Kindheit entwickelt habe, zu erkennen: Konflikten aus dem Weg zu gehen, stets die Vermittelnde zu sein, mich an emotional distanzierte Männer zu binden, mich zum Fußabtreter zu machen und alles zu tun, was andere wollen, um den lieben Frieden zu wahren. Durch meine Therapeuten (ja, im Plural, denn um den richtigen zu finden, muss man viel ausprobieren … Es ist wie Dating, nur sehr viel teurer) habe ich gelernt, dass meine Strategien mir als Kind und Teenager das Überleben sicherten, aber dass ich sie als Erwachsene loslassen muss.
Was mir wohl ganz gut gelingt, denn wenn ich an meine Begegnung mit dem angepissten Personenschützer zurückdenke, war das Letzte, was ich wollte, ihm um jeden Preis zu gefallen, und ich glaube, ich habe mehr Konflikte heraufbeschworen als nötig.
(Ich sollte besser aufhören, an ihn zu denken; er bringt mein Blut schon wieder zum Kochen.)
»Möchtest du Tee?«, fragt meine Mutter und holt zwei Becher aus dem Schrank. Sie gießt mir immer eine Tasse ein, egal, was ich sage.
»Ja, gern«, sage ich und setze mich an die Kücheninsel. »Wo ist Liza?«
»Sie döst in der Sonne.«
Liza ist mein adoptierter Pitbull, ein kleiner, grauer, fetter Hund mit dem niedlichsten Gesicht und der faulsten Persönlichkeit der Welt. Ihr Lieblingsplätzchen ist die Ecke auf der Terrasse, wo durch eine kahle Stelle im Baum etwas Licht hindringt.
Meine Mutter hat sie nach Liza Minelli benannt, von der sie quasi besessen ist. Liza wurde gerettet, als sie ein Jahr alt war, nachdem sie schlimm misshandelt wurde, aber inzwischen ist sie wieder auf dem Damm und hat uns allen beim Gesundwerden geholfen, indem sie selbst gesund wurde.
»Zurück zu dem Nachbarn«, sagt meine Mutter und fixiert mich mit ihrem Blick. Abgesehen davon, dass ihre Haare wirr sind und sie noch ihren Schlafanzug anhat, scheint es ihr heute ganz gut zu gehen. »Wann ist er eingezogen? Ich habe keine Umzugswagen gesehen …«
»Wann hast du das letzte Mal das Haus verlassen?«
Sie zuckt mit den Schultern. »Gestern bin ich mit Liza zum Fähranleger und zurück gelaufen. Und da habe ich nichts Ungewöhnliches gesehen.«
»Also genau genommen überlegt er noch, ob er das Haus mieten wird. Es ist noch nichts entschieden.«
»Hat er eine Frau?«
»Nein«, sage ich, während ich überlege, ob ich einen Ring an Harrisons Finger bemerkt habe. Also, er könnte eine Frau haben, aber in meiner Version der Geschichte hat er keine.
»Bist du sicher?« Sie kneift die Augen zusammen. »Denn ich weiß ja, dass das dein Lieblingstyp ist.«
Ich schenke ihr ein steifes Lächeln. Obwohl sie einfach nur geradeheraus ist und nicht versucht, gemein zu sein, fühlt es sich immer wie ein Schlag in den Magen an, wenn sie meine vergangenen Fehler anspricht, und ich habe einige ziemlich große gemacht.
»Er ist nicht verheiratet«, sage ich noch einmal.
»Aber du hast dich so an ihn geklammert, als ob ihr zusammen wärt. Da ist also etwas.« Sie legt den Kopf schief und mustert mich. »Ich will keine Nervensäge sein, Piper, aber du warst so stolz auf deine Erkenntnisse, die du in den Sitzungen mit Dr. Edgar gewonnen hast.«
»Ich bin immer noch stolz darauf. Und ich bin nicht an diesem Kerl interessiert.«
»Harrison Cole«, sagt sie.
»Ja. Ich war einfach nur freundlich.«
Wenn ich’s mir recht überlege, gab es tatsächlich keinen Grund, mich so an ihm festzuhalten. Ich weiß auch nicht, was das eigentlich sollte.
»Er hat also keine Frau. Hat er Kinder?«
»Ähm, nein.«
Sie dreht mir den Rücken zu, während sie darüber nachgrübelt. »Keine Frau, keine Kinder. Wie kann er sich dieses Haus überhaupt leisten? Gehört es denn nicht den Hearsts? Was arbeitet er?«
»Keine Ahnung«, sage ich, was sich prompt als die falsche Antwort herausstellt, denn ich sehe, wie sich ihre Schultern versteifen. Langsam dreht sie sich mit weit aufgerissenen Augen zu mir um.
»Du weißt nicht, was er arbeitet? Piper … er könnte ein Drogendealer sein. Ein Mafioso. Ein Verbrecher. Anders könnte er sich dieses Haus doch gar nicht leisten.«
Oh-oh.
»Vermutlich ist er Anwalt«, erwidere ich. »Ein richtig erfolgreicher. Oder vielleicht Filmproduzent. Vielleicht ist er mit der königlichen Familie verwandt …«
Sie schüttelt den Kopf, und ich weiß, dass sie beharrlich an der wie auch immer gearteten paranoiden Theorie, die ihr Gehirn ausheckt, festhalten wird. »Anwälten kann man auch nicht trauen.«
»Weißt du was, das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, frage ich ihn einfach, okay?«, sage ich, in der Hoffnung, sie zu besänftigen. »Und wer weiß, ob er überhaupt einziehen wird.«
Dieser Gedanke lässt sie innehalten. »Ich hoffe, nicht. Ich mag keine Fremden.«
»Das weiß ich. Es wird schon alles gut werden, versprochen.«
Und schon wieder versuche ich die Mediatorin zu sein und gebe Versprechen, über die ich keine Kontrolle habe. Es ist wirklich schwer, alte Rollen abzulegen.
Nachdem sie mir einen Tee gekocht hat, gehe ich zum Steg hinunter und setze mich dorthin, um Ruhe, Frieden, die weiche Sommerluft und den langsam nachlassenden Sonnenschein zu genießen. Ein Seehund steckt seinen Kopf aus dem Wasser und mustert mich mit großen, dunklen Augen, bevor er wieder untertaucht. Ein Weißkopfadler fliegt über mir hinweg, auf dem Weg zu einigen Nestern am Yachthafen weiter unten an der schmalen Landenge von Long Harbour.
Das ist das Beste am Leben hier – eins zu sein mit der Natur, Zeit zu haben, vom Stress abzuschalten, die frische salzige Luft und die Brise einzuatmen, die raschelnd durch die Erdbeerbäume fegt, und den Geruch nach sonnenverbranntem Moss.
Wenn die Royals wirklich nebenan einziehen, besteht die Möglichkeit, dass sich das alles ändert. Ich bin kein großer Fan von Veränderungen; ich mag meine gewohnten Abläufe, und so geht es vielen anderen Leuten auf der Insel auch. Bert hatte recht, als er sagte, dass hier womöglich nicht der richtige Ort für Promis sei, erst recht nicht für ein königliches Paar, das seit zwei Jahren immer wieder Schlagzeilen macht und derzeit das Topthema in allen Medien ist.
Wenn sie nebenan einziehen, werden die Paparazzi aus den USA und dem Vereinten Königreich schnell Wind davon bekommen und sich hier draußen Tag und Nacht auf die Lauer legen. Ich könnte dann nicht mehr am Steg sitzen, ohne dass Fotografen in Booten oder auf Jetskis vorbeidüsen und die Ruhe stören würden.
Und vor allem würde jemand wie meine Mutter, die mit Veränderungen überhaupt nicht zurechtkommt, vermutlich einen Zusammenbruch erleiden, wenn sie plötzlich so viel öffentlichem Interesse ausgesetzt wäre.
Es könnte alles sehr schnell sehr chaotisch werden.
Und ich darf noch nicht mal mit jemandem darüber reden. Nicht dass ich irgendwelche engen Freunde hätte, aber trotzdem ist es schwer, diese Sache für mich zu behalten.
Es sei denn …
Nachdem ich meinen Tee ausgetrunken habe, gehe ich zurück ins Haus und schüttele mir einen Auflauf fürs Abendessen aus dem Ärmel, dann verziehe ich mich auf mein Zimmer, bereit für meinen wöchentlichen Podcast.
Normalerweise nehme ich unter der Woche eine Folge auf und veröffentliche sie dann am Freitag. Heute ist ein Aufnahmetag, aber plötzlich steht mir nicht mehr der Sinn danach, historische Liebesromane zu rezensieren.
Ich fühle mich inspiriert. Ich möchte über die Royals sprechen.
Mein Liebesroman-Podcast ›Liebe, Lust & Laster: der Lesepodcast‹ ist ziemlich populär, aber ich betreibe ihn anonym. Sämtliche Social-Media-Accounts, die ich habe, drehen sich um meinen Podcast, und es gibt eine eigene E-Mail-Adresse für Fragen und Rezensionsanfragen von Autoren. Die meiste Zeit lese ich allerdings nur die Bücher, die ich lesen will. So habe ich weniger Druck.
Es ist nicht so, dass ich mich dafür schäme, Liebesromane zu lesen; in meinem echten Leben mache ich keinen Hehl aus meiner Leidenschaft. Aber ich bin Lehrerin, und ich glaube, dass an uns andere Maßstäbe angelegt werden, und ich möchte mich nicht dahingehend zensiert fühlen, worüber ich reden kann und worüber nicht. Wenn ich eine Sexszene vorlese, möchte ich das tun können, ohne Angst zu haben, dass die Öffentlichkeit es herausfindet und mich dafür an den Pranger stellt. Im allerschlimmsten Fall könnte ich deswegen meinen Job verlieren. Es gibt eine Menge verklemmter Spießer auf dieser Insel.
Aber heute Abend möchte ich nicht über Bücher sprechen. Ich möchte über das echte Leben sprechen. Ich möchte über Monica und Eddie sprechen und darüber, welche Richtung ihre Liebesgeschichte jetzt einschlagen könnte, wo sie ihre Liebe über die Pflichten als Royals gestellt haben.
Ich setze mich an meinen Schreibtisch, klappe meinen Laptop auf und ziehe mein Mikro heraus.
Drücke auf »Aufnehmen«.
»Hallo, liebe Liebesromanenthusiasten, Liebhaber der Liebe, Leser von Schund und stolze Bibliophile. Willkommen bei einer weiteren Folge von ›Liebe, Lust & Laster‹.« Ich hole tief Luft und lächele. »Also, normalerweise würde ich jetzt sofort mit der Rezension der Woche beginnen, aber in letzter Zeit habe ich viel an den Duke und die Duchess of Fairfax gedacht. Wir kennen alle die epische Liebesgeschichte von Monica Red und Prince Eddie. Wir haben miterlebt, wie sich dieses ungleiche Paar ineinander verliebt hat, nachdem Prince Eddie Monica nach ihrer Show in London backstage getroffen hatte. Sie sind schnell ein Paar geworden, dennoch wusste die Öffentlichkeit nichts über ihre Affäre, bis Monate später durchsickerte, dass die Grammy-Gewinnerin das Showbusiness hinter sich lassen würde, um sich auf ihr Leben an der Seite unseres großen, blonden Helden zu konzentrieren.
Schon bald läuteten die Hochzeitsglocken, und wir alle – oder fast alle – waren hingerissen von den beiden als Inbegriff des Spruches ›Gegensätze ziehen sich an‹. Der ruhige, stoische Edward und die eigensinnige, lebenslustige Monica wurden das Paar des Jahrhunderts und stellten jahrelange Traditionen und die königliche Familie auf den Kopf.