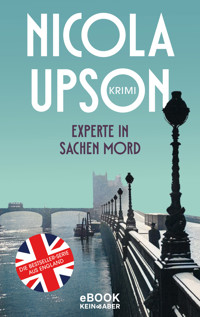15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Krimi
- Serie: Josephine Tey und Archie Penrose ermitteln
- Sprache: Deutsch
London, 1903. Zwei Frauen werden im Holloway-Gefängnis wegen Babymordes gehängt. Dreißig Jahre später soll Josephine Tey einen Roman über die Täterinnen schreiben. Als zeitgleich mehrere junge Frauen tot aufgefunden werden, wird Inspector Archie Penrose' Misstrauen geweckt. Es beginnt die Suche nach einem bösartigen Mörder, der die Vergangenheit nicht ruhen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 658
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Nicola Upson wurde 1970 in Suffolk, England, geboren und studierte Anglistik in Cambridge. Ihr Debüt Experte in Sachen Mord bildet den Auftakt der erfolgreichen Krimireihe. Bei deren Hauptfigur Josephine Tey handelt es sich um eine der bekanntesten Krimiautorinnen des Britischen Golden Age. Mit dem Schnee kommt der Tod war nominiert für den CWA Historical Dagger Prize (2021). Nicola Upson lebt in Cambridge und Cornwall.
ÜBER DAS BUCH
Dreißig Jahre nach einer grausamen Serie von Kindermorden in London macht sich Josephine Tey daran, einen Roman darüber zu schreiben. Zwischen dem Glamour eines privaten Frauenclubs im London der Dreißigerjahre und der düsteren Umgebung des Holloway-Frauengefängnisses begibt sie sich auf die Spur der Täterinnen. Zeitgleich nimmt Inspector Archie Penrose die Ermittlungen in einem neuen Fall auf: Eine junge Frau wurde brutal ermordet und eine weitere in einen schrecklichen Unfall verwickelt. Während der Fall Form annimmt, meint der Inspector, eine Verbindung zu den alten Verbrechen zu erkennen. Nach und nach wird beiden klar, welch lange Schatten die Vergangenheit bisweilen wirft.
Für Mandy. Zwei für Freude.
(OHNE TITEL)VON JOSEPHINE TEYERSTER ENTWURF
GEFÄNGNIS HOLLOWAY, DIENSTAG, 3. FEBRUAR 1903
Dann kam der eiskalte Morgen, wurde unerbittlich zum Tag, sosehr Celia Bannerman ihn auch davon abhalten wollte. Sie sah zu den zwei Reihen winziger Fenster oben in der Mauer hinauf und fragte sich, weshalb jemand beim Bau dieses elenden, widerwärtigen Lochs noch Wert auf Tageslicht gelegt hatte. Zum Hinausschauen waren die kleinen Scheiben jedenfalls nicht gedacht, selbst wenn sie nicht blind vor Schmutz gewesen wären, dazu waren sie viel zu weit oben. So sammelte sich nun der Ruß von der Camden Road Schicht um Schicht auf dem Glas und trennte die Insassinnen damit noch mehr vom Leben, das dort draußen ohne sie weiterging. Es war drückend in der Zelle, die Luft stickig, und da es kaum natürliches Licht gab, brannte Tag und Nacht eine Lampe, verweigerte der Gefangenen auch noch den winzigen Trost, wenigstens im Dunkeln für sich zu sein. Wie so vieles andere im Gefängnisalltag war auch diese Beleuchtung ein Kompromiss, es war niemals wirklich hell oder richtig dunkel. Ob man sich wohl von dem gedämpften Licht auch eine gedämpfte Gefühlswelt der Insassinnen versprach, keine Ausfälle, bessere Kontrolle?
Schatten huschten über die vertraute Zellenausstattung: den hölzernen Waschtisch mit dem lächerlich kleinen Stück Harzseife, dem schmutzstarrenden Lappen, für die Reinigung von sowohl Tasse als auch Nachttopf, das Eckregal mit der Bibel für diejenigen, die tatsächlich noch Trost darin zu finden vermochten, über den Emailleteller und das Messer aus billigem Blech, stumpf wie ein Stück Pappe, und schließlich über das niedrige schwarze Bettgestell, das in der knapp acht Quadratmeter großen Zelle den meisten Platz einnahm. Die Frau darauf lag mit dem Gesicht zur Wand, doch Celia wusste, dass sie nicht schlief. Wie immer beim Gedanken an das, was ihnen bevorstand, krampfte sich alles in ihr zusammen. Einen Augenblick lang war sie wieder Kind, lag morgens im Bett, die Decke über den Kopf gezogen, und betete inständig, die Zeit möge stillstehen und sie vor dem Tag bewahren. Ihre Angst hatte sich damals fast unerträglich angefühlt, doch es waren Lappalien, die sie da beschäftigt hatten, im Vergleich zu dem, was Amelia Sach in den letzten Stunden vor ihrem Tod durchleben musste.
Celia stand leise auf und ging zur hinteren Zellenwand, wo ein robuster, dunkelblauer Umhang an einem Haken hing, bewusst nur auf halber Höhe, damit auch ja niemand auf die Idee kam, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Celia hob den Saum vom staubigen Boden und versuchte, den groben Stoff mit der Hand etwas zu glätten. Es war vergebliche Liebesmüh, doch sie wollte keine Gelegenheit einer freundlichen Geste ungenutzt verstreichen lassen, und sei sie auch noch so klein. Während der drei Wochen zwischen Verurteilung und Hinrichtung war Sach stets von zwei Frauen bewacht worden. Erst waren sie einander noch fremd gewesen, im Laufe der Zeit wurden sie jedoch zu Verbündeten, fast Freundinnen. Es bestand eine ungewöhnlich starke Bindung zwischen Aufseherin und Insassin: Während der achtstündigen Schichten teilte Celia jede Sekunde Sachs elender Existenz, sah ihr zu, wie sie sich wusch und anzog, aß und weinte, lernte ihre Gewohnheiten und Vorlieben kennen wie die eines Gatten in den ersten Ehetagen. Sie hatte mit Sach gelebt, und nun würde sie sie zu ihrem Tod begleiten. Zwei Wärter waren aus einem anderen Gefängnis gekommen, für den Fall, dass die Hinrichtung ihren weiblichen Gegenstücken zu viel abverlangte, doch zwischen Celia und ihren Kolleginnen herrschte die unausgesprochene Entschlossenheit, die Sache bis zu ihrem bitteren Ende zu bringen. Nicht etwa aus Gleichstellungsprinzipien oder professionellem Stolz, und – wenn sie ehrlich war – nicht einmal, um der Gefangenen in ihren letzten Augenblicken Trost zu spenden, sondern schlicht deshalb, weil es zu spät war. Der seelische Schaden war bereits angerichtet. In den letzten Wochen hatten wirklich nur die abgestumpftesten unter ihnen die verbleibenden Tage nicht ebenso verzweifelt abgezählt wie die Verurteilte selbst.
Beine und Rücken waren Celia wegen des langen Sitzens gefühllos geworden, und sie wünschte, die Taubheit würde auch ihre anderen Sinne befallen. Sie streckte die verkrampften Gliedmaßen und wackelte mit dem Fuß, um das Kribbeln abzuschütteln. Ihre Kollegin, die auf dem anderen Stuhl eingeschlafen war, spürte die Bewegung und öffnete die Augen. Die beiden sahen einander an, und Celia nickte. Es war so weit. Sie trat ans Bett, wobei sie ihren Schlüsselbund festhielt, damit er nicht klirrte. Wie albern, dachte sie – wem wollte sie hier vormachen, sie wären nicht hinter Gittern? Doch es war ein weiteres kleines Stück Menschlichkeit, an das sie sich klammern konnte. Sach spannte sich in Erwartung der Hand an ihrer Schulter an, und Celia schlug die Decken zurück, die viel zu dünn für die Jahreszeit waren. Der Geruch von alten Laken, Schweiß und Angst stieg ihr entgegen. Sach rutschte näher an die Wand und versuchte, sich die Decken wieder überzuziehen, doch Celias Griff war fest, und schließlich ließ sich Sach auf die Füße holen. Celia versuchte vergeblich, die große, ausgemergelte Frau mit der arroganten, gefühlskalten Kreatur zu vereinbaren, die seit ihrer Festnahme im November die Zeitungen gefüllt hatte. Sach wirkte viel älter als neunundzwanzig. Ihr Gesicht war grau vor Erschöpfung, und ihr Körper wirkte kaum kräftig genug, um sie zum Galgen zu tragen – wie sehr sie sich doch von der Frau unterschied, die so ungläubig, fast schon empört eingeliefert worden war. In diesen Minuten würden sich die Menschen vor den Gefängnistoren sammeln, um auf die traditionelle Verkündung der Urteilsvollstreckung zu warten. Wenn sie Amelia Sach allerdings jetzt sehen könnten, würden sie in ihr wohl kaum das Monster erkennen, das in ihren Köpfen lebte.
Celia hielt die Gefangene dazu an, sich fertig anzukleiden, und gab sich Mühe, dabei nicht die gleiche mitleidige Miene aufzusetzen, die sie bei sämtlichen Besuchern bemerkt hatte. Sach hatte ihre Kleidung bereits zu Bett getragen, und Celia half ihr lediglich dabei, das vorschriftsmäßige blaue Hemdkleid überzuziehen – ausgeblichen und formlos, um jegliches Gefühl der Individualität unter den Frauen in Holloway auszumerzen. Als sie sich hinkniete, um Sachs Füßen in die schäbigen, schlecht passenden Schuhe zu helfen, bemerkte sie Löcher in ihren Strümpfen, wo die Sohlennägel in der schwarzen Wolle hängen geblieben waren und ihre Haut durchdrungen hatten. Ihre Füße fühlten sich so klein und verletzlich an, dass es Celia kurz den Atem verschlug; die Jury hatte recht, dachte sie – für Frauen musste das Hängen viel schlimmer sein als für Männer. Oder war das ungerecht? Verspürten männliche Wärter dieselbe nackte Verzweiflung, wenn für ihre Gefangenen die Zeit zum Sterben kam? Sie war zu aufgewühlt, um aufzustehen, und kurz spürte sie, wie Sach ihr die Hand auf den Kopf legte; ob die Geste als Segen oder stumme Bitte um Beistand gedacht war, wusste sie nicht, doch sie reichte ihr. Celia riss sich zusammen und fasste Sachs strähniges, ehemals hübsches rotbraunes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen, den sie zu einem Dutt rollte, weit oben am Hinterkopf, damit er nicht in der Schlinge hängen bliebe. Es war ein schlichter Akt, doch er schien Sach mehr zuzusetzen als alles andere. Rasch nahm Celia den Umhang vom Haken und versuchte, das Geräusch zu dämpfen, das eher dem Winseln eines verletzten Tieres als irgendeinem menschlichen Laut glich. Während sie Sach das Gewand um die Schultern legte, fragte sie sich, ob sich Todesangst – so wie Schmutz – in einen Stoff weben, mit jeder armen Seele, die ihn getragen hatte, weiter anwachsen konnte. Sie drehte die Gefangene um, damit sie ihr ins Gesicht sehen konnte, wollte dem überbordenden Kummer Einhalt gebieten, doch die Schreie der Frau wurden lediglich lauter und zusammenhängender. »Lassen Sie das nicht zu! Ich habe doch nichts getan«, wiederholte sie immer und immer wieder und zog Celia damit so tief in ihre Hoffnungslosigkeit hinein, dass die andere Aufseherin eingreifen musste.
»Schon gut, Mrs Sach.« Sanft, aber bestimmt löste sie die Hände, die sich kläglich an Celias Kleid festklammerten. »Sie haben Ihr Frühstück gar nicht angerührt. Essen Sie doch noch eine Kleinigkeit.«
»Können wir ihr nicht etwas Stärkeres geben als Brot und Tee?«, fragte Celia aufgebracht. »Was soll sie denn jetzt noch damit?«
Die ältere Frau schüttelte den Kopf und warf einen raschen Blick auf die Uhr. »Dafür haben wir keine Zeit«, flüsterte sie. »Es ist schon fast neun.«
Wie auf Kommando ertönte ein Geräusch auf dem Gang. Die meisten Gefangenen waren das Warten und Lauschen auf unsichtbare Geschehnisse gewohnt, und Sach nahm die herannahenden Schritte und ihre Bedeutung sofort wahr. Vor der Zelle verstummten sie kurz und gingen dann weiter, und das Flackern der Hoffnung auf Sachs Gesicht war Celia unerträglich. Sie wusste, dass nur die Hälfte der Vollstrecker weitergegangen war; die anderen standen noch vor der Tür und warteten auf ein Zeichen des Gefängnisdirektors. Sie starrte zur Tür und sah eine winzige Bewegung, als der Henker die Klappe über dem Guckloch beiseiteschob, um die geistige Verfassung der Gefangenen einzuschätzen, und dann, nach einem Moment, der sich unendlich anfühlte, setzte das Neun-Uhr-Geläut der benachbarten Kirche ein. Celia zählte zwei Schläge, bevor sie den Schlüssel im Schloss hörte, drei, bevor die schwere Eisentür aufging, und dann war die kleine Gruppe Männer auch schon in der Zelle, setzte eine erbarmungslose Kette von Ereignissen in Gang, aus der es kein Entkommen gab und die sich nicht ungeschehen machen ließe.
Der Henker schritt rasch durch die Zelle und machte sich daran, Sach die Hände hinter dem Rücken zu fesseln. Sobald sie jedoch die Lederriemen an der Haut spürte, schien sie auch noch die letzte Kraft zu verlassen. Celia trat nach vorne, um sie aufzufangen, raunte ihr tröstliche Worte zu, die jedoch das Gegenteil bewirkten, und Sach musste teils auf den Gang geführt, teils getragen werden. Ein paar Meter weiter rechts, an der Tür zur Nachbarzelle, spielte sich eine ähnliche Szene ab, doch der Kontrast zwischen den beiden Gefangenen hätte stärker nicht sein können. Annie Walters war klein, grauhaarig und Anfang fünfzig, mit ihrem stämmigen, unscheinbaren Äußeren das Gegenteil der zierlichen Sach, doch es waren nicht Körperbau oder Alter, das die beiden voneinander unterschied, sondern ihr Gebaren. Walters’ Anblick versetzte Sach fast in Hysterie, wohingegen Walters gut gelaunt und gesprächig war, beiläufige Bemerkungen mit dem zweiten Henker austauschte, als wüsste sie nicht, dass es sich um ihre letzten Augenblicke auf Erden handelte. Beim Anblick der beiden Frauen, die sich zum ersten Mal seit der Verurteilung wieder gegenüberstanden, ließ sich nur schwer glauben, dass sie bei der brutalen Ermordung von Neugeborenen gemeinsame Sache gemacht hatten – bis zu zwanzig Kinder, die meisten davon nur ein paar Tage alt.
Von da an ging es schnell. Der erste Henker stützte Sach und bereitete sie auf den kurzen Weg zum Galgen vor. Mit einer Wärterin an jeder Seite folgten die Verurteilten dem Gefängnispriester durch die Doppeltür am Ende des Flügels in den neuen Hinrichtungsanbau. Es waren nur wenige Schritte, und doch bemerkte Celia die unnatürliche Stille im Gefängnis, fast so, als würde gemeinschaftlich der Atem angehalten. Seit drei Wochen waren die Frauen von Holloway unruhig und beklommen; die unvermeidliche Mischung aus Bestürzung und Sensationsgier, mit der das Urteil aufgenommen worden war, war von einer hilflosen Wut verdrängt worden, von der niemand unberührt blieb, egal, ob Personal oder Gefangene. Celia wusste, dass sie nicht die Einzige war, die sich danach sehnte, die Uhr entweder vor- oder zurückzudrehen, irgendwo anders zu sein, nur nicht in diesem Augenblick.
Und dann waren sie da. Zwei Schlingen hingen ihnen direkt gegenüber, eine etwas höher als die andere, und die Gefangenen wurden rasch auf die Falltür geführt. Die Henker gingen gleichzeitig auf die Knie, um ihnen die Fußfesseln anzulegen. Celia schaute Sach durch den ovalen Galgenstrick hindurch an, wünschte, ihre Tortur wäre zu Ende, und weigerte sich, angesichts des Todes wegzuschauen; nur so konnte sie noch helfen, und sie hielt Sachs verängstigtem Blick stand, während ihr die weiße Haube, die bis dahin aus der Brusttasche des Henkers geragt hatte, übergestülpt und die Schlinge geprüft wurde. Die ganze Zeit über hörte sie die leise, monotone Stimme des Geistlichen, der ein Totengebet intonierte, konnte seine Worte jedoch nicht verstehen. Als der Henker zum Hebel schritt, konzentrierte sie sich nur noch auf den kleinen Stoffkreis über Sachs Mund, der sich abwechselnd nach innen und außen bewegte.
Hinterher konnte Celia nicht mit Sicherheit sagen, ob sie tatsächlich hörte, wie sich Walters im letzten Moment mit einem kurzen Zuruf von Sach verabschiedete, oder ob sie es sich eingebildet hatte. Woran sie sich allerdings sehr deutlich erinnerte – und dabei war sie sich sicher, denn sie tauchte immer noch vor ihr auf, sogar heute, in den frühen Wintermorgenstunden –, war die Stille.
1
Josephine Tey nahm die aufwendig verpackte Hutschachtel entgegen und befestigte sie mithilfe der perfekten Selfridge-Schleife am Rest ihrer Päckchen.
»Und Sie sind sich sicher, dass wir nicht liefern sollen, Madam?«, fragte die Verkäuferin nervös, als wäre die selbstständige Abreise des Hutes eine Beleidigung ihrer professionellen Standards. »Das wäre wirklich nicht die geringste Mühe.«
»Nein, danke, ich komme zurecht.« Josephine lächelte die jungen Damen hinter der Theke schuldbewusst an. »So schwer bepackt schaffe ich es in kein anderes Geschäft mehr, und das ist wahrscheinlich auch besser so. Wenn ich noch mehr in meinen Club schicken lasse, berechnen sie mir bald ein zusätzliches Zimmer.«
Voll beladen mit ihren leichtfertigen Einkäufen betrat Josephine die Rolltreppe ins Erdgeschoss. Die gemächliche Fahrt bot ihr Gelegenheit, das weitläufige, offene Kaufhaus zu bewundern, das sich so sehr von den anderen Geschäften Londons unterschied. Das gesamte Gebäude glitzerte mit dem Wissen um die Verbindung zwischen dem Blick einer Frau und ihrem Portemonnaie; selbst auf den prominent platzierten Schnäppchentischen waren die wunderschönen Kisten fein säuberlich gestapelt, und nichts wies auf ihren herabgesetzten Preis hin. Bis Dezember war es zwar noch eine Woche, doch die Mitarbeiter schmückten die Gänge bereits für die Weihnachtszeit, und der vertraute Kaufhausgeruch – weiche Teppichböden und frische Blumen – hatte einem warmen Zimtduft Platz gemacht, dem lediglich die Parfümwolke der Kosmetikabteilung etwas entgegensetzen konnte. Anscheinend funktionierte der Plan, das Fest näher wirken zu lassen, als es wirklich war: Selbst am späten Nachmittag herrschte Hochbetrieb, und Josephine kämpfte sich an den Schminktheken vorbei hinaus in den Trubel der Oxford Street.
Sie bog nach links ab Richtung Oxford Circus, folgte der langen Reihe Schaufenster bis zur Ecke Duke Street. Hinter den Scheiben drängten sich die Schaufensterpuppen, die an Salzsäulen erinnerten, auf ewig in ihren Gesten gefangen. Manche lockten neugierige Betrachter ins Innere, andere gingen ihrem imaginären Leben nach, ungeachtet der leibhaftigen Frauen, die von draußen jedes Detail genau studierten, und alle waren vor einem Hintergrund aus Licht und Farbe arrangiert, der so kunstvoll geplant war wie eine Theaterkulisse. Josephine blieb vor einer besonders beeindruckenden Schlafzimmerszene stehen. Eine umwerfende Wachsfigur in einem Nachthemd aus Crêpe de Chine trat aus einem Nest seidener Laken und Kissen. Ihr rosafarbener Fuß ruhte leicht auf dem Boden, und sie streckte die perfekt manikürte Hand nach ihrem Nachttisch aus, auf dem eine Morgenzeitung, ein Roman – Die Lady vom Lande in Amerika – und ein Tablett mit feinstem Tee-Porzellan standen. Auf ihrem Schminktisch, dem Hort weiblicher Ausschweifungen, glänzten Kristallflakons mit goldenen Stopfen. Das Bild war bestechend, doch die Botschaft, häusliches Glück stünde ein jeder zur Verfügung, die wusste, wo man einzukaufen hatte, wirkte auf manche Betrachterinnen so schmerzhaft wie auf andere verlockend. Einer ganzen Generation Frauen war die Verwirklichung dieser Vorstellung verwehrt geblieben; einer Generation, deren Chance auf Zufriedenheit und Sicherheit, sogar auf Zweisamkeit, von einem Krieg zerstört worden war, und diesen Verlust konnten selbst die schönsten Satinlaken der Welt nicht dämpfen. Sie warf einen Blick auf die alten Jungfern zu ihrer Rechten und Linken, doch sie verwendete das Wort halbherzig, war sich darüber im Klaren, dass sie sich etwas vormachte, indem sie sich von der Gruppe abgrenzte. In jedem Fall steckte hinter den sorgenvollen Mienen mehr als nur Bedenken darüber, ob die spärliche Bekleidung der Schaufensterpuppe der Novemberkälte gewachsen war.
Der Bürgersteig war gerade breit genug, um zwei Fußgängerströmen Platz zu bieten, und Josephine ging langsam weiter, wobei sie sich in den Kleinstadtfrauen wiedererkannte, die völlig in ihren Besorgungen aufgingen und nichts verpassen wollten. Es war nach siebzehn Uhr, und im Laufe der letzten Stunde waren die Rosa- und Orangetöne des winterlichen Sonnenuntergangs von einem blau-schwarzen Himmel verdrängt worden. Straßenlaternen erstreckten sich vor ihr wie Perlen auf einem Faden, verloren sich in der Ferne und nahmen der Einkaufsmeile – der Damenmeile, wie sie allgemein genannt wurde – die Gewöhnlichkeit des Tages. Einige der kleineren Geschäfte hatten bereits geschlossen und entließen ihre Mitarbeiter auf die Straße, und ein paar Verkäuferinnen hielten inne und betrachteten sehnsüchtig die Schaufenster der größeren Läden. Der lange Arbeitstag hatte den Wunsch nur noch verstärkt, einmal auf der anderen Seite der Theke zu stehen. Die meisten jedoch machten sich rasch auf den Weg zur U-Bahn oder reihten sich in die Busschlangen ein, die mit jeder Sekunde länger wurden, wobei sie ungeduldig vor sich hinmurmelten und es kaum erwarten konnten, die wenigen freien Stunden zu genießen, bevor die alltägliche Routine aufs Neue begann.
So beeindruckend die aneinandergereihten Geschäfte auch sein mochten, die Oxford Street war einer der Teile Londons, die Josephine am wenigsten mochte, und sie ertrug sie aus einer puren Schwäche für Bekleidung, aber keine Sekunde länger als nötig. Sie war froh, das Gedränge und Geklapper hinter sich zu lassen und in die weniger überlaufenen Straßen Richtung Wigmore Street einzubiegen. Das Gefühl der Anonymität bei einem frühabendlichen Spaziergang durch London begeisterte sie nach wie vor. Niemand auf der Welt wusste, wo sie sich befand oder wie sie zu erreichen war, und sie genoss den Frieden, der damit einherging. Sie war vor zehn Tagen aus Inverness eingetroffen, hatte ihre Ankunft in London jedoch erfolgreich geheim gehalten, von ein paar Bekannten in ihrem Club einmal abgesehen. Es würde nicht ewig anhalten; in der nächsten Woche standen ihr mehrere Verpflichtungen bevor, und irgendwann würde sie den Hörer abheben und sich einer Flut von Einladungen stellen müssen. Doch damit hatte sie es nicht eilig. Eine Welt ohne Zeitpläne und Abgabetermine, in der niemand Nachrichten für sie hinterließ, war Josephine mehr als recht. Sie war fest entschlossen, sie so lange wie möglich auszukosten.
Trotzdem war ihr die ungezwungene Geselligkeit des Einkaufsnachmittags nach einem einsamen Morgen auf ihrem Zimmer willkommen gewesen – nur sie und ihre Schreibmaschine und ein paar unscharfe Figuren aus einer Vergangenheit, die sich völlig fremd anfühlte. Sie war sich mit dem Roman, an dem sie gerade arbeitete, noch immer nicht sicher – war der Wunsch, etwas anderes zu schreiben als einen Kriminalroman, wirklich so weise gewesen? Als ihr Verleger ein Buch mit historischem Einschlag vorgeschlagen hatte, war sie mit der Idee der fiktiven Verarbeitung eines realen Verbrechens sehr zufrieden gewesen, insbesondere, da eine persönliche Verbindung bestand, doch der klaustrophobische Schrecken von Holloway schlug sich allmählich auf ihre Stimmung nieder, und sie hatte gerade erst begonnen. Der Sommer – sowohl der echte, den sie in Cornwall verbracht hatte, als auch die imaginäre Version, die sie vor Kurzem bei ihrem Verlag eingereicht hatte – kam ihr weit entfernt vor, und sie sehnte sich nach der wärmenden Sonne auf ihrem Rücken und der tröstlichen Gesellschaft Inspektor Alan Grants, dem Helden ihrer zwei ersten Kriminalromane. Die frühen Stadien eines Buches, in denen die Figuren ihr noch nicht vertraut waren, fielen ihr stets am schwersten. Es fühlte sich an, als beträte sie einen Raum voller Unbekannter, was dank ihrer Schüchternheit eine entsetzliche Vorstellung war. Sie freute sich schon darauf, mit dem Text voranzukommen, obwohl die Welt, die sie erschuf, vermutlich nicht fröhlicher werden würde.
Der Times Book Club auf der anderen Straßenseite war noch geöffnet, und es amüsierte sie, dass Bücher es stets schafften, den inneren Einkäufer im männlichen Geschlecht zu wecken. Eine Lampe unter der Markise warf warmes gelbes Licht auf die Regale, in denen verblasste Umschläge beliebter Romane an obskuren politischen Pamphleten lehnten – die Mischung war so willkürlich wie die Kundschaft, die darin stöberte. Sie überlegte, ob sie hineinschauen sollte, doch sie war zu schwer bepackt, um sich in Ruhe umzusehen, und ging weiter Richtung Cavendish Square. Dort waren die Straßenlaternen nachgiebiger, die Lichtkegel von längeren dunklen Abschnitten unterbrochen, und der Gegend wohnte eine beschauliche Eleganz inne. Der Platz hatte mehr Glück gehabt als andere Teile Londons, in denen Wohnhäuser sich nun an moderne Bürobauten drängen mussten, und bestand zum Großteil noch aus wunderschönen alten Häusern. Es war Feierabend, und auf ihrem Weg zur Nummer 20 beobachtete Josephine, wie in den oberen Stockwerken die Lichter angingen, und stellte sich vor, wie Türen geöffnet wurden und Stimmen nach oben riefen, während sich das Leben vom Büro ins Wohnzimmer verlagerte.
Der Cowdray Club befand sich in einem besonders ansehnlichen Stadthaus aus dem achtzehnten Jahrhundert an der Ecke Henrietta Street, im Herzen der schicksten Gegend des georgischen Zeitalters. Das Gebäude war Lord Asquith abgekauft worden – dem letzten einer Reihe namhafter Eigentümer – und im Jahr 1922 von Annie, Viscountess Cowdray, in einen Club für Krankenschwestern und berufstätige Frauen verwandelt worden. Lady Cowdray, deren Bekanntschaft Josephine nie gemacht hatte, musste eine herausragende Spendensammlerin und treue Unterstützerin des Schwesternberufs gewesen sein, hatte sie doch außerdem ein neues Hauptquartier für das College of Nursing in Asquiths ehemaligem Garten finanziert; dank eines architektonischen Meisterstreichs ergänzten sich die beiden Gebäude perfekt. Das eine war für die beruflichen Bedürfnisse der Krankenschwestern zuständig, das andere für Erholung und Entspannung. Etwas mehr als die Hälfte der Mitglieder waren Schwestern, die anderen entstammten allen möglichen Berufen – Anwältinnen, Journalistinnen, Schauspielerinnen und Verkäuferinnen, die von anregenden Gesprächen, gediegener Umgebung und dem günstigsten Mittagessen der Stadt angelockt wurden –, und Josephine kam hier unter, wenn sie ihre Aufenthalte in London geheim halten und keine sozialen Verpflichtungen eingehen wollte. Seit Lady Cowdrays Tod vor etwas mehr als drei Jahren lebten die Mitglieder nicht mehr ganz so harmonisch zusammen: Die Krankenpflege war ein politischer Beruf, und diejenigen, die den Club fortführten, hatten andere Ansichten zu Prioritäten und Zukunftsgestaltung als seine Gründerin. Vermutlich war es immer so, wenn eine geborene Anführerin starb oder weiterzog, und irgendwann würden sich die Dinge wieder beruhigen. In der Zwischenzeit verhielt Josephine sich unauffällig und mied die Streitereien.
Vor dem Haupteingang verlagerte sie alle Päckchen auf einen Arm, doch die Tür flog auf, bevor sie sie selbst öffnen konnte, und eine junge Frau – eine der Bediensteten des Clubs – schoss heraus und stieß sie dabei um ein Haar zu Boden.
»Habe ich den Feueralarm überhört?«, fragte Josephine etwas sarkastischer als beabsichtigt.
»Oje, Miss, das tut mir leid.« Das Mädchen bückte sich nach den Päckchen, die über den Bürgersteig bis auf die Straße gerutscht waren. »Ich habe nicht richtig aufgepasst.«
»Das war nicht zu übersehen«, erwiderte Josephine, wurde jedoch nachsichtiger, als sie merkte, wie aufgebracht das Mädchen war. »Ist ja nichts passiert. Da ist nichts Zerbrechliches drin.« Sie streckte die Hand nach dem letzten Päckchen aus. »Warum haben Sie es so eilig? Ist alles in Ordnung?«
»Ja, Miss. Ich habe bloß gerade Pause, und die ist nicht besonders lang. Ich bin spät dran für eine Verabredung.«
»Für einen Mantel wird es doch noch reichen, oder?« Sie betrachtete die dünne Baumwolluniform, die sämtliche Angestellten trugen. »Es ist November – in dem Kleidchen holen Sie sich noch den Tod.«
»Ist schon gut, Miss, ich mach mich lieber auf den Weg. Eigentlich soll ich die Tür hier gar nicht nehmen, aber es geht viel schneller als durch die Seitentür und einmal rum. Deswegen hatte ich es auch so eilig. Miss Timpson am Empfang hat jemanden zur Bar gebracht, da bin ich schnell hier raus, als sie nicht hingeguckt hat.« Sie warf einen Blick zum Platz und wandte sich dann wieder Josephine zu. »Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das für sich behalten könnten, Miss. Und ich komme schon zurecht, ehrlich. Ich bleibe nicht lange an der Luft.«
»Na gut, …?«
»Lucy, Miss.«
»Na gut, Lucy, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Aber passen Sie nächstes Mal besser auf.«
»Jawohl, Miss. Danke.«
Josephine sah Lucy hinterher, wie sie auf die Mitte des Platzes zueilte, wandte sich dann ab und ging hinein. Sie war froh um die Wärme in dem geräumigen, ordentlichen Foyer, in dem alles auf eine lange Empfangstheke aus gewissenhaft poliertem Mahagoni ausgerichtet war. Rechts davon hing eine bescheidene eichengerahmte Bronzeplakette mit dem Wappen der Cowdrays, auf der die ersten zweitausend Mitglieder ihre Dankbarkeit gegenüber der Gründerin kundtaten; abgesehen davon waren die Wände leer, und die Blicke der Besucher wurden von mehreren wunderschön ausgestatteten Zimmern angezogen, die direkt vom Eingangsbereich abgingen. Miss Timpson war wieder an Ort und Stelle, und Josephine kam in den Genuss der geballten Cowdray-Club-Begrüßung.
»Miss Tey.« Sie strahlte Josephine an. »Wie ich sehe, hatten Sie einen erfolgreichen Nachmittag. Darf ich Ihnen Ihren Schlüssel holen?«
»Das wäre wunderbar, danke.« Sie erwiderte das aufrichtige Lächeln der Empfangsdame und überlegte, an wen sie sie erinnerte. »Es sind leider noch ein paar mehr Sachen auf dem Weg.«
»Sind schon hier – Robert hat die letzte Fuhre gerade auf Ihr Zimmer gebracht.« Sie warf einen missbilligenden Blick auf die beschädigten Pakete. »Soll er Ihnen mit denen hier helfen? Der Aufzug ist derzeit leider wieder außer Betrieb.«
»Nein, ich komme zurecht.« Josephine wusste, dass sie für Miss Timpsons Geschmack bereits zu viel von Roberts Zeit verschwendet hatte. »Die hier sind nicht schwer.«
»Wie Sie wünschen.« Sie griff nach dem Schlüssel, der an seinem Haken hing, und da fiel es Josephine wie Schuppen von den Augen: Miss Timpson hatte die gleiche unbekümmerte Art wie die Schaufensterpuppe, eine beiläufige Vollkommenheit, die den meisten Frauen unerträglich war, und sei es auch nur, weil sie sich selbst danach sehnten und sie nie erreichen würden. »Melden Sie sich einfach, wenn Sie noch etwas brauchen.«
»Sie erfahren es als Erste.« Josephine nahm den Schlüssel entgegen und machte sich auf den Weg zur Treppe, doch sie schaffte es nicht weit, bevor sie von einer vertrauten Stimme aufgehalten wurde.
»Josephine! Nach dir habe ich gesucht.«
Als sie sich umdrehte, um Celia Bannerman zu begrüßen, war sie – wie jedes Mal – überrascht davon, wie wenig sie sich in zwanzig Jahren verändert hatte. Das lange dunkle Haar, das sie stets zu einem strengen Knoten gebunden hatte, war mittlerweile an den Schläfen ergraut, und sie war zu sehr auf ihre Brille angewiesen, um sie lediglich an einer Kette um den Hals zu tragen, doch auf fast sechzig hätte sie niemand geschätzt. Sie hatten einander während des Krieges in Anstey kennengelernt, einem Ausbildungsinstitut für Sportlehrerinnen in Birmingham, das Josephine als Schülerin besuchte, während Miss Bannerman eine der erfahrensten Ausbilderinnen war. Als sie sich im Cowdray Club wiederbegegneten, hatte Miss Bannerman – beziehungsweise Celia, wie sie immer wieder beharrte – es zu einer der angesehensten Vertreterinnen der Pflegeverwaltung gebracht und viel mit der Geschäftsführung des Clubs zu tun. Seit ihrer Anstellung als Wärterin in Holloway hatte sie viel erreicht, doch an ebenjenen frühen Jahren war Josephine interessiert.
»Ich wollte dir gerade eine Nachricht am Empfang hinterlassen«, sagte Celia. »Aber die Mühe kann ich mir ja jetzt sparen. In deiner Nachricht stand, ich soll mir etwas für dich durchlesen?«
»Ja, den ersten Entwurf davon, worüber wir uns unterhalten hatten. Ich wollte Sie fragen, ob Sie ihn sich mal ansehen würden, nur damit es auch einigermaßen wirklichkeitsgetreu ist, und dann hätte ich noch ein paar zusätzliche Fragen, falls Sie Zeit dafür haben.«
»Ja, natürlich.« Sie schaute auf die Uhr. »Ich hätte jetzt Zeit, wenn dir das passt. In einer Viertelstunde im Salon? Dann kannst du dich kurz sortieren.«
Sie ging davon, ohne eine Antwort abzuwarten, und Josephine erkannte darin das Vertrauen in die eigene Autorität wieder, das ihr den Respekt sämtlicher Schülerinnen eingetragen hatte – Respekt, der mit dem genau richtigen Maß an Angst versetzt war. Nur einmal hatte sie erlebt, wie diese Autorität versagte, und dann auch nur kurz und unter außergewöhnlichen Umständen, und jedes Mal versetzte sie sie zurück in ihre Ausbildungszeit. Sie hastete zur Treppe, als käme sie zu spät zum Unterricht, wurde jedoch erneut aufgehalten, diesmal von Miss Timpson. »Ach, Miss Tey, das hätte ich fast vergessen – nehmen Sie das hier gleich mit«, rief sie, und dank der Lautstärke trat ihr East-End-Akzent hervor. »Das kam heute Nachmittag für Sie.« Sie beugte sich hinter den Tresen und hielt Josephine dann eine teuer aussehende Gardenie hin. Josephine streckte die Hand nach einer Karte aus.
»Tut mir leid, das ist alles. Es war keine Karte dabei.«
»Und Sie sind sich sicher, dass es für mich ist?«
»Und wie. Der Junge aus dem Laden hat sich sehr deutlich ausgedrückt. Ich musste sogar unterschreiben.«
»Aber niemand weiß, dass ich hier bin.«
»Dann hast du vielleicht eine Bewunderin im Haus, meine Liebe.« Josephine wusste sofort, von wem die Anspielung stammte. Die Stimme – warm, anziehend und voll von Zweideutigkeiten – gehörte genauso sehr zum Cowdray Club wie die Ausstattung und war genauso teuer. Die Ehrenwerte Geraldine Ashby fiel in eine ungewöhnliche Mitgliederkategorie: Sie war weder Krankenschwester noch berufstätig, sondern gehörte zu einer Handvoll Damen, die vom Führungsgremium in den Club gewählt worden und nur aus gesellschaftlichen Gründen dabei waren. Geraldines Mutter sicherte ihr den Platz alljährlich nur zu gerne mit einem großzügigen Scheck an das College of Nursing – immerhin war die Zugehörigkeit ihrer Tochter das Respektabelste an ihr –, und Geraldine nahm ihre sozialen Pflichten so ernst wie die anderen Mitglieder ihre Arbeit. Niemand konnte behaupten, sie würde die Dinge nicht erheblich aufwirbeln, und nicht nur, weil sie die besten Cocktails außerhalb des Savoys mischte; alles an ihr war gewagt, was eine erfrischende Abwechslung zur Ernsthaftigkeit bildete, die sonst wolkenartig über dem Club schwebte. Es war unmöglich, sich nicht von ihrem Charme und ihrer guten Laune einnehmen zu lassen, und ihre Schönheit – eine elegante, abenteuerlustige Schönheit – schillerte in einem maßgeschneiderten Hosenanzug ebenso sehr wie im neuesten Chanel-Modell. Kurzzeitig vergaß Geraldine das Mädchen an ihrem Arm – eine hübsche, wenngleich langweilig wirkende Blondine – und lächelte Josephine diabolisch zu. »Überleg nur mal, jede von uns könnte sie dir geschickt haben. Wer wäre dir am liebsten?«
Aus Erfahrung wusste Josephine, dass ihr die passende Antwort – kokett mit einer fein dosierten Portion Geringschätzung – erst später einfallen würde, daher nahm sie die Pflanze lediglich mit einem hoffentlich mysteriösen Lächeln entgegen und schritt entschlossen die Treppe hinauf. An Miss Timpsons Grinsen hatte sie erkannt, dass die Frage, bei wem es sich um ihren Bewunderer handelte, seit Ankunft der Gardenie wild diskutiert worden war, und sie zerbrach sich selbst den Kopf, von wem sie stammen könnte. Archie? Unwahrscheinlich – Gardenien waren nicht seine Art, und wenn er wüsste, dass sie schon in London war, hätte er etwas weitaus Dezenteres gewählt und es persönlich überbracht. Die Motley-Schwestern waren es bestimmt nicht – sie bezweifelte, dass Ronnie ihren Lebtag je etwas Anonymes getan hatte, und Blumen von Lettice gingen normalerweise mit einer Einladung zum Abendessen einher. Lydia vielleicht – als Schauspielerin ohne festes Engagement läge so ein Geschenk zwar außerhalb des Budgets, doch ihre Freundin war für ihren unbekümmerten Umgang mit Geld bekannt, und eine derartige Extravaganz würde zu ihr passen. Oder womöglich hatte Geraldine recht, und ein anderes Clubmitglied hatte sie ihr geschickt. Das hatte ihr gerade noch gefehlt – sie musste den einzigen Ort hinterfragen, an dem sie sich sicher fühlte. Mit einem erleichterten Seufzen schloss sie die Tür hinter sich, stellte die Pflanze kurzerhand ins Waschbecken und versuchte, sie zu vergessen.
Ihr Zimmer war klein, aber gemütlich und mit allem Nötigen ausgestattet: ein Einzelbett, ein massiver Schreibtisch, ein großer Kleiderschrank und ausreichend Stauraum. Am besten gefiel ihr jedoch das große Fenster, das fast eine ganze Wand einnahm und den Cavendish Square überblickte. Sie verstaute ihre Einkäufe, puderte sich die Nase und setzte ihre Brille auf, bevor sie den Papierstapel von ihrem Schreibtisch nahm, an dem sie am Vormittag gearbeitet hatte. Sie überflog die Seiten rasch und notierte sich die Fragen, bei denen Celia ihr hoffentlich weiterhelfen konnte. Dann machte sie sich wieder auf den Weg nach unten und konnte es dabei kaum erwarten, so viel wie möglich über die Kindsmörderinnen von Finchley zu erfahren.
Von Celia war im Salon keine Spur, und Josephine nahm auf einem der blauen Rosshaarsessel an den Fenstern mit Blick auf die Henrietta Street Platz. Der Raum erstreckte sich über die gesamte Breite des ersten Stocks und war mit der hübsch proportionierten Wandvertäfelung – die in elfenbeinweißer Emaille gestrichen war, um so viel Tageslicht wie möglich zu reflektieren – und dem Parkettboden einer der schönsten im Haus. Exquisite Rokoko-Spiegel hingen über im Original erhaltenen Kaminen, von denen sich an jedem Ende einer befand, was darauf hinwies, dass der Bereich ursprünglich in zwei Räume aufgeteilt gewesen war, und hier und da blitzten weitere prachtvolle Stücke auf: ein vergoldetes Sofa mit saphirfarbenen Polstern aus der Zeit Ludwigs XV. sowie drei gigantische Kronleuchter, doch der Rest der Ausstattung war dezent geschmackvoll. Schlichte Mahagoniregale mit einer eklektischen Mischung aus Belletristik und Sachliteratur, einfarbige Samtvorhänge und bequeme Sheraton-Stühle, die abwechselnd in Blau und Beige gepolstert waren und keine Quasten oder locker sitzenden Bezüge hatten, die den Raum unordentlich hätten wirken lassen. Frauen saßen in kleinen Gruppen oder allein an Tischen, spielten Karten oder lasen Zeitung, und leise Gespräche füllten den Raum, welche hie und da von Gelächter und dem Klirren von Geschirr durchsetzt wurden. Es roch nach Privileg, doch die meisten Frauen hatten hart für ihren Platz gearbeitet, und Josephine wusste noch gut, wie stolz sie bei ihrer Aufnahme gewesen war. Wie für viele Frauen ihrer Generation repräsentierte die Mitgliedschaft in einem privaten Club eine neue, wertvolle Unabhängigkeit; zehn Jahre später hatte ihr Leben sich zwar in eine unerwartete Richtung entwickelt, doch mit ihren Verdiensten als Romanschriftstellerin und Bühnenautorin hatte sie sich ihren Platz mehr als verdient. Ihr Erfolg hatte die Begeisterung der frühen Jahre jedoch nicht gedämpft. Teils hing es mit den frischen Zukunftsmöglichkeiten für Frauen zusammen – zumindest für diejenigen, die Glück hatten –, doch es steckte noch mehr dahinter. Im Cowdray Club hatte sie das Gefühl weiblicher Solidarität wiederentdeckt, das sie aus ihrer Jugend und ihren frühen Erwachsenenjahren kannte, und zu ihrem Leidwesen musste sie sich nach wie vor das Bedürfnis eingestehen, dazuzugehören.
»Josephine! Tut mir leid, dass du warten musstest, mir ist etwas dazwischengekommen.« Celia kam mit entschuldigender Miene auf die Fensterfront zugeeilt, und Josephine stand auf, um sie zu begrüßen.
»Schon gut«, sagte sie. »Machen Sie sich keinen Kopf. Wir können uns auch ein andermal treffen, wenn Sie gerade zu viel zu tun haben.«
»Nicht doch, ich freue mich, dich zu sehen. Und ehrlich gesagt, kann ich eine halbe Stunde ohne Komitees, Spendensammlung und Politik gut gebrauchen, du tust mir also im Grunde einen Gefallen.« Sie bedeutete Josephine, Platz zu nehmen, und setzte sich auf den Sessel gegenüber. »Hast du schon von der Benefizgala nächste Woche gehört? Bestimmt, du bist ja mit Ronnie und Lettice Motley befreundet. Die beiden schneidern uns wunderschöne Kleider. Amy Coward denkt jedenfalls anscheinend, ich hätte außer der Galaplanung nichts zu tun, und weil wir ohne sie Noël nicht auf die Gästeliste kriegen, darf ich ihr die Illusion nicht rauben.«
Josephine lachte. »Nach Lady Cowdrays Tod ist Ihnen bestimmt viel zusätzliche Arbeit in den Schoß gefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich so ein Club leicht führen lässt, oder zumindest nicht reibungslos.«
Celia lächelte schief. »Ist das so offensichtlich?«
»Überhaupt nicht. Aber bei so vielen erfolgreichen Frauen auf einem Haufen ist es ja kein Wunder, dass Meinungen aufeinanderprallen.«
»Wenn es nur um persönliche Befindlichkeiten ginge, wäre es ja kein Problem, aber die Sache ist etwas ernster. Das geht alles auf die Prinzipien zurück, auf denen der Club und das College gegründet wurden. Hast du schon die Times von heute gesehen?« Josephine schüttelte den Kopf. »In den Leserbriefen wimmelt es nur so vor Krankenschwestern, die sich darüber beschweren, dass in ihrem Namen Spenden gesammelt werden, die dann Einrichtungen für Leute zugutekommen, die sich ihren Lebtag nie den Kranken genähert haben. Der Club wird zwar namentlich nicht erwähnt, aber wir wissen alle, wer gemeint ist.«
»Aber es läuft doch nicht nur in eine Richtung. Die Mitgliedsgebühren kommen doch auch dem College of Nursing zugute, oder?«
»Natürlich, aber das vergessen die Puristen gerne. Wenn wir nicht aufpassen, teilen wir uns bald in zwei, und ich weiß nicht, wie Club oder College das überstehen sollen.«
Da sie bei ihrer Aufnahme noch mit einem Fuß in der Krankenpflege gestanden hatte, konnte Josephine Verständnis für beide Seiten aufbringen. »Wie stehen Sie dazu?«, fragte sie und nickte kurz Geraldine zu, die gerade am Nebentisch Platz nahm und sie vielsagend angrinste.
Celia seufzte. »Ich probiere gern öfter mal Neues aus. Lady Cowdray meinte immer, Frauen würden viel zu engstirnig, wenn sie nicht zumindest einen Teil ihrer Freizeit mit Leuten aus anderen Berufen verbringen, und ich neige dazu, ihr zuzustimmen. Außerdem fühle ich mich ihrer ursprünglichen Vision verpflichtet, und damit werde ich es nicht einfach haben. Und zu allem Überfluss – das bleibt aber unter uns – haben wir es jetzt auch noch mit Diebstahl im Haus zu tun. Einigen Mitgliedern sind Dinge abhandengekommen, nichts sonderlich Wertvolles, hier ein Halstuch, da ein bisschen Kleingeld, aber natürlich ist es trotzdem besorgniserregend, und wir haben die Polizei eingeschaltet. Ganz diskret, natürlich. Ah, da kommt ja Tilly mit unseren Getränken.« Josephine entdeckte die junge Kellnerin, die zwei große Gläser Gin auf einem Tablett trug. »Ich war so frei. Wenn ich mich mit den Kindsmörderinnen von Finchley auseinandersetzen muss, muss ich mir erst Mut antrinken, und nur ein Schwein trinkt allein.« Sie warf einen Blick zu den Unterlagen auf dem Kartentisch. »Das soll ich mir ansehen?«
Josephine nickte und schob Celia das Schreibmaschinenmanuskript hin, wobei sie innerlich darüber staunte, wie leicht es war, wieder in die alte Lehrerin-Schülerin-Beziehung zu verfallen. Sie beobachtete, wie sich Celia langsam durch die Seiten blätterte, und dachte daran zurück, wie sie zum ersten Mal von Amelia Sach und Annie Walters gehört hatte. Es war der Sommer ihres letzten Jahres in Anstey gewesen, kurz vor den Abschlussprüfungen, als die Nächte lang und die Geduldsfäden angespannt gewesen waren. Der Erfolgsdruck, und für die älteren Schülerinnen auch die Notwendigkeit, eine Stelle in der echten Welt zu finden, lastete schwer auf der gesamten Einrichtung, und im Gemeinschaftsraum war es ungewöhnlich still, während ein halbes Dutzend Prüflinge jede verbleibende Sekunde zum Lernen nutzte. Für gewöhnlich schlug Celia Bannermans hochgewachsene, Respekt einflößende Gestalt jeden Raum, den sie betrat, in ihren Bann, doch an jenem Abend musste sie bereits eine Weile im Zimmer gewesen sein, bevor sie jemand bemerkte. Als Josephine aufsah, stand sie am Fenster und betrachtete die Mädchen in ihrer Obhut aus tieftraurigen Augen. Eine nach der anderen sah auf und bemerkte sie, und als sie endlich die gesammelte Aufmerksamkeit hatte, erklärte sie mit ruhiger, aber ernster Stimme, Elizabeth Price, eine Schülerin in ihrem ersten Ausbildungsjahr, sei tot in der Turnhalle gefunden worden. Sie habe an einem der Seile gehangen, und es bestehe kein Zweifel daran, dass es sich um Suizid handelte – in ihrem Zimmer habe ein Abschiedsbrief gelegen. Miss Bannerman erklärte, Elizabeths eigentlicher Nachname sei Sach, und sie sei die Tochter einer Frau, die für furchtbare Verbrechen an Säuglingen gehängt worden war. Sie sei als kleines Kind adoptiert worden und habe bis vor Kurzem nichts von ihrer Herkunft geahnt. Irgendwie habe sie jedoch die Wahrheit erfahren, und aus ihrem Brief gehe hervor, dass sie nicht damit leben konnte. Celia Bannerman bewegte sich normalerweise mit der Eleganz einer Tänzerin, doch als sie an jenem Abend aus dem Zimmer ging, waren ihre Schritte langsam und schwer. Erst später erfuhr Josephine, dass sie sich die Schuld an Elizabeth Price’ Tod gab.
Celia ließ sich mit der Lektüre von Josephines Manuskript Zeit, und als sie fertig war, nahm sie sich ein paar Abschnitte erneut vor. Schließlich legte sie die Blätter wieder auf den Tisch und griff nach ihrem Glas. »Nehmen Sie sich nicht zurück«, sagte Josephine und ärgerte sich über ihr Bedürfnis, das Schweigen zu brechen. »Ich komme inzwischen mit Kritik zurecht.«
Celia lächelte. »Mit Zurücknahme hat es nichts zu tun. Es ist sehr eindringlich. Vielleicht etwas zu eindringlich für meinen Geschmack – bei der Lektüre kommt alles wieder hoch. Wenn man nicht selbst dabei war, versteht man nicht, wie es ist, einer Hinrichtung beizuwohnen, aber das hier kommt nah dran. Darf ich ein paar Anmerkungen machen?« Josephine nickte. »Das ist natürlich deine Entscheidung, ob du eine packende Erzählung über die Wahrheit stellst, aber die letzten Stunden würden niemals so ruhig verlaufen. Ich verstehe ja, dass du die Beziehung zwischen Gefangener und Wärterin beleuchten willst, aber in der Zelle war mehr los als am Bahnhof von Finchley, wenn du mir die Bemerkung verzeihst. Am Morgen einer Hinrichtung kommen Gott und die Welt vorbei: erst der Direktor, dann der Pfarrer. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei Walters war, aber der Pfarrer hat einige Zeit mit Sach verbracht. Ach ja, und der Direktor fragt die Gefangene immer, ob sie irgendwelche letzten Worte hat.«
»Und? Hatte sie welche?«
»Nein.«
»Kein Geständnis in letzter Sekunde?«
»Nein. Weder Sach noch Walters haben je ein Geständnis abgelegt. Irgendwer hat mir mal erzählt, Walters hätte gesagt, sie hätte nichts gegen ihren Tod, solange Sach auch sterben würde, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Zwischen den beiden herrschte am Ende viel Bitterkeit. Walters fühlte sich von Sach betrogen, weil sie unbedingt ihre eigene Haut retten wollte, und Sach fühlte sich vom Rechtssystem betrogen, weil sie sich für unschuldig hielt. Walters war für die Morde verantwortlich, und Sach hatte stets darauf geachtet, sich nicht die Hände schmutzig zu machen. Das hat sie uns immer wieder erzählt, mir und den anderen Frauen, die sich um sie gekümmert haben.«
»Macht es das nicht nur noch schlimmer? Jemand anderen die Drecksarbeit machen lassen?«
»Sie hat es jedenfalls nicht so gesehen. Ich war sogar überrascht, dass ihr Verteidiger das Argument nicht stärker ausgenutzt hat.«
»Wie haben Sach und Walters sich die Arbeit aufgeteilt? Aus der Zeitung erfährt man immer nur die Hälfte der Geschichte, und ich würde es lieber von jemandem hören, der sie persönlich kannte.«
»Sach hat ein Pflegeheim geführt und junge Frauen im Wochenbett aufgenommen. Die meisten waren unverheiratet und hätten alles darangesetzt, ihre Schande zu verbergen und heil aus der Situation herauszukommen. Anscheinend hat Sach behauptet, sie kenne zahlreiche Frauen, die ein Kind adoptieren wollen, und ihnen angeboten, ein gutes Zuhause für das Neugeborene zu finden.«
»Gegen ein kleines Entgelt, nehme ich an.«
»So klein war es nicht. Die meisten haben etwa dreißig Pfund bezahlt, was damals eine Menge Geld war, besonders für Frauen aus solchen Schichten.«
»Das heißt, sie haben bezahlt und ihre Kinder dann nie wiedergesehen?«
»Genau. Sie waren alle in dem Glauben, ihre Kinder würden adoptiert werden, zumindest haben sie das gesagt. Wobei einige wahrscheinlich zu verzweifelt waren, um sich groß darüber Gedanken zu machen. In Wirklichkeit hat Walters sie aber entgegengenommen und entsorgt. Eines Tages wurde sie mit einem toten Kind auf dem Arm gefunden und hat die Polizei schnurstracks zu Sach geführt. Sach hat bestritten, über die Kindsmorde Bescheid zu wissen, aber niemand hat ihr geglaubt.«
»Glauben Sie, dass sie schuldig war?«
»In so einer Position darf man nicht über Schuld oder Unschuld nachdenken. Das war nicht meine Aufgabe, und ich konnte meiner Arbeit nur nachgehen, indem ich auf das System vertraute. Rückblickend denke ich schon, dass es das richtige Urteil war; die beiden kamen sich allerdings ungerecht behandelt vor. Zwischen Verurteilung und Hinrichtung haben sie einander nicht gesehen, aber sie waren Zellnachbarinnen und haben oft an die Wand gehämmert und sich gegenseitig beschuldigt.«
»War das Ihre erste Hinrichtung?«
»Meine erste und Gott sei Dank auch letzte. In England wurde seit drei Jahren keine Frau mehr gehängt. Damals wurde eine große Sache daraus gemacht, dass es die erste Hinrichtung von Frauen unter dem neuen König war, als würde ein Herrscherwechsel irgendeinen Unterschied machen. Und es war die erste Hinrichtung im neuen Holloway. Ein Testlauf, sozusagen.« Sie klang bitter, und Josephine wunderte sich nicht darüber. Hängen war ein entsetzlicher Tod, und die Tatsache, dass er staatlich organisiert war, nahm ihm nichts an Schrecken. »Keine von uns hatte bis dahin Erfahrung mit so etwas, und dann war es auch noch eine Doppelhinrichtung. Um ehrlich zu sein, haben wir alle auf eine Begnadigung gehofft. Anscheinend hat es selbst dem Henker davor gegraut.«
»Das war Billington, richtig?«
»Ja, zusammen mit zwei Assistenten. Seinem kleinen Bruder und einem der Pierrepoints.«
»Das nimmt einen sicher schwer mit, einer Verurteilten so nahezustehen.« Josephine wusste, dass sie das Offensichtliche aussprach, wollte aber unbedingt wissen, wie Celia sich wirklich gefühlt hatte. »So eine seltsame Beziehung.«
»Ich vermute, es wirkt sich bei jeder anders aus. Ein paar der älteren Kolleginnen waren zu dem Zeitpunkt bereits abgehärtet. Sie haben sicher jahrelang damit gekämpft, die emotionalen Impulse abzuschütteln, die für viele von uns so natürlich sind. Manche waren so verstört davon, dass sie den Dienst ganz verlassen haben, aber du hast recht, immun war niemand. Es hatte auf uns alle einen zerstörerischen Effekt.«
»Wobei eine oder zwei den Ruf sicher auch genossen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand mit einer sadistischen Ader sich jahrelang an so etwas ergötzen kann.«
»Ich glaube, da verwechselst du uns mit Kriminalautorinnen.«
Celia lächelte zwar, doch die Schärfe der Bemerkung entging Josephine nicht. »Haben Sie etwas dagegen?«
»Dass du zum Spaß darüber schreibst? Das hängt von deiner Vorgehensweise ab, aber ich frage mich schon, weshalb man sich diesen Emotionen aussetzen sollte, wenn es nicht unbedingt sein muss – und wieso es jemand zum Vergnügen lesen sollte. Darf ich fragen, warum?«
Josephine dachte nach, bevor sie antwortete. »Ich habe den Abend in Anstey nie vergessen«, sagte sie schließlich. »Wie schockiert ich war, als Sie uns davon erzählt haben. Wir haben Elizabeth natürlich nicht gesehen, und Sie haben uns die Einzelheiten erspart, aber dadurch wuchs ihr Tod in unserer Vorstellung nur noch weiter an. Sie wissen ja, wie fantasiereich Mädchen in dem Alter sein können, und wir waren damals in einer empfindlichen Phase, haben uns Gedanken um die Zukunft gemacht, und ich glaube, uns war allen akut bewusst, wie leicht diese Zukunft erlöschen kann. Ich weiß noch, wie fasziniert ich davon war, was für ein Mensch ihre Mutter gewesen sein musste und was sie dazu getrieben hatte. Damals war es noch gar nicht so lange her, und trotzdem hat es sich angefühlt wie ein Verbrechen aus einem anderen Zeitalter, etwas, worüber Dickens schreiben würde, und nichts, woran wir uns womöglich erinnern konnten.«
Celia nickte. »Einer Gruppe moderner junger Frauen ist es sicher sehr seltsam vorgekommen.«
»Und wir haben nie erfahren, wer Elizabeths Geheimnis entdeckt und sie damit verhöhnt hat, also kam noch ein rätselhaftes Element dazu, über das wir stundenlang spekuliert haben. Tagelang habe ich versucht, mich in ihre Lage zu versetzen, über meine eigene Vergangenheit nachgedacht und darüber, ob es etwas gab, mit dem ich nicht würde leben können.«
»Und?«
»Aus Scham würde ich es wohl nicht tun, aber ich kann mir vorstellen, wie schrecklich es sein muss, wenn man glaubt, man könnte aufgrund seiner Gene selbst zu so etwas Brutalem in der Lage sein. Vielleicht dachte sie, dass sie tief drinnen selbst grausam ist, und sie hatte Angst vor ihrer Zukunft – die Sünden der Mütter und so weiter. Möglicherweise hat sie ihrem Leben deswegen ein Ende gesetzt – sie dachte, das Schicksal ihrer Mutter würde sie eines Tages selbst einholen, da hat sie die Bestrafung selbst in die Hände genommen.« Sie lächelte beschämt. »Oder vielleicht war das auch nur die Fantasie einer Achtzehnjährigen.«
»Nein, ich glaube, da ist etwas dran«, erwiderte Celia ernst. »Sach hat sich während ihrer Haft ständig um ihre Tochter gesorgt. Fast schon ironisch, wenn man darüber nachdenkt, wie skrupellos sie mit anderer Leute Kindern umgegangen ist. Sie musste sich schon sehr von ihren Taten distanziert haben. Jedenfalls machte sie sich ständig Gedanken darum, ob ihr Mann auch Geld für neue Kinderstiefel sparen oder was man ihr später einmal über ihre Mutter erzählen würde. Und aus gutem Grund – der Kindsvater wollte für nichts mehr verantwortlich sein, sobald der Prozess vorbei war. In ihren letzten Tagen hat sie mich angefleht, auf Elizabeth aufzupassen, und ich habe es ihr versprochen, es kam mir nicht besonders schwerwiegend vor. Ich hätte mir nie ausmalen können, dass ich sie beide derart enttäuschen würde.«
»Geben Sie sich nicht die Schuld daran«, erwiderte Josephine sanft. »In gewisser Weise haben wir alle dazu beigetragen. Elizabeth war nicht besonders sympathisch, sie konnte hinterlistig und manipulativ sein. Wenn wir uns mehr Mühe gegeben hätten, sie in unseren Reihen aufzunehmen, wäre sie vielleicht mit den Neuigkeiten zurechtgekommen. Sie hätte eine Freundin gebraucht, und das war nicht Ihre Schuld.«
»Mag sein«, erwiderte Celia wenig überzeugt.
»Hatten Sie während ihrer Kindheit Kontakt zu ihr?«
»Nicht direkt, aber ich habe mich hin und wieder bei ihren Adoptiveltern gemeldet und ihre Schulbildung im Blick behalten. Sie war trotz allem ein schlaues Kind, und ich habe dafür gesorgt, dass sie nach Anstey kam. Das war womöglich ein Fehler, und außerdem war es nicht gerecht gegenüber allen anderen, die sich einen Platz erkämpft hatten. Aber ich habe wirklich geglaubt, sie würde darin aufgehen.«
»Vielleicht wäre das ja auch passiert, wenn sie die Zeit dafür gehabt hätte. Aber die Möglichkeit hat ihr jemand anders gestohlen, nicht Sie.«
»Ich hätte zumindest herausfinden sollen, wer sie dazu getrieben hat.«
»Und was hätte das genützt? Für Elizabeth hätte es keinen Unterschied gemacht, und ich bin mir sicher, diejenige hätte nie mit den Folgen gerechnet. Nun muss sie damit leben, und eine schlimmere Strafe wäre Ihnen wahrscheinlich auch nicht eingefallen. Ich hätte Sie gar nicht erst danach fragen dürfen«, fügte Josephine hinzu, und es tat ihr aufrichtig leid. »Wie unsensibel von mir, die Vergangenheit wieder ans Licht zu zerren und aus Neugier und Unterhaltungsdrang von Ihnen zu erwarten, dass Sie die Lücken füllen.«
»Du hast recht, es tut weh, und ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen. Nicht nur wegen Elizabeth, sondern auch wegen ihrer Mutter. Ihre Hinrichtung hat mein Leben zum Guten gewendet, und wer will schon von einem Tod profitieren?«
»In welcher Hinsicht?«
»Das ist schwer zu erklären, aber was mir von diesem schrecklichen Morgen am deutlichsten in Erinnerung geblieben ist, ist der Augenblick, in dem wir den Hinrichtungsraum betreten haben. Mit deiner Beschreibung von Sachs geistiger Verfassung hast du ins Schwarze getroffen – sie war so verängstigt, dass sie kaum stehen konnte, aber der Gefängnisarzt stand an der Tür, und das schien ihr Kraft zu verleihen. Sie hat sich kurz gefasst, wirklich nur sehr kurz, um sich bei ihm für seine Freundlichkeit zu bedanken. Das werde ich nie vergessen. Sach und Walters nannten sich übrigens beide Krankenschwestern, und zumindest Sach war ausgebildete Hebamme, aber trotzdem haben sie diesen unschuldigen Kindern auf kaltblütigste Weise das Leben genommen und Kapital aus der Verzweiflung anderer Frauen geschlagen. Der Gefängnisarzt war ein fähiger Mediziner, und Sach und Walters hatten seinen Beruf verhöhnt. Wir hätten es ihm nicht verdenken können, wenn er ihnen eine menschliche Behandlung verweigert hätte, aber er legte Sach die Hand auf die Schulter und sagte, sie solle stark sein, und das kam mir damals so unglaublich barmherzig vor.« Sie lachte nervös, und Josephine hatte den Eindruck, es war ihr unangenehm, so leichtfertig so viel preisgegeben zu haben. »Und seitdem versuche ich, dieser Haltung gerecht zu werden.«
»Haben Sie sich deswegen für die Laufbahn als Krankenschwester entschieden?«
»Deswegen habe ich beschlossen, damit weiterzumachen. Vor meiner Zeit in Holloway hatte ich schon einen Teil der Ausbildung absolviert, und ich habe eine Zeit lang im Krankenflügel gearbeitet. Eins kannst du mir glauben – wenn du dich je ermahnen musst, nicht auf die schiefe Bahn zu geraten, bist du dort an der richtigen Adresse. Die Frauen haben nicht auch nur einen Hauch von Privatsphäre. Ständig werden sie von einer Schwester bewacht, und die berüchtigteren Insassinnen werden von den anderen Gefangenen genaustens im Auge behalten. Du kannst dir sicher vorstellen, was das für eine Atmosphäre schafft, solche Frauen zusammenzuzwängen.«
»Ist dafür wirklich viel Vorstellungskraft nötig?« Josephine ließ den Blick vielsagend über die umliegenden Tische schweifen.
Celia lachte. »Glaub mir, das Essen hier ist besser. Aber im Ernst, wie soll man sich unter solchen Umständen auf einen Prozess vorbereiten?«
»Gibt es noch jemanden aus dem Gefängnis, der vielleicht mit mir reden würde? Was ist mit dem Arzt?«
»Ich glaube, er ist im Krieg gefallen«, erwiderte Celia. »Und sonst fällt mir spontan niemand ein. Ich war noch eine Weile mit Ethel Stuke in Kontakt, der anderen Aufseherin, aber sie ist 1915 bei einem Zeppelinangriff ums Leben gekommen. Billington lebt vielleicht noch, aber Gott weiß, wo. Ein paar Jahre lang war er der einzige Henker. Was aus dem Pfarrer geworden ist, weiß ich nicht, aber er war schon damals ziemlich alt. Ich könnte dir höchstens noch Mary Size anbieten. Sagt dir der Name etwas?«
»Nein.«
»Sie ist derzeit stellvertretende Direktorin in Holloway und hat viel für die Frauen dort und Gefängnisse an sich erreicht. Außerdem ist sie auch Mitglied, ich kann sie dir gerne vorstellen. Sach und Walters waren lange vor ihrer Zeit, aber sie könnte bestimmt mit dir über das Leben im Gefängnis an sich reden, wenn dir das weiterhilft.«
»Gern, vielen Dank. Und was ist aus den Familien der beiden geworden? Sie haben Sachs Ehemann erwähnt.«
»Ja, aber ich weiß nicht, wie du ihn finden solltest, sofern er überhaupt noch lebt.« Sie überlegte kurz. »Walters hatte zwei Nichten, die sie mehrfach besucht haben, aber ich weiß nicht mehr, wie sie hießen und wie viel sie dir erzählen könnten, selbst wenn du sie ausfindig machen würdest. Sie kam mir nicht unbedingt wie ein Familienmensch vor.«
»Was ist mit dem Prozess? Es gab doch sicher Zeugen.«
»Das müsstest du selbst recherchieren. Das liegt alles so lange zurück, und ich komme mir langsam alt vor, wenn ich darüber nachdenke, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Es ist gar nicht so einfach, auf den Anfang der eigenen Karriere zurückzublicken, wenn man dem Ende so nahe ist – eines Tages verstehst du das vielleicht.«
Josephine kam sich etwas bevormundet vor, machte sich jedoch lediglich einen Vermerk zu Walters’ Nichten und leerte ihr Glas. »Ich habe noch einige Artikel vor mir«, sagte sie, während sie ihre Papiere zusammensuchte. »Und im schlimmsten Fall schuldet mir die Polizei noch ein paar Gefallen.« Celia hob fragend eine Augenbraue. »Ein guter Freund von mir arbeitet bei Scotland Yard, und ich habe ihm schon öfter ausgeholfen. Was hat es für einen Sinn, Verbindungen bei der Polizei zu haben, wenn man sie nicht ausnutzt?«
»Denk dir einfach etwas aus, Josephine. Ist das nicht dein Talent? Das Leben schreibt immer noch die merkwürdigsten Geschichten. Ich will dir nicht erklären, was du zu tun hast, damit bin ich seit zwanzig Jahren fertig, aber eins muss ich noch loswerden, damit meine Seele Frieden hat: Was damals passiert ist, war weder mysteriös noch faszinierend, es war elend und deprimierend. Sach und Walters waren nichts Besonderes – solche wie sie gab es wie Sand am Meer, und sie waren nicht einmal ausgesprochen gut darin. Falls du über die gewerbsmäßige Ermordung von Kindern schreiben willst, sieh dir mal Amelia Dyer an. Als sie gehängt wurde, hatte sie über vierhundert Säuglinge auf dem Gewissen. Mach nichts aus diesen Frauen, das sie nicht waren. Weder an ihrem Leben noch an ihrem Tod war irgendetwas edel oder heldenhaft.«
»Ich interessiere mich nicht für die Morde.« Josephine ärgerte sich darüber, dass Celia ihr einen Vortrag hielt, doch noch mehr störte es sie, dass sie recht hatte. »Ich bin an der Beziehung zwischen zwei Frauen interessiert, die gemeinsam ein Verbrechen begehen, und daran, wie sich das Vertrauen auflöst, wenn es schiefläuft. Das ist mir bei unserem Gespräch letzte Woche am meisten aufgefallen – die Verbitterung zwischen den beiden, als ihr Tod kurz bevorstand.« Sie spürte, dass sie diesmal wirklich über das Ziel hinausgeschossen war. Für Celia stand sie sicher auf einer Stufe mit den Schaulustigen, die sich ums Schafott gedrängt hatten, bevor Hinrichtungen zur Privatangelegenheit gemacht wurden. »Ich nehme es mir aber zu Herzen.«
»Tut mir leid, dass ich so entmutigend bin. Ich helfe dir natürlich trotzdem, soweit ich kann. Hast du im Moment noch andere Fragen?«
»Nur noch eine. Was passiert direkt im Anschluss an eine Hinrichtung? Ich wollte eigentlich weiterschreiben, aber ich wusste überhaupt nicht, wie.«
»Die Leichen bleiben eine Stunde hängen, dann werden sie abgenommen, gewaschen und für den Gerichtsmediziner und die Geschworenen vorbereitet.«
»Für die Geschworenen?«
Celia nickte. »Dann werden sie in Särge unter die Falltür gelegt, ganz schlichte Holzkisten, und der Mediziner geht die Liste durch, von wegen, die Hinrichtung sei gekonnt durchgeführt worden und der Tod sofort eingetreten – du weißt schon, damit man sich in einer Demokratie besser damit fühlt, was man gerade gemacht hat. In diesem Fall stimmte es sogar, aber andere hatten nicht so viel Glück.« Sie hielt inne. Vermutlich konnte sie die Szene noch so lebhaft vor sich sehen, als hätte sie sich erst gestern abgespielt. »Eins war allerdings ungewöhnlich. Jemand hatte einen Strauß Veilchen auf beide Frauen gelegt.«
»Jemand? Darf ich raten, wer das war?«
»Es ist dein Buch.« Celia lächelte. »Und danke, dass du mir am Ende so viel Mut verliehen hast, aber das ist nicht ganz wahrheitsgetreu. Ich habe es nicht geschafft, Sach in die Augen zu schauen, und ich schäme mich dafür.«
»Was ist Ihnen dabei durch den Kopf gegangen?«
»Es hätte auch mich treffen können«, erwiderte sie, ohne zu zögern. »Was anderes kann man in so einem Moment nicht denken.«
(OHNE TITEL)VON JOSEPHINE TEYERSTER ENTWURF
CLAYMORE HOUSE, EAST FINCHLEY, MITTWOCH, 12. NOVEMBER 1902
Amelia Sach hielt das Kind fest an sich gedrückt und schaute ungeduldig auf die Standuhr, deren gleichmäßiges, zielstrebiges Ticken das Wohnzimmer des Hauses auf der Hertford Road beherrschte. Derzeit kam es ihr vor, als wäre ihr Leben dem Warten unterworfen – dem Warten auf die Ankunft von Kindern, dem Warten auf ihre Abreise, dem Warten auf das nächste schüchterne Klopfen, mit dem der gesamte Ablauf von vorne beginnen würde. Die Uhrzeit, die sie in ihrem Telegramm genannt hatte, war bereits seit zwanzig Minuten verstrichen, und immer noch keine Spur von Walters. Hin und wieder kam ihr der Gedanke, sie verspäte sich absichtlich, um Amelia vor Augen zu führen, wie unabkömmlich sie war, was sie auf sich allein gestellt mit dem Kind einer anderen Frau anfangen würde. Das Kind regte sich auf ihrem Arm und gab einen leisen, zufriedenen Laut von sich. Es war ein wunderschönes Mädchen, kaum ein paar Stunden alt, aber bereits an die seltsame neue Welt gewöhnt, die es so geschäftsmäßig betreten hatte. Die Geburt war unkompliziert verlaufen, sie hatte keinen Arzt rufen müssen, und Amelia betrachtete das Kind dankbar. Es war warm in eine Mütze und ein Tuch gehüllt, die seine Mutter ihm mühevoll gestrickt hatte. Tatsächlich hatte es nur einen angespannten Augenblick gegeben: Als sie das Kind zum Abschied ein letztes Mal zur Mutter brachte, hatte die Frau es derart sehnsüchtig und verzweifelt betrachtet, dass Amelia fast damit rechnete, sie würde es sich anders überlegen; nun wünschte sie insgeheim, sie hätte es getan.