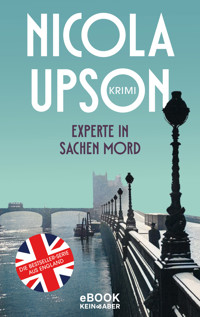17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Krimi
- Serie: Josephine Tey und Archie Penrose ermitteln
- Sprache: Deutsch
September 1939: Josephine Tey begibt sich an Bord des berühmten Passagierschiffes Queen Mary, um ihre Geliebte Marta zu besuchen. Die Reise führt die beiden nach Hollywood an das Filmset von Rebecca, dem neuesten Projekt von Alfred Hitchcock. Doch auch die schillernde Welt der Stars kann von den wachsenden Sorgen wegen des erneuten Kriegsausbruches nicht ganz ablenken.
Derweil muss Inspektor Archie Penrose in England in einem neuen Fall ermitteln. Ein schockierender Mord führt ihn ausgerechnet zu dem Haus, welches einst die junge Daphne du Maurier zu ihrem berühmten Werk Rebecca inspirierte. Als dann ein Teil der Filmcrew unter Verdacht gerät, nehmen Tey und Penrose auf beiden Seiten des Atlantiks die Spur auf. Eine Spur, die geprägt ist von Rebeccas zeitlosen Themen von Besessenheit, Eifersucht und Mord...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Nicola Upson wurde 1970 in Suffolk, England, geboren und studierte Anglistik in Cambridge. Ihr Debüt Experte in Sachen Mord bildet den Auftakt der erfolgreichen, mittlerweile zehnbändigen Krimi-Reihe. Bei deren Hauptfigur Josephine Tey handelt es sich um eine der bekanntesten Krimi-Autorinnen des Britischen Golden Age. Mit dem Schnee kommt der Tod war nominiert für den CWA Historical Dagger Prize (2021). Nicola Upson lebt in Cambridge und Cornwall.
ÜBER DAS BUCH
September 1939: Josephine Tey begibt sich an Bord des berühmten Passagierschiffes Queen Mary, um ihre Geliebte Marta zu besuchen. Die Reise führt die beiden nach Hollywood an das Filmset von Rebecca, dem neuen Projekt von Alfred Hitchcock. Doch auch die schillernde Welt der Stars kann von den wachsenden Sorgen vor einem erneuten Kriegsausbruch nicht ganz ablenken. Derweil muss Inspektor Archie Penrose in England in einem neuen Fall ermitteln: Ein schockierender Mord führt ihn ausgerechnet zu dem Haus, das die junge Daphne du Maurier einst zu ihrem berühmten Werk Rebecca inspirierte. Als daraufhin ein Teil der Filmcrew unter Verdacht gerät, nehmen Tey und Penrose auf beiden Seiten des Atlantiks die Spur auf. Eine Spur, die geprägt ist von Rebeccas zeitlosen Themen – Besessenheit, Eifersucht und Mord.
Der Himmel über unseren Köpfen war tintenschwarz. Am Horizont jedoch war er nicht schwarz. Er war durchsetzt mit Karmin, wie mit verspritztem Blut. Und der salzige Wind vom Meer wehte uns die Asche entgegen.
daphne du maurier – REBECCA
SOMMER 1917
Die Straße war lang und trostlos, zumindest wirkte sie so auf mein zehnjähriges Selbst. Ich war ein buntes Leben gewohnt, und die Abwesenheit von Farbe verwirrte mich: Der weite, graue Himmel, der schwer auf dem Tag lastete, der dunkle Moorboden, der sich meilenweit zu beiden Seiten erstreckte, ein Asphaltband, das kaum breit genug für unser Auto war. Ab und zu wurde die Monotonie von einem Haus mit einem bunt gestrichenen Zaun oder von grünem Dickicht unterbrochen, doch nur selten, und der Anblick betonte lediglich die Leere der Umgebung. Die Landschaft deprimierte mich, wobei ich keinen Grund dafür nennen könnte; im Haus war ich stets glücklich, doch die Anreise stimmte mich jedes Mal traurig.
»Daphne?«, sagte mein Vater scharf, so wie immer, wenn ich still oder zurückgezogen war, einer Welt nachhing, die nichts mit ihm zu tun hatte. Unsere Blicke trafen sich im Rückspiegel, und er lächelte; in diesen ersten Jahren war er noch glücklich und liebevoll gewesen. Ich saß zufrieden zwischen meinen Schwestern, Angela und Jeanne, auf der Rückbank, hörte zu, wie er und meine Mutter über die Bekannten sprachen, die wir besuchen, die Kinder, mit denen wir uns bestens verstehen, die Abenteuer, die wir in dem riesigen Haus erleben würden. Mit Letzterem sollte er recht behalten. Das gute, alte Milton, aus dem ich Manderley gewonnen hatte – ein wunderschöner Landsitz umgeben von weitläufigen Parkanlagen, der seit Generationen von derselben Familie geliebt wurde. Milton war so offen, wie Manderley verschlossen sein würde, und das Leben darin spielte sich ausschließlich in der Gegenwart ab, doch das Wesen der Räumlichkeiten fand mühelos Eingang in die Seiten von Rebecca, war mir beim Schreiben ebenso lebhaft gewärtig wie bei unserem ersten Treffen an jenem Sommertag, als sich der Krieg langsam dem Ende näherte.
Die Fahrt schien endlos, doch schließlich fuhren wir an einem einstöckigen Häuschen vorbei auf das Anwesen. Die Fenster dort standen offen, und im gepflegten, eingezäunten Garten trocknete die Familienwäsche auf der Leine. Die Auffahrt krümmte und wand sich nicht wie die Manderleys, die Vegetation war weder feindselig noch bedrohlich. Stattdessen durchschnitt der Weg auf höfliche Art und Weise das an- und abfallende Gelände und wurde dabei von dichten, strikt abgegrenzten Baumreihen gesäumt. Als wir das andere Ende des Waldstücks erreichten, hatte sich die Sonne durchgesetzt, und wir fuhren in einen anderen, wolkenlosen Tag hinein. Passend zur märchenhaften Umgebung erschien weiter vorne ein zweites Gebäude, eine Art Miniaturkapelle aus honiggelbem Stein mit kleinen Türmchen und einem runden Fenster über der Tür – gotisch, würde ich heute sagen, aber damals wirkte es zu seltsam und zu zauberhaft, um sich so einfach kategorisieren zu lassen. Das Bauwerk faszinierte mich, ließ meine Eltern jedoch kalt, und wir fuhren rasch daran vorbei. An einer Kreuzung, an der mehrere Wege aufeinandertrafen, murmelte mein Vater etwas über Piccadilly Circus, und bis heute weiß ich nicht, ob das ein Scherz war oder ob die Kreuzung wirklich so heißt.
Wir bogen schwungvoll auf die Kiesfläche vor dem Haus, und da ragte es zum ersten Mal vor mir auf – eher elegant als imposant, hübsches elisabethanisches Mauerwerk und zahllose gekuppelte Fenster, Zinnen und Dachbodenräume, die Abenteuer verhießen. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, weshalb es einen derart bleibenden Eindruck auf mich machte. Womöglich lag es nur an der berauschenden Freiheit der Kindheit und daran, dass ich noch nie zuvor ein Herrenhaus gesehen hatte, oder an dem während des Krieges so greifbaren Gefühl, die Welt stünde kurz vor einem einschneidenden Wandel. In letzter Zeit glaube ich allerdings, dass noch mehr dahintersteckte, und zwar schon damals. Eine Art Vorahnung, das Wissen, dass die Vorgänge während unseres Aufenthalts – unschuldig, illusorisch, nie ganz begreiflich – uns irgendwann einholen würden.
In der Nähe befanden sich Gewächshäuser sowie ein ummauerter Garten; Stallungen grenzten an das Haus. Als wir verschwitzt von der Fahrt ausstiegen, hörte ich Hufgeklapper, und irgendwo zur Linken plätscherte ein Brunnen. Die Beschaulichkeit hielt nicht lange an, machte anschwellendem Motorenlärm hinter den Bäumen Platz, dem Knirschen schwerer Reifen auf Kies. Hinter uns flog die Haustür auf, und fünf, sechs Menschen kamen herausgeeilt, allerdings nicht die Familie, die meine Eltern beschrieben hatte. Frauen in Schwesterntracht und Männer in kakifarbenen Uniformen, die uns verärgert ansahen, als ständen wir im Weg. Mein Vater zog mich schützend an sich, und ich spürte seine heiße Hand auf der Schulter. »Schon gut, Daphne«, sagte er. »Das Haus wurde für den Krieg in ein Lazarett umgewandelt, aber keine Angst. Sie kümmern sich hier um unsere Jungs, damit sie wieder zu Kräften kommen.«
Ich weiß noch, wie ich trotz seiner beruhigenden Worte dachte, der Krieg käme direkt zu mir, die Invasion, die wir alle zu fürchten gelernt hatten, fände endlich statt. Insgesamt waren es fünf Wagen, drei Krankenwagen und zwei offene Busse, und auf mich wirkte es, als hätte sich der Konvoi einen direkten Weg durch die dichten grünen Lorbeerbüsche gebahnt. Die Stimmung der Männer an Bord nahm dem Tag auch noch das letzte bisschen Hoffnung. Manche Soldaten ließen den Kopf hängen, sodass ich nur ihre Helme sah; andere saßen still an ihren Nebenmann gelehnt. Eine fremdländische Sonne hatte ihre Haut gebräunt und die Farbe aus ihren Kleidern gebleicht; eingetrocknete Blutflecken zeichneten sich auf weißen Verbänden ab, passten so gar nicht zur englischen Landschaft. Am meisten stach mir jedoch ins Auge, wie schmutzig sie waren, wie Tiere, die sich auf einer schlammigen Wiese gewälzt hatten. Damals ahnte ich noch nicht, wie passend der Vergleich war.
Die Verletzten, die noch laufen konnten, stiegen in einem Gewirr aus Stiefeln, Ellbogen und Geschnaufe aus, und der bis dahin dominierende Abgasgestank wurde von beißendem Schweiß- und Ledergeruch überlagert. Sie standen in einem verunsicherten Grüppchen zusammen und warteten auf Anweisungen, während ihre schwer verwundeten Kameraden umsichtig, aber rasch ins Haus gebracht wurden. Ich weiß noch, wie ich mich fragte, wieso mein Vater sie als Jungs bezeichnet hatte, obwohl sie so alt und geschlagen wirkten. Ich konnte den Blick nicht abwenden, und dann sah ich dem Mann auf der nächstgelegenen Bahre in die Augen. Sein sonnenverbranntes Gesicht stand in Kontrast zu seinem Kissen, an seinen Stiefeln hing der getrocknete Schlamm der Schützengräben. Ich spürte, wie ich rot anlief, doch der Soldat starrte mich lediglich mit leerem Blick an, als hätte er vor langer Zeit den Bezug zu der Welt verloren, der ich angehörte.
Wir wurden von einer Freundin meiner Mutter gerettet – einem liebenswürdigen, eleganten und ätherischen Geschöpf wie aus einem Stück von J. M. Barrie. Sie rauschte mit uns im Schlepptau durch das Haus in die Kriegsräumlichkeiten der Familie, ein paar bescheidene Räume zwischen der Küche und dem derzeitigen Operationssaal, und ich konnte meinen Eltern ansehen, was mit dem Verzicht auf Privatsphäre und Komfort verloren gegangen war. Auf mich und meine Schwestern jedoch wirkte das geschäftige Treiben edel und aufregend, ein Abenteuer, an dem wir schadlos teilhaben konnten. Meine frühesten Erinnerungen an das Haus sind durcheinandergeraten, und manche kommen mir heute traumartiger vor als andere: Männer in locker sitzender Genesungsuniform, die sich unter dem Blick eines Butlers an einem Ende des Esstischs zusammendrängten, eine Gruppe Soldaten, die Billard unter einem Rembrandt spielte, reihenweise unbesetzte Liegestühle auf der Südterrasse, Teller mit riesigen Kartoffelbreihaufen. Ich erinnere mich noch deutlich an das Geplauder und den Husten, das Klirren von Messern und Gabeln und das Schaben von Stühlen, die über den polierten Boden gezogen wurden. Im privaten Speisezimmer der Familie, wo die Wände rosa und weiß waren und eine massive Uhr über dem Kamin prangte, aßen wir köstliche Speisen von mit Vögeln bemalten Tellern.
Nach dem Mittagessen wurden wir zum Spielen davongeschickt, damit die Erwachsenen sich unterhalten konnten. Das Betreten des Lazarettbereichs war uns strikt untersagt, doch in den Gärten und Privaträumen durften wir uns während unseres Aufenthalts frei bewegen. Wenn wir uns daran gehalten hätten, wäre der Nachmittag wohl ohne weitere Vorkommnisse vorbeigezogen, aber unser Anführer – ein blasser kleiner Junge, dem die Invasion seines Zuhauses nichts auszumachen schien – war ebenso versessen darauf, gegen die Regeln zu verstoßen, wie wir ihn vom rechten Weg abbringen wollten. Innerhalb weniger Minuten befanden wir uns in einer langen Galerie, die in einen Krankenflügel verwandelt worden war. Ich wartete darauf, weggescheucht zu werden, doch die Schwestern lächelten den jungen Hausherrn lediglich an, waren offensichtlich an seine Anwesenheit gewöhnt, und niemand schickte uns fort. Der Raum war hell und luftig, in angenehmen Grüntönen mit weißen Stuckblättern und -bändern ausgestattet; mehrere Generationen der Familie schauten von den Wänden auf uns herab, doch ihre missbilligenden Blicke wurden von Bettgestellen und medizinischer Ausrüstung blockiert, und das feminine Wesen des Raums stand in starkem Gegensatz zu seinen jetzigen Bewohnern. Es herrschte Ruhe, und ich fragte mich, wie es sich wohl für die Männer anfühlte, die aus dem Reich von Blut und Dreck, auf welches ich draußen einen Blick erhascht hatte, in diesen Hafen des Friedens eingelaufen waren, in dem die einzige Störung darin bestand, dass eine Decke aufgeschüttelt oder der Boden geschrubbt wurde. Hin und wieder durchbrach ein Schmerzensschrei den Nachmittag, und eine Schwester mit einem leuchtend roten Kreuz auf der Brust trat geräuschlos an ein Bett. Eine andere saß neben einem Soldaten, hatte den Kopf dicht zu ihm geneigt, während er angestrengt einen Brief nach Hause diktierte, und ich malte mir aus, was er wohl sagte und wer zu Hause fieberhaft auf Nachricht von ihm wartete. Ich war derart in meine Fantasiewelt vertieft, dass ich nicht merkte, wie die anderen weiterzogen.
Auf mich allein gestellt, war ich weniger wagemutig und ging zurück auf den Flur, um nach meinen Schwestern zu suchen, entdeckte sie jedoch nicht. Vom anderen Ende des Ganges drang frische Luft herein, und ich hoffte, von dort in den Garten zu gelangen. Außerdem lockte mich der Klang eines Grammofons. Der Raum, aus dem die Musik ertönte, war kleiner als die improvisierte Krankenstation, aber genauso hell und angenehm. Säulen durchzogen das Zimmer, und in der Mitte stand ein mit Farnen bepflanzter Sarkophag. Sämtliche Doppeltüren zur angrenzenden Terrasse standen weit offen, die Vorhänge wölbten sich leicht. Mehrere Soldaten ruhten sich unter einer Markise an der frischen Luft aus. Dahinter, auf dem Rasen vor dem Haus, spielten ein paar andere Krocket, und rote Krawatten und weiße Jackenaufschläge setzten sich patriotisch von blauen Uniformen ab. Die Männer im Inneren wirkten weniger fröhlich, ihre Verletzungen waren offensichtlicher, ihr Gebaren verhaltener – tapfere, lebenskräftige junge Männer, die sich mit Stricken oder Schachspielen begnügen mussten. Einer von ihnen fiel mir besonders auf. Er saß mit einer Decke auf dem Schoß in einem Rollstuhl am Fenster. Ein anderer Mann saß mit ihm am Tisch – kein Soldat, denn seine Uniform war braun und trostlos, und auch kein Arzt, wobei er sich offensichtlich um den Patienten kümmerte und ihm dabei half, ein Modellhaus aus Streichhölzern zu bauen, und das faszinierte mich mehr als die Männer selbst. Da stieß der Soldat versehentlich mit der Hand gegen das Dach, das prompt einstürzte, und frustriert fegte er die Streichhölzer vom Tisch. Sein Freund hob sie unbeirrt wieder auf, rang sich ein Lächeln ab, und der Prozess begann von vorn. Er sah auf und entdeckte mich an der Türschwelle, und als er mich heranwinkte, damit ich besser zuschauen könnte, zögerte ich nicht. Er hatte eine wunderschöne Stimme – sanft und melodisch und leicht, so wie Sonnenlicht, das auf der Wasseroberfläche tanzt.
Das Modell war in allerfeinstem Detail gefertigt, eine Miniaturnachbildung von Milton Hall, die echter wirkte als das Gebäude, in dem wir uns befanden. Er lächelte, als er meine Begeisterung bemerkte, und drehte und wendete es, um mir alle Einzelheiten zu zeigen – die Erker und die zentrale Terrasse, über die wir hereingekommen waren, die weniger strenge Südseite, die ich noch nicht zu Gesicht bekommen hatte, die Kamine und Brüstungen. Alles war so anschaulich und lebensecht, dass ich fast damit rechnete, jemanden hinter den Fenstern zu entdecken. Ich sah zu, wie er dem Soldaten beibrachte, die Streichhölzer für das schräge Dachgeschoss zuzuschneiden, und geduldig abwartete, bis dieser es geschafft hatte. Auf dem Tisch lag ein Stapel mit Entwürfen für zahlreiche Modelle, alle sorgfältig und maßstabsgetreu gezeichnet, und er schob ihn mir zum Durchblättern hin. Dann nannte er mir seinen Namen und erkundigte sich nach meinem.
»Bist du ein schlaues Kind, Daphne?«, fragte er, nachdem ich ihm von meiner Familie erzählt hatte und weshalb wir hier waren. Das war mir schon oft gesagt worden, also bejahte ich, ohne zu zögern, woraufhin er lächelte. »Wenn das so ist, würdest du mir wohl einen Gefallen tun?«
Er holte ein anderes Modell aus der Hosentasche, und ich erkannte die gotische Kapelle, die mich bei der Anfahrt so in ihren Bann geschlagen hatte. Es war in noch kleinerem Maßstab gebaut als Milton Hall, doch sämtliche Eigenheiten waren perfekt nachgebildet, und sicher leuchteten meine Augen, als ich mir die Turmspitzen und Bogen besah, die viel zu schnell an unserem Auto vorbeigezogen waren. Ich konnte kaum glauben, dass so etwas Filigranes überhaupt existierte. »Das habe ich für jemanden gemacht, dem es nicht so gut geht, aber ich bekomme Ärger, wenn ich die Station verlasse. Würdest du es für mich überbringen, wenn ich dir den Weg sage?« Ich zögerte, da ich mit dem riesigen Haus und den labyrinthartigen Gängen nicht vertraut war, doch er wusste, wie man eine neugierige Zehnjährige auf seine Seite zog. »Dann mache ich dir auch so eins, aber du musst das für dich behalten, in Ordnung?«
Wer wird nicht gerne in ein Geheimnis eingeweiht? Die Herausforderung war fast genauso verlockend wie die in Aussicht gestellte Belohnung, und außerdem wollte ich dem klugen, sanftmütigen jungen Mann gefallen, der offensichtlich zaubern konnte; an so einer guten Tat war sicher nichts Verwerfliches. Ich nahm das Geschenk entgegen und lauschte aufmerksam seiner Wegbeschreibung, dann drückte er mir die Schulter und wünschte mir viel Glück. »Komm zurück, wenn du es geschafft hast«, sagte er. »Danke, Daphne.« Auf der Türschwelle drehte ich mich noch einmal um, hoffte vielleicht auf ein paar letzte ermutigende Worte, doch er war schon wieder mit dem Soldaten beschäftigt, sprach mit ihm, als wäre er der einzige Mensch auf Erden, und kurz fragte ich mich, wie es sich wohl anfühlte, diese Art von Aufmerksamkeit zu erhalten. Enttäuscht huschte ich den Hauptgang entlang, bevor ich seine Wegbeschreibung wieder vergessen konnte. Der ausladende Treppenaufgang mit dem vergoldeten schmiedeeisernen Geländer wirkt auch heute noch imposant auf mich, und ich kam mir sehr klein vor, während ich zaghaft den ersten Absatz erklomm, von dem aus ein Bleiglasfenster einen Blick auf die Parklandschaft und grasende Schafe bot. Die Treppe teilte sich nach links und rechts, und ich zögerte kurz, ließ eine Krankenschwester vorbei und hoffte, sie würde mich nicht aufhalten. Dann schaute ich zu beiden Seiten und nahm, wie angewiesen, die rechte. Die Fenster warfen Kreuzmuster auf Wände und Teppichböden, und ich stieg den nächsten Absatz hinauf, bis ich schließlich an einen langen, schmalen Korridor gelangte, der auf beiden Seiten von geschlossenen Türen gesäumt war – noch nie im Leben hatte ich so viele geschlossene Türen gesehen. Ein willkommener Lichtstrahl fiel durch das Fenster am Ende des Ganges, und ich ging langsam weiter, spürte dabei abwechselnd Sonne und Schatten auf meinem Gesicht und zählte sorgfältig die Türen ab, um die richtige zu finden. Als ich mir sicher war, griff ich nach der Klinke, wobei ich mich kurz über die übergroße, verzerrte Silhouette meiner Hand auf dem Holz erschrak.
Ich hätte darauf kommen müssen, dass jemand anders im Zimmer sein könnte, doch ich war zu sehr auf meine Mission konzentriert, um darüber nachzudenken. Die Tür wurde von innen geöffnet, noch bevor ich sie berührt hatte, und vor mir stand eine ganz in Schwarz gekleidete Frau mit einem Kruzifix um den Hals. Ich wusste natürlich nicht, wer sie war, und ich sollte ihren Namen nie erfahren, doch sie starrte so hasserfüllt auf mich herab, dass ich das Modell rasch hinter dem Rücken versteckte. Ich wollte davonrennen, doch sie schien mich mit ihrem Blick zu fesseln. Jetzt, wo ich sie beschreiben muss, fallen mir automatisch die Worte ein, die mich beim Schreiben von Danvers immer begleitet hatten – die tief liegenden Augen, das weiße Totenschädelgesicht, die kindliche Vorstellung einer Märchenhexe. Sah sie wirklich so aus? Ob wahr oder eingebildet – ich bin mir heute nicht mehr sicher; ihren Anblick bin ich jedenfalls nie losgeworden. Wie dumm von mir zu glauben, ich hätte mir die Frau ausgedacht.
Sie wollte wissen, wer ich sei und was ich dort verloren habe. Ihre Stimme war wutverzerrt, und ich wich langsam rückwärts in den Flur zurück. Mein Schweigen verärgerte sie nur noch mehr, und als sie die Hand ausstreckte, um die Wahrheit aus mir zu schütteln, fielen mir meine Füße wieder ein, und ich rannte davon. Was danach kam, ist heute verschwommen. Ich weiß nur noch, dass die Frau mir keifend bis zur Treppe folgte, und kurz darauf hörte ich ein Geräusch wie einen Peitschenknall – doch ich wollte nur noch ins Freie gelangen und dachte nicht weiter darüber nach. Sobald ich die Sonne auf meinem Gesicht spürte und meine Schwestern auf dem Rasen spielen sah, wirkte der Vorfall wie ein schrecklicher Traum. Ich erzählte nie jemandem davon, nicht einmal Angela oder Jeanne. Eine Zeit lang befürchtete ich, meinem Zauberer zu begegnen und ihm mein Versagen gestehen zu müssen, doch meine Sorge war unbegründet: Ich sprach nie wieder mit ihm, und irgendwann verblassten meine Erinnerungen. Bis heute weiß ich nicht, was aus ihm geworden ist, ahnte da noch nicht, dass er – auf völlig andere Weise – erneut für mich gezaubert hatte. Ich frage mich, ob er die Verbindung wohl hergestellt hat oder ob er sich überhaupt noch an das schlaue kleine Mädchen erinnert, das ihn hängengelassen hatte.
Als ich das Modell von Milton Hall ein paar Tage später wiedersah, war es vollständig zertrümmert, wobei ich nicht weiß, wer dafür verantwortlich war. Die Miniatur, die er mir gegeben hatte, das Geschenk für jemand anderen, besitze ich noch heute, obwohl es falsch war, es zu behalten. Es steht auf dem Regal, neben der Häherfeder aus den Wäldern Menabillys und dem Foto meines Vaters in seinem Ankleidezimmer, und nun frage ich mich jedes Mal, wenn ich es betrachte, ob ich den Lauf der Dinge hätte beeinflussen können. Wenn ich früher dort gewesen wäre, wenn ich nicht auf der Treppe gezögert hätte, wenn ich ihr die Stirn geboten hätte, wären die Jahre dann anders verlaufen? Doch all das liegt in der Vergangenheit. Die Kunst besteht darin – das wissen die meisten von uns –, es dort zu belassen.
SEPTEMBER 1939
1
Als der Zug langsam auf das Gleis neben dem Hafenbecken einfuhr, atmete Josephine erleichtert auf. Sie freute sich mehr darauf, das Land zu verlassen, als sie sich je hätte vorstellen können. Die gespannte Erwartung unter den Reisenden war auf der kurzen Fahrt von Waterloo nach Southampton stetig angestiegen, und jetzt, da sie dem Schiff, das sie über den Atlantik bringen würde, so nah waren, konnten manche Passagiere ihre Erregung kaum verbergen. Sie wünschte, ihre eigenen Gefühle wären ähnlich einfach gestrickt, doch ihre Ungeduld hatte nur wenig mit der romantischen Vorstellung vom Reisen oder den Verlockungen Amerikas zu tun. Wie sie es auch drehte und wendete, die Fahrkarte in ihrer Hand roch nach Flucht, doch es war ihr egal. Im Moment sehnte sie sich nur danach, Marta wiederzusehen und die größtmögliche Entfernung zwischen sich und die Erinnerungen der letzten Tage zu bringen.
Die wenigen Gespräche, die sie während der Anreise mit Archie geführt hatte, waren gedämpft verlaufen; keiner von ihnen hatte Lust auf Geplauder. Eine düstere Stimmung hatte sich über das Land gelegt, nachdem die monatelangen Ängste und Spekulationen plötzlich Realität geworden waren, doch selbst der neuerliche Kriegsausbruch konnte ihre persönlichen Schreckenserlebnisse nicht überdecken. Die Freundschaft mit einem Detective Scotland Yards bedeutete, dass Josephine oft mit den tragischen Aspekten seiner Arbeit in Berührung kam. Selbst wenn sich Archie nicht explizit über einen Fall äußern konnte, schlugen sich die Mordfallermittlungen in seiner Laune nieder und beeinflussten seinen Blick auf die Welt. Dieses Mal war Josephine selbst betroffen gewesen – ein Kind war an einem Ort entführt worden, den sie ins Herz geschlossen hatte. Wenig überraschend kämpfte sie seitdem mit einem nagenden Gefühl des Verlusts und Verrats. »Ich bin froh, dass du mich noch verabschiedest«, sagte sie, als Archie ihre Reisetasche aus der Gepäckablage hob.
»Ich auch.«
Archie und sie verstanden sich auch ohne viele Worte, und sie musste ihm nicht erklären, dass es half, mit jemandem zusammen zu sein, der das Gleiche erlebt hatte, selbst wenn sie nicht darüber sprachen, jemand, der verstand, wie schmutzig und verantwortlich sie sich fühlte, egal wie irrational es auch sein mochte. Er lächelte sie an, doch seine Antwort ging im Trubel der Ankunft unter. Die Passagiere schoben sich zu den Türen, konnten es nicht erwarten, einen Blick auf das Schiff zu erhaschen, das es kaum aus den Nachrichten geschafft hatte, seit es vor fast auf den Tag genau fünf Jahren vom Stapel gelaufen war, und Josephine und Archie gesellten sich zu ihnen. Die Fakten und Daten zur Queen Mary waren mittlerweile legendär – höher als der Eiffelturm, schneller als alle anderen Schiffe ihrer Klasse, größer als die Titanic –, und sie ließen sich von den anderen Reisenden im Sog aus Geplapper und Vorfreude mittragen. Doch als das Schiff plötzlich sichtbar wurde, über den Lagergebäuden aufragte und dabei die Hafenkräne so zwergenhaft erscheinen ließ, als entstammten sie Gullivers Reisen, verstummten alle. Der gewaltige schwarze Rumpf streckte sich in die Ferne und wirkte eher bedrohlich als romantisch, und Josephine konnte kaum glauben, dass etwas derart Gigantisches überhaupt schwimmen konnte. Nachdem der erste Eindruck jedoch verblasst war, sah sie über die schieren Ausmaße des Schiffes hinweg, ließ die Schönheit seiner Linien und die majestätische Präsenz auf sich wirken und verstand genau, warum es das Land mit Stolz erfüllte. Die Queen Mary war im Auftrag einer englischen Reederei in Schottland gebaut worden, und der Weg war steinig gewesen. Josephine erinnerte sich noch an die Bilder des halb fertigen Rumpfs in der Zeitung, der in der Werft langsam zu Tode rostete, ein eindrückliches Symbol für die Not und Armut der Depressionsjahre. Die Befürchtung, sie würde nie vollendet werden, geisterte umher, bewahrheitete sich allerdings nicht, und als der Wohlstand im Land wieder stieg und die Arbeiten erneut anlaufen konnten, wurde sie ein ebenso eindrückliches Symbol für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Die Queen Mary hatte in ihrem kurzen Leben schon für vieles stehen müssen: Sie war zu Friedenszeiten entworfen worden, um die alte Welt mit der neuen zu verbinden, und in ihr kamen zwar Stil und Eleganz des sich neigenden Jahrzehnts zum Ausdruck, doch nun waren es ihre Stärke und ihr unbesiegbarer Geist, an den die Briten sich klammerten.
»Ganz außergewöhnlich, oder?«, sagte Archie bewundernd. »Wenn wir zu so etwas in der Lage sind, besteht vielleicht ja doch noch Hoffnung. Und jetzt ab an Bord mit dir.«
Das war leichter gesagt als getan. Obwohl das Schiff riesig und der Kai lang war, schien die Menschenmenge zu groß für beides, und sie kamen nur zentimeterweise voran. »Viele Überfahrten wird es wohl nicht mehr geben.« Archie versuchte, Josephine vor dem schlimmsten Gedränge zu bewahren. »Die Leute verschwinden anscheinend, solange sie noch können.«
Er hatte recht, und Josephine kam sich naiv vor, dass sie die veränderte Atmosphäre nicht bemerkt hatte. Sie musterte die anderen Passagiere genauer, lauschte den Stimmen ringsum und erkannte sofort, dass die meisten Leute eine einfache Fahrt gebucht hatten – jüdische Familien, die vor den Nazis flohen, und Amerikaner, die zurück nach Hause wollten, solange es noch kommerzielle Überfahrten gab. Der Anschein von Luxus und Vergnügen wurde gewahrt – lächelnde Schiffskellner in makellosen Uniformen, Wagen mit teurem Gepäck –, doch stellenweise herrschte ein Gefühl von Dringlichkeit. Kurz kam ihr die Situation unwirklich vor, und die Vorstellung, ins Unbekannte zu segeln, erhielt einen völlig anderen Anstrich, das Gegenteil eines Segens. Archie berührte sie am Arm. »Alles in Ordnung?«
Sie nickte, und sie schoben sich weiter in Richtung der überdachten Laufstege, die sich vom Kai erhoben und auf denen stolz die Worte »RMS Queen Mary« prangten. Der Steward, der die Fahrkarten kontrollierte, hieß Josephine an Bord willkommen, als wäre sie der wichtigste Mensch, der je mit Cunard gereist war, bevor er ihr den Weg zu den Aufzügen erklärte, der sie zu den Kabinen bringen würde. Ihre Kabine lag auf Deck B, welches – abgesehen von einigen Frisier- und Schönheitssalons – anscheinend ausschließlich der Passagierunterbringung diente. Während sie die hell erleuchteten Gänge durchschritt und nach der Nummer auf ihrem Ticket suchte, spähte sie durch die offenen Türen der unbesetzten Kabinen. Alle waren ähnlich luxuriös und durchdacht, jedoch unterschiedlich ausgestattet, und besaßen jeweils einen ganz eigenen Charakter.
»Meinst du, es würde irgendwem auffallen, wenn ich mitkäme?«, fragte Archie, als sie an einer besonders verlockenden Suite mit glänzenden Chromoberflächen und einer Art-déco-Skulptur vorbeigingen.
»Virginia hätte vielleicht was dagegen. Und Marta wahrscheinlich auch.«
»Ich glaube, so etwas Prachtvolles habe ich noch nie gesehen. Gewöhn dich bloß nicht daran, sonst kann ich dich nach deiner Rückkehr nirgendwo mehr mit hinnehmen.«
Josephine lachte. »Mach dir da mal keine Sorgen. Dafür habe ich viel zu viel für diese Fahrkarte ausgegeben. Im Moment ist alles so unsicher, da war es schon fast leichtsinnig, aber es fühlte sich an wie meine letzte Chance.«
Ihre Kabine – nachdem sie sie schließlich gefunden hatte – entpuppte sich als aufwendig, aber eher traditionell ausgestattet: Sanfte Beleuchtung traf auf sattes, warmes Holz. Über dem Bett hing eine Intarsienmalerei, die fliegende Enten über einem See zeigte, und ein Teppich mit Blumenmuster lag im Wettstreit mit drei Vasen, in denen ihre echten Gegenstücke prangten, frische Chrysanthemen in Herbsttönen, die das Farbspiel des Raumes abrundeten. An jede Annehmlichkeit war gedacht worden – reichlich Stauraum sowie eine Thermoskanne und ein Telefon, die jeweils ihre eigene Nische besaßen –, und über ihrer Tür gab es auf dem Gang ein Lichtsystem, falls sie einen Steward rufen musste. Sie stellte ihre Reisetasche auf einem der vier gepunkteten Sessel ab, die im Raum verteilt standen, und bedeutete Archie, Platz zu nehmen. »Ich weiß ja nicht, für wen diese Sessel gedacht sind, aber solange du hier bist, kannst du es dir genauso gut bequem machen.« Die Kabine war geräumiger, als sie befürchtet hatte, und ein riesiger Spiegel gegenüber dem Bett ließ sie noch größer wirken. Dennoch fühlte sie sich leicht klaustrophobisch und ging zur Außenwand, um die Jalousien an den Bullaugen zu öffnen.
»Ich wusste gar nicht, dass sie hier eine eigene Zeitung haben.« Archie nahm die Ocean Times vom Couchtisch, die auf den Abreisetag datiert war. Die Titelseite verkündete, das Schiff sei »die Heimat der Welt«. »Nette Abwechslung. Ich würde zu gerne jeden Morgen die Zeitung aufschlagen und nur gute Nachrichten lesen. Kein Wort von Mord und Totschlag, und kaum etwas über den Krieg.«
Josephine konnte seinen Tonfall nachvollziehen: Die Schlagzeilen, die die meisten Leute entsetzt beim Frühstück studierten, entstammten Archies Alltag – der Fund einer Kinderleiche, der Besuch bei den vor Trauer gebeugten Eltern, die Festnahme des Mörders und das Wissen, dass Gerechtigkeit allein nicht ausreichte. Das alles und noch viel mehr hatte er in den letzten Tagen durchlebt, und sie fragte sich – nicht zum ersten Mal –, wie er damit zurechtkam. »Du sprichst mit Virginia darüber, wenn es dich zu sehr belastet, oder?«, fragte sie. »Ich kenne dich doch. Du sperrst alle anderen aus und willst es mit dir selbst ausmachen, und das funktioniert langfristig nie.«
»Und du bist zu weit weg, um mir zu helfen?« Er lächelte darüber, wie gut sie einander kannten. »Ich will es lieber nicht mit nach Hause zu Virginia und den Kindern schleppen, sonst denkt sie noch, unser gemeinsames Leben wird aus einer Tragödie nach der nächsten bestehen.«
»Bestimmt nicht. Ich habe sie zwar erst einmal gesehen, aber sie wirkte nicht, als müsste sie vor der Wirklichkeit beschützt werden. Ganz im Gegenteil. Du weißt doch, was sie selbst durchgemacht hat.« Virginias erste Ehe war unglücklich verlaufen, wodurch Archie sie kennengelernt hatte; Josephine bewunderte die Stärke ungemein, mit der sie seitdem ihre Kinder beschützte und weiterlebte. »Du würdest doch auch nicht wollen, dass sie ihre Gefühle für sich behält, oder?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Da hast du’s. Und wenn jemand versteht, wie viel dir deine Arbeit bedeutet, dann sie. Sie hatte ja selbst schon Grund genug, dir dafür dankbar zu sein.«
»Mag sein, aber Virginia hilft mir am meisten, wenn ich in ihrer Gegenwart vergessen kann, was passiert ist«, erwiderte er. »Probier es am besten selbst mal aus. Ich weiß doch, wie sehr dich die Geschichte mitgenommen hat. Nutz die Zeit mit Marta, weit weg von allem.«
Josephine schenkte ihm ein schiefes Lächeln. »Ich habe mich schon auf ein Dasein als Hollywood-Witwe eingestellt. Marta arbeitet Tag und Nacht.« Sie zögerte, da sie merkte, dass sie ihrem eigenen Rat nur schwer würde folgen können. »Außerdem will ich nicht mit ihr darüber brüten«, gab sie zu. »Marta hat selbst zwei Kinder verloren, und damit muss sie jeden Tag aufs Neue zurechtkommen. Da kommt es mir falsch vor, mich in anderer Leute Trauer zu suhlen, egal, wie grauenhaft es war.«
»Wobei es doch nicht nur um das Kind geht, oder?« Er hatte recht. Das tief sitzende Verlustgefühl hatte außerdem mit zerstörtem Vertrauen zu tun und der Erkenntnis, dass ein vermeintlich sicherer Ort ebenso sehr für das Böse anfällig war wie der Rest der Welt, mit der politischen Lage im Allgemeinen und all dem, das sie bei einem ungünstigen Kriegsverlauf zu verlieren drohten. »Außerdem kann man nichts für seine Gefühle«, fügte Archie hinzu.
»Wenigstens reise ich nach Hollywood, da bin ich in guter Gesellschaft, wenn ich das Gegenteil vortäusche.«
Eine höfliche Durchsage schallte über den Lautsprecher, füllte den Gang vor der Kabine und unterbrach ihr Gespräch. »Alle Besucher von Bord. Bitte gehen Sie zu den Ausgängen. Das Schiff ist bereit zum Ablegen.«
»Das ist mein Stichwort.« Er stand widerwillig auf, und sie begleitete ihn zum Unterdeck, wo sich eine Schlange aus Geliebten, Eltern und Freunden zum Laufsteg hinabwand. »Pass gut auf dich auf, ja?« Archie nahm Josephine in den Arm.
»Mach ich. Du aber auch.«
»Und schreib mir. Ich will alles über die Wohnung wissen und die Filmstars, denen du begegnest, und was du zu Hitchcock sagst, wenn er fragt, wie dir sein Film gefallen hat. Das ganz besonders.«
Josephine lachte, womit sie unter Umständen nur die Tränen zurückhalten wollte. Sie lebten schon so lange in voneinander getrennten Bereichen, dass Abschiede einfach dazugehörten, doch dieser Abschied war kein gewöhnlicher, und sie hatte keine Vorstellung, wie das Land bei ihrer Rückkehr in ein paar Wochen aussehen oder was mit Archie passieren würde, wenn der Bombenregen über London losginge. »Ich werde nichts auslassen, versprochen«, sagte sie schließlich, als sie sich wieder gefasst hatte. »Und jetzt verschwinde, sonst musst du dir wirklich noch eine eigene Kabine suchen.«
»Richte Marta alles Liebe aus.« Er machte sich auf den Weg zur Treppe, doch anscheinend war sie mit ihrer Angst und Unsicherheit nicht allein, denn plötzlich drehte er sich wieder um und kam zurück, um ihr einen letzten Kuss auf die Wange zu geben. Dann verschwand er die Stufen hinab zum Kai, ohne sich noch einmal umzudrehen.
An Bord herrschte eine feierliche Stimmung, doch ob sie nun aufrichtig oder der Illusion geschuldet war, sie würden alles zurücklassen, ließ sich nur schwer sagen. Josephine bahnte sich einen Weg zum Sonnendeck und fand ein Plätzchen zwischen den Passagieren an der Reling, die zum Kai dreißig Meter weiter unten hinabwinkten. Die Laufstege waren entfernt worden, und das Schiff entfernte sich geschmeidig und gelassen vom Ufer, nichts deutete auf den Bruch hin, der womöglich mit dem Auslaufen einherging. In einem ungewohnten Anflug von Sentimentalität blieb Josephine an Deck, bis England – und damit Archie – aus ihrem Sichtfeld verschwunden war.
Sie brannte nicht darauf, allein in ihrer Kabine zu sitzen, und beschloss, stattdessen das Schiff zu erkunden. Die Vorstellung einer schwimmenden Stadt war ihr immer klischeehaft vorgekommen, doch sie merkte rasch, dass sie nicht ganz unpassend war: Nur schwer hätte sie eine Annehmlichkeit oder einen Luxus nennen können, an die nicht gedacht worden war. Das offizielle Handbuch, welches sämtlichen Passagieren vorlag, prahlte mit Freizeitanlagen, die das Wembley-Stadion füllen würden, und bei ihrer ersten Runde auf den oberen Decks entdeckte sie Plätze für Squash und Tennis, Schwimmbecken sowie eine hochmoderne Sporthalle, dazu zahlreiche Bars und Restaurants, die jegliche körperliche Ertüchtigung an Bord wieder wettmachen würden. Außerdem wurde ein breites Unterhaltungsprogramm geboten – Kinos, Bibliotheken und ein Vortragssaal –, dazu speziellere Einrichtungen wie eine Dunkelkammer, ein schalldichtes Studio mit Bechstein-Klavier und sogar einen beachtlichen Zwingerbereich mit Auslauf für vierbeinige Gäste. Weiter unten, auf dem Promenadendeck, erstreckte sich eine Einkaufspassage mit den berühmtesten Geschäften der Welt über die gesamte Breite des Schiffs und bot Kleidung, Blumen, Zigarren, Schmuck und andere Andenken an. Langeweile dürfte während der Überfahrt keine aufkommen: Hier gab es mehr zu tun, als man in vier Tagen auf See schaffen konnte, und von ihren Sorgen und Ängsten würde sie sich auch ablenken können.
Es war noch früh am Nachmittag, also kehrte sie in den Panoramasalon am Bug des Schiffes zurück und hoffte, sie würde sich an den Seegang gewöhnen, während die Umstände noch ruhig und anfängerfreundlich waren. In dem halbrunden Raum gab es eine Cocktailbar, und auch hier hielten sich Gemütlichkeit und Eleganz die Waage. Die Bar mit den roten Lederhockern war einladend und behaglich; ein Wandbild gedachte dem Thronjubiläum des alten Königs – eine detaillierte Tanzszene, deren sprühend gute Laune sehr zur breiten Auswahl an Spirituosen passte, die darunter zur Schau gestellt wurden. Der Höhepunkt jedoch, dem der Raum seinen Namen verdankte, lag am anderen Ende, wo eine Reihe hoher Fenster einen spektakulären Blick nach vorn und zu den Seiten bot. Wenig überraschend erfreute sich die Bar bereits größter Beliebtheit, doch auf dem erhabenen Bereich ganz vorne war noch ein Platz frei, und Josephine setzte sich und starrte in das Nichts jenseits des Bugs. Die Wärme der Septembersonne und das Glitzern des Wassers gaben ihr ein zauberhaftes und gleichzeitig beunruhigendes Gefühl.
»Miss Tey, wie schön, dass wir uns jetzt schon begegnen.« Die vertraute Stimme hatte einen leichten Midlands-Einschlag, und Josephine drehte sich zu einer hübschen Rothaarigen in einem eleganten Hosenanzug um. »Ich habe Ihren Namen auf der Passagierliste gesehen. Marta hatte schon erwähnt, dass Sie bald zu Besuch kommen. Wie nett, dass wir auf der gleichen Überfahrt sind.«
Josephine zögerte. Sie wünschte, sie hätte zur Vorwarnung selbst einen Blick auf die Liste geworfen. Ihr erstes Treffen mit Alma Reville, der Ehefrau Alfred Hitchcocks, lag mittlerweile drei Jahre zurück, als Hitchcock die Rechte zu einem ihrer Bücher gekauft hatte. Der daraus entstandene Film, Jung und unschuldig, war wohl Hitchcocks Lieblingswerk seiner britischen Schaffensphase, und Josephine wünschte, sie könnte das Gleiche von sich behaupten. Wenn man jedoch die Änderungen betrachtete, die er an ihrer Romanvorlage, Klippen des Todes, vorgenommen hatte, war es jedenfalls keins seiner Lieblingsbücher gewesen. Seitdem war sie über Martas Arbeit mit den Hitchcocks verbunden, konnte sie in Anekdotenform jedoch besser leiden als in echt. Sie riss sich um der Höflichkeit willen zusammen. »Wie schön, Sie wiederzusehen.«
Alma hob eine Augenbraue, ein amüsiertes Funkeln im Blick. »Das heißt, Sie haben uns verziehen?«
Ihre fröhliche Art erinnerte Josephine daran, dass sie und Alma sich auf Anhieb verstanden und gegenseitig respektiert hatten. Obwohl sie Hitchcock nicht hatte leiden können und ihm immer noch übel nahm, was er aus ihrem Buch gemacht hatte – wenn er sich die Liebe und das Ansehen einer so talentierten, bodenständigen und kreativen Frau hatte sichern können, war er vielleicht nicht gänzlich verdorben. Alma besaß einen scharfen Blick und starke Überzeugungen, mit denen sie nicht hinter dem Berg hielt, und die Hitchcocks waren nicht nur privat, sondern auch beruflich Partner. Sie hatte ihre Karriere beim Film vor ihrem Mann begonnen und trug immer noch wesentlich zu seinem Erfolg bei; es sprach für Hitchcock, dass er bereitwillig zugab, wie viel er ihr zu verdanken hatte. »Ich habe zumindest aus meinen Fehlern gelernt«, erwiderte Josephine. »Und meinen Tantiemen hat es auch nicht geschadet.«
»Das freut mich.« Alma warf einen Blick über die Schulter zu ihren Begleiterinnen, ganz offensichtlich zwei weitere Generationen derselben Familie. Ein zehn- oder elfjähriges Mädchen, bestimmt die Tochter der Hitchcocks, und eine kleine, zierliche Frau Mitte sechzig, eine ältere Ausgabe von Alma. »Das hier ist meine Mutter Lucy.« Alma winkte die beiden heran. »Mutter, das hier ist Josephine Tey. Jung und unschuldig basiert auf ihrem Roman.«
Josephine verkniff sich den Kommentar »lose« und streckte ihr die Hand entgegen. »Sehr erfreut, Mrs Reville.« Ihre Augen hatten aufgeleuchtet, als der Name des Films fiel.
»Ich liebe die Geschichte einfach«, erklärte Lucy Reville begeistert. »Ich finde, das ist der beste Film, den die beiden gemacht haben. So rührend und romantisch. Sie waren sicher hin und weg, als Sie ihn gesehen haben.«
Unwissentlich hatte Mrs Reville den Punkt angesprochen, der Josephine an der Adaption am meisten störte – wobei sie zugeben musste, dass sie den Film wahrscheinlich genauso großartig gefunden hätte wie alle anderen, wenn sie nichts mit der Entstehung zu tun gehabt hätte. »Ich konnte es kaum fassen«, erwiderte sie wahrheitsgemäß. »Die Verwandlung war unglaublich.«
Alma lächelte über den leisen Sarkasmus. »Patricia kennen Sie auch noch nicht, oder?«, fuhr sie fort. »Sie war auf dem Internat, als wir in Portmeirion waren.« Und wahrscheinlich war das besser so, dachte Josephine. Die Reise war von der Art Gewalt verdorben worden, auf die sich Patricias Vater auf der Leinwand spezialisierte, mit der er im echten Leben ironischerweise jedoch nicht umgehen konnte.
»Reisen Sie oft so, Miss Tey?«, wollte Lucy Reville wissen.
»Nein, überhaupt nicht. Ich bin zum ersten Mal an Bord.«
»Ich auch. Alma und Alfred fahren ständig hin und her …«
»Das würde ich nicht behaupten, Mutter. Zwei, drei Mal vielleicht.«
»… und sogar Patricia ist ein alter Hase. Sie zeigt mir alles auf dem Schiff. Aufregend, nicht wahr?«
»In der Tat.«
Patricia führte ihre Großmutter zum anderen Ende des Raumes, um ihr das Wandgemälde zu zeigen, und Josephine fand es wenig überraschend, dass die Hitchcocks eine so selbstbewusste, neugierige Tochter hatten. »Ein bisschen wundert es mich ja schon, Sie während der Dreharbeiten hier zu sehen«, sagte sie zu Alma.
»Ich bin mit der Arbeit an Rebecca fertig, deswegen habe ich mir ein paar Tage freigenommen, um meine Mutter abzuholen und während dieser ganzen Sache zu uns zu bringen. Ich bin heilfroh, dass sie einverstanden war.« Alma seufzte. »Bei Hitch lief es nicht so gut. Seine Mutter weigert sich, vom Fleck zu rücken. Sie meint, sie hätte schon mal einen Krieg unbeschadet überstanden, da wird sie sich von diesem nicht unterkriegen lassen.«
»Bewundernswerter Kampfgeist. Trotzdem machen Sie sich natürlich Sorgen, wenn Sie so weit weg sind.«
»Und wie. Wenigstens hat sie sich bereit erklärt, nach Shamley Green zu ziehen, sodass sie nicht mitten im Bombenregen sitzt, aber wer weiß?« Die letzten Worte hingen in der Luft und brachten auf schlichte Weise die allerorts spürbare Unsicherheit in der Bevölkerung zum Ausdruck. »Wollen Sie uns später beim Abendessen Gesellschaft leisten?« Die Einladung kam völlig unerwartet, und Josephine zögerte, bevor sie antwortete. Sie hatte mit ein paar friedlichen, anonymen Tagen gerechnet, bevor sie in die Manege Hollywoods geworfen würde, und nur zu gerne hätte sie daran festgehalten. »Ich wäre Ihnen für die Gesellschaft dankbar«, gestand Alma. »Pat und meine Mutter essen schon früh, und ehrlich gesagt graut es mir davor, das Restaurant allein zu betreten. Zu viel Zeit zum Nachdenken tut mir momentan nicht gut.« Sie lächelte. »Aber falls Sie schon andere Pläne haben …«
»Das wäre ganz wunderbar.« Überrascht stellte Josephine fest, dass sie es ernst meinte.
»Hervorragend. Wie wäre es mit halb acht?«
»Perfekt.«
»Dann passe ich meine Reservierung an, und Sie können sich noch ein bisschen an den Seegang gewöhnen. Bis später.«
Sie ging zu ihrer Familie, und Josephine kehrte auf ihre Kabine zurück, um auszupacken. In ihrer Tasche lag ein Päckchen von Marta, das sie erst an Bord öffnen durfte, und darin fand sie alles, was sie für ihre erste Reise nach Hollywood brauchte: eine Sonnenbrille für den Swimmingpool, einen Reiseführer für Los Angeles, in dem bereits sämtliche Restaurants, Geschäfte und Galerien angestrichen waren, die sie zusammen besuchen mussten, und zwei Karten zur Premiere des neuen Films von Bette Davis im Warner Bros. Theater, von dem Marta wusste, dass er Josephine gefallen würde – eine fiktive Nacherzählung der Beziehung zwischen Queen Elizabeth und dem Earl of Essex, der von Errol Flynn verkörpert wurde. So aufregend das alles auch klang – am meisten rührte sie Martas Brief, in dem sie von ihren Plänen und Vorbereitungen für die gemeinsame Zeit erzählte. Während sie über die Freiheit der nächsten Wochen nachdachte, fernab von zu Hause und heimischen Verpflichtungen, kam ihr das bis dahin drückende Gefühl der Unsicherheit plötzlich erfrischend vor.
Sie entdeckte ihre Ausgabe von Rebecca und las eine Weile, bevor sie sich für das Abendessen umzog und ein Deck weiter hinabging. Das Hauptrestaurant auf der Queen Mary war als Großer Salon bekannt, und alles darin schien dem Namen Ehre machen zu wollen. Josephine blieb am Eingang stehen, der in sich selbst ein überdimensionales Kunstwerk war: ein Gemälde namens Fröhliches England, auf dem idealisierte Szenen des Landlebens im Laufe der Jahrhunderte im Stil eines Wandteppichs dargestellt waren. Zwei massive, kunstvoll verzierte Bronzetüren waren in das Gemälde eingearbeitet, und darauf fanden sich passenderweise Darstellungen von Castor und Pollux, Beschützern der Seefahrt.
Der Eingang hätte Josephine einen Vorgeschmack auf den prachtvollen Speisesaal geben können, und dennoch verschlug es ihr den Atem. Der Große Salon erstreckte sich über die gesamte Breite des Schiffes und war mit seinen hohen Decken, die von einer Kuppel gekrönt wurden, der weitläufigste Raum an Bord. Wie auf dem Rest der Queen Mary herrschte auch hier sattes, poliertes Holz in herbstlichen Tönen vor. Ein cremefarbener Anstrich, der zur Decke hin in Rosa überging, hob die warmen Noten hervor. Das Restaurant mit den dunkelroten Lederstühlen war wunderschön beleuchtet, und damit die Fülle nicht erdrückend wirkte, verlieh hier und da eine Pflanze oder ein Blumengesteck dem Raum natürliche Frische und Leichtigkeit.
Sie nannte ihren Namen am Empfang, und ein Kellner begleitete sie zu ihrem Tisch, wobei sie erst das gesamte Ausmaß des Raumes erkannte, der dadurch gleichzeitig aufregend und einschüchternd wirkte. Alma saß bereits an einem Zweiertisch an einer der zylindrischen Säulen, die den Saal unterteilten. Sie winkte Josephine zu und deutete ihren Gesichtsausdruck dabei richtig. »Ganz schön beeindruckend, was? Jetzt verstehen Sie sicher, weshalb ich mich über Gesellschaft freue. Wenn ich mit Hitch hier bin, macht mir das ganze Tamtam nichts aus – Sie wissen ja, wie er das genießt –, aber allein ist es etwas ganz anderes.«
»Schön, dass es nicht nur mir so geht.«
»Wenn wir ehrlich sind, geht es uns vermutlich allen so.«
Sie sprachen über das Schiff, während sie auf den Kellner warteten, und – wie schon früher – war Alma eine unbeschwerte, unterhaltsame Tischgenossin, was auch gut so war: Das Essen erstreckte sich über sieben Gänge und würde voraussichtlich den gesamten Abend in Anspruch nehmen. »Morgen früh gehe ich direkt eine Runde schwimmen«, erklärte Josephine mit Blick auf den Nachtisch, der gerade am Nebentisch serviert wurde. »Schon drei, vier Tage können erheblichen Schaden anrichten.«
»Durchaus, und das Essen ist wirklich köstlich.«
»Wenn Sie das sagen, wird es wohl stimmen. Marta hat mir erzählt, was für eine tolle Köchin Sie sind.«
»Ach, reines Freizeitvergnügen, aber es macht mir Spaß.« Der Wein wurde serviert, und Alma hob ihr Glas. »Auf eine ereignislose Überfahrt. Marta wird sich unglaublich freuen, wobei sie es wahrscheinlich erst glaubt, wenn Sie leibhaftig vor ihr stehen.«
Josephine wusste nicht, inwieweit Alma über ihre Beziehung mit Marta im Bilde war, doch die beiden kamen nicht nur beruflich, sondern auch privat gut miteinander aus, sodass der Kommentar sie nicht überraschte. »Bislang war nie der richtige Zeitpunkt«, räumte sie ein. »Dann wurde mir allerdings klar, wie viel Zeit man damit verschwenden kann, auf den perfekten Moment zu warten. Viele Hoffnungsschimmer bietet einem der Krieg zwar nicht, aber immerhin hilft er einem, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.«
»Das stimmt, und lustigerweise kommt es mir vor, als hätten wir die letzten Jahre über genau das Gleiche gemacht – auf den richtigen Zeitpunkt für den Umzug nach Amerika gewartet. Ich weiß nicht genau, wieso es so lange gedauert hat. Hitch war schon immer von Amerika fasziniert und konnte als Junge sämtliche Zugfahrpläne und Theater in New York aufsagen, fast so, als hätte er gewusst, dass es eines Tages eine Rolle in seinem Leben spielen würde.«
»Und Sie? Wie gefällt es Ihnen?«
»Einfach wunderbar«, erwiderte Alma, ohne zu zögern. »Ich war vom ersten Augenblick an verliebt – das Wetter, die Orangenblüte, die Freiheit. Ganz besonders die Freiheit. Dort ist es nicht so muffig wie in England. Ich habe das Gefühl, wir gehören dorthin. Selbst jetzt, wo ich nur kurz meine Mutter abgeholt habe, fühlt sich diese Richtung an wie der Heimweg.«
»Das freut mich für Sie. Bei unserem letzten Treffen hatten Sie noch Angst vor dem Umzug.«
»Und jetzt habe ich Angst, dass wir nicht bleiben. Mir kann man es wirklich nicht recht machen.« Sie lächelte und schwieg, während ein anderer Kellner die Suppe servierte und ihnen nachschenkte. Hier, im stabilsten Teil des Schiffs, konnte Josephine beunruhigend leicht vergessen, dass sie sich auf offener See befanden. »Und kein Wunder, dass wir uns wie zu Hause fühlen«, fuhr Alma fort. »Bei unserer Ankunft wurde uns ein fast schon militärischer Empfang bereitet – die besten Restaurants, jedes Wochenende Partys mit anderen Übergesiedelten und Vorträge und Interviews für Hitch.« Josephines entsetzte Miene entging ihr nicht. »Ich weiß schon, was Sie denken, und Sie haben ja recht, aber über den Sommer haben wir unseren eigenen Rhythmus gefunden. In Beverly Hills gibt es eine nette Kirche, und Pat geht auf eine wunderbare Schule auf dem Sunset Boulevard. Hitch fährt sie jeden Morgen dorthin. Er behauptet zwar immer, Hollywood bedeute ihm nichts, aber dann filmt er aus seinem Cabrio einen Meter Heimvideo nach dem anderen wie ein aufgeregtes Kind.« Josephine malte sich die Szene aus, und die Hitchcocks wurden ihr durch ihr gewöhnliches Familienleben sympathischer. »Wir haben unsere Hunde mitgebracht und unsere Haushaltshilfe, und gerade haben wir eine tolle deutsche Köchin namens Erna eingestellt, die reinste Backkünstlerin. Pat ist auch ganz begeistert, und das ist das Wichtigste. Der Umzug war ein wahres Abenteuer für sie, und ich glaube, wir waren noch nie so glücklich.«
»Hört sich an, als würden Sie auf lange Sicht dortbleiben.«
»Hoffentlich. Im Herbst ziehen wir raus nach Bel Air. Die Wohnungen in Wilshire sind schon in Ordnung, modern ausgestattet und praktisch gelegen, wenn man zu den Studios will, aber wir brauchen ein richtiges Haus mit einer anständigen Küche. Zum Teufel mit dem Swimmingpool, um es mit Hitchs Worten zu sagen.«
Es klang idyllisch, doch bislang hatte Alma kein Wort über ihre eigene Karriere verloren. Bei ihrem Kennenlernen waren Josephine ihr Tatendrang und ihre Entschlossenheit aufgefallen, die ungetrübte Freude, die sie aus der kreativen Partnerschaft mit Hitch zog. Alma Reville hatte selbst sämtliche Stellen beim Film durchlaufen, abgesehen von Schauspielern und Regie führen. Sie hatte als Teedame bei der London Film Company begonnen und sich selbst dort hervorgetan; es schien unwahrscheinlich, dass sie mit ihren Rollen als Ehefrau und Mutter zufrieden sein würde, egal, wie viel Freude sie ihr auch bereiten mochten. »Und beruflich?«, fragte sie. »Sie hatten sich ja Gedanken gemacht, dass Sie in Amerika nicht in derselben Form mit Hitch würden arbeiten können wie in England.«
»Das stimmt, aber wir wissen uns schon zu helfen. Hitch hat schon einiges an Einfluss, und sein zweiter Film mit Walter Wanger ist jetzt in trockenen Tüchern. Er hat dafür gesorgt, dass ich mit einem anständigen wöchentlichen Honorar dabei bin und meinen eigenen, unabhängigen Vertrag bekomme. Genau wie Joan – wussten Sie, dass sie uns begleitet hat?« Josephine nickte. Joan Harrison war die rechte Hand der Hitchcocks, gehörte praktisch zur Familie, und die drei bildeten ein eingespieltes Team; eine Rolle, die womöglich Marta zugefallen wäre, wäre sie mit einem Umzug nach Amerika einverstanden gewesen. »Wir arbeiten an einem neuen Drehbuch, damit es fertig ist, wenn Hitch Rebecca abgeschlossen hat, genau wie damals auf der Cromwell Road. Es unterscheidet sich also nicht so sehr wie befürchtet, und die Aussicht ist besser.«
Das Lamm war auf den Punkt gegart und viel zu köstlich, um etwas davon liegen zu lassen; Josephine war mittlerweile erleichtert, dass die übrigen Gänge aus Salat, Obst und Eis bestanden. »Wie kommt Hitch mit Selznick zurecht?« Sie kannte die Antwort zwar bereits, denn zwischen Regisseur und Produzent hatte es schon vor Martas Abreise aus England gebrodelt, war jedoch an Almas Perspektive interessiert.
»Immerhin haben sie sich zusammen Der Zauberer von Oz angesehen, aber ich bezweifle, dass sie je Freunde werden.« Alma verdrehte die Augen. »Sie haben sich wegen des Drehbuchs zerstritten, wie Sie vielleicht gehört haben. David wollte sämtliche Szenen aus dem Buch im Film, und Hitch will … na, Sie wissen ja selbst am besten, was Hitch von einem Buch möchte.«
»Eine Autorin, die sich nicht einmischt?«
Alma lachte. »So in etwa. Nein, Hitch hat seit Geheimagent seine Lektion gelernt. Ein großartiger Roman kann den Filmemacher in den Schatten stellen. Er nimmt sich seitdem lieber zweitklassige Werke vor und verleiht ihnen seine eigene Vision.« Falls Alma merkte, wie beleidigend der Kommentar war, ließ sie sich nichts anmerken, und Josephine verkniff sich ein Lächeln. Sie konnte nur hoffen, dass ihre eigenen Romane so »zweitklassig« waren wie Daphne du Mauriers; Rebecca hatte sich seit Erscheinen im vergangenen Jahr fast eine Million Mal verkauft, und dazu war weder Alfred Hitchcock noch David Selznick nötig gewesen. Sie überlegte, aus schriftstellerischer Solidarität etwas zu sagen, doch Alma war noch nicht fertig. »Aber beide nehmen den Film ernst – die Form, die Sprache, das Erzählen. Ja, sie haben unterschiedliche Herangehensweisen – David arbeitet bis zum Umfallen, und Hitch kommt jeden Abend zum Essen nach Hause –, aber sie leben beide für den Film, deswegen wird die Zusammenarbeit auch funktionieren.« Sie hob eine Augenbraue. »Außerdem haben beide zu viel Angst vorm Versagen. Das würden ihre Egos nicht verkraften.«
»Riskant ist es trotzdem, und ich bewundere Ihren Mut«, erwiderte Josephine. Im Studiosystem Hollywoods regierten nicht die Regisseure, sondern die Produzenten mit ihren Stars, die für Kartenverkäufe beim Publikum sorgten. »Er muss sein Können erneut unter Beweis stellen. In England wäre er auf ewig als größter Regisseur aller Zeiten verehrt worden.«
»Aber in Amerika kann er bessere Filme machen.« Da war sie wieder, die Besessenheit, die alles andere nichtig zu machen schien. Alma hielt inne, als würde sie Josephines Gedanken lesen. »Und er wollte Pat und mich rausholen«, fügte sie leise hinzu. »Er hat lange genug in Deutschland gearbeitet und war sich schon länger sicher, dass es wieder zum Krieg kommen wird. Er wollte seine Familie in Sicherheit bringen, und dafür liebe ich ihn, egal, was darüber in England geredet wird. Er wird als Feigling beschimpft, und das tut weh.« Sie schien noch etwas sagen zu wollen, überlegte es sich dann jedoch anders, um die Stimmung aufzulockern. »Das Filmemachen an sich ist allerdings auch schon ein Krieg.«
»Ja, Marta meinte, dass es nicht besonders harmonisch läuft.«
»Gelinde gesagt. Hat sie Ihnen von den Probeaufnahmen erzählt?«
»Ein bisschen. Bei unserem letzten Gespräch war die weibliche Hauptrolle immer noch nicht besetzt.«
Die Rolle der zweiten Mrs de Winter – an der Seite Laurence Oliviers – war den Gerüchten zufolge die umstrittenste Besetzung Hollywoods. »Das hat sich erst in letzter Sekunde entschieden, das stimmt«, gab Alma zu. »Hitch war stinkwütend, dass er endlose Probeaufnahmen mit Schauspielerinnen über sich ergehen lassen musste, von denen er wusste, dass sie die völlig falsche Wahl waren.«
»Wenn ich das richtig verstehe, war Vivien Leigh ganz versessen darauf, an Larrys Seite zu stehen«, bemerkte Josephine.
»Und wie. Sie wollte unbedingt zwei Mal vorsprechen, obwohl sie für diese Rolle gar nicht geeignet ist – viel zu stark und charismatisch.«
»Da war sicher einiges an Fingerspitzengefühl nötig.«
»Absolut. Aber David hofft, dass sie etwas anderes finden, wo die beiden zusammenarbeiten können.«
»Die Arbeit mit Larry wird sicher auch kein Zuckerschlecken. Er kann zwar ganz umgänglich sein, aber nur, wenn es nach seiner Nase geht.«
»Da ist er nicht der Einzige. Sie kennen sich also?«
»Nicht besonders gut. Er hat in einem meiner Stücke mitgespielt – Bothwell in Queen of Scots.«
»Ach ja, natürlich, das hatte ich ganz vergessen. Wie fanden Sie ihn?«
»Charmant, wenngleich ein wenig zu selbstsicher, und das ist schon fünf Jahre her. Mittlerweile wurde er für Sturmhöhe für den Oscar nominiert, da würde ich mich nicht wundern, wenn er nach der ganzen Grübelei auf Penistone Crag abgehoben wäre.«
»Für solche stimmungsvollen Szenen ist er wirklich hervorragend geeignet, auch abseits der Kamera. Ich hatte ja den Eindruck, dass er erleichtert war, eine Pause von Vivien zu bekommen, aber das kann er natürlich nicht laut sagen.«
Josephine war neugierig, wer am Ende als Siegerin hervorgegangen war. »Und wer hat nun die Rolle bekommen?«
»Joan Fontaine.« Alma verzog das Gesicht.
»Und damit sind Sie nicht einverstanden?«