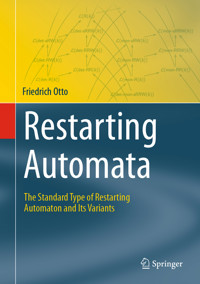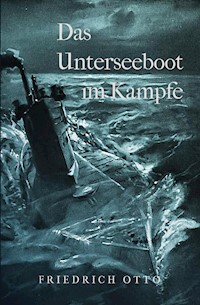Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Mit schonungsloser und erschütternder Offenheit gewährt Friedrich Otto einen Einblick in die Kämpfe an der Somme. Unsichtbare Phosphordämpfe in ungezählten Granattrichtern, die erst nach Tagen ihre tödliche Wirkung zeigen. Andere Gase, die grünen Chlore, zerfraßen selbst die Metalle, die Fernsprechdrähte, die Flintenläufe und die Maschinengewehre, waren aber doch wenigstens sichtbar. Schließlich erblicken Soldaten zum ersten Mal eine neue Waffe an der Front.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Schlacht über dem Nebel
und andere Erzählungen
von
Friedrich Otto
_______
Erstmals erschienen bei:
Georg Müller, München, 1917
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2017 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-087-8
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Der Tod und die Panzerwalze
Der Schuss in der Neujahrsnacht
Der Wolkenfarbene
Luftschiffbeize über der Adria
Schwarze Symphonie
Die Schlacht über dem Nebel
Der Tod und die Panzerwalze
m 13. September bekam der Gewehrführer Werner Kleffel den Befehl, mit seinem Maschinengewehr den Trichter 3 zu beziehen, den erst am Tage vorher eine der neuen französischen 45 cm-Haubitzen aus der Erde herausgespritzt hatte. Von oben sah das ganze Gelände aus wie eine von tausend kleinen Kratern besetzte Mondlandschaft, wie ein von riesigen Pockennarben entstelltes Gesicht. Die Flieger flogen mit erhabenen Gruselgefühlen über dies unmögliche Land.
Der Hauptmann war der Ansicht, dass in den Trichtern noch giftiges Gas stecken könnte, jene schweren unsichtbaren Phosphordämpfe, die erst nach mehreren Tagen ihre tödliche Wirkung offenbaren. Dann fangen die Vergifteten an zu husten, ihre Lungen eitern, und der grauenvollste Tod tritt ein. Andere Gase, die grünen Chlore, zerfraßen selbst die Metalle, die Fernsprechdrähte, die Flintenläufe und die Maschinengewehre, waren aber doch wenigstens sichtbar.
Die Leute der Maschinengewehrabteilung banden sich die Giftschutzmasken um den Kopf. Wie Makaken, wie Bewohner des Mars mit einer langen Rüsselschnauze und bösen Hummerstielaugen sahen sie aus.
Werner Kleffel prüfte noch einmal die gesamten Vorräte der Mannschaften: Munition und Nahrung musste sehr reichlich mitgenommen werden, da bei dem starken Feuer der Engländer und Franzosen an eine Neuverproviantierung sicher nicht oft zu denken war.
„Herr Vizefeldwebel sind nicht der einzige. In allen Nestern stecken die Unseren“, sagte ein Posten. „Da ist es noch am sichersten, besser als in den Gräben!“
„Ich fürchte mich nicht“, sagte Werner Kleffel.
„Trotzdem ist hier was gefällig“, beharrte der Posten.
„Dazu sind wir ja da!“ Darauf brach das kurze Gespräch ab. „Die Hauptsache ist, dass ich überhaupt heil in das Loch hineinkomme“, dachte Kleffel und schätzte die Entfernung des Trichters vom Grabenrand 60, 70, 80 Meter. Solange es noch hell war, konnte er den Trichter unmöglich beziehen. Das wäre zweckloser Selbstmord gewesen. Die Feinde schössen auf jede Nasenspitze, die sich über den Gräben regte und selbst nachts ließen sie ununterbrochen ihre bunten Sterne emporsteigen. Die Scharfschützen hüben und drüben wussten sogar hin und wieder die Öffnungen der Sehschlitze verborgener Panzerplatten zu entdecken und schossen den Spähern die Augen in den Kopf.
Neulich erst hatten so zwei französische Generäle ihr Leben gelassen, als sie durch ein Panzerschild die deutschen Gräben beobachteten. Kurz nach 11 Uhr abends trat die Abteilung an, um die neue Wohnung aufzusuchen. Der Gewehrführer Werner Kleffel und ein Mann stiegen über die Böschung des Grabens und krochen platt und langsam wie Schildkröten auf den Trichter zu. Wenn eine Sterngranate am Himmel platzte, drückten sie ihre Gesichter in die Erde und spielten die Toten. Kleffels Begleiter rutschte zuerst in die Trichtermulde; der Vizefeldwebel hörte, wie er leise aufschrie und glitt ebenfalls in die Tiefe. Er schaltete seine Taschenlampe ein. Acht Tote füllten den Trichtergrund aus. Engländer, die beim letzten Sturm, der ihren sieben Gaswellen folgte, gefallen waren und sterbend noch nach Rettung den Trichter aufgesucht hatten. Sie waren verblutet, verhungert, verdurstet oder am eigenen Gasgift gestorben.
Es dauerte über eine halbe Stunde, ehe die Toten ins Gelände hinausgestoßen waren. Alles musste so langsam und lautlos geschehen, als ob Tote einander mit unsichtbaren Bewegungen begrüben.
Während Kleffel die Leichen in die Höhe schob, rollte sie sein Begleiter Höffer einige Schritte vom Trichter weg, wobei er sich stets im Schutz hielt, um nicht beschossen zu werden, falls der Feind etwas merkte.
Dann schippte er etwas Erde über die kalten Körper und kroch, durchschwitzt und von Erregung gepeinigt, in den Trichter zurück.
„Der Soldat muss viel durchmachen“, so tröstete ihn der Vizefeldwebel.
„Man darf sich nichts daraus machen“, antwortete Höffer.
Diese beiden Redensarten waren richtige Sprichwörter geworden, die beinahe auf jede Lage eines Kriegers passten: ausgeschwitzte und wieder gefrorene Wahrheiten. „Ich ging vor zwei Jahren noch zur Schule“, meinte Kleffel, „und habe mir das auch nicht träumen lassen. — Doch, wo bleiben die anderen?“ Er spähte zum deutschen Schützengraben hinüber und gab zum zweiten Male die Blinkzeichen mit seiner Taschenlampe.
Langsam krochen vier Schatten heran. Sie brachten das Maschinengewehr mit sich, das ein erdfarbener Lappen zudeckte.
Dann wurde der Trichter wohnlich gemacht. Bretter und Dielen wurden im kümmerlichen Licht der wie Glühwürmer glitzernden Taschenlampen zurechtgelegt, und Vizefeldwebel Kleffel übernahm die erste Wache.
Er drückte wiederholt an der „Klapperschlange“, dem Maschinengewehr, herum, ob es genügend feststand und auch gut geschützt war. Trotz der Finsternis war die Arbeit gelungen, und es lag vollkommen fest.
Um drei Uhr morgens weckte er Rubach, einen früheren Forstgehilfen aus Westpreußen, und wollte sich schlafen legen.
Aber das ferne, zornige Knurren eines Flugzeuges hielt ihn auf den Beinen. Ein leiser Warnungsruf aus dem Graben ertönte.
Der fliegende Feind war noch nicht zu sehen, der Lärm der Maschine lag ziemlich tief, und wenn die Gegend nicht wie ein Land der Hölle völlig zerfleischt gewesen wäre, hätte man annehmen können, ein Automobil knarre auf einer Landstraße entlang.
Das Flugzeug kam näher, und Rubach entdeckte ein kleines Licht, das in nur fünfzig Metern über der Erde blinkte. Das war der feindliche Flieger.
Er zog in Zickzacklinien über dem Leichenfeld, und Kleffel war nicht mehr im Zweifel, dass der Flieger den gefährlichen Flug nicht aus Vergnügen machte.
Plötzlich spritzte der Ton der Schnellfeuerwaffe des Fliegers auf, erst kurzschütternd, dann scharfknarrend und zuletzt wie ein helltönendes, langgezogenes, kollerndes Papapapa.
Kleffel glaubte seinen Augen nicht zu trauen, als er eine Kette von Feuerperlen in die Tiefe schießen sah. Alle Sekunden flammte ein magnesiumhelles Geschoss auf. Kein Zweifel, jeder zehnte oder mindestens zwölfte Schuss des fliegenden Maschinengewehrs war eine kleine Leuchtkugel.
Der unheimliche Todesvogel suchte wie eine Nachtmar, wie eine Riesenfledermaus, eine schauerliche schwarze Großroche das Gelände nach Opfern ab.
„Hyäne“, zischte Kleffel. Er bebte, weil es gegen diesen durch die Luft schießenden Feind keine Wehr und Waffe gab. Der Flieger flog die einzelnen Trichter ab und beschoss sie, wenn er im Licht seiner Magnesiumkugelspritze Menschen entdeckte, von oben her.
„Rubach, wenn er zu uns kommt, werfen wir uns auf die Fresse“, sagte Kleffel.
Die fliegende Hyäne fand aber an anderen Stellen genügende Arbeit. Ein Scheinwerfer überfiel sie plötzlich, tief aus der Finsternis bellte ein deutsches Maschinengewehr, und der Flieger verschwand.
Kleffel legte sich schlafen und träumte unruhig. Jemand schlug ihn im Traum auf die Schulter, und er wachte auf.
„Herr Vizefeldwebel! Schon wieder was Neues“, sagte der Posten, der ihn aus dem Schlaf gerissen hatte.
Trotz seiner großen Jugend war Kleffel sofort wach.
„Wie spät ist's“, flüsterte er.
„Fünf Uhr. Es wird schon ein bisschen schummerig.“
„Hören Sie nichts, Herr Vizefeldwebel?“
„Wieder ein Flieger!“ meinte Kleffel.
„Nein, was anderes! Auch nicht ein Luftschiff. Denn es bleibt immer auf einer Stelle. Es klingt wie ein Nebelhorn ohne Stimme.“
Kleffel lächelte: „Am Ende ist es das Einhorn. Das Schweigen im Walde.“
Ein dumpfes mahlendes Geräusch lag in der Finsternis. Ohne Zweifel bewegte es sich auch, denn der Ton wurde bald lebhafter, bald ruhiger und glitt langsam nach Norden ab.
„Es klingt wie ein riesiger Lastwagen“, sagte der Posten.
„Ganz undenkbar im Gebiet der Sommeschlacht“, antwortete Kleffel.
„Wenn es bloß heller würde“, dachte er dann. „Aber was nutzt uns der Tag, dann müssen wir stillliegen und können wir erst recht nichts sehen.“ Er seufzte und setzte sich nieder.
Das Dröhnen wanderte in grausiger Ruhe über das Schlachtfeld. Gegenstandslos, wesenlos wie der Ton an sich, wie das zornige Murren eines Geistes, den das unerhörte Kanonengewitter aus der Erdentiefe gerufen hatte.
„Meinetwegen mag es der Erdgeist selber sein. Einen Tod gibt es nur“, dachte Vizefeldwebel Kleffel und schlief wieder ein.
Es war schon ganz hell, als er wieder erwachte, und Rubach meldete ihm, dass der Ton allmählich in der Frühe sich wieder verloren hätte. Er habe vorsichtig hinausgespäht, aber nichts entdecken können.
„Gott sei Dank, dass ich wenigstens noch etwas geschlafen habe“, sagte Kleffel, und er behielt Recht, denn nun kamen drei Tage und Nächte, in denen er keine Sekunde Schlaf fand.
Unaufhörlich trommelte die feindliche Artillerie. Tag und Nacht schossen dunkle und leuchtende Geschosse durch die Luft, solche, die recht nahe einschlugen und andere, die die Ferne suchten. Stählerne Eisenbahnzüge brüllten in der Höhe. Die Langgeschosse der englischen Schiffsgeschütze hatten einen Ton, der das ganze Knochengerüst der Menschen in der Tiefe unter Schmerzen mitschwingen ließ.
Schon am ersten Abend musste das Wasser eingeteilt werden, wenn es noch einen weiteren Tag reichen sollte. Während des Trommelfeuers am Tage war eine Verbindung mit dem nächsten Graben nicht zu denken. Lange Zypressen von schwarzem Staub und zermalmter Erde sprangen empor, wenn eines der Großgeschosse ins nahe Gelände schlug und dazwischen peitschten die sichergezielten Schüsse der Scharfschützen.
In der Nacht aber war ein Verlassen des Trichters noch weniger möglich, da der Feind häufig nächtliche Sturmangriffe machte und dann die „Totenorgel“ im Trichter jeden Mann zum Dienst verlangte.
Einhundertzehn Stunden hatte das Trommelfeuer gedauert. Alles Land war mit Stahl besät. Die Schützengräben waren zugeschüttet, und nirgends regte sich mehr das Leben.
Jetzt erst in der Frühe des fünften Tages sprang der Feind aus seinen Gräben. Eine Horde Betrunkener brüllte heran. Franzosen und Engländer hatten reichlich Wein für ihren letzten Siegeslauf erhalten und überboten sich im Schreien. Die Farbigen voran. Ein Befehl hatte ihnen die weißen Frauen als Beute versprochen, die die Deutschen angeblich bei sich hätten.
Aber aus der zerstampften, eingeebneten Erde hoben sich die Flintenläufe der Überlebenden, und überall wuchsen die spitzen Hälse der Maschinengewehre empor. Das Land starrte von stählernen Vipern.
Jetzt begann auch die Totenorgel des Trichters ihre Melodie. Sie umfasste nur einen Ton, der in rasendem Furioso und Crescendo, im schauerlichsten Tempo rubato anschwoll und vibrierend die kühle Morgenluft durchpulste.
Der Gewehrführer Kleffel äugte über den Rand des Trichters und bestimmte danach die Streuung des Maschinengewehrs. Es mähte die heranbrausenden Menschen wie hohes Gras. Sie überschlugen sich, brüllten noch sterbend und warfen sich hin und her wie gefällte Pferde. Plötzlich schlug eine Hurrawelle aus dem zerschütteten deutschen Schützengraben. Seitengewehre blitzten. Ein riesiger Neger raste allen voran, den Deutschen entgegen wie ein Amokläufer und brach erst kurz vor Kleffel in die Knie. Er fiel kopfüber in den Trichter, biss Rubach in das Bein und versuchte Höffer zu würgen, bis ihm ein Schlag mit der Schippe das gesamte Gesicht vom Kopfe schälte. Nur die beiden rollenden Augen standen noch in dem blutigen Fleischfetzen. Noch jetzt fletschten die lippen- und wangenlosen Kinnbacken wie im Krampf. Dann erstickte der Neger im eigenen Blut und wurde ruhig.
„Sofort beseitigen“, sagte Kleffel, dessen Gesicht trotz der Starre zuckte und bebte.
Zwei Mann hoben den toten Kaffer über den Trichter.
Der Feind war geflohen und geschlagen, und die deutsche Sturmgruppe hatte sich im vordersten feindlichen Schützengraben festgesetzt. Nur einige Handgranaten brummten noch und reinigten den feindlichen Schützengraben vom letzten Feind, der sich bis zum Tode wehrte.
„Rubach, versuchen Sie uns Wasser und Brot zu holen“, sagte Kleffel. Dann fielen alle zusammen und schliefen wie tot ein.
Hauptmann Brandes sagte am Abend zu seinen Offizieren:
„Die Engländer haben seit einigen Tagen eine neue Sorte Panzerautomobile gegen uns auf die Beine gebracht. Sie nennen sie Tanks, auch Caterpillars. Soweit bis jetzt richtige Nachrichten vorliegen, sind diese Tanks große eiförmige Stahlgebilde mit sechs Maschinengewehren oder Schnellfeuerkanonen. Im Innern der Tanks befinden sich sieben Mann, die sich mittels Prismen und Periskopen über die Vorgänge draußen orientieren. Der Wagen bewegt sich nicht auf gewöhnlichen Rädern, sondern über die Räder sind breite Bänder gelegt, so dass die Fahrzeuge auch über weiches und unebenes Gelände klettern können. Sind wir richtig benachrichtigt, so haben die Engländer diese Tanks dazu bestimmt, die vordersten Gräben anzugreifen und insbesondere Maschinengewehrnester zu zerstören. Da Gott in seiner Langmut die Engländer zugelassen hat, wird er es wohl auch nicht verhindern, dass sie mit ihren langsamen Tanks in der Tat sich an uns heranwagen. In diesem Fall kalt Blut und heiße Granaten. Infanterie- und Maschinengewehrfeuer hat jedoch keinen Zweck, solange nicht der Bauch des neuen trojanischen Pferdes seine Insassen ausspeit. Lassen Sie sich also nicht bluffen, wenn Sie einen der Tanks zu sehen bekommen. Die Artillerie hat übrigens Anweisung, ein ganz besonderes Auge auf die Tanks zu haben. Unterschätzen Sie aber die Gefahr auch nicht. Bei meinem Kameraden Brandes hat einer der Tanks sich sogar gegen eine betonierte Maschinengewehranlage herangewagt und leider mit Erfolg. Also, meine Herren, kommen Sie gesund in Ihre Unterstände.“
Kleffel kehrte mit den anderen zurück. Pioniere hatten bereits einen niedrigen Verbindungsweg zum neubesetzten Schützengraben hergestellt. Auf allen Vieren kroch der Vizefeldwebel in seinen Stand, wo die Mannschaft sich bereits bei einem Spielchen „Tod und Leben“ befand. Zu einem richtigen Skat fehlte die Behaglichkeit.
Gegen Einbruch der Dunkelheit erschienen schon wieder die Harpyien, die französischen Raubeulen, um die versprengten Posten und Trichter und Gräben zu beschießen. Selbst Tote fanden keine Gnade vor den Augen der fliegenden Franzosen und mussten sich den Leib noch einmal mit Kugeln untersuchen lassen.
Mit häßlichem, metallischem Geklapper, gleich dem Fluglärm der sagenhaften Stymphaliden des Altertums, die ihre Flügelfedern als Pfeile auf Menschen abschössen, flogen zwei der Maschinen über das leichenbedeckte Feld und machten auch den geringsten Versuch, noch einige Verwundete vom Schlachtfeld zu lesen, unmöglich.