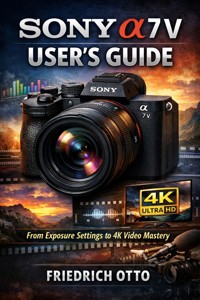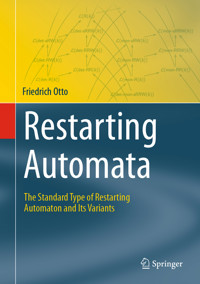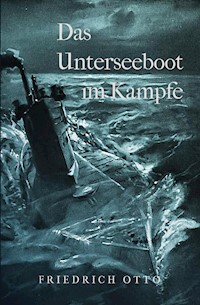Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Erlebnisse Hans Fabers, beginnend mit dem ersten Übungsflug bis hin zur spektakulären Luftschiffjagd und endend mit der Torpedierung eines Kreuzers. Erleben Sie packende Schilderungen der Ereignisse. Die Tragödie des Untergangs des italienischen Luftschiffs Cittá di Ferrara wird genauso beschrieben, wie die Torpedierung eines französischen Panzerkreuzers durch ein kaiserliches U-Boot.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans der Flieger
Eine Erzählung aus dem Weltkrieg
von
Friedrich Otto
______
Erstmals erschienen bei:
Loewes Ferdinand Carl, Stuttgart, 1916
_________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2016 Klarwelt Verlag
ISBN: 978-3-96559-021-2
www.klarweltverlag.de
Inhaltsverzeichnis
Titel
Hans Fabers erster Kriegsflug.
Ein Phönixflug aus Przemysl.
Hans Fabers kühner Nachtflug in Flandern.
Eine Luftschiffjagd an der Adria.
Im Fliegerlager an der Donau.
Fliegertage an den Dardanellen.
Mit Tauchboot und Luftschiff gegen England.
Hans Fabers erster Kriegsflug.
ans Faber war ein junger Flieger, der bei Ausbruch des Krieges noch keinen Namen hatte. Nur einmal war es ihm vergönnt, sich an einem Wettbewerb zu beteiligen, an der großen internationalen Flugwoche in Wien. Aber seine Leistungen blieben dabei so gut wie unbeachtet. Er gewann mit 52 Meter einen dritten Preis im Wettbewerb um den kürzesten Anlauf. Wie stolz Hans Faber im ersten Augenblick auch auf diese Leistung war, so wenig hielt die Freude vor, als er die Künste der übrigen Flieger sah. Da waren die Franzosen, die mit ihren nervenkitzelnden Sturz- und Kopfflügen die Wiener und Wienerinnen entzückten, ferner die berühmten österreichisch-ungarischen und deutschen Höhenflieger, die viele Kilometer empor in den blauen Himmel kletterten, so schnell und sicher, als würden sie von einem riesigen, mächtigen, unsichtbaren Magnet in den Scheitel der Weltenkuppel gezogen. Doch kaum war eine Höchstleistung aufgestellt, so stürmte schon wieder ein anderer ihm nach, bis er sich in einem Punkt dort oben verlor, als sei er auf dem Wege zu einem andern Stern.
Hans Fabers Gefühle beim Anblick so vieler prächtiger Flieger waren geteilt. Teils freute es ihn, dass der Mensch in neun Jahren des Flugs es schon gelernt hatte, so meisterhaft die Lüfte zu beherrschen, teils aber drückte ihn das Bewusstsein nieder, dass ihm wohl so bald kein Lorbeer auf dem Gebiete des Fluges grünen würde. Wie sollte er wohl die kühnen, erfahrenen Flugmeister je übertreffen? Ja, selbst wenn er den Mut und die Kraft in sich gefühlt hätte zu solchen Leistungen, so fehlte es ihm doch an der eigentlichen Lust, sich einem nahezu hoffnungslosen Streben nach Welthöchstleistungen hinzugeben. Er träumte vielmehr von höheren, anderen Zielen auf dem Gebiete des Fliegens. Er sah sich als erster ein bisher unbezwungenes Gebirge überfliegen, er überquerte in krankhaften Träumen den Atlantischen Ozean, er stieg mit seinem Flugzeug bis in Höhen empor, wo neue, ganz unbekannte Gefahren den Flieger bedrohten. Da schossen durch den dünnen Luftraum durchsichtige, gallertartige Riesenwesen, eine Art Lufttintenfische, die widrige, nässende, plötzlich zu Eis gefrierende Säfte auf den Flieger schleuderten oder mit schleimigen Greif- und Saugarmen ihn umschlangen und ihn zu erdrücken versuchten. Hans Faber, der Träumer, schalt sich dann oft, wenn er aus seinen Betrachtungen mit offenen Augen erwachte.
Ein bekannter großer Flieger, dem er im Café Noack in Adlershof einmal sein Leid klagte, hatte ihm gesagt: „Leiste etwas, dann werden sich diese Gesichter und Erscheinungen bald verlieren.“
Jetzt wusste er es.
Er musste etwas leisten!
Aber was? Lohnte es sich wirklich, unter Aufgebot aller Kraft und unter Daransetzung des ganzen Lebens zu versuchen, einen Vorgänger um einige hundert Meter in der Höhe zu überflügeln? Mit derartigen Gefühlen und Gedanken beschwert, stand Hans Faber auf dem Flugfeld zu Aspern bei Wien und sah gerade steil in den Himmel hinauf, als dort ein Franzose seine Purzelbäume schlug.
Plötzlich wurde er angeredet. Ein junger österreichisch-ungarischer Offizier wendete sich zu ihm:
„Herr Flieger-Kamerad sind wohl sehr erstaunt über das!“ Dabei wies der schneidige schlanke Offizier mit seiner Reitgerte in den Himmel hinauf, wo der fremde Flieger kopfunten seine Bahn zog.
„Hans Faber!“ erwiderte der Angesprochene, sich dabei vorstellend.
„Amandus Sommer!“
Der deutsche Flieger fuhr fort:
„Ich bewundere solche Flüge aufrichtig!“
„Und ich nicht minder. Aber ich glaube doch, für die raue Wirklichkeit haben solche Kopfflüge nur selten eine Bedeutung.“
Hans Faber meinte:
„Es sollen aber Fälle vorgekommen sein, in denen Flieger durch den Sturm auf den Kopf geworfen wurden!“
„Gewiss“, entgegnete der Offizier, „aber das stößt doch eigentlich nur den leichten französischen, wackligen Eindeckern zu. Ihre und unsere Flugzeuge stehen entschieden wesentlich fester im Fluge und sind auch bisher noch nie auf den Kopf gestellt worden.“
Der Offizier wollte weiterreden, als ihn eine Damenstimme rief:
„Mandi!“
Amandus Sommer verneigte sich, grüßte und ging fort.
Am andern Tage der Flugwoche war der österreichische Offizier wieder auf dem Flugfeld, diesmal erschien er in einem schönen, leichten Kraftwagen, einem Zweisitzer. Neben ihm, am Steuer, saß seine junge Frau. Der Wagen hielt auf dem eigentlichen Flugfeld, denn für ihn galt keine Sperre, da Amandus Sommer alle Vorrechte eines Fliegers besaß. Als der Leutnant Hans Faber bemerkte, stellte er ihn seiner Frau vor.
„Theres, hier siehst du einen deutschen Flieger, der eine große Zukunft haben wird.“
Hans Faber verteidigte sich energisch gegen diese Worte. „Gnädige Frau, Ihr Herr Gemahl beliebt zu scherzen. Leider befürchte ich, dass ich gar nichts als Flieger werde leisten können!“
Die junge Dame hob den rosenfarbenen Sonnenschirm ein wenig in die Höhe.
„Wenn Sie ernsthaft das Fliegen betreiben, bleibt auch für Sie noch genug zu tun übrig!“
Faber zuckte mit den Schultern.
Sommer aber sagte:
„Die ganze Fliegerei steckt noch in den Kinderschuhen. Was wir hier sehen und bewundern, das sind alles erst Anfänge. Lassen Sie nur einmal große Ereignisse kommen und Sie werden sehen . . .“
Acht Wochen später brach der große Krieg aus. Hans Faber hatte seine kurze Begegnung mit dem jungen österreichischen Offizier längst vergessen. Er meldete sich sofort freiwillig als Flieger und wurde erst einer Festungsflieger-Abteilung in Posen zugeteilt, kam aber nach wenigen Wochen schon dicht an die Front zu einer Feldflieger-Abteilung.
Es brach nun eine harte, arbeitsreiche Zeit für ihn an. Er musste Tag für Tag große Strecken der feindlichen Linien abfliegen, in der Hauptsache nach den Angaben seines Beobachters, der Offizier war, er musste feindlichem Gewehrfeuer zum Trotz oft tief herabsteuern auf irgendeinen Wald zu, um zu ermitteln, ob Russen darin steckten, was die Beobachter gewöhnlich durch ein paar Bomben feststellten. Waren Russen im Walde, so beantworteten sie jede einschlagende Bombe durch wütendes Gewehrfeuer und verrieten sich dadurch. Oder er bekam die Aufgabe, über irgendeine auf der Karte bezeichnete Bahnstrecke zu fliegen, über einen Bahnhof. Der Beobachter warf Bomben auf einen Lokomotivschuppen, und die Maschinen sausten nach allen Seiten auseinander, wie Tausendfüßler und Kellerasseln von einem umgedrehten Stein wegflüchten.
Auf diese Weise vervollkommnete er sich immer mehr im Fluge. Als kühner und doch besonnener Flieger lenkte er sogar bald die Aufmerksamkeit des Führers seiner Feldflieger-Abteilung auf sich, und so wunderte er sich auch kaum noch, als eines Abends der Hauptmann Köhler-Haußen ihn zu sich rief.
„Faber“, sagte der Hauptmann freundlich; „ich habe Sie zur Beförderung zum Unteroffizier vorgeschlagen und hoffe, dass Sie das als eine ganz besondere Auszeichnung betrachten werden. An tüchtigen Fliegern ist zwar kein Mangel, und besonders unsere Offiziersflieger bilden ein tadelloses Material, aber andrerseits ist auch der Bedarf an Menschen groß, und besonders schätzen wir Männer, die den Motor so gut kennen wie Sie. Ich habe neulich mit Vergnügen gehört, wie Sie hinter den russischen Linien niedergehen mussten und Ihren Motor in Kürze wieder in Ordnung brachten, so dass die heranreitenden Kosaken das Nachsehen hatten. Ich habe nun eine ganz besondere Aufgabe für Sie. Wir werden morgen früh besonders schlechtes Wetter bekommen. Gewitter und schwere Böen. Schlafen Sie sich gut aus und melden Sie sich um 6 Uhr bei mir!“
Hans Faber freute sich über diese Mitteilung. Seit langem war er völlig frei von den früheren ihn plagenden Träumen. Meist war er so müde, dass er gar keine Zeit mehr für müßige Gedankenspaziergänge fand, sondern sich glücklich fühlte, wenn er abends noch mit einigen Kameraden über die Ereignisse des Tages plaudern konnte. Er musste oft an den österreichisch-ungarischen Fliegeroffizier Amandus Sommer denken. Wo mochte er wohl jetzt stecken? Fabers Abteilung war die südöstlichste der ganzen deutschen Ostarmee. — Vielleicht, wenn der Zufall günstig war, begegnete er dem österreichischen Kameraden.
Er schlief fest und ruhig trotz der schwülen Augustnacht, die kein Windhauch kühlte. Drückende, lähmende Hitze herrschte am Morgen, als er sich zum Leiter seiner Feldflieger-Abteilung Hauptmann Köhler-Haußen begab.
Der Hauptmann übergab ihm eine Karte:
„Sehen Sie!“ sagte er, „hier habe ich Ihnen mit Rotstift die Strecke eingezeichnet, die Sie heute überfliegen sollen. Sie haben fünf Stunden Zeit. Sie sollen die ganze feindliche Front erkunden und an dieser Stelle das Lysa-Gora-Gebirge überfliegen und etwa 100 Kilometer in das russische Reich vorstoßen und feststellen, auf welcher Bahnstrecke die Russen ihre hauptsächlichsten Truppenverschiebungen vornehmen. Ihre Aufgabe wird noch dadurch besonders erschwert, dass sie vollkommen zuverlässig sein muss; überfliegen Sie zweifelhafte Stellen zwei-, dreimal, bis Sie genau Bescheid wissen.“
Schlag 6 Uhr stieg der Eindecker Hans Fabers über dem Flugplatz auf. Es steckten viele Morgenböen in der Luft, und Faber musste manchmal Höhen- und Seitensteuer und Verwindung zugleich mit einem Schlage betätigen, um nicht abzurutschen. Besonders über Waldrändern erhielt er hastige, schussartige Schläge, und die Luftstöße schlugen manchmal wie Sandsäcke so schwer und wuchtig auf die Tragdecken seiner Taube. Auch in der Höhe wurde dies nicht besser. Teilweise geriet er in die berüchtigten Luftlöcher und fiel 100 Meter machtlos herab oder wurde ebenso plötzlich wieder emporgerissen. Er musste die Zähne aufeinanderbeißen, um nicht die sofortige Entschlussbereitschaft zu verlieren. Dabei wiederholte sich der Kampf mit den Böen fortwährend, so dass seine Spannkraft nachzulassen drohte.
Zur Rechten im Süden bauten sich bereits drohende Haufenwolken auf, deren Hänge wie weißer Neuschnee blendeten, deren Gipfel aber bereits tückisch schwarzblaue Schirme bildeten. Als erfahrener Flieger wusste er sofort, dass das Gewitterbildungen seien. Aber noch waren sie fern und harmlos, diese Gewitterknospen. Auch konnte er hoffen, über das Lysa-Gora-Gebirge hinweg, seitlich nach Osten an ihnen vorbei zukommen.
Wenn nur diese Böen nicht gewesen wären, die seine ganze Aufmerksamkeit zeitweise an sich rissen, so dass er wiederholt die Tiefe und ihre undeutlichen Kriegszeichen aus dem Auge verlor.
Glücklicherweise war der Osten noch wolkenrein. Ein schwerer brauner Dunst füllte die Himmelswand dort aus.
Doch was war das?
Plötzlich, geisterhaft, wie aus dem Nichts entstanden, lagen zwei kleine gelbe Wolken vor ihm in der Höhe. Die wohlbegrenzten Wolken schienen nach unten schwerer zu werden. Sie bildeten kreisartige Figuren, schienen unnatürlich schwer, und fielen langsam erdwärts.
Gleichzeitig hörte Faber durch das Dröhnen seines Motors hindurch ein doppeltes kurzes „Pauh!“
In der Tiefe blitzten zwei rote Feuerzungen aus dem Erdboden auf, und nach wenigen Sekunden sprangen mit einem hohlen Knall wieder zwei der gelben Wolken vor ihm auf.
Das waren russische Granaten.
Schleunigst gab er Höhensteuer und beschrieb eine Kurve. Erst in nahezu 3000 Meter Höhe blieben die tückischen Todeswolken unter ihm zurück.
Hier oben fand Faber auch eine günstigere Windrichtung. Sie stand zwar gegen ihn, war aber regelmäßiger und böenärmer als die unsichere Tiefe unter ihm. Leider konnte er von dieser Höhe aus die Runzeln und Risse der Mutter Erde nicht mehr richtig deuten. Alles hatte sich zusammengeschoben. Riesenfelder erschienen wie kleine aneinandergelegte Dominosteine, Dörfer wie leichte Schutthaufen und Hügel wie kaum sichtbare Schatten. Die Transportzüge der Russen mussten sorgfältig im Blick festgehalten werden, um überhaupt ihre Bewegung zu erraten. Sie krochen anscheinend so langsam wie Raupen. Auch machte sich der Gegenwind immer unangenehmer bemerkbar. Der Benzinstandmesser zeigte den steigenden Verbrauch des Motor-Lebenssaftes an, ohne dass das Flugzeug wesentlich vorwärtskam. So blieb dem Flieger nichts weiter übrig, als die sichere Höhe wieder zu verlassen. Mit volllaufendem Motor donnerte der Eindecker der Tiefe wieder zu. Glücklicherweise blieb die bösartige „zunehmende Bewölkung“ aus, die Schar der kleinen engelhaften Granatwolken.
Hans Faber ging bis auf 1500 Meter herab und hielt erst inne, als er deutlich die Aufschläge ewiger Gewehrkugeln am Rumpfe seines Flugzeuges verspürte. Ein Querschläger zwitscherte mit hässlichem Vogelgepiepe an seinem rechten Ohr vorbei. In 1800 Meter Höhe, die er langsam wieder erklomm, blieben diese peinlichen Stahlhornissen dann weg, und so fand sich Faber wieder allein mit den Böen und Luftlöchern. Er nahm nach der Abwechslung den Kampf mit den Wetterfeinden wieder wohlgemut auf und wandte, soviel er konnte, seine Aufmerksamkeit von neuem ganz der Tiefe zu. Oft musste er sich mit gespreizten Knien gegen die Wand des Eindeckers pressen, um nicht vom Sitz gerissen zu werden. In stilleren Augenblicken trug er seine Zeichen in die Karte ein, die er auf einem Brett an einer Kette befestigt um seinen Leib gelegt trug.
Endlich leuchten die ersten Ausläufer des Lysa-Gora-Gebirges vor ihm auf. Die helleren Straßenstriche fingen an, sich zu krümmen, ein Beweis, dass sie in bergiges Land übergingen. Hans Faber fand, dass es höchste Zeit war, den Südostflug in einen nordöstlichen zu verwandeln, denn jetzt wuchsen die Gewitterwolken im Süden immer gewaltiger vor ihm auf.
Der Vorstoß über das Gebirge gelang ohne größeren Widerstand. Zwar geriet der Eindecker in stark aufwärtsstrebende kaminartige Luftströmungen, die sich über Gebirgen oder großen Wäldern finden, aber mit leicht abwärtsgestelltem Höhensteuer durchschnitt er die Luftsäule und trat nach einer Viertelstunde wieder in die weite endlose russische Ebene ein. Doch schoben sich die Wolkenmassen nun auch im Westen hinter ihm zu, so dass sich Faber bald mitten in einem Kessel von Nebelbildungen sah. Er schwamm in einer großen Wolkenschüssel, die nur in einer Richtung noch einen Ausweg hatte, das war im Osten; im Osten aber war Russland und nichts als Russland. Dorthin durfte er nicht, er musste zurück nach Westen, nach Deutschland. Hans Faber versuchte, nach Nordwesten einen Ausweg zu finden. Aber die Wolken zogen sich auch hier zusammen. Zudem hätte er gegen Wind und Wetter nach dieser Richtung steuern müssen.
Im Süden fiel der erste Blitz, von einer Wolke in die andere springend durchbrach er sie, und fuhr dann zur Erde. Es war dem Flieger als füllte sich die ferne Einschlagstelle des Blitzes mit gelbem Dunst.
Die Erde unter ihm wurde jetzt dunkel. Nur einige Häusergiebel und breite Sandwege nahmen eine unnatürliche Helle an. Einige Lupinenfelder lagen da wie ein brennendes gelbes Feuermeer.
Durch das Gebrüll seines hundertpferdigen Flugmotors hindurch vernahm er bereits den ersten Donner. Die Gewitter schienen mit klingendem Spiele heranzufliegen. Zackige Wolkenherolde flogen an ihm vorbei. Helle Blitze schlugen in wachsen der Anzahl in die Tiefe. Donnerrollen, wie ein Heer von Kesselpauken, erfüllte die Luft. Die Spanndrähte des Eindeckers fingen an zu sausen. Der Gewitterwind blies auf den Vorderkanten der Flügel wie auf Flöten.
Hans Faber wollte zuerst den Kampf mit dem nächsten Gewitter, das aus Südwest heranzog, aufnehmen. Er flog kühn gegen die stahlgraue, erbarmungslose Wand. Aber einige Böen belehrten ihn eines Bessern. Sie stürzten sich wie ganze Wagenladungen schwerer Steine auf ihn, und rissen seinen Eindecker erst in die Tiefe, hoben ihn dann wieder blitzschnell empor und drehten ihn dann wie ein Spielzeug herum. Ehe er es sich versah, hatte er die Wolke im Rücken und wurde von Südwest nach Nordost fortgerissen — nach Russland hinein.
Auch unter dem Flieger erschienen jetzt die drohenden Wolken. Bald musste Faber ganz zwischen Gewitterwolken stecken, wie in einer Hohlkugel.
Er spähte nach einer Wolkenlücke, um sich durch diese hinab auf die Erde zu stürzen, ganz gleich wohin. Hier oben konnte er unmöglich bleiben.
Er sah nach dem Benzinstandmesser. Glücklicherweise war noch kein Mangel an diesem kostbaren Stoffe. Auch der Umdrehungszähler, der angab, wievielmal sich die Schraube in der Minute im Kreise drehte, gab gute Nachricht. Die rote, leise zitternde Zunge stand über 1500.
Es war Hans Faber unmöglich, nach unten durch die Gewitterwolken zu stoßen. Die Böen rissen ihn hin und her wie einen Papierfetzen, und er hätte bestimmt sein Leben und seine Maschine vernichtet, wenn er eine Landung auf fremder Erde versucht hätte.
In einer großen nach Osten weit ausladenden Spirale floh er vor dem Gewitter und versuchte über die Wolken hinauszukommen, denn die Gewitterwolken gingen meistens ziemlich tief.
Von der Erde sah er nichts mehr. Auch der rettende Spalt im Osten war verschwunden. Die Gewitter schienen nicht bloß heranzuziehen, sondern sich überall zu bilden. So versuchte er mit stark angezogenen, Höhensteuer über die Wolkenbänke zu gelangen. Der Höhenmesser zeigte bereits 2800 Meter, aber immer noch standen die Nebelgebirge vor ihm.
Eins der Gewitter zog bereits unter ihm dahin. Er sah unter sich Blitze iu die Tiefe fahren, und vernahm hier oben über den Wolkenkissen und in der dünnen Luft nichts mehr vom Donner. Nur das gelbe und blaue Feuer der Blitze deutete auf die entfesselte Hölle unter ihm.
Der Flieger war glücklich in verhältnismäßig sicherer Höhe über den Wettern seinen Weg suchen zu können. Die Sonne schimmerte durch eine Dunstschicht über ihn hindurch, wie eine durch Seide abgeblendete Lampe, und der Flieger versuchte nun nach Sonne, Uhr und Kompass seine Bahn zu ziehen.
Die Tiefe sandte von Zeit zu Zeit Luftwirbel in die Höhe. Sie kamen plötzlich und ohne jede Warnung an, und schlugen wie Geschosse von unten gegen den Eindecker. Einer der Schläge war so stark, dass Faber sich besorgt über den Rand seines Sitzes hinausbog, um nachzusehen, ob nicht etwa Granaten ihn getroffen hätten. Aber das wäre natürlich ganz unmöglich gewesen. Weder Freund noch Feind konnte ihn hier oben sehen. Er war sich gänzlich selbst überlassen.
Ein schweres Einsamkeitsgefühl überkam ihn zeitweise und trat als eine neue Gefahr heran.
Aber Faber riss sich zusammen, sobald er das erkannte, und mit starker innerer Selbstzucht wies er alle niederdrückenden Gedanken von sich.
„Memme, Feigling“, schalt er sich, wenn er angesichts seiner Lage zu verzagen drohte.
„Du wärest nicht wert, ein deutscher Flieger zu sein, wenn du auch nur eine Spur von Angst hättest“, sagte er laut zu sich. Die inneren Ermahnungen, die sich an den tapferen Teil seines Ichs wandten, halfen denn auch, und mit ruhigem Trotz gewappnet, steuerte er über die Wolken im Osten hinweg.
Die Gewitterriesen beantworteten die Flucht des gefangen gewesenen Fliegers mit einer sofortigen Schwenkung und Erhöhung ihrer mit tödlicher Elektrizität geladenen Massen.
Als Faber sich aber in 3500 Meter Höhe über dem Gewitter befand, sah er zu seinem Entsetzen seinen Weg von neuem durch einen himmelhohen Wolkenturm verlegt, eine Wolkensäule von horizontumfassender Breite. Die Wände der wasserdunstüberfüllten Luftsäule glänzten in reinstem Weiß; die Vertiefungen waren dunkelblau und tiefschwarz. Das ganze obere Rad aber war von einem Saum flüssigen Goldes eingefasst, so dass der Flieger zeitweise seine Augen von der überirdischen Helligkeit abwenden musste.
Wie der Gaurisankar türmten sich die Wolkenmassen vor ihm aus. Ein Zurück gab es für Hans Faber nicht mehr, denn hinter ihm tobten die Gewitter. Über den Wolkenberg zu fliegen, war unmöglich, denn die leuchtenden Nebelmassen ragten wohl bis zu 5 und 6000 Meter hinauf. Hinab konnte Faber auch nicht, weil unten die Gewitterböen herrschten. Also musste er hindurch!
„Durch!“ schrie Hans Faber seinem Motor zu. Er gab leicht Tiefensteuer und ließ seinen Eindecker mit höchster Umdrehungszahl gegen die Wand der Wolken rennen.
„Was war das?“ Einen Augenblick fuhr er bis ins Mark erschreckt zusammen. Ein riesiger, schattenhafter Eindecker raste aus den Wolken auf ihn zu. Er schien noch in Dunst zu liegen und flog ihm schnurgerade entgegen.
Faber machte bestürzt eine Schwenkung. Der mächtige Schattenvogel folgte aber sofort und plötzlich musste Faber lächeln: „Wolkenspiegel“, sagte er. Die hellen Nebelmassen hatten die Umrisse seines eigenen Schattens widergespiegelt. Aber unheimlich war die Erscheinung doch. Sie hatte den Flieger so gepackt, dass er es gar nicht bemerkte, wie er plötzlich selbst in den grauen Wassermassen des Turms versank. Das Licht des Tages verlor sich schnell hinter ihm. Es wurde dunkler und dunkler.
Eine neue Erscheinung schreckte den Flieger. Der Kompass schien seine Geltung eingebüßt zu haben, er drehte sich, soviel auch Faber Seitensteuer gab, um ihn wieder zur Ruhe zu bringen. Nach einigem Nachdenken entsann sich Faber jedoch, dass sein Fluglehrer ihn auf diese rätselhafte Erscheinung bereits aufmerksam gemacht hatte mit dem Bemerken: „warum der Kompass in den Wolken verrückt wird, ist noch nicht ganz aufgeklärt worden. Die Tatsache ist jedenfalls vorhanden. Tritt dieser Fall ein, so geben Sie andauernd stark Seitensteuer rechts!“
Hans Faber befolgte diesen Rat und hatte auch endlich die Genugtuung, dass die Kompassnadel sich wieder beruhigte. Aber den Flieger schmerzten die Muskeln, so stark hatte er andauernd das Seitensteuer zu ziehen. Nach seiner Meinung musste er unbedingt in einem Kreise rechts fliegen. Aber der Kompass zeigte sicher geradeaus und ohne sich diesen Zwiespalt der Natur erklären zu können, blieb Hans Faber unbeirrt dabei, Seitensteuer rechts zu geben.