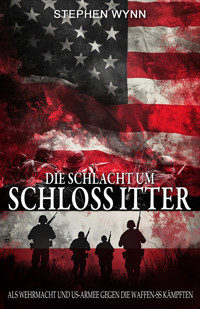
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EK-2 Militär
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in eine der außergewöhnlichsten und spannendsten Geschichten des Zweiten Weltkriegs
– ein Moment, in dem sich erbitterte Feinde zusammentaten, um gegen einen gemeinsamen Gegner zu kämpfen. In seinem Sachbuch Die Schlacht um Schloss Itter bringt Ihnen Autor Stephen Wynn eine der kuriosesten Gefechte des Zweiten Weltkriegs näher.
Eine Burg hoch in den Tiroler Alpen, ein dramatischer Showdown
: Die Schlacht um Schloss Itter erzählt die wahre Geschichte, wie Soldaten der Wehrmacht, angeführt von Major Josef Gangl, Seite an Seite mit US-Truppen, österreichischen Widerstandskämpfern und französischen Kriegsgefangenen das Tiroler Schloss Itter gegen Truppen der Waffen-SS verteidigten. Inmitten des Chaos der letzten Kriegstage bildet sich die wohl ungewöhnlichste Allianz des gesamten Krieges … Stephen Wynn, ein erfahrener Autor für historische Sachbücher, erweckt in Die Schlacht um Schloss Itter eine der außergewöhnlichsten Episoden des Zweiten Weltkriegs zum Leben. Mit akribischer Recherche, mehr als 20 Bildern und einer fesselnden Erzählweise entführt er den Leser in eine Zeit, in der Entscheidungen über Leben und Tod innerhalb von Sekunden getroffen wurden. Dieses Buch beleuchtet nicht nur das taktische Vorgehen und den Verlauf der Schlacht, sondern auch die menschlichen Facetten des Krieges – Mut, Opferbereitschaft und die Fähigkeit, Feindschaften zu überwinden. Die historische Genauigkeit und die unvergleichliche Tiefe machen dieses Werk zu einem Muss für alle, die Geschichte nicht nur verstehen, sondern erleben möchten.
Worauf warten Sie noch? Sichern Sie sich jetzt Die Schlacht um Schloss Itter und lassen Sie sich diese einzigartige Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg nicht entgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Stephen Wynn
Die Schlacht um Schloss Itter
Als Wehrmacht und US-Armee gegen die Waffen-SS kämpften
EK-2 Militär
Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!
Liebe Leserin, lieber Leser,
zunächst möchten wir uns herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie dieses Buch erworben haben. Wir sind ein Familienunternehmen aus Duisburg und jeder einzelne unserer Leser liegt uns am Herzen!
Mit unserem Verlag EK-2 Publishing möchten wir militärgeschichtliche und historische Themen sichtbarer machen und Leserinnen und Leser begeistern.
Vor allem aber möchten wir, dass jedes unserer Bücher Ihnen ein einzigartiges und erfreuliches Leseerlebnis bietet. Haben Sie Anmerkungen oder Kritik? Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen besonders gefallen hat oder wo Sie sich Verbesserungen wünschen. Welche Bücher würden Sie gerne in unserem Katalog entdecken? Ihre Rückmeldung ist wertvoll für uns und unsere Autoren.
Schreiben Sie uns: [email protected]
Nun wünschen wir Ihnen ein angenehmes Leseerlebnis!
Ihr Team von EK-2 Publishing
Einleitung
Wäre der Zweite Weltkrieg nicht gewesen, hätte das Schloss Itter aus dem 13. Jahrhundert, das sich etwa 2.000 Meter über dem Eingang des Brixentals in der österreichischen Region Tirol befindet, keinen wirklichen Platz in der modernen Geschichte gehabt, abgesehen davon, dass es ein malerisches Gebäude ist, dessen Geschichte bis in die Römerzeit zurückverfolgt werden kann, als sein Standort Teil der Hauptverkehrsroute zwischen Italien und dem Rest Europas war. Das Dorf Itter befindet sich etwa 16 Kilometer westlich des beliebten österreichischen Skigebiets Kitzbühel. Die erste Burg in Itter wurde 1240 fertiggestellt, aber nach ihrer Zerstörung um 1530 wieder aufgebaut.
Das Brixental ist mehr als 29 Kilometer lang und gehörte zwischen 1312 und 1805, für 500 Jahre zum Land Salzburg, als es unter die Herrschaft des neu gegründeten Königreichs Bayern kam, bevor es 1816 endgültig Teil des Landes Tirol wurde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Burg bereits in einem ruinösen Zustand, den die bayerische Regierung unverständlicherweise hatte entstehen lassen.
Im Laufe der Jahre hatte das Schloss viele Besitzer, darunter den berühmten französischen Kaiser Napoleon Bonaparte aus dem 19. Jahrhundert. Aufgrund seiner abgelegenen Lage wohnten viele seiner Besitzer nur selten dort, und im Laufe der Zeit wurde es nur noch eine Ruine – ein Schandfleck in der Landschaft.
Das Schloss in seiner heutigen Form wurde auf den Fundamenten seines Vorgängers errichtet, nachdem es im 19. Jahrhundert von dem deutschen Geschäftsmann Paul Spiess erworben worden war. Sein Plan war es, aus dem neuen Gebäude ein hochwertiges Hotel zu machen. Die Arbeiten zur Wiederherstellung des Schlosses in seinem alten Glanz begannen 1878 und wurden sechs Jahre später, 1884, abgeschlossen. Stattdessen beschloss Spiess, seine Verluste zu begrenzen und das Gebäude an die deutsche Komponistin und Pianistin Sophie Menter zu verkaufen, die es für die nächsten 20 Jahre zu ihrem Wohnsitz machte. Dank ihres Besitzes des Schlosses ist bekannt, dass einige der weltweit bekanntesten Musikgrößen der damaligen Zeit dort verweilten. Darunter zählten Komponisten wie Franz List und Pjotr Iljitsch Tschaikowski sowie Arthur Rubenstein, der polnisch-amerikanische Pianist. Dieser wird von vielen immer noch als einer der größten Pianisten aller Zeiten angesehen. Er war ein so großes Talent, dass er 1900 im Alter von nur 13 Jahren erstmals mit den Berliner Philharmonikern auftrat.
Menter verkaufte das Schloss 1902, nachdem die Kosten für seinen Unterhalt untragbar geworden waren. Der neue Besitzer war der deutsche Geschäftsmann Eugen Mayr, der weitere Renovierungen und Verbesserungen, einschließlich elektrischer Beleuchtung und fließendem Wasser, vornahm, bevor er es in das Schlosshotel Itter umwandelte. Trotz des Erfolgs als Hotel wurde es an den stellvertretenden Landeshauptmann von Tirol, Dr. Franz Gruner, verkauft, der es hauptsächlich als Ferienhaus nutzte.
Im Jahr 1940 wurde das Schloss erstmals von der deutschen Regierung gepachtet. Offiziell wurde es der Sitz des Deutschen Bundes zur Bekämpfung der Tabakgefahren. Hitler verabscheute die Gewohnheit des Rauchens so sehr, dass er jedem verbot, in seiner Gegenwart zu rauchen.
In den letzten Monaten des Jahres 1942 wurde Schloss Itter von der Schutzstaffel offen als Haftanstalt für so genannte Ehrenhäftlinge genutzt. Am 7. Februar 1943 wurde es auf Befehl von Reichsführer-SS, Heinrich Himmler beschlagnahmt und in ein Gefängnis umgewandelt, das speziell für prominente, vor allem französische Persönlichkeiten bestimmt war. Man hoffte, dass diese im Falle eines Friedensschlusses zwischen dem nationalsozialistischem-Deutschland und den Alliierten einen gewissen Verhandlungswert besaßen. Zu diesem Zweck wurde es offiziell zu einem Außenlager des berüchtigten Konzentrationslagers Dachau.
Die Region Tirol in Österreich war von den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs weitgehend verschont geblieben. Das Gebiet mit seinen hohen Bergen und seiner Abgeschiedenheit bot den Nazis einen natürlichen Zufluchtsort für die enormen Mengen an unrechtmäßig erworbenem Geld, Gold, Kunstwerken und religiösen Artefakten, die sie aus Banken, Kunstgalerien, Privatwohnungen und von Privatpersonen aus zahlreichen Ländern in ganz Europa geraubt hatten. Man geht davon aus, dass die Nationalsozialisten Gold, Platin und Schmuck im Wert von etwa 4,5 Milliarden Pfund in den Toplitzsee versenkt haben, einen abgelegenen See mitten in einem dichten Wald in den Alpen.
Das Gebiet wurde schließlich in der ersten Maiwoche 1945 von amerikanischen Truppen erobert. Diese US-Truppen gehörten größtenteils der 88th Infantry Division an. Am 9. Mai unterzeichnete Deutschland mit den Alliierten die Bedingungslose Kapitulation. In dieser Zeit begannen die Amerikaner, die Verstecke zu entdecken, die die deutsche Regierung und Parteigrößen benutzt hatten, um die große Anzahl gestohlener Kunstwerke zu verstecken.
Alles war darauf ausgerichtet, dass die verbliebenen deutschen Streitkräfte gegen die vorrückenden Alliierten auf Leben und Tod kämpfen würden, während sie sich in den Alpen in Verteidigungsstellungen verschanzten. Die alliierten Befehlshaber waren davon ausgegangen, dass vor allem diese hartgesottenen Waffen-SS Einheiten die so genannte „Werwolf“-Taktik anwenden würden, bei der eine Art Guerilla-Widerstandstruppe hinter den feindlichen Linien operieren und Chaos, Panik und Unsicherheit verursachen würde. Diese Taktik würde Hand in Hand mit anderen deutschen Kräften eingesetzt werden, die als defensive Frontlinie agieren würden.
Man befürchtete, dass die Deutschen die Region zusammen mit anderen Gebieten, die sich im Besitz der Nazis befanden, nutzen könnten, um ein letztes Bollwerk in den Alpen zu errichten und bis zum bitteren Ende zu kämpfen. Dazu kam es jedoch nicht - vor allem wegen der Ankündigung von Hitlers Tod in seinem Berliner Bunker. Dies wiederum führte zu einem Chaos in den schwindenden Reihen der Partei, die wussten, dass der Krieg fast zu Ende war und dass sie nicht auf der Gewinnerseite stehen würden.
Die Schlacht um Schloss Itter im Mai 1945 war zweifellos eines der ungewöhnlichsten Ereignisse des Krieges, denn es war eine von nur zwei bekannten Gelegenheiten, bei denen sich alliierte und deutsche Streitkräfte zusammenschlossen und Seite an Seite kämpften. Ob dies aus grundlegender Zurückhaltung geschah oder aus der Einsicht heraus, dass die Sieger angesichts des sich rasch dem Ende zuneigenden Krieges darauf bedacht sein würden, diejenigen zu fassen und zu bestrafen, die für die Gräueltaten während des Krieges verantwortlich waren, ist unbekannt. So oder so geschah es, und amerikanische und deutsche Soldaten kämpften mit vereinten Kräften gegen eine Einheit der Waffen-SS, die das Schloss und die dort gefangen gehaltenen, überwiegend französischen Gefangenen zurückerobern wollte. Welches Schicksal ihnen widerfahren wäre, wenn sie von der SS gefangen genommen worden wären, bleibt unklar, aber es hätte höchstwahrscheinlich die Geschichte Frankreichs verändert und wäre ein weiterer Schandfleck für die deutsche Nation auf Jahre hinaus gewesen. Unter den Gefangenen im Schloss befanden sich einige der erfahrensten politischen und militärischen Köpfe Frankreichs, von denen einige die französische Politik der Nachkriegszeit prägen sollten. Darunter waren zwei ehemalige französische Premierminister. Namentlich Édouard Daladier und Paul Reynaud, sowie die Schwester des Führers der Freien Französischen Streitkräfte, General Charles de Gaulle, Marie-Agnes Cailliau.
Haupteingang des KZ Dauchau zu dem Schloss Itter gehörte
Ein Mitglied der SS-Totenkopfverbände
Kapitel Eins Der Beginn des Endes
Das genaue Datum, an dem das Ende für das nationalsozialistische Deutschland begann, ist umstritten, aber ein Datum, das in Betracht gezogen werden sollte, ist der D-Day: Dienstag, der 6. Juni 1944, der Beginn der Landung der Alliierten in der Normandie in Nordfrankreich. Als die vollständige Invasion des von Deutschland besetzten Europas begann.
An diesem Tag landeten mehr als 150.000 amerikanische, britische, kanadische und französische Soldaten auf einem 80 Kilometer langen Abschnitt der französischen Küste im Rahmen der Operation Overlord. Dies war die größte Invasion auf dem Seeweg, die es je gegeben hat, zusammen mit fast 200.000 Marinesoldaten und 10.000 Luftstreitkräften.
Zunächst sah es nicht so aus, als würde die Invasion so verlaufen, wie es sich die Alliierten vorgestellt hatten, denn die Ziele des ersten Tages, nämlich die Verbindung aller fünf Landeköpfe und die Einnahme der Städte Carentan, Saint-Lô und Bayeux, wurden nicht erreicht. Caen, ein wichtiges Ziel, wurde erst am 21. Juli eingenommen.
Das Hauptproblem für die Wehrmacht bestand darin, dass die Generale zwar wusste, dass eine alliierte Invasion in Europa unmittelbar bevorstand, aber nicht genau wusste, wo sie stattfinden würde. Das bedeutete, dass die Wehrmacht ihre Verteidigungskräfte nicht an einem bestimmten Ort konzentrieren konnte. Stattdessen waren sie über die gesamte Länge des Atlantikwalls verteilt, der sich von der nördlichsten Spitze Norwegens bis hinunter zur Grenze zwischen Frankreich und Spanien erstreckte.
Deutschlands beste Chance, die alliierten Streitkräfte daran zu hindern, ins Landesinnere vorzudringen und in irgendeiner Form Fuß zu fassen, bestand darin, sie daran zu hindern, in nennenswerter Zahl an Land zu gehen. Wären die Alliierten an den Stränden besiegt worden und gezwungen gewesen, sich auf ihre Landungsboote zurückzuziehen und über den Ärmelkanal nach England zurückzukehren, hätte sich der Krieg noch über Jahre hinziehen können. Möglicherweise wäre es nicht zu einem alliierten Sieg und dem Ende des Dritten Reiches gekommen.
Am 18. Juni, weniger als zwei Wochen nach dem D-Day, kam es in der Normandie zu den schlimmsten Stürmen seit mehr als 40 Jahren, die zum Verlust von mehr als 800 alliierten Schiffen und zur Beschädigung großer Teile der provisorischen Mulberry-Häfen führten. Dieses Ereignis machte die Einnahme des Hafens von Cherbourg noch wichtiger.
Als die Alliierten ihre Pläne für die Landung in der Normandie aufstellten, wussten sie, dass sie einen Tiefwasserhafen wie den von Cherbourg benötigen würden, um dringend benötigte Verstärkung und Ausrüstung direkt aus den Vereinigten Staaten heranschaffen zu können. Die Kämpfe um die Eroberung des Hafens von Cherbourg dauerten bis zum 29. Juni, als die deutschen Truppen, die den Hafen verteidigten, sowie deren Hauptgarnison kapitulierten. Dies taten sie jedoch nicht bevor sie den Hafen von Cherbourg so stark beschädigten und seine Gewässer vermint hatten, dass der Hafen bis Mitte August nicht voll nutzbar war, obwohl die ersten Schiffe bereits Ende Juli einlaufen konnten.
Innerhalb von zwei Monaten hatten die alliierten Streitkräfte in Europa stärker Fuß gefasst. Sie hatten die deutsche Armee in Frankreich besiegt, und am 25. August erreichten die Alliierten Paris und befreiten es. Große Menschenmengen französischer Zivilisten säumten die Champs Elysees, um den Einzug der Alliierten in Paris zu beobachten. Es ist interessant festzustellen, wie schnell und einfach die deutschen Streitkräfte „kapituliert“ hatten, mit einem Verlust von etwa 200.000 Gefallenen oder Verwundeten und der gleichen Anzahl von Männern, die gefangen genommen wurden.
Die Alliierten stoppten jedoch nicht, nachdem Frankreich befreit worden war. Stattdessen setzten sie den Kampf fort und zwangen die Deutschen, ihren Rückzug bis in das Herz des Deutschen Reiches fortzusetzen. Im April 1945 war der Krieg so gut wie vorbei. Die Rote Armee stand vor den Toren Berlins, die Amerikaner, Briten und Franzosen im Westen, die sowjetischen Streitkräfte im Osten. Der Wettlauf war eröffnet, und es ging nur noch darum, wer zuerst in Berlin eintreffen würde. Für die Zivilbevölkerung der Stadt galt es, das kleinere Übel zu wählen. Nach der Aggression, der Brutalität und dem mangelnden Mitgefühl, das die deutschen Streitkräfte während ihres Einmarsches in „Mütterchen Russland“ im Rahmen der Operation Barbarossa gegenüber der sowjetischen Bevölkerung an den Tag gelegt hatten, war der Gedanke, was passieren könnte, wenn die sowjetischen Streitkräfte das Rennen gewinnen würden, fast unvorstellbar. Insbesondere, nachdem die Gräueltaten der Roten Armee in den eroberten deutschen Ostgebieten bekannt wurden. Die Wahrheit war jedoch, dass mit der Einnahme Berlins weder strategisch noch militärisch etwas zu gewinnen war und ein solcher Sieg lediglich Propagandazwecken diente.
Im April 1945 hatte die US 6th Army Group Österreich erreicht und wurde in der ersten Maiwoche in den Kampf um die Zurückdrängung und der Kapitulation aller deutschen Truppen in diesem Gebiet einbezogen.
Teile der US 3rd Infantry Division waren die ersten alliierten Truppen, die in Berchtesgaden eintrafen und es einnahmen, während sich die Reste der deutschen Heeresgruppe G am 5. Mai bei Haar in Bayern den US-Truppen ergaben. Die Einwohner von Berchtesgaden hatten sich daran gewöhnt, dass sich führende Mitglieder der NSDAP in der Gegend aufhielten. Adolf Hitler hatte dort ein Ferienhaus, den so genannten Berghof, der in der nahe gelegenen Region Obersalzberg in den bayerischen Alpen liegt. Etwa zur gleichen Zeit war die US 103rd Infantry Division durch Bayern nach Innsbruck vorgedrungen, wo sie in der Schlacht um Schloss Itter in Aktion treten sollte.
Auf dem Schloss waren seit dem deutschen Sieg über Frankreich im Jahr 1940 eine Reihe bekannter französischer Gefangener festgehalten worden, um sie als spätere Verhandlungsmasse für die Alliierten zu nutzen. Darunter befanden sich Politiker, zum Beispiel ehemalige Premierminister, hohe Offiziere, ein Tennisstar und die Schwester des Führers der Freien Französischen Streitkräfte, General Charles de Gaulle. Die Gefangenen befürchteten, dass Elemente der Schutzstaffel, von denen bekannt war, dass sie sich in der Gegend aufhielten, das Schloss angreifen würden, um die Gefangenen zu töten. Um einen solchen Angriff zu verhindern, schlossen sich amerikanische und Wehrmachts-Soldaten zusammen, um die französischen Gefangenen und das Schloss vor den fanatischen SS-Truppen zu schützen.
Obwohl zum Zeitpunkt der Schlacht um Schloss Itter bereits klar war, dass der Krieg bald zu Ende sein würde und die Alliierten als Sieger hervorgehen würden, entschieden sich einige deutsche Einheiten dennoch, weiterzukämpfen. Für die Deutschen Truppen, die in Süddeutschland und Österreich im Einsatz waren, gab es zumindest die Gewissheit, dass die sowjetische Bedrohung für sie etwas geringer war, da sich die Rote Armee auf die Einnahme von Berlin konzentrierten.
Um noch einmal auf die deutschen Truppen zurückzukommen, zu denen auch die Männer der 17. SS-Panzergrenadierdivision „Götz von Berlichingen“ gehörten, die an dem Angriff auf Schloss Itter teilnahmen, stellt sich natürlich die Frage nach dem Warum.
Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, mussten die Angehörigen der Streitkräfte ab 1934 einen neuen
Eid ablegen. Bis dahin waren solche „Eide“ immer auf den Schutz der Nation und die Einhaltung der Verfassung geleistet worden, aber der neue Eid wurde dahingehend geändert, dass die Eidesleistenden, zu denen auch die Mitglieder der SS- Verfügungstruppe, dem Vorgänger der spteren Waffen-SS gehörten, Adolf Hitler die Treue schworen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum sich nach Hitlers angeblichem Tod nicht einfach alle Militärangehörigen ergeben haben, denn sobald er tot war, wurde jeder ihm geschworene Treueeid null und nichtig. Eine mögliche Erklärung dafür, warum die SS-Einheiten nach der Nachricht von Hitlers Tod weiterkämpften, ist die Tatsache, dass ein Teil der Männer, die in den Waffen-SS-Einheiten dienten, keine Deutschen waren, sondern ausländische Freiwillige. Dies und die Tatsache, dass viele von ihnen befürchteten, dass man ihnen kein Pardon geben würde, wenn sie sich ergaben oder gefangen genommen wurden, ließen ihnen keine andere Wahl, als den Kampf fortzusetzen, bis sie im Kampf fielen, was ihrer Meinung nach zumindest einen ehrenvollen Tod garantierte.
Vielleicht war es Naivität, vielleicht war es Arroganz, vielleicht war es beides, aber nach Hitlers angeblichem Selbstmord übernahm sein Nachfolger, Großadmiral Karl Dönitz, die Aufgabe, eine neue provisorische deutsche Reichsregierung in der nördlichen Stadt Flensburg, die nahe der dänischen Grenze lag, zu errichten. Dönitz glaubte sogar, in der Lage zu sein, mit den Alliierten zu verhandeln, um in einem späteren Friedensvertrag günstige Bedingungen zu erhalten. Möglicherweise war er aber auch nur hoffnungsvoll, vielleicht sogar wahnhaft, denn es scheint ihm nicht in den Sinn gekommen zu sein, dass die Alliierten, die in einem kollektiven Sinne handeln, nichts Geringeres akzeptieren würden als die absolute und bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte.
Georg Bochmann, Kommandeur der SS-Truppen welche das Schloss angriffen
Kapitel Zwei Schloss Itter
Bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs war Schloss Itter im Besitz von Dr. Franz Gruner, der das Anwesen 1925 erworben hatte, als er stellvertretender Landeshauptmann von Tirol war. Aufgrund der extremen Abgeschiedenheit des Schlosses hielt er sich jedoch nicht oft dort auf.
Obwohl sich die Burg seit dem Anschluss Österreichs im März 1938 in österreichischem Besitz befand, pachtete die deutsche Regierung sie erst 1940 von Gruner. Die Verwendung des Wortes „gepachtet“ ist interessant, da es darauf hindeutet, dass Gruner in dieser Angelegenheit eine Wahl hatte. Vielleicht hatte er das, aber aus Angst vor den möglichen Konsequenzen, wenn er sich ihren Forderungen nicht beugte, ist es auch möglich, dass er sich zu seiner eigenen Sicherheit einfach mit der Vereinbarung einverstanden erklärte. Vielleicht war das, was ihm die SS im Rahmen ihrer Vereinbarung zahlte, ausreichend, um ihn gleichgültig zu machen? Was auch immer die Wahrheit ist, es ist unklar, ob er den wahren Zweck kannte, für den die Nationalsozialisten das Schloss nutzen wollten.
Während des Zweiten Weltkriegs war die Beschlagnahmung großer Privatwohnungen auf beiden Seiten gängige Praxis. In solchen Fällen war die Wehrmacht dafür bekannt, den Eigentümern einen angemessenen Preis für die entstandenen Unannehmlichkeiten zu zahlen. Die SS hingegen war nicht so sehr darauf bedacht, die vereinbarten Bedingungen der deutschen Militärpolitik einzuhalten, wenn sie nicht dazu bereit war. Stattdessen nahm sie sich einfach, was sie wollte, insbesondere wenn sie der Meinung war, dass es nicht notwendig war, gute Beziehungen zur lokalen Bevölkerung zu pflegen.
Dr. Gruner starb am 23. Januar 1941 im relativ jungen Alter von 45 Jahren und wurde auf dem Ottakringer Friedhof in Wien beigesetzt. Sein Tod kam sowohl plötzlich als auch unerwartet, aber es gibt keine Hinweise darauf, dass Himmler oder die SS in irgendeiner Weise für seinen Tod verantwortlich waren.
Reichsführer-SS Heinrich Himmler ordnete an, dass Schloss Itter am 7. Februar 1943, zwei Jahre nach Grüners Tod, beschlagnahmt werden sollte. Schließlich wollte man nicht länger für das Schloss zahlen, wenn man es sich einfach kostenlos aneignen konnte. Die einzige wirkliche Überraschung ist, warum man es nicht schon früher beschlagnahmt hat.
Es ist interessant, dass das Schloss mehr als zwei Jahre vor Kriegsende in ein Gefängnis umgewandelt wurde, um hochrangige Häftlinge unterzubringen. Ist dies ein Hinweis darauf, dass die deutsche Reichsregierung bereits 1943 daran zweifelte, den Krieg zu gewinnen?
Der Mann, der mit der Ausführung von Himmlers Anweisungen für die Burg beauftragt wurde, war SS-Obergruppenführer (General der Waffen-SS) Oswald Ludwig Pohl, der nicht nur der oberste Verwalter aller Konzentrationslager der Nazis war, sondern auch die Leitung des SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes innehatte. Nach dem Krieg gelang es Pohl zunächst, sich der Gefangennahme zu entziehen, wurde aber schließlich im Mai 1946 verhaftet, nachdem er in der Nähe von München entdeckt worden war, wo er sich als einfacher Landarbeiter versteckt hielt. Pohls Prozess, der am 8. April 1947 in Nürnberg begann und am 3. November 1947 endete, war der vierte von 13 Kriegsverbrecherprozessen, die in der deutschen Stadt stattfanden. Pohl wurde für schuldig befunden und zum Tod durch Erhängen verurteilt. Es folgten mehrere Berufungsverfahren im Namen Pohls gegen seine Verurteilung und sein Urteil, bevor es am 11. August 1948 endgültig bestätigt wurde. Trotzdem wurde er erst am 7. Juni 1951 hingerichtet, als er im Gefängnis von Landsberg am Galgen starb.
Ein Offizier des Konzentrationslagers Dachau, Hauptsturmführer Sebastian Wimmer, wurde mit der Gesamtleitung der an der Burg vorgenommenen Änderungen beauftragt. Zu seinem Glück hatten mehrere Gefangene, die im Hauptlager inhaftiert waren, vor ihrer Inhaftierung als Handwerker gearbeitet, und auf Schloss Itter konnten ihre besonderen Fähigkeiten zum Einsatz kommen. Trotz des beabsichtigten Verwendungszwecks wurden viele der Gegenstände des Schlosses, wie Möbel, Gemälde, Bücher und Silberwaren, in Kisten verpackt und zur sicheren Aufbewahrung an einen anderen Ort gebracht.
Etwas mehr als zehn Wochen nach der Anmietung des Schlosses war es vollständig von einer herrschaftlichen Residenz in ein Gefängnis umgewandelt worden, aber nicht in irgendein altes Gefängnis. Es gab keine kalten Stahltüren oder einfache Bedingungen, wie sie für den einfachen Soldaten oder diejenigen, die aus politischen Gründen in regulären Kriegsgefangenenlagern festgehalten wurden, üblich gewesen wären. Die Unterbringung im Schloss ähnelte nun eher der in einem Fünf-Sterne-Hotel, obwohl alle 19 Schlafzimmer für eine Doppelbelegung vorgesehen waren. Ein Teil des Umbaus umfasste auch Unterkünfte für die deutschen Wachen, die auf der Burg stationiert werden sollten. Der einzige von ihnen, dem ein eigenes Zimmer zugewiesen worden wäre, das über ein eigenes Bad verfügt hätte, wäre der deutsche Offizier Sebastian Wimmer gewesen, der die Gesamtleitung der Burg innehatte.
Der einzige Zweck der Beschlagnahmung der Burg bestand in der spezifischen Inhaftierung bestimmter Personen, die als Ehrenhäftlinge bezeichnet wurden und die inhaftiert und relativ komfortabel untergebracht wurden, was ihrer potenziellen Bedeutung für Deutschland entsprach. Hitler war der irrigen Ansicht, dass die Gefangenen später dazu verwendet werden könnten, bei künftigen Kapitulationsverhandlungen mit den Alliierten günstigere Bedingungen zu erzielen.
Trotz seines eigentlichen Zwecks wurde das Schloss von den Deutschen offiziell als Evakuierungslager bezeichnet und unter die operative Kontrolle des Konzentrationslagers Dachau gestellt, das etwa 145 Kilometer weiter nördlich lag und etwa 197 weitere Außenlager in ganz Nordösterreich und Süddeutschland umfasste.
In der Anfangsphase ihrer Inhaftierung auf der Burg war das Leben für die VIP-Gefangenen, so kann man sagen, äußerst gut. Sie erhielten nicht nur drei „vollwertige Mahlzeiten“ pro Tag, die sie innerhalb der Burgmauern essen konnten, wo immer sie wollten, sondern auch Alkohol, der größtenteils in Form von edlem Wein angeboten wurde, sowie eine finanzielle Zuwendung. Das Leben auf der Burg unterschied sich zweifellos stark von dem in einem „normalen“ Kriegsgefangenenlager oder einem der Konzentrationslager. Tatsächlich ist der Unterschied zwischen Schloss Itter und diesen anderen Lagern schwer zu begreifen.
Die einzige Ähnlichkeit, die zwischen Schloss Itter und dem nahe gelegenen Konzentrationslager Dachau festgestellt werden konnte, bestand darin, dass beide von bewaffneten Wachen patrouilliert wurden, die dafür sorgen sollten, dass keiner der Insassen entkam. Jeder, der in einem der beiden Lager war, lief Gefahr, erschossen zu werden, wenn er auch nur versuchte zu fliehen – ein Szenario, das jeder verstand.
Im Jahr 1944 waren die Härten des Krieges auch in Itter zu spüren. Die Beschaffung von Lebensmitteln und Brennstoffen wurde immer schwieriger, was zu einer Situation führte, die sowohl für die Gefangenen als auch für die Wachen nur als Entbehrung bezeichnet werden konnte. Akzeptierte Normen wie die Nutzung von Elektrizität im gesamten Schloss wurden zu einem unerreichbaren Luxus, und in den dunklen Stunden wurden Kerzen verwendet.
Diejenigen, die im Schloss festgehalten wurden, waren intelligente Menschen, obwohl es kein Genie erfordert hätte, um zu erkennen, dass solche Engpässe an einem prestigeträchtigen Ort wie Schloss Itter ein direktes Spiegelbild des Kriegszustands aus deutscher Sicht waren. Einige der Gefangenen interpretierten dies so, dass der Krieg eher früher als später vorbei sein würde, aber sie waren auch besorgt um ihre persönliche Sicherheit und machten sich Gedanken darüber, was die Nazi-Hierarchie mit ihnen machen würde, wenn sie den Krieg als verloren betrachteten und sie keinen Wert mehr hätten.
In vielerlei Hinsicht war die Entscheidung, Schloss Itter als Gefängnis zu nutzen, naheliegend, da es sich bereits um ein solides Bauwerk handelte, das nicht wirklich viel zusätzliche Arbeit erforderte, um sicherzustellen, dass es für die dort Inhaftierten äußerst schwierig sein würde, zu entkommen. Da viele der Schlafzimmer des Schlosses einfach als „Zellen“ ausgewiesen wurden, wurde die Umwandlung durch das Anbringen einiger zusätzlicher Schlösser, bewaffneter Wachen, Flutlichter und reichlich Stacheldraht auf den hohen Mauern des Schlosses abgeschlossen.
Der Mann, der für die neuen Bewohner des Schlosses verantwortlich war, war SS-Hauptsturmführer Sebastian Wimmer von der 3. SS-Panzerdivision „Totenkopf“. Wimmer wurde 1902 in Dingolfing, Deutschland, geboren und trat im März 1923, ein paar Monate nach seinem 21. Geburtstag, der Münchner Polizei bei. Nachdem er den Rang eines Feldwebels erreicht hatte, wurde er im Februar 1935 aus unbekannten Gründen aus der Truppe entlassen, doch innerhalb weniger Wochen hatte er sich als Führer bei der Schutzstaffel verpflichtet und fand sich im neu eröffneten Konzentrationslager Dachau wieder.
Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs diente Wimmer in der neu formierten „Totenkopf“-Division, die größtenteils aus KZ-Wachpersonal der SS-Totenkopfverbände (SS-TV oder „Totenkopf“-Formation) bestand. Die deutschen Truppen marschierten in Polen ein und beteiligten sich an der Ermordung polnischer Zivilisten, sowohl politisch als auch unpolitisch, sowie polnischer Kriegsgefangener.
Zwischen Januar und September 1942 diente er in der 2. SS-Panzerdivision „Das Reich“, die am 10. Juni 1944, nur vier Tage nach der Landung der Alliierten in der Normandie, 642 Zivilisten im französischen Dorf Oradour-sur-Glane ermordete.
Im September 1942 wechselte Wimmer zurück zur Totenkopf-Division, fand sich aber diesmal im Konzentrations- und Vernichtungslager Majdanek wieder, das ursprünglich als Zwangsarbeitslager für ausländische Arbeiter, darunter russische Kriegsgefangene, Juden und politische Gefangene verschiedener Nationalitäten, genutzt wurde. Dort war er Leiter des Schutzhaftlagers, was im Wesentlichen bedeutete, dass er die Gesamtleitung des Lagers innehatte und somit an den zahlreichen dort begangenen Gräueltaten beteiligt war. Dazu gehörten Erschießungen durch ein Erschießungskommando, Erhängungen und der Einsatz von Zyklon-B in den Gaskammern.
Nach nur sechs Monaten in Majdanek kehrte er im März 1943 als stellvertretender Schutzhaftlagerführer nach Dachau zurück, wo er bis Oktober des folgenden Jahres blieb, bevor er in das nahe gelegene Schloss Itter wechselte, um dort die Verantwortung für die Gefangenen zu übernehmen.
Wimmers Ernennung zum Kommandanten von Schloss Itter könnte man durchaus als etwas ungewöhnlich bezeichnen. Hier war ein Mann, der den Ruf hatte, gegenüber allen, die unter seiner Kontrolle standen, gleichermaßen extreme Brutalität und Grausamkeit an den Tag zu legen. Es schien ihn nicht einmal sonderlich zu kümmern, dass das Leben und Wohlergehen der Männer unter seinem Kommando auf dem Spiel stand. Die offensichtliche Frage ist, warum die deutschen Behörden einen Mann wie Wimmer mit seinem Ruf mit der Verantwortung für einige ihrer berühmtesten Kriegsgefangenen betrauten? Aus seiner Sicht muss das Leben im, vergleichsweise luxuriösem Schloss attraktiver gewesen sein, als das Leben im Konzentrationslager Dachau und die damit verbundene Entbehrungen.
Es muss einen triftigen Grund dafür gegeben haben, einen jungen Mann von nur 24 Jahren für eine solche Position zu ernennen, aber die vielen Jahrzehnte, die seither vergangen sind, haben es schwieriger gemacht, dies zu verstehen. Es ist schwer zu glauben, dass Deutschland keinen älteren, weiseren, erfahreneren und besser geeigneten Offizier für eine so wichtige Position gefunden haben soll. Vielleicht lag es an seinen mörderischen Fähigkeiten und seiner blinden Hingabe an die „größere Sache“ von Adolf Hitler und der NSDAP, dass er die Leitung übernahm? Es war durchaus möglich, dass eine Situation eintreten könnte, in der das NS-Regime, das erkannte, dass es solche „hochwertigen“ Gefangenen nicht mehr benötigte, beschloss, sie stattdessen töten zu lassen. Sollte ein solches Szenario jemals Realität werden, würde man jemanden brauchen, der die Morde ohne zu zögern ausführt. Es ist mehr als vorstellbar, dass ranghohe Nationalsozialisten glaubten, Wimmer sei dieser Mann.
Zur Bewachung der prominenten Insassen des Schlosses wurde Wimmer ein Stellvertreter, Otto Stefan, und nur 25 Wachen der SS-Totenkopfverbände zur Seite gestellt. Die Männer dieser Einheit waren für die Sicherheit innerhalb des nationalsozialistischen Konzentrationslagersystems in ganz Europa verantwortlich. Das Mützenabzeichen der SS-TV war ebenfalls der Totenkopf mit gekreuzten Knochen, aber um sich von anderen SS-Einheiten zu unterscheiden, trugen sie dasselbe Abzeichen auch am rechten Kragen ihrer Uniformen.
Historisch gesehen handelte es sich bei den Mitgliedern des SS-TV in der Regel um ältere Männer, die im Krieg hauptsächlich als Lagerwachen eingesetzt waren. Diese Rolle übernahmen sie nur zu gerne, vor allem, wenn sie dadurch nicht an tatsächlichen Kämpfen auf den Schlachtfeldern in ganz Europa teilnehmen mussten. Die Versetzung nach Schloss Itter rettete den Wachen höchstwahrscheinlich das Leben, denn als das Hauptlager des Konzentrationslagers Dachau am 29. April 1945 von der 45th Infantry Division der United States 7th Army befreit wurde, wurde eine unbekannte Anzahl der dortigen Lagerwachen von einigen der Insassen sowie von einigen der amerikanischen Soldaten, die das Lager befreiten, getötet. So schockiert und angewidert waren sie von dem, was sie entdeckt hatten. Ob die SS-TV-Wachen freiwillig oder zur Erfüllung ihrer Pflichten nach Schloss Itter abkommandiert wurden, ist unklar.
Die Einstellung der Wachen gegenüber denen, für die sie auf dem Schloss sorgen sollten, war sehr unterschiedlich, und keine Wache glich der anderen. Die menschliche Natur bringt es mit sich, dass Individuen je nach Persönlichkeit unterschiedliche Beziehungen zu Mitgliedern einer Gruppe aufbauen. Die Interaktionen zwischen den Wachen und den Gefangenen in der Burg wurden zweifellos in gewissem Maße von dem Wissen beeinflusst, dass der Krieg für Deutschland schlecht lief und dass sie durchaus auf der Verliererseite stehen könnten. Die Wachen waren sich auch sehr bewusst, wie sie mit den Gefangenen umgingen, wenn ihre Vorgesetzten in der Nähe waren, da sie genau wussten, dass sie an die Front versetzt werden könnten, wenn sie den Eindruck erweckten, zu vertraut mit ihnen zu sein, oder an einen Ort, der mit Sicherheit gefährlicher war als die Situation auf Schloss Itter.
Einer der ersten VIP-Gefangenen, die in der Burg festgehalten wurden, war Albert Lebrun, der bis Juli 1940 Präsident Frankreichs gewesen war, bevor er von Philippe Pétain abgelöst wurde. Lebrun hatte den ehemaligen italienischen Premierminister Francesco Saverio Nitti sowie den ehemaligen französischen Botschafter in Italien und Deutschland, André François-Poncet, als Gesellschaft. Ihr Aufenthalt im Schloss war nur von kurzer Dauer, und sie alle verließen das Schloss vor Kriegsende im Mai 1945.
Im Schloss waren auch mehrere Gefangene aus den besetzten osteuropäischen Ländern untergebracht, die jedoch nur als Arbeitskräfte gehalten wurden, um bei der Instandhaltung und Pflege des Schlosses zu helfen. Zwei dieser Männer, insbesondere Zvonimir Čučković, ein kroatischer Widerstandskämpfer, und Andreas Krobot, ein tschechoslowakischer Koch auf der Burg, spielten später eine wichtige Rolle in der Schlacht, wie wir an einer anderen Stelle sehen werden.
Wenn Wimmer der Befehl erteilt worden wäre, die Gefangenen zu töten, wäre es höchst unwahrscheinlich gewesen, dass er ihn ausgeführt hätte. Wie die Gefangenen, für die er nun verantwortlich war, konzentrierte er sich nun darauf, den Krieg zu überleben. Das Letzte, was er brauchte, war, für die Morde an so vielen hochrangigen Personen verantwortlich zu sein. Dies wer eine Tat, für die er ganz klar niemals ungestraft davonkommen würde. Wenn überhaupt, musste er solche Personen auf seiner Seite halten und sich bei allen Nachkriegsprozessen, in die er verwickelt werden könnte, positiv über ihn äußern. Obwohl er akademisch gesehen nicht der Hellste war, war er auch nicht so dumm, die potenziell tödliche Lage nicht zu erkennen, in der er sich befinden würde, sollte Deutschland den Krieg verlieren. Seine mörderischen und barbarischen Kriegshandlungen hätten ihn zweifellos als Vergeltung am Galgen enden lassen.
Im April 1945 erreichten eine Reihe hochrangiger deutscher Offiziere und ihre Untergebenen, einige in Begleitung ihrer Familien, die Burg, um den aus dem Osten vorrückenden sowjetischen Truppen zu entkommen. Sie blieben nie lange, denn Zeit war kostbarer als je zuvor. Die Burg bot einen bequemen Ort zum Schlafen und um ein paar Vorräte zu sammeln, bevor sie weiterzogen, entweder in Richtung Deutschland oder zu den vorrückenden amerikanischen und französischen Truppen, je nachdem, was zuerst kam.
Der einzige Mann, dessen Ankunft auf der Burg am Abend des 30. April 1945 die dort festgehaltenen Personen zweifellos beunruhigte, war SS-Obersturmbannführer (Oberstleutnant) Wilhelm Eduard Weiter, der auch der letzte Kommandant des Konzentrationslagers Dachau war. Sein Ruf eilte ihm voraus, und die auf der Burg festgehaltenen Personen hatten erfahren, dass er kurz vor seiner Abreise für die Ermordung von etwa 2.000 Insassen des Lagers verantwortlich gewesen war. Man glaubte auch, dass er für die Ermordung des deutschen Dissidenten Georg Elser am 9. April 1945 verantwortlich war. Am 8. November 1939 hatte Elser versucht, Adolf Hitler durch eine Bombe im Bürgerbräukeller in München zu ermorden. Die Bombe explodierte, tötete Hitler jedoch nicht, da er den Ort bereits verlassen hatte, bevor die Bombe hochging. Sie tötete jedoch acht weitere Menschen und verletzte 62 weitere. Der Obersturmbannführer erhielt einen Brief vom Gestapo-Chef Heinrich Müller, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass Elser getötet werden sollte und sein Tod einem alliierten Luftangriff zugeschrieben werden sollte. Der Grund für eine derart ausgeklügelte Vertuschung ist unklar, ebenso wie die Frage, warum Elser, der versucht hatte, Hitler zu töten, nach seiner Gefangennahme nicht hingerichtet wurde, sondern stattdessen mehr als fünf Jahre lang in Gefangenschaft blieb.
Obersturmbannführer Weiter war ein Rätsel. Er hatte während des Ersten Weltkriegs in der deutschen kaiserlichen Armee gedient, nachdem er sich 1909 zunächst freiwillig gemeldet hatte, und war anschließend auf dem Balkan sowie an der Ost- und Westfront im Einsatz gewesen. Er beendete den Krieg jedoch als Regimentszahlmeister. Nachdem er die Armee am Ende des Krieges verlassen hatte, trat er in die bayerische Polizei ein, wo er eine ähnliche Position wie in der Armee innehatte.
Wilhelm Eduard Weiter trat erst 1937 der NSDAP bei, da er keine wirklichen politischen Überzeugungen oder Interessen für das Nachkriegsdeutschland hatte. Es genügte ihm, den Krieg überlebt zu haben und Teil eines neuen Deutschlands zu sein. Selbst wenn er, wie viele seiner Landsleute, schwere Zeiten durchmachte, da die Wirtschaft seines einst geliebten Landes am Boden lag, arrangierte er sich mit den neuen Gegebenheiten. Nachdem er der Partei beigetreten war, wurde SS-Obergruppenführer Oswald Pohl, der Leiter des SS-Hauptamtes für Wirtschaft und Verwaltung, auf ihn aufmerksam.
Nach Weiteres Ankunft auf Schloss Itter stellten sich die dort festgehaltenen französischen VIPs natürlich die Frage, ob er gekommen war, um ihnen dieselbe Behandlung angedeihen zu lassen wie den Gefangenen in Dachau. Letztendlich mussten sie sich jedoch keine Sorgen machen. Weiter dachte zwar an den Tod, aber nur an seinen eigenen. In den frühen Morgenstunden des 2. Mai, nach einem Abend mit starkem Alkoholkonsum, erschoss sich Weiter. Eine Tat, die ihm sicherlich schwer fiel. Er zielte auf sein Herz, verfehlte es jedoch, und als er feststellte, dass er noch am Leben war, richtete er seine Waffe auf seinen Hinterkopf und drückte ein zweites Mal ab. Diesmal war er erfolgreicher und wurde sofort getötet.
Obersturmbannführer Weiters Selbstmord war etwas verblüffend, denn trotz seines, nach außen hin zur Schau gestellten, gleichmäßigen Maßes an Arroganz, Gewalt und Brutalität war er in erster Linie ein feiger Rohling, der, als er erkannte, dass der Krieg verloren war, schlicht den einfachsten Ausweg wählte. Auch wenn es mit Hilfe von reichlich Alkohol, der ihm auf seinem Weg half, geschah. Er hatte wahrscheinlich geahnt, dass er sich nach Kriegsende für seine Taten verantworten müsste, und war zu dem Schluss gekommen, dass er als Strafe für seine Kriegsverbrechen am Galgen enden würde.
Als Lagerkommandant von Dachau war er nicht nur der Mann, der die Gesamtverantwortung für den täglichen Betrieb des Lagers trug, sondern hatte buchstäblich die Macht über Leben und Tod in seinen Händen. Er fiel eher durch seine ständige Abwesenheit im Lager Dachau auf und zog es stattdessen vor, seine Schergen mit der Ausführung dessen zu beauftragen, was er als die eher banalen und funktionalen Aspekte des Lagers betrachtete. Er entfernte sich so sehr von seinen Verantwortlichkeiten, dass sich die Bedingungen für die Insassen im Laufe der Zeit dramatisch verschlechterten, obwohl dies keine Situation war, die ihm große Sorgen bereitete.
Weiters Selbstmord scheint Wimmer und seine Männer so sehr beschäftigt zu haben, dass sie das Schloss am oder um den 4. Mai 1945 verließen, weil sie um ihre eigene Sicherheit fürchteten. Diese Furcht galt insbesondere vor den Russen, wenn sie blieben. Die Hauptsorge für sie war, was ihr Schicksal sein würde, wenn sie sich auf die Seite der Amerikaner gegen ihre deutschen Landsleute, wenn auch die SS, stellen würden und dann auf der Verliererseite landen würden. Wimmer, der sich zusätzlich Sorgen um seine Frau und seinen kleinen Sohn machte, und seine Männer beschlossen, nicht zu warten, um es herauszufinden.
Eine noch beeindruckendere und mächtiger aussehende „Burg“ als die in Itter war die Festung Kufstein aus dem 13. Jahrhundert, die mit einer Höhe von 506 Metern über dem Meeresspiegel die gleichnamige Stadt, die sich unter ihr befand, buchstäblich überragte. Dies war auch die nächste Burg, in der sich Hauptsturmführer Wimmer wiederfand, diesmal jedoch als Gefangener. Die Tatsache, dass er nur wenige Wochen nach seinem Aufenthalt auf Schloss Itter gefangen genommen wurde, ist nicht so überraschend, wenn man bedenkt, dass er von seiner Frau und seinem kleinen Sohn begleitet wurde. Diese haben ihn sicherlich verlangsamt und seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Wirklich überraschend ist jedoch, dass Wimmer nach Kriegsende nie wegen Kriegsverbrechen angeklagt wurde, obwohl er in den ersten Kriegstagen an Massenmorden in Polen beteiligt war und Leiter des Schutzhaftlagers in Majdanek und stellvertretender Leiter des Schutzhaftlagers im Konzentrationslager Dachau war. Dort wurden Tausende Unschuldige, hauptsächlich jüdische Zivilisten, ermordet. Es ist unglaublich, dass er nie wegen seiner Kriegsverbrechen angeklagt wurde, und nur die französischen Behörden könnten damals die Antwort darauf geben.
Wimmer wurde bis 1949 in französischer Haft gehalten, bevor er einfach freigelassen wurde. Es gab kein Aufsehen, keinen Wirbel, nichts anderes als die Freilassung eines weiteren Mannes aus dem Gefängnis in der Nachkriegswelt, die sich selbst in dieser vergleichsweise kurzen Zeit so sehr verändert hatte. Es ist in der Tat erstaunlich, dass ein Mann wie Wimmer nie für seine zahlreichen Verbrechen vor Gericht gestellt wurde und insgesamt nur vier Jahre in Gefangenschaft verbrachte. Es gibt keine Erklärung dafür, wie und warum er so milde behandelt wurde.
Im Mai 1951 kehrte er schließlich in seine Geburtsstadt zurück und zog wieder bei seinem Vater ein, ohne seine Frau oder seinen Sohn. Es ist bekannt, dass er im folgenden Jahr Selbstmord beging, aber warum er sich das Leben nahm, ist unklar. Vielleicht lag es daran, dass er seine Familie verloren hatte, oder vielleicht lag es daran, dass er keine Macht mehr hatte, keinen Einfluss auf andere, ein Konzept, mit dem er einfach nicht zurechtkam. Während des Krieges war er ein „Jemand“, ein Mann mit der Macht zu entscheiden, ob ein Mensch lebte oder starb. Er wurde von seinesgleichen respektiert, aber von denen, die unter seiner Kontrolle oder seinem Kommando standen, gefürchtet. Als der Krieg vorbei war, wurde er zu einem „Niemand“.
Was seinen Stellvertreter auf Schloss Itter, Otto Stefan, betrifft, so wurde er in den folgenden Jahren zu einer Art Mysterium, da sowohl sein Aufenthaltsort als auch das Datum seines Todes unbekannt sind. Falls er den Krieg überlebte, wurde er nie von den Alliierten gefangen genommen und musste sich daher auch nie wegen seiner Handlungen während des Krieges vor Gericht verantworten. Es ist durchaus möglich, dass er einfach seine Identität wechselte, sich als einfacher Soldat verkleidete und sich in ihrer Mitte verlor, was durch die völlige Verwirrung unmittelbar nach Kriegsende erheblich erleichtert wurde.
Kapitel Drei Französische Gefangene auf Schloss Itter
In diesem Kapitel geht es um die Geiseln, die auf Schloss Itter festgehalten wurden, sowie um einige deutsche Offiziere, die bei den Ereignissen, die sich dort im Mai 1945 abspielten, eine herausragende Rolle spielten. Es werden auch Einzelheiten und Einblicke in die Gründe gegeben, warum die Deutschen diese Personen als potenzielle Verhandlungsmasse bei künftigen Verhandlungen mit den Alliierten angesehen haben.
Obwohl sie in einem der wahrscheinlich schönsten und komfortabelsten Kriegsgefangenenlager untergebracht waren, war die Zusammensetzung der Charaktere, die innerhalb der Burgmauern festgehalten wurden, gelinde gesagt interessant. Auch wenn die Atmosphäre sicherlich nicht so harmonisch war, wie man es eigentlich hätte erwarten können.
Ein Aspekt ihrer kollektiven Inhaftierung, den die Deutschen nicht bedacht hatten, oder wenn doch, dann war er ihnen nicht wirklich wichtig, war, dass sich nicht alle ihre französischen Gefangenen mochten oder sich überhaupt wohl fühlten, im selben Raum zu sein. Es war eine potenziell explosive Situation für sie alle.
Einige dieser Männer hatten einander politisch oder militärisch abgelöst oder die Entmachtung des jeweils anderen durchgeführt. Einige waren aktive Unterstützer des Vichy-Regimes, einer von ihnen hatte sogar eine Regierungsposition inne. Die meisten anderen waren Anhänger der Bewegung „Freies Frankreich“, die während des gesamten Krieges von General Charles de Gaulle von London aus angeführt wurde.
Zunächst einmal waren Paul Reynaud und Edouard Daladier nicht nur ehemalige Premierminister Frankreichs, sondern auch politische Erzrivalen und Feinde. Für den ehemaligen Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte, General Maxime Weygand, hatten sie persönlich und kollektiv absolut nichts übrig. Seine Verbrechen konnten, soweit es Reynaud und Daladier betraf, nicht vergessen oder vergeben werden. Weygand hatte sich im Mai 1940 nicht nur als Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte, eine Position, die er von General Maurice Gamelin übernommen hatte, dem Deutschen Reich ergeben, sondern auch zunächst mit den feindlichen Besatzungstruppen kollaboriert. Nachdem Gamelin seine Position als Oberbefehlshaber der französischen Streitkräfte an Weygand verloren hatte, war es nicht überraschend, dass er nicht gerade sein größter Freund war. Zwei weitere, die aufgrund ihrer gegensätzlichen politischen Ansichten nicht gerade einer Meinung waren, waren der Gewerkschaftsführer Léon Jouhaux und der antikommunistische Oberst François de La Roque.
Während der gesamten Zeit, die sie auf Schloss Itter verbrachten, blieben die politischen Rivalitäten und die persönliche Verbitterung zwischen den Gefangenen bestehen. Obwohl sie alle Gefangene waren, versuchten die Gruppen, einander aus dem Weg zu gehen, und aßen sogar an getrennten Tischen. Oberflächlich betrachtet schien dies sicherlich kein Rezept für gesellige Gespräche und ein langfristiges Zusammenleben zu sein, aber da keine andere Option in Sicht war, musste das Beste aus einer schlechten Situation gemacht werden.
Zu den Gefangenen auf der Burg gehörten einige der Guten und Großen der französischen Gesellschaft:
Jean Laurent Robert Borotra
Borotra war ein berühmter französischer Tennisspieler, der in den späten 1920er und frühen 1930er Jahren eine dominierende Rolle im Welttennis spielte. Er war auch Minister für Körperkultur in der Vichy-Regierung von Petain zwischen August 1940 und April 1942 und wurde im November 1942 von der Gestapo verhaftet. Er wurde zunächst im Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar inhaftiert, bevor er auf die Burg Itter gebracht wurde, wo er bis zum Kriegsende blieb.
Seine Rolle bei den anschließenden Kämpfen auf der Burg Itter war von großer Bedeutung, da er es war, der es während der Kämpfe sicher aus der Burg schaffte, um zu versuchen, alliierte Streitkräfte in unmittelbarer Nähe ausfindig zu machen und mit ihnen zur Burg zurückzukehren.
Borotra wurde am 13. August 1898 in der südwestfranzösischen Stadt Biarritz geboren, und schon in seinen frühen Schuljahren wurde deutlich, dass er intellektuell ein äußerst begabter Mensch war.
Es mag sein, dass ein Teil seiner eisernen Entschlossenheit, erfolgreich zu sein, auf den Tod seines Vaters zurückzuführen war. Als ältestes von vier Kindern war er im zarten Alter von Neun Jahren plötzlich der Mann im Haushalt. Seine ersten Gedanken galten nicht dem Ziel, ein berühmter Tennisspieler zu werden, sondern dem Ingenieurwesen, das ihn reizte und das er als seine zukünftige Karriere ansah.
Um sein Englisch zu verbessern, erhielt er 1912 die Möglichkeit, während der Sommerferien zwei Monate lang bei einer Familie in England zu leben. Während dieser Zeit wurde er zum ersten Mal mit dem Tennisspiel bekannt gemacht.
Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war Borotra noch nicht ganz 16 Jahre alt und noch zu jung, um seinem Land in der Stunde der Not zu dienen. Sobald er seinen 18. Geburtstag erreicht hatte, meldete er sich zur französischen Armee und wurde einer Artillerieeinheit zugeteilt. Er überstand den Rest des Krieges ohne verwundet oder verletzt zu werden, was insofern bemerkenswert war, als er die meiste Zeit an der französischen Front verbrachte. Somit war er nie weit entfernt von der Gefahr und der Möglichkeit eines plötzlichen und sofortigen Todes.
Borotras Militärdienst endete nicht mit dem Ende der Kämpfe. Stattdessen blieb er bis in die letzten Wochen des Jahres 1919 in der französischen Armee. In dieser Zeit spielte der Sport eine große Rolle im französischen Militärleben, und Borotra entdeckte, dass er eine natürliche sportliche Begabung hatte, insbesondere im Tennisspiel. Nach Beendigung seines Militärdienstes in der französischen Armee kehrte er zu seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Biarritz zurück. Dort verbrachte er viele Stunden damit, seine Fähigkeiten zu verbessern und mit einem seiner Brüder in seinem örtlichen Tennisclub verschiedene Tennisschläge zu üben.
Trotz seiner neu entdeckten Liebe zum Tennis kehrte Borotra zu seinem Studium zurück und erwarb einen Abschluss in Ingenieurwesen an der renommierten Ecole Polytechnique am Stadtrand von Paris. Nachdem er sich als Ingenieur qualifiziert hatte, befand er sich in einer Art Zwickmühle, da die Grand Slams des Tennis nur Amateurspielern offenstanden, ein Status, der bis 1968 bestand. Die Reisen um die ganze Welt, um an den großen Turnieren, insbesondere den Grand Slams, teilzunehmen, kosteten Geld, was oft dazu führte, dass sich weniger wohlhabende Spieler, unabhängig davon, wie gut sie waren, die Teilnahme an Turnieren außerhalb ihres eigenen Landes nicht immer leisten konnten. Es sei denn, sie verfügten über die entsprechenden finanziellen Mittel.
Borotra gewann sein erstes großes Turnier 1924 in Paris. In seiner Karriere sollte er noch eine Reihe weiterer solcher Turniere gewinnen. Dazu gehörten sein zweites French Open 1931, die Australian Open 1928 und Wimbledon 1924 und 1926. 1925 wurde er sowohl bei der französischen Meisterschaft als auch in Wimbledon Zweiter. Bei seinem einzigen Auftritt bei der US-amerikanischen Meisterschaft 1926 musste er sich seinem Landsmann René Lacoste geschlagen geben. 1929 wurde er in Frankreich zum zweiten Mal Zweiter, was bedeutet, dass er beide Niederlagen in Frankreich ebenfalls gegen René Lacoste hinnehmen musste. Er war auch 1927 und 1929 in Wimbledon Vizemeister, wobei er beide Niederlagen gegen seinen Landsmann Henri Cochet hinnehmen musste.
Bei Doppelmeisterschaften schnitt Borotra besser ab, wo er bei zwölf Teilnahmen neun Titel gewann. Er gewann die French Championship 1925, 1928, 1929, 1934 und 1936. Seine Siege 1925 und 1929 errang er mit René Lacoste, während er 1928 und 1934 an der Seite von Jacques Brugnon gewann. 1936 gewann er seinen fünften und letzten französischen Doppeltitel als Partner von Marcel Bernard. Borotra gewann auch Wimbledon 1925 mit René Lacoste und erneut 1932 und 1933 mit Jaques Brugnon, mit dem er auch die Australian Championship 1928 gewann. Seine drei Niederlagen erlitt er bei der französischen Meisterschaft 1927 mit René Lacoste, in Wimbledon 1934 mit Jacques Brugnon und bei der französischen Meisterschaft 1939, ebenfalls mit Jacques Brugnon.
Zwischen 1925 und 1934 nahm er auch an fünf gemischten Doppelmeisterschaften teil und gewann sie alle. Dabei gewann er alle vier großen Tennismeisterschaften, wobei jeder Sieg mit einem anderen Partner errungen wurde.
1925: Wimbledon. Partnerin: Suzanne Lenglen (Frankreich).
1926: United States Championship. Partnerin: Elizabeth Ryan (USA).
1927: French Championship. Partnerin: Marguerite Broquedis (Frankreich).
1928: Australian Championship. Partnerin: Daphne Akhurst (Australien).
1934: French Championship. Partnerin: Colette Rosambert (Frankreich).
Zusammen mit seinen französischen Kollegen Jacques Brugnon,
Henri Cochet und René Lacoste wurde Borotra oft als einer der „Vier Musketiere“ bezeichnet, benannt nach der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Alexandre Dumas aus dem Jahr 1921. In den 1920er und 1930er Jahren gewannen die vier Männer insgesamt 20 Grand-Slam-Einzeltitel sowie 23 Grand-Slam-Doppeltitel. Gemeinsam führten sie Frankreich zwischen 1927 und 1932 zu sechs aufeinanderfolgenden Davis-Cup-Titeln.
Nach seiner Demobilisierung im Jahr 1919 war Borotra auf der Reserveliste der französischen Armee geblieben. Als sich in ganz Europa Unruhen zusammenbrauten und ein Krieg immer wahrscheinlicher wurde, wurde er erneut aufgefordert, seinem Land in der Stunde der Not beizustehen, was er bereitwillig als Teil des 232. schweren Artillerie-Regiments der französischen Armee tat. Obwohl Borotra und die meisten seiner Männer im Mai 1940 in Sedan eine tapfere und heldenhafte Verteidigung leisteten, wurden sie schnell von deutschen Truppen umzingelt und abgeschnitten. Borotra gehörte zu den Glücklichen, denen die Flucht gelang, und obwohl er vorhatte, sich auf den Weg nach England zu machen, konnte er diese Reise aufgrund anderer Kriegsereignisse, die außerhalb seiner Kontrolle lagen, nie antreten.
Im selben Jahr, 1940, erklärte er sich bereit, Direktor der Kommission für allgemeine Bildung und Sport der neuen, von Marschall Pétain geführten Vichy-Regierung Frankreichs zu werden, kurz nachdem diese im Juni 1940 gebildet worden war. Trotzdem war er kein großer Freund der deutschen Behörden und dessen, wofür sie standen, und er scheute sich nicht, seine Ansichten und Meinungen zu verbergen. Borotras unwirsche und unbekümmerte Haltung gegenüber den deutschen Besatzern verärgerte diese sehr. Je mehr Gelegenheiten sie ihm boten, seine Zustimmung zur Zusammenarbeit von Vichy-Frankreich mit den Besatzungstruppen zu zeigen, desto mehr weigerte er sich, dies zu tun. Dazu gehörte auch, dass er sich weigerte, die Jugend Frankreichs in der Entsprechung zur deutschen Hitlerjugend zu leiten. Er entfremdete sich auch von Teilen der weiblichen Bevölkerung Frankreichs, als er ihnen die Teilnahme an Rad- und Fußballwettbewerben untersagte.
Je länger er seine Handlungen der Nichtbefolgung fortsetzte, desto wahrscheinlicher wurde seine Verhaftung. Schließlich wurde er am 22. November 1942, als er in Paris in einen Zug einsteigen wollte, von Beamten der Gestapo verhaftet und verbrachte den Rest des Krieges in Gefangenschaft, das letzte Jahr davon auf Schloss Itter
Edouard Daladier
Obwohl er bereits vor Beginn des Ersten Weltkriegs ein französischer Politiker war und obwohl er zu Beginn des Krieges bereits 30 Jahre alt war, diente Daladier in der französischen Armee und war an der Westfront im Einsatz. 1916 kämpfte er mit dem 209. französischen Infanterieregiment in Verdun, wo sein inspirierendes Verhalten dazu führte, dass er vor Ort zum Leutnant befördert wurde, nachdem er den Krieg als gewöhnlicher Wehrpflichtiger begonnen hatte. Später wurde er erneut befördert und beendete den Krieg als Hauptmann, nachdem er sowohl mit der Ehrenlegion als auch mit dem Kriegskreuz ausgezeichnet worden war. Nach Kriegsende kehrte er wieder in die Politik zurück.
Daladier war eine einschüchternde Persönlichkeit, mit einem Gesichtsausdruck, dem sich nicht viele über einen längeren Zeitraum hinweg aussetzen konnten, vor allem wegen seines kalten Blicks und seiner stählernen und verbissenen Entschlossenheit. Er war ein kräftig gebauter Mann mit breiten Schultern und einem so großen Hals, dass er oft als „Stier von Vaucluse“ bezeichnet wurde (der Name der Region im Südosten der Provence-Alpes-Côte d'Azur, die er im französischen Parlament vertrat).
Daladier trat sein Amt am 10. April 1938 an und war bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs französischer Premierminister. Dies war seine dritte und letzte Amtszeit als französischer Premierminister, nachdem er diese Position bereits zwischen dem 31. Januar und dem 26. Oktober 1933 sowie zwischen dem 30. Januar und dem 9. Februar 1934 innegehabt hatte.
Am 30. September 1938 war er mit Neville Chamberlain, Adolf Hitler und Benito Mussolini in München, als alle vier Männer das Münchner Abkommen unterzeichneten, das die Abtretung des sudetendeutschen Gebiets der Tschechoslowakei an das Deutsche Reich vorsah. Dies geschah trotz der Tatsache, dass Frankreich und die Tschechoslowakei einen Militärpakt hatten, der 1925 unterzeichnet worden war. Die Tschechoslowakei war weder zu dem Treffen in München eingeladen worden, noch war sie Unterzeichner des Abkommens. Hitler verkündete, dass das Sudetenland sein letzter Gebietsanspruch in Nordeuropa sein würde. Etwas naiv glaubten ihm sowohl Chamberlain als auch Daladier. Aber fairerweise waren die meisten europäischen Nationen froh über das Abkommen, da sie darin eine Möglichkeit sahen, den Frieden in ganz Europa zu sichern.
Daladier übte offen Kritik an Deutschland und scheute sich nicht, dies auch zu sagen. Dies wurde in einer Botschaft, die er am 29. Januar 1940 in einer Radiosendung an das französische Volk richtete, mehr als deutlich: „Für uns geht es um mehr als nur darum, den Krieg zu gewinnen. Wir werden ihn gewinnen, aber wir müssen auch einen Sieg erringen, der weitaus größer ist als der mit Waffen. In dieser Welt der Herren und Sklaven, die diese Verrückten, die in Berlin regieren, schmieden wollen, müssen wir auch die Freiheit und die Menschenwürde retten.“
Daladier blieb bis zum 21. März 1940 Premierminister, als er zurücktrat, weil Frankreich Finnland nach dem Einmarsch Russlands am 30. November 1939 nicht unterstützt hatte.
Der Mann, der Daladier als französischer Premierminister ersetzte, war Paul Reynaud, der auch einer der Gefangenen auf Schloss Itter sein sollte. Trotz seines Rücktritts als Premierminister behielt Daladier das Amt des Verteidigungsministers bis zur Niederlage der französischen Armee in der Schlacht von Sedan gegen die deutschen Streitkräfte der Heeresgruppe A, einer gewaltigen Streitmacht, die aus mehr als 45 Divisionen bestand. Bei dieser Gelegenheit hatte Daladier keine Zeit, auch sein verbleibendes Regierungsamt niederzulegen, und wurde stattdessen ersetzt, als der neue Premierminister sein Amt antrat.
Nach der Niederlage Frankreichs im Mai/Juni 1940 machte sich Daladier auf den Weg nach Französisch-Marokko, wo die französische Exilregierung tätig werden wollte. Doch wie Daladier schnell feststellen musste, sollte dies kein Zufluchtsort für ihn sein. Stattdessen wurde er verhaftet und von der Vichy-Regierung, die den südlichen Teil Frankreichs kontrollierte, wegen Hochverrats angeklagt. An der Spitze der Regierung stand Marschall Philippe Pétain, der die Entscheidung traf, mit dem nationalsozialistischen Deutschland zu kollaborieren.
Von seiner Verhaftung bis zu dem Zeitpunkt, an dem er schließlich vor Gericht erschien, um sich seinen Anklägern zu stellen, wurde Daladier in der alten französischen Militärkaserne Fort du Portalet im Aspe-Tal in den Pyrenäen festgehalten. Seine Gefangenschaft war nicht einsam, da er in Gesellschaft anderer bekannter französischer Persönlichkeiten wie Leon Blum, Paul Reynard und Maurice Gamelin war, um nur einige zu nennen.
Zwischen dem 19. Februar und dem 21. Mai 1943 war Daladier Angeklagter im Riom-Prozess. Dies war ein Versuch der Vichy-Regierung, die Führer der Dritten Französischen Republik, der französischen Regierung, die zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs an der Macht war, offiziell für die Niederlage Frankreichs gegen Deutschland verantwortlich zu machen. Dabei ging es jedoch eher um die französische Innenpolitik, da die Regierung der Dritten Französischen Republik, die 1936 an die Macht gekommen war, ein Bündnis aus linkssozialistischen und kommunistischen Parteien war.
Es hing viel von diesem Fall ab, und um ihre Strafverfolgung zu unterstützen, konnten Pétain und die Vichy-Regierung zusätzlich darauf hinweisen, dass Frankreich der ursprüngliche Angreifer gewesen war, als es am 3. September 1939 Deutschland den Krieg erklärte.
Der Fall, der sich zu einer langwierigen Angelegenheit entwickelte, verlief nicht ganz nach Plan, da die Anschuldigungen gegen die Angeklagten nicht bewiesen werden konnten und das Verfahren am 21. Mai 1943 offiziell eingestellt wurde.
Für Daladier bedeutete dies jedoch nicht die Freiheit.





























