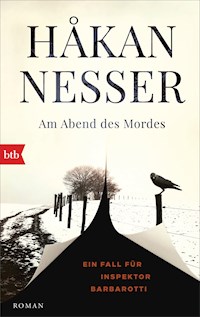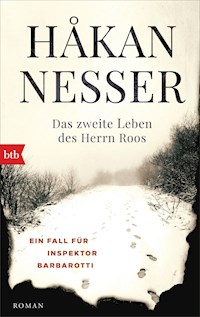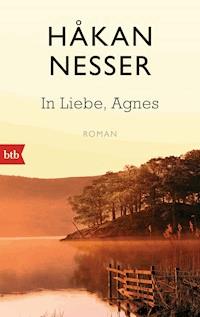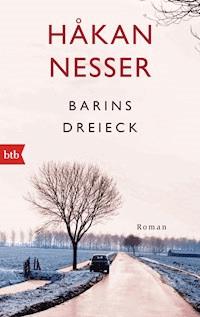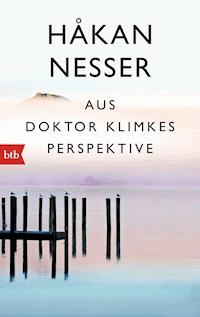9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Van-Veeteren-Krimis
- Sprache: Deutsch
Ein Priester, der von einem Zug überfahren wird. Ein Mädchen, das spurlos verschwindet. Eine Mutter, die niemand vermisst. Welche Verbindung besteht zwischen den dreien? Als Van Veeteren sein Antiquariat verlässt, um einigen mysteriösen Todesfällen nachzugehen, weiß er noch nicht, dass sein Gegenspieler ein zu allem entschlossener Serienmörder ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Håkan Nesser
Die Schwalbe, die Katze, die Rose und der Tod
Roman
Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrandt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die schwedische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Svalan, katten, rosen, döden« bei Albert Bonniers Förlag, Stockholm
Copyright © 2001 by Håkan Nesser
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2003 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Umschlaggestaltung: © Corbis/Jonathan Andrew
ISBN 978-3-89480-868-6 V004
www.goldmann-verlag.de
Kefalonia,
August 1995
1
»Im nächsten Leben möchte ich ein Olivenbaum sein.«
Sie machte eine vage Geste mit der Hand zum Abhang hin, über den die Dämmerung schnell hinabsank.
»Die können mehrere hundert Jahre alt werden, habe ich gehört. Das klingt doch beruhigend, findest du nicht?«
Hinterher würde ihm immer mal wieder einfallen, dass das ihre letzten Worte waren. Über den Olivenbaum und das beruhigende Gefühl. Es war sonderbar. Als trüge sie irgendetwas Großes, Sublimes mit sich auf die andere Seite. Etwas Erhabenes, die Spur einer Art Einsicht, an der es ihr eigentlich mangelte.
Gleichzeitig erschien es ihm natürlich auch etwas eigentümlich, dass sie eine so allgemeine – und eigentlich ja ziemlich nichts sagende – Reflexion machte, direkt nach diesen schrecklichen Worten, die ihr Schicksal so definitiv besiegelten. Die ihr Leben beendeten und ihrer Beziehung ihre letztendliche Bestimmung verliehen.
»Ich liebe einen anderen.«
Natürlich wäre es ihr nie in den Sinn gekommen, dass es sich in dieser Art und Weise entwickeln würde. Dass gerade das der Ausweg war – wahrscheinlich nicht vor den letzten Sekunden –, aber irgendwie war es auch bezeichnend, sowohl für ihre Ahnungslosigkeit als auch insgesamt für ihre Beziehung. Es war oft vorgekommen, dass sie die Reichweite von Dingen und Geschehnissen erst begriff, nachdem es schon zu spät war. In einem Stadium, in dem es keinen Sinn mehr hatte und in dem auch Worte – das Reden überhaupt – schon verbraucht waren. In dem nur noch die nackte Handlung übrig blieb – so hatte er schon früher gedacht.
»Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich weiß, dass ich dir damit weh tue, aber wir müssen ab jetzt getrennte Wege gehen. Ich liebe einen anderen.«
Danach Schweigen.
Dann das mit dem Olivenbaum.
Er gab keine Antwort. Hatte sie erwartet, dass er antworten würde?
Es war keine Frage gewesen, die sie da gestellt hatte. Nur eine Feststellung. Ein fait accompli. Was zum Teufel hätte er darauf sagen sollen?
Der Balkon war nicht groß. Sechs, acht Quadratmeter. Ein kleiner weißer Tisch mit zwei Stühlen, die wie alle anderen Plastikstühle und alle anderen Plastiktische auf der ganzen Welt aussahen. Und das Gleiche traf auf das Hotel zu. Nur zwei Stockwerke, kein Speisesaal, kaum etwas, was als Rezeption zu bezeichnen war, sie hatten die Reise last minute gebucht und keine großen Ansprüche gestellt.
Olympos. Ein paar Minuten Fußweg vom Strand, die Wirtin hatte einen Bart, und die Anzahl der Zimmer betrug wohl so ein Dutzend, vermutlich weniger.
Ihr kunterbuntes Badelaken hing zum Trocknen über dem Geländer. Jeder mit einem Glas Ouzo, nicht mehr als ein halber Meter zwischen ihnen, sie frisch geduscht, braun gebrannt und erfrischt nach einem ganzen Nachmittag am Strand.
Ein Duft von Thymian vom Berghang in unheiliger Allianz mit dem verbleiten Benzin von der Durchgangsstraße unten. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen.
Das und diese Worte.
Plötzlich erklingt ein Ton in seinem Kopf.
Leise und fern, aber äußerst hartnäckig. Er tobt wie ein kleines Rinnsal zwischen den Zikaden, die nach einem heißen Tag müde zirpen. Es hört sich an, als wären es mehrere hundert, obwohl es vermutlich nur zwei oder drei sind. Er steht auf. Kippt den Ouzo im Stehen, holt ein paarmal tief Luft.
Stellt sich hinter sie, schiebt ihr Haar zur Seite, legt ihr die Hände auf die nackten Schultern.
Sie erstarrt. Es ist eine fast unmerkliche Spannung nur einiger Muskeln, aber er merkt es sofort. Seine Fingerspitzen auf ihrer warmen Haut sind empfindlich wie kleine Seismographen. Er tastet nach den spitzen Rändern ihres Schlüsselbeins. Fühlt ihren Puls schlagen. Sie sagt nichts. Ihre linke Hand lässt das Glas auf dem Tisch los. Dann sitzt sie ganz still. Als wartete sie.
Er schiebt die Hände höher, um ihren Hals. Spürt, dass er eine Erektion bekommt.
Ein Motorrad mit hörbar kaputtem Auspuff knattert unten auf der Straße vorbei. Das Blut strömt ein, in die Hände und in den Unterleib.
Jetzt, denkt er. Jetzt.
Anfangs ähnelt ihr Kampf einer Art Orgasmus, er registriert diese Ähnlichkeit bereits, während es noch abläuft. Ein Orgasmus?, denkt er. Wie paradox. Ihr Körper spannt sich in einem Bogen zwischen den nackten Fußsohlen auf dem Boden und seinen Händen um ihrer Kehle. Der Plastikstuhl kippt, mit der linken Hand schlägt sie das Ouzoglas um, es fällt nach hinten und landet auf seinen Badeschuhen, rollt weiter, ohne kaputt zu gehen. Sie packt seine Handgelenke, ihre dünnen Finger umklammern sie, bis ihre Knöchel weiß hervortreten, aber er ist der Stärkere. Der unendlich viel Stärkere. Das Motorrad knattert weiter das schmale Asphaltband zwischen den Olivenhainen entlang, ist offenbar vom Hauptweg abgebogen. Er drückt noch fester zu, der Ton in seinem Kopf hält an und die Erektion auch.
Es dauert nicht länger als vierzig, fünfzig Sekunden, aber der Augenblick erscheint lang. Er denkt an nichts Spezielles, und als ihr Körper schließlich erschlafft, wechselt er seinen Griff, hält aber den Druck aufrecht, geht in die Knie und beugt sich von hinten über sie. Ihre Augen stehen weit offen, die Ränder der Kontaktlinsen sind deutlich erkennbar, die Zunge ragt ein wenig zwischen den ebenmäßigen weißen Zähnen hervor. Er überlegt kurz, was er denn mit dem Geschenk machen soll, das er für sie zum Geburtstag gekauft hat. Die afrikanische Holzfigur, die er am Vormittag auf dem Markt von Argostoli erstanden hat. Eine Antilope im Sprung. Vielleicht kann er sie ja behalten.
Vielleicht wird er sie auch wegwerfen.
Er überlegt, wie er die restlichen Tage verbringen wird, während er langsam seinen Griff lockert und sich aufrichtet. Ihr kurzes Kleid ist hochgerutscht und gibt den Blick auf den winzigen weißen Slip frei. Er betrachtet ihr dunkles Dreieck, das durch die dünne Baumwolle hindurchschimmert, und streicht über sein steinhartes Glied.
Steht auf. Geht zur Toilette und onaniert. Soweit er überhaupt etwas empfinden kann, ist es ein sonderbares Gefühl.
Sonderbar und ein wenig leer.
Während er auf den rechten Moment wartet, liegt er im Dunkeln auf dem Hotelbett und raucht.
Raucht und denkt an seine Mutter. An ihre unleugbare Sanftheit und dieses eigentümliche Vakuum von Freiheit, das sie hinterlassen hat. Seine Freiheit. Seit ihrem Tod im Winter gibt es plötzlich nicht mehr ihren Blick in seinem Rücken. Niemand sieht ihn mehr ganz und gar, niemand ruft einmal die Woche an, um sich zu erkundigen, wie es ihm geht.
Niemand, dem eine Ansichtskarte geschrieben werden muss, und niemand, dem er Rechenschaft ablegen kann.
Wäre sie noch am Leben, wäre diese Tat kaum denkbar gewesen, dessen ist er sich vollkommen sicher. Nicht in dieser Art. Aber nachdem die Blutsbande zerschnitten sind, ist vieles einfacher geworden. Im Guten wie im Bösen, so ist es nun einmal.
Einfacher, aber auch ein wenig sinnloser. Es gibt keine richtige Schwere mehr in ihm, keinen Kern – immer wieder sind ihm diese Gedanken in dem vergangenen halben Jahr gekommen. Mehrere Male. Plötzlich hat das Leben seine Dichte verloren. Und jetzt liegt er auf einem Hotelbett auf einer griechischen Insel und raucht und sieht ihr sanftes und gleichzeitig strenges Gesicht vor sich, während seine Ehefrau tot auf dem Balkon liegt und erkaltet. Er hat sie an die Wand gelehnt und eine Decke über sie gelegt, und er ist sich nicht sicher, ob seine Mutter nicht auf irgendeine unergründliche Weise – in irgendeinem verflucht unerforschten Sinne – weiß, was sich an diesem Abend hier ereignet hat. Trotz allem.
Es irritiert ihn ein wenig, dass er diese Frage nicht für sich beantworten kann – und auch nicht sagen kann, wie sie sich zu dem, was er an diesem warmen Mittelmeerabend gemacht hat, stellen würde –, und nach der zehnten oder auch elften Zigarette steht er auf.
Es ist erst halb eins. In den Bars und Discotheken herrscht immer noch Hochbetrieb, es ist gar nicht daran zu denken, den Körper jetzt schon fortzuschaffen. Noch lange nicht. Er tritt auf den Balkon und bleibt dort eine Weile mit den Händen auf dem Geländer stehen, während er überlegt, wie er es anstellen soll. Es ist keine einfache Aufgabe, einen Körper unbemerkt aus dem Hotel zu schaffen – sei es auch noch so klein und abgelegen, sei es auch ganz dunkel –, aber er ist es gewohnt, schwere Aufgaben anzupacken. Oft können sie ihn sogar stimulieren, ihm ein leicht berauschtes Lebensgefühl bereiten und diese verlorene Dichte wieder holen. Sicher hat er es auch deshalb in seinem Beruf so weit gebracht. Er hat schon früher darüber nachgedacht, in einer Art immer wiederkehrender Reflexion. Die Herausforderung. Das Spiel. Die Dichte.
Er saugt den Duft des Olivenhains bewusst mit den Nasenflügeln ein, versucht die Olivenbäume wahrzunehmen, als wären sie die ersten – oder die ältesten – der Welt, aber es nützt nichts. Ihre letzten Worte stehen im Weg, und die Zigaretten haben seinen Geruchssinn reichlich abgestumpft.
Er geht nach drinnen, holt das Päckchen vom Nachttisch und zündet sich noch eine an. Setzt sich dann draußen auf den weißen Plastikstuhl und überlegt, dass sie es trotzdem geschafft haben, fast acht Jahre verheiratet zu sein. Das ist ein Fünftel seines Lebens und bedeutend länger, als seine Mutter vorhergesagt hatte, als er ihr damals erzählte, dass er eine Frau gefunden hatte, mit der es wohl ernst werden würde. Bedeutend länger.
Obwohl sie ihre Meinung niemals so explizit geäußert hat.
Als er auch diese Zigarette aufgeraucht hat, hebt er seine tote Ehefrau hoch und trägt sie ins Zimmer. Legt sie quer über das Doppelbett, zieht ihr T-Shirt und Slip aus, bekommt kurz eine Erektion, aber kümmert sich nicht darum.
Ein Glück, dass sie so leicht ist, denkt er. Wiegt ja fast nichts. Hebt sie wieder hoch, legt sie sich über die Schulter. Wie er sie wohl tragen muss? Er hat nur eine dunkle Vorstellung davon, wie der rigor mortis eigentlich funktioniert, und als er sie wieder aufs Bett kippt, lässt er sie in der gebogenen Form liegen, die sie auf seiner kräftigen Schulter eingenommen hat.
Falls sie erstarren sollte.
Dann holt er das Zelt aus der Garderobe, das leichte Nylonzelt, das er unbedingt hatte mitnehmen wollen, und wickelt es um den Körper. Verknotet es mit den vielen Nylonleinen und stellt fest, dass es richtig adrett aussieht.
Könnte ein Teppich oder so etwas sein.
Ein Riesendolman.
Aber es ist seine Ehefrau. Nackt, tot und hübsch verpackt in ein Zweimann-Zelt der Marke Exploor. So ist es und nicht anders.
Um halb drei Uhr nachts wacht er nach einem kurzen Schlummer auf. Das Hotel scheint in einen dumpfen Nachtschlaf gesunken zu sein, aber immer noch ist der Lärm des Nachtlebens von der Straße und zum Strand hin zu hören. Er beschließt, noch eine Stunde zu warten.
Genau sechzig Minuten. Trinkt Kaffee, um sich wach zu halten. Die Nacht erscheint ihm wie ein Verbündeter.
Das Mietauto ist ein Ford Fiesta, keines der allerkleinsten Modelle, und sie hat reichlich Platz im Kofferraum, zusammengefaltet, wie sie ist. Er öffnet die Haube mit der rechten Hand und lässt sie von der linken Schulter hineinrutschen, indem er sich ein wenig vor und zur Seite beugt. Schließt die Kofferhaube, schaut sich um und setzt sich hinters Steuer. Das ging glatt, denkt er. Nicht ein Mensch zu sehen.
Nicht im Hotel und nicht draußen auf der Straße. Er lässt den Motor an und fährt los. Auf seinem Weg aus der Stadt heraus sieht er drei Lebewesen. Ein mageres Katzengerippe, das sich an einer Häuserwand entlangschleicht, und einen Straßenfeger mit seinem Esel. Keiner von ihnen nimmt auch nur Notiz von ihm. Ganz einfach, denkt er. Zu sterben ist eine ganz einfache Sache. Er hat das theoretisch sein ganzes Leben lang gewusst, jetzt hat er die Theorie in die Praxis umgesetzt. Genau das macht den Sinn des Lebens aus. Es war ihm seit langem klar. Denn die Handlung des Menschen, das ist Gottes Gedanke.
Auch an die Schlucht hatte er schon lange gedacht, aber ihr Bild verschwimmt in seiner Erinnerung, und so ist er gezwungen, das erste rosa Licht der Morgendämmerung abzuwarten, um den richtigen Ort zu finden. Vor zwei Tagen sind sie auf dem Weg über den Berg von Sami und die Ostseite hier vorbeigekommen, er erinnert sich daran, dass sie anhalten wollte, um genau dieses Fleckchen zu fotografieren, er erinnert sich daran, dass er ihr nachgegeben, sie aber Probleme gehabt hatte, die richtige Kameraeinstellung zu finden.
Jetzt stehen sie wieder hier. Eigentlich handelt es sich eher um einen Felsspalt, es ist kaum als Schlucht zu bezeichnen. Ein tiefer Felseinschnitt in einer Haarnadelkurve, dreißig, vierzig Meter geht es fast senkrecht nach unten – der Grund verliert sich in einem Wirrwarr dorniger Büsche und Müll, der von weniger rücksichtsvollen Autofahrern aus heruntergekurbelten Seitenfenstern hinausgeworfen wurde.
Er stellt den Motor ab und steigt aus. Schaut sich um. Horcht. Es ist zehn Minuten nach fünf. Ein früher Raubvogel steht absolut unbeweglich über dem kargen Berghang im Südwesten. Ganz unten in dem V zwischen zwei anderen steinigen Abhängen kann er eine Handbreit Meer sehen.
Ansonsten Schweigen. Und ein deutlicher Duft von Kräutern, die er kennt, aber nicht benennen kann. Oregano oder Thymian vermutlich. Oder Basilikum. Er öffnet den Kofferraum. Überlegt einen Augenblick lang, ob er sie aus der Zeltplane befreien soll, lässt es dann aber. Niemand wird jemals den Körper dort unten finden, und niemand wird von ihm Rechenschaft bezüglich eines Zelts fordern. Er hat das Auto noch zwei Tage und kann sich eine Fahrt zur anderen Seite gönnen. Sich der Stangen, Schnüre und Hülle in einem anderen Felsspalt entledigen. Oder im Meer.
Nichts liegt näher auf der Hand. Nichts.
Er schaut sich noch einmal um. Hebt das große Paket und wirft es über das niedrige Geländer. Es stößt ein paarmal gegen die steilen Wände, bricht durch die trockenen Büsche und verschwindet. Der Raubvogel scheint auf die Geräusche zu reagieren und sucht sich eine neue Position, ein Stück weiter im Westen.
Er richtet sich auf. Schwer, sich vorzustellen, dass sie das wirklich ist, denkt er. Schwer, bei dem hier wirklich anwesend zu sein.
Zündet sich eine Zigarette an. Er hat in dieser Nacht so viel geraucht, dass ihm schon die Brust weh tut, aber das ist von untergeordneter Bedeutung. Er steigt ins Auto und setzt seinen Weg den Berg hinauf fort.
Zwölf Stunden später – während der heißesten Stunde der Siesta – schiebt er die Glastür des mit Klimaanlage versehenen Büros de Reiseveranstalters auf dem großen Marktplatz von Argostoli auf. Sitzt geduldig auf dem klebrigen Plastikstuhl und wartet, während zwei übergewichtige und sonnenverbrannte Frauen der blonden Dame im blauen Kostüm hinter dem Tresen die Mängel ihres Hotels schildern.
Als er mit der Blonden allein ist, setzt er mit seiner verzweifeltsten Stimme an und erklärt ihr das mit seiner Ehefrau.
Dass er sie verloren habe.
Dass sie verschwunden zu sein scheint. Wie vom Erdboden verschluckt.
Seit gestern am späten Abend, sie wollte noch einmal schnell schwimmen gehen, natürlich könnte es eine ganz natürliche Erklärung dafür geben, aber es beunruhige ihn doch. Sie war noch nie so lange und ohne Bescheid zu geben fort.
Da sollte man doch etwas unternehmen?
Sich bei irgendwelchen Behörden erkundigen?
Oder den Krankenhäusern?
Oder was tue man in so einem Fall?
Die Dame bietet ihm ein Glas Wasser an und schüttelt besorgt ihr nordisches Haar. Sie kommt nicht aus seinem Land, aber sie verstehen sich dennoch gut. Müssen nicht einmal Englisch miteinander reden. Als sie sich zur Seite nach dem Telefon beugt, kann er eine ihrer Brüste bis zur Brustwarze hinunter sehen, und ein plötzlicher, ziehender Schmerz durchfährt ihn.
Und während sie vergeblich versucht, während dieser heißesten Stunde des Tages jemanden am Telefon zu erreichen, überlegt er, wer der andere, von dem seine Ehefrau geredet hatte, wohl sein könnte.
Derjenige, von dem sie behauptete, ihn zu lieben.
Maardam,
August bis September 2000
2
Typisch, dachte Monica Kammerle, als sie den Hörer aufgelegt hatte. So verdammt typisch. Ich hasse sie.
Sofort holte sie das schlechte Gewissen ein. Wie üblich. Sobald sie einen negativen Gedanken über ihre Mutter dachte, war es zur Stelle und brachte sie dazu, sich zu schämen. Das Gewissen. Diese innere, vorwurfsvolle Stimme, die ihr sagte, dass man nicht schlecht über seine Mutter denken durfte. Dass man eine gute Tochter sein und stützen statt umstürzen musste.
Einander stützen statt einander umstürzen, wie sie einmal vor vielen Jahren in einer Mädchenzeitschrift gelesen hatte. Zu der Zeit war ihr das so weise erschienen, dass sie es ausgeschnitten und mit Nadeln über ihrem Bett befestigt hatte, als sie noch in der Palitzerlaan wohnten.
Inzwischen wohnten sie in der Moerckstraat. Die Vierzimmerwohnung im Deijkstraaviertel – mit hohen Decken und Blick über den Park, den Kanal und das grünspanbedeckte Dach der Czekarkirche – war zu teuer geworden, als sie nur noch zu zweit waren. Dennoch hatten sie noch fast drei Jahre lang nach dem Tod ihres Vaters dort gewohnt; aber zum Schluss war das Geld, das er hinterlassen hatte, unwiderruflich aufgebraucht. Natürlich. Sie hatte die ganze Zeit gewusst, dass sie umziehen mussten, da brauchte sie sich gar nichts vorzumachen. Früher oder später, es hatte nie eine Alternative gegeben. Ihre Mutter hatte es ihr ein oder zwei Mal sehr eingehend und auf ungewöhnlich einfühlsame Weise erklärt, und im Frühling waren sie hierher gezogen.
In die Moerckstraat.
Es gefiel ihr nicht.
Nicht der Name der Straße, der dunkle Straße bedeutete. Nicht das düstere Wohnhaus aus braunen Ziegeln mit drei niedrigen Etagen. Nicht ihr Zimmer, nicht die Wohnung, nicht das sterile Viertel mit den schnurgeraden, engen Gassen, den schmutzigen Autos und Geschäften und keinem einzigen Baum.
Ich bin sechzehn Jahre alt, überlegte sie. Das Gymnasium dauert noch drei Jahre, dann ziehe ich hier aus. Dann würde sie es allein schaffen.
Wieder meldete sich das schlechte Gewissen, und sie blieb eine Weile am Telefon stehen, bis die Gewissensbisse abebbten. Schaute über den Rand der Gardine aus dem Fenster und betrachtete die haargenau gleiche schmutzigbraune Fassade auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die schmalen dunklen Fenster, die elf von zwölf Stunden im Schatten lagen, selbst an einem ziemlich sonnigen Tag wie heute.
Die Menschen können einem Leid tun, dachte sie plötzlich. Nicht nur Mama und ich, sondern alle zusammen. Jeder Einzelne. Aber es wurde nichts besser durch diese Einsicht.
Es gefiel ihr, derartige kleine philosophische Gedanken über das Leben zu formulieren. Sie schrieb sie nicht nieder, behielt sie nur eine Weile im Kopf und dachte darüber nach. Vielleicht, dass sie dadurch eine Art Gemeinsamkeit mit anderen herstellen konnte. Eine Art finsteres Zusammengehörigkeitsgefühl.
Dass sie doch nicht so anders war, trotz allem. Dass das Leben eben so aussah.
Dass ihre Mutter genau wie die Mütter anderer sechzehnjähriger Mädchen war und die Einsamkeit für alle und jeden gleich groß.
Und natürlich konnte ihre Mutter irgendwann einmal gesund werden – auch wenn diese dicke Psychologenfrau kaum so tat, als würde sie an eine derartige Entwicklung glauben. Eher versuchte man, die Entwicklung mit Hilfe von Medikamenten im Griff und unter Kontrolle zu halten. Besser, sich nicht zu viel zu erhoffen. Besser, nur maßvoll zu leben.
Manisch-depressiv. So hieß es. Und von verantwortungsbewusster Medikamentierung hatte sie gesprochen.
Monica Kammerle seufzte. Zuckte mit den Schultern und zog das Kochrezept aus dem Ordner.
Hähnchen in Orange mit Reis und Brokkolisoße.
Die Hähnchenteile waren bereits eingekauft und lagen im Kühlschrank. Den Rest musste sie noch bei Rijkman’s besorgen. Reis, Gewürze, Apfelsinen, Salat. Eissorbet als Dessert… Sie hatte alles aufgeschrieben, und ihre Mutter hatte sie gezwungen, ihr die ganze Liste noch einmal am Telefon vorzulesen.
Manisch, dachte sie. Ein sicheres Zeichen dafür, dass sie sich auf dem Weg in die manische Phase befand. Deshalb hatte sie wahrscheinlich auch den Zug verpasst. War am Grab in Herzenhoeg gewesen und dort zu lange geblieben, es war nicht das erste Mal.
Aber die Verspätung und die Menüfrage waren kein Problem. Nicht für ihre Mutter, oh nein, es gab so gut wie kein Problem für sie, wenn sie sich in dieser Phase befand. Eine kurze, aufbrausende Phase, sie dauerte selten länger als ein paar Wochen. Es gab so gut wie keine Grenzen, für nichts sozusagen.
Und ihre Medikamente lagen sicher daheim im Badezimmerschrank. Wie üblich. Monica musste das nicht einmal überprüfen, um es zu wissen.
Wäre es nicht besser, das Essen abzusagen?, hatte sie vorsichtig vorgeschlagen. Er wollte schließlich um acht Uhr kommen, dann hätte er doch keine Lust, bis halb zwölf auf sie zu warten.
Aber ihre Mutter erklärte, dass er das doch hatte, das waren Dinge, von denen sich eine naive Sechzehnjährige keinen Begriff machte. Sie hatte alles schon mit ihm besprochen, als er sie von seinem Handy aus anrief. Könnte sie bitte zusehen, eine gute Tochter zu sein, und tun, worum ihre Mutter sie bat?
Monica riss den Notizzettel vom Block und holte sich Geld aus der Haushaltskasse. Sah, dass es schon halb sechs war, und wusste, dass sie sich beeilen musste, wenn sie den Liebhaber ihrer Mutter nicht enttäuschen wollte.
Liebhaber?, dachte sie, während sie ihren Einkaufswagen zwischen den Regalen entlangschob und versuchte, alles zu finden. Das Wort gefiel ihr nicht, aber ihre Mutter nannte ihn so.
Mein Liebhaber.
Monica gefiel der Mann besser als die Bezeichnung. Sehr viel besser. Endlich einmal.
Wenn es dieses Mal doch klappen würde, fantasierte sie. Wenn es wahr würde und die beiden beschlössen, es wirklich miteinander zu versuchen.
Aber das erschien ihr äußerst unwahrscheinlich. Soweit sie wusste, hatten die beiden sich erst ein paar Mal gesehen, und die meisten sprangen nach dem dritten oder vierten Treffen ab.
Dennoch erlaubte sie sich die kindliche Hoffnung, dass er bei ihnen bleiben könnte, und sie versuchte, sich sein Bild vor ihrem inneren Auge zu vergegenwärtigen. Ziemlich groß und kräftig. Wahrscheinlich so um die Vierzig. Mit grau melierten Schläfen und warmen Augen, die ein wenig an die ihres Vaters erinnerten.
Und dann hatte er eine nette Stimme, das war vielleicht das Wichtigste. Ja, wenn sie darüber nachdachte, dann war klar, dass sie die Menschen fast immer danach beurteilte.
Nach ihrer Stimme. Und nach dem Handschlag. Dabei konnte man nicht lügen, wahrscheinlich hatte sie so etwas einmal vor langer, langer Zeit in irgendeiner Mädchenzeitschrift gelesen, aber das spielte keine Rolle. Es stimmte, das war die Hauptsache. Man konnte mit so vielem anderen lügen: mit den Lippen, den Augen und den Gesten.
Aber nie mit der Stimme und der Art, wie man jemandem die Hand gab.
Und was ihn betraf, so harmonierten diese beiden Charakterzüge auch noch außergewöhnlich gut: eine ruhige, dunkle Stimme, durch die die Worte ihr richtiges Gewicht bekamen – und eine Hand, die groß und warm war und weder zu hart zudrückte, noch das Gefühl hinterließ, sie wolle sich lieber zurückziehen. Es war fast ein Genuss, ihm die Hand zu geben.
Sie lachte leise über sich selbst und richtete dann ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Einkaufsliste. Was für ein Menschenkenner man doch ist, dachte sie. Schließlich habe ich ihn alles in allem nicht viel mehr als zehn Minuten lang gesehen. Ich sollte Psychologin oder so was werden.
Während sie das Essen zubereitete, grübelte sie wie üblich über die EINSAMKEIT nach. Mit großen Buchstaben, so sah sie es oft vor sich geschrieben. Wahrscheinlich, um dem Wort noch mehr Würde zu verleihen.
Ob es möglich wäre, sie zu durchbrechen, nachdem sie jetzt in einer neuen Klasse im Gymnasium angefangen hatte, oder ob es wieder genau das Gleiche werden würde. Die EINSAMKEIT, ihr einziger treuer Begleiter.
Ob sie sich wohl auch weiterhin nie trauen würde, Freunde mit nach Hause zu bringen. Mit einer Mutter, die ihre Tochter und sich selbst unmöglich machte, sobald ein fremder Mensch über die Türschwelle trat.
Oder jedenfalls die Gefahr dafür bot. Die mitten am helllichten Nachmittag unter einer Decke auf dem Sofa im Wohnzimmer liegen konnte – mit einem Fleischmesser und einer Schachtel Schlaftabletten neben sich, lauthals fordernd, ihre Tochter solle ihr dabei helfen, sich das Leben zu nehmen.
Oder die in halb totem Zustand in ihrer eigenen Kotze in der Badewanne schwamm, zwei leere Weinflaschen vor sich auf dem Boden.
Oder die aufgekratzt wie sonst was den zwölfjährigen Mädchen zeigen wollte, wie man auf die effektivste Art onanierte. Da die Sexualkunde in den Schulen ja sowieso nichts tauge.
Nein, dachte sie. Nein, nicht länger als drei Jahre, ich darf nicht auch so werden.
Und die Männer. Kerle, die kamen und gingen, jedes Mal während der manischen Wochen im Herbst und im Frühjahr, einer schlimmer als der andere und nie jemand, der öfter als drei oder vier Mal kam. Wie gesagt.
Abgesehen von Henry Schitt – der behauptete, Schriftsteller zu sein und vier Wochen lang den ganzen Tag über Haschisch auf der Toilette oder draußen auf dem Balkon rauchte, bis sie all ihren Mut zusammennahm und Tante Barbara in Chadow anrief.
Tante Barbara hatte natürlich nicht persönlich eingegriffen, das tat sie nie. Aber sie hatte dafür gesorgt, dass zwei Sozialarbeiter kamen und Henry rauswarfen. Und dass ihre Schwester für ein paar Stunden ärztliche Betreuung bekam.
Und eine neue Dosierung an Medikamenten.
Das war im Frühling vor anderthalb Jahren gewesen, und es war schon möglich, dass es danach etwas besser geworden war. Zumindest solange die Medizin nicht unangerührt im Badezimmerschrank stand, nur weil ihre Mutter sich viel zu gesund fühlte, um sie noch länger zu nehmen.
Und jetzt dieser Benjamin Kerran.
Wenn sie an ihn dachte, dachte sie auch, dass es das erste Mal während all dieser Jahre war, dass sie nicht den Schrei nach ihrem Vater in ihrer Brust hörte. Diesen verzweifelten Schrei aus einem verzweifelten Körper.
Benjamin? Das Einzige, was sie eigentlich an ihm auszusetzen hatte, war der Name. Er war viel zu groß, um Benjamin zu heißen. Und kräftig und warm und lebendig. Ein Benjamin, das sollte so ein kleiner Schmächtiger sein mit schmutziger Brille und einem Gesicht voller Pickel und Mitesser. Und schlechtem Atem, genau wie der Benjamin Kuhnpomp, mit dem sie ein Jahr lang in die gleiche Klasse gegangen war, in der Fünften, und der danach wohl zum Urbild für alle Benjamine auf der ganzen Welt geworden war.
Jetzt stand sie also hier und machte das Essen für einen ganz anderen Benjamin.
Einen, der der Liebhaber ihrer Mutter war und der gern bei ihnen bleiben durfte, solange er wollte.
Was Monica betraf, so würde sie jedenfalls alles tun, um ihn nicht abzuschrecken, die Sache war klar, das versprach sie sich selbst. Sie kontrollierte die Temperatur und schob die Form mit den Hähnchenteilen in den Ofen. Es war noch nicht halb acht, wenn sie sich nicht die Haare wusch, würde sie es schaffen, noch zu duschen, bevor er kam.
»Du musst doch nicht hier sitzen und einen alten Kerl unterhalten, nur weil deine Mutter sich verspätet hat. Lass dich nicht von deinen Plänen abhalten.«
Sie lachte und kratzte den letzten heruntergelaufenen Sorbetklecks von ihrem Teller.
»Du bist doch kein alter Kerl, und außerdem habe ich keine anderen Pläne. Bist du satt?«
Er klopfte sich lachend auf den Bauch.
»Da würde nicht einmal mehr eine Rosine reinpassen. Hat deine Mutter dir das Kochen beigebracht? Es war wirklich delikat. Ein alter Junggeselle wie ich ist, was das Essen angeht, nicht gerade verwöhnt, weißt du.«
»Ach was«, wehrte sie ab und spürte, wie sie rot wurde.
»So, jetzt legen wir eine Folie über die Reste, dann kann deine Mutter sie sich aufwärmen. Und ich kümmere mich um den Abwasch.«
»Nein, ich…«
»Keine Widerrede. Guck du solange Fernsehen, während ich mich drum kümmere. Oder lies ein Buch. Ach, apropos Buch…«
Er stand auf und ging in den Flur. Wühlte in der Plastiktüte, die er dort auf der Hutablage gelassen hatte, und kam zurück.
»Bitte schön. Als kleiner Dank für das Essen.«
Er legte ein flaches, eingewickeltes Paket vor ihr auf den Tisch.
»Für mich? Warum das denn?«
»Warum nicht?«
Er begann, den Tisch abzuräumen.
»Vielleicht gefällt es dir ja gar nicht, aber manchmal muss man es einfach drauf ankommen lassen.«
Sie strich über die gekreuzten Schnüre.
»Willst du es nicht öffnen? Ich habe auch was für deine Mutter, sie braucht also nicht eifersüchtig zu sein.«
Sie schob die Schnur über eine Ecke und riss das weinrote Papier auf. Zog das Buch heraus und konnte ihre Verblüffung nicht verbergen.
»Blake!«, rief sie aus. »Woher hast du das gewusst?«
Er kam zu ihr und stellte sich hinter sie, die Hände auf der Stuhllehne.
»Songs of Innocence and of Experience, ja. Nun ja, ich habe zufällig gesehen, dass du ›Tyger, Tyger, burning bright‹ an deiner Pinnwand hängen hast, es war deine Mutter, die mich gezwungen hat, in dein Zimmer zu gucken, du musst mein Eindringen entschuldigen. Wie dem auch sei, jedenfalls habe ich gedacht, dass das vielleicht ein Lieblingsdichter von dir ist… und das Buch ist auch schön, mit Zeichnungen und allem.«
Sie blätterte vorsichtig, und als sie die geheimnisvollen Bilder und die verschnörkelte Handschrift sah, spürte sie plötzlich, wie ihr die Tränen in den Augen standen. Um sie zurückzuhalten, stand sie schnell auf und umarmte ihn.
Lachend erwiderte er ihre Umarmung.
»Ja, ja, kleines Fräulein, so etwas Besonderes ist es ja nun auch nicht. Darf ich jetzt darum bitten, in der Küche in Ruhe gelassen zu werden?«
»Du bist so lieb. Ich hoffe…«
»Was hoffst du?«
»Ich hoffe, dass es mit Mama und dir gut geht. Du tust ihr… uns so gut.«
Sie hatte das gar nicht sagen wollen, aber jetzt war es heraus. Er hielt sie an den Schultern auf Armeslänge von sich entfernt und betrachtete sie mit einem leicht verblüfften Gesichtsausdruck.
»Die Zeit wird’s zeigen«, sagte er.
Dann schob er sie aus der Küche.
Als er sich neben sie aufs Sofa setzte, war es zwanzig Minuten nach zehn. Es war noch mehr als eine Stunde, bis ihre Mutter heimkommen würde. Monica hatte sich einen französischen Film im Fernsehen angesehen, ihn aber nach einer Viertelstunde wieder ausgemacht. Stattdessen hatte sie die Leselampe eingeschaltet und war zu Blake übergegangen.
»Lies was«, bat er sie.
Sie hatte plötzlich einen ganz trockenen Mund.
»Mein Englisch ist gar nicht so schlecht.«
»Meins auch nicht. Und ich habe das Gefühl, als würden alle Jugendlichen heutzutage wie waschechte Briten reden. Hast du ein Lieblingsgedicht? Es muss dir nicht peinlich sein, wenn du stecken bleibst.«
Sie überlegte und blätterte ein paar Seiten zurück.
»Vielleicht das hier.«
»Lass hören.«
Sie räusperte sich, schloss zwei Sekunden lang die Augen und begann dann.
O Rose thou art sick
The invisible worm
That flies in the night
In the howling storm
Has found out thy bed
Of crimson joy
And his dark secret love
Does thy life destroy
Sie klappte das Buch zu und wartete auf seine Reaktion.
»Schön«, sagte er. »Und traurig. Es heißt The Sick Rose, oder?«
Sie nickte.
»Obwohl es doch von Menschen handelt. Ich habe schon gemerkt, dass du es nicht so einfach hast. Wenn du erzählen willst, höre ich gern zu.«
Plötzlich wurde ihr klar, dass es genau das war, was sie wollte. Aber ist das passend?, dachte sie. Und wie viel sollte sie denn erzählen? Und wo sollte sie anfangen?
»Wenn du nicht willst, musst du nicht. Wir können auch einfach so zusammensitzen. Oder über Fußball reden. Oder über schlechte Fernsehprogramme oder über die schwierige Situation der Igel in der heutigen Gesellschaft…«
»Du ähnelst meinem Vater«, sagte sie lachend. »Nein, wirklich. Wir haben auch immer hier auf dem Sofa gesessen und uns laut was vorgelesen. Als ich klein war, na ja, da hat natürlich er meistens gelesen… und ich habe auf seinem Schoß gesessen.«
Dann vergingen noch drei Sekunden, bis sie in Tränen ausbrach.
Dann setzte sie sich auf seinen Schoß.
Hinterher hatte sie Schwierigkeiten, sich daran zu erinnern, worüber sie geredet hatten.
Ob sie eigentlich viel gesagt oder die meiste Zeit nur still dagesessen hatten.
Wahrscheinlich Letzteres.
Aber sie erinnerte sich an seinen guten Geruch. Sie erinnerte sich an den rauen Stoff seines Hemds und an seine gleichmäßigen, tiefen Atemzüge gegen ihren Rücken. Seine warmen, starken Hände, die ihr immer wieder vorsichtig über die Arme und das Haar strichen.
Und sie erinnerte sich daran, dass sich kurz, nachdem die alte Wanduhr über dem Fernseher elfmal geschlagen hatte, etwas in ihr geregt hatte, was sich nicht hätte regen dürfen.
Und dass sich fast gleichzeitig bei ihm etwas geregt hatte, was absolut verboten war.
3
Er rief am nächsten Tag an und bat um Entschuldigung.
Spät am Nachmittag, ihre Mutter war auf irgend so einem Einführungstreffen für Leute, die längere Zeit aus dem Arbeitsprozess heraus gewesen waren und jetzt wieder eingegliedert werden sollten. Vielleicht hatte sie ihm das ja erzählt, sodass er wusste, wann er anrufen konnte.
»Verzeih mir, Monica«, sagte er. »Nein, das sollst du gar nicht. Es ist unverzeihlich.«
Sie wusste nicht, was sie antworten sollte.
»Wir waren beide daran beteiligt«, sagte sie.
»Nein«, beharrte er. »Es war ganz und gar mein Fehler. Ich begreife nicht, wie ich es dazu kommen lassen konnte. Ich war zwar ein bisschen müde und bin auch nur ein Mensch, aber mein Gott, das ist keine Entschuldigung. Es ist wohl das Beste, wenn du mich nicht mehr siehst.«
Er schwieg, und sie meinte, sein schlechtes Gewissen durch den Hörer greifen zu können.
»Na, so weit sind wir ja nicht gegangen«, betonte sie. »Und ich habe ja wohl auch meinen Teil an Verantwortung daran. Mit sechzehn ist man schließlich kein Kind mehr.«
»Blödsinn«, sagte er. »Ich habe ein Verhältnis mit deiner Mutter. Das ist so was, was man in Klatschzeitschriften liest.«
»Liest du Klatschzeitschriften?«, fragte sie. »Das hätte ich nicht gedacht.«
Er lachte, unterbrach sich dann aber selbst.
»Nein«, sagte er. »Aber vielleicht sollte ich das lieber tun, da könnte ich noch was lernen. Auf jeden Fall soll dir so was nicht noch mal zustoßen, das verspreche ich dir. Es ist wohl das Beste, wenn ich die Freundschaft mit deiner Mutter beende…«
»Nein«, widersprach sie. »Nein, tu das nicht.«
Er zögerte mit seinem nächsten Satz.
»Warum nicht?«
»Weil… weil… weil du ihr gut tust. Sie mag dich, und du magst sie doch auch. Und ich mag dich auch… nicht so wie gestern, das war ein Unglücksfall.«
Er schien wieder zu zögern.
»Ich habe eigentlich angerufen, um mich zu entschuldigen, und… und um zu sagen, dass ich die Konsequenzen zu ziehen gedenke und euch beide in Zukunft in Ruhe lassen werde.«
»Du hast doch Mama nichts erzählt?«
Er seufzte.
»Nein, deiner Mutter habe ich nichts erzählt. Es wäre natürlich das Ehrlichste gewesen, aber ich weiß nicht, wie sie es aufgenommen hätte. Und wenn man nun mal ein Waschlappen ist… du siehst, mit was für einem Stinkstiefel du es zu tun hast…«
»Du bist kein Stinkstiefel. Hör auf, schließlich waren wir zu zweit auf dem Sofa, ich bin ja nicht unzurechnungsfähig.«
»Entschuldige.«
Eine Weile schwiegen beide. Sie spürte, wie die Gedanken in ihrem Kopf wie ein Schwarm quirliger Spatzen herumsausten.
»Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass du das Ganze zu leicht nimmst«, sagte er zum Schluss. »Vielleicht sollten wir uns treffen und alles noch mal gründlich besprechen.«
Sie überlegte.
»Warum nicht?«, sagte sie dann. »Schaden kann es ja wohl kaum. Wann und wo?«
»Wann hast du Zeit?«
»Immer. Die Schule fängt erst nächste Woche wieder an.«
Er schlug einen Spaziergang im Wollerimspark am nächsten Abend vor, und sie fand das eine gute Idee.
Der folgende Abend war ein Mittwoch und einer der heißesten im ganzen Sommer. Nach einem ziemlich kurzen Spaziergang ließen sie sich auf einer Bank unter einer der herabhängenden Weiden am Kanal nieder und redeten mehr als eine Stunde lang miteinander. Anschließend machten sie eine Wanderung durch die Stadt. An der Langgraacht entlang, durch Landsloorn und hinaus bis nach Megsje Bojs. Sie war diejenige, die am meisten redete. Erzählte von ihrer Kindheit, von dem Tod ihres Vaters, von ihrer Mutter. Von den Problemen in der Schule und von Freundinnen, die sie nur im Stich ließen. Er hörte zu und stellte Fragen. Als sie auf einen Wanderweg in den Wald einbogen, hakte sie sich bei ihm ein. Als sie ein wenig weiter im Dunkel waren, wo es keine Laternen mehr gab, legte er ihr einen Arm um die Schulter, und irgendwann kurz vor Mitternacht konnte sie feststellen, dass sie jetzt wirklich ein Liebespaar geworden waren.
Irgendwie ging das so weiter.
Nach dem Abend und der Nacht draußen in Megsje Bojs ließ er die folgenden vier Tage nichts mehr von sich hören. Erst am späten Sonntagabend, als sie wiederum allein zu Hause war. Erneut bat er um Entschuldigung, erklärte, dass es unverantwortlich war, und dass das, was sie da trieben, beendet werden müsste, bevor es ein schreckliches Ende nähme.
Sie redeten zehn Minuten lang hin und her, beschlossen, sich dann ein letztes Mal zu treffen, um alles endgültig zu klären. Am Dienstag holte er sie von der Schule ab, sie fuhren in seinem Auto ans Meer, und nach einem langen Spaziergang am Strand liebten sie sich in einer Kuhle zwischen den Dünen.
Als sie sich trennten, erwähnte keiner mit einem Wort, dass sie das abbrechen wollten, was da vor sich ging, und in den ersten Schulwochen war er zweimal bei ihnen in der Moerckstraat zu Besuch. Beide Male blieb er die Nacht über bei ihrer Mutter, und in der hellhörigen Wohnung konnte sie hören, dass sie sich bis weit in die Morgenstunden hinein liebten.
Aber sie wusste, dass er eines Tages zu ihr zurückkommen würde.
Das ist nicht gescheit, dachte sie. Das ist der reine Wahnsinn.
Aber sie tat nichts, überhaupt nichts, um der Sache ein Ende zu bereiten.
Noch nicht.
Die Schule war ernüchternd. Ihre Hoffnungen auf eine Veränderung, darauf, dass sie eine neue Chance bekommen würde, jetzt, wo sie auf dem Gymnasium anfing, wurden bald zunichte gemacht.
In der ehrwürdigen alten Bungelehranstalt – in die übrigens auch ihr Vater vor langer Zeit gegangen war – landete sie zwar in einer Klasse mit überwiegend neuen, unbekannten Gesichtern. Aber es gab auch ein paar Bekannte darunter, und es dauerte nur ein paar Tage, dann war ihr klar, dass diese alten so genannten Freunde und Freundinnen aus der Deijkstraaschule beschlossen hatten, sie in der Rolle zu belassen, die ihr nun mal ein für alle Mal zustand. Die sie ganz allein für sie kreiert und geschneidert hatten.
Es war den neuen Gesichtern problemlos anzusehen, dass sie wohl das Eine oder Andere wussten. Dass sie so einiges gehört hatten, obwohl doch erst ein paar Tage des Schuljahrs vergangen waren. Wie sie lebte und wie es um ihre Mutter stand beispielsweise. Die Geschichte von der Kotze und der Badewanne, die sie einer äußerst zuverlässigen Freundin vor ein paar Jahren anvertraut hatte, war in keiner Weise gegessen, nur weil sie die Schule gewechselt hatte. Und auch nicht die weit verbreitete Onanielektion. Eher schien es, als hätten die Gerüchte neuen Wind unter die Flügel bekommen.
Man wusste schließlich Bescheid. Dass Monica Kammerle ein bisschen eigen war. Kein Wunder. Mit so einer Mutter. Es war nun mal so, da war es auch nicht überraschend, dass sie sich lieber von den anderen fern hielt, die Ärmste.
Und wenn sie an Benjamin dachte und daran, was in ihrem Zuhause vor sich ging, konnte sie nicht anders, als ihren Mitschülern Recht geben.
Klar, sie war merkwürdig. Sie war nicht wie die anderen. Sie nicht und ihre Mutter auch nicht.
Vielleicht nicht einmal Benjamin. Als sie das dritte Mal mit ihm ins Bett ging – daheim in der Moerckstraat an einem Vormittag, als ihre Mutter bei ihrem Wiedereingliederungskursus war und sie einen Sporttag in der Schule schwänzte –, wurde ihr klar, wie wenig sie eigentlich über ihn wusste.
Seinen Namen. Benjamin Kerran.
Sein Alter. Neununddreißig. Genauso alt wie ihr Vater gewesen wäre, ein Jahr jünger als ihre Mutter. Benjamins graue Schläfen führten dazu, dass die meisten ihn leicht älter schätzten. Etwas über Vierzig ungefähr.
Beruf? Das wusste sie nicht genau. Er arbeitete irgendwo in der Stadtverwaltung. Sie konnte sich nicht daran erinnern, dass er das irgendwann einmal präzisiert hätte.
Wohnung? Keine Ahnung. Nun war es schon verrückt, dass sie nicht einmal wusste, wo er wohnte. Sie hatten sich nie bei ihm zu Hause getroffen – nur außerhalb oder daheim in der Moerckstraat, wenn ihre Mutter nicht im Weg war. Es war schon ein wenig sonderbar, dass sie seine Wohnung nicht ein einziges Mal nutzten, wenn er denn allein wohnte, wie er behauptete. Sie beschloss, seine Adresse herauszubekommen, sobald sie sich wiedersehen würden. Im Telefonbuch stand er nicht, da hatte sie schon nachgesehen.
Eigentlich hätte sie sich ja auch bei ihrer Mutter danach erkundigen können. Monica hatte doch einen ganz legitimen Grund, etwas über deren Liebhaber zu erfahren. Oder etwa nicht?
Und sein Leben? Was wusste sie über sein Leben?
Fast nichts. Er war einmal verheiratet gewesen, das hatte er ihr erzählt, aber es war offenbar schon lange her. Etwas von irgendwelchen Kindern hatte er nie erwähnt.
Dann gab es wohl keine, wie Monica Kammerle annahm.
Merkwürdig, dachte sie. Merkwürdig, dass ich so wenig über den einzigen Geliebten weiß, den ich jemals in meinem Leben hatte. Und habe.
Gleichzeitig musste sie einsehen, dass es nicht besonders verwunderlich war. Das alles überdeckende Gesprächsthema zwischen ihnen war immer sie selbst gewesen. Jedes Mal, wenn sie sich trafen.
Monica Kammerle. Monica Kammerles Kindheit und Jugend. Ihre Mutter und ihr Vater. Ihre Lehrer, ihre alten falschen Freundinnen, ihre Lieblingsbeschäftigungen und Lieblingsbücher. Ihre Gedanken über alles zwischen Himmel und Erde, und was für ein Gefühl das für sie war, wenn er sie auf die eine oder andere Weise anfasste. Und wenn er in ihr war.
Aber über ihn? Nichts. Und das war kaum sein Fehler. Sie redete gern, und er schien gern zuzuhören. Wenn man also ehrlich war, dann konnte man feststellen, das sie einfach nur ein egoistisches sechzehnjähriges Mädchen war, das gern den eigenen Bauchnabel betrachtete und nie weiter guckte, als die eigene Nase reichte.
Andererseits hatte sie seit dem Tod ihres Vaters nie richtige Zuhörer gehabt. So ist es nun einmal, man hat halt bestimmte Bedürfnisse, dachte sie, und wenn man die Möglichkeit bekam, sie zu befriedigen, dann nutzte man diese natürlich auch.
Außer dem Thema Monica Kammerle gab es eigentlich nur noch ein einziges anderes Gesprächsthema, dem sie ihre Zeit widmeten.
Ihre Beziehung.
Genauer gesagt, die verbotene Tatsache, dass sie den gleichen Liebhaber wie ihre Mutter hatte. Dass sie, Monica Kammerle, sechzehn Jahre alt, und er, Benjamin Kerran, neununddreißig, sich tatsächlich die Zeit damit vertrieben, miteinander zu bumsen. Von vorn und von hinten. Mit den Mündern, den Zungen, den Händen und allem Möglichen. Bumsten, was das Zeug hielt. Sie stellte bald fest, dass sie das Ganze mit einer Art mit Angst vermischter Verzückung erlebte, einem leicht rauschhaften Entsetzen, sobald sie davon sprachen.
Als ob sie es erfunden hätten. Als ob kein anderer Mensch wusste, dass man das tun konnte. Oder als ob all das Hässliche allein dadurch, dass sie es benannten, in irgendeiner Weise zulässig wurde. Dadurch, dass sie darüber sprachen. Sie war sich ganz sicher, dass er das auf die gleiche Art und Weise erlebte.
Wir wissen ja genau, dass wir etwas Falsches machen, deshalb können wir es uns auch erlauben, sagte er einmal.
Deshalb können wir es uns auch erlauben?
Anfangs glaubte sie das.
Anfangs war sie eigentlich nur ein wehrloses Opfer in seinen Armen, sie war klug genug, auch das zu begreifen.
Denn ihr gefiel das, was er mit ihr machte. Alles, fast alles.
Und ihr gefiel das, was sie mit ihm machen sollte. Und dass ihm das gefiel.
Es gibt andere Kulturen, erzählte er ein anderes Mal, Kulturen, in denen junge Mädchen in das Liebesleben eingeführt werden, indem man sie mit einem erwachsenen, erfahrenen Mann zusammen führt. Das ist vielleicht gar keine so dumme Idee.
Monica Kammerle war seiner Meinung. Bestimmt keine so dumme Idee.
Nach einer Nacht, in der er bei ihrer Mutter geschlafen hatte, aber vor dem Morgengrauen schon gegangen war, vertraute diese ihrer Tochter am Frühstückstisch an, dass Benjamin sicher der beste Liebhaber war, den sie je gehabt hatte.
Monica war geneigt, ihr zuzustimmen, sagte aber nichts. Zweifellos hatte Benjamin einen starken, äußerst positiven Einfluss auf ihre Mutter, das war gar nicht zu übersehen. Diese manische Phase, die Ende August auf dem Weg gewesen war, war abgeebbt. Sie nahm ihre Medikamente regelmäßig – soweit Monica das beurteilen konnte, wenn sie im Badezimmerschrank nachguckte –, und sie wirkte gesünder und ausgeglichener, als Monica sie seit dem Tod ihres Vaters jemals wahrgenommen hatte.
Sie ging vier Tage in der Woche zu ihrem Wiedereingliederungskurs, sie kochte Essen, kaufte ein und wusch die Wäsche. Fast wie eine ganz normale Mutter. Es war noch nie vorgekommen, dass sie so ausdauernd und konzentriert gewesen war. Jedenfalls nicht, soweit Monica sich erinnern konnte.
Lieber nichts beschreien, dachte sie. Vielleicht ist das ja der reine Wahnsinn, was wir hier machen, aber wir sind wohl irgendwie nicht von dieser Welt.
Sie lachte bei dem Gedanken und dachte an ihre Klassenkameradinnen. Wenn die wüssten!
Der Drang, sich anzuvertrauen, es zumindest einer Person zu erzählen, tauchte ein paar Tage später auf, genauer gesagt an dem frühen Morgen, als er ihre Mutter im Schlafzimmer zurückließ und stattdessen zu ihr ins Zimmer kam.
Das war zwischen einem Dienstag und einem Mittwoch Anfang September. Kurz nach fünf Uhr. Benjamin und ihre Mutter hatten, wenn sie es richtig verstanden hatte, einen Ausflug nach Behrensee gemacht und waren erst spät nach Hause gekommen. Sie hatte schon geschlafen, als sie zurückkamen, hatte nur die vage Erinnerung, etwas im Flur gehört zu haben.
Sie wachte davon auf, dass er ihre Brustwarze streichelte. Er hatte einen warnenden Finger auf den Lippen liegen und zeigte mit einem Kopfnicken zum Schlafzimmer. Nahm ihre Hand, ließ sie sein steinhartes Glied fühlen und sah sie fragend an. Es war etwas Hungriges in seinem Blick und gleichzeitig etwas fast hundeähnlich Flehendes.
Und obwohl sie erst sechzehn Jahre alt war – und erst vor achtzehn Tagen ihre Unschuld verloren hatte –, las sie während dieser kurzen Sekunde in diesen glänzenden Augen die Warnung vor dem Balanceakt, der sich in der körperlichen Liebe verbirgt. Erfuhr – obwohl sie noch gar nicht richtig wach war – die glasklare Einsicht, welche Abgründe unter den rücksichtsvollsten Berührungen und Blicken verborgen lauern.
Sobald etwas schief geht. Und wie leicht konnte etwas schief gehen.
Sie zögerte eine Sekunde. Schaute nach, ob er wenigstens die Tür richtig geschlossen hatte. Nickte und ließ ihn von hinten in sich eindringen.
Das tat weh, war in keiner Weise wie sonst. Sie war nicht bereit gewesen, es brannte, und er war bedeutend grober, als er sonst war. Schien allein auf seine Wünsche bedacht zu sein, und schon nach wenigen Minuten spritzte er ihren Rücken voll, ohne dass sie auch nur in der Nähe eines Orgasmus gewesen war.
Ohne dass sie auch nur einen Deut an Genuss gehabt hatte.
Er bat murmelnd um Entschuldigung und schlich zurück ins Schlafzimmer. Nein, das war ganz und gar nicht wie sonst gewesen, und zum ersten Mal spürte sie, wie ein überwältigendes Ekelgefühl in ihr aufstieg.
Wird ihr wohl sagen, dass er nur auf dem Klo war, dachte sie. Falls sie aufwacht, ihre Mutter. Oh verdammte Scheiße.
Sie stieg aus dem Bett. Stolperte zur Toilette und übergab sich, bis sie sich innerlich vollkommen leer fühlte. Duschte, duschte, duschte.
His dark secret love does thy life destroy, dachte sie. Nein, so geht es nicht weiter. Nicht, wenn ich nicht mit jemandem drüber reden kann.
4
»Können Sie mir sagen, was das hier ist?«
Der junge Verkäufer lächelte nervös und zupfte an seinem Schnurrbart. Van Veeteren wischte den Tresen mit seinem Jackenärmel ab und platzierte das Objekt mitten auf die glänzende Oberfläche. Der Jüngling beugte sich zunächst vor, aber als er gewahr wurde, worum es sich handelte, richtete er sich wieder auf und ließ sein Lächeln ausklingen.
»Natürlich. Ein Olivenkern.«
Van Veeteren hob eine Augenbraue.
»Ach, wirklich? Sind Sie sich da ganz sicher?«
»Natürlich.«
Er nahm den Kern vorsichtig mit Daumen und Zeigefinger hoch und betrachtete ihn.
»Kein Zweifel. Ein Olivenkern.«
»Gut«, sagte Van Veeteren. »Dann sind wir ja soweit einer Meinung.«
Er zog vorsichtig das zusammengelegte Taschentuch aus seiner Tasche und wickelte es umständlich auf.
»Und das hier?«
Nach allem zu urteilen erwog der junge Mann, auch dieses Objekt näher in Augenschein zu nehmen, aber aus irgendeinem Grund änderte er auf halbem Weg seine Meinung. Blieb halb vorgebeugt stehen, mit einem dümmlichen Ausdruck in dem sommersprossigen Gesicht.
»Sieht aus wie eine Plombe.«
»Haargenau!«, rief Van Veeteren und rückte den Olivenkern neben den kleinen dunklen Metallklumpen, sodass beide mit nur wenigen Zentimetern Abstand nebeneinander auf dem Tresen lagen. »Und darf ich jetzt fragen, ob Sie eine Ahnung haben, mit wem Sie das große Vergnügen haben, an einem schönen Septembernachmittag wie diesem hier zusammenzustehen und sich zu unterhalten?«
Der Verkäufer versuchte es mit einem neuerlichen Lächeln, aber es wollte ihm nicht so recht gelingen. Sein Blick huschte ein paar Mal zwischen Schaufenster und Tür hin und her, als hoffte er, ein etwas normalerer Kunde würde auftauchen und die aufgeladene Atmosphäre im Laden entspannen. Aber niemand wollte ihm zu Hilfe eilen, also schob er seine Hände in die Taschen seines weißen Kittels und versuchte, ein wenig schneidiger auszusehen.
»Aber natürlich. Sie sind Kommissar Van Veeteren. Worauf wollen Sie hinaus?«
»Worauf ich hinaus will?«, wiederholte Van Veeteren. »Oh, das will ich Ihnen sagen. Ich will nach Rom hinaus, und dafür werde ich verdammt noch mal auch sorgen. Bereits morgen früh, genauer gesagt, da habe ich einen Flug von Sechshafen aus gebucht. Und eigentlich hatte ich vor, meine Reise in bester Verfassung, nämlich mit allen Zähnen, anzutreten.«
»Zähnen?«
»Zähnen. Außerdem ist es zwar korrekt, dass ich Van Veeteren heiße, aber was meinen Beruf angeht, so möchte ich darauf hinweisen, dass ich vor drei Jahren meinen Dienst bei der Polizei quittiert habe.«
»Ja, sicher«, nickte der Jüngling ergeben. »Aber man hört ja, dass Sie ab und zu noch einrücken.«
Einrücken?, dachte Van Veeteren und verlor für einen Moment den Faden. Man hört, dass ich einrücke? Was zum Teufel… ?
Er versuchte, schnell die vier Jahre zu überschauen, die vergangen waren, seit er Hiller sein Abschiedsgesuch überreicht hatte – was der Polizeipräsident auf eigene Faust in eine Art permanenter Dienstbefreiung umgewandelt hatte, für die es wohl kaum eine Grundlage in den Verordnungen gab –, um zu rekapitulieren, ob es sich tatsächlich so verhielt, wie dieser rotflaumige Mann behauptete.
Dass er einrückte? Dass er Probleme hatte, die Finger davon zu lassen?
Drei, vier Male fielen ihm ein. Fünf, sechs vielleicht, es kam darauf an, wie man es zählte.
Mehr war da nicht. Einmal oder ein paar Mal im Jahr. Also kaum der Rede wert, und nie war er selbst es gewesen, der die Initiative ergriffen hatte. Höchstens ein einziges Mal. Meistens waren es Münster oder Reinhart gewesen, die bei einem Bier bei Adenaar’s oder Kraus eine Bemerkung hatten fallen lassen. Mit einer fast heimtückischen Frage gekommen waren oder um einen Rat gebeten hatten. Erzählt hatten, dass man sich verrannt hatte.
Ganz einfach um Hilfe gebeten hatten, ja, so war es gewesen. Manchmal hatte er abgelehnt, manchmal war er interessiert gewesen. Aber eingerückt? Nein, das war zu viel gesagt. Eine Übertreibung, denn irgendeine Art von Polizeiarbeit in direktem Sinne hatte er nicht mehr übernommen, seit er Buchhändler geworden war, da war sein Gewissen so weiß wie die Unschuld oder Arsen.
Er schielte zu dem Verkäufer, der von einem Bein aufs andere trat und das Schweigen kaum ertragen konnte. Van Veeteren selbst hatte damit nie Probleme. Im Gegenteil, das Schweigen war ein alter Verbündeter und konnte manchmal direkt als Waffe gelten.
»Quatsch«, erklärte er schließlich. »Ich arbeite mit alten Büchern in Krantzes Antiquariat. Punkt. Schluss und Aus. Aber hier geht es nicht um meine persönlichen Aktivitäten, sondern um diesen Olivenkern.«
»Ich verstehe«, sagte der Verkäufer.
»Und um diese Plombe.«
»Ja?«
»Sie bleiben also dabei, dass Sie mich wiedererkennen?«
»Äh… ja, natürlich.«
»Bleiben Sie auch dabei, dass Sie mir heute Morgen ein Sandwich verkauft haben?«
Der Verkäufer holte tief Luft, als wolle er somit neue Kraft schöpfen.
»Wie ich es seit ein paar Jahren jeden Morgen tue, ja.«
»Nicht jeden«, korrigierte ihn Van Veeteren. »Bei weitem nicht. Sagen wir mal, an drei von fünfen, und schon gar nicht seit so langer Zeit, da ich bis Januar bei Semmelmann’s eingekauft habe, bis die dichtgemacht haben. Ich frage mich übrigens, ob mir bei denen etwas Ähnliches hätte passieren können.«
Der Verkäufer nickte ergeben und zögerte.
»Aber was zum Teufel… worum geht es eigentlich?«, presste er hervor, während ihm die Röte wieder vom Hemdkragen aufstieg.
»Um den Inhalt des Sandwiches natürlich«, sagte Van Veeteren.
»Den Inhalt?«
»Haargenau. Nach dem, was Sie angegeben haben, und nach dem, was ich erwartete, haben Sie mir heute Morgen ein Sandwich mit einem Belag verkauft, bestehend aus Mozzarellakäse… Büffelmilch natürlich… Gurken, sonnengetrockneten Tomaten, frischem Basilikum, Zwiebeln, Salatblättern und entkernten griechischen Oliven.«
Die Röte breitete sich wie ein Sonnenaufgang im Gesicht des Angestellten aus.
»Ich wiederhole: entkernten Oliven!«
Mit einer beherrschten Geste machte Van Veeteren den Jüngling auf die kleinen Teile auf dem Tresen aufmerksam. Der Jüngling räusperte sich und faltete die Hände vor seinem Körper.
»Ich verstehe. Wir bedauern natürlich, wenn es der Fall sein sollte, dass…«
»Es ist so, dass«, bestätigte Van Veeteren. »Genauer gesagt ist es so, dass ich mir einen Termin bei Zahnarzt Schenk in der Meijkstraat geben lassen musste. Bei einem der teuersten Zahnärzte in der ganzen Stadt, aber weil ich morgen abreise, hatte ich keine andere Wahl. Ich möchte Sie nur über den Stand der Dinge informieren, damit Sie sich nicht wundern, wenn die Rechnung bei Ihnen eintrifft.«
»Natürlich. Mein Vater…«
»Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie das Ihrem Vater auf überzeugende Art und Weise erklären können, aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen, ich habe keine Zeit mehr, hier noch länger mit Ihnen zu diskutieren. Sie können Kern und Plombe behalten. Als Erinnerung und als kleine Mahnung, ich habe für keines von beiden länger Verwendung. Vielen Dank und adieu.«
»Danke, danke«, stammelte der Jüngling. »Auf Wiedersehen darf ich doch wohl hoffen?«
»Ich werde es in Erwägung ziehen«, erklärte Van Veeteren und trat hinaus in den Sonnenschein.
Den restlichen Nachmittag saß er im hinteren Zimmer des Antiquariats und arbeitete. Beantwortete elf Anfragen von Buchläden und Bibliotheken – acht negativ, drei positiv. Katalogisierte eine Sammlung Landkarten, die Krantze in einem Keller in der Altstadt von Prag gefunden hatte (wie immer es ihm auch gelungen sein mochte, so eine Reise durchzuführen und dann auch noch in einen Keller hinabzusteigen: an Rheuma, Ischias, Krampfadern und chronischer Bronchitis leidend). Van Veeteren begann, vier Kartons zu kennzeichnen und zu sortieren, die ihm am gleichen Morgen von einer Haushaltsauflösung gebracht worden waren und ihn einen Appel und ein Ei gekostet hatten.
Die wenigen Kunden, die in den Laden kamen, ließ er ungestört in den Regalen herumstöbern, und die einzige Transaktion belief sich auf ein halbes Dutzend alter Kriminalromane, die er für einen ganz guten Preis an einen deutschen Touristen verkaufte. Um Viertel nach fünf rief Ulrike an und fragte, wann er nach Hause kommen würde. Er erzählte ihr die Geschichte von dem Olivenkern und der Plombe und meinte, sie würde der Geschichte übermäßig viel Gewicht beimessen. Sie vereinbarten, sich gegen sieben Uhr bei Adenaar’s zu treffen – oder sobald er wieder aus dem Zahnarztstuhl aufgestanden war. Keiner von beiden hatte sonderlich Lust, am Abend vor ihrer Abreise noch am Herd zu stehen, und außerdem war es gar nicht sicher, ob er mit dem neuen Gebiss gleich wieder kauen konnte.
»Es handelt sich nicht um ein Gebiss«, betonte Van Veeteren. »Sondern um eine Plombe.«
»Die haben immer gute Suppen bei Adenaar’s«, bemerkte Ulrike Fremdli.
»Bier werde ich auf jeden Fall schlucken können«, entgegnete Van Veeteren. »Bei Suppe weiß ich nicht so recht.«
Nachdem sie aufgelegt hatten, blieb er eine Weile sitzen, die Hände im Nacken verschränkt. Spürte plötzlich, dass etwas Warmes in seinem Inneren herumschwirrte, was immer das auch sein mochte. Ein zurückhaltendes, kaum merkbares Gefühl, aber was für eins?
Glück?
Das Wort wollte vor lauter Angeberei platzen, und schnell tauchten verschiedene Assoziationen auf. Nein, nicht Glück, korrigierte er sich. Aber es hätte schlimmer sein können. Und es gab andere Leben, die sinnloser waren als seines.
Dann begann er, über Relativismen nachzudenken. Darüber, ob das Unglück anderer Menschen sein eigenes größer oder kleiner machte – darüber, ob es tatsächlich in der Welt so armselig und erbärmlich eingerichtet war, dass dieser Relativismus der einzige Grund dafür war, etwas als gut oder schlecht anzusehen, und dann war da auf einmal jemand, der versuchte, seine Aufmerksamkeit zu erwecken…
Ein paar gekünstelte Huster und ein vorsichtiges »Hallo« waren aus dem vorderen Raum zu hören. Er überlegte schnell, ob er sich zu erkennen geben sollte oder nicht. Stand dann doch auf und tat es.
Sechs Monate später war er immer noch nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung gewesen war.
Der Mann war in den Dreißigern. Groß und mager und mit einem Gesicht, das sich alle Mühe gab, hinter einem langen Pony, einem dunklen Bart und einer Brille möglichst wenig von sich preiszugeben. Eine leichte Nervosität schien ihn wie ein schlechter Körpergeruch zu umgeben, und Van Veeteren hatte kurz die Assoziation von einem Verdächtigen, der versucht, sich vor einem entscheidenden Verhör zu sammeln.
»Jaha?«, fragte er. »Kann ich mit irgendetwas helfen?«
»Das hoffe ich«, sagte der Mann und streckte die Hand vor. »Wenn Sie Van Veeteren heißen. Mein Name ist Gassel. Tomas Gassel.«
Van Veeteren begrüßte ihn und bestätigte, dass er der Richtige war.
»Sie müssen entschuldigen, dass ich auf diese Art und Weise Kontakt mit Ihnen aufnehme. Mein Anliegen ist etwas delikat. Haben Sie ein wenig Zeit?«
Van Veeteren schaute auf die Uhr.
»Eigentlich nicht«, meinte er dann. »Ich habe in einer halben Stunde einen Termin beim Zahnarzt. Wollte für heute gerade schließen.«
»Verstehe. Würde es dann morgen besser passen?«
Van Veeteren schüttelte den Kopf.
»Leider nicht. Ich verreise morgen. Worum geht es denn?«
Gassel zögerte.
»Ich muss mit Ihnen sprechen. Aber ich fürchte, ein paar Minuten reichen dafür nicht. Die Sache ist nämlich die, dass ich in eine Situation geraten bin, die ich nicht bewältigen kann. Weder berufsmäßig noch als Privatperson.«
»Was meinen Sie mit berufsmäßig?«
Gassel sah ihn einen Augenblick lang verwundert an. Dann streckte er seinen Hals und hob den Bart mit der Hand hoch. Van Veeteren konnte den weißen Priesterkragen erkennen.
»Ach so, ich verstehe.«
»Sie müssen entschuldigen. Ich vergesse immer, dass es nicht gleich ins Auge fällt. Ich bin Kaplan in der Gemeinde von Leimaar hier in der Stadt.«
»Aha?«, sagte Van Veeteren und wartete auf eine Fortsetzung.
Gassel strich seinen Bart wieder zurecht und räusperte sich.
»Die Sache ist also die, dass ich mit jemandem reden muss. Mich beraten, wenn Sie so wollen. Ich befinde mich in einer Lage, die… in der meine Schweigepflicht im Konflikt mit dem steht, was meine moralischen Gefühle mir zu tun gebieten. Einfach ausgedrückt. Es ist bereits eine Weile vergangen, und ich fürchte, dass etwas äußerst Unangenehmes geschehen wird, wenn ich keine Maßnahmen ergreife. Etwas äußerst Unangenehmes und… Ungesetzliches.«
Van Veeteren suchte in der Brusttasche nach einem Zahnstocher, erinnerte sich dann aber daran, dass er mit dieser Gewohnheit vor eineinhalb Jahren gebrochen hatte.
»Und warum wenden Sie sich ausgerechnet an mich? Sie werden doch einen Hirten in Ihrer Gemeinde in Leimaar haben, der Ihnen in so einer Situation viel näher stehen müsste?«
Gassel schüttelte abwehrend den Kopf.
»Das könnte man annehmen. Aber bei derartigen Fragen befinden wir uns nicht gerade auf einer Wellenlänge, der Pastor Brunner und ich. Leider. Ich habe das Ganze natürlich auch schon in Erwägung gezogen, und… nein, es ist ganz einfach nicht möglich, die Sache auf diese Art zu handhaben. Sie müssen mir das glauben.«
»Und warum sollte ich es besser handhaben können? So viel ich weiß, sind wir uns noch nie begegnet.«