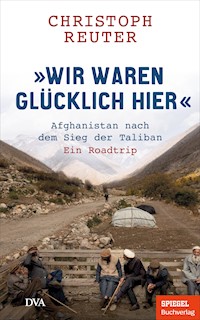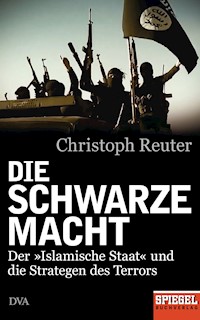
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was den »Islamischen Staat« so gefährlich macht
Nach seinem brutalen Eroberungszug im Jahr 2014 herrscht der »Islamische Staat« heute über mehr als fünf Millionen Menschen und eine Fläche von der Größe Großbritanniens. SPIEGEL-Korrespondent Christoph Reuter zeichnet den präzise geplanten Aufstieg der Dschihadisten nach und stößt zu den Wurzeln des Terrors vor – im zerfallenden Irak, im syrischen Bürgerkrieg und in den vielfältigen Konflikten der Region, die die Strategen des Terrors geschickt für ihre Zwecke zu nutzen wissen.
IS, der »Islamische Staat«, ist weit mehr als die gefährlichste Terrorgruppe der Welt. Er ist eine Macht, die ein zuvor ungekanntes Maß an Perfektion zeigt – in seinem Handeln, seiner strategischen Planung, seinem vollkommen skrupellosen Wechsel von Allianzen und seiner präzise eingesetzten Propaganda. Der Glaube wird von den Dschihadisten zwar demonstrativ zur Schau getragen, ist für die Strategen des IS jedoch nur eines unter vielen Mitteln, ihre Macht zu erweitern.
Christoph Reuter zeigt eindrucksvoll, wie der IS so große Gebiete in Syrien und im Irak erobern konnte und wer den Dschihadisten dabei in die Hände spielte. Sein Buch stützt sich auf bislang unbekannte Dokumente, vielfältige Kontakte und jahrelange Recherchen in der Region. Es bietet ungewohnte Einblicke in die Entstehung und Entwicklung des »Islamischen Staates« und macht vor allem eines deutlich: Wir sollten uns von der Propaganda des IS nicht täuschen lassen. Denn die Terrororganisation ist in vielem anders, als wir denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
CHRISTOPH REUTER, geboren 1968, berichtet seit Jahrzehnten aus den Krisenregionen der islamischen Welt, zunächst für Die Zeit und den Stern, seit 2011 für den SPIEGEL. Neben preisgekrönten Reportagen veröffentlichte er mehrere Bücher, darunter Mein Leben ist eine Waffe (2002) über Selbstmordattentäter. Für seine Recherchen über den »Islamischen Staat« wurde er u. a. als Reporter des Jahres geehrt, sein Buch Die schwarze Macht wurde 2015 mit dem NDR Kultur-Sachbuchpreis als bestes Sachbuch des Jahres ausgezeichnet.
Die schwarze Macht in der Presse:
»Reuters Buch ist eine Recherche-Meisterleistung. […] Wie keinem anderen Autor gelingt es ihm, den IS, seine Strategie und Methoden zu beschreiben.«
Deutschlandfunk
»Eine faktenreiche und brillante Analyse der Entstehung, des Aufstiegs und der Strategien des IS.«
NDR Kulturjournal
»Reuter recherchiert nicht nur hervorragend, er analysiert klar und profund und schreibt flott und lebendig.«
Süddeutsche Zeitung
»Reuter ist es gelungen, einen immensen Fundus an Material anschaulich und scharfsinnig zu einem packenden Sachbuch zu verdichten.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
»In seiner Dichte und Tiefe ist es auf dem deutschen Markt in jedem Fall einmalig.«
Stuttgarter Zeitung
Christoph Reuter
Die schwarze Macht
Der »Islamische Staat« und die Strategen des Terrors
Aktualisierte und erweiterte Taschenbuchausgabe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2015 by
Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München,
und
SPIEGEL-Verlag, Hamburg, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
Umschlag: any.way, Hamburg, nach einer Vorlage von Büro Jorge Schmidt, München
Karten: Peter Palm, Berlin
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-16410-2V004
www.penguin-verlag.de
Für Bente
Inhalt
Vorwort zur Taschenbuchausgabe
Die Reißbrett-Dschihadisten
Einleitung
Das unterschätzte Kalkül der Machtsammler
1 Das Stasi-Kalifat
Der akribisch geplante Aufstieg des »Islamischen Staates«
2 Wechselhafte Anfänge
Von al-Qaida im Irak zum Siegeszug des IS in Syrien
3 Herbst der Angst
Die Eroberung Nordsyriens durch den IS
4 Gemeinsam zum Gegenschlag
Der Versuch der Syrer, sich gegen den IS zu wehren
5 Blitzkrieg der Dschihadisten
Die Eroberung Mosuls und die Rückkehr des IS in den Irak
6 Al-Qaida war gestern
Warum der »Islamische Staat« radikal anders ist
7 Auf dem Berg der Jesiden
Die Katastrophe von Sinjar und die Wende für den IS
8 Wer köpft, dem glaubt man
Der »Islamische Staat« und die Medien
9 Nordkorea auf Arabisch
Herrschaft, Wirtschaft und Alltag im »Islamischen Staat«
10 Die Kolonien des Kalifats
Der IS als Terror-Exporteur
11 Die Schlafwandler
Der IS und seine Nachbarstaaten
Ausblick
Das Warten auf die Fehler der anderen
Anmerkungen
Orts- und Personenregister
VORWORT ZUR TASCHENBUCHAUSGABE
Die Reißbrett-Dschihadisten
Als das Manuskript der ersten Ausgabe im März 2015 abgeschlossen war, begann die Ungewissheit: Was von der beschriebenen Wirklichkeit würde vielleicht schon bei Erscheinen wenige Wochen später überholt sein? Inwieweit würde die Analyse dieser so kühl-nüchtern planenden Organisation unter dem Banner des absoluten Glaubens ihre weitere Genese erklären? Das Wachstum des »Islamischen Staates« im Verborgenen hatte über ein Jahrzehnt gebraucht, aber sein Ausbruch, der rasante Siegeszug durch Syrien und Irak hatten kaum ein Jahr gedauert.
In den 15 Monaten seit vergangenem März ist immens viel passiert in Syrien, im Irak, aber auch in Libyen und anderen Ländern des Nahen Ostens. Im Mai 2015 eroberte der IS nach exakt derselben Blaupause wie in Syrien die Mitte Libyens: die Stadt Sirt, Heimat des 2011 gestürzten Diktators Muammar al-Gaddafi. Mitte 2016 verliert er diese Region schrittweise wieder.
Mit der massiven Intervention der russischen Streitkräfte im Spätsommer 2015 zugunsten des Assad-Regimes in Syrien hat sich das Kräfteverhältnis dort verschoben. Der IS war zwar Vorwand hierfür, blieb aber monatelang fast unbehelligt von Russlands Luftangriffen, die vor allem den Rebellen galten. Über Bande geriet der »Islamische Staat« allerdings unter Druck: Moskau entdeckte die straff organisierte kurdische Kadertruppe der YPG, den syrischen Ableger der Separatistenpartei PKK, als Verbündeten. Zum einen drängten die YPG-Truppen den IS zurück, vor allem aber wuchs der Druck auf die Türkei, ihr Gewährenlassen des IS schließlich doch zu beenden – und die Grenze nach Syrien tatsächlich zu sichern.
Damit verlor der IS ab Herbst 2015 schrittweise seine essenzielle Nachschubroute für Menschen und Material, ist seither fast abgeschnitten vom Zustrom der früher problemlos über die Türkei einreisenden Anhänger, aber auch von technischem Gerät wie Anlagen zur Ölraffinierung, Chemikalien und Zündschnüren für seine Bombenindustrie sowie medizinischem Gerät. Dies trifft den IS langfristig härter als der Verlust einzelner Landstriche oder Orte.
Im Irak haben die Angriffe der Armee, vor allem aber der weitaus stärkeren schiitischen Milizen einen Großteil des 2014 verlorenen Terrains zurückgewonnen. Die Grausamkeit der schiitischen, von Irans Revolutionswächtern maßgeblich geführten Milizen, ihre massenhafte Vertreibung und Ermordung aller Sunniten (als potenzielle Unterstützer des IS) hat dabei allerdings keine neue Stabilität geschaffen, sondern vollkommene Unsicherheit. Es ist ungewiss, wohin die von beiden Seiten mit Tod und Terror bedrohten sunnitischen Muslime sich wenden werden, wenn sie nicht in ihre Städte und Dörfer zurückkehren können.
Die von den USA geführte Koalition zum Kampf gegen den IS hat Kurden in Syrien wie im Irak sowie die irakische Armee zum Kampf gegen den IS ausgerüstet und angetrieben. Vor allem aber hat sie ihr Bombardement des »Kalifats« fortgesetzt und so langsam, aber stetig dem »Islamischen Staat« Tausende seiner Kämpfer, mehrere seiner Führungskader und insgesamt viel von seiner Bewegungsfähigkeit genommen.
Als Reaktion darauf hat der IS seit November 2015 begonnen, womit er lange gewartet hatte: mit massiven Terrorattacken im Ausland, am 13. November in Paris, im März 2016 in Brüssel, mehrfach in der Türkei, in Bangladesch. Dazu kommen die Amokläufe von Einzeltätern, die sich zum IS bekannten, aber bei denen sich keine direkte Verbindung zur Terrororganisation nachweisen ließ – sowie der Anschlag auf die Maschine der russischen Fluggesellschaft Kogalymavia, die am 31. Oktober 2015 nach ihrem Start im ägyptischen Ferienort Scharm asch-Scheich über der Sinai-Halbinsel abstürzte, wozu der IS sich bekannte.
In seinem Propaganda-Furor lässt sich der IS fortwährend über die nahende Apokalypse aus, beschwört die Endzeitschlachten zwischen den Heeren der Muslime (allerdings nur der Sunniten) und der »Römer« (womit der Westen, die Ungläubigen insgesamt gemeint sind). Doch in seinem Handeln ist er nicht apokalyptisch, sondern zynisch. Die Terroranschläge hat er bislang begrenzt auf Länder, deren Gegenreaktion berechenbar bleibt. Frankreichs Ministerpräsident François Hollande ließ nach den furchtbaren Attacken auf Paris die IS-Hochburg Raqqa aus der Luft bombardieren – Militärlager und Stützpunkte, die längst geräumt waren.
Einen großen Terroranschlag auf seine erklärten Hauptfeinde Iran oder gar die USA aber hat der IS bis zum Juli 2016 nicht begangen. Griffe er die USA an, fiele deren Vergeltung aller Voraussicht nach so vernichtend aus, dass es mit dem »Kalifat« ein sehr rasches Ende hätte.
Bündelt man all die Reaktionen des IS auf seine stärker werdenden Gegner, das Schrumpfen seines »Kalifats«, so wird immer wieder das kalte Kalkül sichtbar, das schon seinen Aufstieg begleitete: ein Umschwenken auf Terrorattacken, die aber doch dosiert bleiben. Ein Rückzug, dem nichts von Ausharren bis zum letzten Mann und Apokalypse anhaftet, sondern der eine völlige Umkehrung der frühen Angriffstaktiken darstellt: Alles wird vermint, Scharfschützen werden postiert, wenige Kämpfer verloren, während dem Gegner hohe Verluste zugefügt werden, ohne dass er die IS-Schützen auch nur zu Gesicht bekäme.
Wo er sich zurückzieht, hinterlässt der IS völlige Verwüstung: zerstörte Städte (die auf irakischer Seite oft nach dem Einmarsch von den Eroberern noch weiter gesprengt werden), vergiftete Brunnen, verminte Felder. Eine Strategie der verbrannten Erde.
Bemerkbar macht sich aber noch etwas, schon lange vor den Rückzügen; etwas, das selten auftaucht in den Nachrichten von Kämpfen, Eroberungen, Explosionen, etwas, das leiser, aber fundamentaler ist: die Desillusionierung der Untertanen. Mittlerweile sind Hunderte Dörfer, Dutzende Städte seit zwei Jahren und länger in der Gewalt des »Islamischen Staates«. Aber nirgends, nicht in Syrien, nicht im Irak, findet sich ein Ort, dessen Bewohner sich vollen Herzens zum IS bekennen. Stattdessen herrschen Angst und Ausweglosigkeit, man klammert sich an die Annahme, dass der IS nur für eine Weile bleiben werde.
Der Reißbrett-Dschihad des IS ging davon aus, dass er seine Macht allein durch Kontrolle und die Verbreitung von Furcht festigen werde. Doch Gottes Reich auf Erden, denn um nichts Geringeres geht es dem IS ja, kann den Gläubigen keine Heimat bieten. Von den Zehntausenden Zugereisten, die ins »Kalifat« strömten, sind viele tot, wollen andere wieder weg, aber können nicht. Und von jener alten, nur durch historischen Zufall zum Dschihad geratenen Führungsspitze des IS, die sich aus Saddam Husseins einstigen Rängen rekrutierte, bleiben immer weniger Männer übrig.
Wenn aber der »Islamische Staat« als Territorium weiter schrumpft, und danach sieht es aus im Sommer 2016, nützen ihm auch die perfekten Pläne einer schleichenden Eroberung und anschließenden hermetischen Kontrolle wenig. Der IS kann im Untergrund überleben, hat dies schließlich schon einmal getan, kann mit seinen Terrorattacken fortfahren, was sich viel leichter bewerkstelligen lässt als das Erobern und Verwalten eines lebensfähigen Territoriums, eines Staates – auch wenn die Aufmerksamkeit der Welt genau andersherum funktioniert. Aber für ein Dasein im Untergrund braucht es Loyalität statt Angst und Kontrolle. Doch Loyalität, die Zustimmung, ja Begeisterung der lokalen Bevölkerung kommt nicht vor in den elaborierten Bauplänen des Kalifats.
Der IS ist eher ein künstliches Projekt als eine langsam, organisch gewachsene Bewegung. Das hat seine enormen Erfolge bis 2014 ausgemacht – aber bringt zwangsläufig die fundamentale Schwäche mit sich, dass dem ultimativen Glaubensprojekt die Gläubigen fehlen.
So könnte das weitere Schicksal des »Islamischen Staates« am ehesten von den Fehlern seiner Gegner abhängen. Die entscheidenden Fragen werden sein, wer sich nach seiner Vertreibung im Vakuum der Verwüstung ansiedeln wird und welche, falls überhaupt irgendeine, Stabilität dadurch entstehen kann.
So unklar dies bleibt, so absehbar ist ein anderer Umstand: dass das globale Interesse am IS wieder einfach verwehen wird, sobald er sein Territorium verloren hat und damit auch sein Terror an anderen Orten verebbt. Dann kann der »Islamische Staat« sich wieder in Ruhe sammeln, Schutzgelder erpressen und sich für eine nächste Gelegenheit zur erneuten Ausbreitung rüsten. Sofern, und das ist wieder eine offene Frage, er dann noch das Personal für ein derart diszipliniertes, planvolles Vorgehen hat.
Mit Blick auf die vergangenen Eroberungszüge des »Islamischen Staates« und bar aller ethischen Einwände muss man konstatieren, dass der Dschihad vom Reißbrett ein Erfolgsmodell sein kann. Man wünscht sich, dass er es in Zukunft nicht mehr sein wird. Aber die Umstände – die Barbarei seiner schiitischen Gegner, die Ignoranz der westlichen Mächte – bleiben günstig. Leider.
EINLEITUNG
Das unterschätzte Kalkül der Machtsammler
Wir sehen, was wir kennen. Unsere Erwartungen hat der »Islamische Staat« gern bedient. Aber unter der starren Oberfläche des Fanatismus sitzt ein mutationsfreudiger Organismus, flexibel bis zum Äußersten und klüger als all seine Vorgänger.
Von 42 Anführern des »Islamischen Staates« seien 34 »in den vergangenen 90 Tagen« getötet oder gefangen genommen worden, verkündete General Ray Odierno nicht ohne Stolz die Bilanz des Anti-Terror-Krieges in Bagdad. »Devastated«, am Boden zerstört, sei die Organisation, ergänzte der US-Generalstabschef Mike Mullen auf der Andrews Air Force Base in Maryland.1 Die Amerikaner klangen beinahe fasziniert über das vermessene Projekt der Dschihadisten: »Die wollen das gänzliche Scheitern der Regierung im Irak«, so Odierno, »sie wollen ein Kalifat im Irak etablieren.« Nun aber, unterwandert, führungslos und verraten, ihre Kämpfer gejagt bis in die letzten Winkel der westirakischen Steppen, sah es ganz danach aus, als ob dieses Vorhaben vor dem Untergang stand. Das war im Juni 2010.
Tatsächlich waren die Extremisten, die Jahre zuvor noch weite Landstriche der westirakischen Provinz kontrolliert hatten, zu diesem Zeitpunkt verhasst bei ihren potenziellen Untertanen. Sie wurden gejagt nicht nur von amerikanischen Einheiten und der irakischen Armee, sondern auch von den »Erweckungs-Milizen« der sunnitischen Stämme, die genug davon hatten, sich von mordwütigen Fanatikern terrorisieren und ausplündern zu lassen. Der anmaßende Name des »Islamischen Staates« stand in surrealem Gegensatz zur Fläche, die er kontrollierte, ja überhaupt zur schwindenden Existenz dieses »Staates«.
Doch Odierno, Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte im Irak und ein kluger Kopf ohne ein Haar auf dem glatt polierten Schädel, war zurückhaltend mit einem allzu euphorischen Abgesang: »Al-Qaida im Irak«, wie ein älterer Name der Gruppierung lautete, »hat sich als widerstandsfähig erwiesen. Sie werden versuchen, sich neu zu formieren. Sie müssen allerdings eine neue Führungsriege aufstellen. Sie haben einige Namen veröffentlicht, aber wir wissen nicht, ob dahinter echte Personen stehen oder ob das Platzhalter sind.« Einer dieser Namen damals lautete: Abu Bakr al-Baghdadi.
2010 zurückgeworfen auf ein Dasein als Terrorzelle im Untergrund, ist dieser »Islamische Staat« (IS) vier Jahre später zurückgekehrt als globaler Inbegriff des Schreckens und, tatsächlich, als Staat. Der IS herrscht im Frühjahr 2015, wenn auch angefochten, über mehr als fünf Millionen Menschen und eine Fläche von der Größe Großbritanniens; er wird angeführt von eben jenem Abu Bakr al-Baghdadi, dem »Befehlshaber der Gläubigen«, der sich Ende Juni 2014 zum »Kalif« ausrufen ließ.
Wie das? Wie konnte einer im Grunde gescheiterten, geschrumpften Radikalengruppe, die weder über Macht oder nennenswerte Mittel noch über Rückhalt und Sympathisanten verfügte, ein solcher Siegeszug gelingen?
Erklärungsversuche variieren je nach Herkunft der Erklärenden: Al-Qaida-Experten betrachten den IS als al-Qaida-Abspaltung und vermissen einen spektakulären Anschlag in den Dimensionen des 11. September 2001. Kriminalisten sehen im IS eine mafiöse Holding zur Profitmaximierung im Diesseits.2 Geisteswissenschaftler sehen genau das Gegenteil und verweisen auf die apokalyptischen Verlautbarungen der Medienabteilung des IS, auf seine Todesverherrlichung und den Glauben, in göttlicher Mission unterwegs zu sein.3
Doch mit apokalyptischen Visionen alleine erobert man keine Städte und halben Länder. Irrationale Terroristen, die nur auf das Fanal ihrer Explosionen fixiert sind, gründen keinen Staat. Als kriminelles Kartell wiederum begeistert man keine Anhänger in aller Welt, von denen Tausende ihre Existenz aufgeben, ins »Kalifat« und in den Tod zu ziehen.
Vor allem die Frage nach dem religiösen Kern verstellt den Blick auf den höchst facettenreichen Weg dieser Terrororganisation. Im Sommer 2010, just als General Ray Odierno in vorsichtigem Optimismus dem fast aufgeriebenen Führungszirkel des »Islamischen Staates« schwere Zeiten voraussagte, übernahm ein kleiner Kreis ehemaliger Geheimdienstler und Militärs dort das Ruder. Es waren die ehemaligen Kader des Regimes von Saddam Hussein, die den IS zum Siegeszug der kommenden Jahre führen würden. Hinter dem Emblem des Gottesstaates und der Gestalt des nominellen Emirs Abu Bakr al-Baghdadi bauten diese neuen Führer eine Machtmaschinerie, um Schritt für Schritt so viele Menschen, Material, Fläche unter ihre Kontrolle zu bringen, wie noch keine Terrorgruppe zuvor. Auf den ersten Blick erscheint dieses Amalgam aus (ehemaligen) Baathisten und Dschihadisten widersprüchlich: Die offiziell im Irak herrschende Baath-Partei war säkular gewesen, die Islamisten waren das Gegenteil davon. Aber letztlich trafen sich beide Systeme in der Überzeugung, dass die Herrschaft über die Massen in den Händen einer kleinen Elite liegen sollte, die diesen Massen keinerlei Rechenschaft schuldig sei – sie herrsche ja im Namen eines großen Plans, legitimiert wahlweise von Gott oder von der Glorie der arabischen Geschichte.
Für eine Weile blieb der IS ein kriminelles Netzwerk, das im Irak Schutzgelder erpresste, Zahlungsunwillige ermordete oder deren Geschäfte sprengte und mit dem Geld Terroranschläge vor allem in Bagdad finanzierte. Groß genug, um Furcht zu verbreiten, zu klein, um den offenen Kampf wagen zu können. Doch dann kam die Gelegenheit, die Auflösung der alten Ordnungen zu nutzen: Der heutige Siegeszug des »Islamischen Staates« begann diskret, als irgendwann im Jahr 2012 ein winziges Vorauskommando der IS-Führung nach Syrien ging, um dort innerhalb eines Jahres zu ungeahnter Stärke heranzuwachsen. Das vom Bürgerkrieg zerrissene Land, in dem eine Vielzahl verschiedenster Rebellengruppen gegen das Regime des Diktators Baschar al-Assad kämpfte, bildete die Basis für den Aufstieg des IS zur wohl mächtigsten Terrororganisation der Welt. Dabei gründete der »Islamische Staat« seine Macht zunächst weder auf Terror noch auf die Zustimmung der syrischen Bevölkerung. Das maßgebliche Instrument, zu solch beispielloser Stärke anzuwachsen, war etwas, das keiner der großen Dschihad-Theoretiker, deren Schriften vom »Management der Barbarei« oder dem »führerlosen Dschihad« immer wieder zitiert werden, sich je ausgedacht hatte: eine hochaufwändige, auf Monate angelegte, diskret ins Werk gesetzte Unterwanderung und Ausspionierung der anarchischen Rebellenszene Nordsyriens. Zunächst ganz friedlich und freundlich, um dann umso erbarmungsloser zuzuschlagen.
Dass die strategischen Köpfe von al-Qaida nicht früher schon auf ein solches Konzept gesetzt hatten, lag nicht an ihrem Unvermögen. Sondern daran, dass es eine Situation der völligen Anarchie in den arabischen Kernländern vor 2011 nicht gab. Vordenker des Terrors waren stets davon ausgegangen, dass man zuerst einen Staat, eine bestehende Ordnung zum Kollabieren bringen müsse, um auf den Ruinen dann sein eigenes Reich errichten zu können. In weiten Teilen Nordsyriens aber gab es ab 2012 keinen Staat mehr, sondern ein rudimentäres Nebeneinander Dutzender Rebellenbrigaden und Stadträte, die gegen das Regime von Baschar al-Assad – und mitunter auch gegeneinander – kämpften. Zwar funktionierte die staatliche Ordnung im syrischen Bürgerkrieg besser, als später geschrieben wurde, aber sie blieb dezentral und damit anfällig.
Die Paradoxie am Aufstieg des »Islamischen Staates« liegt darin, dass er erst in dem Moment möglich wurde, als sich viele Menschen in Syrien – wie zuvor in Tunesien, Ägypten, Libyen – gegen Diktatur und Unterdrückung erhoben. Die Menschen nahmen ihr Schicksal in die eigenen Hände, ohne zentrale Führung, selbst ohne ein klares Programm, was denn nach Assads Sturz geschehen sollte. Sie unterschätzten, welchen Preis sie für ihr Aufbegehren zahlen würden. Wo die Diktatur wich, entstanden Räume, die der IS besiedeln konnte wie ein Parasit das Wirtstier. Wie in Kapitel 1 dargestellt werden wird, ergriffen die Strategen des »Islamischen Staates« die Möglichkeit, die sich in Syrien eröffnete, infiltrierten unbemerkt das Land und begannen, Schritt für Schritt einen immer größeren Machtbereich zu erobern. Dabei assistierten dem IS dieselben syrischen Geheimdienstgeneräle, die schon Jahre zuvor geholfen hatten, Radikale aus aller Welt durch Syrien zu al-Qaida im Irak zu schleusen.
Dass der »Islamische Staat« eine Schöpfung der Geheimdienste sei, wie es die syrische Opposition behauptet, ist eine Übertreibung. Aber dafür, dass die Terrorgruppe schon lange vor Beginn des Aufstandes in Syrien vom Apparat des Assad-Regimes gefördert wurde, gibt es erdrückend viele Beweise aus Ermittlungen amerikanischer Behörden, aus Zeugenaussagen übergelaufener syrischer Offizieller und ausgestiegener Dschihadisten, aus Dokumenten und Kampfverläufen. Diese stillschweigende Kooperation zwischen dem »Islamischen Staat« und dem syrischen Regime, die in Kapitel 2 ausführlich beleuchtet werden wird, war dabei für beide Seiten profitabel. Man könnte sogar sagen, der Aufstieg des IS in Syrien war das Beste, was Staatschef Baschar al-Assad nach 2011 passieren konnte: Alle internationale Aufmerksamkeit gilt seitdem dem Kampf gegen die Terrorarmee des »Islamischen Staates«, während die fortgesetzten Bombardements der Zivilbevölkerung, der Giftgas-Einsatz und Massenmord von Gefangenen seitens des syrischen Regimes kaum noch wahrgenommen oder, wie Assad selbst, als kleineres Übel angesehen werden.
Genauso nüchtern und berechnend, wie der »Islamische Staat« sein Geheimdienstgeflecht aufbaute, verfuhr er politisch. Und wieder sah die Wirklichkeit sehr anders aus als die Botschaft, die der IS von sich verbreitete. Dem selbstentworfenen Bild zufolge bekämpfte der IS Feinde, die von den strengsten Auslegern des Glaubens schon vor knapp 1400 Jahren identifiziert wurden: die Ungläubigen, wozu in seinen Augen auch alle »abtrünnigen« muslimischen Sekten wie die Schiiten zählen. Doch in der Realität verhielt sich die IS-Führungsriege sehr flexibel und opportunistisch bei der Frage, wen sie gerade angriff und mit wem sie paktierte. Wie in Kapitel 3 und 4 zu sehen sein wird, gingen die Führungskader des IS rasch wechselnde, taktische Allianzen ein, um sie im geeigneten Moment wieder zu verraten: Erst kämpften die Dschihadisten gelegentlich mit den syrischen Rebellen, während sie das Gros ihrer Energie für den Machtausbau in deren Gebieten aufwandten, dann, als die syrischen Fraktionen sich in bis dato ungesehener Einigkeit gegen den IS wandten und ihn ab Januar 2014 bekämpften (Kapitel 3), warfen ihnen die Dschihadisten ihr ganzes Kriegsarsenal mit Wucht entgegen, jagten innerhalb weniger Wochen mehr Selbstmordattentäter in die Reihen der Rebellen als im Jahr zuvor gegen die Armee des Assad-Regimes. Nun begann der IS eine Phase der unerklärten Kooperation mit dem Regime Baschar al-Assads (Kapitel 4). Ab Anfang 2014 kämpften in Syrien IS-Einheiten und die syrische Armee Seite an Seite gegen denselben Feind – die syrischen Aufständischen. Gleichzeitig verschonte die syrische Luftwaffe den Herrschaftsbereich des IS mit ihren Angriffen, während IS-Kämpfer von ihren Emiren angehalten wurden, auf keinen Fall ihre Waffen gegen die Soldaten der syrischen Armee zu richten.
Im Juni 2014 dann kehrte der IS mit Macht in den Irak zurück, in das Land, in dem er einst entstanden war. Wie in Kapitel 5 beschrieben werden wird, überrannten die Sturmspitzen des IS die irakische Millionenstadt Mosul und fast den gesamten Nordwesten des Landes, erbeuteten gigantische Waffenbestände der irakischen Armee, überfielen später die jesidischen und christlichen Orte im Nordirak.
Nach diesem Eroberungsfeldzug stand die Armee des »Islamischen Staates« auf einmal derart gut ausgerüstet und schlagkräftig da, dass sie keine Rücksicht auf ihre Partner von gestern mehr zu nehmen brauchte, nicht auf jene in Syrien, nicht auf jene im Irak. In einer Folge überraschender Angriffe wandten sich die IS-Truppen gegen Assads Armee und beendeten Anfang August 2014 jäh das Stillhalteabkommen mit den Kurden im Nordirak – nach Wochen der diskreten Vorbereitung und mithilfe von Überläufern aus den attackierten Orten.
Folgt man diesem atemlosen Siegeszug des »Islamischen Staates«, so zeigt sich, dass er vor allem nach einer Maxime handelte: Der IS hat stets das getan, was ihm im jeweiligen Moment nutzte. Bis zum Spätsommer 2014 agierte er kühl und rational, überließ den Lauf der Dinge weder dem Zufall noch Hoffnung oder Glauben. Ausgerechnet der Glaube, möchte man einwenden angesichts der Allgegenwart des Islam in der Eigenwerbung des IS. Aber die detaillierten Überlieferungen aus Koran und islamischer Frühgeschichte, die Geschichten von der Unterjochung der Ungläubigen, der Glaubensheuchler und -leugner, die allgegenwärtigen schwarzen Banner und die vor Koranzitaten triefenden Episteln der Öffentlichkeitsabteilung des »Kalifats« – all das war für den IS bei seinem kometenhaften Aufstieg nur eines von mehreren Mitteln zum Zweck. In welchem Maße der »Islamische Staat« ein Glaubensprojekt ist und inwiefern die Taten und Proklamationen des IS tatsächlich vom Koran gedeckt sind, soll in Kapitel 6 näher beleuchtet werden.
Wenn die Eroberung Mosuls den Höhepunkt des spektakulären Siegeszuges des IS darstellt, so wurde die Einnahme der Stadt Sinjar und die Belagerung des gleichnamigen Berges, wie Kapitel 7 zeigen wird, zum Symbol für die Grausamkeit der Dschihadisten. Nachdem der IS seinen Aufstieg über Jahre so gut wie unbemerkt von der Weltöffentlichkeit vorbereiten und umsetzen konnte, wurden die Verjagung, Versklavung und Ermordung der Jesiden von Sinjar plötzlich weltweit wahrgenommen und verurteilt. Die USA und andere Mächte gerieten unter Druck einzugreifen – auch wenn im Fall der Jesiden die Kämpfer der kurdischen Arbeiterpartei PKK zu den wahren Rettern in der Not wurden.
Und auch wenn er in Sinjar scheiterte: Mit seinen Eroberungen bis zum Sommer 2014 hat es der »Islamische Staat« geschafft, im Sinne seines Namens manifest geworden zu sein. Der Staat gibt seinem maßlosen Anspruch, Gottes Plan zu verwirklichen, Substanz, Quadratmeter um Quadratmeter. Das »Kalifat« ist keine bloße Schimäre mehr, kein Fiebertraum verzweifelter Bombenleger. Man kann den »Islamischen Staat« durchfahren, stundenlang. Welche enorme Wirkung dies hat auf die weltweite Szene der Anhänger und zunehmend Gewaltbereiten, spiegelt sich in all den Attacken und Anschlägen wider, die gar nichts direkt mit dem IS zu tun haben – und doch ausgelöst werden von der Veränderung des Klimas, von einem ansteigenden Gefühl der Ermächtigung in der internationalen islamistischen Szene. Die wird noch verstärkt von der dröhnenden wie raffinierten Propaganda des IS, die in Kapitel 8 untersucht werden wird. Im Kontrast dazu soll in Kapitel 9 ausführlich das Leben im »Islamischen Staat« beschrieben werden. Hinter die Fassade zu schauen, die der IS von sich präsentiert, ist für Journalisten so gut wie unmöglich geworden. Nur anhand eines dichten Netzes an Quellen und Informanten, die nun schon seit vielen Monaten unter der Herrschaft des IS leben, ist ein unverstellter Blick möglich, kann beleuchtet werden, was die Herrschaft dieses Staates für die Bevölkerung tatsächlich bedeutet, wie er funktioniert und wie er sich finanziert.
Der größte Erfolg des »Islamischen Staates«, die Eroberung weiter Landstriche und die Gründung des »Kalifats«, ist eine ambivalente Errungenschaft, denn er macht die Dschihadisten zugleich verwundbar. Der Terror hat nun eine Adresse, kann angegriffen werden. Seit die Luftangriffe gegen den IS geflogen werden, ist seine Ausdehnung ins Stocken geraten. Wie die USA und andere westliche Staaten mit der Herausforderung durch den IS umgehen und wie die arabischen Nachbarstaaten auf die Bedrohung reagieren, soll in den beiden abschließenden Kapiteln 10 und 11 beschrieben werden. Hier stellt sich auch die Frage nach der Zukunft und der Überlebensfähigkeit des »Islamischen Staates«.
Erstaunlich ist, dass der IS nach seinem beispiellosen Siegeszug immer noch unterschätzt wird. Kommentatoren schreiben hoffnungsvoll davon, dass sich die Untertanen des »Islamischen Staates« angesichts der desolater werdenden Versorgungslage von der Terrorgruppe abwenden. Doch wohin sollen sie sich wenden angesichts flächendeckender Bespitzelung, rigider Kontrollen und einer weitgehenden Entwaffnung durch den IS? US-Politiker wiederholen stetig, dass im Irak die sunnitischen Milizen von einst wiederbelebt werden müssen, die vor knapp einem Jahrzehnt al-Qaida im Irak Einhalt boten. Währenddessen hat das irakische Parlament sich bis Februar 2015 noch nicht einmal grundsätzlich darauf geeinigt, ob dies geschehen soll – und gleichzeitig ermorden die Hinrichtungskommandos des IS systematisch die potenziellen Anführer solcher Milizen oder vereinnahmen deren Stämme.
Dass wir Formationen wie den »Islamischen Staat« stets fast nur aus der Ferne beurteilen, verführt zur Täuschung und zur Unterschätzung. Über die Jahre hat sich im Westen ein so festes Bild vom islamistischen Terrorismus geformt, dass zuwiderlaufende Sachverhalte an diesem Klischee abperlen wie Tropfen an einer Teflonbeschichtung. Zwar findet in der Berichterstattung über den »Islamischen Staat« Erwähnung, dass dessen Führungsebene ab 2010 fast ausschließlich aus einstigen irakischen Geheimdienstoffizieren und Parteikadern der Ära Saddam Husseins bestanden habe. Aber was für eine enorme Bedeutung diese faktische Übernahme einer Radikalengruppe durch glaubensfreie Ingenieure der Macht bedeutet, geht in den sich überschlagenden Nachrichten zum Terror des IS vollkommen unter. Zerlegt man den kometenhaften Aufstieg des IS ab 2012 in einzelne Schritte, wie es in den folgenden Kapiteln geschehen wird, so offenbart sich das hochflexible, präzise eingesetzte Strategiearsenal einer Organisation, die Fanatismus als Methode der Mobilisierung einsetzt, wechselnde Zweckallianzen auch mit erklärten Feinden eingeht und dabei äußerst rational agiert. Scheinbar mühelos gegensätzliche Elemente vereinend, passt sich der IS stets aufs Neue an seine Umgebung an, tritt auf wie ein mutierender Virus.
Dasselbe Gebilde hat sich in den vergangenen Jahren in unterschiedlichster Gestalt gezeigt: als abgeschottete Terrorgruppe, als weitreichendes Spitzelnetz mit harmlosem Anstrich, als hochgerüstete Armee, die mit Sturmattacken und Selbstmordattentätern ihre Gegner niederwalzt. Seit Mitte 2014 schließlich, unter Berufung auf die heiligen Überlieferungen, präsentiert es sich als ultimative Machtinstanz, der sklavisch zu gehorchen göttlicher Wille sei. Diesem Willen zuwiderzuhandeln, wäre ein todeswürdiges Verbrechen – so deklariert es der »Islamische Staat«. Denn er ist Gottes Exekutive.
Das vorliegende Buch will den IS in seiner Gesamtheit, in all seinen Facetten und Mutationsformen darstellen. Es wird die Entstehung des IS, seine Vorläuferorganisationen und seine Metamorphosen nachzeichnen, und es wird die Hintermänner aufzeigen, die den Aufstieg des »Islamischen Staates« penibel planten und auf den geeigneten Moment warteten, diesen Plan umzusetzen. Die Taktik des steten Wandels, des schnellen Anpassens an veränderte Umstände, des opportunistischen Wechsels von Allianzen ist das bestimmende Merkmal, den Aufstieg des »Islamischen Staates« zur beherrschenden Macht in großen Teilen Syriens und des Irak zu verstehen.
Dieses Buch wird deswegen einen möglichst nahen Blick auf den IS werfen und die Umstände seines Aufstiegs vor Ort begreiflich machen – im Irak, in Syrien, im Libanon, in den Gebieten der Autonomen Region Kurdistan. Dass etwa der »Islamische Staat« mit militärischer Wucht 2014 durch den Irak rollte, ist bekannt. Viel faszinierender und auch aufschlussreicher jedoch ist sein Aufstieg zuvor in Nordsyrien: wie dort das kleine irakische Vorauskommando aus einströmenden Dschihad-Pilgern quasi aus dem Nichts eine Kadertruppe formte. In einem fremden Land mit anderen Fremden aus Tunesien, Tschetschenien, Belgien und zahllosen anderen Ländern eine koloniale Unterwerfung zu organisieren, das hat noch keine dschihadistische Bewegung zuvor geschafft oder auch nur versucht.
Wie dieser Aufstieg ablief, ließ sich an vielen Orten Nordsyriens minutiös beobachten. Dass er auch genauso geplant war, ergibt sich aus Hunderten von Interviews, die über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren vom Autor geführt wurden. Überdies lässt es sich durch mehrere exklusive Aktenfunde belegen, die erstmals für dieses Buch ausgewertet wurden, darunter Dutzende handschriftliche Aufrisse zum Staatsaufbau von einem der wichtigsten Architekten des »Islamischen Staates«.
Dieses Buch kann zum jetzigen Zeitpunkt nur eine Momentaufnahme sein, der weitere Fortgang ist offen. Selbst wenn es gelänge, die strategischen Schritte des IS ungefähr zu prognostizieren, hängt die tatsächliche Entwicklung von zu vielen Unwägbarkeiten ab. Aber die Entstehung des IS, den mal schleichenden, mal blitzartigen Aufstieg in der Tiefe zu durchdringen, ist unabdingbar, um den komplexen Charakter, die Stärken und Schwächen dieser in vielem neuartigen und sich auch immer wieder neu erfindenden Organisation zu verstehen.
Denn der »Islamische Staat« ist weit mehr als die gefährlichste Terrorgruppe der Welt. Er ist eine Macht, die auf verschiedenen Feldern ein zuvor ungekanntes Maß an Fähigkeiten zeigt, militärisch, geheimdienstlich, medial. Ein »totalitäres, expansives und hegemoniales Projekt«, wie es Volker Perthes, der Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, zusammenfasste. Mit seinen Vorgängern wie al-Qaida hat der »Staat« nicht viel mehr gemeinsam als das dschihadistische Label. In seinem Handeln, seiner strategischen Planung, seinem vollkommen skrupellosen Wechsel von Allianzen und seinen präzise eingesetzten Propagandainszenierungen ist im Kern nichts Religiöses mehr erkennbar. Der Glaube, auch in seiner extremsten Form, ist nur eines von vielen Mitteln zum Zweck. Die einzig konstante Maxime des »Islamischen Staates« bleibt: Machterweiterung um jeden Preis.
Zu den Begrifflichkeiten
Selten hat eine Organisation, die auf Propaganda und Image so viel Wert legt wie der »Islamische Staat« (IS), seinen Namen so häufig geändert. 1999 entstand die Ursprungsgruppe als Jamaat al-Tauhid wa al-Jihad, die »Gemeinschaft der Einheit und des heiligen Kampfes«. Der Jordanier Abu Musab al-Zarqawi nannte so seine Kämpfertruppe, die ihr Camp im westafghanischen Herat hatte. Nach dem Sturz der Taliban fassten Zarqawi und seine Getreuen Fuß im Irak. Mit Beginn des spannungsreichen Zweckbündnisses mit al-Qaida wurde Zarqawis Truppe 2004 zu »al-Qaida im Irak« (AQI) und einige Monate nach seinem Tod 2006 umbenannt in »Islamischer Staat im Irak« (ISI). Dieser Name war Programm: Fortan würde die Gruppe versuchen, einen eigenen Staat zu erobern, was bis 2010 allerdings beinahe im Untergang der Terrorformation mündete. Die Machtübernahme der Führung durch ehemalige Geheimdienstoffiziere und die Mutation zur Untergrundmafia, die mit Schutzgelderpressungen reich wurde, verhalf dem »Islamischen Staat im Irak« zum dramatischen Comeback: Nachdem die Formation generalstabsmäßig geplant in Nordsyrien Fuß gefasst hatte, kam im April 2013 auch die Namenserweiterung zum »Islamischen Staat im Irak und in Großsyrien«, jener vorkolonialen Region, die auf Arabisch als al-Sham, in Europa als Levante geläufig war. Aus dieser Namensvielfalt erwuchsen, je nachdem, wie man den Begriff »Großsyrien« bzw. »al-Sham« verwendet, verschiedene Abkürzungen: ISIS (Islamischer Staat im Irak und Syrien), ISIG (Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien), ISIL (Islamischer Staat im Irak und in der Levante). Deutsche Sicherheitsbehörden wollten alles richtig machen und fügten noch die Variante »IStIGS« (Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien) hinzu.
Auf Arabisch ergeben die Anfangsbuchstaben eine eingängige Variante: Aus Daula al-islamiya fil-Iraq wa al-Sham wurde: Da’ish. Ein Wort, das sich hervorragend mit dem Gestus der Abscheu hervorstoßen lässt. »Da’ish, das klingt wie eines der Monster aus den Märchen, die man uns als Kinder erzählt hat«, befand der von den Schergen dieses Monsters gejagte syrische Intellektuelle Yassin Haj Saleh. Entsprechend drakonisch ahndeten die Da’ishis, wie die Anhänger genannt wurden, diejenigen mit Peitschenhieben, die sie das Verhöhnungskürzel aussprechen hörten. Daula, Staat, war die einzig erlaubte Kurzform für die damals gern schwarz maskiert auftretende Schreckenstruppe. Doch die Leute hielten sich nicht daran, im Gegenteil: Das Arabische ist eine schöpfungsfreudige Sprache, und so entstanden bald der Dada’ishi für Kindersoldaten, die Ada’ishiya für weibliche Kader und sogar eine einschlägige Verbform: anada’ish als Passivform fürs Verprügeltwerden.
Auch nachdem der »Islamische Staat« am 29. Juni 2014 das globale »Kalifat« verkündete, alle Länderzusätze im Namen strich und fortan als »Kalifat des Islamischen Staates« tituliert werden wollte, blieb der Name Da’ish im Arabischen an ihm haften.
Doch wie soll man ihn außerhalb der arabischen Welt nennen? Frankreichs Außenminister Laurent Fabius hat für sein Land den Amtsgebrauch von Da’ish beschlossen: »Ich empfehle nicht, den Terminus ›Islamischer Staat‹ zu verwenden, denn damit verwischt man die Trennlinien zwischen Islam, Muslimen und Islamisten.« Das Auswärtige Amt in Deutschland hält sich zumeist an den Namen »IS«, das Pentagon variiert zwischen »ISIS« und »Da’ish«. Eine Gruppe britischer Imame forderte Premier David Cameron auf, doch bitte fortan vom »Un-Islamischen Staat« zu sprechen. Ein ähnliches Anliegen, sich gegen die Vereinnahmung des Begriffs »Islam« durch den IS zu wehren, lässt unter dem Hashtag #notinmyname eine weltweite Twitter-Kampagne von Muslimen florieren.
Dieses Buch nun ist kein Statement, sondern der Versuch, so akribisch wie möglich Entstehung, Strategien und Widersprüche dieser Schreckensformation zu beschreiben. Das Risiko, von bloßen Namen vereinnahmt zu werden, dürfte gering sein. Um die unterschiedlichen Mutationsformen des »Islamischen Staates« über die Jahre wiederzugeben, werden deshalb im Folgenden für die drei »Namensphasen« des IS die Abkürzungen der jeweiligen Titel verwandt: ISI für »Islamischer Staat im Irak« ab 2006, »ISIS« für die um Syrien erweiterte Organisation ab April 2013, »IS« schließlich für die Zeit ab Juli 2014. In übersetzten Zitaten arabischer Sprecher bleibt Da’ish stehen, sofern der Zitierte den Begriff so verwendet hat.
1 DAS STASI-KALIFAT
Der akribisch geplante Aufstieg des »Islamischen Staates«
Keiner weiß, wer der Mann wirklich ist, der in einer nordsyrischen Kleinstadt den Siegeszug der Dschihadisten plant. Mit Kugelschreiber bringt der Architekt des Terrors Dutzende Organigramme und Listen zu Papier – den Masterplan für den »Islamischen Staat«
Spröde sei er gewesen. Zuvorkommend höflich. Schmeichelnd. Extrem aufmerksam. Beherrscht. Verlogen. Undurchschaubar. Bösartig. Jene Männer aus verschiedenen Orten Nordsyriens, die sich Monate später an ihre Begegnungen mit ihm erinnern, schildern ganz unterschiedliche Facetten des Mannes. Nur in einem sind sie sich einig: »Wir wussten nie, wem wir da eigentlich gegenübersitzen.« Und das in mehrfacher Hinsicht. Denn wer der hochgewachsene Endfünfziger mit dem kantigen Gesicht wirklich war, das wussten noch nicht einmal jene, die ihn an einem Januartag 2014 nach kurzem Feuergefecht im Ort Tal Rifaat erschossen. Dass sie den strategischen Kopf des »Islamischen Staates« umgebracht hatten, war ihnen nicht bewusst – und dass es überhaupt geschehen konnte, war eine rare, aber letztlich fatale Fehlkalkulation des brillanten Zynikers. Den örtlichen Rebellen musste erst jemand erklären, wie wichtig der Mann gewesen war, bevor sie seinen Leichnam wieder aus der kaputten Kühltruhe hoben. Eigentlich hatten sie ihn darin begraben wollen.
Samir Abed al-Mohammed al-Khleifawi war der echte Name des Mannes, dessen knochige Züge von einem weißen Vollbart etwas gemildert wurden. Unter diesem Namen kannte ihn niemand. Aber auch mit Haji Bakr, seinem bekanntesten Pseudonym, wussten die wenigsten etwas anzufangen. Irgendwann Ende 2012 war der Iraker in der Umgebung von Aleppo aufgetaucht, Syriens nördlicher Wirtschaftsmetropole, um die ab dem Sommer desselben Jahres erbittert gekämpft wurde. Seit verschiedene Rebellengruppen die nahen Grenzübergänge eingenommen hatten, kam ein steter Strom ausländischer Dschihadisten über die türkische Grenze. Haji Bakr war schon länger da, einer von vielen, die sich in dieser syrischen Zwischenwelt aufhielten, in der die Macht Baschar al-Assads bis auf kleine Inseln verschwunden war. Aber stattdessen gab es nicht eine neue Macht – sondern derer viele. Iraker kamen nur wenige, aber weder fiel Bakr als Kämpfer auf, noch machte er Anstalten, Anführer einer Rebellengruppe werden zu wollen, wie sie zu Dutzenden in jenen Tagen entstanden. Der alte Mann, der viel unterwegs war, hatte etwas ganz und gar anderes vor: Er wollte einen Staat errichten – mit dem ihm innewohnenden Anspruch auf die Weltherrschaft.
So etwas ist nicht ganz einfach.
Fast ein Jahrzehnt hatte der einstige Baath-Parteikader schon damit verbracht, eine Macht zu etablieren gegen die neuen Verhältnisse im Irak, die der früheren Elite des Landes ihre Stellung genommen hatten. Er war Geheimdienstoberst der Luftabwehr in Saddam Husseins Armee gewesen, zuständig kurioserweise unter anderem für Konzepte zur Rettung von Piloten notwassernder Militärjets, bevor Saddam Hussein gestürzt und die Armee per Dekret aufgelöst wurde. Bakr war daraufhin in den Untergrund gegangen. Um gegen die Amerikaner zu kämpfen, hatte er die kurzlebigen »Brigaden der Baath-Partei« mitgegründet und war dann bei al-Qaida gelandet, erinnert sich der irakische Kenner der Dschihadisten Hischam al-Haschimi, der ihn noch aus der Zeit vor Saddams Sturz kannte: »In Anbar«, einer Provinz im Westirak, »lernte er Abu Musab al-Zarqawi kennen«, den jordanischen Gründer von al-Qaida im Irak. Ein Fanatiker oder Ideologe sei der Mann, der mit Haschimis Cousin an der Luftwaffenbasis Habbaniya stationiert war, hingegen nicht gewesen. Sondern schlicht verbittert darüber, per Federstrich des US-Statthalters Paul Bremer einfach auf die Straße gesetzt worden zu sein. Außerdem war Bakr ein überzeugter Nationalist, der fand, dass die amerikanischen Besatzer vertrieben gehörten.
In der Eskalation des irakischen Bürgerkriegs folgte Haji Bakr dem Kurs Zarqawis. Noch erbitterter als die Amerikaner bekämpfte er die nun herrschende Mehrheit der Schiiten. Ab 2006 verfolgte seine Bewegung den ambitionierten – oder größenwahnsinnigen – Plan, einen »islamischen Staat« zu errichten, und hatte sich konsequent umbenannt in »Islamischer Staat im Irak« (ISI). Der Plan sah die Wiederauflage der Umma vor, der frühen Gemeinde des Propheten Mohammed, die nach beispiellos kurzen Eroberungszügen zum Imperium herangewachsen war. Ein solcher Staat, wie auch immer er aussehen würde, könnte aus dem Vollen der Überlieferungsgeschichte und Mythen schöpfen. Er wäre Projektionsfläche für all die Enttäuschten, Zukurzgekommenen und Wütenden in der islamischen Welt, denen man ein Heilsversprechen mit göttlichem Siegel präsentieren könnte.
Auch andere hatten derartige Versuche schon vorher unternommen: Ob Osama Bin Laden, die Muslimbrüder, zig kleinere Dschihadistengrüppchen oder nationale Bewegungen wie die Taliban – ihnen allen schwebte stets als Endziel ein solcher Staat vor, wenn auch unterschiedlichen Ausmaßes. Und sie alle waren gescheitert, auf die eine oder andere Weise: die Taliban am Terror ihrer al-Qaida-Gäste, die anderen an ihrer Unfähigkeit, mehr als einen Gebietszipfel zu erobern, den sie dann meist auch nur für kurze Zeit halten konnten, bevor sie vernichtend geschlagen wurden – die Gruppe Ansar al-Islam 2003 im Nordirak, die Gruppe Fatah al-Islam 2006 im Flüchtlingslager Nahr al-Barid im Nordlibanon, die radikalen Koranschüler in Islamabads Roter Moschee 2007.
Fehlschlag nach Fehlschlag. An einem von ihnen war Haji Bakr beteiligt. Denn auch im Irak würde der Kampf von al-Qaida spätestens 2010 zunächst scheitern, würden ihre Führer aufgerieben werden. Bakr überlebte. Ein ehemaliger Häftling des syrischen Gefängnisses Saidnaya, in dem die meisten islamistischen Häftlinge und vor allem die Rückkehrer aus dem Irak einsaßen, erinnert sich: »Haji Bakr war bei al-Qaida aufgetaucht, aber die meisten echten Islamisten misstrauten ihm – schließlich war er ein Funktionär der Baath-Partei gewesen, ein hoher Offizier, rasiert, ein Saddam-Mann, kurz: einer von denen, die sie früher ins Gefängnis gebracht hatten. Außerdem glaubte ihm keiner, dass er plötzlich religiös geworden sei.« Aber er hatte andere Qualitäten, so Haschimi: »Er war ein begnadeter Planer und Logistiker, sehr organisiert, sehr klug.« Ideologen hatte al-Qaida ja ohnehin genügend. Woran es den religiösen Ultras stets gemangelt hatte, waren gewissermaßen die Ingenieure des Terrors, die zum Erfolg einer Operation – eines Sprengstoffattentats, einer Gefangenenbefreiung – nicht auf Gottvertrauen setzten, sondern auf solide, umsichtige Vorbereitung. Solche Männer brauchte auch die radikalste religiöse Terrorvereinigung. Gott schenkt einem nicht den Sieg, wenn man den Zünder vergisst oder am Mobiltelefon über Anschlagsdetails spricht und anschließend vom US-Militär mit einer Rakete eingeäschert wird.
Die einzelnen Führer der Terrororganisation waren selten gemeinsam an einem Ort, kommunizierten oft über komplizierte, langwierige Umwege und kannten einander schlicht wenig. Haji Bakr war zuständig für die Kontakte zum Kreis um den einstigen irakischen Vizepräsidenten Izzat al-Duri, der vor dem Einmarsch der Amerikaner 2003 alles andere als eine Führungspersönlichkeit gewesen war. Vielmehr handelte es sich bei ihm um einen devot ergebenen Jugendfreund Saddam Husseins, der vor seinem Aufstieg in der Politik als Verkäufer von Eisbarren gearbeitet hatte. Aber al-Duri hatte schon zu Regime-Zeiten Kontakte zur Nakschbandiya-Bruderschaft gehalten, ursprünglich ein Sufi-Orden, aus dem eine militärische Formation im Kampf gegen die US-Truppen hervorgegangen war. Und: Izzat al-Duri war nach dem Sturz Saddam Husseins nie verhaftet worden, als Einziger aus der Führungsspitze.
Von 2006 bis 2008 war Haji Bakr im berüchtigten irakischen Gefängnis Abu Ghraib und für eine Weile auch im US-Gefangenenlager Camp Bucca im Süden inhaftiert. Danach pendelte er gelegentlich nach Syrien, hatte nahe Damaskus eine Wohnung und soll sich dort mindestens einmal zwischen 2008 und 2010 mit Asif Schaukat getroffen haben, dem Chef des Militärgeheimdienstes, Schwager von Baschar al-Assad – und Koordinator des diskreten Transfers von Dschihadisten aus aller Welt durch Syrien in den Irak. Bakr avancierte zu einem der militärischen Anführer des ISI, zuständig für die Provinz Anbar, dann zu dessen Militärchef, ernannt von ISI-Führer Abu Ayyub al-Masri. Als dieser und Zarqawis nomineller Nachfolger Abu Omar al-Baghdadi im Frühjahr 2010 von den Amerikanern gestellt wurden und sich lieber in die Luft sprengten, als aufzugeben, war es Haji Bakr, der dessen Nachfolger kürte: Abu Bakr al-Baghdadi, wie er sich nennt, ein enger Vertrauter noch aus den Jahren in Anbar. Bakr habe, so ein ISI-Gefolgsmann jener Zeit, die verbliebenen Mitglieder der obersten Räte einzeln gesprochen und ihnen jeweils die Zustimmung aller anderen versichert. Später dann seien drei Männer, die sich gegen ihn ausgesprochen hatten, spurlos verschwunden.
Ob es letztlich die Machtübernahme der einstigen Baathisten oder die Lernkurve aller war: Die überschaubare Schar der Anführer (die meisten waren von den amerikanischen und irakischen Truppen nach und nach getötet worden) schien zu einem für religiöse Fanatiker ungewöhnlichen Schritt entschlossen: aus Fehlern zu lernen. Eine Lehre zu ziehen aus all den Desastern der vergangenen Jahrzehnte, den fehlgeschlagenen Versuchen, irgendwo auf dem Wege des Dschihad an die Macht zu kommen und sich vor allem dort zu halten.
So war Haji Bakr erneut nach Syrien gegangen, als Teil einer winzigen Vorhut und mit einem aberwitzigen Plan: unter ihrer irakischen Führung eine Armee aus den anderen Ausländern zu bilden, die nun nach Syrien strömten. Das war ungefähr so, als würde sich eine Handvoll Österreicher in die Schweiz begeben, um dort mit einsickernden Deutschen die Macht an sich zu reißen. Doch die ambitiöse Umwegskonstruktion hatte einen Vorteil, der ihren Planern offenbar wichtig war: Unauffälligkeit. Explizit hatte Haji Bakr verfügt, dass die irakischen Kämpfer des ISI bleiben sollten, wo sie waren, in Mosul, Tikrit, Hawija, den Hochburgen des sunnitischen Ressentiments gegen die Regierung in Bagdad. Deren immer rigidere Apartheidspolitik, Kabinettsposten, Offiziersränge, Beamtenpositionen nur noch mit Schiiten zu besetzen, hatte zwar die Wut unter den Sunniten geschürt, die etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachten und die unter Saddam wie in den Jahrzehnten zuvor die Herrscher des Landes gewesen waren. Aber noch existierte der irakische Staat, und noch waren auch die verschiedenen militanten Gruppen zu uneins, ihm die Stirn zu bieten.
Stets waren die Dschihadisten in den vergangenen Jahrzehnten in ihren eigenen Ländern an der jeweiligen Staatsmacht gescheitert. Im Irak ab 2003 hatten die einmarschierten Amerikaner zwar per Federstrich Armee, Regierung und Behörden aufgelöst, aber zugleich jeden späteren Versuch der al-Qaida-Machtübernahme verhindert. Jede Bewegung der Radikalen in Ägypten, Libyen, in Syrien war in den letzten 30 Jahren fehlgeschlagen. Es war, als versuchten sie, immer wieder aufs Neue durch einen Eisblock zu schwimmen. Doch in Syrien nun, jedenfalls im Norden, war die einst alles kontrollierende Staatsmacht bis auf Überbleibsel besiegt, vertrieben, zerschmolzen. An ihrer Statt gab es Hunderte von Ortsräten und Rebellenbrigaden, es war ein anarchisches Nebeneinander, in dem niemand mehr die Übersicht hatte. Der geeignete Aggregatzustand für ein Projekt, das eine maßlose Glaubensvision erforderte. Oder ebensolchen Zynismus. Oder beides.
In Syrien, wo sich Haji Bakr und die übrigen entsandten Führungskader ausweislich der Koordinaten seines Navigationsgeräts erst einmal in den kaum kontrollierten, menschenarmen Steppen der Ostprovinz Hassaka einrichteten, fehlte es allerdings zu einer schlichten militärischen Unterwerfung der potenziellen Untertanen an so ziemlich allem, was dafür nötig gewesen wäre: Männern, Waffen und vor allem Lokalkenntnissen. Wer könnte dem »Islamischen Staat« zugeneigt sein, wer bliebe auf jeden Fall Gegner? Wer besaß Charisma, Geld, informelle Führungspositionen? Und wo wohnten diese Leute?
Dies würden die Dschihadisten als Erstes in Erfahrung bringen. Sie hatten Geld, das sie seit Jahren vor allem mit einem engmaschigen Netz von Schutzgelderpressungen in der irakischen Handelsmetropole Mosul verdienten, ihrer Hochburg. Und sie hatten einen Plan, den Haji Bakr begann, Blatt um Blatt aufzuzeichnen für die ersten kleinen Schritte zur Machtergreifung. Denn jetzt hatten sie keinen Eisblock mehr vor sich, sondern Wasser, in dem sie sich wie Fische bewegen konnten.
Nordsyrien Anfang 2013, das war schon damals eine verwüstete, schwer fassbare Welt. Man könnte sagen, das Jahr begann mit einem verrußten Kanarienvogel. Unterwegs an einem Januartag, unter einem hektischen Himmel, an dem sich Sonne und Regenwolken in rascher Folge abwechselten. In der Ebene nördlich von Aleppo lag das weite Areal der Infanterieschule, die von Rebellen erst Tage zuvor eingenommen worden war. An der Ecke der Mauer, wo gerade ein überlebensgroßes Kachelporträt Baschar al-Assads zu Scherben gehämmert wurde, lag eine Kreuzung, und da saß diese Familie: ein Mann, eine Frau, drei Kinder, ein paar Matratzen, Koffer, Plastikgefäße mit eingelegten Oliven. Am auffälligsten war der Vogelkäfig mit einem grauschwarzen Kanarienvogel darin. Er sah mitgenommen aus, in jeder Hinsicht.
»Wir haben die letzten Wochen nur mit schlechtem Diesel und Plastik geheizt«, entschuldigte der Mann den Zustand des Vogels, »der Rauch«. Sie kamen aus Salahedin, einem Viertel Aleppos, das im Spätsommer des Vorjahres zur Frontlinie geworden war, und waren in ein Dorf nahe der Infanterieschule geflohen, das nach deren Fall nun von weitreichender Artillerie aus dem Osten der Stadt beschossen wurde. Also weiter. Bis zu dieser Kreuzung hatte sie ein Wagen mitgenommen, nun hofften sie, dass ein Auto noch vor dem nächsten Regen käme. Jemand hatte versprochen, Bescheid zu sagen, irgendwer sollte kommen. Es hatte bereits zu nieseln begonnen, als schließlich ein kleiner Transporter auftauchte, sie ihre Habe verluden und aufbrachen, irgendwohin, sie wussten es selbst nicht.
Der ganze Norden Syriens, die Provinz Aleppo mit der gleichnamigen Hauptstadt, die toskanisch anmutende Hügellandschaft von Idlib, die Steppen von Raqqa, Hassaka, bis hin nach Deirez-Zor im Osten, waren zu einer mittelalterlichen Welt geworden: Manche Städte noch beherrscht von der Armee, teils zu Ruinen bombardiert, der Rest ein Flickenteppich lokaler Rebellengruppen und Räte, die zwar nicht gegeneinander kämpften, aber sich auch selten vereinigten über ihren Sprengel, ihre Provinz hinaus. Zwischen dem dröhnenden Mahlstrom unzähliger Gefechte, Bombardements auf Dörfer und Städte trieben Hunderttausende Flüchtlinge umher wie Treibgut auf hoher See. Sie blieben, wo es gerade ruhig war, flohen weiter, wenn es zu gefährlich wurde, stets gejagt von der unergründlichen Einsatzplanung der syrischen Luftwaffe, die einen Ort gern monatelang in Frieden ließ, um dann jählings wieder zuzuschlagen.
Es war eine gespenstische Gleichzeitigkeit des Ungleichen. Denn inmitten der Anarchie hatte sich überall in jenen Gebieten des Nordens, die von den Rebellen kontrolliert wurden, Ortsräte organisiert, Komitees, um das Machtvakuum zu füllen – während die Luftwaffe Tag um Tag die Infrastruktur einäscherte. Trinkwasserleitungen wurden bombardiert, Getreidespeicher, Krankenhäuser, Behörden, Schulen. In der 150 000-Einwohner-Stadt Manbij, die schon im Vorjahr als erste Großstadt im Norden begonnen hatte, sich selbst zu verwalten, wurden Packen für Packen alle Gerichtsakten, Heiratsurkunden, Dokumente des Katasteramtes aufs Land evakuiert. »Die Rettung des Staates vor seiner Zerstörung durch die Regierung«, nannte es einer der Anwälte vom Justiz-Komitee. Im hart umkämpften, halb zerschossenen Rumpfgebilde der einstigen Millionenmetropole Aleppo, wo Hunderttausende ohne Strom hausten und abends alle paar Meter Menschen vor kleinen Feuern auf dem Bürgersteig saßen, dauerte die Antwort auf die schlichte Frage »Wer herrscht?« eine Weile. »Na, die Tauhid-Brigade«, die größte Rebelleneinheit, »der Stadtrat, die ›Freien Anwälte‹, die Viertel-Komitees«, zählte Rafat Rifai auf, einer der Organisatoren des Übergangs-Stadtrates, »die Gerichte, die beiden Ärzte-Vereinigungen und die Nusra-Front«, die Radikalen-Truppe. »Gleichzeitig könnte man sagen: niemand. Was Aleppo hier zusammenhält, ist der Gesellschaftsvertrag seiner Bewohner. Der Respekt voreinander und die Fähigkeit zum Kompromiss. Jedenfalls noch«, und dann erzählte er von der Angst vor den islamistischen Fanatikern, die viele damals teilten. Sie würden immer mehr, und vor allem hätten sie Geld, von dem niemand wusste, woher es stammte.
Niemand herrschte, jedenfalls nicht so, wie Haji Bakr das Herrschen verstand. Es war ein Schwebezustand der Anarchie, weit zivilisierter als Assads Diktatur es gewesen war oder Haji Bakrs Vorhaben es sein würde, aber eben auch verwundbar.
Das mysteriöse Geld, von dem sich die Nusra-Front finanzierte, oder zumindest ein Großteil davon, stammte von Haji Bakr. Ab November 2012 war er für ein halbes Jahr verantwortlich gewesen für den Nachschub an Waffen und Geld für die Nusra-Front in Aleppo. Ein Iraker hatte ihn empfohlen, so ein ehemaliger Nusra-Mann später: »Der hat Ahnung von Management und Verwaltung. Dem könnt ihr trauen!« Mit Ersterem hatte der Mann zweifellos recht, mit Letzterem zweifellos unrecht. Vorerst organisierte Bakr reibungslos die Versorgung der Nusra-Front mit den beiden essenziellen Elementen, Geld und Waffen. Wobei die finanziellen Mittel ausschlaggebend waren, denn Munition, Waffen, selbst schweres Gerät konnte man kaufen: von anderen Rebellen, aus dem Irak und dem Libanon – und direkt von korrupten Offizieren der syrischen Armee.1 Der Großteil der Finanzierung kam aus dem Irak und den Mitteln des ISI, der schon seit Jahren mit einem ausgedehnten Netz von Schutzgelderpressung und Wegezöllen vor allem in der Wirtschaftsmetropole Mosul Millionen einnahm.
An vielen Orten Syriens ließen sich ab Herbst 2012 ausländische Radikale nieder: In Azaz und Tal Rifaat in der Provinz Aleppo, in Aleppo selbst, in Meyadin am Euphrat tief im Osten nahe der irakischen Grenze. Sie blieben für sich, mischten sich selten mit den anderen Kämpfern, sondern bezogen ein Haus, eine verlassene Hühnerfarm und waren einfach da. »Wir wissen auch nicht, was die treiben«, zuckte ein Mann in Meyadin im Dezember 2012 mit den Schultern: »Die sind komisch. Aber sie tun nichts.« Sie wollten nur missionieren. Sagten sie zumindest. Manchmal gaben sie an, zur Nusra-Front zu gehören, wie in Aleppo, andernorts hatten sie sich gar keinen Namen gegeben, sondern nur von sich gesagt, sie seien »Brüder«: gekommen im Kampf für den wahren Glauben. Wie in Meyadin. Andere nannten sich Muhadschirun, nach der Hidschra, dem Auszug Mohammeds mit wenigen Getreuen aus Mekka: Der war Jahre später siegreich zurückgekehrt, um den neuen Glauben und die neue Macht zuerst in der Stadt selbst und dann in riesigen Gebieten durchzusetzen.
Der im Grunde genommen romantische Impuls, alles hinter sich zu lassen und für die gottgewollte Sache in die Fremde zu ziehen, war bei den Ankommenden allerdings oft nicht sonderlich durchdacht. Fragte man sie, warum sie gekommen seien, lautete die erste Antwort stets »Dschihad« und bald danach kam eine vage Idee von einem islamischen Staat. Doch hakte man weiter nach, wie die Phase des Kampfes denn übergehen sollte in eine des Staates, wurden die Antworten einsilbig. Das sei nicht ihre Sache, sagten die Neuankömmlinge. Oder: Gott werde da helfend eingreifen, sie müssten nur den Weg ebnen.
Diese radikalen Einwanderer hatten die strategische Weitsicht von Maulwürfen. Manchmal konnte man in den Cafés und Flughäfen der Südtürkei frustrierte Rückkehrer treffen, die sich bitterlich beklagten über die Undankbarkeit der Syrer. Fast wortgleich erzählten ein Tunesier, ein Marokkaner und ein Dagestaner: »Wir haben alles zu Hause hinter uns gelassen, die Wohnung, den Job aufgegeben, um in Syrien für den wahren Islam zu kämpfen, die Leute dort auf den rechten Pfad zu bringen. Aber was tun die Syrer? Die wertschätzen unser Opfer gar nicht!« Ihnen war entgangen, dass die Syrer bereits Muslime waren. Vielleicht hatte es ihnen einfach keiner gesagt.
Es bedarf eines starken Motivs, ohne Not die eigene Existenz hinter sich zu lassen und zum Kampf in ein Land zu ziehen, mit dem man bis dato nichts zu tun gehabt hatte. Doch über diesen Kampf hinaus äußerte keiner von diesen Fußsoldaten des Dschihad einen Grund, warum sie nun ausgerechnet nach Syrien gekommen waren und was sie zum Aufbau eines islamischen Staates beitragen wollten – außer, ihn zu beherrschen. Es war die hermetische Denkwelt einer Sekte, deren Jünger sich jedoch nicht auf ihresgleichen und ihre Rituale beschränken – sondern fortwährend versuchen, weitere Gebiete unter ihre Herrschaft zu bringen.
Das Merkwürdige an den Männern war der Widerspruch: Einzeln wirkten die meisten dieser Muhadschirun konfus, aggressiv, beseelt – aber vor allem planlos. Doch gleichzeitig gab es die zentralen Unterkünfte, waren nahe dem Grenzdorf Atmeh und der Stadt Daret Azze militärische Trainingslager entstanden, die zu keiner Rebellengruppe gehörten, nicht einmal zur Nusra-Front – aber die straff organisiert waren und deren Männer mit keinem Journalisten sprachen. Die Einreisenden kamen aus Saudi-Arabien, Tunesien, der Türkei, dem Kaukasus, aus Algerien und Europa. Nur aus dem Irak war kaum jemand dabei, nicht einmal im Camp von Meyadin, eine Dreiviertelstunde Autofahrt von der syrisch-irakischen Grenze entfernt. Und die wenigen Iraker, die man dennoch traf, waren keine Dschihadisten, sondern wollten »gegen die Diktatur, für die Freiheit« kämpfen, wie es einer von ihnen bündig kundtat. Das war insofern merkwürdig, als westliche Geheimdienste stets angaben, die Nusra-Front sei ein Ableger des »Islamischen Staates im Irak«. Nur wo waren dann die Iraker?
Im Nachhinein erklärte es sich. Haji Bakr hatte den eigenen Kämpfern explizit untersagt, nach Syrien zu gehen. Zum einen wollte er die eigenen Ränge nicht schmälern, und zum anderen wollte er verhindern, dass seine Kader außer Kontrolle gerieten. Und Kontrolle war, ist das Wichtigste im »Islamischen Staat«.
Im Tosen des Krieges saß der »Herr der Schatten«, wie Bakr auch genannt wurde, in der ruhigen Kleinstadt Tal Rifaat und schrieb. Er skizzierte die Verwaltungsstruktur eines Staates bis auf Ortsebene, erstellte Listen zur schleichenden, unbemerkten Infiltration von Dörfern, entwarf Zuständigkeiten, wer wen überwachen solle. Mit Kugelschreiber zeichnete er die Befehlsketten des Sicherheitsapparates auf Briefpapier. Das stammte, vermutlich ein Zufall, vom syrischen Verteidigungsministerium, mit Briefkopf der Abteilung Unterkünfte und Immobilien. Was Haji Bakr entwarf und was in den folgenden Monaten erstaunlich akkurat umgesetzt wurde, war kein Glaubensmanifest, sondern der technisch präzis entworfene Bauplan für einen »Islamischen Geheimdienst-Staat«. Ein Stasi-Kalifat.
Der Plan zur Unterwerfung Nordsyriens begann mit demselben Detail für jeden Ort: Unter dem Vorwand, ein Daawa-Büro, ein islamisches Missionszentrum, zu eröffnen, sollten aus jedem Dorf willige und intelligente Gefolgsleute angeworben werden. Aus jenen, die zu Vorträgen und Kursen zum rechtgeleiteten islamischen Leben kämen, sollten ein oder zwei ausgewählt werden, ihr Dorf bis in die letzte Faser auszuspionieren. Dafür erstellte Haji Bakr eine Liste:
Zähle die machtvollen Familien auf.
Benenne die mächtigen Personen in diesen Familien.
Finde ihre Einkunftsquellen heraus.
Nenne Namen und Mannstärke der (Rebellen-)Brigaden im Dorf.
Sammle die Namen ihrer Anführer, wer sie kontrolliert und ihre politische Orientierung.
Eruiere ihre (gemäß Scharia) illegalen Aktivitäten, mit denen wir sie im Bedarfsfall erpressen können.
Falls mithin jemand kriminell war, schwul, eine geheime Affäre hatte, sollten all diese Details als kompromittierende Druckmittel gesammelt werden. »Die Klügsten machen wir zu Scharia-Scheichs«, hatte Haji Bakr angemerkt, »wir werden sie dann noch eine Weile trainieren und sie dann losschicken.« Als P. S. war der Hinweis angefügt, dass jeweils mehrere »Brüder« ausgewählt würden zu versuchen, Töchter der wichtigsten Familien zu heiraten, um »die Durchdringung dieser Familien sicherzustellen, ohne dass diese überhaupt davon wissen«.
Die Kundschafter sollten über ein Ziel-Dorf möglichst alles in Erfahrung bringen: Wer dort wohne, wer das Sagen habe, welche Familien religiös seien, welcher islamischen Rechtsschule sie angehörten, wie viele Moscheen es gebe, wer der Imam sei, wie viele Frauen und Kinder er habe und wie alt diese seien; wie seine Predigten seien, ob er eher der Mystiker-Variante, den Sufis, zuneige, ob er auf Seiten der Opposition stehe oder des Regimes und wie seine Position gegenüber dem Dschihad sei. Dann: ob der Imam ein Einkommen beziehe? Falls ja, von wem? Und zu welchen Familien gehören diese Unterstützer? Wählen sie den Imam aus, oder wer beruft ihn ins Amt? Und schließlich: Wie viele Demokraten gibt es im Dorf?
Wie seismische Signalwellen sollten die Prediger-Agenten funktionieren, ausgeschickt, noch kleinste Risse, uralte Verwerfungen in den Tiefenschichten der Gesellschaft aufzuspüren und alles zu nutzen, was deren Spaltung und Unterwerfung dienlich sein könnte.
Für manche Dörfer und Kleinstädte wie Tal Rifaat war der Prozess der Informationsgewinnung offensichtlich schon vorangeschritten. In den Papieren von Haji Bakr finden sich Listen der örtlichen Informanten, die meisten Anfang 20, andere aber auch erst 16 oder 17 Jahre alt.
In den Plänen, in denen er die Verwaltung des künftigen Staates skizzierte, kamen zwar auch Bereiche vor wie Finanzen, Schulen, Kindergärten, Medien, Transportwesen. Aber immer wieder ging es um das Kernthema, das in Organigrammen und Listen für Zuständigkeiten und Berichtspflichten akribisch abgehandelt wird: Überwachung, Spionage, Morde, Entführungen. Für jeden Schura-Rat, ein allgemeines Aufsichts- oder Beratungsgremium und die zentrale Verwaltungsinstanz, hatte Haji Bakr einen Emir, einen Befehlshaber, für »Ermordungen«, einen Emir für Entführungen, einen für die Scharfschützen, einen für Kommunikation und Verschlüsselung sowie einen Emir zur Überwachung der anderen Emire vorgesehen – »falls sie ihre Arbeit nicht gut machen«. Die Keimzelle dieses gottgefälligen Staates würde das teuflische Räderwerk einer Zellen- und Kommandostruktur sein, die bodenlose Furcht verbreitet.
Von Anfang an geplant war, dass die Geheimdienste parallel arbeiteten, selbst auf Provinzebene: eine allgemeine Nachrichtendienst-Abteilung unterstand dem »Sicherheits-Emir« einer Region, der Vize-Emire für die einzelnen Bezirke befehligte. Jedem von diesen wiederum unterstanden sowohl ein Führer geheimer Spionagezellen wie ein »Nachrichtendienst- und Informationsmanager« des Bezirks. Die Spionagezellen auf der Ortsebene waren gesondert dem Stellvertreter des Bezirks-Emirs untergeordnet. Kurz: Jeder würde jeden überwachen.
Die Verantwortlichen für Gefängnisse und Verhöre sowie für die Ausbildung der Scharia-Richter in geheimdienstlicher Informationsgewinnung (sic) waren nochmal ausgegliedert und unterstanden ebenfalls dem Bezirks-Emir, während eine separate Abteilung der »Sicherheitsoffiziere« direkt dem regionalen Emir zugeordnet war.
Scharia, Gerichtsbarkeit, alles war nur Mittel zum Zweck, unterworfen einem einzigen Ziel: Überwachung und Bespitzelung. Selbst das Wort, das Haji Bakr für die Schaffung der echten Muslime, benutzte, Takwin, ist kein religiöser, sondern ein technischer Begriff, der die Implementierung von etwas bezeichnet.2
Ein unvoreingenommener Betrachter könnte den Eindruck gewinnen, George Orwell hätte Pate gestanden, dieser Ausgeburt paranoider Kontrolle seine Form zu geben. Aber es war viel simpler: Samir Abed al-Mohammed al-Khleifawi alias Haji Bakr modifizierte lediglich, womit er groß geworden war: Saddam Husseins allumfassenden Geheimdienstapparat, in dem sich niemand, auch kein Geheimdienstgeneral, je sicher sein konnte, nicht seinerseits bespitzelt zu werden. Diese »Republik der Furcht« hatte der irakische Exilautor Kanan Makiya 1989 unter Pseudonym beschrieben: Ein Staat, in dem jeder einfach verschwinden konnte und Saddam Hussein seinen offiziellen Amtsantritt 1979 mit der Aufdeckung einer fingierten Verschwörung besiegelte. Die angeblichen »Verschwörer« aus der Parteispitze endeten vorm Erschießungspeloton – und wurden von den verschont gebliebenen Führungskadern erschossen. Selbst die Überlebenden entkamen nicht.
Worauf der Staats-Entwerfer Haji Bakr ebenfalls viel Wert legte: Es ging nicht um Personen, es ging um Funktionen. Jeder sollte, musste ersetzbar bleiben. Für die meisten Positionen war ein Stellvertreter mit eingeplant. Dabei ging es in seinen Organigrammen vorläufig nicht um die mörderischen Machtspiele einer etablierten Diktatur und auch nicht darum, den engsten Führungszirkel einer global operierenden Terrorgruppe vor dem Einschleusen ausländischer Agenten zu bewahren – sondern um die schrittweise Machtübernahme in syrischen Kleinstädten.
Was er in seinen wechselnden Unterkünften zu Papier brachte, Blatt für Blatt mit sorgsam umrandeten Kästchen für die einzelnen Zuständigkeiten, war nichts Geringeres als eine Blaupause für die voranschreitende Unterwerfung all jener Gebiete, die sich nicht umgehend gegen die so harmlos daherkommende Unterwanderung zur Wehr setzten. Haji Bakrs Pläne, die nach seinem Tod an einem sicheren Ort verwahrt wurden und hier erstmals veröffentlicht werden, umfassen offenbar auch die frühen Stadien seiner Überlegungen. Von manchen Aufrissen existieren verschiedene Entwürfe: Mal sollte der »Sicherheits-Emir« einer Region noch eine eigene Geheimdienstabteilung befehligen, parallel zum »Sicherheits-Emir« eines Bezirks, mal sollten die Geheimdienstzellen auf Bezirksebene gebündelt werden. Mal gab es noch einen »Scharia-Richter« des Sicherheitsdienstes auf Regionalebene, mal nicht.
Aber für den Anfang ging es darum, erst einmal Fuß zu fassen. So entstanden, ganz nach Plan, ab Frühjahr 2013 in vielen Dörfern und Städten Nordsyriens Daawa-Büros, unschuldig wirkende Missionierungsstellen, wie sie von zig islamischen Wohltätigkeitsorganisationen weltweit vielfach mit Geldern aus Saudi-Arabien in den vergangenen Jahrzehnten eröffnet wurden. Gegen Daawa ist nichts einzuwenden, harmloser als mit religiöser Bekehrung kann man sich nicht geben. Genau das war der Plan. Es galt, einen Mittelweg zu finden: das Weichbild der Gesellschaft zu kennen, ohne sich von vornherein allzu unbeliebt zu machen und Feinde zu schaffen, die man noch nicht besiegen konnte.
So machte etwa in Raqqa ein Daawa-Büro auf, »aber die sagten nur, sie seien ›Brüder‹, erwähnten ISI