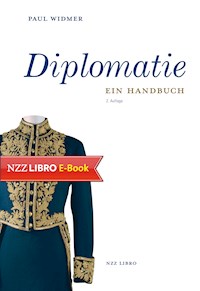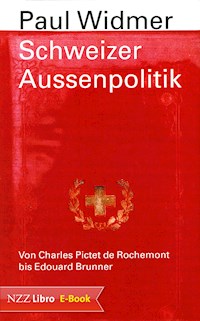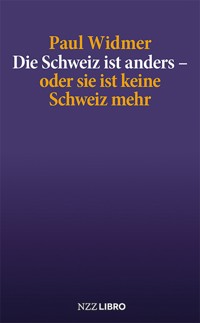
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Modell «Schweiz» ist in Gefahr. Der Druck von aussen, sich den üblichen Standards anzupassen, steigt. Und die Bereitschaft im Innern, Eigenverantwortung zu übernehmen, lässt nach. Was bedeutet das? Es könnte auf das Ende der historischen Mission der Schweiz hinauslaufen. Voltaire staunte, dass die Schweiz einen Platz in der Weltgeschichte ergattern konnte, obschon sie nichts als ein paar Felsbrocken anzubieten habe. Warum nehme man überhaupt von ihr Notiz? Seine Antwort: weil sie mehr Freiheit biete. Immer wieder schaffte es die Schweiz, sich mit ihrer Demokratie, dem Föderalismus, der Neutralität und der Mehrsprachigkeit von den vorherrschenden Trends abzuheben. Sie war eine Alternative. Die Schweiz muss ihre Eigenart bewahren. Entweder hat sie etwas Spezielles zu bieten, oder sie geht im Mainstream auf. Auf Voltaires Frage gäbe es dann keine Antwort mehr. Die Schweiz würde zwar dem Namen nach noch existieren, aber das wäre auch alles. Als Alternative hätte sie abgedankt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Einleitung
Das Modell Schweiz – eine Alternative
Der Name Schweiz – ein Wirrwarr
Der Begriff Schweiz – eine Benchmark
Die Nation Schweiz – eine Nation avant la lettre
Die Schweiz als Staat – ein notwendiges Übel
Die neutrale Schweiz – eine gefährdete Erfolgsgeschichte
Fazit
Ausgewählte Literatur
Personenverzeichnis
Ebenfalls bei NZZ Libro erschienen
Ebenfalls bei NZZ Libro erschienen
Über den Autor
Über das Buch
Paul Widmer
Die Schweiz ist anders – oder sie ist keine Schweiz mehr
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
2. Auflage 2024
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 2. Auflage 2024 (ISBN 978-3-907396-73-5).
© 2024 NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Lektorat: Kerstin Köpping
Korrektorat: Ulrike Ebenritter
Umschlag: Felix Wallbaum, Weiß-Freiburg GmbH
Gestaltung, Satz, Datenkonvertierung: 3w+p GmbH, Rimpar
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN Print 978-3-907396-73-5ISBN E-Book 978-3-907396-74-2
www.nzz-libro.ch
Einleitung
Noch ein Essay zur Schweiz, als ob es deren nicht schon genug gäbe! Ich höre schon den Seufzer, wie man ihn nach endlosen Wortmeldungen auf langweiligen Tagungen vernimmt: Mein Gott, alles ist schon gesagt, nur noch nicht von allen. Und gibt es zur Schweiz überhaupt noch etwas Positives zu sagen? Nein, das sollte man besser unterlassen, meinte der britische Historiker Tony Judt im Leibblatt der linksliberalen Trendsetter, in der New York Review of Books. Die Schweiz heutzutage zu rühmen, sei völlig altbacken; das sei, als ob man ein Loblied aufs Zigarettenrauchen anstimmte.1 Und der luzide Intellektuelle, den es Jahr für Jahr nach Mürren im Berner Oberland zog, tat es 2010 in seinem letzten Lebensjahr trotzdem.
Mein Vorhaben ist, ich gestehe es, etwas vermessen. Dennoch will ich, Trend hin oder her, nicht davon absehen. In der Schweiz lief einiges anders als in den Ländern ringsum. Es lohnt sich, darauf einen Blick zu werfen. So stelle ich einige Überlegungen zur Schweiz als Modell, als Name, als Begriff, Nation und Staat an, ergänzt um einige Beobachtungen zur Neutralität. Das tönt relativ abstrakt, ist es aber nicht. Ich operiere weniger mit Definitionen als mit konkreten Beispielen aus Geschichte und Gegenwart. Zuweilen greife ich tief in die Vergangenheit zurück, um die Gegenwart zu erklären. Der Philosoph Hermann Lübbe lehrt, dass man das, was stutzig macht, was vom Üblichen abweicht, nur historisch erklären kann.2 Man muss den besonderen Grund aufdecken, weshalb etwas so geworden ist, wie wir es vorfinden. Die Schweiz weicht in den sechs Bereichen, die ich analysiere, markant von den anderen Staaten ab. Sie schlug eine Sonderentwicklung ein.
Bei meinem historisch grundierten Ansatz leitet mich die Überzeugung, dass man aus der Geschichte lernen kann – zwar weniger, wie man es machen muss, als wie man es nicht machen darf. Denn eine Situation präsentiert sich in der Gegenwart nie genau gleich wie in der Vergangenheit. Die Zukunft ist stets offen für verschiedene Varianten. Die Vergangenheit dagegen ist abgeschlossen. Dort kann man das Verhältnis von Ursache und Wirkung studieren. Man kann Erfolg und Misserfolg erklären. Geschichtliche Erfahrung liefert keine Erfolgsrezepte für die Gestaltung der Zukunft, aber sie hilft, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Ja, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.
Was also ist an der Schweiz erklärungsbedürftig?
Da ist vorab ihr eigenständiger politischer Weg. Zu allen Zeiten erhielt die Schweiz deswegen viel Aufmerksamkeit, im Positiven wie im Negativen. Für einige verkörpert sie die Kleinstaaterei in Reinkultur, andere jedoch sehen in ihr ein modellhaft gutes Staatswesen. Dabei werden zwei verschiedene Züge hervorgehoben. Die einen empfehlen die Schweiz wegen ihrer lebendigen Demokratie, die anderen wegen ihres ausgeprägten Föderalismus und nicht wenige wegen beidem zusammen.
Dann gibt es einiges zum Namen zu sagen. Ich kenne kein anderes Land, das in der Namensgebung einen solchen Wirrwarr aufweist. Die Schweizer setzten sich über alle Ansätze zu einer Normierung respektlos hinweg. Auf derart Nebensächliches legten sie wenig Wert. Eine solche Nonchalance konnten sie sich nur leisten, weil die Schweiz als Nation längst gefestigt war, als der Sprachnationalismus aufkam und die nationalen Attribute für sakrosankt erklärte.
Erstaunlich ist die Schweiz auch als Begriff. Wer von ihr redet, ruft starke Assoziationen hervor. Überall in der Welt kann man sich darunter etwas vorstellen, nicht nur geografisch, sondern auch politisch, gar staatskundlich. Nicht nur in den Nachbarländern, selbst auf anderen Kontinenten verbindet man die Schweiz mit Demokratie, Neutralität oder Frieden. Sie steht für einen bestimmten Typus von Staat. Dass ein kleines Land zu einem Aushängeschild oder, neudeutsch gesprochen, zu einer Benchmark wird, kommt eher selten vor. Die frühe Entstehung des Begriffs Eidgenossenschaft schon im 14. Jahrhundert trug wesentlich dazu bei.
Und die Schweiz als Nation: Ist sie eine oder ist sie keine? Natürlich ist sie eine, aber keine Sprachnation, sondern eine Willensnation. Was die Schweiz zusammenhält, ist der Wille zur Freiheit. Daraus ist die Eidgenossenschaft entstanden. Und dieser Wille hält sie bis heute zusammen. Mit grosszügigen direkt-demokratischen Rechten und einem starken föderalistischen Schutz vor zentraler Macht gewährt sie mehr Freiheit als die Staaten ringsum. Sollte dies eines Tages nicht mehr der Fall sein, wäre es um ihre Daseinsberechtigung schlecht bestellt.
Zum Staat dagegen hatten die Schweizer lange ein distanziertes Verhältnis. Nichts von Staatsvergötterung, nichts von Verfassungspatriotismus. Den Staat, genauer den Zentralstaat, betrachteten sie eher als ein notwendiges Übel. Die Eidgenossen liessen den Ausbau der Verwaltung, diesen sicht- und spürbarsten Ausdruck des Staates, nur mit grösster Zurückhaltung zu. Dagegen suchten sie mit einem feinmaschigen Milizwesen die öffentlichen Aufgaben selbst zu erledigen. Eigenverantwortung und Selbstbestimmung schätzte man höher als einen machtvollen Staat. Die Kraft der mittelalterlichen Gemeindeautonomie wirkte über Generationen nach, bis sich die moderne Schweiz mit der Bundesverfassung von 1848 eine föderalistische Gestalt gab. Inspiriert vom Verfassungsmodell der Vereinigten Staaten und in Symbiose mit Errungenschaften der Französischen Revolution floss alteidgenössisches Gedankengut in die neue Ordnung ein. Die Staatsskepsis ist mittlerweile stark abgeflacht. Doch selbst heute noch dürfte die Staatsgläubigkeit in der Schweiz um einiges niedriger sein als in anderen Ländern. Politisches Denken in der Schweiz hat nicht selten einen antistaatlichen Stachel.
Schliesslich noch die Neutralität. Sie gehört so selbstverständlich zur Schweiz wie das Matterhorn. Während Jahrhunderten machte die Eidgenossenschaft die Neutralität zur Grundlage ihrer Aussenpolitik. Auf dem Wiener Kongress (1814/15) spielte sie gar eine Pionierrolle. Die Signatarstaaten bestätigten, dass ihre bewaffnete und immerwährende Neutralität legitimer Teil einer Friedensordnung ist. Sie erkannten sie völkerrechtlich an. Inmitten von Grossmächten bemühte sich die Schweiz seither, mit grosser Konstanz eine Neutralitätspolitik zu verfolgen, nicht immer ganz lupenrein, im Grossen und Ganzen aber doch recht zuverlässig. Damit ist sie ausserordentlich gut gefahren.
Und heute? Im Ukrainekrieg hat es die Schweiz mit einer wankelmütigen Politik fertiggebracht, dass die Hauptantagonisten in Moskau und Washington in dem einen Punkt übereinstimmen, die Schweiz hätte ihre Neutralität aufgegeben. Wenn ein solcher Eindruck aufkommen kann, dann ist einiges falsch gelaufen. Ist der Schweiz der Mut zum Anderssein abhandengekommen? Schauen wir die Sonderentwicklungen im Detail an.
Endnoten
1Tony Judt: Magic Mountains. In: The New York Review of Books, May 27, 2010.
2Hermann Lübbe: Geschichtsbegriff und Geschichtsinteresse. Basel und Stuttgart 1977, 35 ff.
Das Modell Schweiz – eine Alternative
Die Formulierung sitzt, wie bei fast allem, was er sagte. In seinem Essai sur les moeurs et sur l'esprit des nations konstatiert Voltaire mit Erstaunen, dass es den Eidgenossen gelungen sei, einen Platz in der Weltgeschichte zu ergattern. An sich sei die Schweiz nichts als ein armseliges Stück Land in unwirtlichen Bergen. Warum nehme man überhaupt von ihr Notiz? «Man erregt nur Aufmerksamkeit, wenn man selber etwas ist. Doch alles, was die Natur in drei Vierteln dieses Landes zu bieten hat, ist ein verhangener Himmel, unfruchtbare und steinige Böden, Berge und Abhänge. Dennoch streitet man sich mit gleichem Eifer um die Souveränität dieser Felsbrocken wie um das Königreich Neapel oder um Kleinasien.»3
Was also ist es, das die Schweiz anzubieten hat? Die Antwort des Chef-Aufklärers: Freiheit. So sah es auch Friedrich Schiller. Auch für ihn, der mit «Wilhelm Tell» das grossartigste Schauspiel über die Demokratie geschrieben hat, war auf den ersten Blick nicht einsichtig, weshalb die Bergler ihre unergiebigen Böden beackerten, statt in die fruchtbaren Ebenen zu ziehen. Im wohlhabenden Flachland liess sich leichter leben. Aber etwas hatten die Eidgenossen den andern voraus: ihre Freiheit. Dieser politische Vorteil wog nach Schiller die materiellen Nachteile mehr als auf.
Tatsächlich beeindruckte die Schweiz, seit sie in der Frühen Neuzeit aus dem Ränkespiel der Grossmachtpolitik ausgeschieden ist, nie durch äussere Statur. Sie bewegte sich am Rande des Geschehens, ziemlich abgehoben vom Zeitgeist. Aber sie war eine eigenwillige Zeugin für alternative Möglichkeiten staatlicher Existenz. Deshalb verachtete sie der deutschnationale Historiker Heinrich von Treitschke als eine Anomalie – ein kurioses Land, das sich anders als die Länder ringsum entfaltet, aber letztlich für den Gang der Weltgeschichte irrelevant ist.4 In mehreren historischen Phasen hat sich die Schweiz als – so Karl Schmid – «Ort des Gegenläufigen» hervorgetan.5
Auch heute ist der Wille zum eigenständigen Weg nicht erloschen. Er macht sich vor allem im Verhältnis zur Europäischen Union (EU) bemerkbar. Mögen andere Staaten in die EU streben oder sich eng assoziieren, die Schweiz gibt sich distanziert. Sie will die intensiven Beziehungen lediglich unter Wahrung der Grundsätze der direkten Demokratie und des Föderalismus pragmatisch ausbauen. Das ist ihr wichtiger als das wohlige Gefühl des Mitmachens. Es geht ihr um den Schutz ihrer von unten her aufgebauten Demokratie.
Nicht äussere Kennzeichen, nein, politische Ideen, für die sie steht, machen die Schweiz seit jeher interessant. Ihre Eigenständigkeit provoziert. Sie erhält viel Anerkennung, aber auch viel Ablehnung. Je nach Zeitalter überwiegt das eine oder das andere. Den kultivierten Humanisten etwa waren die raubeinigen Eidgenossen nicht geheuer. Der Elsässer Jakob Wimpfeling, der als Begründer der deutschen Geschichtsschreibung gilt, lässt sich über die «Herrschaft des unleidlichen Pöbels» und die «wilde Staatsform» der Eidgenossenschaft aus.6 Auch Trithemius, ansonsten ein gesittet auftretender Abt von Hirsau, hielt nicht viel von den Schweizern. Sie seien «von Natur übermütig, den Fürsten feind, aufrührerisch und schon seit langer Zeit widerspenstig und ungehorsam gegen die Herren, von Verachtung gegen andere, von Anmassung erfüllt, im Krieg hinterlistig und Liebhaber des Betrugs, im Frieden nie recht beständig (...)».7 Die Diffamierung ging so weit, dass sich der einheimische Humanist Glareanus genötigt sah, die Würde der Schweizer zu verteidigen. Nur weil diese sich nicht wie Sklaven den Tyrannen unterworfen hätten, sondern ihre Freiheit mit dem Recht und den Waffen verteidigten, verdienten sie nicht, derart in den Dreck gezogen zu werden.8
Auch im 19. Jahrhundert kam die Schweiz bei den europäischen Vordenkern meistens nicht gut weg. Je mehr das Jahrhundert voranschritt, desto stärker überlappte der Drang nach Einheit den Drang nach Freiheit. Den ungestümen Nationalstaaten war die mehrsprachige Schweiz kein Vorbild – weit eher ein schrulliges Auslaufmodell. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der als junger Mann immerhin drei Jahre in Bern als Hauslehrer verbracht hatte, bedachte die Schweiz in seinem philosophischen Werk mit keinem Wort, nicht einmal mit einer Fussnote. Die Volkssouveränität gehöre «zu den verworrenen Gedanken, denen die wüste Vorstellung des Volkes zugrunde liegt. Das Volk ohne seinen Monarchen (...) ist die formlose Masse, die kein Staat mehr ist (...)».9
Unter Hegels Sickereffekt beargwöhnte die gesamte nationalistische deutsche Geschichtsschreibung das Kuriosum in den Alpen. Selbst die Liberalen konnten seit Bismarcks Zeiten mit der helvetischen Gegenläufigkeit nicht mehr viel anfangen. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert stand die Schweiz keineswegs im Zentrum internationaler Bewunderung, sondern auf einem Abstellgleis. Sogar ein freisinniger Bundesrat soll einem Ausländer gestanden haben, er sei nur für die Schweiz ein Republikaner, im Ausland sei ihm die Monarchie auch lieber.10 Mehrheitsfähig war die Ansicht, mit dem Schweizer Staat lasse sich kein Staat machen.
Später, nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch der kontinentalen Reiche, sollte sich das etwas ändern. Aber die grundsätzlichen Zweifel am Schweizer Modell verstummten nicht, auch nicht im Landesinnern. Dabei wurde insbesondere der starke Föderalismus als altväterisch abgelehnt. Der scharfzüngige Theologe Karl Barth warnte 1963, die Schweiz sei drauf und dran, «der Dorftrottel Europas» zu werden – was das Nachrichtenmagazin Der Spiegel selbst Jahre danach noch genüsslich im Artikel Die Schweiz – Vorbild von gestern zitierte.11 Sogar ein so kluger Kopf wie Herbert Lüthy hat, wie Oliver Zimmer in seinem meisterhaften Essay Wer hat Angst vor Tell? nachwies, das Kunststück fertiggebracht, im Abstand von weniger als drei Jahren zwei weitgehend gegensätzliche Analysen zum Föderalismus vorzulegen: das erste Mal mit positivem (Die Schweiz als Antithese), das andere Mal mit negativem Unterton (Vom Geist und Ungeist des Föderalismus).12
Auch das Ausland sparte und spart nicht mit ätzender Kritik. Für Dominique Moïsi, einen bekannten französischen Experten für internationale Beziehungen, verkörpert die Schweiz – wie schon für Orson Wells im Film Der dritte Mann – den Staat der Spiesser schlechthin. Er erklärt, Europa hätte die Wahl zwischen Aufstieg und Abstieg. Zur Illustration der falschen Wahl fällt ihm nur die Schweiz ein. Sollte Europa diesem Beispiel folgen, dann entwickle es sich zu einem wohlhabenden Kontinent mit Nischenerfolgen in der Technologie und mit einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft, werde aber mit seiner Selbstsucht politisch völlig bedeutungslos und versinke im Provinzialismus.13
Gewiss, wer das Grosse, wer das Mächtige und Elitäre vergöttert, den muss die Schweiz enttäuschen. Aber das sind nicht die Werte, die sie im Laufe ihrer Geschichte angestrebt hat. Diese sind, wie eben erwähnt, oft gegenläufig zu den Zeittrends. Sie beruhen auf den vier Pfeilern des Schweizer Staatswesens. Es sind dies die Demokratie, der ausgeprägte Föderalismus, die dauernde bewaffnete Neutralität und die Mehrsprachigkeit. Allen ist eines gemeinsam: Sie schränken die Machtkonzentration im Staat ein. Die direkte Demokratie nimmt Regierung und Parlament an die kurze Leine und stellt sicher, dass der Volkswille auch in Sachgeschäften befolgt wird. Der Föderalismus stärkt Kantone und Gemeinden auf Kosten des Bundes. Mit der Neutralität versagt sich die Schweiz selber jegliche militärische Eroberung und beschneidet den aussenpolitischen Spielraum der Regierung. Mit der praktizierten Mehrsprachigkeit setzt sie der kulturellen Dominanz einer einzigen Sprachgruppe Grenzen.
Alle vier Pfeiler werden gelegentlich als Modell hingestellt, sei es einzeln, sei es in Kombination. Das gilt auch für die Neutralität. So wurde etwa Österreich 1955, ehe es seine Souveränität zurückerlangte, im Moskauer Memorandum darauf verpflichtet, «immerwährend eine Neutralität der Art zu üben, wie sie von der Schweiz gehandhabt wird.»14 Auch in der Diskussion um den militärischen Status der Ukraine wird die Schweizer Neutralität zuweilen ins Spiel gebracht. Der deutsche SPD-Politiker Otto Schily beispielsweise preist sie als Lösung an. Zudem sollte sich seiner Meinung nach die Ukraine auch am Schweizer Umgang mit der Mehrsprachigkeit orientieren. «Die Schweiz hat es in mustergültiger Form verstanden, über Jahrhunderte eine freiheitliche Gesellschaft zu entwickeln, mit urdemokratischen, vorwiegend dezentralen Entscheidungsverfahren sowie mit wechselseitigem Respekt vor unterschiedlichen kulturellen und ethnischen Prägungen, einschliesslich der dort selbstverständlichen Akzeptanz der Mehrsprachigkeit.»15
Der relativ gelassene Umgang mit verschiedenen Sprachen und Kulturen in der Schweiz wird auch von anderen als Vorbild hingestellt. Nach dem Fall der Berliner Mauer plädierte etwa der ungarische Intellektuelle György Konrád für eine Verschweizerung Mitteleuropas. Oder der deutsche Autor und Theatermacher Michael Schindhelm empfahl dasselbe für ganz Europa. Am häufigsten jedoch wird die Schweiz für die beiden anderen Pfeiler ins Spiel gebracht: für ihre partizipative Demokratie und ihren Föderalismus.
Die Bewunderung für die Freiheiten der Schweizer reicht weit zurück, bis zur Entstehung der Eidgenossenschaft. Ihre Bündnisse sollen schon die Aufmerksamkeit von zeitgenössischen Gelehrten erregt haben. Nach Jacques Attali, einem überaus produktiven französischen Intellektuellen und ehemaligen Berater von Präsident François Mitterrand, war besonders der Spätscholastiker Johannes Duns Scotus von den Eidgenossen begeistert. Diese hätten genau jenen Staat verwirklicht, den er in seiner politischen Philosophie postulierte.16
Wer war Duns Scotus? Der Franziskanermönch wurde um 1266 in Schottland geboren, lehrte vorwiegend in Paris und verstarb 1308 in Köln. Er war hochgelehrt, einer der angesehensten Theologen und Philosophen des Mittelalters. Ob er tatsächlich die Eidgenossen als politisches Vorbild nahm, ist meines Erachtens nicht nachgewiesen. Jedenfalls liefert Attali keine Beweise. Und Nachfragen bei anerkannten Spezialisten der mittelalterlichen Philosophie ergaben keine Bestätigung von dessen Behauptung. Doch eines ist sicher: Die politische Theorie des «doctor subtilis» weist hohe Übereinstimmung mit dem auf, wozu sich die Bauern um den Vierwaldstättersee verpflichteten, nämlich keinen Herrscher ausser dem Kaiser über sich anzuerkennen, selbst zu bestimmen, was bei ihnen Gesetz ist, sich durch Bündnisse gegenseitig Beistand zuzusichern und etwaige Streitigkeiten durch Schlichtung zu beheben.