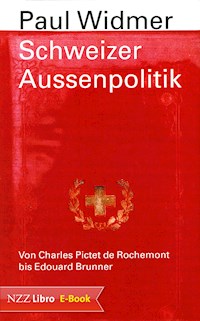Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Neue Kommunikationsformen und neue Akteure verändern die internationalen Beziehungen. Die Diplomatie dagegen hält wie kaum ein anderer Beruf die Tradition hoch. Wie bewältigt sie die neuen Herausforderungen? Dieses Handbuch gibt eine verbindliche Antwort darauf. Der Autor verfügt über langjährige Erfahrung als Diplomat, aber auch über enge Beziehungen zur akademischen Welt. Zum ersten Mal seit fünfzig Jahren wird die Praxis der Diplomatie im deutschen Sprachraum wieder umfassend dargestellt. Das Buch enthält u.a. Kapitel zur Geschichte der Diplomatie, zum diplomatischen Recht, zur Public Diplomacy und E-Diplomatie, zum Aufbau von Aussenministerium und Vertragsnetz, zu den professionellen und charakterlichen Anforderungen an die Diplomaten, zur Sprache als Werkzeug der Diplomatie, zu den Eigenheiten der multilateralen Diplomatie und zu Seriösem und weniger Seriösem in der sogenannten Friedensdiplomatie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
PAUL WIDMER
Diplomatie
EIN HANDBUCH
2. überarbeiteteund erweiterte Auflage
NZZ Libro
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2018 NZZ Libro, Neue Zürcher Zeitung AG, Zürich
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 2. Auflage 2018 (ISBN 978-3-03810-385-1)
Lektorat: Ingrid Kunz Graf, Schaffhausen
Titelgestaltung: GYSIN [Konzept+Gestaltung], Chur
Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN E-Book 978-3-03810-388-2
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Neuen Zürcher Zeitung
Vorwort
Der britische diplomatische Dienst geniesst einen ausgezeichneten Ruf. Doch in Grossbritannien betreibt man nicht nur eine geschickte Diplomatie. Man denkt auch darüber nach und schreibt Bücher zum Thema. Das hat Tradition. Auf der ganzen Welt gibt es kein berühmteres Nachschlagewerk als den «Satow». Seit der ehemalige Diplomat und Gelehrte Sir Ernest Satow seinen Guide to Diplomatic Practice vor hundert Jahren herausgebracht hat, wurde das Standardwerk immer wieder aufgelegt und überarbeitet. Bis heute schlägt man darin nach, wenn man etwas genau wissen will. Und Satow fand etliche Nachfolger. An britischen Universitäten – und nun auch an amerikanischen – wird Diplomatie gelehrt, häufig von Diplomaten, die zwischen Theorie und Praxis pendeln. Das fördert natürlich die Publikationen. Gerade in jüngster Zeit erschienen mehrere Handbücher zur diplomatischen Praxis sowie Sammelbände zu Teilbereichen der Diplomatie.
Ganz anders sieht es im deutschen Sprachraum aus. Handbücher zur Diplomatie sucht man vergebens. Das letzte umfassende Werk stammt aus der Feder des italienischen Diplomaten Pietro Gerbore. Erscheinungsjahr 1964. Ansonsten findet man Monografien zu diesem und jenem – und viel Memoirenliteratur. Diplomaten schreiben ihre Erinnerungen gern auf. Einige haben etwas zu berichten, andere würden ihre biederen Denkwürdigkeiten besser im Kreis von Freunden und Verwandten zirkulieren lassen. Zu viele Reiseberichte, zu viel Cocktailgeplauder. Und dann gibt es die Völkerrechtsliteratur. Sie füllt ganze Regale. Wer etwas zum diplomatischen Recht sucht, ist gut bedient. Aber sonst?
Das war die Situation, als ich im Herbst 2011 an der Universität St. Gallen mit einem Lehrauftrag in internationalen Beziehungen begann. Mein Kurs «Grundzüge der diplomatischen Praxis» richtet sich in erster Linie an Studenten, die in die Diplomatie einzusteigen erwägen, in zweiter Linie auch an Betriebswirtschaftler, die wissen möchten, was es mit der Diplomatie auf sich hat. Das vorliegende Handbuch ist aus diesem Kurs erwachsen. Es sucht das weite Feld der Diplomatie zu vermessen, die einzelnen Domänen abzustecken und in einen Gesamtkontext einzuordnen, kurz: eine Tour d’Horizon der Diplomatie zu vermitteln.
Ich bemühte mich, einen Mittelweg zwischen theoretischen Erwägungen und praktischen Erörterungen einzuschlagen, berücksichtigte die vorhandene Literatur, stützte mich aber auch auf meine eigenen Erfahrungen in der bilateralen und multilateralen Diplomatie. Natürlich ist ein solches Verfahren stark durch die eigene Biografie geprägt. Das kommt in der Wahl der Beispiele ebenso zum Vorschein wie in den Urteilen. Auch erfolgt die Darstellung von einem Schweizer Blickwinkel aus. Allerdings verglich ich die Verhältnisse in der Schweizer Diplomatie immer wieder mit den diplomatischen Diensten anderer Länder. Da viele meiner Studenten aus Deutschland stammen, lag mir besonders daran, die Diplomatie des Auswärtigen Amtes einzubeziehen. Herrn Botschaftsrat Michael Cantzler von der Deutschen Botschaft in Bern – und vorher Leiter der Ausbildung für den gehobenen auswärtigen Dienst in Berlin – danke ich, dass er im Kapitel «Das Aussenministerium» die Angaben zum Auswärtigen Amt überprüfte.
Auch anderen Personen habe ich Grund zu danken, zuerst Herrn Botschaftsrat Dr. Thomas Oertle, der das gesamte Manuskript mit der Gründlichkeit und dem Scharfsinn des ETH-Absolventen durchgesehen hat. Botschafter Lorenzo Schnyder von Wartensee hatte die Freundlichkeit, sich jene Kapitel anzuschauen, in denen er sich als ehemaliger Protokollchef besonders auskennt. Schliesslich durfte ich einmal mehr auf die angenehme Zusammenarbeit mit dem Leiter des Verlags Neue Zürcher Zeitung, Herrn Hans Peter Thür, und dessen Team zählen.
Zum Schluss noch drei Bemerkungen: In diesem Buch gibt es etliche statistische Angaben. Der Leser, der das Buch vielleicht erst in einigen Jahren in die Hände nimmt, möchte sicher wissen, auf wann sich diese Angaben beziehen. Um den Lesefluss nicht ständig mit Klammerangaben von der Art «(Stand: 20. 7. 2013)» unterbrechen zu müssen, schreibe ich oft einfach «heute». Das «heute» – oder ein anderes Adverb, das die Gegenwart anzeigt – bezieht sich auf den Sommer 2013. Sofern eine exakte Angabe meines Erachtens unerlässlich ist oder wenn die Zeitangabe vom Sommer 2013 abweicht, füge ich den genauen Zeitpunkt in Klammern an.
Seit einigen Jahrzehnten nimmt die Anzahl der Frauen in der Diplomatie stark zu. Auf allen Stufen trifft man Diplomatinnen an. Selbst Aussenministerinnen sind keine Ausnahme mehr. Um diesen Sachverhalt korrekt wiederzugeben, müsste man eine Vokabel oft in beiden Geschlechtsformen anführen, also von Botschafter und Botschafterin sprechen. Diese umständliche Schreibweise habe ich vermieden. Aber es versteht sich von selbst, dass die männliche Form von «der Botschafter» genau so beide Geschlechter umfasst wie umgekehrt das weibliche «die Exzellenz».
Schliesslich muss ich noch anfügen, dass ich mich in meinen Ausführungen zur Geschichte der Diplomatie auf den westlichen Kulturkreis beschränkt habe. Ein Grundmuster staatlichen Verhaltens wie die Diplomatie kommt jedoch auch in anderen Kulturkreisen vor. China und Indien haben schon früh diplomatische Bräuche entwickelt. Und in der islamischen Welt setzte bald nach der Islamisierung ebenfalls eine eigene diplomatische Tradition ein. Für diese Bereiche sei auf die weiterführende Literatur verwiesen.
Bern, im Herbst 2013
Vorwort zur zweiten Auflage
Der erfreuliche Anklang, den das Handbuch fand, machte schon nach knapp vier Jahren eine Neuauflage nötig. Ich passte für die Neuauflage viele statistische Angaben an, ergänzte einige Textstellen und fügte einen neuen Abschnitt über die parlamentarische Diplomatie ein.
Verweise auf Literatur, die sich in der kommentierten Bibliografie oder im Literaturteil am Ende eines Kapitels befinden, sind im Text zwischen Klammern gesetzt (z.B. Satow, 3), andere Verweise, die sich auf weniger zentrale Darstellungen beziehen, sind in den Fussnoten zu finden.
Bern, im Frühjahr 2018
Einleitung
Die Diplomatie ist ein staatlicher Dienstzweig, der die offiziellen Beziehungen zum Ausland besorgt. Er vertritt die nationalen Interessen auf internationaler Ebene und setzt somit souveräne Staaten voraus. Doch was soll dieses Konzept von souveränen Staaten und nationaler Interessenvertretung? Einige finden, man könne im Zeitalter der Weltinnenpolitik nicht mehr von Aussenpolitik sprechen, sondern nur noch von internationalen Beziehungen. Die Auffassung von innen und aussen, ja das ganze Konzept der Souveränität beruhe auf einem falschen Ansatz. Damit könne man die Komplexität der heutigen Welt nicht mehr erfassen. «Die Diplomatie hat sich überlebt», diese Behauptung hört man immer wieder. Sie sei ein Zombie, der noch etwas zucke, aber kein richtiges Leben mehr in sich habe. Freilich, so neu ist diese Ansicht nicht. Kein Geringerer als Hugo Grotius, der Begründer des Völkerrechts, befand schon zu Beginn des 17.Jahrhunderts, man würde die Diplomatie, die sich in ihrer neuzeitlichen Form mit ständigen Gesandtschaften eben erst entfaltet hat, am besten gleich wieder abschaffen.1 Und Leo Trotzki wollte die Diplomatie zusammen mit dem Kapitalismus begraben. «Ich werde», meinte der erste Aussenminister des sowjetischen Russland, «einige revolutionäre Aufrufe erlassen und dann das Geschäft zumachen.»2
Neben den konzeptuellen Vorbehalten entzieht auch, so scheint es, die technische Entwicklung der Diplomatie den Boden unter den Füssen. Wozu noch Diplomaten in fremden Ländern stationieren, wenn man mit Internet, Skype und Laptop die Beziehungen mit anderen Staaten direkt aus dem Aussenministerium herstellen kann? Erneut fallen Todesurteile – allerdings nur die letzten in einer langen Reihe. Um nur einige der vorangehenden Stationen zu erwähnen: Mit der Einführung des Faxgeräts, hatte der amerikanische Präsidentschaftskandidat Ross Perot verkündet, brauche es die Diplomatie nicht mehr;3 das Aufkommen des Fernsehens hatte den Schnelldenker Zbigniew Brzezin´ski zum Kommentar verleitet, nun müsste man die Aussenministerien mit ihrer Diplomatie, wenn es sie nicht schon gäbe, nicht mehr erfinden;4 und als die ersten Telegrafen die Nachrichtenübermittlung revolutionierten, meinte Lord Palmerston, der überragende britische Staatsmann des 19. Jahrhunderts: «My God, this is the end of diplomacy.»5
Das Ende der Diplomatie also? Sieht man die Anzahl der Personen, die sich als Diplomaten ausweisen, bekommt man allerdings ein anderes Bild. Noch nie gab es so viele Diplomaten wie heute. Auch scheint die Attraktivität des Berufs unvermindert anzuhalten. Mehr junge Leute denn je versuchen die diplomatische Karriere einzuschlagen. Was hat folglich das Schlagwort vom Ende der Diplomatie auf sich? Nun, es ist falsch – aber nicht in jeder Hinsicht. Tatsächlich hat sich der Beruf stark gewandelt. Vom einstigen ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, der in fremden Landen fernab von jeglichen Interventionen der Zentrale Verträge für seinen Souverän aushandelte, ist nicht mehr viel geblieben. Der Diplomat wird heute an der kurzen Leine gehalten. Die von der Informationstechnologie zur Verfügung gestellten Möglichkeiten erlauben es der Zentrale, sogar in laufenden Verhandlungen einem Unterhändler das Wording zu diktieren. Gegenläufig zum technischen Fortschritt schrumpften die effektiven Vollmachten des Diplomaten.
Aber die Diplomatie erlebte einen Zuwachs in anderer Richtung. Bis tief ins 20. Jahrhundert hinein erachteten die meisten Botschafter nur die «grossen» politischen Fragen ihrer würdig. Um anderes, auch um die Wirtschaft, kümmerten sie sich eher mit der linken Hand. Gern schob man solche Angelegenheiten auf einen jüngeren Mitarbeiter ab. Doch das hat sich geändert. Immer mehr Aufgaben kommen auf eine Auslandsvertretung zu. Sie muss sich mit den unterschiedlichsten Sparten befassen, angefangen von der Wirtschaft, dem Handel, der Energie, der Wissenschaft, der Kultur, den Medien, den Migrationsfragen bis hin zur polizeilichen Zusammenarbeit und zur Touristenbetreuung. Zudem sollte eine Botschaft im Zeichen der Public Diplomacy medial überall präsent sein. Mehr denn je repräsentiert und empfängt ein Botschafter, hält Vorträge und betreut durchreisende Parlamentarier und andere Delegationen, netzwerkt er Tag und Nacht – nur eines tut er weniger: Er unterschreibt kaum noch Verträge im Namen seines Landes. Dass ein Botschafter sein Land nicht nur symbolisch, sondern auch rechtlich bei der akkreditierten Regierung vertritt, ist auf der Wichtigkeitsskala weit nach hinten gerutscht. Verkürzt kann man den Wandel so formulieren: Die Diplomatie hat an Tiefe eingebüsst, aber an Breite gewonnen. Und der Botschafter sticht weniger durch seine Vollmachten als durch seine Omnipräsenz hervor. Er ist zu einem ambassadeur extraordinaire et omniprésent geworden.
Um die Zukunft der Diplomatie muss man sich somit keine Sorgen machen, gleichgültig welche Theorien über die internationalen Beziehungen und welche umwerfenden technologischen Neuerungen auch auf den Markt kommen. Die Diplomatie wird weiterbestehen. Aber wie es um deren Qualität bestellt ist, das sollte man sich in der Tat überlegen. Die leichtfüssige Eventkultur, das zwitschernde Plaudern auf allen Kanälen, das ständige Telefonieren bekommen einem Beruf schlecht, in dem die Sprache das wichtigste Arbeitsinstrument ist. In der Diplomatie zählt, was grosse Diplomaten von Metternich über Bismarck bis zu Kissinger wussten, jedes Wort. Nicht umsonst spöttelt man: Ein Diplomat ist eine Person, die zweimal überlegt, bevor sie nichts sagt. Bei den Benutzern von sozialen Medien bekommt man oft den Eindruck, dass sie das Gegenteil praktizieren: Sie versenden zwei Messages, bevor sie sich etwas überlegen. Wenig erstaunlich, dass schon einige Diplomaten über ihre impulsiven Facebook-Einträge gestrauchelt sind.
Zu viele Worte, zu wenige Gedanken: Das sind die Kennzeichen der neuen Entwicklungen in der Diplomatie. Dieser Befund ergibt sich aus einer enervierenden Rastlosigkeit der diplomatischen Omnipräsenz. Jedermann ist rund um die Uhr abrufbar, jedermann prüft mehrmals täglich sein E-Mail-Konto, jedermann verschickt laufend Messages mit Kopien an Krethi und Plethi. Der quantitative Output ist beeindruckend, der qualitative weniger. Für vertiefte Analysen besteht kaum noch Zeit, weder zum Verfassen noch zum Lesen. Der lange Atem fehlt. Nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb George F. Kennan sein berühmtes «Langes Telegramm». Der 8000 Wörter umfassende Text beeinflusste die amerikanische Strategie auf Jahre hinaus. Er trug wesentlich dazu bei, dass die USA der Sowjetunion gegenüber eine Containment-Politik einschlugen. Solches ist heute undenkbar. Eine Analyse von dieser Länge würde im Aussenministerium wahrscheinlich zuerst gestapelt und dann archiviert. Gelesen würde sie bestenfalls von einem untergeordneten Sachbearbeiter. Auch fragt man sich, was die permanente Verfügbarkeit bringt. Bismarck verbrachte Monate auf seinen Landgütern und zog sich tagelang zurück, um eine Denkschrift zu verfassen. Er war oft unerreichbar. Hat das seine Entscheidungsfähigkeit geschwächt? Man erhält den gegenteiligen Eindruck.
Vieles hat sich also am diplomatischen Betrieb geändert. Dennoch ist die Aufgabe des Diplomaten im Kern über die Jahrhunderte hinweg die gleiche geblieben. Ein Diplomat wird von seiner Regierung in ein anderes Land geschickt, um dort offiziell die Interessen zu vertreten. Und wie geschieht das? Indem er glaubwürdig auftritt und mit Geschick für seine Sache argumentiert. So gewinnt er das Vertrauen seiner Gesprächspartner. Mit der Kraft des Wortes und mit seiner Persönlichkeit muss er überzeugen können. Etwas anderes steht ihm nicht zur Verfügung. Denn wir haben es mit souveränen Staaten zu tun. Die Diplomatie mit ihren ständigen Vertretungen, wie wir sie heute kennen, ist zu Beginn der Neuzeit gleichzeitig mit den souveränen Staaten entstanden, sozusagen als deren Ergänzung. Die Idee der Souveränität lässt über dem Souverän keinen anderen Herrscher zu. Folglich ist es eine sehr diffizile Angelegenheit, zwischen Staaten, von denen im Prinzip keiner sich von einem anderen etwas sagen lassen muss, einen Modus Vivendi zu finden. Nur zu leicht drohen die zwischenstaatlichen Beziehungen dem Diktat roher Gewalt zu verfallen. Doch mit den Mitteln der Diplomatie sucht man einen solchen Zustand zu vermeiden und die unterschiedlichen Interessen durch freiwillig eingegangene Verträge zu überbrücken.
Völkerrecht und Diplomatie haben die Aufgabe, die pure Macht in den internationalen Beziehungen einzudämmen und durch verlässliche Regeln zu ersetzen, die für alle Vertragspartner gleicherweise gelten. Dadurch wird Rechtssicherheit und Stabilität geschaffen. In den letzten Jahrzehnten wurden dabei grosse Fortschritte erzielt. Man könnte sich den enormen Aufschwung, den die internationalen Beziehungen im Zeichen der Globalisierung auf allen Gebieten genommen haben, ohne den Ausbau des internationalen Rechts gar nicht vorstellen. Aber deswegen darf man die nach wie vor bestehende Schwäche der internationalen Ordnung nicht übersehen. Das Gewaltverbot lässt sich nur insoweit durchsetzen, als sich die Staaten daran halten. Wenn die USA entschlossen sind, einen militärischen Einsatz ohne Genehmigung durch den UNO-Sicherheitsrat durchzuführen, kann niemand sie daran hindern. Trotz aller Verrechtlichung der zwischenstaatlichen Beziehungen gibt es in den meisten Streitfällen keine oberste Instanz, die einen Vertragsbrecher gegen dessen Willen zur Rechenschaft ziehen könnte.
Auch die liberale Weltordnung, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, beruht letztlich auf einem brüchigen Fundament, nämlich dem neuzeitlichen Staatensystem. Dieses ändert sich ständig. Es findet seinen Ausdruck in wechselnden politischen Konstellationen, die jeweils ihre eigenen völkerrechtspolitischen Vorstellungen durchzusetzen versuchen. Die Macht ist nur so lange gezähmt, als sich die Staaten auf eine gemeinsame Vorstellung von völkerrechtlichen Grundsätzen einigen können. Derzeit erleben wir mit dem Niedergang westlicher Macht gerade eine zunehmende Infragestellung von völkerrechtlichen Grundsätzen, die sich im Zeichen westlicher Vorherrschaft durchgesetzt haben. Daran kann die Diplomatie wenig ändern. Sie kann sich nur dort entfalten, wo jemand bereit ist, der Macht Zügel anzulegen. Ist dies nicht der Fall, kann sie nicht einschreiten. Die Macht der Macht entzieht sich der Diplomatie.
Diplomatie ist hauptsächlich Interessenpolitik, obschon sich ein Staat durchaus auch für universelle Werte engagieren kann. Und Interessenpolitik ist – für unsere Ohren etwas gefälliger ausgedrückt – im Grunde nichts anderes als Machtpolitik. Nach wie vor bestimmt Macht das Kräftefeld in der Aussenpolitik. Aber in den internationalen Beziehungen geht es nicht nur darum, Macht krude durchzusetzen, sondern auch sie zu bändigen, ihre Wucht abzufedern, sie im verbindlichen Netz des Völkerrechts zu zähmen. Hier kommt die Diplomatie ins Spiel. Mit ihrer auf die Erhaltung des Friedens ausgerichteten Bestimmung sucht sie die Projektion der Gewalt, die Demonstration der Stärke, das brutale Diktat von Drohung und Forderungen zurückzudrängen, ohne indes die machtpolitischen Ambitionen des eigenen Staats aus den Augen zu verlieren. Diplomatie ist Machtpolitik in gesitteter Gestalt.
Das Gesittete kommt vom Recht und von der Religion her. Beide setzen dem Individuum und dem Kollektiv Grenzen. Sie verweisen auf Pflichten jenseits der persönlichen Machtsphäre. Im Gegenspiel von Macht und Recht gedeiht die Diplomatie. Wo es weder Recht noch Aussicht auf Recht gibt, kann es auch keine Diplomatie geben, und wo es nicht um Machtinteressen geht, und seien sie noch so höflich vorgetragen, hat die Diplomatie nichts zu tun. Nochmals: Diplomatie ist Interessen- oder Machtpolitik – aber mit friedlichen Mitteln, mit der Kraft des Worts ausgefochten. Sie ist deshalb per se Friedenspolitik. Stets sucht sie die kriegerische Konfrontation zu vermeiden. Wo sie versagt, bestimmen meistens die Waffen das Gesetz des Handelns.
Auf die Diplomatie sind alle angewiesen, aber einige mehr als andere. Athen bedurfte der Diplomatie, Alexander der Grosse nicht. Statt mit Diplomaten rückte er mit Soldaten an. Nicht die mächtigen Imperien und Grossstaaten entwickelten die Diplomatie. Mit ihrer militärischen Macht im Rücken konnten sie dieses Instrument notfalls auch entbehren. So blieb es bis zum Anbruch der Neuzeit. Rom pflegte die Diplomatie, aber nur am Rand. Viel grösseres Gewicht legte es auf die Entwicklung des Rechts, das es den eroberten Völkern auferlegte. Dann schickte es Vollzugsbeamte, nicht Diplomaten. Die kleineren Staaten hingegen, vornehmlich die Handelsnationen, waren auf die Diplomatie angewiesen. Republiken wie Venedig oder Dubrovnik erschlossen und sicherten sich ihre Märkte nicht selten mit der Diplomatie. Sie ersetzte ihnen die Armeen, die sie nicht hatten. Oder Byzanz verstand es mit Diplomatie, die umgebenden Völker im Zaum zu halten. Dadurch hielt es dem Ansturm der Völkerwanderung tausend Jahre länger stand als Westrom.
Auch heute sind mittlere und kleinere Staaten stärker auf die Diplomatie angewiesen als die grossen. Wo das Recht vorherrscht, können sie sich entfalten, wo nur die Macht zählt, sind sie gefährdet. Ihre Kräfte reichen nicht aus, um sich durchzusetzen. Deshalb verbünden sie sich gegen die Macht der Grossen am zweckmässigsten mit dem Recht und versuchen auf diese Weise, in den Fährnissen der Weltpolitik zu bestehen. In der Schweiz ist man schon lange zu dieser Einsicht gelangt. Charles Pictet de Rochemont verhandelte nach diesem Grundsatz auf dem Wiener Kongress, Minister Konrad Kern, der erste vollamtliche Diplomat des neuen Bundesstaats nach 1848, sprach von der «Macht unseres guten Rechts», am zitierfähigsten aber ist der Satz des grossen Völkerrechtlers Max Huber: «Der kleine Staat hat», so sagte er, «seine grösste Stärke in seinem guten Recht.»6
Die Diplomatie wird heute an vielen Akademien und Hochschulen unterrichtet. Angehende Diplomaten und internationale Beamte interessieren sich für die Kurse, doch auch Zuhörer aus anderen Bereichen möchten wissen, was es mit der Aussenpolitik und ihren offiziellen Vertretern im Ausland auf sich hat. Doch das lässt sich in Hochschulsälen nur bedingt erlernen. Die Diplomatie ist keine Wissenschaft. Sie verfährt nicht gesetzmässig. Das Verhältnis von Ursache und Wirkung ist, da sich die Rahmenbedingungen ständig ändern, stets verschieden. Dafür zählen äussere Umstände, Menschenkenntnis, Verständnis für Landessitten und Traditionen mehr als in anderen Berufen.
Dennoch kann man einiges lernen. Ich sehe Möglichkeiten auf drei verschiedenen Ebenen. Da ist einmal das Handwerkliche, das jeder Diplomat, der sich keine Blössen geben will, beherrschen muss. Dazu gehören die Regeln im diplomatischen Leben, die Bestimmungen über Immunitäten und Privilegien, Fragen des Protokolls, des schriftlichen Verkehrs mit ausländischen Regierungen, einige Faustregeln des Verhandelns und dergleichen mehr. Zweitens kann man ein Hintergrundwissen über die bilateralen und multilateralen Beziehungen, über die verschiedenen Arten der Diplomatie und über die internationalen Organisationen vermitteln. Solche Kenntnisse stehen jedem aussenpolitisch Interessierten wohl an. Drittens kann man Fälle aus Geschichte und Gegenwart erläutern. Auch wenn man weiss, dass sich die Geschichte nie wiederholt, kann man aus ihr lernen – weniger, wie man etwas machen muss als vielmehr, wie man es nicht machen darf. Keine Entscheidungssituation präsentiert sich exakt so, wie sie in der Vergangenheit vorlag. Die Zukunft ist stets offen. Anders jedoch ist es mit der Vergangenheit. Diese ist abgeschlossen. Man sieht, was ein Entscheid oder eine Handlung bewirkt hat. Deshalb kann, wer geschichtliche Kenntnisse hat, von vornherein viele Varianten ausschliessen. Geschichtliche Erfahrung liefert keine Erfolgsrezepte zur Gestaltung der Zukunft, aber sie hilft wenigstens, Fehler der Vergangenheit zu vermeiden.
Anderes hingegen kann man kaum erlernen. Es hängt von Persönlichkeit und Geschick ab. Diplomatie ist also keine Wissenschaft – was ist sie dann? Einige meinen ein Handwerk, andere eine Kunst. Wie dem auch sei: Meisterleistungen ergeben sich nur dort, wo sich Engagement mit Geschick und Gespür paart. Ein Unterhändler, der keinen sechsten Sinn für das Timing hat, mag ein tüchtiger Negoziator sein, aber ein Meister seines Fachs wird er nie werden. Vieles kann er sich aneignen, aber der letzte Schliff wird ihm immer fehlen.
Es gibt geborene Diplomaten, von ihrem Wesen, von ihrem Naturell her. Instinktmässig erfassen sie die Situationen richtig und sind mit kreativen Lösungen zur Hand. Aber sie sind rar. Die grosse Mehrheit der anderen hält sich mit Vorteil an den Ratschlag, den Staatssekretär Bernhard Ernst von Bülow (1815–1879) seinem Sohn Bernhard (1849–1929), dem späteren Reichskanzler, erteilte. Dieser hatte sich wie sein Vater für den Diplomatenberuf entschieden. Zur Einführung schenkte ihm der Vater das Standardwerk Le Guide diplomatique von Baron Charles de Martens und meinte: «Gerade in der Diplomatie lernt man durch das Leben mehr als durch Bücher. Aber wer ein Künstler werden will, und die Diplomatie ist, merke dir das, keine Wissenschaft, auch leider kein Zweig der Ethik, sondern eine Kunst, der muss auch die Technik seines Berufes beherrschen.»7 So ist es. Dem ist nichts beizufügen.
1 Begriff
1.1 Begriffsbestimmung
Die Diplomatie ist Teil der Aussenpolitik eines Staats. Sie ist deren sichtbarster Ausdruck, besteht sie doch nicht nur aus einem immateriellen Teil, den Gesprächen und Verhandlungen der Diplomaten, sondern auch aus einem materiellen Teil, dem diplomatischen Apparat. Den materiellen Aspekten verdankt die Diplomatie ihre Bekanntheit und starke mediale Präsenz. Man sieht im Fernsehen Staatsempfänge, begegnet in den Hauptstädten den schwarzen Limousinen mit besonderen Kennzeichen und kennt vielleicht auch einige «Exzellenzen» oder repräsentative Botschaftsgebäude.
Die Diplomatie ist ein Mittel, um mit anderen Staaten friedliche Beziehungen zu pflegen. Dies geschieht durch offizielle Vertreter in Gesprächen und Verhandlungen. Oft führen Verhandlungen zu internationalen Vertragsabschlüssen, zu völkerrechtlichen Verträgen. In erster Linie versuchen die Staaten, die eigenen Interessen zu wahren: in der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft oder der Kultur. Doch die meisten Staaten verfolgen auch Anliegen nicht nur aus purem Eigennutz, sondern um die internationale Friedensordnung zu stärken, etwa im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe oder der Guten Dienste.
Die vielleicht bekannteste Definition von Diplomatie stammt vom Briten Sir Ernest Satow. Sie lautet: «Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of relations between the governments of independent states […] or, more briefly still, the conduct of business between states by peaceful means» (Satow, 3). Diese Definition freilich beschreibt mehr den Sollzustand als den Istzustand. In der Tat sollte Diplomatie stets mit Takt betrieben werden. Häufig ist dies auch der Fall – aber nicht immer. Manchmal geht es alles andere als taktvoll zu und her. Man denke nur an die Schlussrunden in harten Verhandlungen, wenn die Nacht der langen Messer anrückt. Oder an das Dayton-Abkommen (1995). Der amerikanische Unterhändler Richard Holbrooke verlegte die Verhandlungen absichtlich in mächtige Kasernen im Bundesstaat Ohio, um die balkanischen Streitparteien nur schon atmosphärisch einzuschüchtern. Mit Takt hatte dies ebenso wenig zu tun wie seine «Big-Bang-Verhandlungsmethode».
Die Diplomatie kann sich bilateral, multilateral oder über eine Drittpartei abwickeln. Die bilaterale Diplomatie erfolgt zwischen zwei Staaten. Von multilateraler Diplomatie spricht man, wenn mehrere Staaten gleichzeitig miteinander in Beziehung treten. Dies geschieht besonders häufig im institutionellen Gefäss einer internationalen Organisation. Eine Drittparteiendiplomatie liegt vor, wenn ein dritter Staat, der von einem anstehenden Geschäft nicht direkt betroffen ist, vermittelt oder seine Guten Dienste einbringt.
Der Begriff «Diplomatie» deckt sich nicht mit dem Begriff «Aussenpolitik», auch wenn zuweilen, insbesondere im französischen Sprachgebrauch, die Tendenz besteht, die Begriffe gleichzusetzen. Man sagt etwa La diplomatie de l’Elysée und meint die Aussenpolitik des französischen Präsidenten. Der Begriff «Diplomatie» ist eindeutig enger gefasst als jener von «Aussenpolitik». Erstens stehen der Aussenpolitik mehr Mittel zur Verfügung als nur die Diplomatie. Sie verfügt noch über zwei andere Kanäle, nämlich militärische Macht und wirtschaftliche Stärke. Damit kann man ebenfalls Aussenpolitik betreiben, obgleich diese Verfahren nicht dem Ideal von internationalen Beziehungen entsprechen.
Zweitens deckt der Begriff «Aussenpolitik» nicht nur die Durchsetzung der aussenpolitischen Interessen ab, sondern auch das, was vor der Durchsetzung geschieht. Aussenpolitik umfasst den gesamten Ablauf der Beziehungen eines Staats mit der Staatenwelt, angefangen von der Formulierung der Ziele über die Gestaltung bis zur Durchsetzung. Die Formulierung der aussenpolitischen Ziele gehört zweifelsohne nicht in den Kompetenzbereich der Diplomaten. Vielmehr steht dieses Vorrecht, das in absolutistischen Staaten eine chasse gardée des Herrschers war, in Demokratien Regierung und Parlament zu.
Der Begriff «Diplomatie» hat auch viel mit dem zu tun, was man «die internationalen Beziehungen» nennt. Aber auch diese beiden Begriffe sind nicht deckungsgleich. Die internationalen Beziehungen fokussieren auf der Analyse der zwischenstaatlichen Abläufe, die Diplomatie auf dem Handwerklichen, der Durchsetzung der aussenpolitischen Interessen. Die internationalen Beziehungen sind eigentlich die Summe aller Aussenpolitik der Einzelstaaten und aller Tätigkeit der internationalen Organisationen. Vom Begriff «Aussenpolitik» heben sie sich dadurch ab, dass sie die zwischenstaatlichen Beziehungen nicht aus der Perspektive eines Staats darstellen, sondern aus der Vogelschau. Wer von Aussenpolitik spricht, betrachtet die Welt aus dem Inneren eines Staats, wer von internationalen Beziehungen spricht, nimmt einen Standpunkt ein, der jenseits des nationalstaatlichen Blickwinkels liegt. Sein Augenmerk ist auf die grenzüberschreitenden Beziehungsmuster und Wirkungszusammenhänge gerichtet.
Nebst den Staaten üben heute immer mehr nicht staatliche Akteure, beispielsweise internationale Konzerne, NGOs oder Verbände, ihren Einfluss auf die internationalen Beziehungen aus. Im Gegensatz zu den staatlichen Akteuren haben sie dazu kein demokratisch legitimiertes Mandat. Wenn nicht staatliche Akteure die internationalen Beziehungen entscheidend prägen, spricht man von «transnationalen Beziehungen».
Schliesslich sollte man den Begriff «Diplomatie» vom umgangssprachlichen Gebrauch von «Diplomatie» abgrenzen. Man sagt etwa: «Man muss ein Problem mit mehr Diplomatie angehen», und meint damit: mit mehr Takt und Geschick. «Diplomatie» gerinnt zu einem Synonym für psychologisch geschicktes Vorgehen. Dieser Wortgebrauch hat an sich nichts mit der professionellen Diplomatie zu tun. Aber er lehnt sich an Vorstellungen an, die man gemeinhin dem Begriff «Diplomatie» zuschreibt.
1.2 Entstehung des Begriffs
Der Begriff «Diplomatie» ist relativ spät entstanden. Der Sache nach gab es zwar so etwas wie Diplomatie schon in der Antike, vor allem in Ägypten. Auch ist schon in der Bibel im 2. Buch Samuel von Gesandten die Rede. Aber die einzelnen aussenpolitischen Tätigkeiten brachte man noch nicht auf einen Begriff, mit dem man ein ganzes Feld abdeckte. Man sprach von «Gesandten», von legati, ab dem 13. Jahrhundert auch von «Ambassadoren», aber nie von «Diplomatie».
Selbst nach dem epochemachenden Westfälischen Frieden von 1648, der nach den Schrecken des Dreissigjährigen Kriegs Regeln für das Zusammenleben von souveränen Staaten aufstellte, tauchte der Begriff noch nicht auf, obschon sich die politisch Interessierten intensiv mit den neuen zwischenstaatlichen Beziehungen befassten. Zwischen 1625 und 1700 entstanden über 150 Bücher zur Diplomatie. Doch behalf man sich mit Umschreibungen. So betitelte Abraham de Wicquefort sein berühmtes Werk, das 1680/81 erstmals erschienen ist und ein eigentliches Handbuch der Diplomatie darstellt, mit L’ambassadeur et ses fonctions. In den zwei Bänden kommt das Wort «Diplomatie» nicht vor. Das zweite grosse Buch über die Diplomatie aus der Zeit des Absolutismus stammt aus der Feder des französischen Diplomaten François de Callières. Er nannte sein Buch – 1716 herausgekommen und heute noch ein Klassiker – De la manière de négocier (Wie man verhandelt). Mit «Verhandlungskunst» umschrieb man bis zur Französischen Revolution gemeinhin das, was man heute als «Diplomatie» bezeichnet. Diderots Encyclopédie, die das ganze Wissen am Vorabend der Französischen Revolution umfasste, enthielt einen Artikel zum Stichwort ambassadeur, aber keinen zum Stichwort diplomatie.
Der Begriff «Diplomatie» setzte sich erst mit dem Wiener Kongress (1814/15) durch. Auf dieser grossen Konferenz wurden nach den Napoleonischen Kriegen nicht nur die politischen Verhältnisse in Europa neu geordnet, die Kongressteilnehmer stellten auch zum ersten Mal Verhaltensregeln für die offiziellen Vertreter von Staaten in Gaststaaten auf. Unausgesprochen wurden die Diplomaten – die Botschafter, Gesandten, Geschäftsträger – als eigenständige Berufsgattung neben den Staatsmännern und Politikern anerkannt. Und mit dieser Differenzierung stieg auch das Bedürfnis, die Gruppe, deren Status und Tätigkeit als Gesamtes mit einem Sammelbegriff zu erfassen. Das war die Geburtsstunde des Begriffs «Diplomatie».
1.3 Das Wort «Diplomatie»
Das Wort «Diplomatie» stammt aus dem Griechischen. Es ist von διπλουν und διπλομα abgeleitet. Diploun heisst falten, Diploma das Doppelte, das Gefaltete. Im Römischen Reich wurden Reisepässe auf zwei Tafeln ausgestellt, die man mit versiegelten Schnüren aneinanderheftete. Der rechtsverbindliche Teil befand sich auf der Innenseite der Tafeln, wurde indes, um die Kontrollen zu erleichtern, auf der Aussenseite der meist bronzenen Tafeln wiederholt. Denn die Diploma, ausgestellt vom kaiserlichen Amt a diplomatibus, waren nur gültig, solange die Siegel nicht aufgebrochen waren. Mit der Zeit bezeichnete man auch andere Dokumente als «Diploma», vor allem solche, die Privilegien, Besitztitel und Verträge mit anderen Völkern enthielten. Sie wurden in den kaiserlichen Archiven aufbewahrt und von eigens ausgebildeten Berufsleuten, den Archivaren, betreut.
Ab dem Mittelalter, als Urkundenfälschungen an der Tagesordnung waren, wurde es immer wichtiger, echte von falschen oder gefälschten Dokumenten zu unterscheiden. Um den betrügerischen Anspruch von Rechtstiteln abzuwehren, setzten die Herrscher Spezialisten ein, die sich mit den res diplomaticae, also dem Urkundenwesen, befassten. Hierin taten sich besonders die päpstliche Kanzlei und die mit einem professionellen Stab ausgestattete Kanzlei am karolingischen Hof hervor.
Über die Jahrhunderte gab es freilich keine eigene Bezeichnung für die Tätigkeit und das Arbeitsgebiet der Urkundenbetreuer. Erst der französische Benediktiner Jean Mabillon (1632–1707) hob diese Beschäftigung auf ein wissenschaftliches und begriffliches Niveau. In seiner Schrift De re diplomatica entwickelte er wissenschaftliche Kriterien zur Feststellung von echten und falschen Urkunden. Damit schuf er die Grundlagen für die moderne Urkundenlehre, die Diplomatik, la diplomatique auf Französisch. Diese war ursprünglich Teil der Rechtslehre. Doch seit dem 19.Jahrhundert ist die Diplomatik den historischen Hilfswissenschaften zugeordnet. Die Wissenschaftler, die sich mit diesem Forschungsgebiet befassen, bezeichnet man als «Diplomatiker». Mehr als tausend Jahre brachte man also die diplomatischen Angelegenheiten nicht mit der Aussenpolitik, sondern mit Urkunden und Verträgen in Beziehung. In diesem Sinn, als reine Urkundenlehre, behandelt auch noch Diderots Encyclopédie den Eintrag diplome & diplomatique. Jeder Hinweis auf eine Weiterentwicklung des Begriffs hin zur Diplomatie im modernen Sinn fehlt in dem ausführlichen, mehr als zehnseitigen Eintrag.
Etymologisch entspringt das Wort «Diplomatie» den gleichen Wurzeln wie «Diplomatik»; das gilt natürlich auch für die Wörter «Diplomat» und «Diplomatiker». Aber seit dem Ende des Ancien Régime beginnt die neue, auf die Aussenpolitik bezogene Bedeutung das Sprachfeld zu beherrschen und die alten Assoziationen zu verdrängen. Der Wiener Kongress sodann besiegelte diesen Sachverhalt. Im Englischen und Französischen gibt es heute für «Diplomatiker» kein entsprechendes Wort mehr. (Hingegen kennt das Englische zwei Wörter zur Bezeichnung eines Diplomaten: das gebräuchliche diplomat und das altertümliche diplomatist). Wenn man von einer Person spricht, die sich beruflich mit Urkunden befasst, muss man in diesen Sprachen den Sachverhalt umschreiben. Und im Deutschen ist der Terminus technicus «Diplomatiker» nur noch in historischen Fachkreisen geläufig.
Aber etwas von der Urkundenlehre hat sich bis heute im Begriff «Diplomatie» erhalten. Man kann die Spuren dieser Begriffsverschiebung noch deutlich erkennen. Sie führen von «Dokumenten» über «internationale Dokumente» zu «internationalen Verhandlungen». Leibniz hat 1693 eine Sammlung von Völkerrechtsverträgen unter dem Titel Codex juris gentium diplomaticus herausgegeben, der Franzose Jean Dumont bezeichnete 1726 eine andere Sammlung als Corps universel diplomatique du droit des gens. In beiden Fällen bezieht sich das Wort «diplomatisch» noch auf Verträge – aber bezeichnenderweise nun auf internationale Verträge verengt. Und heute hat «diplomatisch» immer etwas mit internationalen Verhandlungssituationen zu tun.
Verträge spielen in der Diplomatie seit je eine grosse Rolle. Jedes Land hat seine Völkerrechtsspezialisten. Je mehr ein Aussenministerium mit den rechtsgültigen Verträgen vertraut ist und bei Bedarf Präzedenzfälle abrufen kann, je mehr es auch die agreed language, die in bestehenden Verträgen bereits akzeptierten Formulierungen beherrscht, eine umso wirksamere Aussenpolitik kann dieses Land betreiben. Auf nichts kann man sich in schwierigen Verhandlungen leichter einigen als auf eine früher schon akzeptierte Terminologie. Grossbritannien, das diese Tradition behutsam pflegt, erfreut sich in Diplomatenkreisen zu Recht eines besonders guten Rufs in Sachen Diplomatie und Verträge.
Literatur
Zu diesem Kapitel gibt es wenig Literatur. Am meisten findet sich bei:
Constantinou, Costas M.: On the Way to Diplomacy. Minneapolis MN: University Press of Minnesota 1996.
Gilbert, Felix: The ‹New Diplomacy› of the Eighteenth Century. In: World Politics 4 (1), 1–38.
Leira, Halvard: A Conceptual History of Diplomacy. In: Costas M. Constantinou et alt. (eds.): The Sage Handbook of Diplomacy. Los Angeles: Sage 2016, 28–38.
Nicolson, Harold Sir: Diplomacy. 3. Auflage. Oxford: Oxford University Press 1969.
Paulmann, Johannes: Diplomatie. In: Jost Dülffer und Wilfried Loth (Hg.): Dimensionen internationaler Geschichte. München: Oldenbourg 2012.
Ausserdem nützlich für die Abgrenzung von Diplomatie, Aussenpolitik und internationalen Beziehungen:
Sharp, Paul: Diplomatic Theory of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press 2009.
Wilhelm, Andreas: Aussenpolitik. Grundlagen, Strukturen, Prozesse. München: Oldenbourg 2006.
2 Die Geschichte der Diplomatie
2.1 Vorgeschichtliche Ursprünge
Zu allen Zeiten gab es Situationen, in denen Völker das Bedürfnis hatten, ihre Probleme nicht mit Krieg, sondern mit Verhandlungen zu lösen. Dazu bedarf es des Gesprächs von Mensch zu Mensch. Der Gesandte ist wohl eine Urgestalt. Jedenfalls hat man das früh schon so empfunden. Deshalb verorteten die Griechen die Ursprünge des Gesandtschaftswesens in der Mythologie. Sie stellten die Gesandten unter den Schutz des Gottes Hermes, des schnellen Götterboten, eines schlauen Charmeurs, aber auch eines Schlitzohrs. Leider hatte Hermes schon immer einen zwiespältigen Ruf, wovon auch etwas am Beruf des Diplomaten hängen blieb. Harold Nicolson, der grosse englische Homme de Lettres, meinte, die Diplomaten hätten es später bereut, dass die Griechen sie nicht unter den Schutz eines weniger brillanten, dafür zuverlässigeren Gottes gestellt hätten (Nicolson, 7).
Auch das Christentum projizierte den Beginn der Gesandtschaften in die Mythologie. In dieser Sicht setzte Gott, seit er die Welt erschaffen hat, Gesandte zwischen sich und den Menschen ein. Die ersten Theoretiker der Diplomatie in der Frühen Neuzeit sprachen von den Engeln, den αγγελοι, als den ersten Gesandten (Nicolson, 5 f.). Insbesondere der Engel Gabriel, der den Menschen verschiedene Botschaften brachte, wurde zum eigentlichen «Go-between». Etwas von dieser Vorstellung hat sich bis heute gehalten. So gilt dieser Erzengel als Patron der Diplomaten. Oder der amerikanische Botschafter William Macomber spielte mit diesem Motiv. Er hat in den 1970er-Jahren sein Buch über die moderne Diplomatie unter den Titel The Angels’ Game gestellt. Heute würden jedoch, wie er selbst vermutet, wohl nur die wenigsten Leute die Diplomaten im Umfeld der Engel ansiedeln (Macomber, 13).
Wichtig an diesen mythologischen Bildern ist freilich nicht die vordergründige Erzählung, sondern die Aussage, die dahintersteckt. Es ist das Verlangen, das Verhältnis von einem Volk zum anderen mit dem Wort statt mit roher Gewalt zu regeln. Und dazu braucht es Boten, die einen besonderen Schutz geniessen. Sie waren in einem gewissen Sinn sakrosankt. Denn würde der Bote, wenn er im anderen Lager eintrifft, gleich getötet, so könnten die Beziehungen nie von der Stufe der Gewalt auf die Stufe des Verhandelns angehoben werden. Deshalb gewährte man den Boten oder Gesandten – in dieser Frühzeit weiss man nie recht, um was es sich handelt – schon früh einen Schutz, den die Krieger nicht bekamen. Hier liegt der Ursprung der diplomatischen Vorrechte und Immunitäten. Ein sprechendes Beispiel findet sich, um nun zur geschichtlichen Zeit zu schwenken, im 2.Buch Samuel (10.1–5). König David liess dem Ammoniterkönig Hanun durch Gesandte sein Beileid zum Tod des Vaters aussprechen. Doch dieser misstraute den Gesandten. Er glaubte, sie seien nur gekommen, um seine Stadt auszuspionieren. Er liess ihnen den Bart und das Gewand bis zu den Lenden abschneiden. Dann schickte er sie, verhöhnt und gedemütigt, zurück. Es ist bemerkenswert, dass die Gesandten nicht getötet, sondern nur beleidigt wurden. Und es ist ebenso bemerkenswert, dass die Beleidigung, weil sie gegen das Gesandtenrecht verstiess, nachher einen Krieg auslöste.
2.2 Von den Anfängen in Ägypten bis zur Frühen Neuzeit
2.2.1 Ägypten
Der Übergang vom mythologischen zum historisch dokumentierten Gesandtschaftswesen fand zuerst in Mesopotamien, in anderen Gebieten des Nahen Ostens und in Ägypten statt. Besonders gut dokumentiert sind die Anfänge der Diplomatie in Ägypten. Schon vor Tutanchamun besass das Pharaonenreich einen hoch entwickelten Beamtenapparat mit einem auswärtigen Dienst. Davon zeugen die in akkadischer Keilschrift geschriebenen Amarna-Briefe aus der Zeit von Echnaton. Ein Teil davon, die sogenannten internationalen Briefe, richteten sich an die Herrscher in den nahöstlichen Reichen und in Mesopotamien. Sie deuten auf ein ausgebildetes diplomatisches System hin.
Um das fruchtbare Nildelta zu schützen, stützten sich die Herrscher nicht nur auf die Armee, sondern sie suchten den Migrationsdruck aus dem Nahen Osten auch mit diplomatischen Mitteln zu bremsen. Namentlich pflegten sie gute Beziehungen zu anderen Fürstenfamilien, um die Machtzentren in ihrem Sinn zu beeinflussen.
In Theben gab es ein voll entwickeltes Aussenministerium, das nebst einer Kanzlei auch über ein Archiv und einen Übersetzungsdienst verfügte. Die Beamtenschaft war in verschiedene Klassen unterteilt und bot eine Laufbahn, die vom Boten bis zum Botschafter führte. Wie intensiv die Beziehungen nach aussen waren, geht auch aus folgenden Fakten hervor: Das Aussenministerium gebrauchte statt der eigenen Hieroglyphen vorzüglich die von den anderen Völkern benützte Keilschrift. Sodann bezeugen Verträge wie der Bündnisvertrag zwischen Ramses II. und dem Hethiterkönig Hattušili III. eine ausgebildete Vertragstechnik (Wildner, 9 f.).
2.2.2 Griechische Stadtstaaten
Auch in den griechischen Stadtstaaten ist vom 6. vorchristlichen Jahrhundert an ein Gesandtschaftswesen bezeugt. Die Ausgestaltung konnte freilich nicht nur von Staat zu Staat erheblich wechseln, sondern auch im gleichen Staat über die Jahrhunderte. Dennoch lassen sich einige Grundzüge erkennen. Im Athen des Demosthenes (4. Jahrhundert v. Chr.), über das wir recht gut unterrichtet sind, sah es etwa so aus:
Die Gesandten waren keine ständigen Gesandten. Sie wurden bei Bedarf in einen anderen Staat entsandt, meistens in Gruppen von drei, fünf oder zehn Gesandten, und wurden hierfür mit einem präzisen Mandat betraut. Zudem erhielten sie ein Schriftstück, das sie dem Magistraten des Empfangsstaats zur Beglaubigung vorlegten. Die letzte Kompetenz für das Gesandtschaftswesen lag bei der Volksversammlung. Sie verabschiedete das Mandat, und nach erfolgter Mission genehmigte sie den Rechenschaftsbericht. Sie empfing auch die ausländischen Gesandten, um deren Anliegen anzuhören.
Doch einiges an diesem Vorgehen war mehr auf Schein als auf Substanz ausgerichtet. Es war schon in der griechischen Antike schwierig, Diplomatie im grellen Licht der Öffentlichkeit zu betreiben. Deshalb wurde der Volksversammlung ein Organ vorgeschaltet, nämlich der Rat der 500. Er empfing die Gesandten, wenn sie ihre Mission antraten, noch vor der Volksversammlung und gab ihnen nicht selten nebst dem offiziell bekannten Mandat einen Geheimauftrag mit. Er empfing sie auch zuerst, wenn sie von ihrer Mission zurückkehrten. Erst dann begaben sie sich in die Volksversammlung, um das Ergebnis ihrer Mission mitzuteilen, und legten ihre finanziellen Belege dem Rechnungshof vor. Gleich verfuhr der Rat der 500 mit den fremden Gesandten. Er empfing sie zuerst, um delikatere Angelegenheiten im kleinen Kreis zu besprechen. Anschliessend wandten sich die Gesandten an die Volksversammlung und versuchten mit viel rhetorischem Aufwand, ihre Sache zu vertreten. Dann zogen sie sich zurück und warteten das Ergebnis der Beratungen der Volksvertreter ab.8
Die Athener waren sich bewusst, dass das Gelingen einer Mission stark von der Persönlichkeit der Gesandten abhing. Deshalb wurden diese nicht wie die Mehrheit der Magistraten durch das Los gezogen, sondern von der Volksversammlung gewählt. Häufig bevorzugte man Strategen, entweder politische Führer aus der Volksversammlung oder Heerführer. Lange Zeit musste ein Kandidat auch über 50 Jahre alt sein, um für einen Gesandtenposten infrage zu kommen. Die Wichtigkeit des Alters geht schon aus dem griechischen Ausdruck «presbeus» hervor: πρεσβευς bedeutet «Gesandter», aber auch «Ältester».
Zudem legte man grossen Wert auf rhetorische Begabung, da die Gesandten im Normalfall ihren Auftrag vor einer Volksversammlung vorzutragen hatten. Sie waren nicht mehr schlichte Boten, die eine Nachricht überbrachten, sondern sie mussten fähig sein, eine hinreissende Rede zu halten. Nicht umsonst betrauten die Athener im Jahr 346 die damals grössten Redner – Demosthenes und Aischines – mit einer Mission zum makedonischen König Philipp. Die überragende Bedeutung, die man der Rede des Gesandten beimass, ist dem Leser von Thukydides auch schon aus dessen Peloponnesischem Krieg bekannt, etwa im berühmten Gespräch der athenischen Gesandten mit den Meliern, die sich weigern, ihre Neutralität aufzugeben und im Peloponnesischen Krieg für Athen Partei zu ergreifen.
1
Aus dem Melierdialog
[85] «Ehe die Athener aber irgendwo Gewalt anwandten, schickten sie zuerst Gesandte, damit diese verhandelten. Die Melier jedoch führten die Gesandten nicht zum Volk, sondern zu den Behörden und dem Rat der Adligen, damit sie diesen erklärten, weshalb sie kämen. Da redeten die Gesandten von Athen etwa so:
‹Wenn wir unsere Worte schon nicht ans Volk richten dürfen, weil man offenbar befürchtet, dass wir die Menge mit einer verfänglichen und fragwürdigen Darstellung beirren und verführen könnten (denn offenkundig ist das die Ansicht der Behörden und des Rates der Adligen), so bitten wir Euch, seid noch vorsichtiger: gebt uns Eure Antworten Punkt für Punkt, nicht in einer langen Rede, sondern unterbrecht uns sogleich, wenn wir etwas sagen, das Ihr nicht annehmen könnt. Und nun sagt uns zuerst, ob unser Vorschlag Euch gefällt.›
[86] Die melischen Ratsherren antworteten: ‹Eure freundliche Aufforderung, einander in Ruhe zu überzeugen, vernehmen wir gern. Aber die kriegerische Art, wie ihr auftretet und droht, widerspricht dem offensichtlich. Ihr seid, wie wir merken, hergekommen, um über das Gespräch selber zu richten. Deshalb wird uns das Gespräch, wenn wir mit unseren Argumenten obsiegen und Euch nicht nachgeben, wohl Krieg bringen. Hören wir aber auf Euch, dann verfallen wir in Knechtschaft.›
[87] Die Athener: ‹Wenn Ihr jetzt schon Vermutungen über den Ausgang der Gespräche anstellt, dann hören wir besser gleich auf. Wenn Ihr indes über Eure Lage und die Erhaltung der Stadt beraten wollt, dann können wir miteinander reden.›
[88] Die Melier: ‹Es ist begreiflich und verzeihlich, wenn man in solcher Bedrängnis auf mancherlei Worte und Gedanken verfällt. Doch in der gegenwärtigen Versammlung geht es um unsere Existenz. Die Verhandlung soll deshalb, wenn es Euch recht ist, in der von Euch vorgeschlagenen Form stattfinden.›» (Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges)
Aus Griechenland ist allerdings auch bekannt, dass Gesandte nicht immer nur auf die Kraft ihres Wortes vertrauten, sondern manchmal auch mit Bestechungen nachhalfen. Perikles gestanden die Bürger einen Pauschalfonds für auswärtige Angelegenheiten zu, über den er keine Rechenschaft ablegen musste (Wildner, 16). Ab und zu dürften daraus, wie man es nannte, «Geschenke» bezahlt worden sein. Und zu Beginn des 6. Jahrhunderts wurden Abgesandte des persischen Grosskönigs in Athen und Sparta ermordet, wohl weil sie bei Bestechungsversuchen ertappt worden waren. In Athen erhielten die Gesandten für ihren Auftrag ein Taggeld. Später übernahmen oft reiche Bürger die Kosten.
Nebst diesen Ad-hoc-Missionen gab es noch Vorkehrungen, die schon nahe an ständige Missionen herankamen. Die Griechen kannten mit der aus der Gastfreundschaft erwachsenen Proxenia (πποχευια) ein Vertretungswesen, das unseren Honorarkonsulaten gleicht. Ein Privater – meistens ein Angehöriger des Residenzlandes – vertrat, jenseits der grossen politischen Fragen, die laufenden Interessen eines Staats im Residenzland. Auf einer Vertragsbasis kümmerte er sich um die Landsleute und die geschäftlichen Beziehungen seines Mandanten. Meist trug er die Kosten für seine ehrenamtliche Tätigkeit selbst. Diese Public Private Partnership avant la lettre erlaubte den griechischen Kolonien enge Beziehungen mit den Festlandstädten zu unterhalten und dadurch die griechische Identität zu festigen.
2.2.3 Römisches Reich
Das griechische Gesandtschaftswesen wurde von den Römern grossenteils übernommen, allerdings ohne die Proxenia. Von konsulatsähnlichen Einrichtungen haben wir keine Kenntnis. Auch schränkten die Römer den Zutritt von fremden Gesandten ein. Dieses Privileg erhielten nur solche Völker, denen es eigens zugestanden wurde. Dann freilich wurden sie grosszügig behandelt. Man gewährte ihnen besonderen Schutz; während ihres Aufenthalts in Rom wurden sie mit grosser Aufmerksamkeit bedacht. Als Staatsgäste wurden sie in speziellen Häusern untergebracht. Auch erhielten sie bei religiösen Feiern und staatlichen Spielen Ehrenplätze. Ihre Anliegen trugen die Gesandten in Rom dem Senat vor. Sie traten nicht wie in Griechenland vor dem Volk auf.
Die eigenen Gesandten behandelte Rom ähnlich wie die griechischen Stadtstaaten. Der Senat und später der Kaiser vertrauten Ad-hoc-Missionen einem Gesandten oder meistens einer Gruppe von Gesandten an. Für ihre Tätigkeit erhielten sie eine Entschädigung und viel Hilfspersonal. Um sich ausweisen zu können, verlieh ihnen der Senat auch einen goldenen Siegelring. Solche Gesandtschaften waren begehrt. Sie trugen dem Reisenden eine bevorzugte Behandlung ein. Mit der Zeit erschlichen sich immer mehr Privatpersonen einen Gesandtenstatus. Caesar versuchte, solche Missbräuche zu beseitigen (Wildner, 19).
Diplomatie oder die Kunst des Verhandelns war nicht die Stärke der Römer. Sie eroberten sich das Reich mit militärischer Macht, zeichneten sich als Verwalter und Strassenbauer aus und stärkten den Zusammenhalt durch das Recht. Im Jus Gentium – im Gegensatz zum für die römischen Staatsangehörigen bestimmten Jus civile – regelten sie den Umgang mit den Ausländern. Und mit dem Anlegen von Archiven bildeten sie Archivare aus, die über Präzedenzfälle und diplomatisches Prozedere Auskunft geben konnten. Das Verhandeln mit anderen Völkern und Herrschern pflegten sie hingegen kaum. Als unangefochtene Herrscher über die damalige Welt hielten sie es nicht für nötig, mit anderen Völkern auf gleicher Augenhöhe zu verkehren.
2.2.4 Byzanz
Das sollte sich erst in der Spätantike und vorzüglich in Byzanz ändern. Das Reich hatte kaum noch die Kraft, sich mit militärischen Mitteln zu verteidigen. Dafür setzte man nun auf die Diplomatie. Sie sollte die Sicherheit gewähren, die man früher mit dem Heer erzielte. Denn es war zu einer Überlebensfrage geworden, ob man es verstand, mit den das Reich bedrängenden Völkern zu verhandeln. Die Kaiser am Bosporus taten alles, um Kriege zu vermeiden. Sie beherrschten diese Kunst so gut, dass ihr Ostreich (1453) rund tausend Jahre länger dem Ansturm trotzte als das Westreich (476). Sie betrieben eine üppige Scheckbuchdiplomatie. Das war immer noch billiger, als Krieg zu führen. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, darf die byzantinische Diplomatie als eine der erfolgreichsten gelten.
Aber das Vorgehen war mehr als fragwürdig. Das Erfolgsrezept bestand darin, dass sich Byzanz den Frieden mit Geldzahlungen und Intrigen erkaufte. Der Hof verstand es ausgezeichnet, einerseits Zwietracht zu säen und die das Reich bedrohenden Völker gegeneinander aufzuhetzen, andererseits die ans Reich angrenzenden Herrscher mit exzessiven Geschenken oder Tributzahlungen als Freunde zu vereinnahmen. Dabei schreckte man weder vor Schmeicheleien noch Lügen, Betrug oder Bestechung zurück. Vielmehr setzte man diese Mittel recht offen ein. Die Byzantiner bedienten sich all dessen, was bis heute der Diplomatie negativ anhaftet. Die Rechtfertigung für ihre Verschlagenheit lieferte Kaiser Anastasios 515 schriftlich: «Es gibt ein Gesetz, das dem Kaiser befiehlt, zu lügen und seinen Eid zu brechen, wenn es für das Heil des Reiches erforderlich ist.»9
Damit Byzanz diese listenreiche Politik betreiben konnte, musste es freilich auch über einen entsprechenden diplomatischen Apparat verfügen. Es genügte nicht mehr, wenn die Gesandten nur Botschaften überbrachten und sich auf die Verteidigung der Interessen des Byzantinischen Reichs beschränkten. Sie mussten auch über die inneren Verhältnisse bei Nachbarvölkern und deren Beziehungen untereinander berichten, sie mussten Fragen folgender Art beantworten: Wie sind die Machtverhältnisse? Welche Absichten hegen die Herrscher? Was haben sie für einen Charakter? Welche Schwächen weisen sie auf? Man musste in Konstantinopel wissen, mit wem man es bei Verhandlungen zu tun hatte, vor allem, welche Schwächen der Verhandlungspartner aufwies und wie man diese ausnützen konnte. Es war der byzantinische Hof, der die Berichterstattung als wichtige Aufgabe ins Pflichtenheft der Diplomatie einschrieb. Der Gesandte sollte nun ein scharfer Beobachter und ein guter Menschenkenner sein. Die rednerischen Anforderungen dagegen rückten in den Hintergrund. Wie in den griechischen Stadtstaaten der rhetorisch geschulte Gesandte den Boten verdrängte, so vollzog sich in Byzanz ein Profilwechsel vom Orator zum Berichterstatter (Nicolson, 10).
Damit diese Politik Früchte trug, wurde auch die Zentralverwaltung ausgebaut. Seit Kaiser Konstantin I. (306–337) gab es ein Amt, das sich um die diplomatischen Angelegenheiten kümmerte, jenes des magister officiorum. Später, ab etwa 600, wurde dieses Amt nur noch als Ehrentitel vergeben. Die Aufgaben gingen an den gewichtigen Logothetes tou dromou über. In einer speziellen Sektion wurden die Beglaubigungsschreiben für die ins Ausland entsandten Diplomaten verfasst. Dieses Amt beschäftigte sich auch mit den Protokollfragen. In Konstantinopel hatte man das Zeremoniell bis ins Detail ausgefeilt und in Kompendien festgehalten, beispielsweise im Buch De ceremoniis aulae Byzantinae, das Kaiser Konstantin VII. (913–959) in Auftrag gegeben hatte. Das Zeremonielle wurde häufig nicht mehr als symbolischer Ausdruck eines ernsthaften Sachverhalts aufgefasst. Es war vielmehr auf Effekthascherei ausgerichtet, nicht unähnlich der heutigen Eventkultur. Nicht umsonst bezeichnet man ja eine Überbetonung des Zeremoniellen, deren Sinn man nicht mehr erkennt, als «byzantinisch».
Der magister officiorum oder der Logothetes betreute auch die fremden Gesandtschaften. Im Allgemeinen wurden diese vorzüglich behandelt, auch mit Geschenken und Ehrenbezeugungen überhäuft. Am byzantinischen Hof war man darauf aus, sie mit pompösem Aufwand zu beeindrucken. War man aber mit einem Gesandten oder dessen Mission nicht zufrieden, dann strafte man ihn mit dem Entzug von protokollarischen Ehren ab. Die fremden Gesandten wurden in einem für sie bestimmten Gebäude in der Nähe des Kaiserpalastes untergebracht – und nebenbei auch überwacht (Wildner, 22). Die meisten Gesandtschaften waren von vorübergehender Natur. Der Heilige Stuhl entsandte als einziger einen ständigen Vertreter an den oströmischen Hof. Man nannte diese Legaten apocrisiarii. Sie befassten sich jedoch nur mit religiösen Fragen. Deshalb kann man in ihnen keine Vorläufer der ständigen Gesandtschaften sehen. Auch der heilige Gregor der Grosse (540–604), einer der bedeutendsten Kirchenväter, war sechs Jahre lang Apocrisiar in Konstantinopel.
Zusammenfassend gesagt, wirkte sich Byzanz dreifach auf die Entwicklung der Diplomatie aus: einmal positiv mit der Einführung einer umfassenden Berichterstattung über das Gastland und zweimal negativ: erstens mit der Durchtriebenheit als Nebenattribut der Diplomatie, zweitens mit einem pompösen, auf Effekthascherei ausgerichteten Zeremoniell.
2.2.5 Früh- und Hochmittelalter
Ausser in Konstantinopel waren im Früh- und Hochmittelalter die diplomatischen Beziehungen nur noch am päpstlichen Hof intensiv. Das Reich, das im Westen an die Deutschen übergegangen war, besass ja nicht einmal eine Hauptstadt. Der westliche Kaiser zog vielmehr von Königspfalz zu Königspfalz. Es gab auch nicht viele Angelegenheiten, die den Kontakt mit einem fremden Herrscher erforderten. Die raren ausländischen Boten, zur Zeit der Merowinger meistens legati und später nuncii genannt, empfing der Kaiser mit Vorliebe an Reichstagen oder an Heerschauen. Meistens überbrachten sie Glückwünsche oder Huldigungen. Sie hatten keinen anderen Auftrag, als eine Botschaft zu überbringen. Zu Verhandlungen waren sie nicht ermächtigt. Sie waren schlichte Briefträger (Queller, 194).
Aber es gab gelegentlich auch anspruchsvollere Aufträge, vor allem Heiratsanträge. In solchen Fällen entsandte man meistens eine aus mehreren Personen bestehende Gesandtschaft. Besonders bekannt ist die Mission des Bischofs Liutprand von Cremona an den byzantinischen Hof. Liutprand war schon früher in Konstantinopel gewesen und galt als ein Kenner der dortigen Verhältnisse. Im Auftrag Kaiser Ottos des Grossen sollte er mit Kaiser Nikephoros II. eine Ehe zwischen Ottos Sohn, dem späteren Kaiser Otto II., und einer purpurgeborenen Tochter von Nikephoros aushandeln. Die Ehe kam wegen Streitigkeiten um Besitztümer nicht zustande. Aber Liutprand, der auch Geschichtsschreiber war, berichtete ausführlich über seine Mission und die erstaunlichen Zeremonien am Hof der Byzantiner in seinem Werk Antapodosis. Dieser Bericht ist eine der besten Quellen zu den diplomatischen Verhältnissen im Mittelalter. Übrigens brachte 972 eine andere Gesandtschaft unter der Leitung des Kölner Erzbischofs Gero die gewünschte dynastische Verbindung zustande. Otto III. heiratete die Byzantinerin Theophanu.
Die grosse Leistung des Mittelalters für die Entwicklung der Diplomatie lag nicht im Ausbau der Verhandlungskunst, sondern in der Errichtung von Kanzleien. In der päpstlichen Verwaltung wie am Kaiserhof unterstellte man das nach dem Vorbild der Römer eingerichtete Archivwesen einem cancellarius, einem Kanzleichef. Dieser nutzte den im Archiv angesammelten Erfahrungsschatz für die Entscheidungsfindung. Er stützte sich auf Präzedenzfälle. Das verlieh seiner Argumentation Gewicht. Er wurde zum wichtigsten Mitarbeiter in aussenpolitischen Angelegenheiten des Herrschers. In karolingischer Zeit bedurfte jedes Edikt der Gegenzeichnung durch den Kanzler. Die Diplomatie aber bekam mit den Kanzleien einen wissenschaftlichen Unterbau (Nicolson, 11).
Der cancellarius war der Chef einer grösseren Verwaltung, die aus Kanzlisten und Schreibern bestand. Alle waren geistlichen Standes. Nur die Kleriker verfügten über die nötigen Sprach- und Schreibkenntnisse. Auch kannten sie aus den klösterlichen Bibliotheken zahlreiche antike Texte. So hielten sie in grossen Zügen an den diplomatischen Gepflogenheiten aus römischer Zeit auch nach dem Umbruch der Völkerwanderung fest. Zu neuen Formen der Diplomatie und der Verhandlungskunst kam es indes im westlichen Europa bis ins Spätmittelalter hinein nicht. Aus weltanschaulicher Sicht bestand auch wenig Anlass dazu. Denn der Kaiser verstand sich als Beschützer des Orbis christianus. Er stand über den anderen weltlichen Herrschern und hatte folglich mit ihnen nicht zu verhandeln, sondern ihnen zu befehlen. Dasselbe galt für den Papst. Er war Oberhaupt der Kirche und hatte als solcher keinen Verhandlungspartner, den er als ebenbürtig anerkennen konnte.
Die mit Abstand beste Kanzlei besass die Kirche. Im Verkehr mit den Ortskirchen, aber auch mit den weltlichen Herrschern, setzte sie oft Boten ein. Diese nannte man wahlweise legati, oratores, commissarii oder nuncii. Doch den Terminus Nuntius bevorzugte man auch für Boten, die im Dienst von weltlichen Herrschern standen. Das Wort sollte indes ab dem Spätmittelalter aus dem Vokabular der weltlichen Diplomatie verschwinden. Als Bezeichnung für den Vertreter des Heiligen Stuhls hielt es sich jedoch bis heute. Der Aufgabenbereich eines Nuntius ist heute allerdings weiter gefasst. Er ist nicht bloss ein Bote, seine Stellung gleicht jener eines Botschafters.
2.3 Von der Errichtung ständiger Gesandtschaften bis zum Wiener Kongress
2.3.1 Die norditalienischen Stadtstaaten
Das Mittelalter stand im Zeichen der Einheit. Es gab eine Christenheit, und es gab idealerweise ein weltliches Reich. Dieses wurde vom Kaiser beherrscht. Ihm unterstanden alle anderen christlichen Herrscher. Doch diese Vorstellung entsprach im ausgehenden Mittelalter keineswegs mehr der Realität. Die zahlreichen Schismen mit gegenseitigen Exkommunikationen verspotteten den Einheitsgedanken ebenso sehr wie die sich der Oberhoheit des Kaisers entziehenden und nach voller Machtfülle drängenden Fürsten und Gebietsherrschaften. Es gab nun viele Fürsten und bald auch Länder, die den Papst nicht mehr als geistliches Oberhaupt anerkannten. Damit änderte sich auch das Selbstverständnis des Diplomaten. Gewiss, in der Vergangenheit stand dieser normalerweise im Dienst eines einzigen Herrn. Aber er erfüllte idealiter zugleich auch eine Aufgabe im Dienste der weltlichen und kirchlichen Einheit. Damit war es nun vorbei. Ein Gesandter suchte einzig die Interessen seines Herrschers zu fördern. Die Bedürfnisse der Allgemeinheit bewegten ihn viel weniger als die Frage, ob die Moral den Eigeninteressen Grenzen setzen dürfe. Wo sich der Gemeinsinn zurückzog, breitete sich die Staatsräson aus.
Die moderne Diplomatie, wie wir sie verstehen, also die Pflege der Beziehungen von einem Staat zum anderen, mit einem Gesandten oder Botschafter vor Ort, der sich auf die Dienste einer ständigen Vertretung stützen kann, entstand in der Frühen Neuzeit in Italien. Es ist wohl kein Zufall, dass die ständigen Missionen zuerst in den norditalienischen Stadtstaaten aufkamen. Denn diese Städte, die nur locker in das Feudal-system des Reichs integriert waren, hatten zahlreiche gemeinsame Interessen, standen aber auch untereinander in einem prekären Machtverhältnis. Alle waren ungefähr auf der gleichen Stufe. Sie befanden sich nicht in einem hierarchischen Abhängigkeitsverhältnis. Umso härter rangen sie um ihre aussenpolitische Stellung und um ihre Sicherheit.
Wann die erste ständige Mission errichtet wurde, ist umstritten. Aber unbestritten ist, dass das ständige Gesandtschaftswesen in der Renaissance in Italien entstand. Dabei war das Herzogtum Mailand führend. Es baute als erster Staat ein Netz von Gesandtschaften in Italien auf. Seit Adolf Schaube 1889 seinen Artikel «Zur Entstehungsgeschichte der ständigen Gesandtschaften» publizierte, halten viele das Jahr 1446 für den Beginn des ständigen Gesandtschaftswesens.10 Damals entsandte der Condottiere Francesco Sforza von Mailand Nicodemus von Pontremoli als seinen Vertreter nach Florenz, wo dieser mit einem kleinen Unterbruch 20 Jahre blieb. Andere betonen, dass Filippo Maria Visconti schon 1425 einen Botschafter an den Hof in Wien entsandt hatte. Dieser residierte dort sieben Jahre. Kaiser Sigismund seinerseits hielt in seiner Eigenschaft als König von Böhmen und König von Ungarn Gegenrecht – als König, nicht als Kaiser, weil der Kaiser, der über den anderen Herrschern stand, keine Botschafter entsandte. Er liess sich in Mailand mehrere Jahre mit einem «Orator» vertreten (Hamilton, 42). Wieder andere, etwa Harold Nicolson, halten das Jahr 1455 für entscheidend. Damals schickte Francesco Sforza einen Gesandten nach Genua (Nicolson, 13).
Das genaue Datum lässt sich kaum feststellen, weil der Aufbau der Infrastruktur für die permanenten Vertretungen erst allmählich erfolgte. Oft ist es schwierig zu sagen, ob es sich um eine lange Sondermission handelte oder schon um den Anfang einer ständigen Vertretung. Letztlich entstanden die ständigen Vertretungen aus dem praktischen Bedürfnis heraus, die Sondermissionen, die sich häuften und einander ablösten, zu verstetigen. Die Zeit war reif für einen grundlegenden Wechsel im Vertretungswesen. Das fragile Gleichgewicht zwischen den Stadtstaaten erforderte förmlich ständige Vertretungen. Die Republiken mussten ihre eigenen Interessen an den anderen Höfen kontinuierlich vertreten, damit sie nicht das Opfer von gefährlichen Allianzen wurden. Auch mussten sie wissen, was um sie herum vorging. Deshalb musste der Gesandte viele Informationen sammeln und diese nach Hause senden. Das zeigt sich deutlich am Beispiel von Nicodemus, der den Sforzas half, die Machtgelüste Venetiens vom Herzogtum Mailand abzuwenden, nachdem das Geschlecht der Visconti ausgestorben war.
Nicodemus von Pontremoli (1411–1481) erlangte, als er sich für längere Zeit als Mailänder Diplomat in Florenz niederliess, das Vertrauen von Cosimo de Medici und brachte diesen, der bisher die Republik Venedig unterstützt hatte, auf die Seite der Sforza. Mit viel Energie verhandelte er 1451 ein Bündnis zwischen Mailand, Florenz und Frankreich als Gegengewicht zur Allianz von Venedig, Neapel, Montferrat und Savoyen. Seine Politik trug Früchte, als die beiden Allianzen im Frieden von Lodi (1454) ihre Kriege einstellten. Somit war dank dem Bündnis von Mailand mit Florenz verhindert worden, dass sich in Norditalien eine Grossmacht etablierte. Dem Friedensvertrag schlossen sich auch die anderen wichtigen Staaten auf der Halbinsel an. Auf diese Weise entfaltete sich während 40 Jahren ein prekäres Gleichgewicht zwischen Venedig, Mailand, Florenz, dem Kirchenstaat und Neapel. Jeder Staat wurde der Alliierte der anderen. Es war nur folgerichtig, wenn man dieses neue Allianzsystem mit dem Austausch von Botschaftern besiegelte. Der ständige Vertreter vor Ort gab erstens den freundschaftlichen Beziehungen Ausdruck, zweitens amtete er als Verbindungsperson zu den Allianzpartnern, und drittens beobachtete er allfällige Verschiebungen im Bündnis und rapportierte diese schleunigst seinem Herrscher. Dank diesem Early Warning gelang es mehr als nur einmal, das stets bedrohte Gleichgewicht zu wahren.11 Der ständige Vertreter war zu einem unentbehrlichen Bindeglied zwischen souveränen Herrschern geworden.
Somit hatte sich bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts das ständige Gesandtschaftswesen von Mailand aus bereits auf Venedig, Florenz, den Kirchenstaat und das Königtum von Aragon in Neapel ausgebreitet. Auch wurde der Gesandte nun immer mehr als Ambassador bezeichnet. Bald sollten auch nördliche Staaten, die durch Sondergesandte beim Heiligen Stuhl diese Institution kennenlernten, mit der Errichtung von ständigen Missionen beginnen. Frankreich tat sich in dieser Hinsicht besonders hervor. Gleichzeitig aber bestanden die Ad-hoc-Gesandtschaften in vielen Teilen Europas noch während Jahrhunderten weiter (Hamilton, 42).
2.3.2 Die Republik Venedig
Besonders prägend auf die Gestaltung der neuzeitlichen Diplomatie wirkte sich Venedig aus. Die Serenissima liess sich vorwiegend von Byzanz inspirieren – im Guten, aber nicht minder im Schlechten. An dieser verhängnisvollen Filiation wird die neuzeitliche Diplomatie lange kranken. Der venezianische aussenpolitische Apparat war hervorragend organisiert. Er verfügte über eine Kanzlei mit gut geschultem Personal, einem raffinierten Chiffrierdienst und einem Geheimdienst. Die Gesandten erhielten detaillierte Instruktionen und waren auf einen fragwürdigen Verhaltenskodex verpflichtet, der so lautete: «Siamo Veneziani, poi Christiani.» Was für Venedig gut war, das ziemte sich. In der Substanz unterschied sich diese Devise kaum von der Maxime eines Anastasios: Dem Gesandten war alles erlaubt, was die Interessen seines Staats förderte. Auch die Signoria billigte Bestechung und Mord, wenn sie diesem Zweck dienten. Die Kanzlei führte sogar Buch über die Bestechungsgelder, die für den Sultan, den Papst, den Kaiser und andere Souveräne aufgewendet wurden (Wildner, 33).
Die politische Leitung der Aussenpolitik oblag dem Rat der Zehn. Er wachte streng über den diplomatischen Apparat. Von den Gesandten wurden unbedingter Gehorsam und Verschwiegenheit verlangt. Auch mussten die Diplomaten, wie in Byzanz, fleissig Bericht erstatten. Dabei wurden zwei Sorten unterschieden: die laufende Berichterstattung über Einzelthemen, die dispacci, und die umfassenden Abschlussberichte, die relazioni. Die Diplomaten mussten über ihre Amtsführung Rechenschaft ablegen. Etwaige Verfehlungen kamen vor ein Inquisitionstribunal.
Gesellschaftlich gehörten die Gesandten der Schicht der Nobili an. Sie waren durch Familientradition und ihren Einsitz im Rat mit den politischen Geschäften vertraut. Die laufenden Angelegenheiten und die Kanzleiarbeit bewältigten Sekretäre, die aus anderen Schichten kamen. Die Gesandten blieben drei oder vier Jahre auf ihren Posten, dann wurden sie versetzt oder kletterten in ihrer Heimatstadt die Karriereleiter hinauf. Die Sekretäre dagegen waren weder einem Rotationssystem unterworfen, noch hatten sie Aufstiegsmöglichkeiten.
Die beim Dogen beglaubigten ausländischen Gesandten beobachtete die Signoria mit grossem Misstrauen. Sie wurden streng überwacht und bespitzelt. Mit den Venezianern durften sie keinen gesellschaftlichen Kontakt pflegen. Bezog ein neuer Botschafter ein Palais, wurde dieses von einem Mitglied des Inquisitionstribunals vor dem Bezug daraufhin untersucht, ob es keine geheimen Zugänge zu den Nachbarliegenschaften habe. Reichte die Isolierung nicht aus, zwang die Regierung die Nachbarn, aus deren Liegenschaften auszuziehen. Bezahlte Informanten mussten über alle Vorgänge auf den Gesandtschaften rapportieren.