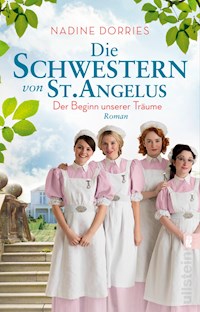8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es geht weiter mit den Krankenschwestern von St. Angelus! St. Angelus braucht einen neue Oberschwester, aber die Mitglieder des Liverpool er Krankenhaus-Ausschusses haben Emily Haycock und Dr. Gaskell überstimmt, und die mysteriöse Miss Van Gilder aus Südengland wird eingestellt. Das Leben in St. Angelus wird schon bald auf den Kopf gestellt, und viele der Angestellten bangen um ihre Jobs. Doch Miss Van Gilder hat ein dunkles und unlauteres Geheimnis, und die Belegschaft setzt alles daran, ihresgleichen zu schützen und Miss Van Gilder zu entlarven. Werden sie es rechtzeitig schaffen, bevor Miss Van Gilders Einmischen nicht nur die Moral der Krankenschwestern, sondern auch das Leben der Patienten gefährdet? Besonders das Schicksal eines sehr kranken kleinen Jungen steht auf Messers Schneide ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Die Schwestern von St. Angelus - Auf neuen Wegen
Die Autorin
NADINE DORRIES ist Bestseller-Autorin der Four Streets-Trilogie, The Angels of Lovely Lane-Serie und Ruby Flynn. Sie wuchs in einer Arbeiterfamilie in Liverpool auf und machte eine Ausbildung zur Krankenschwester, bevor sie in der Gesundeheitsbranche Karriere machte, ihr eigenes Unternehmen gründete und schließlich wieder verkaufte. Seit 2005 sitzt für Mid-Bedfordshire im englischen Parlament.
Das Buch
St. Angelus braucht eine neue Oberschwester. Gespannt warten die jungen Krankenschwestern Victoria, Pammy, Beth und Dana auf Miss Van Gilder,die den Posten übernehmen soll. Doch die resolute Frau stellt das Leben in St. Angelus völlig auf den Kopf und beobachtet mit Argusaugen nicht nur die aufkeimende Liebe zwischen Dana und einem jungen Chirurgen. Bald bangen die Frauen um ihre Stellung. Doch Miss Van Gilder hat ein dunkles Geheimnis, und die Schwestern setzen alles daran, Miss Van Gilder zu entlarven. Werden sie das böse Spiel der intriganten Oberschwester aufdecken, bevor Patienten zu Schaden kommen? Besonders das Schicksal eines kleinen kranken Jungen steht auf Messers Schneide ...
Nadine Dorries
Die Schwestern von St. Angelus - Auf neuen Wegen
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch 1. Auflage Januar 2021© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Copyright © Nadine Dorries, 2016Titel der englischen Originalausgabe: The Children of Lovely Lane (Head of Zeus 2017)Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © Head of Zeus (Frauen), © FinePic®, München (Hintergrund, Blätter)Foto der Autorin: © Cassie DorriesE-Book powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-8437-2384-8
ISBN 978-3-8437-2384-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Kapitel siebenunddreißig
Kapitel achtunddreißig
Kapitel neununddreißig
Kapitel vierzig
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Kapitel eins
Für meine eigenen Kinder, meine drei unglaublich klugen, selbstständigen, starken, freundlichen, schönen Töchter Philippa, Jennifer und Cassandra.
Kapitel eins
Emily Haycocks Hand zitterte ein wenig, als sie den Brief las. Sie wusste nicht, dass Dr. Gaskell ihn ihr erst eine halbe Stunde zuvor auf den Schreibtisch gelegt hatte. Doch der frische blaue Umschlag lockte sie schon, ehe sie ihr Cape abgenommen hatte. Er war das Erste, was sie sah, als sie ihre Bürotür öffnete. Als Leiterin der Pflegeschule von St. Angelus wohnte Schwester Haycock in den Zimmern im ersten Stock über dem Haupteingang des Krankenhauses. Sie trug zwar keine Tracht mehr, sträubte sich jedoch dagegen, auch das dazugehörige dicke, gefütterte Cape aufzugeben, das sie sich binnen Sekunden über die Schultern werfen konnte. Denn Emily war immerzu in Eile.
Ich werde mich eines Tages zurückziehen müssen, Emily, und mein Gefühl sagt mir, dass es eher früher als später sein wird. Dann möchte ich St. Angelus in guten Händen wissen. In den richtigen Händen. Der neue NHS stellt uns vor viele Herausforderungen, und ich hege keinerlei Zweifel daran, dass es noch viele weitere geben wird. Das Krankenhaus muss sich dieser neuen Welt, die sich rapide verändert, anpassen, und nichts würde mich mehr erfreuen, als Sie in der Rolle der stellvertretenden Oberschwester zu sehen. Dann stünden Sie bereit, das Ruder zu übernehmen, wenn die Oberschwester zum selben Schluss gelangt wie ich, was die prestigeträchtige Stellung angeht, die sie bereits so lange innehat. Es ist an der Zeit, dass eine neue Generation für unsere Patienten und die Mitarbeiter im St. Angelus sorgt.
Emily sank auf ihren Stuhl und atmete langsam aus. Ihr war gar nicht bewusst gewesen, dass sie beim Lesen den Atem angehalten hatte. Sie war Anfang dreißig, in Liverpool geboren und aufgewachsen und hatte sich im St. Angelus als Krankenschwester nach oben gearbeitet. Über die Jahre hatte sie sich Respekt erwerben können, indem sie sich gegen die Oberschwester behauptete, und sie war bei allen beliebt – sogar ein wenig zähneknirschend selbst bei der Oberschwester. Emily und sie waren auf dem falschen Fuß gestartet, doch seit die Oberschwester sicher war, dass Emily es nicht auf ihren Posten abgesehen hatte – jedenfalls noch nicht –, war sie der nicht mehr ganz jungen Frau gegenüber aufgetaut.
Der Chefarzt Dr. Gaskell war der Mediziner mit den meisten Dienstjahren am Krankenhaus, und Emily hatte keine Ahnung, dass er über sie wachte und sie einzig seinetwegen überhaupt vor Jahren im St. Angelus eine Anstellung bekommen hatte. Während des Krieges hatte er Emilys an TB erkrankte Mutter behandelt und nie das ernste junge Mädchen mit der besorgten Miene vergessen, das ihn fragte: »Geht es Mam bald wieder besser?« Als Mrs Haycock später nicht zu ihrem Röntgentermin und der Verlegung ins Sanatorium auf der anderen Seite der Bucht erschien, hatte er nachgefragt und erfahren, dass seine Patientin eines der vielen Opfer des Bombenhagels auf die George Street gewesen war. Es war die schlimmste Nacht gewesen, die Liverpool im Krieg durchgemacht hatte. Die einzigen Überlebenden der Haycock-Familie waren die junge Emily und ihr Stiefvater.
Das nächste Mal sah Dr. Gaskell Emily am Tag ihres Bewerbungsgesprächs im Krankenhaus. Er erkannte den Namen und später auch das Gesicht wieder. Als sie vor dem Auswahlkomitee saß, das er leitete, berührte ihn etwas an ihr. Er spürte ihre Verletzlichkeit, und für ihn war es kaum vorstellbar, was sie durchlebt hatte. Deshalb war er entschlossen gewesen, diese offensichtlich sehr fähige junge Frau als Schwesternschülerin im St. Angelus anzunehmen. Seine Stimme hatte letztlich den Ausschlag gegeben. Das hatte ihn für einen kostbaren Moment mit Zufriedenheit erfüllt, weil er das Gefühl hatte, damit indirekt seine Pflicht gegenüber seiner Patientin zu erfüllen, indem er ihre Tochter förderte. Am Ende hatte er ihr so doch noch hilfreich sein können. Es war keine bewusste Entscheidung, doch an jenem Tag war er zu Emilys Schutzengel geworden.
Mittlerweile war Emily von der Stationsschwester zur Verantwortlichen für die Schwesternausbildung aufgestiegen. Sie liebte ihre Arbeit. Zwar hätte sie die Möglichkeit gehabt, sich an anderen Häusern als stellvertretende Oberschwester zu bewerben, doch sie zog es vor, an dem Krankenhaus zwischen der Dock Road und der Lovely Lane zu bleiben, das sie schon als Kind gekannt hatte.
Emily behielt Dr. Gaskells Brief in ihrer Handtasche, und oft nahm sie ihn heraus und las ihn erneut, wenn sie sich unbeobachtet fühlte. Tief im Innern wusste sie, dass sie den nächsten und letzten Schritt tun sollte. Denn nichts wünschte sie sich mehr als das: ihren Traum wahr zu machen und Oberschwester von St. Angelus zu werden. Aber sie wollte auch die gegenwärtigen Schwesternschülerinnen bis zu ihrem Abschlussexamen begleiten, und bis dieser Tag gekommen war, würde sie bei ihnen bleiben. Das war ihre Pflicht. Und es war noch zu früh, um stellvertretende Oberschwester zu werden. Obendrein war da die nie angesprochene Hürde, der sie sich bisher nicht stellen wollte, nämlich, dass alle Oberschwestern ledig waren. Hätte sie jene Stelle erst einmal inne, könnte sie nie mehr eine Ehefrau sein. Und sie hegte die leise, wenn auch schwindende Hoffnung, dass sie eines Tages jemanden kennen- und lieben lernen würde. Noch war es nicht zu spät. Sie könnte noch ein Kind bekommen, was allerdings bald passieren müsste. Und es zeichnete sich nicht ab, dass es dazu kommen würde. Der Tag, an dem sie sich stark genug fühlte, diesen Traum aufzugeben, wäre der, an dem sie sich sagte: Das war es, du bist jetzt offiziell eine alte Jungfer. Erst dann würde sie die nächste Stufe in der Schwesternhierarchie erklimmen.
Wochen später erzählte sie endlich Biddy von dem Brief. Biddy Kennedy war die Hauswirtschafterin der Schwesternschule und hatte die Rolle der Mutter, Mentorin und Freundin für Emily übernommen, sobald sie begriffen hatte, dass alle drei Posten frei waren.
»Na, wo der Vorstand jetzt die Stelle ausgeschrieben hat, wieso bewerben Sie sich nicht?«, fragte Biddy sie, während sie das Telefon auf Emilys Schreibtisch polierte.
Emily hatte gerade die Bewerbungsformulare der neuen Schwesternschülerinnen gelesen und wollte mit ihren Notizen für die nächste Vorlesung beginnen. Die Überschrift Das Lymphgefäßsystem stand schon seit zwei Tagen provozierend oben auf dem Blatt. Doch es war sinnlos, sich konzentrieren zu wollen, solange Biddy im Zimmer war.
»Wissen Sie was, Biddy?«, sagte sie. »Ich denke, der Jahrgang, der im Januar 1952 aufgenommen wurde, ist der beste, den dieses Krankenhaus gesehen hat, seit ich die Schule leite.«
Sie blickte von ihren Unterlagen auf und lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück. »Zu Schwester Tanner bekomme ich nur gute Berichte. Sie wird so sehr geschätzt, dass die Oberschwester sie als Nächstes in die Notaufnahme schickt. Wer hätte das nach ihrem holprigen Start gedacht?«
»Lenken Sie nicht ab«, schalt Biddy sie lächelnd. »Wir alle wissen, dass Sie Schwester Tanner und die anderen Schwestern unten in der Lovely Lane sehr gernhaben. Jeder würde meinen, dass sie Ihre eigenen Kinder sind. Sie haben ihr erstes Jahr geschafft, kennen sich jetzt aus. Und glauben Sie mir, keine von denen wird es Ihnen danken, wenn Sie Ihre eigene Karriere auf Eis legen, während sie die Ihrer Schülerinnen vorantreiben.«
Emily legte ihren Füller hin. Es geht wieder los, dachte sie. Mir wird der Marsch geblasen. Und da es bei Biddy kein Entrinnen gab, konnte sie ihr ebenso gut ihre volle Aufmerksamkeit schenken.
»Das weiß ich alles, Biddy, aber ich hänge an dieser Gruppe. Für die Mädchen habe ich meinen Kopf hingehalten. Ist Ihnen klar, dass Dana Brogan das erste Mädchen aus Westirland ist, das bei uns zur Vollschwester ausgebildet wird und nicht bloß zur Schwesternhelferin? Und dass Schwester Tanner die erste Schwesternschülerin in diesem Krankenhaus ist, die aus dem Hafenviertel stammt und den typischen Dialekt von dort spricht? Das ist mein Werk. Ich bin für diese Schülerinnen verantwortlich und kann sie nicht im Stich lassen.«
Biddy zog die Augenbrauen hoch, unterbrach sie aber nicht.
»Ich habe diese Stelle gerade mal seit ein paar Jahren und kann sie erst aufgeben, wenn ich bewiesen habe, dass ich etwas bewegen kann. Was frühestens in zwei Jahren der Fall sein wird. An dem Tag, an dem die Schwestern Tanner, Brogan, Baker und Harper in einer Reihe vor mir stehen, um sich von mir ihr St.-Angelus-Abzeichen an die Tracht stecken zu lassen, kann ich anfangen, darüber nachzudenken. Sie werden der Beweis sein, dass ich etwas Sinnvolles getan habe.«
»Mag schon sein. Ich hoffe, dass es gut für Sie ausgeht und Sie die Entscheidung später nicht bereuen. Stellen Sie sich vor, die neue stellvertretende Oberschwester wird ein noch schlimmerer Drachen als die Oberin. Wir wissen ja, wie lange es gedauert hat, bis sie sich Ihnen gegenüber zivil verhalten hat.«
Emily saß im Ausschuss, der sämtliche Bewerbungen für das St. Angelus prüfte, von den Schwesternschülerinnen bis hin zu den Fachärzten. Dr. Gaskell leitete ihn, und sobald er begriffen hatte, dass Emily sich nicht selbst um den Posten der stellvertretenden Oberschwester bewerben würde, hatte er sie gebeten, die Bewerbungen dafür vorweg durchzugehen und eine Auswahlliste zu erstellen.
»Nun, wir haben versucht, geeignete Bewerberinnen auszuwählen«, sagte sie. »Keine, die noch in den Vorkriegszeiten der 1930er feststecken. Das Krankenhaus braucht eine moderne stellvertretende Oberschwester, die freundlich und klug ist. Der an den Patienten genauso viel liegt wie an den Schwestern. Die Veränderungen begrüßt und sich dafür einsetzt, dass auch verheiratete Schwestern hier arbeiten dürfen. Wie wir wissen, ist deren Ausschluss schlicht Diskriminierung und muss aufhören. Das ist die Frau, die wir suchen, Biddy.«
Biddy hob den Stiftebecher hoch und polierte schwungvoll den bereits blitzblanken Schreibtisch. Nachdem sie den Becher wieder hingestellt hatte, grinste sie Emily an. »Sie wissen, dass Sie gerade sich selbst beschrieben haben, oder?«
Emily ignorierte sowohl die Frage als auch Biddys Blick. »Ich habe eine neue Technik, um sicherzugehen, dass wir genau die richtige Bewerberin aussuchen«, sagte sie. »Ich war für eine erste Vorauswahl zuständig. Wie es dazu kam, dass die Oberschwester der zugestimmt hat, weiß ich zwar nicht, aber sie hatte keine Einwände. Die Kandidatinnen hatten alle ziemlich ähnliche Voraussetzungen: gleiche Herkunft, gleiche Erfahrung, beinahe alle beim Militär ausgebildet und ehemalige Mitglieder des Queen-Alexandra-Schwesterncorps. Der Krieg hat nach wie vor großen Einfluss. Also habe ich einfach jene Bewerberinnen ausgewählt, deren Namen sich nett anhören.« Sie klang recht zufrieden mit sich.
Biddy richtete sich auf und blickte Emily ungläubig an. Langsam legte sie den Telefonhörer wieder auf, den sie gründlich abgewischt hatte. Der Apparat klingelte leise, als Biddy ein letztes Mal mit dem Lappen über den Hörer strich.
»Damit ich das richtig verstehe: Sie haben bisher nur dafür gesorgt, dass die neue stellvertretende Oberschwester einen schönen Namen hat?«, fragte Biddy entgeistert.
Sie ging zur Fensterbank, um sie abzuwischen, und steckte ihren Lappen in die Schürzentasche. Dann wandte sie sich halb um und sah Emily an. Aus dem Augenwinkel konnte sie die Schwesternschülerinnen aus der Lovely Lane durch das hintere Tor kommen sehen, auf dem Weg zu ihrer Arbeit auf den ihnen neu zugewiesenen Stationen. Die rosa Trachten waren ein hübscher Anblick vor dem rußgeschwärzten Stein des Krankenhausgebäudes. Pammy Tanner ging wie immer voran, plapperte und lachte. Ihre gestärkte Haube wippte und sah vom Morgennebel schon bedenklich schlaff aus.
»Da kommen Ihre Mädchen«, sagte sie mit einem kaum merklichen Nicken zu Emily. »Diese Schwester Tanner ist ein Liverpooler Gewächs, wie es im Buche steht. Sagt immer zehn Wörter, wo eines genügen würde, kann nie still sein und gestikuliert beim Reden. Ist Ihnen das auch aufgefallen?«
Einen Moment lang war Biddy vom adretten Äußeren und der morgendlichen Frische der jungen Schwestern abgelenkt. In neun Stunden würden sie erschöpft die Treppe hinuntertrotten und für ihren Rückweg zur Lovely Lane doppelt so lange brauchen wie für den Hinweg heute Morgen. Sie beobachtete, wie die jungen Mädchen durchs Tor verschwanden, als sie die Treppe zum Hauptgebäude hinaufgingen, und blickte wieder zu Emily. »Hätten Sie die Schwesternschülerinnen nach dem Namen ausgesucht, wären Schwester Tanner und Schwester Brogan jetzt nicht hier, oder?«
»Hm, wonach soll ich denn sonst gehen?«, fragte Emily ratlos. »Es gibt sonst keine Unterschiede. Weil nur ledige Schwestern in Krankenhäusern arbeiten dürfen, lesen sich ihre Lebensläufe, bis sie vierzig sind, alle gleich. Genauso gut könnten sie alle voneinander abgeschrieben haben.«
Biddy schüttelte verwundert den Kopf. »Hoffen wir mal, das rächt sich nicht und beißt Ihnen noch in Ihren mageren kleinen Hintern, Miss«, sagte sie kichernd.
»Das wird es nicht. Sie sind alle im Corps gewesen, haben beim Militär gedient, in Lazaretten gearbeitet. Alle sind unverheiratet, und alle waren zwischen acht und zehn Jahre lang als Krankenschwestern tätig.«
Emily war nicht sonderlich gekränkt. Ihre Beziehung zu Biddy war besonders, und jetzt, da die Hauswirtschafterin ihr wenig professionelles Auswahlverfahren nüchtern in Worte fasste, klang es sogar für Emily vollkommen lächerlich. Und sie begann, ihre Methode selbst zu hinterfragen. Deshalb beschloss sie, das Thema zu wechseln. »Tja, ein Tee und ein Bacon-Sandwich wären jetzt schön. Und später hätte ich gern noch eine Scheibe von dem Schokoladen-Victoria-Kuchen; ich habe gestern gerochen, dass Sie in der Küche welchen gebacken haben. Das wäre mir sehr recht, ebenso wie etwas weniger von Ihren Zurechtweisungen.« Essen war immer ein sicheres Terrain bei Biddy.
»Ich kann den Bacon schon riechen«, meinte Biddy. »Schon verrückt, dass wir Kakao in der Küche haben. Es ist das erste Mal seit 1940, hat die Köchin mir erzählt. Nach dreizehn Jahren, können Sie sich das vorstellen? Damals gingen die Vorräte aus.«
»Ich habe gewusst, dass wir Kakao haben. Den erschnüffelt meine Nase aus einer Meile Entfernung. Und ich möchte schwören, als die Köchin gestern den Deckel von der Dose genommen hat, habe ich den Duft bis oben ins Klassenzimmer gerochen.«
»Sie hätten Tom mal sehen sollen, den Pförtnerjungen, der sie gebracht hat«, sagte Biddy. »Der hat richtig gesabbert, und alle mussten grinsen. Gut, eine Tasse Tee und ein Bacon-Sandwich kommen sofort, Schwester.« Es hatte soeben eine dezente Korrektur ihrer besonderen Beziehung stattgefunden, wie die Tatsache bewies, dass Biddy sie »Schwester« genannt hatte. Doch noch vor dem Feierabend würde sie wieder salopp über Emilys »mageren Hintern« spötteln.
Auf dem Weg nach draußen griff Biddy nach der Schaufel und kippte noch einige Kohlen aufs Feuer. Dann schloss sie die Bürotür hinter sich. Auf dem Weg die Treppe hinunter zur Küche schmunzelte sie vor sich hin.
»Was grinst du denn so?«, fragte Madge Jones aus der Telefonzentrale, die mit einer Tasse in der Hand an der Spüle lehnte und der kleinen chinesischen Köchin zuschaute, wie sie den besten Biskuit buk, den sie je gesehen hatte.
»Komisch, wie beliebt unsere Küche ist, seit es dort wieder Kakao gibt«, sagte Biddy, die Madge lächelnd begrüßte. In der Hierarchie des nicht-medizinischen Personals stand Madge irgendwo an der Spitze, zusammen mit dem Chefpförtner Dessie Horton. So wie Dessie hatte sie eine Aufgabe, die niemand sonst bewältigen könnte, ohne einen Nervenzusammenbruch zu erleiden.
»Ich bin nur hier, um ihn zu riechen, Biddy«, entgegnete Madge. »Aber bilde dir bloß nichts ein. Die Dosen stehen heute in allen Küchen – also kann ich überall hingehen, um Kakao zu riechen.«
Beide Frauen lachten.
»Was gibt es Neues?«, fragte Biddy, während sie ein Teetablett vorbereitete und zwei dicke Scheiben Weißbrot mit Butter bestrich.
Madge kam näher, damit niemand vom Küchenpersonal sie hörte. »Da war ein sehr interessanter Anruf, bei dem ich in der Leitung geblieben bin. Du weißt ja, dass ich das nicht sehr oft tue, versteht sich – Vertraulichkeit und so.«
Madge holte tief Luft und zog an ihrer Zigarette, und Biddy nickte energisch. Sie verzog keine Miene, obwohl sie dachte: Doch, tust du dauernd, du Lügnerin. Den ganzen Tag belauschst du Telefongespräche. Was Biddy natürlich nicht sagen konnte. Madge war überaus nützlich für die Gruppe, aber mit Vorsicht zu genießen. Sie kam sich ungeheuer wichtig vor, und niemand wagte es, sich mit ihr anzulegen.
Madge drückte ihre Zigarette in dem Ascher aus, den sie in ihrer Hand balancierte, und fuhr fort: »Jedenfalls war es Dr. Gaskell. Er hat mit einem der anderen Ärzte im regionalen TB-Ausschuss geredet, mit dem aus Manchester. Und ich habe gehört, wie er gesagt hat, er ärgert sich darüber, dass deine Miss Haycock sich nicht für den Posten der stellvertretenden Oberschwester beworben hat. Er hat gesagt, dass er ihr einen Brief geschrieben hat, in dem er ihr praktisch gesagt hat, sie muss sich nur bewerben, und die Stelle gehört ihr. Er will sie bitten, es sich noch mal zu überlegen.« Nervös blickte sie zur Köchin und tippte sich seitlich an die Nase.
Madge und Biddy hatten einen Pakt. Kein Wort von Madge wurde nach außen getragen. Wissen und Verschwiegenheit waren, wie sie alle sehr gut wussten, gleichbedeutend mit Macht.
»Na, da wird er enttäuscht werden, denn sie bewirbt sich nicht«, erklärte Biddy sachlich. »Sie will Schwester Tanner weiter im Blick behalten und denkt, keine von den Schülerinnen schafft es ohne sie. Für Schwester Tanner ist sie so was wie der Schutzengel, und sie wird nicht lockerlassen, bis sie ihren Abschluss hat. Da können weder ich noch Dr. Gaskell oder sonst wer irgendwas tun. Sie ist ein richtiger Sturkopf, und daran ist nichts zu ändern.«
»Es ist sowieso nicht diese Stelle, was sie braucht, Biddy. Sie braucht Liebe.«
»Denkst du, das weiß ich nicht? Aber sie lernt ja keinen kennen, nie. Tag und Nacht hat sie nichts als ihre Arbeit im Sinn. Die einzige Pause, die sie mal bekommt, ist, wenn sie ihren Stiefvater in dem Veteranenheim in der Dock Road besucht. Was ist das für ein Leben? In einem Heim voller verwundeter und alter Soldaten wird sie ja wohl ihre große Liebe nicht finden. Sie müsste einen Mann in ihrem Alter kennenlernen, bis dahin hat Amors Pfeil keine Chance, ihren mageren kleinen Hintern zu treffen. Gar keine.«
»Wetten, das sagst du ihr nicht ins Gesicht?« Madge spülte ihre Tasse unter dem Wasserhahn aus und grinste Biddy an.
»Und ob ich das tue! Wir verstehen uns. Manchmal denke ich, ich bin alles, was sie hat. Jemand anderen habe ich noch nicht gesehen.«
»Ach, hör auf! Was ist mit dem neuen Facharzt auf der Gyn, dem Sohn von Dr. Gaskell?«
Dr. Oliver Gaskell war seit über sechs Monaten auf der Gynäkologie, doch es müssten noch weitere fünf Jahre vergehen, ehe Madge, die seit vor dem Krieg im Krankenhaus arbeitete, nicht mehr von ihm als »dem neuen Facharzt« sprechen würde.
»Oh, in den hatte ich große Hoffnungen gesetzt«, meinte Biddy. »Er schien auch sehr interessiert. Aber nein, sie erlaubt mir nicht mal, irgendwas zu erwähnen, was mit Romanzen zu tun hat. Da macht sie gleich dicht. Und wenn ich nur seinen Namen nenne, wechselt sie ganz schnell das Thema.«
Biddy hatte keine Ahnung, dass Emily ihn sehr wohl in Erwägung gezogen hatte. Sie war sogar einmal mit Oliver Gaskell ausgegangen. Doch nachdem sie ihn auf dem Ärzteball mit Schwester Tanner hatte tanzen sehen, wo er die Schwester ein wenig zu eng an sich hielt und deren Haar küsste, waren jedwede Gedanken an eine erblühende Romanze verpufft. Bei Emily bekam keiner eine zweite Chance. Noch dazu war nun ihr Schützling Pammy Tanner in ihn verliebt. Und im Grunde ihres Herzens wusste Emily, dass Oliver Gaskell für sie nie infrage gekommen war.
Madge verschränkte die Arme über ihrem roten Strick-Twinset und musterte ihre frisch rot lackierten Nägel. Ihr blond gefärbtes Haar ging ihr bis knapp unters Kinn, und nicht zum ersten Mal dachte Biddy, wie gut sie für eine Fünfzigjährige aussah. Anders als sie selbst war Madge keine Sklavin ihrer Lockenwickler und Hühneraugen und sah stets aus wie aus dem Ei gepellt. Sie mochte leuchtende Farben, Nylonstrümpfe, hohe Absätze und jeden neuen Lippenstift, den Woolworths anbot. Doch der Ausdruck »gewöhnlich« würde niemals zu einer Frau passen, die so klug war wie Madge und sich so lange in einer Stellung hielt, die niemand außer ihr so gut ausfüllen könnte.
»Tja, ich denke, ich kenne jemanden, der sie ziemlich gern mag«, sagte Madge, die ihre Aufmerksamkeit von ihren Fingernägeln zurück auf Biddy lenkte.
»Und wer soll das sein?«, fragte Biddy, die prompt höchst interessiert war. »Jemand, den ich kenne?«
»Oh ja, das würde ich schon sagen. Dessie. Er hört nie auf, von ihr zu reden, und das bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Probier’s mal. Frag ihn einfach, wie das Wetter heute Nachmittag wird, und er findet einen Weg, sogar dann irgendwie ihren Namen ins Spiel zu bringen.«
Biddy lächelte. Madge sprach mit einer hübschen Telefonstimme, die jeder bewunderte. Ihre scharfen Vokale und die präzise Wortwahl sprachen für Bildung und Überlegenheit, mit einem Hauch von walisischem Akzent. Die Iren in Liverpool verstanden sich besser mit Chinesen als mit Walisern, so viel stand fest. Andererseits sagte Biddy oft zu ihrer Freundin Elsie, dass sie nicht alle gar so übel waren, die Waliser, nur diejenigen, die Vorurteile gegen Iren hegten.
Nun verschränkte Biddy die Arme vor ihrer großen Brust und sah Madge nachdenklich an. »Dessie? Also auf den wäre ich nie gekommen.« Er war ein guter Freund von ihr.
»Nein, kein Wunder. Du bist nämlich ein bisschen zu eng mit Dessie befreundet, deshalb. Du erkennst nicht, was direkt vor deiner Nase ist. Wenn du mich fragst, wird sie ihn auch nie in Betracht ziehen – dazu kennt sie ihn viel zu lange. Und da, denke ich, kommst du ins Spiel. Sprich einen Zauber, misch einen Liebestrank, steck sie in denselben Raum. Irgendwas, damit sie Dessie in einem neuen Licht sieht, nicht nur als den Chefpförtner, mit dem sie im Krankenhaus arbeitet, sondern als … du weißt schon.«
»Als was?«, fragte Biddy stirnrunzelnd.
»Ach, Biddy, natürlich als einen Mann, mit dem sie … Oh, Gott, Biddy, ins Bett gehen will, du weißt schon, der ihr mal ein wenig Spaß bereitet.«
Biddy hustete. Vom Blech der Köchin war ein Bröckchen Schokoladenkuchen auf den Tisch gefallen, und sie hatte es sich sofort in den Mund gesteckt. An dem erstickte sie jetzt beinahe. Tränen schossen ihr in die Augen, als sie Madge ansah. »Jetzt hör aber auf! Mir wird gerade klar, dass sie für mich wie eine Tochter ist. Der Gedanke, dass Dessie und meine Chefin – nein, nicht auszudenken! Musst du nicht in der Telefonzentrale sitzen, oder so?«
Madge grinste und stöckelte auf ihren hohen Absätzen aus der Küche. An der Tür drehte sie sich noch einmal zu Biddy um. »Denk drüber nach. Zwei einsame Menschen. Entzückende Menschen, Biddy. Du weißt, dass es nur richtig wäre.«
Emily hatte stirnrunzelnd auf die geschlossene Tür geblickt, während sie Biddys Schritten hinunter zur Küche nachlauschte. Sie war ja selbst befremdet darüber, wie sie die Aufgabe gehandhabt hatte, Bewerberinnen auszusuchen. Sie wollte Dr. Gaskell nicht enttäuschen, und zugleich wusste sie, dass sie es schon getan hatte, indem sie sich selbst nicht bewarb.
Eine Möwe segelte kreischend vom Mersey nach oben, landete auf dem Sims vor ihrem Fenster und rammte den Schnabel gegen das Glas, sodass Emily vor Schreck zusammenzuckte. Das Feuer im Kamin flackerte auf und knisterte, als sich die neuen Kohlen in die Glut fügten.
»Du dummer Vogel«, sagte sie zu der Möwe, als die ins Zimmer spähte, zu den Papieren auf ihrem Schreibtisch, dann hinauf zu Emilys Gesicht und zurück zu den Papieren. Es brachte Emily zum Grinsen. Sie nahm ihren Füller und eines der Berichtblätter, das auf eine Benotung wartete. »Hoffen wir mal, das beißt Ihnen nicht in Ihren mageren kleinen Hintern«, hörte sie Biddys Worte in ihrem Geiste. Damit hatte die Hauswirtschafterin einen Nerv getroffen. Zum ersten Mal machte Emily sich Sorgen. Auch wenn sie es nie zugeben würde, hatte Biddy eine unheimliche Art, sehr oft den Nagel auf den Kopf zu treffen.
Emily wusste nichts davon, wie unglücklich die Oberschwester mit Dr. Gaskells Entscheidung gewesen war, die Auswahlliste der Bewerberinnen ihr als Schulleiterin zu überlassen. Dass er überhaupt ihre Zustimmung bekam, eine Stellvertreterin einzustellen, war schon ein Kampf gewesen. Vor wenigen Wochen hatte er seinen ganzen verblassenden Charme einsetzen und in den Privaträumen der Oberschwester aufkreuzen müssen, um über die neue Stelle zu reden. Seit Schwester Aprils Fortgang gab es keine Stellvertreterin mehr, und das war 1941 gewesen, also vor zwölf Jahren. Schwester April war gegangen, um im Schwesterncorps zu dienen, wurde in Feldlazarette geschickt, und seither hatte niemand mehr von ihr gehört. Manch einer dachte, dass die Oberschwester auf ihre Rückkehr wartete. Hoffte. Sicher würde Schwester April eines Tages wieder die Stufen hinaufsteigen und ins St. Angelus kommen, um sie alle zu überraschen. Doch man hörte nichts. Briefe an ihre Familie kamen ungeöffnet zurück. Anrufe liefen ins Leere.
1947 gab es noch immer keine Nachricht von Schwester April, und es war für jeden offensichtlich, dass die Oberschwester sich sorgte. »Ich erkundige mich«, hatte Dr. Gaskell gesagt. Er war schon länger der Vorstandsvorsitzende der Klinik, als jeder, sogar die Oberschwester, sich erinnern konnte. »Ich habe immer noch sehr viele Kontakte in der Armee, Schwester Oberin. Und bei einem Namen wie Schwester Aprils muss jemand wissen, wo sie ist.«
Doch seine Erkundigungen brachten gar nichts, und jetzt war es an der Zeit, eine neue stellvertretende Oberschwester zu ernennen. Behutsam hatte er das Thema bei der Oberschwester angesprochen. »St. Angelus wächst beinahe zu schnell für uns. Wer hätte gedacht, dass einmal so viele leichtsinnige junge Männer in Automobilen und auf Motorrädern herumfahren würden. Allein letzte Nacht sind uns zwei junge Patienten in der Notaufnahme gestorben.«
Die Oberschwester hatte geseufzt. »Ich bin ja nicht grundsätzlich gegen die Idee«, sagte sie. »Es ist nur so, dass ich damit gerechnet habe, dass Schwester April zurückkommt. Sie hat St. Angelus geliebt.« Ihre Stimme versagte, und sie wandte sich verlegen ab, weil ihr die Tränen kamen.
»Ich weiß, Schwester Oberin, doch es ist schon sehr lange her.«
Das konnte sie nicht leugnen. Es war wirklich eine sehr lange Zeit gewesen, für sie alle. Die Nachwirkungen des Krieges wurden mit jedem Tag weniger spürbar. Und die Menschen freuten sich auf das, was der Frieden ihnen bot, nicht zuletzt die Hoffnung auf wachsenden Wohlstand. Für viele war es zu schmerzlich, sich zu erinnern. Jeder in Liverpool hatte jemanden verloren oder kannte jemanden, der in den finstersten Jahren gelitten hatte.
»Und es sind nicht nur die Motorräder und Automobile. Die neue Welle von Kriegsheimkehrern bedeutet, dass unsere Entbindungsstation bis auf den Flur überfüllt ist. Und die Einführung des NHS bringt jeden an seine Grenzen. Sie sind erschöpft, weil Sie zwölf Stunden täglich an sieben Tagen die Woche arbeiten. Sie sind nicht Florence Nightingale, auch wenn Sie ihr dicht auf den Fersen sind.«
Dr. Gaskell lächelte, und die Oberschwester gab nach.
»Sie haben recht. Ich habe meine Mutter schon beinahe ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Ich muss den Zug nach Lytham St Annes nehmen und sie in ihrem Heim besuchen. Sie ist jetzt fast neunzig, also sollte ich es bald tun.«
»Nun, ich denke, Sie haben eben selbst die Entscheidung getroffen. Wir brauchen eine stellvertretende Oberschwester. Ich habe Schwester Haycock gebeten, die Bewerbungen zu sichten und eine Vorauswahl von acht Kandidatinnen zu treffen. So, jetzt ist es heraus, und Sie werden mir hundert Gründe nennen, warum Sie glauben, dass ich einen Fehler mache. So leiten wir dieses Krankenhaus schon seit Jahren, nicht wahr?«
Sein Lächeln und seine bescheidene Haltung wirkten nicht.
»Aber, Dr. Gaskell, ich bin es, die am engsten mit der Stellvertreterin zusammenarbeiten wird. Es muss jemand sein, den wir angenehm finden. Eine Frau, von der ich weiß, dass ich mit ihr arbeiten kann.«
»Jemanden wie mich, meinen Sie?« Fragend zog Dr. Gaskell die Augenbrauen hoch.
Wieder schnappte die Oberschwester nicht nach dem Köder.
»Ihr werden einige sehr wichtige Aufgaben übertragen werden, für die ich dann keine Zeit mehr habe, und wir müssen auf ihre Kompetenz vertrauen können. Ich kann nicht die Hälfte meiner Arbeit an jemanden übertragen, wenn ich nicht absolut sicher bin, dass sie richtig erledigt wird. Ich bin es, nicht der Vorstand, die täglich mit ihr zusammenarbeiten muss. Und sie wird so viele neue Maßnahmen umsetzen müssen …«
»Was genau der Grund ist, Schwester Oberin, weshalb wir die Kenntnisse von Schwester Haycock nutzen sollten.« Er erwähnte nicht, dass er insgeheim zutiefst enttäuscht war, weil Emily die Chance ausgeschlagen hatte, selbst die Stelle anzunehmen. »Kommen Sie, wir beide sind noch Leute der alten Schule. Diese neue Generation von Ärzten und Schwestern hat im Krieg gedient, ist also schon auf dem Prüfstand gewesen. Sie sind zurückgekehrt und haben beruflich da weitergemacht, wo sie aufgehört hatten. Jetzt sind sie ein vollkommen neuer Menschenschlag. Sie haben andere Ideen, die eher zu dieser neuen Welt passen, von der alle immerfort reden.«
Sie waren ins Wohnzimmer der Oberschwester gegangen und setzten sich vor den Kamin, den die Haushälterin Elsie O’Brien eigens für den Besuch von Dr. Gaskell angefeuert hatte. Da er sein Leben der TB-Behandlung gewidmet hatte, konnte Dr. Gaskell kalte Räume nicht ausstehen. Deshalb saßen sie seit mehr Jahren, als jeder von ihnen nachzählen wollte, vor einem heimeligen Feuer. Es war still im Zimmer bis auf das Ticken der Standuhr, die einst der Mutter der Oberschwester gehört hatte.
Die Oberschwester saß auf ihrer Sesselkante, die Beine leicht seitlich angewinkelt, die Hände im Schoß verschränkt, und starrte in die züngelnden Flammen. Dr. Gaskell kannte sie, seit sie eine ziemlich junge Frau gewesen war. Als er nun ihr Profil betrachtete, stellte er zum ersten Mal fest, dass sie stark gealtert war, und fragte sich, wann das geschehen sein mochte. War es, als Schwester April zum Corps ging, während des Krieges? Oder als sie sich in Schwester Antrobus verliebt hatte, die Schwester April kaum unähnlicher sein konnte? Jene Liebe war entsetzlich missbraucht worden. Schwester Antrobus hatte sich als kaltherzige Frau entpuppt, die vor nichts haltmachte, um ihre Interessen durchzusetzen. Eine Frau mit einer starken Persönlichkeit und reichlich Ehrgeiz, die die Oberschwester bitter im Stich gelassen und sie vor dem gesamten Haus bloßgestellt hatte. Als Schwester Antrobus endlich von Schwester Tanner entlarvt wurde, versetzte man sie von der Gynäkologie in die Notaufnahme, wo sie nicht allzu lange Zeit mit einzelnen Patienten verbringen würde.
Der Oberschwester war wohl bewusst, dass sie seit Wochen den Krankenhausklatsch dominierte, aber sie ertrug es mit Fassung und hocherhobenem Haupt unter ihrer Haube. Möglicherweise war sie da so gealtert, dachte Dr. Gaskell. Grausam gekränkt, ihre Würde erdrückt unter der Last des Tratsches. Plötzlich wurde Dr. Gaskell das Herz schwer. Wahrscheinlich war er der Einzige im St. Angelus gewesen, der gewusst hatte, dass die Oberschwester in Schwester April verliebt gewesen war. Eventuell hatte er es sogar noch vor ihr selbst erkannt. Er war bis heute in seine Frau verliebt und betete sie an. Sie hatte ihm einen Sohn geboren, ihn in seiner TB-Arbeit unterstützt, sich nie beklagt, dass er zu viel arbeitete, und sie war ständig in seinen Gedanken. Die gleiche Zuneigung, die er für seine Frau hegte, hatte er in den Augen der Oberschwester gesehen, als sie mit ihrer Stellvertreterin April arbeitete. Und er hatte auch die Verzweiflung an jenem Tag gesehen, als Schwester April durch das Tor fortging. Er hatte miterlebt, wie der Oberschwester das Herz brach, und tiefes Mitleid empfunden, weil deren Gefühle ein gesellschaftliches Tabu waren. Über sie durfte niemals gesprochen werden, man hatte sie stumm zu ertragen. Welche Kraft muss sie all die Jahre aufgewandt haben, dachte er. Um sich dann in Schwester Antrobus zu verlieben und das Gesicht zu verlieren.
Dr. Gaskell schlug einen sanfteren Ton an, wie er ihn sonst eher bei Patienten benutzte. »Sehen Sie es ein, wir entstammen einem anderen Zeitalter. Der NHS wird alles verändern. Das zu verstehen, fällt uns schwer, doch Sie wissen, dass die wenige Macht, die wir hier noch besitzen, eines Tages verschwinden wird. Ich habe Schwester Haycock diesen Prozess zum Wohle des St. Angelus anvertraut, und zu Ihrem, Margaret. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, auch zu meinem. Wir müssen mit der Zeit gehen.«
Die Oberschwester sah ihn streng an. Das letzte Mal, dass Dr. Gaskell sie beim Vornamen genannt hatte, war bei seiner Mitteilung gewesen, dass es keine Nachricht von Schwester April gab.
»Wir sind immer noch im Bewerbungskomitee und haben jeder eine Stimme«, fuhr Dr. Gaskell fort, »selbst wenn die Vertreter des Liverpool District Hospitals Board in der Überzahl sind. Am besten lassen wir Schwester Haycock die Bewerbungen übernehmen. Sie hat eine objektivere Sicht, wer und was erforderlich ist. Also …, haben Sie noch eine Flasche Sherry in der Anrichte dort?«
Die Oberschwester lächelte. Dr. Gaskell gelang es immer wieder, seinen Willen bei ihr durchzusetzen. Er war der einzige Arzt im Krankenhaus, zu dem sie wirklich aufschaute. Als sie ihm sein Sherryglas reichte, blinzelte sie kurz beim Anblick seines faltigen Gesichts und des weißen Haars. Obwohl er nie über sein Alter sprach, war man sich allgemein einig, dass er längst über siebzig sein musste. »Wie viel Zeit bleibt uns beiden noch hier?«, fragte sie, als sie sich wieder hinsetzte.
»Ich habe keine Ahnung, aber gewiss werden wir es merken, wenn es so weit ist. Und mit ein wenig Glück wird es am selben Tag sein, sodass wir gemeinsam gehen können. Dieses Krankenhaus wird fortbestehen, und es ist eine Tatsache, dass unser Beitrag, je älter wir werden, beständig kleiner wird gegenüber den Jüngeren, die mehr Energie besitzen.«
»Seit wann sind Sie so abgeklärt?«, fragte die Oberschwester. Sie klang ein klein wenig verärgert, was sich jedoch schnell gab, weil sie einsah, dass er recht hatte. »Ich stelle fest, dass ich Schlachten kämpfe, die ich eigentlich nicht kämpfen muss«, sagte sie. »So war es früher nie. Es ist, als würde ich sie wollen, um meine Autorität zu festigen. Was für eine Kraftverschwendung.«
Dr. Gaskell versuchte, das Thema zu wechseln. »Wie geht es Ihrer Mutter?«
Die Mutter der Oberschwester lebte in einem der besten Pflegeheime in Lytham St Annes. Es war eher ein Luxushotel, und die Oberschwester hatte das Haus der Familie verkauft, um die Unterbringung zu bezahlen. Ihr die beste Pflege zu sichern, war ihre Art, ihr Gewissen zu beruhigen, weil sie ihr Leben der Sorge für andere gewidmet hatte, nicht für ihre eigene Mutter. Sie besaß immer noch Ersparnisse und einiges Geld aus dem Hausverkauf, doch wenn der Tag kam, dass sie in den Ruhestand trat, hätte sie kein Zuhause und niemanden, zu dem sie gehen konnte. Dr. Gaskell hatte eine Frau und eine Familie. Für ihn wäre die Zukunft ganz anders, dachte sie.
Während sie vor dem Feuer ihren Sherry tranken, hoffte die Oberschwester, dass der Tag, an dem sie sich dem Ruhestand, der Armut und Einsamkeit stellen musste, nie kommen würde.
Unten auf dem Hof verstreute Dessie Horton Kohlen auf dem Pflaster. Dabei rief er dem Pförtnerjungen etwas zu, der mit einem Blecheimer zur Schwesternschule eilte. »Wo willst du damit hin, Tom?«, fragte er.
»Die sind für Biddy. Sie braucht mehr Kohlen für Schwester Haycocks Büro über der Schule, und ich bringe sie ihr.«
»Schon gut, Tom, ich mache das.«
Tom stellte den Eimer hin, schob seine Mütze nach hinten und kratzte sich am Kopf. »Aber das ist meine Arbeit, Dessie.«
»Weiß ich, Junge, doch ich möchte, dass du zurück zur Pförtnerloge läufst. Jake hat eine Liste von Stationen, die Sauerstoffflaschen brauchen. Die sind wichtiger als die Kohle.«
Froh, dass er Dessie nicht verärgert hatte, rannte Tom in Richtung Pförtnerhaus. Wie alle Jungen, die für Dessie arbeiteten, war auch er ausnahmslos loyal ihm gegenüber. Dessie, ein kinderloser Witwer Anfang vierzig, behandelte jeden seiner Helfer so, als wäre er sein Sohn. Und sie vergalten es ihm mit Respekt und Zuneigung.
Emily blickte auf, als sie hörte, wie die Bürotür leise geöffnet wurde. »Ah, hallo, Dessie. Das ist ja eine Überraschung. Wo ist Tom? Er ist doch nicht krank, oder?«
»Nein, ganz und gar nicht. Jake braucht ihn, weil wir einen Ansturm auf Sauerstoffflaschen haben. Anscheinend ist heute auf allen Stationen und in der Aufnahme der Teufel los. Es ist der Smog, sagt die Oberschwester. Der schlägt den Leuten auf die Brust.«
Emily drehte sich um und blickte durchs Fenster zum grauen Himmel und dem gelblichen Dunst in der Luft. »Der ist wirklich furchtbar. Was meinen Sie, Dessie, es heißt, wir bekommen dieses Jahr einen üblen Winter mit viel Schnee?«
Für einen kurzen Moment konnte Dessie nicht antworten. Er wusste, es stand immer schlimmer um ihn. Früher hatte er sie nur aus der Ferne beobachtet, wenn sie durchs Tor der Schwesternschule ging. Sie hatte keine Ahnung, welche Wirkung sie auf jeden Mann hatte, mit dem sie sprach. Sogar Dessies Assistent Jake, der glücklich mit Martha verheiratet war, schmolz bei Schwester Haycocks tiefblauen Augen dahin. Ihre Schwesternschülerinnen verehrten sie und hielten sie für eine Heldin. Immerzu setzte sie sich für sie ein, focht ihre Schlachten, vertrat ihre Interessen und nur wenige ihrer eigenen. Sie war engagiert und leidenschaftlich, aber auch einsam und verwundbar. Wenn er sie abends gehen sah und er wusste, dass sie ihren gebrochenen Stiefvater Alf besuchen würde, wurde Dessie die Brust eng. Er kannte ihre Geschichte. Das taten sie alle. Ihre gesamte Familie – die Mutter und die kleinen Brüder – waren beim Bombeneinschlag in der George Street umgekommen. Nur Alf hatte überlebt, weil er aus dem Haus gelaufen war, um Emily zu suchen.
Nachdem sie Dessie höflich etwas Aufmerksamkeit geschenkt hatte, wandte sie sich bereits wieder den Papieren auf ihrem Schreibtisch zu. Dessie wollte noch etwas sagen, überlegte es sich aber anders und kippte die Kohlen in die Schütte neben dem Kamin. Dann richtete er sich auf und erlaubte sich einen letzten Blick. Sein Herz pochte schneller, was es jetzt in ihrer Gegenwart immer tat. Er hatte es absichtlich so arrangiert, dass er zu ihr gehen konnte. Ihm war ganz gleich, ob sie da war oder nicht. Schon die süße Luft, die sie geatmet hatte, wäre ihm genug gewesen.
Sie schmunzelte über etwas, das sie las, schnalzte leise mit der Zunge und nahm ihren Füllfederhalter auf. Dann begann sie zu schreiben, ohne Dessie wahrzunehmen, der sich einen Augenblick gönnte, um die Frau anzusehen, die ständig seine Gedanken beherrschte.
Es war ihr Haar, stets ordentlich hochgesteckt, aber mit kleinen Locken, die sich den Klammern entzogen und sich noch vor dem Mittagessen befreiten. Es waren ihre kleinen Schritte, ihre Verletzlichkeit, ihr Lächeln, die Art, wie sie sich in das Schwesterncape wickelte, das sie nicht aufgeben wollte. Es gab keinen lebenden Mann, der sich nicht wünschen würde, dieses Cape zu sein. Ihre zierliche Gestalt zu schützen und sie mit seinen Armen zu umfangen. Dessie schaute zu, wie sie schrieb, während er zur Tür ging und sie sehr leise hinter sich schloss, um Schwester Haycock nicht zu stören. Durch das Glas in der Tür sah er noch einmal zu ihr. Sie hatte nicht bemerkt, dass er gegangen war, doch es kümmerte Dessie nicht. Ihm genügte, dass sie seinen Namen kannte, ihm für die Kohlen dankte und ihm in die Augen sah. Damit konnte er eine Woche oder länger überleben.
Dich hat es übel erwischt, Dessie, sagte er sich, als er die Holzstufen, jeweils zwei auf einmal, hinuntereilte.
Biddy, die mit einem Tablett in den Händen im Zwischenstock stand, sah er gar nicht. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als er mit gesenktem Kopf und dem leeren Eimer in der Hand an ihr vorbeisprang.
»Waren das die Kohlen für Schwester Haycocks Büro?«, fragte sie.
Dessie hielt mitten im Laufen inne. »Ja, Biddy. Ich habe einige nachgelegt, und die Schütte ist randvoll. Jetzt hat sie es schön warm.«
»Gut, und im Klassenzimmer brauchen wir auch welche. Da bibbern sich zweiundzwanzig Schwesternschülerinnen halb zu Tode.«
»In Ordnung, ich schicke Tom gleich hin.«
Biddy grinste. »Oh, dann übernimmst du das nicht selbst?« Doch ihre Frage kam zu spät, denn unten fiel bereits die Tür ins Schloss.
»Sieh an«, murmelte sie. »Anscheinend hat Madge recht.«
Emily war ans Fenster gegangen und zog die untere Scheibe ein wenig hoch. Die Möwe trippelte auf dem breiten roten Sandsteinsims zur Seite und beäugte sie misstrauisch, als Emily ihr einen halben trockenen Pfeilwurzkeks hinlegte.
»Hier, du dummer Vogel«, sagte sie. »Der ist für dich.« Die Möwe schaute zu dem Keks und zurück zu Emily. »Iss ihn, wann immer du willst, aber warte nicht zu lange, denn es gibt bald Regen.«
Als sie den Kopf wieder zurückzog, sah sie Dessie über den Hof laufen. Einer der Jungen kam ihm entgegen und nahm ihm den leeren Kohleneimer ab. Emily fiel auf, wie liebevoll Dessie die Mütze des Jungen nach hinten schob und wieder richtig hinrückte. Und der Junge rief lachend: »Mann, Dessie!«
Fröstelnd schloss Emily das Fenster wieder und beobachtete Dessie, wie er zurück zur Pförtnerloge ging.
Biddy kam herein und stellte das Tablett auf den Schreibtisch. »Hm, das ist ja ein schönes Feuer. Ich habe meine Tasse mitgebracht und stehle mir einen Tee aus Ihrer Kanne«, sagte sie zu Emily, die ihr den Rücken zugekehrt hatte und aus dem Fenster schaute.
Sie brachte Emily ihre Tasse und bemerkte Dessie, der soeben um die Ecke bog. Als sie zu Emily sah, erkannte sie, dass sie ebenfalls zu ihm blickte.
»Was ist mit Dessies Frau passiert?«, fragte Emily.
Biddy beschloss, zu lügen und ihr die Geschichte zu erzählen, die man Dessie erzählt hatte. Doch das würde schwierig werden. Je weniger sie sagte, desto besser. »Es war die Bombe am Hafen. Dieselbe Nacht.«
Emily warf ihr einen Seitenblick zu, als sie die Tasse und die Untertasse annahm. Mehr Worte waren nicht nötig. Sie wusste genau, was Biddy meinte. Dessie hatte seine Frau in derselben Nacht verloren wie Emily ihre Familie. Sie beide hatten gelitten, und wie jeder in Liverpool, dem der Krieg nahe Menschen geraubt hatte, litten sie schweigend.
»Mich wundert, dass er niemanden hat, Sie wissen schon, verlobt ist oder so. Er ist solch ein reizender Mann. Ich hätte gedacht, dass ihn sich mittlerweile mal eine kluge Frau geschnappt hat.«
»Dessie? Nein. Er hat lange getrauert, ist jetzt aber drüber hinweg. Ihn interessieren nur seine Jungs und deren Familien. Unten in der Dock Road ist unser Dessie so was wie ein Held.«
Emily nickte – es war ihr bekannt – und drehte sich zu ihrem Schreibtisch um. Zu spät wurde ihr klar, dass Biddy näher ans Fenster getreten war.
»Heilige Maria Mutter Gottes!«, schrie Biddy. »Ist das zu glauben? Dieser Vogel hat uns einen Keks bis hier oben auf den Sims gebracht!«
Kapitel zwei
Amy Currans Elternhaus war mit allem vollgestopft, was man für Geld kaufen konnte. Zu viele Sessel. Zu viele Beistelltische mit Fransendeckchen und dekorativen Lampen. Bilder und Kruzifixe schmückten sämtliche Wände, und es gab kaum einen Zentimeter Fensterbank, auf dem kein Nippes stand. Verglichen mit ihren Nachbarn, waren Amys Eltern wohlhabend. Ihr Vater arbeitete bei McConaghy's, der Jute- und Altmetall-Verarbeitungsfabrik, die seiner Schwägerin und deren Mann gehörte. Dort war er von Anfang an dabei gewesen, hatte die meiste Arbeit geleistet, um das Geschäft in Schwung zu bringen, und bekam dafür fünf Prozent vom Gewinn.
»Fünf lächerliche Prozent. Ohne mich hätten die gar kein Geschäft«, beklagte er sich bei seiner Frau allmorgendlich ungefähr fünf Minuten lang, bevor er seine Mütze aufsetzte, die Donkeyjacke anzog, seine Sandwiches nahm, die stets in fettabweisendes Papier und feuchte Baumwolle eingewickelt waren, und die zwei Meilen zur Arbeit radelte. »McConaghy’s ist das, was es ist, weil ich hart dafür gearbeitet habe. Ich halte uns die Händler warm, spendiere ihnen freitagabends ein Pint Guinness. Deine Schwester und ihr Mann haben ihren Kopf bloß, damit’s ihnen nicht in den Hals regnet. Zwei Leute halten den Laden am Laufen: ich unten und die kleine Lily Lancashire oben im Büro.«
Dies war ein täglicher Klagegesang, und Amy konnte ihn Wort für Wort nachahmen. Sie verstand nicht, worüber er sich beschwerte.
»Ich kann nichts essen. Mein Magen ist heute Morgen ganz schlimm«, antwortete ihre Mutter jeweils, während sie ihm sein Frühstück hinstellte.
Er ignorierte es immer, trank seinen Tee und fuhr fort: »Lily kennt jeden Penny, der reinkommt oder rausgeht, und sie ist grundehrlich. Das arme Kind kommt in Lumpen zur Arbeit, aber bieten sie ihr eine Lohnerhöhung an? Einen Teufel tun sie!«
»Ich glaube, ich gehe heute mal zum Arzt und sage ihm, wie schlimm es ist. Ich brauche auch neuen Hustensaft, denn dieser wirkt nicht«, klagte seine Frau. Zwei Menschen, die beim Frühstück zwei verschiedene Unterhaltungen führten, jeder in seiner Welt.
Oft hörte Amy ihren Vater über seine fünf Prozent jammern, dachte allerdings, dass es trotzdem recht viel sein musste. Es reichte jedenfalls, dass ihre Mutter jeden Samstagmorgen mit ihr in die Stadt gehen und ihr neue Sachen kaufen konnte. Amy war das am besten gekleidete Mädchen in der Gegend, und das wusste sie. Sie hatte alles. Eine Frisierkommode, die sich unter der Sammlung von Nagellackfläschchen und Lippenstiften fast durchbog; Schuhe in Kartons, die sich beinahe bis zur Decke stapelten, und eine brandneue Fuchspelzstola, die auf einem Bügel außen an ihrem Kleiderschrank hing. Amy liebte ihre Besitztümer und lebte für die Mittwochnachmittage bei der Friseurin und der Maniküre. Überall wurde neidisch aufgeseufzt, wenn sie die Straße hinunter nach Hause ging. Oft waren ihre Arme beladen mit braunen Papiertüten und Schachteln von den besten Geschäften in der Stadt. An ihrem einundzwanzigsten Geburtstag würde sie diesen Weg in dem schwingenden Nerzmantel ihrer Mutter gehen.
Amy hatte eine Freundin, Dodo, die als Sekretärin in der Notaufnahme des St. Angelus Hospital arbeitete. Sie hieß eigentlich Doreen, doch der Name gefiel Amy nicht, weshalb sie ihn in Dodo umwandelte. Als Einzelkind war Amy es gewohnt, alles zu bekommen, was sie wollte. Sie war achtzehn Jahre alt geworden, ohne je ein Nein zu hören, und als sie Doreens Namen änderte, war es dasselbe gewesen: als wäre Doreen eine der vielen Porzellanpuppen, die Amy als Kind bekommen hatte. Und sollte es doch mal einen Anflug von Widerstand geben, wusste Amy, wie man Leuten das Leben schwer machte.
»Also, wenn du mit mir befreundet sein willst, dann kannst du das sein, aber diesen Namen halte ich nicht aus. Doreen? Ein fürchterlicher Name. Wie willst du denn mit diesem Namen einen Jungen finden? So heißen die Freundinnen meiner Mam im Mütterverein.«
Doreen hatte unglücklich dreingeblickt. Sie mochte ihren Namen recht gern. »Ich kann meinen Namen doch nicht ändern, Amy, du Dummkopf. Ich bin Doreen O’Prey, und die werde ich immer sein.«
»Hier, den kannst du haben, Dodo.« Amy hielt der dankbaren Doreen ein halb volles Fläschchen mit rosa Nagellack hin.
Doreen strahlte. Bei ihr zu Hause hatte noch nie jemand einen Nagellack besessen.
»Und, Dodo, ich finde, es wird Zeit, dass wir anfangen, in der Stadt auszugehen. Verfluchte Scheiße, wir sind beide achtzehn und noch Jungfrauen. Das ist doch nicht normal.«
Um ein Haar hätte Doreen den Nagellack fallen lassen. »Amy, so kannst du nicht reden! Jetzt musst du zur Beichte gehen.«
»Nein, muss ich nicht«, erwiderte Amy, die zum ersten Mal diesen Kraftausdruck ausprobierte und anfing, hysterisch zu lachen. »Verfluchte Scheiße! Da hörst du’s noch mal, klingt das nicht toll?«
Doreen sah aus, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen.
»Ach, ist ja gut, Dodo, mach dir nicht gleich in die Hose. Ich höre schon auf. Also, du musst dir natürlich irgendwas Hübsches von mir anziehen – nicht geschenkt, verstanden? – und mit mir in die Stadt gehen. So findest du einen netten Jungen und keinen Hafenarbeiter wie all die anderen Mädchen hier. Du musst ja nicht mit ihm ins Bett gehen, aber ich kann es gar nicht erwarten. Ich will wissen, weshalb alle so ein Theater darum machen. Das Grapes Inn ist nichts für mich und dich, Dodo. Wir haben Klasse und gehen in der Stadt aus.«
Obwohl es einigen sanften Widerstand gab, konnte Amy ihren Vater überreden, mit Dodos Vater zu reden, damit sie gemeinsam in die Stadt durften. »Daddy, ich sterbe hier mit Mam. Sie hört nie auf zu jammern, wie krank sie ist. Sie redet nur mit mir, wenn es um ihr Rheuma geht. Bitte, Dad!«
Er war Wachs in ihren Händen. Wann immer er die Chance hatte, seiner hypochondrischen Frau für einen Abend zu entfliehen, ergriff er sie. Also setzte er seine Mütze auf, ging zu Dodos Vater und klärte ihn darüber auf, was für eine gute Idee es war, dass die Mädchen mal einen Samstagabend zusammen ausgingen. Er würde dafür sorgen, dass sie sicher waren, und alle Kosten übernehmen.
So kam es, dass Doreen zu Dodo wurde, wenn sie mit Amy zusammen war, weil sie als Dodo hin und wieder einen alten Mantel geschenkt bekam, ein Teil, bei dem das Futter eingerissen war, oder ein Paar Schuhe mit abgebrochenem Absatz, das sie behalten durfte, wenn sie es reparieren ließ. Und sie gingen zusammen in die Stadt. Doreen begann zu glauben, dass Amy wirklich wusste, wovon sie redete, denn an ihrem ersten Abend lernte sie einen wunderbaren Mann aus Middlesbrough kennen, einen Handelsvertreter. Sie verliebte sich in dem Augenblick in ihn, als er mit einer kleinen Flasche Rotwein in der einen und einer Zigarette in der anderen Hand auf sie zukam.
Doreen hatte in ihrem ganzen Leben noch nie Alkohol getrunken, und es war auch das erste Mal, dass sie rauchte. »Ich weiß nicht, was ich tun soll«, hatte sie schüchtern gesagt, als er ihr die Zigarette anzündete und sie ihr gab.
»Lern es, und zwar verflucht schnell, Dodo«, zischte Amy, was Doreen sehr peinlich war.
Sie fragte sich, warum Amy sich ihre Bemerkungen nicht für den Mann namens Ben aufsparte, der sie mit Aufmerksamkeit überschüttete. Sie zog an der Zigarette, hustete und wäre am liebsten gestorben, als Amy laut lachte und zu den beiden Männern sagte: »Guckt sie euch an! Sie weiß gar nichts. Klecker mir ja keinen Rotwein auf mein Kleid, Dodo. Du kannst dir die Reinigung nicht leisten.«
Doreen wäre fast vergangen vor Scham und wünschte, der Boden möge sich auftun und sie verschlucken. Mit Amy war es immer dasselbe. Hätte sie doch nur den Mut, ihr zu sagen, sie könne sich ihr Kleid sonst wo hinstecken, und nach Hause zu gehen. Doch weil ihr Vater wegen seiner Kriegsverletzungen nicht arbeiten konnte, gab Doreen ihren gesamten Lohn ihrer Mutter, und dies war ihre einzige Chance, einen Abend auszugehen.
Amy wusste, dass Doreen kein Geld hatte. Deshalb hatte sie den Bus in die Stadt und die ersten Getränke an der Bar des Grand bezahlt, wofür Dodo ihr dankbar war. Das durfte sie nicht vergessen.
»Was verkaufen Sie?«, fragte Doreen ihren Verehrer, um von Amys gemeinem Lachen abzulenken.
»Staubsauger«, antwortete er, während er ihr Glas füllte. »Bleiben Sie bei mir, Dodo, und es wird nie ein zeitsparendes Gerät geben, von dem Sie noch nicht gehört haben. Ich bekomme sie alle direkt aus Amerika.«
Dodo hatte noch nie einen Staubsauger gesehen und war entsprechend beeindruckt. Vielleicht hatte Amy recht, und es könnte ein anderes Leben auf sie warten.
Am vierten Samstagabend hatte sich der Reiz, verqualmte Bars und Musik zu entdecken, für Amy abgenutzt, nicht hingegen der des Mannes, der ihr Getränke spendierte. Bisher wusste sie von ihm lediglich, dass er Ben hieß. Er hatte ihr weder seinen Nachnamen verraten, noch, wo er wohnte. Doch die Antworten auf diese Fragen fand sie selbst heraus, als er einmal in der Bar des Adelphi zur Toilette ging und sie allein mit den anderen zurückblieb. Da tauchte sie eine Hand in seine Jackentasche und zog seine Brieftasche heraus. Dort stand alles in seinen Dokumenten, und sie merkte sich seinen Namen und seine Adresse. Nachdem sie den dicken Packen Zehnpfundscheine bewundert hatte, steckte sie die Brieftasche wieder zurück.
Doreen beugte sich zu Amy vor. »Ich glaube, nächste Woche komme ich nicht mit, Amy. Dieser Bob ist nicht so nett, und ehrlich gesagt finde ich es langweilig, dass er nur über Staubsauger und Dampfbügeleisen redet. Nächsten Samstag musst du dir jemand anderen suchen. Da gehe ich lieber mit meiner Mam und ihren Freundinnen zum Bingo.« Den ganzen Tag über hatte Doreen schon ihren Mut sammeln müssen, um Amy das zu sagen. Jetzt war ihr Mund ausgetrocknet, und ihre Hände zitterten.
Amy drehte sich zu Doreen, und ihr Tonfall wurde so giftig, dass Doreen Tränen in den Augen brannten. »Mach das ruhig, aber komm später nicht heulend zu mir gelaufen, wenn du kein anständiges Kleid anzuziehen hast. Geh in Lumpen zum Bingo, und lass dich ja nicht mehr bei mir blicken, du nichtsnutziges Ding!«
Doreens Kehle war wie zugeschnürt, und sie konnte nicht antworten. Stattdessen floh sie zum Eingang des Lokals und wartete auf den Mann, den sie glücklicherweise bald los wäre. Bob. Doreen hatte ihm versprochen, dass er sie im Bus nach Hause begleiten durfte, und wie könnte sie das ablehnen? Da Amy so eingeschnappt war, hatte sie ohnehin niemand anderen, der ihr den Bus bezahlen konnte. Hätte sie das Geld gehabt, wäre sie allein nach Hause gefahren. Sie wäre zur nächsten Haltestelle gerannt – nur weg von ihnen allen.
Doreen schloss die Augen. Ihr war gleich, ob sie in Lumpen herumlief. Dieses Ausgehen mit Amy, die Treffen mit Männern in Bars und das Fluchen waren nichts für sie. Und es reichte ihr. Sie mochte arm sein, aber sie war nicht so dumm, dass sie nicht erkannte, wie sehr dies hier ihrem Ruf schadete. Doreen war ein anständiges Mädchen. Ihre Familie respektierte sie. Ihr Vater war stolz auf sie, weil sie die Stelle im Krankenhaus bekommen hatte. Sein Freund Dessie hatte sie ihnen vermittelt. Die beiden hatten zusammen im Krieg gedient, und sobald ihr Vater hatte einsehen müssen, dass seine geschwächte Brust ihn zum Invaliden machte, war Dessie zu ihnen gekommen, um zu sehen, was er tun könnte. Zu Anfang hatte Doreen ihren Alltag hart gefunden. Sie hatte ganz unten anfangen müssen, doch mittlerweile arbeitete sie in der Notaufnahme, wo sie die Patientendaten notierte, und sie liebte es. Die Leute kamen sogar zu ihr nach Hause und erzählten ihr von ihren Leiden. Ihr wurde klar, dass sie ein besserer Mensch war, als Amy gerade wurde, und sie wollte nicht deren Weg einschlagen.
Amy blickte ihr nach, als sie zum Eingang des Adelphi eilte. Sie stand auf und wartete darauf, dass Dodo es sich anders überlegte und zurückkam. Aber die drehte sich nicht einmal mehr um, blieb einfach nur dort stehen und kehrte Amy den Rücken zu. Tja, dann hau doch ab, Dodo, dachte Amy und trank ihren Piccolo aus. Sie würde schon wiederkommen, dessen war Amy sich sicher. Und jetzt hatte sie andere Pläne. Ihre Eltern waren heute Morgen in ihren jährlichen Urlaub abgereist, sodass sie allein zu Hause war und ihre Freiheit genießen konnte. In ihrem roten Mantel und den passenden Schuhen sah sie aus wie ein bunt gefiederter Vogel und platzte fast vor Lebenslust und Wagemut.
Ben kam von der Toilette zurück und zog im Gehen seinen Reißverschluss hoch. Er war immer viel schicker angezogen als Bob. Und er hatte eindeutig Geld; so viel stand für Amy nun fest.
»Wo ist Dodo?«, fragte er, während er sich eine Zigarette anzündete.
»Die wollte früher gehen. Bob bringt sie mit dem Bus nach Hause, hat sie gesagt.«
»Sie ist noch ein bisschen kindlich. Nicht wie du, was, Amy? Du bist schon eine erwachsene Frau.« Ben neigte sich vor, und ehe er sie aufs Ohr küsste, blies er ihr den Rauch ins Gesicht.
»Meine Eltern sind weg. Möchtest du mit zu mir kommen?«, flüsterte sie.
Als er den Kopf von ihrem Hals hob, blitzten seine Augen auf. »Ob ich möchte? Natürlich möchte ich. Ich finde, das klingt nach einer sehr guten Idee.«
Die vorherigen Samstage hatte Ben sie zur Bushaltestelle begleitet. Am ersten Abend hatte er sie geküsst. Am zweiten hatte er eine Hand in ihren BH geschoben, und Amy war schwindlig geworden vor Aufregung. Er hatte ihren Hals geküsst und geraunt: »Heb deinen Rock hoch, Amy.« Dazu blieb jedoch keine Zeit, denn die Lichter des nahenden Busses hatten die Haltestelle schon hell erleuchtet.
Amy war erpicht darauf, dass Ben so schnell wie möglich mehr wollte. Sie wusste, dass es falsch war und ihr Vater, sollte er vorbeikommen und sie sehen, vor Entsetzen sterben würde. Doch das kümmerte sie nicht. Sie langweilte sich und musste etwas haben, das man nicht kaufen konnte. Kleider, Schuhe und Taschen wurden allmählich öde, und dasselbe galt jetzt auch für Dodo, das Mädchen, dessen Namen sie geändert hatte.
»Wenn ich Ben alles erlaube, wird er mich heiraten wollen«, hatte sie am Nachmittag davor zu Dodo gesagt.
»Niemand macht das vor der Hochzeit«, hatte Dodo entsetzt erwidert.
Als ihre Eltern heute Morgen endlich zu ihrer alljährlichen Reise nach Abersoch aufbrachen, konnte Amy sie gar nicht schnell genug aus dem Haus haben. Sie fuhren in dem neuen Wagen, den sie von den fünf Prozent gekauft hatten.
»Meine Gallenblase spielt verrückt«, hatte ihre Mutter geklagt. »Mir ist nicht wohl dabei, so weit weg vom St. Angelus zu sein, wenn es mir so schlecht geht. Was ist, wenn sie platzt oder so und ich ins Krankenhaus muss?«
Amys Mutter jammerte über ihre Gallenblase, seit ihr Hausarzt, in dem verzweifelten Versuch, irgendeine Diagnose für die vielen Wehwehchen ihrer Mutter zu finden, dieses Organ erwähnte, das berüchtigt dafür war, blonden, dicken Frauen über fünfzig Probleme zu machen.
»Kann die platzen?«, hatte ihr Mann besorgt gefragt.
»Nein, kann sie natürlich nicht, Dad«, sagte Amy, als sie die Kofferraumklappe über dem neuen Lederkoffer ihrer Mutter schloss. »Ich habe Dodo gefragt, und sie sagt, das ist unmöglich.« Amy hatte nichts dergleichen getan, war jedoch auf jeden Einwand vorbereitet gewesen, den ihre Mutter vorbringen könnte, um ihrem Vater den Urlaub auszureden, für den er das ganze Jahr gearbeitet hatte. »Und gibt es nicht auch ein Krankenhaus in Abersoch?«
»Ich weiß nicht, ob da eines ist.« Ihre Mutter klang sehr ängstlich. »Haben wir das nachgesehen?«