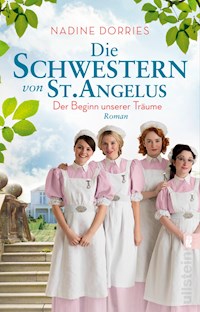
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liverpool 1953: vier junge Frauen, ein großer Traum! Dana ist der tristen Zukunft als Ehefrau eines Farmers entkommen und von der Großstadt Liverpool vollkommen überwältigt. Aristokratin Victoria flieht vor ihrem hochverschuldeten Erbe und hat eher romantische Vorstellungen davon, was es heißt Krankenschwester zu sein. Beth ist die verwöhnte Tochter einer Militärsfamilie, und Pammy kommt aus einer verarmten Gegend Liverpools, wo niemand von einer solchen Berufung auch nur träumt. Vier verschiedene Frauen mit dem gleichen Ziel: die erfolgreiche Schwesternausbildung im St. Angelus Hospital. Doch dann droht eine Tragödie das Krankenhaus in seinen Grundfesten zu erschüttern und die jungen Krankenschwestern müssen zusammenstehen und zeigen, was sie gelernt haben...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 619
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Die Schwestern von St. Angelus - Der Beginn unserer Träume
Die Autorin
NADINE DORRIES ist Bestseller-Autorin der Four Streets-Trilogie, The Angels of Lovely Lane-Serie und Ruby Flynn. Sie wuchs in einer Arbeiterfamilie in Liverpool auf und machte eine Ausbildung zur Krankenschwester, bevor sie in der Gesundeheitsbranche Karriere machte, ihr eigenes Unternehmen gründete und schließlich wieder verkaufte. Seit 2005 sitzt für Mid-Bedfordshire im englischen Parlament.
Das Buch
Liverpool 1953: vier junge Frauen, ein Traum!Dana ist der tristen Zukunft als Ehefrau eines Farmers entkommen und von der Großstadt überwältigt. Aristokratin Victoria flieht vor ihrem hochverschuldeten Erbe und hat eher romantische Vorstellungen davon, was es heißt, Krankenschwester zu sein. Beth ist die verwöhnte Tochter einer Militärsfamilie, und Pammy kommt aus einer verarmten Gegend Liverpools, wo niemand auch nur von einer solchen Berufung träumt. Vier verschiedene Frauen mit dem gleichen Ziel: die Schwesternausbildung im St. Angelus Hospital. Um hier bestehen zu können, müssen die jungen Krankenschwestern zusammenhalten und zeigen, was in ihnen steckt.
Nadine Dorries
Die Schwestern von St. Angelus - Der Beginn unserer Träume
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage September 2020© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020Copyright © Nadine Dorries, 2016Titel der englischen Originalausgabe: The Angels of Lovely Land (Head of Zeus 2016)Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © Yolanda de Kort / trevillion images (Haus, Wiese), © Lee Avison / trevillion images (Treppe), © Head of Zeus (Frauen), © FinePic®, München (Himmel)Gesetzt aus der Quadraat Pro powered by pepyrus.com
ISBN 978-3-8437-2385-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Für Chris
Prolog
Liverpool, Dezember 1940
Die junge Emily Haycock rannte wie der Wind die George Street entlang nach Hause. Sie war zehn Minuten später als sonst dran, und ihre Lunge schien sich mit dem Dunst des Merseys zu füllen, als sie die letzten Meter hügelaufwärts zum hinteren Tor lief. Sie war pünktlich aus der Munitionsfabrik gekommen, doch der Bus hatte unendlich lange gebraucht. Die George Street befand sich oben auf einem Steilhang, von dem ausgetretene Stufen nach unten zu den Docks führten.
Emily wusste, dass sie sich zu Hause umgehend die Essensmarken greifen und wieder loslaufen musste, um im Eckladen am Ende der Albert Street mit dem Rest der Fabrikarbeiter anzustehen. Sie hoffte, dass noch genug Bacon und Butter übrig wären, wenn sie an der Reihe wäre, damit sie ihren kleinen Brüdern ein Abendessen machen konnte. Bald wurde es dunkel, dann schloss der Laden, und alle bereiteten sich auf die Verdunkelung vor.
Emilys Stiefvater Alfred war im letzten Jahr verwundet von seinem Regiment, King’s Own Lancaster, zurückgekehrt. Jetzt trug er eine Schiene an seinem Bein und ging am Stock. Es war offensichtlich, dass er immerzu Schmerzen hatte, auch wenn er sich selten beklagte. Am Tag seiner Entlassung aus dem Krankenhaus hatte er sich sofort bei der Heimwehr gemeldet, bei der er nun jede einzelne Nacht verbrachte, sieben Tage die Woche.
»Hallo, Spatz«, sagte er, als Emily beinahe zur Hintertür hineinstürzte. Er saß auf der Sofakante. Morgens hatte es ihre gesammelten Kräfte gebraucht, das Ungetüm mit dem Holzrahmen und dem Rosshaarpolster aus dem Wohnzimmer vor den Küchenherd zu ziehen. Und auf ihm, eingehüllt in eine geflickte Decke, schlief Emilys erbärmlich dünne Mutter. Obwohl es ihr sichtlich schlecht ging, hatte sie am frühen Morgen darauf bestanden, aus dem Bett gehoben und nach unten getragen zu werden. Die Luft in der Küche roch säuerlich nach Blut und Sputum, ungewaschenem Haar und von Erbrochenem fauligen Atem.
»Pst.« Alfred hielt einen Finger an seine Lippen.
»Wie geht es ihr?«, flüsterte Emily, näherte sich auf Zehenspitzen dem Sofa und betrachtete das einst schöne, blasse Gesicht, das nun die Farbe von Talg hatte. Der Kopf ihrer Mutter war zur Seite gedreht, das Gesicht beinahe zur Rückenlehne gewandt. Schweißperlen standen auf ihrer Oberlippe, und Emily konnte ihren angestrengten und flachen Atem hören. Ihre Mutter lag im heilsamen Tiefschlaf der Kranken. In einem ihrer Mundwinkel war noch ein kleiner Blutstreifen, den sie bei einem ihrer Hustenanfälle mit ihrem Taschentuch dort verwischt haben musste. Ihre Lider waren dünn wie Pergament, und ihre Augen schienen tiefer eingesunken.
»Hast du einen guten Tag gehabt?« Alfred streichelte Emilys Unterarm. Es war eine liebevolle Geste, mit der er ihr Solidarität im gemeinsamen Kummer signalisierte. Emily brachte keinen Ton heraus. Jedes Mal, wenn sie das Haus betrat, brauchte sie einen Moment, um sich darauf einzustellen, wie ihr Leben jetzt war, nicht, wie es sein sollte. Sie war erst sechzehn, und wenn sie tagsüber in der Fabrik an ihrer Werkbank stand, konnte sie sich einbilden, dass es diese neue Situation mit ihrer schwer kranken Mutter und dem verwundeten Stiefvater nicht gab. Sie konnte sich ausmalen, alles wäre noch so wie vor dem Krieg, vor der Schwindsucht, bevor sie ihren Plan aufgeben musste, sich im St. Angelus zur Krankenschwester ausbilden zu lassen.
»Der Arzt war heute hier. Er hat gesagt, dass er sie ins Sanatorium schicken möchte, drüben in West Kirby. Sie hat versprochen, es sich zu überlegen. Er hat gesagt, er würde alle Hebel in Bewegung setzen, um ihr dort ein Bett zu besorgen. Ein guter Mann. Ja, das ist er.«
Emily bejahte stumm. Sie hatte den Facharzt oft gesehen, wenn er ihre Mutter besuchte, und mochte ihn sehr. Ihr kam er wie die Güte und Fürsorge in Person vor.
»Wie bezahle ich Sie für Ihren Besuch?«, hatte sie Alfred nach dem ersten Mal fragen hören.
»Gar nicht«, hatte der Arzt geantwortet. »Die Regierung deckt die Kosten im Rahmen eines Sonderprogramms, und selbst wenn nicht, würden Sie nichts zahlen müssen.«
Nachdem er gegangen war, hatte Emily seine Liste mit Anweisungen gelesen.
In dem Augenblick hatte Emily gewusst, dass ihr Traum, Krankenschwester zu werden, geplatzt war.
»Sie will das Haus und die Kinder nicht verlassen, aber deine Worte von heute Morgen haben gewirkt«, sagte Alfred. »Dr. Gaskell möchte sie noch einmal röntgen lassen, und dann möchte er die schwer befallene Lungenseite kollabieren lassen, um sie zu entlasten. Er weiß nicht, was er sonst tun soll, weil die Bettruhe nicht zu helfen scheint. Deine Mutter kann so stur sein.« Dabei sah er seine Frau mit einem solch zärtlichen Blick an, dass Emily es kaum aushielt. Sie wusste, was er meinte. Heute Morgen hatte sie ihn gebeten, wieder den Arzt zu rufen. Der anscheinend rapide Verfall hatte ihr Sorgen gemacht. Anstatt wenige Male am Tag Blut zu husten, war es morgens alle fünf Minuten gewesen.
»Wenigstens stimmt sie der Bettruhe zu. An die hält sie sich.« Emily griff nach Strohhalmen, und Alfred wusste es.
»Sie hat auch zugestimmt, morgen zu Dr. Gaskell ins St. Angelus zu gehen. Er ist ein guter Mann und der Beste für diese Krankheit hier in Liverpool, weißt du? Er kennt sich aus. Ich denke, er wird versuchen, sie nach dem Röntgen zu überreden, dass sie sich gleich ins Sanatorium bringen lässt. Wie er mir erzählt hat, ist er in Sorge, dass es um den anderen Lungenflügel schlecht steht. Das Problem ist, dass wegen des Krieges so viele Sanatorien geschlossen wurden. Die Warteliste kann über Monate voll sein. Vielleicht findet sie keinen Platz.«
Alfred verstummte. Sie beide wussten, wenn Emilys Mutter bereit war, ihre kleinen Söhne zu verlassen, musste sie sehr krank sein.
»Um zehn Uhr morgen früh sollen wir im St. Angelus sein«, sagte er nach einer Weile.
Emily hockte sich hin, ergriff die knochige, blau geäderte Hand ihrer Mutter, die wie eine Vogelkralle anmutete, und küsste den Handrücken. Sie verbarg ihr Gesicht, weil Alfred sie nicht weinen sehen durfte. Er hatte schon genug, mit dem er fertig werden musste, und sie sollte ihn unterstützen, ihm keine Last sein.
Emilys Eltern glaubten, dass sie nicht ahnte, wie schlimm es stand. Da irrten sie. Sie hatte die beiden nachts reden, flüstern und weinen gehört, wenn sie glaubten, Emily und die jüngeren Kinder würden schlafen.
Sie hatte den Husten ihrer Mutter bemerkt, ihr Frösteln und Schwitzen, das Blutwürgen und wie sie – übermannt von Erschöpfung – in einen Sessel sank. Ebenso die geschwollenen Knöchel und die schmerzende Brust. In ihrer Kindheit in den Hafenstraßen von Liverpool hatte sie genug Leute mit demselben Leiden gesehen, um Bescheid zu wissen.
Heute Morgen, als Emily ihre Mutter wusch und ihr ihren Tee brachte, hatte sie ihre Entscheidung gefällt.
»Ich höre in der Fabrik auf, Mam. Rita ist eine große Hilfe mit den Kindern, doch bis es dir besser geht, bleibe ich lieber zu Hause. Schließlich hat der Arzt gesagt, dass du nur einmal am Tag aufstehen darfst, um zur Toilette zu gehen. Ich muss hier sein, Mam.«
Ihre Stimme war gebrochen, denn Emily war den Tränen näher gewesen, als sie dachte. Ihre Mutter hatte versucht zu antworten, bekam jedoch erneut einen Hustenanfall. Emily sah den leuchtend roten Schaum, den ihre Mutter in ihrem Taschentuch verbergen wollte.
»Ich denke auch, es ist das Beste, Liebes«, hatte ihre Mutter gesagt und das Gesicht vor Schmerz verzogen, als Emily ihre Arme anhob, um sie zu waschen, und ihr dabei behutsam das Taschentuch aus den dünnen Fingern wand.
»Das ist kein gutes Zeichen, oder?«, hatte sie mit einem Kopfnicken zu dem roten Flecken gefragt.
»Ach, ich weiß nicht, Liebes. Vielleicht ist es das doch, du weißt schon: Das Schlechte muss raus, damit man richtig gesund wird.« Emilys Mutter hatte keine Ahnung, woher diese Worte kamen; sie wollte lediglich ihre Tochter beruhigen. Eventuell entsprangen sie einer uralten Erinnerung, dem Geist eines verstorbenen Angehörigen, oder sie hatte sich das in ihrer Stunde der Not schlicht ausgedacht, während sie darum rang, ihrer Familie die Angst zu nehmen. Und sie alle zusammenzuhalten.
»Ich bitte Dad, den Arzt zu rufen, und sage in der Fabrik, dass ich zu Hause gebraucht werde. Der nächste Freitag könnte mein letzter Tag sein. Das hier muss besser werden, Mam. Gehst du bitte ins Sanatorium?«
Mutter und Tochter lächelten einander matt zu. Dann bückte Emily sich und küsste ihre Mutter auf die Wange. »Ich muss weitermachen, Mam. Hörst du die Kleinen?«
Wieder wechselten sie einen Blick liebevoller Erschöpfung, da sie den Streit von unten hörten. »Ich bringe sie auf dem Weg zur Arbeit bei Rita vorbei – also falls ich ihnen nicht vorher die Köpfe einschlage. In einer halben Stunde muss ich los, sonst komme ich zu spät. Alf und ich schieben das Sofa in die Küche, und dann hilft Alf dir nach unten. Du hast übrigens recht: Unten ist es wärmer, aber du darfst nicht die Schiedsrichterin für die Jungs spielen.« Emily wusste, dass ihre Mutter genau deshalb nach unten wollte und es ihr Freude machen würde.
»Geh nur, Liebes, und danke«, sagte ihre Mutter. Sie drückte Emilys Hand. Doch als Emily an der Tür war, rief ihre Mutter sie zurück. »Komm her, Emily!«
Zögerlich drehte Emily sich zum Bett um. »Nicht, Mam«, ging es ihr durch den Kopf. Ihre Mutter sollte ihr nicht sagen, was los war. Für sie beide war es viel besser, wenn sie weiterhin vorgaben, alles würde gut. Für Emily war es leichter so.
»Alfred ist nicht dein richtiger Vater, aber du weißt, dass er dich lieb hat, nicht? Du bist ihm nicht weniger wichtig als die Jungen. Nein, du bist immer etwas Besonderes für ihn gewesen.«
Emily atmete erleichtert auf. »Mein Gott, Mam, natürlich weiß ich das! Ich liebe ihn auch. Alfred ist mein Dad. Er ist der Beste. Einen Netteren hättest du gar nicht heiraten können. Ich sage ihm täglich, dass er mein Alfred der Große ist!«
Emily grinste ihrer Mutter zu, die in dem Bett wie eine Puppe wirkte, entsetzlich abgemagert. Sie sah Tränen in den Augen ihrer Mutter schimmern. Was sie eben gesagt hatten, war mehr als eine Würdigung des Mannes, der ihnen ein Heim, Sicherheit und Liebe gab. Ihre Mutter wollte sich vergewissern, dass für Alfred gesorgt war, sollte ihr etwas passieren.
»Mach dir keine Gedanken wegen Alfred, Mam. Er wird immer meine Nummer eins sein, und ich lasse ihn nie im Stich, versprochen.«
Gestern Abend hatte Emily wach gelegen und die geflüsterte Unterhaltung ihrer Eltern gehört. »Es ist schon zu weit fortgeschritten. Jetzt sind beide Lungenflügel befallen.« Ihre Mutter hatte geschluchzt und Alfred sich vergeblich bemüht, sie zu trösten. Seine Stimme hatte erstickt geklungen, doch ihrer Mutter war es wie immer gelungen, ihn zu beruhigen.
Emily wäre am liebsten zu ihnen ins Bett geschlüpft und hätte sie angefleht: »Bitte, sagt mir, was los ist, denn das hier kann nicht wahr sein. Ich verstehe nicht, was geschieht. Alles ändert sich, und ich habe solche Angst.« Sie war voller Furcht gewesen, weil sie nicht wusste, was auf sie zukam. Und weil sie ahnte, dass das Schlimmste noch vor ihr lag.
Jetzt, am Ende des Tages, erkannte Emily, dass sich der Zustand ihrer Mutter binnen weniger Stunden deutlich verschlechtert hatte. »Sie hat die meiste Zeit auf dem Sofa gelegen und weigert sich, wieder nach oben ins Bett zu gehen«, erzählte ihr Dad. »Sie meinte, dass sie dich sehen will, wenn du von der Arbeit kommst, und die Jungen, wenn sie aus der Schule zurück sind. Du kennst ja deine Mam. Sie hasst es, irgendwas zu verpassen.«
Emily roch etwas, das ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Als sie sich umdrehte, sah sie eine Steingutform, bedeckt mit einem Geschirrtuch, auf dem Küchentisch stehen. Prompt kamen ihr die Tränen, wie es gegenwärtig dauernd geschah. Es musste eine Spende von einer der Nachbarinnen sein; wahrscheinlich Mrs Simmonds, die oft vorbeikam und sich zu ihrer Mutter setzte, wenn ihr Dad seine Runden machte. Wenn kein Fleisch im Haus war, nahm sie alles an Gemüse mit, was sie in der Küche der Haycocks fand, um es Stunden später in einem essbareren Zustand zurückzubringen. Oder sie kochte doppelt so viel Labskaus, wie sie für sich brauchte, und stellte die Hälfte hin, damit Emily es für die Kinder aufwärmen konnte, wenn sie von Rita zurückkehrten. Rita war eine weitere Nachbarin, auf die sie angewiesen waren. Für Emily war Rita eine Vertraute und ihre beste Freundin. Sie war nur wenige Jahre älter als Emily, hatte aber schon ihre eigene Familie.
Emilys Mutter öffnete die Augen und lächelte Alfred an. Emily empfand für einen Moment Eifersucht. Ihre Mam und Alfred liebten sich so sehr, dass Emily sich häufig ausgeschlossen fühlte. Sie sank wieder neben dem Sofa auf die Knie. »Mam, geht es dir gut?«, bettelte sie um die Aufmerksamkeit ihrer Mutter, wollte sie von Alfred ablenken und hatte dabei zugleich ein schlechtes Gewissen.
»Ah, da bist du ja, Spatz«, flüsterte ihre Mutter ein bisschen überrascht. »Ich muss gespürt haben, dass du zu Hause bist. Und ich bin froh, dass ich aufgewacht bin. Könntest du die Essensmarken nehmen und für mich zum Laden gehen, bevor die Kleinen heimkommen?«
»Die Kleinen sind schon zurück, Liebling. Sie sind direkt zu Rita gegangen«, sagte Alfred lächelnd zu seiner Frau. Ritas kleine Söhne und ihre eigenen waren unzertrennlich. »Sie kommen bald her, Spatz. Rita hat sie von der Schule aus mit zu sich genommen.«
»Es ist, als hätten wir entweder vier kleine Jungen oder gar keine«, sagte Emily, die das Heft mit den Coupons aus der Schublade des Küchentisches nahm. »Irgendwann kriegen wir raus, welche unsere sind, nicht? Wenn wir sie endlich auseinanderhalten können.« Sogar ihre Mutter lachte, obwohl es sie zum Husten brachte.
Es gab Pläne, die Kinder aus der Arthur Street und der George Street zu evakuieren. Es wäre zu nahe an den Docks und zu gefährlich, hieß es in dem amtlichen Schreiben. Viele Kinder waren schon fort, zumeist nach Nordwales, aber die, deren Eltern sich nicht von ihnen trennen wollten oder glaubten, der Krieg wäre bald vorbei, blieben. »Unsere Jungs gehen nirgends hin«, hatte Alfred gesagt, als der Brief kam. »Wenn uns eine Bombe erwischt, sterben wir gemeinsam.«
Emily hatte gelacht. »Uns erwischt keine Bombe, Dad, aber es könnte sicherer und leichter für Mam sein, wenn die Kinder gehen. Eine der Frauen in der Fabrik hat gesagt, dass eine Menge der Evakuierten sehr gut zu essen bekommen. Die in Nordwales kriegen Eier und Fleisch, und das allein ist ein guter Grund, sie wegzuschicken.«
Die Woche zuvor waren viele Kinder aus der Arthur Street nach Rhyl evakuiert worden, und die Mütter weinten noch. Alfred hatte sie gesehen und gehört, weshalb er die Jungen auf keinen Fall wegschicken wollte, auch wenn Emily dachte, dass es der richtige Zeitpunkt sein könnte. Jetzt, da ihre Mutter sich nicht mehr gegen das Sanatorium sträubte, wurde es eventuell Zeit, dass Emilys jüngere Geschwister zu ihren Altersgenossen kamen. Bei dem Gedanken an ihr Zuhause ohne die Jungen und ihre Mam grauste ihr dennoch davor, schrecklich einsam zu sein.
»Der Krieg wird schon vorbei sein, ehe die Kinder in Wales ankommen«, hatte Alfred gesagt. »Es wäre eine verschwendete Reise. Und außerdem will ich nicht, dass Fremde auf unsere Kinder aufpassen. Deine Mam würde es um den Schlaf bringen. Sie wäre krank vor Sorge.«
Was Alfred sagte, war nicht ganz abwegig. Heute Abend waren die Kleinen bei Rita und amüsierten sich, und Rita dachte genauso wie Alfred. Ihr Mann Jack hatte vor Wochen von der Front geschrieben, sie solle die Kinder evakuieren lassen. Bisher hatte Rita zwar nichts gesagt, aber gestern Morgen erst hatte Emily die Frau, die für die Organisation der Evakuierungen zuständig war, aus Ritas Hinterhof kommen sehen.
Sie hatte keine Ahnung, wie sie und ihr Dad es ohne Rita schaffen sollten. Falls deren eigene Kinder evakuiert wurden, wie könnten sie dann noch ihre Hilfe annehmen? Rita kämpfte jeden Tag, sprang aber immer ein, und im Gegenzug tat Emily für sie, was sie konnte, einschließlich auf ihre Jungen aufpassen, wenn Rita zu ihren Wochenendschichten in die Munitionsfabrik ging. Wären Ritas Kinder fort, würde sie zweifellos mehr Schichten arbeiten, und warum sollte sie auch nicht? Es würde allerdings bedeuten, dass sie nicht mehr da wäre, wenn Emily und ihre Familie sie brauchten. Diese Sorge trieb Emily seit gestern um, doch jetzt musste sie zum Laden laufen und die Kinder abholen, ehe es dunkel wurde.
»Ich laufe schnell zum Laden, Mam. In einer halben Stunde bin ich wieder da.«
Ihre Mutter lächelte ein wenig. »Du bist ein gutes Kind, Emily, das beste. Ich bin so froh, dich zu haben.« Emily küsste sie auf die Stirn und verharrte einen Moment so, um den Geruch des Haares einzuatmen, das sie sich nicht zu waschen traute.
Bevor sie zum Laden eilte, sah sie kurz bei Rita herein. »Gib mir deine Coupons. Im Laden haben sie Butter!«
»Oh, du bist ein Schatz!«, sagte Rita und holte ihre Essensmarken aus einer Schublade. »Wie geht’s deiner Mam? Ich hatte ihr mittags ein bisschen Graupensuppe gebracht, aber die wollte sie nicht essen.« Sorgenvoll sah sie Emily an, deren zwei kleine Brüder herbeigelaufen kamen und ihre Beine umschlangen, als sie die Küche betrat.
»Wir haben hier so viel Spaß, Emily! Willst du mitspielen? Rita hat gesagt, nachher müssen wir Radio hören, weil es Nachrichten über den Krieg gibt und sie wissen will, wo Onkel Jack ist. Kommst du dann auch?« Richard hüpfte vor ihr auf und ab und sah mit großen Augen zu ihr auf.
»Werde ich, wenn ich alles erledigt habe«, versprach Emily und lächelte Rita zu. »Und sobald der Abendbrottisch abgeräumt ist und wir zu Hause spielen können. Solange wir nicht zu laut sind. Mam ist auf dem Sofa, das wir heute Morgen in die Küche gerückt haben, und es würde ihr sicher gefallen.«
»Mammy ist auf dem Sofa! Mammy geht es wieder besser!«, rief Richard und hüpfte noch aufgeregter auf der Stelle. Dann rannte er zurück, um weiter mit den anderen Jungen zu spielen.
»Ich war heute da, als Dr. Gaskell gekommen ist«, sagte Rita. »Dein Dad hatte mich gebeten zu bleiben, als er zum Club musste, um seine Route für die Verdunkelung abzuholen. Er hat gesagt, dass es deiner Mam heute Morgen ziemlich schlecht ging. Der Arzt hat ihr eine Spritze gegen die Schmerzen gegeben und eine Medizin in einer braunen Flasche auf der Kommode dagelassen. Die soll sie nehmen, wenn es wieder zu schlimm wird. Er hat gesagt, dass deine Eltern morgen ins St. Angelus kommen sollen. Deshalb habe ich überlegt, ob du vielleicht willst, dass ich mit ihnen gehe, falls du nicht kannst.« Emily wollte widersprechen, aber Rita fuhr schon fort: »Maisie Tanner hat angeboten, die Jungs zur Schule zu bringen. Sie ist ganz vernarrt in euren kleinen Richard, also hätte ich Zeit, mit ins Krankenhaus zu gehen. Der Arzt hat gesagt, dass jemand bei deinen Eltern sein sollte und sich mit anhören, was er sagt, damit sie es später in ihrer Sorge nicht vergessen. Und ich habe ihm gesagt, dass es kein Problem ist, weil entweder du oder ich mitkommen. Was meinst du? Kannst du hin, oder soll ich? Ich glaube, der Arzt möchte, dass sich die Schwestern von St. Angelus um deine Mutter kümmern, und ich wüsste keine besseren. Meine Mam war im St. Angelus, und sie hat die Schwesternschülerinnen da geliebt. Die Engel von der Lovely Lane hat sie die genannt. Sie alle wohnen in diesem großen weißen Haus gegenüber vom Park. Weißt du, welches ich meine?«
Emily nickte. Sie hatte die Schwestern in ihren langen Röcken, den Capes und den gerüschten Kappen gesehen und als kleines Mädchen gedacht, dass sie noch nie so schöne Damen gesehen hätte. Zwar hatte sie es bisher niemandem anvertraut, aber alles, was sie sich jemals gewünscht hatte, war, einer von diesen »Engeln« zu werden. Eine Tracht zu tragen und für Kranke zu sorgen. Der Krieg, Alfreds Einberufung und schlimme Verwundung, die Krankheit ihrer Mutter und die zwei kleinen Jungen im Haus hatten all das zunichtegemacht.
»Ich höre nächsten Freitag in der Fabrik auf, Rita, weil ich jetzt zu Hause sein muss. Wenn Mam ins Krankenhaus kommt, kann ich nicht den ganzen Tag in der Fabrik sein. Kannst du morgen mitgehen, und ich reiche meine Kündigung ein?«
»Ja, selbstverständlich. Falls der Doktor vorschlägt, dass sie im St. Angelus bleibt, denke ich, dass es am besten so ist. Deine Mam wird bald mehr Hilfe brauchen, als wir ihr geben können. Sie wird die Engel brauchen.«
Emily kamen die Tränen. »Rita, wird meine Mam sterben?«
Rita wischte sich die Hände an der Schürze ab und ging auf Emily zu. »Sterben? Natürlich nicht, Liebes.« Sie nahm Emily in die Arme und drückte sie. »Sie wird im St. Angelus bleiben, um wieder gesund zu werden, nur bis ein Platz im Sanatorium frei ist, wie Maisie Tanners Mam. Und jetzt lauf los. Wir beide haben keine Zeit zu weinen. Dafür ist zu viel zu tun. Übrigens habe ich das beste Nachthemd deiner Mam gewaschen und meines, damit sie es auch tragen kann. Pack die mit einigen gewaschenen Sachen für sie zum Mitnehmen ein, und ein Kopftuch, damit ihr Haar ordentlich aussieht. Ich wollte es ihr waschen – Alf und ich hatten den Herd zum Glühen gebracht, damit das Wasser heiß wird, aber sie wollte nicht. Sie hat sogar mit uns geschimpft, dass wir Koks vergeuden. Und ich sollte das Wasser für die Kinder aufsparen. So, hier sind meine Coupons. Ich passe auf die Kinder auf, und du läufst los und holst die verdammte Butter.«
Sie gab Emily ihr Heft mit den Essensmarken und umarmte sie wieder. »Jetzt geh. Ich habe die Suppe fertig, wenn du wiederkommst. Danach kannst du wieder nach drüben.«
Als Emily zum Laden kam, stand Maisie Tanner vor ihr in der Schlange. Emily wusste, dass sie mit Rita zur Schule gegangen und jetzt mit Stan Tanner verheiratet war, der ebenfalls an der Front war. Sie hatten ein kleines Mädchen, das fünf oder sechs sein musste. Die Familie lebte bei Maisies Eltern, und Emily war gerührt, dass sie angeboten hatte, auf die Jungen aufzupassen.
»Ah, hallo, Emily. Wie geht es deiner Mam?«, begrüßte Maisie sie herzlich. »Ich habe Rita schon gesagt, dass ich euch gerne helfe, wie ich kann. Kein Problem. Meine Mam hat erst heute gesagt, dass sie sich erinnert, wie deine Mam einen Haufen Kinder mit Betty mit nach Crosby an den Strand genommen hat. Die halbe Straße hatten sie dabei. Erinnerst du dich an Betty, die Freundin von deiner Mam? Sie ist jetzt übrigens in Wales und sitzt da den Krieg aus.«
Das wusste Emily. Die Haycocks bekamen einmal die Woche Post von Betty, die ihnen schrieb, dass sie wahnsinnig waren, in Liverpool zu bleiben, und die Seeluft in Trearddur Bay genau das Richtige für ihre Mam wäre. Emily begann, sich zu fragen, ob sie recht hatte.
»Sie haben fünf Kinder in jedem Kinderwagen geschoben und in den und aus dem Zug geladen. Weiß der Himmel, wie sie das angestellt haben! Gott, es war wirklich witzig. Unsere Brenda war eines der Kinder, und sie erinnert sich noch daran. Seitdem war sie nie wieder am Strand. Aber sie sagt, dass sie den Tag nie vergessen wird. Ich habe deine Mutter geliebt, armes Ding.«
Emily konnte nicht antworten. Sie hörte nur, dass Maisie in der Vergangenheit sprach. Geliebt? Ihr kam es vor, als wäre Maisie, die nicht viel älter war als sie, weiser, als sie es je sein würde. Maisie gab Emily das Gefühl, nichts zu wissen. Machten Ehe und Kinder das mit einem? Wurde man durch sie älter und weiser?
»Rita will morgen mit Mam zu dem Arzt im St. Angelus«, sagte sie stattdessen. »Und ich werde in der Fabrik kündigen, denn ich muss zu Hause sein. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass andere helfen.«
»Na, das ist wirklich kein Problem, aber für deinen Dad wird es gut sein«, antwortete Maisie. »Du bist ein gutes Kind, Emily. Und sorge dich nicht. Das St. Angelus ist ein wunderbares Hospital. Einige Frauen in unserer Straße haben angefangen, ihre Kinder dort zu bekommen. Meine Mam sagt, die gehen nur hin, weil sie im Bett liegen und sich verwöhnen lassen wollen. Sieben Tage bleiben sie da, und die Schwestern waschen die Babys und alles. Man selbst muss keinen Finger krümmen. Das Engelhotel nennt meine Mam es. Sie hat es da geliebt, als es ihr wieder besser ging. Es wäre zu schön, wenn unsere kleine Pammy mal eine von den Engeln aus der Lovely Lane wird. Ich glaube aber, dies hier wird ein Junge. Es hört überhaupt nicht auf zu treten.« Lachend strich Maisie über ihren Babybauch. »Ich muss denen sagen, dass sie Stan nicht mehr in Heimaturlaub schicken sollen, denn noch eines will ich nicht, bevor dieser verdammte Krieg vorbei ist. Andererseits ist ein Jahr ohne viel zu lange für jeden Mann, und mein Stan soll ja nicht auf dumme Gedanken kommen, nicht?«
Emily wurde rot bis zu den Haarwurzeln, stellte aber zugleich fest, dass es in ihrer eigenen Straße viele Engel gab.
Ihre Nachbarn waren wunderbar. Sie wechselten sich ab, bei ihrer Mam zu sitzen, für sie zu kochen, sie zu waschen und zu umsorgen. Die ganze Gegend war voller Engel, und Maisie Tanner war einer der besten.
Ohne Vorwarnung schrillte plötzlich der Fliegeralarm los.
»Lauf!«, schrie Maisie, als der entsetzliche Lärm einer Explosion ihre Ohren zum Klingeln brachte. Das Ladenfenster zerbarst, und Scherben flogen durch die Luft. Noch nie hatte Emily etwas so Furchtbares gehört oder gesehen, und für einen winzigen Moment ließen alle in der Schlange ihre Taschen fallen, hielten die Hände vor ihr Gesicht und standen wie versteinert da. Ein kurzer Moment Stille folgte, als die letzten Glassplitter zu Boden hagelten. Als Erster rührte sich der Ladenbesitzer und brüllte allen zu, sie sollten gehen.
»Wir sind hier zu nahe an den verdammten Docks«, japste Maisie atemlos, als sie zurück zur Straße rannten.
»Hier, in den Bunker, Emily. Maisie, komm schon «, rief ein Nachbar, der mit Emilys Dad in der Heimwehr arbeitete und nachts sämtliche Häuser überprüfte, ob sie richtig verdunkelt wurden. Den beiden entging kein noch so kleiner Lichtstreifen. Jetzt stand er am Eingang des Luftschutzbunkers und scherzte mit den Kindern, die hineinliefen.
»Ich kann nicht. Ich muss zurück zu den Kindern und meiner Mam«, antwortete Emily.
»Warte!« Maisie packte ihre Hand. »Rita wird die Kinder in den Bunker am anderen Ende der Arthur Street bringen, und dein Dad wird deine Mam irgendwie nach unten schaffen. Er trägt sie, wenn es sein muss. Meine Mam ist sicher schon mit Pammy auf dem Weg in den Bunker, also sind wir hier am sichersten. Komm jetzt. Diesmal klingt es richtig nahe. Diese Mistkerle.«
Emily blickte zum Bunker und zur Straße zurück nach Hause. Die Bomben fielen früh. Wenn sie sich beeilte, könnte sie in unter drei Minuten zu Hause sein.
»Die sind gleich alle in Sicherheit. Tun wir lieber, was Tom sagt.« Die Sirenen heulten weiter, und Emily konnte Maisie bei dem Krach kaum verstehen, doch als die ältere Frau plötzlich wieder ihren Arm packte, wurde ihr klar, dass sie jetzt nicht mit ihr streiten durfte. Maisies Griff war zu fest, und sie verzog das Gesicht vor Schmerz.
»Ist es das Baby?«, fragte Emily erschrocken.
Maisie nickte, und Emily beobachtete, wie der gequälte Gesichtsausdruck ebenso schnell verschwand, wie er gekommen war. »Aber das kann nicht sein. Ich bin erst im siebten Monat, und das weiß ich so genau, weil da Stan im Heimaturlaub war. Es wird schon wieder aufhören.«
Emily hatte die Heimwehr-Übungen für Fliegeralarm ein halbes Dutzend Male mitgemacht. Sie wusste, dass Rita und die Jungen jeden Moment die George Street hinunter zum Bunker laufen würden. Rita hatte es mit den Kindern trainiert, und wahrscheinlich waren sie bereits auf dem Weg, die beiden kleineren im Kinderwagen und Richard und Henry hinten auf der Achse, die Hände fest an den Griff geklammert, während Rita schob. Sie würden sich in die entgegengesetzte Richtung bewegen und Rita die Kinder anspornen, in dem sie vorgab, dass sie Zug spielten. »Tschu-tschu«, würden die Kinder flüstern, und »Alle einsteigen in den Bunkerzug«, würde Rita antworten.
Ehe sie in den Bunker liefen, drehten Maisie und Emily sich zum Knall einer weiteren Explosion um und blickten hinunter zum Flussufer. Der Himmel war grellrot von auflodernden Flammen.
»Oh mein Gott!« Emily hielt sich eine Hand vor den Mund. »Eines der Schiffe muss getroffen sein. Der Himmel brennt.«
Maisie folgte ihrem Blick zum Mersey und war sprachlos.
»Na los, kommt ihr jetzt rein, oder nicht?« Tom klang nervös und wurde ungeduldig.
Und dann setzte die Stille ein. Eine schwere, drückende Stille, in der niemand sprach. Emilys Nackenhaare richteten sich auf vor Angst, und ihre Haut spannte sich an, als sie sich umschaute und bemerkte, dass alle totenstill dastanden und warteten. Dann kam es, das ohrenbetäubende Pfeifen und eine so laute Explosion, dass sie zunächst gar nichts mehr hörte. Die George Street war getroffen.
Es war ein kalter, diesiger Morgen, und immer noch schwelten Feuer, als Emily die Straße entlangging, die sie nicht mehr wiedererkannte. Benommen weigerte sie sich, in Panik zu geraten, versuchte, ruhig zu atmen – ein und aus, ein und aus. Die Frau, die Maisie bei der Geburt ihrer Tochter geholfen hatte – nicht des Sohnes, von dem Maisie überzeugt war, dass sie ihn bekommen würde –, war zur Arthur Street vorausgelaufen, den Namen von Maisies Mutter rufend, wie Maisie es selbst den Großteil der Nacht getan hatte. Sie hatte sich angestrengt, nicht vor Schmerz zu schreien, als sie die Bomben fallen hörten. Die Furcht hatte Emily das Herz zusammengedrückt, als sie in dem Bunker hockte und Maisies Hand hielt. »Da draußen ist es schlimm«, hatte eine der Frauen gesagt.
Tom, in dessen Bunker sie waren, hatte geantwortet: »Ist es. Es ist schlimm.«
Obwohl es jetzt hell war, schimmerte der Himmel dunkelorange durch den Staub und Rauch. Der Lärm einer einzelnen rennenden, laut rufenden Frau war surreal und verwirrend.
»Wo sind die Häuser und der Laden? Wo ist der Laden hin?«, fragte Emily niemanden direkt. Löschfahrzeuge versperrten ihr den Weg, und Männer, die an der Gashauptleitung arbeiteten, riefen ihr zu, sie solle stehen bleiben.
»Wo wollen Sie denn hin?«, rief ein junger Mann, als sie sich an der schon aufgestellten Absperrung vorbeidrängte. »Ey, halt! Sind Sie verrückt geworden? Da dürfen Sie nicht hin.«
»Aber ich muss. Ich wohne da. Ich muss nach Hause«, antwortete Emily. »Rita hat die Kinder.«
»Geht nicht, Schätzchen. In der Straße hat es einen direkten Einschlag gegeben. Es ist zu gefährlich.« Der Mann umfing ihren Arm und sah sie voller Mitgefühl an. »Auf welcher Straßenseite haben Sie gewohnt?«
Emily drehte sich zu ihm um. »Wir wohnen auf unserer Seite«, antwortete sie verwirrt. »Auf dieser.« Sie blickte zu der Stelle, an der die Häuser gestanden hatten und nun nichts mehr außer Trümmern war, und da sah sie ihre Mutter. Ungläubig schüttelte sie den Kopf. Ihr Verstand erkannte nicht, was sie so klar wahrnahm wie die Flammen, die noch aus dem Schutt ihres Zuhauses aufzüngelten. Sie rieb sich die Augen. Staub und Rauch verzerrten ihre Sicht. Dies hier war ein Albtraum. Sie würde aufwachen. Es konnte nicht wahr sein. Es durfte nicht real sein, und doch war es das. Es war real. Und das war ihre Mutter.
»Oh Gott, nein. Nein!«, schrie Emily, und ein Mann, den sie noch nie gesehen hatte und dessen Gesicht rußgeschwärzt war, kaum aus dem Qualm auf sie zugelaufen.
»Geht es Ihnen gut?«, rief er. »Sie müssen hier weg. Erst müssen wir die Gasleitungen sichern, ehe jemand in die Straße darf. Wohnt sie hier?«, fragte er den Feuerwehrmann, der Emily am Arm festhielt.
Emily hörte nicht zu. Sie blickte zu dem Gesicht ihrer Mutter, die auf dem Dach des Hauses gegenüber von ihrem früheren lag. Ihr Arm baumelte herunter, und sie starrte auf die Straße, die Augen weit offen und endlich frei von Schmerz.
»Alles in Ordnung, Mädchen? Ehrlich, ich muss Sie von dem Gas wegbringen.« Der Mann war nun vor ihr, doch sie konnte ihn nicht ansehen.
»Mam«, flüsterte sie.
Er folgte ihrem Blick. »Oh nein, verflucht!«, murmelte er, legte den Arm um ihre Schultern und wollte sie wegführen.
»Wir müssen meine Mam holen. Ich komme, Mam!«, rief sie, so laut sie konnte. »Richard! Henry! Richard!«, schrie sie in den Trümmerhaufen. »Rita!«
Sie wollte loslaufen, aber jetzt hielten mehr Hände sie fest.
»Bring sie ans Ende der Straße. Da ist ihr Dad. Er lebt noch«, hörte sie eine Stimme. »Sie lassen ihn auch nicht her.«
»Aber Rita hat die Kinder. Sie muss heute mit Mam zum Krankenhaus. Ich komme, Mam. Wir holen dich jetzt runter.«
»Komm mit, Liebes«, sagte ein Mann, den sie von der Heimwehr kannte. Er legte einen Arm um sie und hielt sie so, dass sie sich nicht bewegen konnte. »Keiner kann etwas tun. Ihr müsst nicht mehr ins Krankenhaus. Kein Arzt kann helfen. Sie sind alle tot, Liebes. Jeder in dieser Häuserreihe. Die ganze Nacht haben wir die Trümmer abgesucht. Es ist niemand mehr am Leben außer deinem Dad. Er war unterwegs, um dich zu holen, als die Bombe kam. Bringen wir dich zu deinem Dad.«
Sie hörte die Unterhaltungen der anderen Feuerwehrmänner in der Nähe, die sie nicht sehen konnten. Sie kamen von irgendwo inmitten des Staubs und der Flammen.
»Die war übel. Ein großes Mistding. Ich schätze, hier drinnen sind eine Frau und vielleicht vier oder fünf Kinder, vielleicht mehr. Alle tot.« Für einen Augenblick lichtete sich der Rauch, und Emily sah den Mann stehen, wo einst Ritas Küche gewesen war.
»Ich habe ihre Essensmarken«, flüsterte Emily unter Tränen. Sie wusste, zwei der Kinder, die der Mann meinte, waren ihre kleinen Brüder. »Ich habe ihre Essensmarken«, schluchzte sie wieder.
Kapitel eins
St. Angelus Hospital, Liverpool, Dezember 1951
Das St. Angelus war ursprünglich ein Armenhaus mit Blick auf den Mersey und den Atlantik dahinter. Die dunkle Sandsteinfassade hatte sich längst dem Schmutz, Rauch und schwarzem Ruß ergeben, der wie Glasur über die Mauern rann. Die vielen hohen Schornsteine spien erstickenden Qualm aus den Öfen im Keller aus, die für die Beheizung der Florence-Nightingale-Stationen sorgten.
Mitten durch das Erdgeschoss im Krankenhaus verlief ein langer, blank polierter Korridor vom Haupteingang bis zur Hintertür. Die Operationssäle, die Schwesternschule, die Lehrräume für die angehenden Ärzte, die Leichenhalle und die Küchen waren in eigenen Gebäuden untergebracht, die im Laufe der letzten zweihundert Jahre hinzugekommen waren. Von ihnen waren manche gemauert, andere, wie die Prothetikklinik, hatte man in den Nachkriegsjahren eilig aus vorgefertigten Teilen zusammengebaut und mit Blechdächern versehen.
Mit Ausnahme der Bereiche, in denen Patienten schliefen, wurde alles von einem Heer von Reinigungskräften nachts geputzt. Die Frauen rutschten auf entzündeten Knien voran, Metalleimer neben sich, und schrubbten die Böden mit harten Bürsten. Sie arbeiteten von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und bekamen fünf Schilling die Schicht. St. Angelus blitzte und roch streng nach Lysol, dessen einprägsamer Duft auf viele beängstigend wirkte.
Martha O’Brien war für das Ärztezimmer im St. Angelus zuständig und deshalb für jeden von Bedeutung unsichtbar.
Was allein ihre Schuld war, wie sie sehr wohl wusste.
Zumindest würden das alle sagen. Sie hatte gegen die Regeln verstoßen, also was erwartete sie? Eine Frau ohne jedweden Einfluss. Sie machte Feuer, räumte die Zeitungen weg, klopfte die Kissen auf und bereitete das Mittagessen für die Ärzte um Punkt ein Uhr. Das war ihr Job. Er sah vor, dass sie Tee servierte, kein Mitgefühl, würde man ihr sagen. Doch sie hatte es getan, weil er ihr leidtat, ohne zu ahnen, was sie damit auslöste. Hätte sie es gewusst, wäre sie so weit weggelaufen, wie ihre Beine sie trugen, oder, noch besser, hätte schlicht den Mund gehalten. Tagein, tagaus hatte sie ihn beobachtet, wie er sorgenvoll auf dem Stuhl saß, und sich gefragt, was ihn plagte. Erst als Dr. Mabbutt auf einen Tee vorbeischaute, wurde das Geheimnis in dem Gespräch der beiden Männer gelüftet.
»Ihr sollt also künftig zwei Ärzte auf der Gyn sein? Tja, das ist ein Ding. Damit ist Ihre Abteilung die einzige im Haus mit zwei Ärzten.«
Der Orthopäde Dr. Mabbutt sprach Dr. Scriven an, den Geburtshelfer und Gynäkologen. Dr. Scriven verlagerte seine Position in dem Sessel und blätterte seine Zeitung so energisch um, dass das Blatt beinahe zerriss. Martha kannte all ihre Namen und ihre Fachgebiete, und da sie eine kluge junge Frau war und die Ärzte viel redeten, wenn sie sich hier begegneten, wusste sie mehr über ihr Privatleben, als sie sich vorstellten. Abgesehen von Dr. Gaskell, der schon so lange im St. Angelus war, dass sich niemand an eine Zeit ohne ihn erinnerte, waren Dr. Mabbutt und Dr. Scriven am längsten hier. Die Schwestern und anderen Ärzte behandelten sie mit einer Ehrfurcht, dass sie nahezu einen gottgleichen Status genossen.
Donnerstagnachmittags spielten sie zusammen Golf, wenn sie mit ihren Visiten im Privatflügel fertig waren, der Station fünf. Einmal im Monat gaben sie abwechselnd ein Dinner für andere auserwählte Ärzte, Praktikanten und deren ehrgeizige Ehefrauen. Angesichts seiner vielen Dienstjahre und seiner Stellung im Krankenhausvorstand war Dr. Scriven als der leitende Arzt nur noch Dr. Gaskell unterstellt, der dem Vorstand vorsaß. Dr. Gaskell war überdies im hiesigen TB-Komitee und allenthalben respektiert und verehrt. Sein Wort war im St. Angelus Gesetz. Zweifellos hatte Dr. Scriven Einfluss, jedoch nicht so viel, dass ihn der Vorstand zurate ziehen würde, bevor man entschied, ihm die Alleinherrschaft über die Station zwei zu nehmen – seine Machtbasis und Quelle unerschöpflicher Bewunderung.
Keiner der beiden Männer zuckte auch nur mit der Wimper, als Martha den Teewagen hinüberrollte, oder schien sie wahrzunehmen, während sie warteten, dass ihnen die Teetassen in die ausgestreckten Hände gereicht wurden. Im St. Angelus gab es neun Ärzte, und Martha musste jeweils nur einmal gesagt werden, wer wie viel Zucker, Milch oder Zitrone in seinem Tee wünschte. Sie nahm ihre Arbeit sehr ernst, kleidete sich sorgfältig und gab acht, dass ihre Schürze und ihre Rüschenhaube stets makellos sauber waren. Ihr langes dunkles Haar war zu einem ordentlichen Knoten gesteckt und jede einzelne Strähne sorgsam unter der Haube festgezurrt.
»Man sollte meinen, du würdest operieren, so wie du dich um die Sachen bemühst«, rief ihre Mutter Elsie oft, wenn sie morgens das Haus verließ, um den Bus um zehn nach sechs zu erwischen. Und es stimmte: Martha war so stolz auf das Ärztezimmer wie ihre Mutter zu Hause auf ihr Wohnzimmer.
Dr. Mabbutt sank in den bequemen braunen Ledersessel vorm Kamin, gegenüber von Dr. Scriven, der zu Marthas Verdruss noch seinen OP-Kittel trug anstelle des Anzugs, den er in den Sprechstunden und auf den Visiten anhatte. Im obersten Stock des St. Angelus gab es zwei Operationssäle, und die beiden Männer hatten parallel dort operiert, ehe sie für den Nachmittag Schluss machten. Die postoperativen Überprüfungen auf den Stationen überließen sie den Assistenzärzten und Famulanten.
Dr. Scrivens Kittel war schaurig blutbespritzt. Keiner der anderen Ärzte kam jemals in solch einem Aufzug zum Tee, und Martha hoffte inständig, dass einer von ihnen diese Gewohnheit irgendwann genauso abstoßend fände wie sie und erwähnte, dass der Arzt vielleicht etwas mehr Respekt vor dem Raum zeigen könnte, den zu putzen und angenehm herzurichten Martha ihr Leben widmete. Sie selbst würde natürlich nie etwas sagen, denn das kam ihr nicht zu.
Hätte sie doch bloß nie vergessen, wer sie war. Wie anders könnte dann alles sein. Manchmal fragte sie sich, ob Dr. Scriven angeben wollte, wenn er in seinem OP-Kittel durch die Tür kam, wenn doch alle anderen Ärzte achtgaben, sich ihre vorher auszuziehen. Sie war nur ein Hausmädchen, doch Martha schien es, als würde Dr. Scriven gern Eindruck machen oder vielmehr müssen, sogar bei einem solch unbedeutenden Publikum wie ihr.
Sie war bei den Nonnen von St. Chad’s zur Schule gegangen, hatte fleißig gelernt und war ein kluges Mädchen. Nach dem Krieg waren sie nur noch zu zweit zu Hause, daher musste sie sich eine regelmäßige Arbeit suchen, und der Lohn war entscheidend gewesen, als sich diese freie Stelle auftat. Ihr Vater und ihr Bruder waren beide im Krieg gefallen, weshalb Martha es für ihre Pflicht hielt, so bald wie möglich für ihre Mutter und ihr Zuhause aufzukommen. Folglich hatte sie ihren Plan, die neue Sekretärinnenschule in der Stadt zu besuchen und bei einer der Reedereien zu arbeiten, an den Nagel gehängt.
Es gab Momente, in denen sie ihr Schrubben unterbrach und mit dem Lappen in der Hand kniend innehielt, sodass die Mischung aus rosa Flüssigseife und dunkelgrünem Lysol auf den Boden tropfte. Seufzend malte sie sich aus, wie sie morgens mit einer Handtasche am Arm zur Arbeit ging, hübsch angezogen, in Schuhen mit kleinen Pfennigabsätzen und einem weit schwingenden Mantel, auf dem Weg zu einem schicken Büro unten am Hafen. Sie empfand keine Reue. Ihre Mutter und sie waren zufrieden, und Jake Berry, ihre Sandkastenliebe, arbeitete ebenfalls im St. Angelus; er war hier Pförtnergehilfe. Nicht, dass sie offiziell ein Paar wären. Nein, Martha würde nicht erlauben, dass Jake das glaubte. Außerdem waren sie seit der Schulzeit erst zweimal ausgegangen, und beide Male war es lediglich ein Sonntagsessen, gefolgt von einem Spaziergang am See im Sefton Park gewesen. Beim letzten Mal hatte Jake Marthas Hand genommen und sie in seine Ellbogenbeuge gehakt.
»Bald wirst du meine Frau, nicht?«, hatte er gefragt. »Du bist jetzt siebzehn. Wir können dann jeden Tag so gehen.«
Martha war rot geworden, aber eine Antwort blieb ihr erspart, weil ein Orchester in der Nähe eine Melodie anstimmte. Anstatt etwas zu sagen, hatte sie Jake schüchtern angelächelt und seinen Arm ein klein wenig gedrückt. Es genügte, dass Jake vor Stolz platzen wollte, weil er neben sich das Mädchen hatte, das er schon anbetete, seit sie als Kinder in Lumpen und löchrigen Schuhen auf der Straße gespielt hatten.
Martha schenkte den Ärzten ihren Tee ein und lauschte aufmerksam. Sie kannte Dr. Mabbutts Tonfall gut und hörte heraus, dass er noch nicht mit Dr. Scriven fertig war.
Letzterer setzte ein steifes Lächeln auf. »Ja, die Oberschwester hat es mir letzte Woche nach der Vorstandssitzung erzählt.« Martha erkannte, dass er sich bemühte, gelassen zu klingen. »Ich komme kaum hinterher mit den vielen Patientinnen, die mir geschickt werden. Und die Notfälle werden in Scharen eingeliefert. Die Liverpooler Frauen gebären mehr Kinder, als das St. Angelus entbinden kann, mitsamt den Folgeproblemen, die sich ergeben können.«
Darüber hatte Martha selbst im Echo gelesen und wusste mithin, dass es nicht gelogen war. In Liverpool gab es einen Babyboom. Doch nachdem sie Dr. Scriven ein Jahr lang beobachtet hatte, bemerkte sie auch, dass er diese Unterhaltung nicht genoss.
Sie gab ihm die Tasse auf der Untertasse in die flache Hand. Er beachtete sie nicht oder dankte ihr, sondern nahm den Löffel auf und begann zu rühren.
Dr. Mabbutt schien eine Schwäche entdeckt zu haben und sie genüsslich auszukosten. Er würde den sich windenden Dr. Scriven nicht vom Haken lassen.
»Hm, mag sein. Trotzdem weiß ich nicht, ob es mir gefallen würde. Meine Station ist meine. Die Stationsschwester und ihre Leute wissen, wie ich was wünsche. Nein, für mich käme es nicht infrage, fürchte ich. Außerdem haben wir jetzt alle diese neuen übereifrigen Ärzte. Die Burschen, die ihr Studium unterbrochen hatten, um im Krieg zu kämpfen. Natürlich sind sie beim Vorstand sehr beliebt und werden die Karriereleiter hinauffallen. Dr. Gaskells Sohn ist einer von ihnen, und er kann beachtliche Verdienste im Krieg vorweisen, wie ich höre. Gott, nein, ich würde keinen von denen bei mir haben wollen, wo er nur darauf wartet, mich als Sprungbrett zu benutzen und mir meine Station wegzuschnappen.«
Dr. Mabbutt schüttelte sich übertrieben und grinste. Doch sosehr Dr. Scriven sich bemühte, konnte er es nicht erwidern. Vier Wochen hintereinander hatte Dr. Mabbutt ihn beim Golf geschlagen; und nun nutzte er seine Information als weiteren Schachzug in ihrem Kampf um Überlegenheit und die unausgesprochene Anerkennung als zweiter Mann nach Dr. Gaskell. Dr. Scriven atmete langsam tief ein. Ihm war vollkommen klar, dass sein Kollege noch nicht fertig war.
»Wir sind übrigens auch sehr ausgelastet. Sie haben mir einen zusätzlichen Assistenzarzt und einen Praktikanten zugeteilt. Anscheinend kaufen sich jetzt sogar die Arbeiter Motorfahrzeuge. Ich habe eben einen jungen Kerl mit beidseitigen Oberschenkelhalsfrakturen operiert, die er sich bei einem Motorrollerunfall zugezogen hat. So etwas werden wir künftig gewiss noch sehr viel mehr sehen. Ich frage mich, warum sie nicht einfach eine zweite Gyn-Station einrichten. Warum drängen sie Ihnen einen zweiten Arzt auf? Egal, wie viel Sie zu tun haben, erweckt es nach außen den Eindruck, als würde man Ihrer Meinung oder der Qualität Ihrer Arbeit nicht trauen.«
Rums. Das hatte gesessen. Und Dr. Scriven zuckte leicht.
Er trank von seinem Tee, um Zeit zu schinden, weil er nicht gleich eine Erwiderung parat hatte. Dieselbe Frage hatte er sich gestellt. Und er seufzte fast vor Erleichterung, als die Rufglocke läutete. Dr. Mabbutt blickte zu dem Brett an der Wand und sah sein Licht blinken, als bereits das Telefon schrillte. Hastig sprang er aus seinem Sessel auf, wobei er sich Tee aufs Knie schüttete.
»Ja, bin schon unterwegs«, sagte er schroff in den Hörer, bevor er ihn aufknallte. »Tja, das war eine kurze Pause. Mein Letzter hat eine Krise im Aufwachraum, und der Anästhesist bekommt seinen Blutdruck nicht rauf. Weder der Praktikant noch die OP-Schwester sind zufrieden. Der arme Kerl ist erst sechzehn. Ich habe schon befürchtet, dass er den Schock nicht überlebt. Dabei habe ich die Frakturen gar nicht angerührt. Damit wollte ich warten, bis er stabil ist. Ich habe bloß zugenäht, was ich konnte. Allein mit dem Wundfaden könnte ich schon die halbe Hafenstraße auslegen.«
Er nahm seine Tasse auf und trank den Rest von seinem Tee. Als er zur Tür ging, konnte er nicht widerstehen, noch eine letzte Spitze zu platzieren. »Wissen Sie eigentlich schon, ob Sie sich mit dem Neuen ein Team teilen oder er seine eigenen Leute bekommt?«
Nicht einmal inmitten eines Notfalls wollte er seinen Vorteil verschenken. Er stand an der offenen Tür und wartete auf eine Antwort.
»Sein eigenes, versteht sich. Ich habe der Oberschwester gesagt, dass ich aus meinem Team niemanden entbehren kann. Wir sind so schon überlastet.«
»Ah, das ist noch schlimmer, wenn Sie mich fragen. Konkurrierende Teams auf einer Station … wer braucht die?«
Seine Worte hingen in der Luft, als die Tür zufiel.
Martha mochte im Krankenhaus arbeiten, seit sie vierzehn war, aber sie war alles andere als dumm. Dr. Scriven hatte versucht, vor Dr. Mabbutt das Gesicht zu wahren, doch Martha sah, dass er innerlich schäumte und unglücklich war. Ihr entging auch nicht, dass sein vor einem Jahr bloß an den Schläfen grau meliertes Haar inzwischen vollständig grau war. Neuerdings trug er eine Brille, und, so seltsam es war, sie fand ihn mit dem dunklen Brillengestell und dem grauen Haar noch attraktiver als zuvor.
»Schweinehund«, hörte sie ihn leise murmeln.
Ungefragt schenkte sie ihm Tee nach und legte zwei Pfeilwurzkekse auf einen Teller. »Es geht nichts über eine Tasse Tee und einen Pfeilwurzkeks, um einen aufzumuntern«, hatte ihre Mutter immer gesagt, wenn ein Fliegeralarm vorbei war und sie nach einer Nacht im Bunker zurück ins Haus kamen. Bei ihrer Mutter schien es zu wirken.
Dr. Scriven war tief in Gedanken versunken. Nun beugte er sich vor, stützte die Ellbogen auf die Knie, faltete die Hände und tippte sich mit dem ausgestreckten Zeigefinger an die geschürzten Lippen.
»Einen Penny für Ihre Gedanken«, sagte Martha, während er automatisch nach oben griff, um ihr den Tee abzunehmen.
Und da war er, der Moment, in dem sie eine Grenze überschritt, die Regeln brach und eine Abfolge von Ereignissen in Gang brachte, die ihre Welt und alles zerstören sollten, was sie als gut und wahr kannte. Jene Worte, jene impulsive Äußerung von Fürsorge und Mitgefühl würde verantwortlich sein für Schmerz und Verrat, Geheimnisse und Lügen und, was das Schlimmste war, einen Tod.
Kapitel zwei
Ein Dorf außerhalb von Belmullet, County Mayo, Irland, früher im Sommer 1951
»Dana, wach schon auf, Schlafmütze, und komm nach unten! Dein Brief ist angekommen, und dein Daddy verspätet sich, wenn er nicht bald aufbricht.«
Dana blinzelte wütend. Ihre Mutter hatte ihre Vorhänge zurückgezogen, sodass grelles Sonnenlicht durch ihr Fenster strömte. Gestern war es den ganzen Tag diesig und regnerisch gewesen, wie so oft an der windigen Westatlantikküste.
»Wie spät ist es?«, fragte sie, als sie die Füße aus dem Bett auf den kleinen Läufer schwang, um das kalte Linoleum zu meiden. In ihrem Bauch vermengte sich Furcht mit Vorfreude.
Er war angekommen, der Brief, der ihr sagen würde, ob sie als Schwesternschülerin im St. Angelus in Liverpool angenommen war oder nicht. Falls ja, wäre ihr Traum wahr geworden. Falls nicht, müsste sie das Angebot von dem Krankenhaus in Dublin annehmen, was sie wirklich nicht wollte. Ihr Vater hatte klipp und klar gesagt, sollte sie eine Ausbildung in Dublin machen, müsste sie an ihren freien Tagen und in den Ferien nach Hause kommen und ihrer Mutter auf dem Hof helfen. Dana liebte ihre Eltern, aber ein Einzelkind zu sein hatte seine Nachteile.
»Es ist halb acht, und kannst du jetzt bitte den Brief aufmachen! Der hat zwei Wochen gebraucht, bis er hier war. Es ist eine Schande!« Danas Mutter schwenkte den braunen Umschlag durch die Luft, als wollte sie sich Luft zufächeln. »Der Krieg ist lange vorbei, und die geben immer noch den Deutschen die Schuld, dass die Post langsamer ankommt, als sie unser Esel mit gefesselten Beinen bringen könnte. Jetzt beeil dich schon! Ich will zur Frühmesse, und Daddy muss mit dem Wagen in den Ort.« Mit diesen Worten lief ihre Mutter aus dem Zimmer und die Treppe hinab, wobei sie rief: »Noel, du rührst dich nicht vom Fleck! Warte, bis Dana unten ist und ihren Brief aufgemacht hat. Jetzt stellt euch mal beide an den Tisch.«
Dana zog sich ihren Morgenmantel über und blickte aus ihrem Fenster zu den unendlichen Meilen des vom Dunst umwaberten Moors. »Du wirst mir sicher nicht fehlen«, sagte sie zu dem nassen, weich abfallenden Grün. »Ich will mein eigenes Leben, ja, will ich. Und ich will Patrick O’Dowd nicht heiraten!«
Wie aufs Stichwort hörte sie den Gatterriegel klacken, und als sie das Gesicht ans Fenster presste, konnte sie Patrick über den Hof kommen sehen. Hatte er ihren Blick erahnt? Jedenfalls sah er zu ihrem Fenster auf und winkte ihr zu. Dana erwiderte matt.
Patrick verschwand unter ihrem Fenster, um durch die Hintertür ins Haus zu gehen. »Die blöde Mrs Brock«, verfluchte Dana die Postbotin, als sie ihren Morgenmantel abstreifte und ihre Hose anzog. Sie muss ihm erzählt haben, dass mein Brief gekommen ist, dachte sie. Und er musste begriffen haben, was es war. Warum sonst sollte er hier sein?
Jetzt war sie wütend, was sie sich auf keinen Fall anmerken lassen wollte. Sie zog sich einen Pullover über und ging nach unten in die Küche, wo das Familienkomitee auf sie warten würde. Ihre Großmutter dürfte bereits vor ihr gewusst haben, dass der Brief da war. Mrs Brocks Antennen reichten bis nach Sligo.
Die nächsten zwanzig Minuten musste Dana sehr vorsichtig sein. Ihr Glück war, dass ihre Mutter niemals die Messe versäumen würde, und ihr Vater musste in die Stadt, um den frisch eingetroffenen Dünger zu besorgen, ehe er ausverkauft war. Beim Abendessen gestern hatte er von nichts anderem geredet. Ihr Plan war, ihrem Vater stets einen Schritt voraus zu sein, seine Argumente zu erahnen und eine Antwort bereit zu haben, gegen die er nichts einwenden konnte. Alles war ganz einfach. Er war ein schlichter Mann, der sein Leben an seiner Religion und einigen sehr strengen moralischen Regeln ausrichtete, geerbt von Danas Großmutter, die nun in ihrem Sessel am Feuer saß. Was Patrick anging, war er der Sohn auf der benachbarten Farm, die wiederum vom besten Freund ihres Vaters bewirtschaftet wurde. Er war Dana so vertraut wie ein Bruder, und bei der vielen Zeit, die er hier verbrachte, hätte er es ebenso gut sein können.
Als Dana die Küchentür öffnete, war die ganze Familie um den Tisch versammelt und wartete. Ihre Mutter lächelte, ihr Vater runzelte die Stirn, ihre Großmutter blickte verdrossen drein, und Patrick hatte sichtlich Angst, dass seine Welt aus den Fugen geraten könnte.
»Ich muss zur Toilette«, sagte sie lächelnd und betrat die Küche. »Himmelherrgott, ihr seht ja alle aus wie bei einem Exekutionskommando. Wartet eine Minute.«
Grinsend lief sie nach draußen. Fünf Minuten waren geschafft; blieben noch fünfzehn, wenn sie wieder drinnen war.
»Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee war, dass sie sich in Liverpool bewerben durfte«, sagte Patrick zu Danas Vater und knetete seine Mütze in den Händen.
»Mach dir deswegen keine Gedanken, Patrick«, entgegnete Noel. »Die nehmen sie nie an. Welches Mädchen, das in Belmullet zur Schule gegangen ist, hat es jemals ins St. Angelus in Liverpool geschafft? Das ist bloß ein Traum. Selten mal nehmen die ein Mädchen vom Notre-Dame-Kloster in Galway, weiß der Himmel, warum. Du kennst ja sicher den Spruch über die, ›Vom Notre Dame zum Kind im Arm‹, weil so viele von denen schwanger werden, sobald sie in Liverpool ankommen.«
Patrick grinste bei diesen Worten von Mann zu Mann. Er kannte Mr Brogan schon sein ganzes Leben und zollte ihm den gleichen Respekt wie seinem eigenen Vater.
»Hör mal, ich musste zustimmen«, fuhr Noel fort. »Als einziger Mann im Haus muss ich hier für klare Ordnung sorgen. Danas Mam hat manchmal den Teufel in sich, kann ich dir sagen, und wenn ich nicht sehr klug und streng bin, tanzen mir die beiden auf der Nase rum. Aber hin und wieder muss ich auch nachgeben, um des lieben Friedens willen. Beruhige dich, es wird alles gut. Sie geht in hunderttausend Jahren nicht ans St. Angelus.«
Er nahm seinen Teebecher vom Tisch auf und trank einen großen Schluck, um nicht mehr sagen zu müssen. Verdammte Mrs Brock. Sie musste Patrick von dem Brief erzählt haben, ehe er ihn von der Post abgeholt hatte. Und er war nicht annähernd so zuversichtlich, wie er tat. Seine Dana war schon immer ein kluges Mädchen gewesen.
»Wundert mich nicht«, hatte er zu seiner Frau gesagt, als Dana einen Mathe-Preis in der Schule gewann. »In meiner Schulzeit haben alle Brogans Preise gewonnen.«
Mrs Brogan wusste, dass es eine glatte Lüge war, das focht sie jedoch nie an. Sie hatte frühzeitig gelernt, dass sich der Frieden im Haus nur wahren ließ, wenn keiner dem Vater widersprach.
Noel blickte sich im Raum um und wünschte, jemand anders würde Patrick in ein Gespräch verwickeln. Sollte Dana wie durch ein Wunder im St. Angelus angenommen sein, wollte er sich nicht um Patrick kümmern müssen. Für ihn hatte heute Morgen Vorrang, den Dünger und das Futter zu holen. Seine Farm war nicht eine der ertragsreichsten in Westirland, weil er sich auf seinen Lorbeeren ausruhte und Zeit für junge Männer mit Liebeskummer hatte.
»Würde Patrick doch bloß alles mir und seinem Vater überlassen«, hatte er gestern Abend nach einer Menge Guinness zu Danas Mutter gesagt. »Sie wird ihn heiraten, weil ich ihr verdammt noch mal sage, dass sie ihn heiratet. Krankenschwester hin oder her, sie macht, was das Beste für die Familie und die Farm ist.« An dieser Stelle war er wie üblich auf den Küchentisch gekippt.
Patrick nahm wortlos seinen Tee auf. Er hatte es auf die Brogan-Farm abgesehen. Da Noel Brogan keine Söhne und nur eine Tochter hatte, musste Dana eine gute Partie machen. Patrick wiederum war der älteste Sohn der Nachbarfarm, und es wäre nur sinnvoll, die beiden Höfe zusammenzulegen. Außerdem wollte er Dana schon zur Frau, solange er denken konnte. Und seit ihre Väter sich darauf geeinigt hatten.
»Warum sollte es nicht so kommen?«, hatte Mr O’Dowd erwidert, als Patrick ihn vor einem Jahr fragte, ob er sicher sei, dass Dana Ja sagen würde, denn sie wirkte nicht sehr erpicht darauf. Jedes Mal, wenn er sie küssen wollte, vertröstete sie ihn auf später. Und einige dieser Zurückweisungen waren sehr verletzend gewesen.
»Hast du jemals eine Zahnbürste gesehen, Patrick? Auf deinen grünen Zähnen wächst schon ein Pelz. Das ist eklig«, hatte sie gesagt, als er bei der Ernte versucht hatte, sie an die Scheunenwand zu drängen.
Kurz darauf hatte sie ihn geschlagen. Da war er noch ein Junge gewesen. Inzwischen hatten sich sowohl seine Statur als auch seine Einstellung geändert. Er war kein Heranwachsender mehr und in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Gewalt alltäglich war. Und er hatte gelernt, mit Frauen so umzugehen wie sein Vater.
»Falls Dana mich will, hat sie eine komische Art, es zu zeigen«, hatte er zu seinem Vater gesagt. »Ich habe noch nicht mal ihre Brüste angefasst. Sie stößt mich immer weg.«
Er hatte weder mit dem Schlag gerechnet, der ihn seitlich am Kopf und der Wange traf, noch mit dem Mundvoll Erde, als er auf dem Boden aufschlug. Mr O’Dowd war schon sein Leben lang neidisch auf Noels fruchtbares Land und arbeitete seit Jahren daran, dass es eines Tages seiner Familie zufallen würde.





























