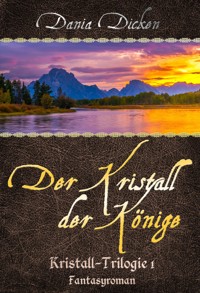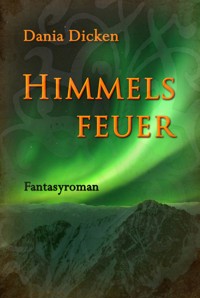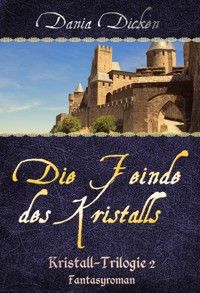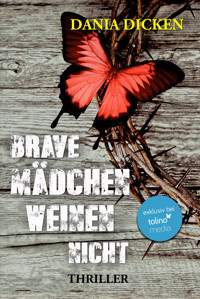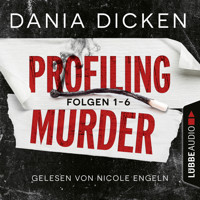4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In der kalifornischen Kleinstadt Waterford hat die Polizei es selten mit schlimmeren Verbrechen als Fahrraddiebstählen zu tun, bis eines Abends die Leichen einer vierköpfigen Familie in ihrem Haus gefunden werden. Ein Unbekannter hat tagelang mit seinen Opfern zusammen gelebt, bevor er sie brutal ermordet hat. Polizistin Sadie erhält zum ersten Mal die Gelegenheit, ihre Ausbildung an der FBI Academy zu nutzen. Mit ihren Kollegen Phil und Matt versucht sie, ein Profil des Familienmörders zu erstellen. Ihn zu finden, ist ihr ein ganz persönliches Anliegen: Vor fünfzehn Jahren wurde auch Sadies Familie getötet — von ihrem eigenen Vater ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Dania Dicken
Die Seele des Bösen
Finstere Erinnerung
Sadie Scott 1
Psychothriller
Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich;
aber jede unglückliche Familie
ist auf ihre besondere Art unglücklich.
Lew Tolstoi, Anna Karenina
Klamath Falls, Oregon: Fünfzehn Jahre zuvor
Inzwischen klang die Stimme ihrer Mutter fast schrill. Tränen brannten in Kims Augen, während sie an die Decke starrte. Er würde Mum wieder schlagen. Das tat er immer. Viel zu oft hatte sie ein blaues Auge oder sogar Flecken am Hals. Würgemale.
Das Licht der Laterne vorn an der Straße leuchtete ins Zimmer. Der Baum vorm Fenster warf Schatten, die sich im Wind bewegten. Manchmal fand Kim das unheimlich, aber im Moment bereitete der Streit ihrer Eltern ihr ernstere Sorgen.
„Bist du wach?“, fragte Kristy leise von der anderen Seite des Zimmers.
„Ja“, erwiderte Kim. „Wie soll man denn da schlafen?“
„Allerdings.“ Kristy schlug die Decke zurück und setzte sich aufrecht.
„Was machst du?“
Ihre Schwester antwortete nicht gleich, weil ein Tobsuchtsanfall ihres Vaters sie beide zusammenzucken ließ.
„Ich will nicht, dass er sie wieder schlägt“, sagte Kristy.
„Willst du da jetzt runtergehen?“, fragte Kim erschrocken. „Was, wenn er dann hochkommt?“
„Er kommt nicht hoch.“ Kristy sagte das, als wäre das eine unumstößliche Tatsache, aber Kim hatte da ihre Zweifel. Dennoch stand Kristy unbeeindruckt auf und schlich auf leisen Sohlen zur Tür. Ein Lichtspalt fiel ins Zimmer, als sie die Tür einen Spalt breit öffnete. Sofort wurde aus dem undeutlichen Gebrüll von unten ein klar verständlicher Streit.
„Du kannst froh sein, dass es nicht dich getroffen hat! Aber mach nur so weiter ...“ donnerte ihr Vater.
„Du bist ja krank!“, schrie ihre Mutter. „Lass mich los!“
Resigniert schloss Kim die Augen. Es war wieder so weit, dass er Mum weh tun würde. Das darauffolgende dumpfe Geräusch und der erstickte Aufschrei bestätigten ihre Befürchtung.
„Das muss aufhören“, murmelte Kristy. Als sie einen Fuß aus dem Zimmer setzte, fuhr Kim hoch.
„Nicht!“, zischte sie. Weil sie die Ältere war, fühlte Kristy sich immer verantwortlich und wollte schlichten. Von Toby konnten sie das auch kaum erwarten, schließlich war er erst sechs. Aber Kristy war schon vierzehn und träumte bereits davon, auszuziehen und allem zu entfliehen. Kim wollte nichts lieber, als ihre Schwester zu begleiten. Doch das würde noch ein Traum bleiben, denn sie waren beide zu jung.
Vermeintlich unerschrocken verschwand Kristy auf dem Flur. Unruhig schlich Kim ihr hinterher. Als sie die Zimmertür wieder öffnete, sah sie ihre Schwester oberhalb der Treppe stehen. Nach einem weiteren Schritt erkannte sie ihre Eltern unten im Flur. Dad hatte Mum rückwärts gegen die Tür gedrückt. Ihre Haare standen wirr ab, ihre Augen waren tränennass. Von ihrem Vater sah Kim nur den Rücken.
Die Schusswaffe hinter seinem Gürtel bemerkte sie erst, als er danach griff, die Waffe entsicherte und sie ihrer Mum vors Gesicht hielt. Er zwang sie dazu, den Mund zu öffnen und schob den Lauf der Waffe hinein. Für einen Moment vergaß Kim zu atmen. Auch Kristy rührte sich nicht.
„Du gehst ganz bestimmt nicht zur Polizei“, sagte ihr Vater bedrohlich leise. Nackte Angst stand in den Augen ihrer Mutter geschrieben. Mit dem Mut der Verzweiflung rannte Kristy die Treppe hinunter.
Dann knallte es.
Kim machte einen Satz zurück, bis sie den Türrahmen im Rücken spürte. Kristy schrie markerschütternd laut und ging fast in die Knie. Über das Treppengeländer hinweg sah Kim weit verspritztes Blut auf der weiß lackierten Haustür, spürte ihr Herz für einen winzigen Moment nicht mehr schlagen.
Kristy wimmerte hysterisch, war auf den untersten Treppenstufen in sich zusammengesackt. Ängstlich machte Kim einen Schritt nach vorn, bis sie ihre Schwester sehen konnte. Sie kauerte vor den Füßen ihres Vaters, der neben der Leiche ihrer Mutter stand und die Waffe auf seine eigene Tochter richtete.
Kim wollte schreien, aber sie konnte nicht. Sie krallte die Finger ins Geländer und schnappte nach Luft.
„Ich hätte euch längst alle umbringen sollen“, sagte ihr Vater. Zitternd hob Kristy den Kopf und sah ihm direkt in die Augen.
„Du bist ein feiges Schwein“, sagte sie, von Schluchzern unterbrochen.
„Feige nennst du mich?“ Mit der rechten Hand holte er aus und schlug Kristy quer übers Gesicht. Er traf sie so heftig, dass sie rücklings gegen die Wand flog und benommen die Treppe hinunterrutschte. Sofort packte ihr Vater sie, warf sie zu Boden und trat ihr in den Magen. Kim zuckte zusammen.
„Du bist genau so ein Miststück wie deine Mutter“, zischte er. „Wird Zeit, dass du stirbst. Aber erst gleich.“
Erneut schlug er Kristy, bevor er sich über sie kniete. Sie strampelte wie wild und schrie, denn inzwischen war sie wieder bei Sinnen.
„Lass mich in Ruhe!“, kreischte sie, aber sie hatte keine Chance. Wie gelähmt beobachtete Kim, was geschah. Schon wieder. Sie hatte es schon einmal gesehen, als ihr Vater geglaubt hatte, allein mit Kristy zu Hause zu sein. Kim war fast in ihr gemeinsames Zimmer geplatzt und hatte etwas gesehen, das sich wie Säure in ihre Erinnerung geätzt hatte. Etwas, von dem Kristy sie beschworen hatte, es niemandem je zu sagen. Unter Tränen hatte sie Kim das Versprechen abgerungen, als sie ihr Höschen im Waschbecken vom Blut gesäubert hatte.
Und Kim hatte es ihr versprochen. Sie wusste nicht mehr, warum. Vielleicht hätten sie dieser Hölle entrinnen können, wenn sie doch etwas gesagt hätte.
Aber jetzt war es zu spät. Kristy schrie und weinte. Reglos starrte Kim auf die Szene, die sich neben ihrer toten Mutter abspielte. Das Blut rann langsam an der Tür entlang nach unten. Es war einfach überall.
Impulsiv drehte sie sich um und rannte zurück in ihr Zimmer, lief zum Wandschrank und öffnete eine Tür. Zitternd und ängstlich setzte sie sich unter Pullover und Hosen und zog leise weinend die Tür hinter sich zu. Sie ertrug diesen Anblick nicht mehr. Sie wusste auch nicht, was sie tun sollte. In der oberen Etage gab es kein Telefon. Handys besaßen sie alle nicht.
Ihr fiel nicht ein, was sie tun konnte, um ihren Vater zu stoppen. Um das zu stoppen. Um dafür zu sorgen, dass er aufhörte.
Ihre Zimmertür stand immer noch einen Spalt weit offen, so dass sie das Weinen und die Schreie ihrer Schwester hören konnte. Schluchzend krallte Kim die Finger ins Haar und wiegte sich hin und her. Sie musste doch etwas tun. Sie musste Kristy helfen. Sie musste nach Toby sehen. Sie musste die Polizei rufen.
Aber sie rührte sich nicht. Sie war nicht wie Kristy. Wie gelähmt saß sie da und versuchte, die Bilder aus ihrem Kopf zu verbannen. Die Bilder davon, wie ihr Vater neben der Leiche ihrer Mutter kniete und ...
Plötzlich knarrte eine der Dielen neben der Treppe. Entsetzt schrak Kim hoch und hielt die Luft an. Das musste Toby sein. Sekundenbruchteile später bestätigte ein Schrei ihren Verdacht.
„Lauf weg, Toby!“, schrie Kristy, bis ihre Stimme brach. Dann knallte es wieder. Kim schrie auf und merkte erst da, dass sie sich die Lippe blutig gebissen hatte. Toby schrie noch immer. Also war nicht er es, den ihr Vater getroffen hatte.
„Du kleiner Scheißer!“, brüllte ihr Vater. Ein weiterer Schuss übertönte Tobys Geschrei und unterbrach es abrupt. Kim fuhr hoch und wagte kaum zu atmen. Auf der Treppe hörte sie Schritte.
„Kim“, sagte ihr Vater mit zuckersüßer Stimme. „Hast du dich versteckt?“
Noch ein Schritt. Am ganzen Körper angespannt kniete Kim im Schrank und überlegte fieberhaft. Er würde sie auch erschießen. Er hatte gerade Mum, Kristy und Toby erschossen, da würde er bei ihr bestimmt nicht aufhören.
Das Garagendach. Es war ihre einzige Chance.
Ohne lange zu überlegen, sprang sie auf und rannte aus dem Zimmer. Ihr Vater hatte nicht damit gerechnet und die Waffe nicht so schnell erhoben, wie Kim über den Flur zum Schlafzimmer ihrer Eltern rannte. Sie betete, dass das Fenster nicht wieder klemmte, drehte die Haken zur Seite und stemmte das Fenster mit der Kraft der Verzweiflung hoch. Ihre geringe Körpergröße kam ihr zugute, als sie sich hastig durch die Fensteröffnung zwängte. Ein weiterer Schuss ertönte und die Scheibe splitterte. Panisch sprang Kim aufs Garagendach, prallte unsanft auf und purzelte über die Schindeln. Nichts bremste ihren Sturz, deshalb fiel sie vom Dach und landete auf dem Bauch. Fast hätte sie sich einen Zahn ausgeschlagen, ein stechender Schmerz zuckte durch ihre Nase. Doch damit hielt sie sich nicht auf, sie kämpfte sich unter Tränen hoch und stolperte weiter. Sie musste weg.
Der nächste Knall schmerzte. Dass es nicht der Knall selbst, sondern die Kugel war, begriff sie nicht gleich. Ein heftiges Stechen machte sich in ihrem Rücken bemerkbar und bremste ihre Schritte. Etwas Heißes lief über ihre Haut. Ihr wurde schwarz vor Augen und sie ging erneut zu Boden.
Sie landete auf der Seite, aber sie schrie nicht. Sie konnte nicht. In Todesangst starrte sie hoch zum Schlafzimmerfenster ihrer Eltern. Da stand ihr Vater noch und beobachtete sie. Kim begriff und blieb reglos liegen, biss sich auf die Zunge, stellte sich tot.
Sekunden später verschwand er. Sie wollte aufstehen, aber sie konnte nicht. Der Schmerz strahlte überallhin aus. Tränen strömten über ihre Wangen, hilfesuchend schaute sie sich um. Bei einigen Nachbarn war noch Licht. Oder wieder? Kim wollte schreien, aber mehr als ein Wimmern brachte sie nicht zustande. Das Blut lief ihr in den Kopf, der schmerzhaft dröhnte, denn sie lag mit dem Kopf nach unten auf der abschüssigen Auffahrt. Ihr Atem schlug Wolken, denn es war kalt. Es roch, als läge Schnee in der Luft. Schnee ...
Im Augenwinkel nahm sie einen Lichtschein wahr. Es war warmes Licht, wirkte nicht bedrohlich, hatte eine Farbe zwischen orange und gelb.
Es wurde heller.
Erst nach einigen Augenblicken begriff Kim, dass es im Wohnzimmer brannte. Flammen schlugen hinter dem Fenster hoch, leckten an den Vorhängen.
Vor ihren Augen tanzten Sternchen. Sie glaubte an Einbildung, als sie Sirenen hörte. Das alles musste Einbildung sein.
Dann fielen ihre Augen zu und sie verlor das Bewusstsein.
Waterford, Kalifornien: heute
„Das nächste Mal blinken Sie besser beim Abbiegen“, sagte Phil mit einem Augenzwinkern zu der jungen Mutter, die mit hochrotem Kopf wieder in ihren Wagen stieg. Sadie warf ihm einen zweifelnden Blick zu, allerdings so, dass nur er es merkte.
„Was denn?“, fragte Phil. „So ein Blinker ist doch keine Sonderausstattung!“
Ohne etwas zu erwidern, stieg Sadie wieder in den Streifenwagen. Phil folgte ihr und warf die Tür hinter sich zu.
„Wer den Schaden hat, braucht wie üblich für den Spott nicht zu sorgen“, murmelte Sadie.
„Wenigstens ist gleich Schichtende, so dass wir uns nicht mit weiteren Blechschäden herumschlagen müssen“, sagte Phil, ohne auf ihre Bemerkung einzugehen.
„Zum Glück.“
Phil startete den Motor, drehte den Wagen und fuhr zurück zum Police Department. Auf der Hauptstraße herrschte reger Feierabendverkehr. Die Sonne stand bereits so tief, dass sie ihnen in die Augen schien. Phil klappte seine Sonnenblende herunter und blickte sehnsüchtig zu Taco Bell hinüber.
„Enchiladas?“ fragte Sadie, der sein Blick wie üblich nicht entgangen war.
„Vielleicht Tacos“, sagte er. „Gleich. Und bei dir?“
„Ich bin bei Fanny und Norman.“
„Oh, ich wünschte, meine Mum würde mich auch noch bekochen!“
Sadie grinste. „Komm doch mit.“
„Ein anderes Mal gern. Soll ich dich dort absetzen?“
„Ist das nicht ein Umweg?“
Phil machte eine Handbewegung. „Ein klitzekleiner.“
„Gern, warum nicht.“
Es war tatsächlich kein großer Umweg. In einer Stadt wie Waterford wäre ein großer Umweg auch schwierig geworden, denn so groß war die Stadt gar nicht. Sie lag im kalifornischen Central Valley inmitten von Weinbergen, eine halbe Autostunde von Modesto entfernt. Außer der High School, dem Police Department und dem Tuolumne River gab es in dieser Stadt nichts, was nennenswert gewesen wäre. Und doch bezeichnete Sadie sie als Heimat.
Minuten später waren sie am Ziel. Phil hielt vor dem Haus und nickte ihr zu. „Schönen Abend noch und bis morgen dann.“
„Ja, bis morgen“, erwiderte Sadie und stieg aus. Langsam fuhr Phil davon. Sadie atmete tief durch und ließ sich die Abendsonne ins Gesicht scheinen, bevor sie zu Fannys und Normans weißgestrichenem Haus ging. Auf der Veranda vor dem Haus standen einige Blumenkübel, die Tante Fanny hingebungsvoll pflegte. Norman schalt sie dafür, dass sie das ohnehin knappe Wasser zum Blumengießen verschwendete, doch sie hörte nicht darauf.
Sadie klopfte an die Tür, öffnete dann Fliegen- und Haustür und betrat das Haus. Sie hatte gerade erst einen Schritt hinein gemacht, als Onkel Norman vor ihr stand.
„In Uniform?“ Dann hob er die Stimme. „Schatz, die Polizei ist hier!“
„Soll in die Küche kommen!“, schmetterte es von dort zurück. Je näher Sadie der Küche kam, desto deutlicher konnte sie den Duft von Maccaroni and Cheese riechen. Ihre Tante drehte ihr den Rücken zu und streute noch ein wenig Käse über die Auflaufform.
„Fanny, du bist die Beste“, sagte Sadie und umarmte ihre Tante von hinten. „Ich muss dich leider aufgrund eines Verstoßes gegen das Delikatessengesetz festnehmen. Du kochst zu lecker.“
„Du hast ja noch gar nicht probiert“, antwortete Fanny unbeeindruckt, wusch sich die Hände und umarmte Sadie dann. „Schön, dass du da bist. Heute in Uniform?“
„Phil hat mich gerade hier abgesetzt.“
„Du hättest ihn mitbringen sollen“, sagte Norman tadelnd. Er war ein hochgewachsener, schlaksiger Mann; so groß, dass er schon seit vielen Jahren unwillkürlich etwas krumm ging. An seine Glatze hatte Sadie sich immer noch nicht gewöhnt.
„Ich habe ihn sogar eingeladen, aber er wollte nicht“, erwiderte Sadie.
„Banause“, ereiferte Norman sich.
„Jetzt hör schon auf, Sadie immer verkuppeln zu wollen!“, mahnte Fanny streng.
„Aber jetzt sieh dir unsere Sadie doch an! Haben die Jungs hier alle Tomaten auf den Augen?“
„Du weißt doch, dass das alles nicht so einfach ist“, murmelte Fanny. „Sadie, setz dich doch. Möchtest du Limonade mit Eis?“
„Oh ja“, erwiderte Sadie und setzte sich an den bereits gedeckten Tisch, der in den Erker hineinragte. Norman folgte ihr mit einem Glaskrug voller Limonade. In der anderen Hand hielt er einen Becher mit Eiswürfeln.
„Ist Phil denn nicht dein Typ?“, bohrte er weiter, während er Eiswürfel in Sadies Glas rutschen ließ.
„Nein, Phil ist nicht mein Typ“, antwortete Sadie gelassen. „Er ist mein Partner. Und, wie du vielleicht vergessen hast, hat er bereits eine Freundin.“
„Und die ist nicht das Mädchen mit den rötesten Haaren in ganz Waterford?“ Verächtlich schüttelte er den Kopf. „Und so schöne Sommersprossen hast du auch.“
„Jetzt hör schon auf“, ermahnte Sadie ihn scherzhaft. „Ein Feuermelder ist nichts gegen mich!“
„Du bist eben etwas Besonderes.“
„Und du bist eine besondere Nervensäge!“ Fanny nahm ebenfalls am Tisch Platz. Norman schenkte auch ihr Limonade und Eiswürfel ein.
„Wie geht es dir denn?“, versuchte Sadie, das Thema zu wechseln und musterte ihren Onkel gespannt.
Er fuhr sich demonstrativ über die Glatze. „Ziemlich luftig da oben. Heute ist ein guter Tag, ich habe Hunger und habe alles drin behalten. Beste Voraussetzungen also für Mac and Cheese!“
„Fannys Maccaroni sind sowieso meine Leibspeise“, sagte Sadie belustigt, wurde dann aber gleich wieder ernst. „Das ist doch gut, Norman. Die Ärzte kriegen dich schon wieder hin.“
„Richtig. Die Heilungschancen sind bei frühzeitiger Erkennung von Hautkrebs ja nicht schlecht. Du weißt, ich bin ein Optimist!“
„Das ist auch richtig so“, stimmte Fanny zu.
„Wie geht es Gary und Sandra?“, erkundigte Sadie sich.
„Bestens. Gary hat vorgestern hier angerufen und angeregt, dass wir demnächst einen gemeinsamen Grillabend machen.“
„Oh ja, das klingt ja hervorragend“, fand Sadie.
„Sandra geht es ebenfalls gut, aber sie ist ja auch erst im siebten Monat. Die beiden freuen sich schon riesig auf das Kind.“
Sadie lächelte. „Ich auch, dann werde ich Tante.“
„Ja, nachdem wir uns da weder bei dir noch bei Joanna Hoffnung machen dürfen ...“ stichelte ihr Onkel.
„Norman, jetzt hör aber auf! Sadie wird es uns schon wissen lassen, wenn sie jemanden gefunden hat“, ermahnte Fanny ihren Mann. Der Duft aus der Küche wurde immer stärker. Sadie spürte, wie ihr Magen laut vernehmlich knurrte. Fannys Mac and Cheese war eine ihrer besseren Kindheitserinnerungen.
Bis zum Essen sprachen sie über Normans Chemotherapie, um das leidige Thema pünktlich abzuschließen. Es hatte wie ein Faustschlag in Sadies Magen gesessen, als sie von seiner Krebserkrankung erfahren hatte. Der Gedanke, dass ihr Onkel, der immer wie ein Vater für sie gewesen war, möglicherweise daran sterben würde, war unerträglich für sie. Das durfte nicht passieren. Das durfte es einfach nicht. Aber lebensfroh, wie er war, trug er die Diagnose mit Fassung und unterzog sich der aufreibenden Behandlung, ohne zu klagen. Ihrer Tante merkte Sadie öfter an, dass das alles sie sehr mitnahm.
Endlich trug Fanny die Nudeln auf und verteilte sie auf den Tellern. Beim bloßen Geruch lief Sadie das Wasser im Munde zusammen. Die cremige Soße war einfach wundervoll und die würzigen Schinkenstückchen ...
Für einen Moment war es totenstill, während sie zusammen die Nudeln genossen. Die Abendsonne leuchtete durchs Erkerfenster herein und tauchte alles in ein goldenes Licht. Sadie mochte den Spätsommer. Sie hatte große Lust, an die Küste zu fahren und auf den Pazifik zu blicken, irgendwo nördlich von San Francisco, wo die Küste besonders beeindruckend war. Und das war sie nicht nur dort.
Als sie auch ihren Nachschlag verputzt hatte, lehnte sie sich zufrieden auf ihrem Stuhl zurück und lächelte. „Danke, Fanny. Das war einfach köstlich!“
Norman nickte zustimmend und aß weiter. Er hatte noch immer etwas auf seinem Teller, während Fanny bereits fertig war.
„Noch ein wenig Eis zum Nachtisch?“, fragte sie.
„Beim nächsten Fitnesstest werde ich grandios versagen“, prophezeite Sadie.
„Nein, das wirst du nicht.“ Seufzend beugte Fanny sich vor. „Warum verteilst du hier Strafzettel für Falschparker? Warum machst du nicht etwas aus deiner Ausbildung?“
„Fanny ...“ Händeringend suchte Sadie nach Worten. „Ich bin zufrieden, wie es gerade ist. Jetzt wo Onkel Norman krank ist, will ich nicht weggehen. Und das müsste ich, um das einsetzen zu können, wovon du sprichst.“
„Ja, aber Waterford? Willst du für immer hierbleiben?“
„Es gefällt mir hier“, behauptete Sadie. „Hier seid ihr. Hier sind meine Freunde. Hier ist alles, was ich kenne! Und weggehen bedeutet nicht San Francisco oder Los Angeles. Das bedeutet Quantico. Virginia. Das will ich nicht. Ich bin noch nicht soweit.“
„Lass das Mädchen in Ruhe“, sagte Norman.
„Ach, das sagt der Richtige“, wehrte Fanny sich. „Kind, wir wollen doch nur dein Bestes. Du musst nicht unseretwegen hierbleiben.“
„Schon gar nicht meinetwegen“, sagte Norman. „Ich bin ein alter Mann! Aber der Krebs kriegt mich nicht klein. Eher besiege ich ihn! Du kannst ruhig gehen, wohin du willst.“
„Ich will aber gar nicht gehen“, beharrte Sadie. Während Fanny abräumte und das Eis auf den Tisch stellte, starrte Sadie auf das Muster in der Tischdecke. Das war alles lieb gemeint von den beiden, aber das stand gerade nicht zur Debatte. Ja, sie hatte Kriminologie und Psychologie studiert. Sie hatte als Zweitbeste des ganzen Jahrgangs abgeschlossen. Sogar ihre Bewerbung beim FBI war von Erfolg gekrönt gewesen und ihr Training in der Academy auch. Und ja, sie verteilte jetzt trotzdem wieder Strafzettel in Waterford.
Sie war noch nicht soweit.
Nachdem sie zwei Kugeln Eis verputzt hatte, blickte sie demonstrativ auf die Uhr. „Ich werde dann mal nach Hause gehen. Die Katzen verhungern sicher schon.“
„Ich fahre dich“, sagte Norman.
„Nicht nötig“, erwiderte sie.
„Ich bestehe darauf.“
Sadie gab sich geschlagen. Dankbar umarmte sie ihre Tante und verabschiedete sich von ihr, bevor sie mit Norman das Haus verließ und sie sich in seinen alten Pickup setzten, der blubbernd ansprang. Zwar hätte sie auch laufen können, aber sie wollte sein Angebot nicht ausschlagen.
„Und du bist wirklich glücklich hier?“, fragte er, während er rückwärts ausparkte.
„Ja, warum denn nicht? Es geht mir gut, wirklich. Macht euch keine Sorgen.“
„Das tun wir aber. Weißt du, Gary hat bald eine richtige kleine Familie und selbst Joanna ... na ja, sie scheint glücklich zu sein mit dem, was sie macht.“
„Ist sie“, sagte Sadie. „Ganz bestimmt sogar.“
„Ja, wahrscheinlich. Aber ... Kind, wir machen uns doch nur Sorgen.“
„Ich weiß, Norman. Aber das müsst ihr wirklich nicht. Ich werde nicht Phil heiraten und ich werde auch nicht immer mit meinen Katzen allein bleiben.“
„Das will ich auch hoffen“, sagte er augenzwinkernd. „Sadie, ich will nur, dass du weißt, dass du immer zu uns kommen kannst. Zu mir.“
Sie seufzte ergeben. „Als könnte ich das je vergessen! Ihr wart immer so gut zu mir. Besser als ... na ja.“
„Ich weiß schon“, sagte Norman. „Aber meiner Schwester mache ich keinen Vorwurf. Sie hatte ja auch keine Ahnung.“
„Lass uns davon aufhören“, bat Sadie hastig. Sie war froh, als sie schließlich in ihre Straße einbogen. Mit einer Umarmung verabschiedete sie sich von ihrem Onkel, bevor sie ausstieg. Inzwischen war die Sonne untergegangen. Nachdenklich blickte sie dem Pick-Up hinterher, bevor sie die Haustür aufschloss und von zwei maunzenden Bestien umgarnt wurde, die ihr mit jedem Ton mitteilten, dass ihr Napf schon viel zu lang leer war.
„Ich weiß ja, ihr beiden“, sagte sie, warf die Haustür hinter sich zu und ging schnurstracks in die Küche, um dort eine Dose Katzenfutter zu öffnen. Das Gemaunze ging weiter, bis der Napf auf dem Boden stand und die Katzen sich darum versammelt hatten.
„Guten Appetit, ihr zwei, ich gehe mal duschen“, sagte sie, hängte den Schlüssel ans Schlüsselbrett und löste ihren Zopf. Schon auf dem Weg ins Schlafzimmer oben zog sie ihre Uniform aus, warf die Kleidungsstücke aufs Bett und schälte sich auf dem Weg zum Bad aus ihrer Unterwäsche. Verschwitzt, wie sie war, wurde es wirklich Zeit für eine Dusche.
Sie zog den Badewannenvorhang zurück, drehte das Wasser auf und legte ihr Handtuch bereit. Bis dahin war das Wasser angenehm warm.
Weil sie nur die kleine Lampe über dem Spiegel eingeschaltet hatte, duschte sie im Dämmerlicht. Als sie sich Shampoo in eine Handfläche träufelte, fiel ihr Blick unwillkürlich auf die Quernarben an ihren Handgelenken. Sie waren schon so alt, dass sie inzwischen kaum noch zu sehen waren. Aber sie verrieten etwas über sie, das sie nicht nur lieber vergessen hätte, sondern von dem sie sich wünschte, dass es nie passiert wäre.
Sadie hielt das Gesicht unter den Wasserstrahl, während sie sich das feuerrote Haar einshampoonierte. Inzwischen hatte sie sich mit ihrer Haarfarbe angefreundet und sie mochte auch ihre Sommersprossen. Die gehörten zu ihr und waren nicht schlimm. Zwar konnte sie Normans Faszination nicht nachvollziehen, aber ihr Onkel war voreingenommen und blind vor väterlicher Liebe.
Sie hatte manches Mal gezweifelt, ob sie diese Liebe verdiente. Sie hatte ihrer Familie so vieles zugemutet und deshalb ein schlechtes Gewissen. Vermutlich verging das nie.
Genüsslich ließ sie das warme Wasser über ihre Haut laufen, als sie sich die Haare ausspülte. Nachdem sie die Spülung einmassiert hatte, seifte sie sich von Kopf bis Fuß mit Duschgel ab. Die kreisrunde Narbe an ihrem Rücken, über die ihre Finger dabei glitten, spürte sie kaum. Sie hatte sich daran gewöhnt.
Mittwoch
Sadie erwachte, als Mittens von ihrem Bett sprang und mit einem dumpfen Aufprall auf dem Boden landete. Auf leisen Pfoten schlich die Katze aus dem Schlafzimmer und verschwand. Figaro hingegen hatte gerade beschlossen, sich noch einmal umzudrehen und zusammenzurollen. Er war ein grauer Tigerkater, der Sadie irgendwann zugelaufen war. Eines Morgens hatte er maunzend vor ihrer Haustür gesessen und um Futter gebettelt. Er war ziemlich abgemagert gewesen und hatte nicht sehr gesund gewirkt, so dass die tierliebe Sadie keinen Augenblick gezögert und ihn hereingeholt hatte. An diesem Tag hatte sie frei gehabt, so dass sie ihn kurzerhand vom Tierarzt hatte durchchecken lassen. Sie hatte ihn gefüttert und ihm einen warmen Platz vorm Kamin angeboten, den er sofort dankbar angenommen hatte und nun sein Zuhause nannte. Wenig später hatte Sadie ihm zur Gesellschaft die schwarze Katze Mittens aus dem Tierheim geholt. Mittens war eine kleine Diva, aber die beiden kamen gut zurecht. Durch ihre Katzenklappe gingen sie ein und aus und bereicherten nun Sadies Leben. Sie hatte damals ohnehin überlegt, sich ein Haustier anzuschaffen, um nicht allein zu sein. Und nun hatten die beiden Katzen im Haus das Sagen, wie Mittens ihr Augenblicke später unmissverständlich miauend aus der Küche zu verstehen gab.
Sadie stöhnte gequält, aber weil sie wusste, dass Mittens nicht aufhören würde, stand sie auf und streckte sich. Mit einem halben Auge beobachtete Figaro sie dabei, wie sie das Schlafzimmer verließ, und folgte ihr Augenblicke später. Wenn es irgendwo etwas zu essen gab, war Figaro auch dort. Im Halbschlaf machte Sadie den beiden ihr Futter fertig und stattete dann dem Bad einen Besuch ab. Als sie sich eine Schale Cornflakes in der Küche machte, waren die Katzen schon längst fertig und hatten es sich nebenan auf dem Sofa gemütlich gemacht.
„Ihr habt ein Leben“, murmelte Sadie und begann, in ihren Cornflakes zu löffeln. Ihre Katzen waren wirklich zu beneiden. So ein Leben hätte Sadie auch gern gehabt. Aber dieses Glück hatte sie nicht. Sie hatte niemanden, der sie fütterte, streichelte und ihr einfach ein Zuhause anbot. Dafür musste sie selbst sorgen.
Während ihres Frühstücks leistete der Radiosprecher ihr Gesellschaft. Ansonsten war es recht still im Haus. Das war es meistens, wenn die Katzen nicht gerade Streit anzettelten. Das geschah aber nur selten. Ohnehin war es ein eher kleines Haus, aber Sadie genügte es. Schließlich war sie allein.
Es rührte sie, dass Norman sich deshalb Sorgen machte, denn immerhin war sie nun schon sechsundzwanzig. Das wäre nicht weiter bemerkenswert gewesen, aber Sadie hatte in ihrem ganzen Leben noch keinen Freund gehabt. Das machte Norman schon eher Sorgen. Dabei war es nicht, dass Sadie abgeneigt war. Aber sie wusste genau, wenn sie jemanden an sich heran ließ, würde er irgendwann Fragen stellen. Das war auch sein gutes Recht. Jeder würde Fragen stellen zu der Narbe auf ihrem Rücken. Jeder würde fragen, warum sie bei Onkel und Tante groß geworden war. Das war ganz natürlich. Aber Sadie wollte dazu nichts sagen. Nie mehr.
Nach dem Frühstück widmete sie sich der Hausarbeit. An diesem Tag hatte sie Spätschicht, deshalb konnte sie bis zur Mittagszeit alles erledigen, was über die letzten Tage liegengeblieben war. Sie machte die Wäsche, räumte ein wenig auf, fuhr zwischendurch zum Einkaufen. Das war auch der hauptsächliche Verwendungszweck ihres alten Toyota, denn sie wohnte so nah am Police Department, dass sie oft zu Fuß zur Arbeit ging.
Bepackt mit Tüten voller Waren aus dem Supermarkt kehrte sie kurz vor Mittag nach Hause zurück und räumte alles weg. Sie hatte ihr kleines Haus in freundlichen hellen Farben eingerichtet, alles war weitläufig und offen. Manchmal war es ihr trotzdem zu groß, aber sie wollte nicht immer allein leben. Gerade erst hatte sie ihrer besten Freundin Tessa angeboten, doch bei ihr einzuziehen. Sie und Tessa und die Katzen – das hätte ihr gefallen.
Das Radio dudelte noch immer, während sie sich schnell etwas zum Mittagessen warm machte. Figaro streunte maunzend um den leeren Napf und verlangte nach Aufmerksamkeit und Nachschub.
„Nein, du verwöhnter Kater“, sagte Sadie gelangweilt, während sie in ihrem Chili rührte. „Du hast noch genug Cracker. Nimm die.“
„Mau“, erwiderte Figaro wenig überzeugt. Schließlich gab Sadie doch nach und öffnete die nächste Dose Katzenfutter, die sie eigentlich hatte geben wollen, bevor sie zur Arbeit ging. Mittens und Figaro versammelten sich schmatzend um den Napf.
Minuten später hatte auch Sadie ihr Mittagessen fertig. Sie beobachtete die Katzen und hörte die Radionachrichten, während sie ihr Chili con Carne verspeiste. Ein FedEx-Transporter hielt gegenüber bei den Nachbarn und lieferte dort etwas ab. Es war ein ganz normaler Tag, ein vollkommen langweiliger Mittwoch.
Nach dem Mittagessen spülte Sadie noch schnell und beobachtete dabei den Postboten, der die Straße entlang ging und die Post verteilte. Schließlich zog Sadie ihre Uniform an, verabschiedete sich von ihren Katzen und verließ das Haus, um sich auf den kurzen Weg zum Police Department zu machen. Die Sonne schien von einem fast wolkenlosen Himmel und es war sehr warm, aber zum Glück wehte ein kühlender Wind.
„Hey, Sadie“, grüßte der Postbote sie, als sie ihn überholte.
„Hallo, Mark“, erwiderte sie mit einem Lächeln. In Waterford kannte man sich.
An gepflegten Vorgärten vorbei ging sie bis zur Hauptstraße, die von kleinen Läden gesäumt war. Von da an hatte sie es nicht mehr weit bis zum Police Department. Sie musste keine Viertelstunde laufen, bis sie dort war.
Vor der Tür traf sie Ted, der seine wohlverdiente Zigarette nach Dienstschluss rauchte. Er grüßte sie mit einer Kopfbewegung und lächelte. „Hi, Sadie.“
„Hi, Ted“, erwiderte sie. „Bei dem Wetter könnte man glatt auf die Idee kommen, sich in den Pool zu legen, nicht?“
„Könnte man, aber ich muss mit dem Wagen in die Werkstatt. Das wird heute nix mit Pool.“
„Dann viel Erfolg“, sagte sie, bevor sie das winzige Gebäude betrat. Nicht jeder blickte auf oder grüßte sie, als sie sich ins Büro begab. Das nahm Sadie jedoch nicht persönlich, denn ihre Kollegen waren in die Arbeit vertieft. In einer Ecke hatte Phil sich an den Schreibtisch gesetzt und las in einer Akte. Sadie ging zu ihm hinüber und blieb vor dem Tisch stehen.
„Hi“, sagte er, ohne den Kopf zu heben. „Wie war es gestern Abend?“
„Sehr nett, und bei dir?“
„Du hattest recht. Enchiladas. Bin mit Jessy hingefahren.“
Sadie lächelte. „Das klingt doch gut. Was steht heute an?“
„Mike hat mit Papierkram gedroht, aber die Drohung konnte ich gerade noch abwenden. Er hat uns für den Streifendienst eingeteilt.“
„Gut“, fand Sadie.
„Da habe ich ja Glück!“, schreckte eine Stimme von hinten die beiden auf, die Sadie nur zu gut kannte. Sie drehte sich um und grinste in Tessas Richtung.
Ihre beste Freundin seit Schulzeiten war ähnlich zierlich wie Sadie, ansonsten jedoch ein vollkommen anderer Typ. Sie trug ihr schwarz gefärbtes Haar sehr kurz geschnitten und hatte es seitlich gekämmt. Eine ihrer Ponysträhnen war blau. In der Augenbraue, der Nase und der Unterlippe war sie gepierct, trug ein enges Tanktop und, dem Wetter völlig unangemessen, ihre üblichen schweren Stiefel.
„Der Nerd ist da“, sagte Phil grinsend.
„Dir auch einen schönen Tag“, erwiderte Tessa ungerührt und legte eine Laptoptasche vor ihm auf den Tisch. „Läuft wieder.“
„Was war denn los?“, fragte Sadie.
„Das Übliche. Jede Menge Malware, Pop Up-Zeug und sowas. Keine Viren, aber eine Menge Schrott, der so einen Rechner schon mal lahmlegen kann.“ Zufrieden verschränkte sie die Arme vor der Brust.
„Danke, dass du ihn wieder flott gemacht hast.“
„Klar. Rechnung an Mike?“, fragte Tessa.
Sadie nickte. „Wie immer. Bei dir alles gut?“
Tessa verdrehte die Augen. „Gestern Abend habe ich noch Zeug von Stacey in meinen Schubladen gefunden. Wenn das noch lange so weitergeht, gibt es bald ein zweites Freudenfeuer.“
Phil lachte. „Du verbrennst die Sachen deiner Ex?“
„Klar, im Grill auf der Terrasse. Was glaubst du denn?“, erwiderte Tessa.
Sadie tauschte einen amüsierten Blick mit Phil. „Keine faulen Kompromisse, oder?“
„Die Kuh hat mit einer anderen rumgemacht! Und zwar, ohne mir was zu sagen. Das geht gar nicht. Sie hätte diese Tiffany ja mitbringen können, aber nein ...“
Während Phil lachte, suchte Sadie den Blick ihrer Freundin. „Im Ernst, zieh doch zu mir. Muss ja nicht für immer sein.“
„Ich weiß das ja total zu schätzen, Sadie, aber ich würde immer wieder jemanden mitbringen. Willst du das?“
„Warum denn nicht? Ich habe gern Leben im Haus. Billiger wäre es für uns außerdem.“
„Ja, mal sehen. Lass mich erst mal Staceys letzte Sachen verbrennen, okay?“
„Klar“, erwiderte Sadie belustigt.
„So, ich muss dann wieder. Wollen wir am Wochenende einen Weiberabend machen? So mit Popcorn und schlechten Filmen?“
„Bin dabei!“ Sadie nickte sofort.
„Sehr gut. Ich ruf dich an! Bis dann.“
Mit schnellen Schritten rauschte Tessa davon und verließ das Polizeigebäude. Fasziniert blickte Phil ihr hinterher.
„Deine Freundin ist lustig“, fand er.
„Tessa ist in Ordnung“, erwiderte Sadie.
„Klar, so meinte ich das nicht. Ich meinte wirklich, dass sie lustig ist.“
„Das stimmt.“
„Sollen wir?“
Sadie nickte und holte ihr Funkgerät aus einer Schublade. Auf ihrem Weg nach draußen verabschiedeten sie sich von den Kollegen und stiegen in einen der Streifenwagen.
Tessa war Sadies Freundin, seit sie denken konnte. Sie hatte in der Schule am Tisch gleich neben Sadie gesessen und die Lehrer mit frechen Kommentaren provoziert. Mit ihrem Bruder war sie bei ihrer Mutter, einer extravaganten Künstlerin, aufgewachsen und immer recht eigen gewesen. In der Pubertät hatte sie eine schwere Zeit durchgemacht, als ihr bewusst geworden war, dass sie sich statt für Männer für Frauen interessierte. Sadie war der erste Mensch gewesen, dem Tessa das anvertraut hatte und es hatte nie zur Diskussion gestanden, dass sie sich von Sadie mehr erhoffte. Das hatte sie nie getan, denn Sadie war einfach nicht ihr Typ.
Genau wie ihr Bruder interessierte Tessa sich sehr für Technik und Computer. Nach ihrem Highschool-Abschluss hatte sie begonnen, in Estebans Computerladen an der Hauptstraße zu arbeiten. Sie hatte ein Händchen für streikende Computer und war gut darin, Viren und andere Probleme aufzuspüren oder defekte Hardware zu reparieren. Nun arbeitete sie schon seit einigen Jahren in dem Laden und plante parallel noch ein Fernstudium in Informatik, weil sie, wie sie sagte, nicht immer für Esteban die streikenden Laptops von Hausfrauen oder Schuljungen reparieren wollte. Sie wäre gern gleich nach der High School ans College gegangen, doch ihre allein erziehende Mutter hatte das nicht finanzieren können und so ging Tessa nun eben einen Umweg. Sadie war froh, dass sie einander auch nicht verloren hatten, als sie begonnen hatte, Kriminologie zu studieren. Im Anschluss hatte sie die Polizeischule besucht und danach begonnen, bei der hiesigen Polizei zu arbeiten. Das Fernziel hatte damals gelautet: FBI Academy, Quantico.
Und tatsächlich hatte die Academy sie im letzten Jahr angenommen. Sie hatte die Ausbildung durchgezogen, aber dann hatte Norman erfahren, dass er Krebs hatte. Sadie hatte vor der Wahl gestanden, sich für mindestens drei Jahre zu verpflichten oder sich doch in der Nähe der Familie aufzuhalten und war deshalb erst einmal nicht beim FBI geblieben – sehr zum Verdruss ihrer Ausbilder.
Virginia war viertausend Kilometer von zu Hause entfernt. Zwar war Einsamkeit nicht neu für sie, aber schon während ihres Studiums hatten Fanny, Norman, Gary und Tessa ihr gefehlt ... das hatte sie nicht auf Dauer gewollt. Schon gar nicht in diesem Moment, da Norman seine Familie um sich brauchte.
Vielleicht irgendwann mal.
„Willst du nicht mal fahren?“, riss Phil sie aus ihren Gedanken.
„Wieso, du machst das doch gut“, sagte sie grinsend.
Er lachte. „Ich meine ja nur. Falls dir langweilig wird.“
„Mir ist nicht langweilig.“
„Kaum zu glauben. Streifendienst in Waterford ...“
Als hätte er ihre Gedanken gelesen. „Ich mag Streifendienst in Waterford.“
„Im Ernst?“ Fragend zog er eine Augenbraue in die Höhe. „Es ist doch total öde hier. Ich würde wegziehen, aber komischerweise gefällt es Jessy hier ja auch.“
„So komisch ist das nicht. Ich bin hier aufgewachsen. Hier sind meine Familie und Freunde.“
„Klar ... aber du warst an der FBI Academy. Wer kommt bitte zurück, um dann in Waterford Blechschäden aufzunehmen?“
„Ich“, sagte Sadie unbeeindruckt. „Das will ich ja nicht für immer machen. Sag ich ja nicht.“
„Schon klar. Ich wundere mich nur immer. Warum wolltest du dann an die Academy?“
Unwillkürlich zog Sadie die Schultern hoch. „Weil ich Verbrecher nicht nur einsperren will. Ich will verstehen, wie sie ticken. Das kann uns ja auch hier zugute kommen.“
„Verstehen, wie sie ticken?“
„Ja, um Täterprofile erstellen zu können. Ist doch gut, wenn das hier jemand kann.“
Phil setzte den Blinker und bog ab. „Das stimmt. Aber in solchen Momenten fällt mir immer auf, wie wenig ich eigentlich über dich weiß. Ich kenne Fanny und Norman und ich weiß, dass du zwei Katzen hast. Das ist alles.“
Sadie lächelte scheu und starrte aus dem Fenster. „Da gibt es auch nicht viel mehr zu wissen.“
„Wo hast du gelebt, bevor ihr hergekommen seid?“
„In Oregon“, sagte Sadie.
„Aber Fanny und Norman haben nicht immer hier gelebt, oder?“
„Nein. Wir sind erst nach zwei Jahren hierher gezogen.“
Phil warf ihr einen mitfühlenden Blick zu. „Tut mir echt leid wegen deiner Familie.“
„Das ist lange her“, murmelte Sadie. „Ich habe nie ganz begriffen, warum ich den Brand als Einzige überlebt habe, aber ich denke auch nicht mehr darüber nach.“
„Schlimme Sache.“ Etwas Besseres fiel Phil nicht ein.
„Willst du Jessy eigentlich heiraten?“, wechselte Sadie schnell das Thema, bevor Phil weitere Fragen stellen konnte.
„Klar, wieso nicht. Bald. Irgendwann.“ Dieses Thema behagte ihm nun überhaupt nicht, deshalb spielte er den Ball zurück. „Und du?“
„Gib mir wen zum Heiraten und ich mach’s“, sagte Sadie lapidar.
Phil grinste, während er langsam am Basketballplatz vorbeifuhr und die Jugendlichen beobachtete. Ab und zu waren sie schon dorthin gerufen worden, weil Jugendliche sich stritten. Auch Prügeleien hatte es schon gegeben, jedoch nur selten. Im Moment war jedoch alles ruhig.
Die beiden fuhren weiter und nahmen einen heruntergekommenen mexikanischen Imbiss unter die Lupe, vor dem öfter Drogendealer gesehen wurden. Tatsächlich hielten sich unter der Markise drei zwielichtig wirkende junge Männer auf, so dass Phil in der Nähe parkte und langsam und entspannt ausstieg.
„To serve and protect!“, rief einer der Jungs ihnen zu. Auch Sadie stieg langsam aus.
„Hey Jungs“, sagte Phil. „Was geht ab bei euch?“
„Bei uns?“, fragte ein anderer. „Nicht viel. Wir chillen ein bisschen und gleich gibt’s was zwischen die Beißer!“
„Kann man hier gut essen?“, erkundigte Phil sich.
„Aber ja, Mann! Die Hütte sieht schäbig aus, aber wir wollen die Bude ja auch nicht mieten!“ Der Halbwüchsige lachte.
„Was würdet ihr empfehlen?“
„Die Guacamole ist der Hammer! Und der Mojito ...“
Sowohl Sadie als auch Phil war schnell klar, dass diese Jungs nichts zu verbergen hatten. Zwar kannten sie es schon, dass natürlich gerade Kriminelle sehr unbefangen mit der Polizei plauderten, um keinen Verdacht zu erregen, aber die drei jungen Männer waren harmlos. Schließlich ging Phil in den Imbiss, um etwas zu trinken zu kaufen. Sadie lehnte sich an die Motorhaube und blinzelte in die Sonne.
„Sie haben total krasse Haare, Lady“, sagte der erste der Jungs. Sadie drehte ihm den Kopf zu.
„Danke“, erwiderte sie.
„Nein, im Ernst. Die sind voll schön, so in der Sonne. Gibt’s nicht oft.“
„Das stimmt. Meine Vorfahren sind Iren, da kommt das wohl her.“
„Cool. Mein Großvater war Schotte, Mann. Aber ich war da noch nie.“
Augenblicke später war Phil zurück und sie fuhren weiter. Die Jungs blickten ihnen noch kurz hinterher, aber dann waren sie auch schon wieder abgebogen und fuhren weiter durch die Straßen der Kleinstadt.
„Wir können ja mal was zusammen unternehmen“, sagte Phil ins Schweigen hinein.
„Gern. Woran hast du gedacht?“
„Weiß nicht, vielleicht einen Ausflug nach Frisco oder Monterey?“
„Oh ja.“ Sadies Augen leuchteten. „Ich liebe San Francisco. So eine wundervolle Stadt.“
„Ja, allerdings. Ich würde gern dort leben.“
„Das hätte was.“
Im Radio dudelte nichtssagende Popmusik. Sie fuhren mit offenen Fenstern und beobachteten das Treiben auf den Straßen, das im Fünfminutentakt zunahm. Kinder kamen aus der Schule, die ersten Pendler kehrten nach Hause zurück. Das zu sehen, wirkte immer sehr beruhigend auf Sadie. Normalität war etwas, das sie liebte. Sie sehnte sich danach.
Als sie an eine Kreuzung fuhren, fiel ihnen in einem Wagen ein Mann im Anzug auf, der etwas auf seinem Handy zu tippen schien. Phil schaltete die Warnbeleuchtung des Streifenwagens ein und fuhr bei Grün zu dem Wagen in der Querstraße hinüber, um davor zu parken. Der Mann ignorierte ihn, bis Phil ausstieg und auf ihn zuging. Dann öffnete der Mann zumindest sein Fenster.
„Sir, Sie dürfen beim Autofahren ihr Handy nicht benutzen“, begann Phil. „Sie dürfen telefonieren, aber keine Nachrichten schreiben.“
„Officer, es ist sehr wichtig“, erwiderte der Mann nach einem kurzen Augenblick.
„Mag sein, aber Sie legen das jetzt bitte weg.“ Phil sagte das ruhig, aber nachdrücklich und tatsächlich tat der Mann, worum Phil ihn gebeten hatte. Schließlich erwiderte er Phils Blick ungerührt.
„Was kann ich für Sie tun, Officer?“
„Sie können jetzt zwanzig Dollar Strafe zahlen.“
„Zwanzig Dollar?“
Phil nickte. „So sieht’s aus.“
Sadie hörte nicht hin, während der Mann eine Diskussion anzetteln wollte. Allerdings ließ Phil sich nicht darauf ein, verteilte seinen Strafzettel und setzte sich schließlich wieder kopfschüttelnd in den Streifenwagen. Der Verkehr floss um sie herum.
„Wichtigtuer“, brummte Sadie.
„Du sagst es. Dass man am Steuer telefonieren darf, finde ich auch nicht richtig.“
„Nein, in der Tat.“
Die beiden fuhren weiter. Eine ereignislose Stunde später hielt Phil an einem Sandwichladen, um sich etwas zu kaufen. Sadie folgte ihm und bevorratete sich mit einem Sandwich, denn sie wusste, irgendwann würde sie auch Hunger bekommen.
Sie übernahm das Fahren, damit Phil in Ruhe essen konnte, und meinte, eine gewisse Zufriedenheit erkennen zu können. Vielleicht war ihm das auch wichtig, weil er schon bei Konfrontationen mit Menschen voraus ging. Darauf legte er allerdings selbst Wert, denn ihnen beiden war klar, dass Menschen auf einen männlichen Polizisten grundsätzlich anders reagierten als auf eine Frau. Für Sadie war das in Ordnung, sie bezog es nicht auf sich, dass Phil manchmal ernster genommen wurde. Wenn sie ehrlich war, legte sie auch keinen Wert darauf, mutig voran zu preschen, wenn es um eine fünfköpfige Straßengang ging. Zwar verfügte sie über die notwendigen Fähigkeiten, um damit fertig zu werden, aber sie machte sich da nichts vor: Sie war verletzlicher.
Und das ließ sie grundsätzlich den Rückzug antreten.
Es begann zu dämmern. Als es dunkel war, hielten sie an einem Café, um eine Pinkelpause einzulegen. Während Phil mit der Kellnerin plauderte, suchte Sadie die Toiletten auf. Als sie zurückkehrte, war Phil gerade verschwunden.
„Hallo, Dorothy“, begrüßte sie die Kellnerin ebenfalls freundlich.
„Ihr seht entspannt aus“, stellte die Angesprochene fest.
„Ja, es ist ein ruhiger Tag.“
„Das ist doch auch schön. Wie geht es dir?“
„Bestens, und selbst?“
„Ich brauche Urlaub“, tat Dorothy kund. „Letzte Woche hatte ich zwei Tage lang Migräne. Schrecklich!“
Sadie stimmte ihr zu. Mittlerweile war sie geübt in Smalltalk. Es war gut, wenn man als Polizist über diese Fähigkeit verfügte – zumindest, wenn man in einer Kleinstadt wie Waterford aktiv war. Die Leute kannten einen, man kannte sie. Und, was noch viel wichtiger war, die Menschen vertrauten einem. Sie riefen die Polizei bei häuslicher Gewalt und bei Fahrraddiebstählen. Sadie nahm alles gleich ernst.
Das Funkgerät an ihrem Gürtel rauschte. „Zentrale an Wagen 36, bitte kommen.“
Sadie griff nach ihrem Funksender und drückte den Sendeknopf. „36 hört.“
„Wir haben einen möglichen 187 am Curran Drive. Die Hausnummer ist 24. Nachbarn haben den Notruf gewählt. Fahrt ihr hin?“
„Sind schon unterwegs“, funkte Sadie zurück und lief an Dorothy vorbei zu den Toiletten. „Phil! Die Zentrale hat uns einen 187 gefunkt!“, rief sie über den Gang. Sekunden später wurde die Tür geöffnet und Phil kam zum Vorschein.
„Einen 187? Sicher?“
Sadie zuckte mit den Schultern. Beim Rausgehen grüßten sie die verdutzte Dorothy, gingen rasch zum Streifenwagen und fuhren los.
Phil warf seiner Partnerin einen irritierten Blick zu. „Ein Mord? Hier?“
„Keine Ahnung“, erwiderte Sadie. Sie konnte es selbst nicht glauben, denn seit sie in Waterford ihren Dienst verrichtete, hatte es dort keinen Mord gegeben.
Vier Minuten später waren sie am Ziel. Es war eine ruhige Seitenstraße in einem Wohngebiet mit sauberen Auffahrten und gepflegten Vorgärten. Sie hielten vor dem Haus mit der Nummer 24. Auf dem gegenüberliegenden Grundstück standen ein Mann, eine Frau und ihr halbwüchsiger Sohn in der Auffahrt. Eine normale Durchschnittsfamilie, die versuchte, den amerikanischen Traum zu leben.
„Officer“, sagte der Mann sofort. „Gut, dass Sie da sind!“
„Haben Sie angerufen?“, fragte Phil.
„Ja, das waren wir. Mein Name ist Mark Newport. Unsere Nachbarn, die Blooms ... unser Sohn wollte vorhin rübergehen, um bei Nick Bloom ein Videospiel abzuholen. Wir hatten die Familie gar nicht mehr gesehen ...“ stammelte der Mann nervös.
„Ich hab geklopft“, sagte der Junge, der etwas gefasster klang. „Aber die Tür war nur angelehnt, deshalb ging sie gleich auf. Ich hab gerufen und bin dann rein. Dachte, das ist okay, weil ich ja manchmal da bin. Alles war dunkel und keiner war da ... aber es roch so komisch. Ich wollte dann oben in Nicks Zimmer nachsehen, ob er da ist, und da habe ich ihn gefunden. Er war tot.“
„Hast du sonst noch jemanden gesehen?“, fragte Sadie.
Der Junge schüttelte den Kopf. „Jedenfalls niemanden, der noch am Leben war ...“
„Wer wohnt alles dort?“, fragte Phil.
„Tom, Marge und die beiden Kinder“, sagte Mr. Newport. „Nick und Amy. Wir haben sofort angerufen, als Dave zurückkam und sagte, er hätte Nick tot gefunden!“
„Wir sehen uns das an“, sagte Phil, während Sadie sich langsam umdrehte und zu dem Haus hinüber starrte. Es lag dunkel da, ein Baum stand gleich davor neben der Auffahrt.
Genau wie damals bei ihr zu Hause.
Wie ferngesteuert ging sie los, hörte gar nicht auf das, was Phil mit der Familie besprach. Vor der Garage der Blooms parkte ein Familienvan. Bevor Sadie die Auffahrt betrat, tastete sie nach ihrer Taschenlampe und der Waffe. Die Haustür stand noch zur Hälfte offen, deshalb genügte ein leichter Tritt. Lampe und Waffe hielt Sadie mit ausgestreckten Armen vor sich und hielt instinktiv die Luft an, um nicht ihren eigenen Atem zu hören.
Sie konnte nicht warten. Es war ihr unmöglich. Obwohl sie es besser wusste, hing sie dem Gedanken nach, dass sie vielleicht noch jemanden finden würde. Lebend.
Doch alles war totenstill. Sadie überlegte, aber dann entschied sie sich, nach einem Lichtschalter zu suchen. Mit rechts hielt sie immer noch die Waffe vor sich, während sie mit der anderen Hand die Taschenlampe festhielt und nach einem Lichtschalter tastete. Neben dem Türrahmen wurde sie fündig, das Licht im Flur flammte auf.
„He, was machst du denn?“, fragte Phil von hinten. „Jetzt warte gefälligst auf mich!“
Sadie erwiderte nichts. Sie ließ die Stille im Haus auf sich wirken, hörte dabei aber das Blut in ihren Ohren rauschen und ihren Herzschlag. Beides erschien ihr ohrenbetäubend laut in der ansonsten herrschenden Geräuschlosigkeit.
In diesem Haus war kein Leben mehr, das spürte sie schon jetzt. Sie wusste, wie sich der Tod anfühlte.
„Sehen wir uns das Erdgeschoss an“, sagte Phil leise. Sadie nickte, ohne ihm wirklich zuzuhören. Sie ging voraus, obwohl inzwischen auch Phil seine Waffe in der Hand hielt. Ihr Herz raste.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte noch jemand das Wohnzimmer benutzt. Vor dem Sofa lagen Verpackungsfolien und Papierchen. Auf dem Couchtisch stand eine leere Pappschale, in der sich noch eine Gabel befand. Quer auf dem Fußboden lag eine Wasserflasche.
Vorsichtig schauten Sadie und Phil sich um, nahmen das benachbarte Arbeitszimmer und die Küche unter die Lupe. Das Arbeitszimmer war sauber, aber die Küche erinnerte an eine Müllhalde. Überall stand schmutziges Geschirr, Besteck und Müll lagen herum, der Mülleimer quoll über. Die benutzte Pfanne stand verkrustet auf dem Herd. Es roch ziemlich übel.
„Gehen wir nach oben“, murmelte Phil. Sadie sagte noch immer kein Wort. Ihr Schock war zu groß. Sie hatte Fotos solcher Tatorte während ihrer Ausbildung gesehen, aber die Realität war anders. Viel schlimmer. In der Luft lag der süßliche Geruch von Verwesung. Nur leicht, aber deutlich wahrnehmbar.
Nacheinander erklommen sie die Treppe nach oben. Das Zimmer des Jungen, Nick, erreichten sie zuerst. Sadie blickte an Phil vorbei, dann stockte ihr der Atem.
Nick saß neben der Heizung und war mit Handschellen daran gekettet. Oder zumindest das, was von ihm übrig war. Unter dem vielen Blut an den Überresten seines Kopfes konnte Sadie sehen, dass man ihn geknebelt hatte. Der scharfe Geruch von Urin lag in der Luft. Nick war mit äußerster Brutalität totgeschlagen worden, ohne Rücksicht auf Verluste.
„Mein Gott“, murmelte Phil. Sadie starrte einfach nur. Sie fühlte sich innerlich taub, während sie automatisch den Rückzug antrat und versuchte, das Bedürfnis zu schreien zu unterdrücken. Immer noch die Waffe in der Hand, ging sie mit schweren Schritten zum nächsten Zimmer hinüber. Was sie dort sah, entlockte ihr unwillkürlich einen Schluchzer. Sie schlug die linke Hand vor den Mund und spürte, wie ihr die Knie weich wurden.
Ein Mädchen, vermutlich Amy, lag nackt auf ihrem Bett, an allen vieren gefesselt. Obwohl ihr kalt vor Entsetzen war, betrat Sadie vorsichtig das Zimmer. Das blonde Mädchen war nicht so brutal erschlagen worden wie ihr Bruder, sondern mit einem Kabel erdrosselt. Ihre blutunterlaufenen Augen starrten gespenstisch an die Decke. An Hand- und Fußgelenken war Blut getrocknet. Auch sie war geknebelt.
Trotzdem hörte Sadie in ihrem Kopf Schreie.
Kristys Schreie.
Eine Träne löste sich aus ihrem Auge und kullerte über ihre Wange. Amy Bloom war auch etwa vierzehn Jahre alt, zumindest war das Sadies Vermutung.
Sie konnte einen leisen Schluchzer nicht unterdrücken. Einen Augenblick später spürte sie Phils Hand auf ihrer Schulter. Eine nette Geste, wie sie fand, aber er wusste ja gar nicht, warum dieser Anblick sie so berührte. Reglos stand sie da und starrte auf die tote Amy. Phil löste sich langsam von dem Anblick und ging weiter. Sadie hingegen konnte sich nicht bewegen. Sie umklammerte die Waffe in ihrer Hand und spürte, wie alles vor ihren Augen verschwamm. Ein vergewaltigtes und ermordetes Mädchen ...
Ein dicker Kloß im Hals schnürte Sadie die Luft ab, ihr war heiß und ihre Haut kribbelte. Zwar war keine akute Gefahr erkennbar, aber das machte keinen Unterschied für sie. Nicht im Haus einer toten Familie.
Aufgewühlt wischte sie die Tränen an ihrer Uniform ab, löste sich aus ihrer Starre und folgte Phil. Er war nicht weit gekommen, sondern stand gerade hinter der Tür des Elternschlafzimmers und rührte sich nicht. Sadie rang immer noch mit sich und versuchte, sich nicht von ihren Gefühlen überwältigen zu lassen, was für einen kurzen Moment ihre gesamte Konzentration erforderte.
Was sich ihr im Elternschlafzimmer offenbarte, ließ ihr das Blut in den Adern gefrieren. Sie sah den Rücken einer nackten Frau, übersät von Blut und Wunden. Schnitte. Das getrocknete Blut hatte alle Farben zwischen rot und fast schwarz. Die Frau war an der Gardinenstange festgebunden, die sich inzwischen unter dem Gewicht der Toten verdächtig durchbog. Mit Blick auf Phil stellte Sadie fest, dass er kreidebleich war. Im Gegensatz zu ihr hatte er so etwas noch nie gesehen.
„Wo ist der Vater?“, brach sie das Schweigen. Phil reagierte nicht gleich, deshalb ging sie an ihm vorüber ins Bad der Eltern. Es war leer. Als sie sich wieder umdrehte, stand Phil immer noch kreidebleich mitten im Raum und starrte auf die Tote.
Sie musste weitermachen. Das war ihre verdammte Aufgabe. Für einen kurzen Moment konzentrierte Sadie sich aufs Atmen und versuchte, den Geruch zu ignorieren, dann wurde sie ruhiger.
„Ich sehe mal im Keller nach“, murmelte sie.
„O ... kay“, stammelte Phil und tastete nach seinem Funkgerät. „Ich rufe alle.“
Sadie erwiderte nichts. Sie fühlte sich taub, während sie nach unten ging und die Tür zum Keller öffnete. Eine dumpfe Ahnung ließ sie glauben, dass sie den Vater dort finden würde. Eine Ahnung – und der Gestank, der von unten herrührte.
Wie durch Watte hörte sie von oben Phils Stimme, während sie nach unten stieg und mit der Taschenlampe in dem finsteren Kellergewölbe herum leuchetete, bevor sie endlich einen Lichtschalter fand.
Als das kalte Neonlicht aufflammte, erkannte sie, woher der Gestank rührte. In einer Ecke lag die Leiche des Vaters, die bereits verweste. Auch von weitem erkannte Sadie Maden und hörte das Summen von Fliegen.
Reflexhaft würgte sie, aber sie schlug die Hand vor den Mund und rannte wieder nach oben, um am Tatort bloß keine Spuren zu hinterlassen.
Glücklicherweise befand sich die Kellertür in der Nähe der noch offenen Haustür, so dass sie das Haus ohne Schwierigkeiten verlassen und in der frischen, warmen Abendluft stehenbleiben konnte. Zitternd steckte sie ihre Waffe weg und konzentrierte sich dann erneut aufs Atmen. Frische Luft. Keine Verwesung. Sie legte den Kopf in den Nacken und blickte empor zu den Sternen.
Eine tote Familie. Sie hatte noch nie einen Mordfall bearbeitet – und dann musste es ausgerechnet eine tote Familie sein.
Sie gab ihren weicher werdenden Knien nach und setzte sich auf die Trittstufen vor der Haustür. Kurz zuvor war ihr noch heiß gewesen, jetzt war ihr eiskalt. Mit zitternden Fingern fuhr sie sich durchs Haar und versuchte, die Vergangenheit nicht hochkommen zu lassen. Nicht jetzt. Nicht bei ihrem ersten großen Fall, in dem sie sich beweisen konnte ...
Doch es half nicht. Heiße Tränen strömten über ihre Wangen, ein heftiges Zittern überlief sie. Angespannt schnappte sie nach Luft und fuhr mit den Händen durch ihr feuerrotes Haar. In ihrem Kopf waren die Schreie ihrer Mutter, ihrer beiden Geschwister. Nur zu gut konnte sie sich vorstellen, was Amy und Nick Bloom ausgestanden hatten. Und ihre Eltern.
Als sie Schritte auf der Treppe im Haus hinter sich hörte, wischte sie sich schnell die Tränen ab, stand auf und atmete tief durch. Sie durfte sich nichts anmerken lassen.
Doch Phil stürzte an ihr vorbei, ohne auf sie zu achten. Er hielt sich am Geländer der Veranda fest und würgte, aber er übergab sich nicht. Keuchend stand er da und versuchte, wieder zu sich zu kommen. Nun war es Sadie, die ihm beruhigend über den Rücken strich.
Ein Tag zuvor
Sie fragte sich, ob sie das überleben würde.
Eigentlich glaubte sie nicht mehr daran, denn er hatte schon bei ihrem Vater und ihrem Bruder kein Erbarmen gezeigt. Wahrscheinlich war es nur eine Frage der Zeit.
Von nebenan konnte sie ihre Mutter schmerzerfüllt stöhnen hören. Zwar wusste sie nicht, was der Mann mit ihr gemacht hatte, aber es konnte nichts Gutes sein. Nicht nach dem zu urteilen, was sie gehört hatte ... die Schläge und das Wimmern. Und das Stöhnen des Mannes.
Sie verstand nicht, warum der Mann das tat. War er einfach nur böse? Jemand, der so etwas tat, musste böse sein. Böse und gestört.
Sie hätte misstrauisch werden müssen, als sie nach Hause gekommen war. Da war es so seltsam still im Haus gewesen. Sonst dröhnte immer Musik aus Nicks Zimmer und Mum telefonierte ganz oft. Aber da war es totenstill gewesen.
Doch noch bevor sie sich hatte fragen können, was passiert war, hatte der Mann hinter ihr gestanden und sie überwältigt. Er hatte sie ins Wohnzimmer gebracht, zu Mum und Nick, und ihr gedroht, dass er beide umbringen würde, wenn sie sich wehrte. Sie hatte es geglaubt, denn Mum und Nick waren an Stühle gefesselt und geknebelt gewesen. So wie sie Minuten später auch.
Im Augenwinkel hatte sie Dads Füße gesehen. Er hatte hinter dem Wandvorsprung gelegen – tot, wie sie schnell erkannt hatte.
Das hatte ihnen allen Angst gemacht. Besonders Mum. Sie hatte ja versucht, sich zu wehren, doch vergebens. Der Mann hatte ihr schnell klar gemacht, was geschehen würde, wenn sie nicht gehorsam war. Entweder hatte er Nick bedroht oder sie. Das hatte Mum einlenken lassen.
Er hatte keinerlei Mühen gescheut, um ihnen allen klar zu machen, dass es ihm ernst war. Er hatte sie einzeln und nacheinander in ihre Zimmer gebracht und dort gefesselt. Ans Bett. Genau so, wie sie jetzt dort lag.
Aber er hatte sich Zeit gelassen. Er verfolgte einen genauen Plan. Jeden Abend hatte er sie zum Abendessen nach unten geholt, nacheinander und sehr vorsichtig. Er hatte sie an den Stühlen festgebunden, um sie unter Kontrolle zu halten. Zum Essen hatte er ihnen jeweils die rechte Hand losgebunden, denn er hatte gesagt, dass er sie nicht einzeln füttern wollte.
Das war ihm wichtig gewesen, jeden Abend. Sie hatten immer zusammen gegessen. Und dann hatte Dad auch nicht mehr hinter dem Mauervorsprung gelegen. Dad war fort.
Mum hatte versucht, Fragen zu stellen. Aber er wollte nicht reden. Für jedes Wort, das ungebeten gesprochen wurde, gab es eine Strafe. Mum hatte schon am ersten Abend erfahren, welche. Amy hatte immer noch ihre Schreie im Ohr. Später hatte er es dann getan, ohne es als Strafe zu meinen. Er hatte nachts im Bett ihrer Eltern geschlafen ... mit Mum. Und Dad war tot.
Mum hatte ihn gefragt, warum er das tat. Daraufhin hatte er sie geschlagen, aber eine Antwort hatte er nicht gegeben.
Er hatte sie alle geschlagen. Das hatte er getan, um sie einzuschüchtern, und Amy hatte Angst vor ihm. Sie konnte gar nicht anders. Den ganzen Tag lag sie in ihrem Bett, hatte Hunger und Durst, und nur abends holte er sie nach unten, um mit ihnen zu essen. Schweigend.
Aber jetzt war schon der dritte Abend in Folge, wo er das nicht mehr tat. Sie bekamen nur noch etwas zu trinken. Doch bis jetzt wusste Amy nie, ob es ein gutes Zeichen war, wenn er die Treppe hochkam, oder ein schlechtes. Denn er kam nicht immer mit Wasser. Manchmal kam er auch aus anderen Gründen.
Beim letzen Abendessen hatte Mum schon nackt am Tisch gesessen. Das hatte Amy nicht überrascht, denn zuvor hatte er auch ihr schon weh getan. Das tat er nicht nur mit Mum.
Inzwischen lag sie seit zwei Tagen nackt auf ihrem Bett und versuchte immer noch, Hunger und Angst zu ignorieren. Sich zu wehren, hatte ja doch keinen Sinn.
Das hatte sie an Nick gesehen. Nach diesem letzten Abendessen hatte er den Mann angegriffen. Er hatte Mum helfen wollen, irgendetwas tun wollen.
Der Mann hatte ihn nicht sofort dafür bestraft. Das hatte er erst am Abend vorher getan. Amy hatte mit angehört, wie er nebenan auf Nick eingeschlagen hatte. Sie hatte die erstickten Schreie ihres Bruders gehört und andere schlimme Geräusche ... und dann war Nick still gewesen. Ganz plötzlich. Sie hatte ihn niemals wieder gehört.
Ihr Bruder war tot. Das hatte der Mann ihr nicht sagen müssen, als er kurz darauf zu ihr gekommen war, um ihr wieder weh zu tun. Sie hatte noch Blutspritzer in seinem Gesicht gesehen.
Jetzt waren es nur noch sie, Mum und er. Sie konnte nicht glauben, dass Dad und Nick tot waren. Sie verstand auch nicht, warum. Warum nur hatte der Mann das getan? Er war in ihr Haus eingedrungen und hatte alles zerstört. Er quälte Mum, er war unglaublich brutal, hatte ein grausames Blitzen in den Augen.
Sie hörte seine Schritte auf der Treppe. Ihre Augen weiteten sich und sie begann, panisch zu atmen. Ihre Atemzüge gingen flach und schnell. Was würde er jetzt tun? Brachte er Wasser?
Als sie ihn vor sich in der Tür stehen sah, gefror ihr das Blut in den Adern. Er starrte sie an, was ein entsetzliches Gefühl war. Schließlich lag sie nackt da.
Jetzt würde er ihr wieder weh tun.
Erst da sah sie, dass er eine Schnur in den Händen hielt. Ängstlich fragte sie sich, was er damit tun würde und begann, erstickt zu wimmern, als er näher kam. Todesangst ergriff sie, als er sich über sie beugte und ihr die Schnur um den Hals legte. Ihre Blicke trafen sich.
Würde er es so beenden?
Sie wusste die Antwort, als er an den Enden der Schnur zog und ihr die Luft abschnürte.
***
Ständig flammten Blitzlichter auf. Sadie hörte immer wieder den Auslöser der Kamera. Inzwischen steckte sie, wie jeder andere Anwesende auch, in einem weißen Ganzkörperanzug, um den Tatort nicht zu verunreinigen. Auf der Straße waren mehrere Autos, unter anderem der Wagen des Coroners, geparkt. Die Spurensicherung war immer noch damit beschäftigt, kleine Nummern im ganzen Haus verteilt aufzustellen. Dort, wo sie schon fertig waren, schoss Polizeifotograf Matt Whitman seine Fotos. Auch er steckte natürlich in einem Anzug, so dass er bei seinen sportlichen Verrenkungen gleich noch komischer aussah.
Aber dafür hatte Sadie gerade keinen Sinn. Innerlich rang sie um Fassung und versuchte, professionell zu wirken. Wie sie an Phil sehen konnte, war das angesichts dieses Tatortes schwierig genug, aber sie musste gerade dagegen ankämpfen, dass die Eindrücke sich mit ihren Erinnerungen vermischten. Es war so nah dran ...
Mit vor der Brust verschränkten Armen lehnte sie am Türrahmen zur Küche und beobachtete Matt bei seiner Arbeit. Er war ein paar Jahre älter als sie, hatte kurzes dunkelblondes Haar, war der sportliche, durchtrainierte Typ. Sadie fand ihn durchaus gutaussehend.
„DNA im Becher“, kommentierte er die leere Lasagne-Pappschale.
„Hoffentlich“, sagte Sadie. „Aber selbst wenn, ich mache mir keine großen Hoffnungen auf einen Treffer.“
„Wer weiß“, sagte Matt. „Ich habe schon die dümmsten Täter erlebt.“
„Der hier war nicht dumm“, erwiderte Sadie. „Alles andere als das. Er hat eine ganze Familie ermordet.“
„Allein?“
Nachdenklich blickte Sadie ins Nichts. „Die DNA-Analyse wird es zeigen.“
„Klar. Aber hast du eine Vermutung?“
Sie überlegte. „Ich glaube, es war nur einer.“
„Wieso?“ Matt kniete sich vor den Couchtisch und machte ein weiteres Foto.