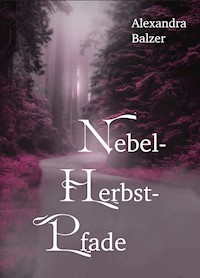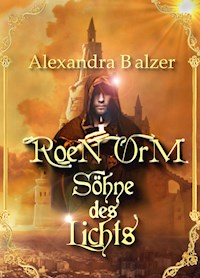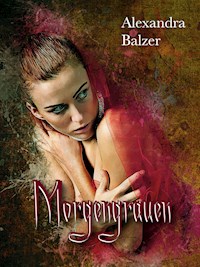2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Der König muss von seinem Thron aus herrschen. Findet die Stadt, die ihm allein geweiht. Erhebet sie aus den Schleiern des Vergessens. Bereitet ihm den Weg zu dem Reich, das seiner würdig ist.“ Weder Rast noch Ruh gönnt Maondny ihren gottgeweihten Kriegern. Sie weiß, wie dringend sie die versunkene Stadt erreichen müssen. Alles hängt nun von Kiomy und Nakoio ab – dem gefallenen Gott und dem verstörten Jungen, der von Geburt an nichts als Zurückweisung und Schmerz kannte … Ca. 46.000 Wörter Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieser Roman ca. 230 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
„Der König
muss von seinem Thron aus herrschen.
Findet die Stadt, die ihm allein geweiht.
Erhebet sie aus den Schleiern des Vergessens.
Bereitet ihm den Weg zu dem Reich, das seiner würdig ist.“
Weder Rast noch Ruh gönnt Maondny ihren gottgeweihten Kriegern. Sie weiß, wie dringend sie die versunkene Stadt erreichen müssen. Alles hängt nun von Kiomy und Nakoio ab – dem gefallenen Gott und dem verstörten Jungen, der von Geburt an nichts als Zurückweisung und Schmerz kannte …
Ca. 46.000 Wörter
Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieser Roman ca. 230 Seiten
von
Alexandra Balzer
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Glossar
Vorwort
Liebe Leser, liebe Leserin,
ich muss mich von Herzen entschuldigen. Ich hatte versprochen, dass dieses Buch bereits Dezember 2016 veröffentlicht werden sollte. Solche Versprechen nehme ich sehr ernst, und auch das „voraussichtlich“, das ich hinzugefügt hatte, macht die Sache für mich nicht erträglicher. Leider hatte ich mich überschätzt. Ich werde in einigen Monaten in ein anderes Bundesland umziehen. Bis dahin muss noch vieles gestemmt und geregelt werden und dieser Spagat zwischen meinem Hauptberuf – dem Schreiben – und privates Allerlei ist mir schlechter gelungen als erhofft. Aus diesem Grund kündige ich die beiden noch verbliebenen Teile der Zorneszeichen etwas bedächtiger an: Teil 6 ist für Frühjahr/Sommer 2017 geplant, Teil 7 für Herbst/Winter. Ich hoffe sehr, dass dieser Plan reibungslos funktionieren wird, bitte noch einmal um Verzeihung und wünsche nun hoffentlich wunderbare Lesestunden mit Maondnys bunter Kampftruppe.
Alexandra Balzer
Kapitel 1
„Woher soll ich euer Schicksal kennen, Sterblicher? Ich bin Shilauty, der Schöpfer Tan‘aaras. Ich weiß, wo sämtliche Reichtümer zu finden sind, ich kenne jeden Weg und Steg, jede Pflanze, jedes Geschöpf. Die Vergangenheit bietet keine Geheimnisse. Die Zukunft, das Schicksal jedoch, davon weiß ich nichts. Das ist niemandem gegeben, nicht einmal dem Weltenschöpfer persönlich.“
Zitat aus „Gespräch mit den Göttern“, Theaterstück, wegen Blasphemie verboten. Datum unbekannt.
eise stand Nakoio auf. Kiomy hatte sich am Fußende des Bettes wie ein Kätzchen zusammengerollt und schlief in seliger Unschuld. Das war sehr erfreulich. Nakoios Gefühle ihm gegenüber waren seiner Beobachtung nach durchaus vergleichbar mit denen von Menschen und Elfen, die sich Haustiere hielten. Zumindest, wenn es reine Luxusgeschöpfe waren, die keinem weiteren Zweck dienten, im Gegensatz zu Schafen, Kühen und Schweinen. Eine Art zärtliche Freude an einem niedlichen, recht hilflosen Geschöpf gehörte dazu. Ein Tierchen, das possierliche Dinge tat und täglich mit Aufmerksamkeit und Nahrung versorgt werden müsste, auch wenn es prinzipiell allein zurechtkommen könnte.
Die liebenswürdige Naivität und Jugend des Kleinen hatte Nakoio mit einer Macht und Geschwindigkeit überwältigt, die für einen einstigen Gott geradezu grotesk anmutete. Bis vor kurzem hatte er nicht einmal gewusst, dass er zu solchen Empfindungen fähig sein könnte, obwohl es leider logisch war – seine Hülle war menschlich und diese entschied über sein emotionales Spektrum.
Sanft strich er über Kiomys widerspenstiges, goldbraunes Haar und zog die Decke noch ein wenig höher. Der Junge war ein Halbelfen-Pashatva-Mischling. Die neigten nicht zum Frieren, noch weniger als er in seiner menschlichen Gestalt. Dennoch konnte Nakoio sich von dieser fürsorglichen Geste nicht abhalten. Es war lächerlich, sogar ein wenig peinlich, aber was sollte er dagegen tun? Er mochte sein Kätzchen eben und wollte, dass es ihm gut ging. Nur aus diesem Grund hatte er sich auch in dieser Nacht mit ihm gemeinsam ins Bett gelegt, obwohl er bereits gestern geschlafen hatte – er wollte, dass Kiomy sich wohl fühlte und ohne Schwierigkeiten einschlafen konnte. Ein Wunsch, der erfüllt worden war.
Er spürte den Traum des Jungen unter seinen Fingerspitzen. Lediglich am äußersten Rand seines Bewusstseins, da er nicht wie sonst gewohnt zur Magie greifen und die Gedanken der Sterblichen lesen konnte. Shilauty, der Göttervater, würde ihn sonst finden. Bei ihrer Wiederbegegnung, die selbstverständlich bloß eine Frage der Zeit war, durfte man getrost davon ausgehen, dass keinerlei zärtliche Gefühle im Spiel sein würden … Darum kämpfte er ebenso tapfer wie sinnlos darum, diese Begegnung noch um einige Jahre aufzuschieben.
Lautlos verließ er den Schlafraum, suchte sich ein Buch aus der gewaltigen Bibliothek, die Illoziz ihm erschaffen hatte, und trat ins Freie. Von außen war seine palastartige Behausung lediglich ein schäbiges Zelt. Ein Wunderwerk der Magie, das der Dämon da vollbracht hatte. Das musste Nakoio ihm zugestehen, obwohl er Illoziz eigentlich nicht leiden mochte. Oder na ja, nicht allzu sehr schätzte. Was auf Gegenseitigkeit beruhte. Es war kompliziert, wie üblich bei den Gefühlen der Sterblichen und fast Sterblichen wie einen dämonischen Halbgott. Aus diesem Grund besaßen sie diese Lästigkeit. Gefühle waren der einzige bedeutsame Unterschied zwischen ihnen und den Göttern. Die tiefen, komplexen, sich vermischenden Empfindungen waren damit gemeint; denn die einfachen, wie Wut, Triumph, Freude waren auch den Allmächtigen gegeben. Macht, ewiges Leben, sofern man nicht getötet wurde, Magie, die Fähigkeit, in anderen Sphären einzudringen und überleben – das waren unwichtige Nebensächlichkeiten, mit denen man keine klare Unterscheidung treffen konnte. Andernfalls wären Illoziz und Maondny ebenfalls Götter. Keine Welt, verdiente Maondny als Gottheit, auch Tan’aara nicht!
Nakoio setzte sich mit dem Buch ins Gras. Auch wenn er im Körper eines Menschen gefangen war, er besaß noch einen Teil seiner einstigen Macht. Darum genügte ihm das Licht des Mondes, um diese Geschichte lesen zu können. Es war eine elfische Sage über die Liebe eines Elfen zu einer Menschenfrau. Die übliche Tragik, in wunderschöne Worte über das Wesen der wahren Liebe gehüllt. Er empfand solche Geschichten nicht bloß als seltsam unterhaltsam, sondern auch als Anleitung, wie er mit den unvertrauten Reaktionen seines Körpers umzugehen hatte. Liebe, Freundschaft, Angst, Trauer, Verlangen – nichts davon hatte in seiner bisherigen Existenz eine Rolle gespielt. Es beruhigte ihn, dass auch die Sterblichen damit zu kämpfen hatten, obwohl sie in diese Gefühlswelten hineingeboren waren. Unglücklicherweise war die Welt selten so wunderschön und Liebe beinahe nie derart rein und unschuldig, wie der längst verstorbene Meister der Worte sie dargestellt hatte. Nicht einmal elfische Liebe besaß solche Tiefe, obwohl dieses Volk unfähig war, etwas zu vergessen und ihre Empfindungen niemals verblassten – was letztendlich zu ihrem Untergang geführt hatte.
Als er das Buch beendet hatte, blickte Nakoio in den Himmel. Es war eine unruhige Angelegenheit, auf den Angriff der Magier zu warten. Warum bloß brauchten die solange, um zu ihnen zu gelangen? So effektiv konnten eine einzelne Magierbestie und ein junger, unerfahrener Greif gar nicht sein, um eine Horde Pashatvas aufzuhalten.
„Unterschätze die beiden nicht“, hörte er Maondnys Stimme in seinem Bewusstsein. „Khun ist einzigartig, sowohl was seine Intelligenz als auch seine anderen Fähigkeiten betrifft. Er ist gewachsen, seit er mit uns durch die Lande zieht. Der Greif war Sayids Seelenbruder und hat von ihm vieles über die Pashatvas gelernt, was er jetzt nutzen kann. Die beiden sind tatsächlich extrem effektiv. Zudem agiert der Anführer dieser Gruppe ausgesprochen vorsichtig. Er weiß, dass er genügend Zeit hat und will nicht riskieren, unnötig Leute zu verlieren. Darum hat er sich verschanzt. Er arbeitet an einem Weg, wie er an diesen Wächtern vorbeischlüpfen kann, um zu Kiomy zu gelangen. Das wird ihm bald gelingen.“
„Sprich, er wirkt einen Blutfluch.“ Nakoio verzog geringschätzig den Mund. Er hatte nichts Grundsätzliches gegen die Idee einzuwenden, die Lebenskraft anderer zu stehlen, um die eigenen Ziele zu erreichen – immerhin war er der Gott der Lügner und Diebe. Doch Blut zu benutzen, das war grässlich schmutzig und entbehrte jegliche Eleganz. Magischer Diebstahl musste für seine Begriffe einfach subtiler geschehen, um Bewunderung zu verdienen. Da waren sogar die Methoden der Leptahs angenehmer!
„Ich vermute, du wirst mir nicht sagen, wann es soweit ist?“, fragte er, solange Maondny noch in Plauderlaune war.
„Das vermutest du richtig. Heute Nacht seid ihr allerdings sicher.“
„Dann will ich nun nach Kiomy sehen. Nicht dass der Kleine wieder einen Albtraum ausbrütet, der ihn am Schlafen hindert.“
„Genau das tut er im Augenblick. Er ist eine geplagte junge Seele … Es ist gut, dass du behutsam zu ihm bist. Davon hatte er zu wenig in seinem bisherigen Leben.“
„Ist es auch gut für mich, Maondny? Sollte ein Gott tatsächlich lernen, etwas zu gewinnen, indem er gibt? Du weißt, ein solches Konzept ist für mich fremdartig bis verstörend.“
„Es ist das Beste, was dir je geschehen ist, mein Freund. Gib noch mehr, gib alles, was du hast. Was du dabei gewinnen kannst, ist nahezu unermesslich.“
Wie stets war es schwierig zu erkennen, ob Maondny ihre Worte ernst meinte, scherzte oder versuchte, ihn für ihre Zwecke zu manipulieren. Sie war nun einmal eine Kriegsherrin, eine Meisterin des Schicksals, und keine Schutzheilige des Friedens. Sie würde ihn ohne Bedauern für ihre Ziele opfern.
Maondny löste sich von ihm, verzichtete dabei auf Abschiedsworte. Nakoio erhob sich. Er sah den Luchs in der Nähe, Kiomys Freund. Das Tier belauerte ihn, fürchtete ihn und die Macht, die er wittern konnte.
„Sei unbesorgt, er ist sicher bei mir“, sagte er laut. Die Pinselohren zuckten in seine Richtung. Der Luchs glaubte ihm nicht. Natürlich nicht. Nakoio konnte niemanden beschützen, nicht einmal sich selbst. Würde er seine Magie nutzen, wäre kein Lebewesen mehr sicher, das sich in seiner Nähe aufhielt. Shilauty würde schlimmstenfalls auch einen halben Kontinent entvölkern, um den abtrünnigen Sohn einzufangen; sollte das Versteckspiel noch länger andauern, könnte es tatsächlich dazu kommen.
Vielleicht habe ich die Vernichtung verdient, wenn ich nicht einmal mehr einen Luchs überzeugend anlügen kann. Schöner Gott der Lügen, pah!, dachte er und kehrte in das Zelt und dort in seinen Schlafraum zurück. Kiomy wälzte sich ruhelos umher, er wimmerte unterdrückt im Schlaf. Nakoio berührte ihn an der Stirn und sprach leise auf ihn ein.
„Schlaf, mein Kleiner. Lass dich von deinen Erinnerungen nicht foltern. Sie sind es nicht wert, so viel Macht über dich einnehmen zu dürfen. Schlaf. Ich bin hier und werde auf dich achtgeben, so gut ich kann.“
Kiomys Atmung beruhigte sich. Er blinzelte kurz, drehte sich dann auf die andere Seite und schlief weiter. Den Rest der Nacht stand Nakoio über ihm vor dem Bett wie eine Wächterstatue, und sah diesem Jungen beim Atmen und Träumen zu. Es war seltsam friedlich, Verantwortung für ein Leben zu übernehmen. Kurios. Wie viel Freiheit darin lag, sich willig an andere zu binden.
Kiomy trat ins Freie. Nakoio hatte ihm ein köstliches Frühstück zubereitet und er hatte sogar noch einmal den magischen Badezuber benutzen dürfen. Im Moment war Nakoio in ein Buch vertieft, darum wollte Kiomy nach dem Luchs Ausschau halten. Das scheue Tier wagte sich nicht heran, solange der gefallene Gott in der Nähe war. Es war merkwürdig, wie freundlich diese Schreckensgestalt sein konnte. Wenn Kiomy nicht gut auf sich aufpasste, würde er noch anfangen, ihm echtes Vertrauen und vielleicht sogar Zuneigung zu schenken. Soweit war er bis jetzt nur bei seiner Pflegemutter gegangen, obwohl die ihn nie wirklich fürsorglich behandelt hatte.
Der Luchs wartete auf ihn. Zwischen den Holzfiguren lag er am Boden, jene Greifgestalten, die explodieren würden, sollten Feinde über den Schutzkreis dringen, den die Königin der Blütenfeen errichtet hatte. Kiomy setzte sich neben dem Luchs ins morgenfeuchte Gras. Das Tier ließ sich nicht gerne berühren, geschweige denn streicheln; darum versuchte er es erst gar nicht. Er konnte ihn gut verstehen, er ließ sich ebenfalls nur ungern berühren.
Erinnerungen drängten bei diesem Gedanken an die Oberfläche. Erinnerungen an die Schläge, die er bei seiner Pflegefamilie und von den Nachbarn erhalten hatte. An die noch viel schlimmeren Prügel, die er bei den Magiern erdulden musste, nachdem sie die Menschen in seinem Dorf abgeschlachtet und ihn verschleppt hatten. An den Missbrauch, den er wochenlang schreckensstarr ertragen hatte, bis es den Magiern der Kampfgruppe, in die er hineingezwungen wurde, zu langweilig geworden war.
„Willst du spielen?“, fragte er den Luchs und blickte sich nach der Lumpenpuppe aus Leder um, die er für seinen Gefährten gebastelt hatte. Die Ohren des Tieres zuckten, es reagierte allerdings nicht wie sonst auf diese Frage. Sein kurzer Stummelschwanz zuckte, er war mit einem Mal deutlich angespannt. Wie gebannt fixierte er einen Punkt in der Ferne, wo Kiomy nichts als brusthohes Gras erkennen konnte. Vielleicht hörte sein Freund dort ein Nagetier rascheln? Nein – bei der Jagd benahm sich der Luchs anders. Es wirkte beinahe, als wäre sein Gefährte verängstigt.
Unruhig stand Kiomy auf. Aus dem Augenwinkel bemerkte er Nakoio, der das Zelt verließ und langsam auf ihn zukam. Die Luft begann in der Entfernung zu flimmern, genau dort, wo der Luchs hinblickte. Knisternder Geruch nach Magie waberte schwer durch die Luft, bevor es aus heiterem Himmel einen Donnerschlag gab und an die hundert Magier aus dem Nichts erschienen.
Kiomy erstarrte. Panik lähmte seine Muskeln, seinen Atem, seinen Verstand. Er zuckte leicht, als Nakoio ihm die Hände auf die Schultern legte.
„Keinen Laut“, raunte er ihm ins Ohr. „Sie können uns nicht wahrnehmen, dennoch, bleib vollkommen still.“
Kiomy wollte nicken, konnte sich jedoch nicht erinnern, wie diese Bewegung funktionierte. Es verwirrte ihn lediglich, wie stark Nakoio war, wie viel Kraft von ihm ausstrahlte, obwohl er schmal war und kaum erwachsen wirkte. Für einen Moment hätte er fast vergessen, dass ein leibhaftiger Gott hinter ihm stand … Der ihn nicht retten konnte.
Die Magier kamen heran. Wie gebannt betrachtete Kiomy diese Männer, das Goldbraun ihrer Haut, Augen und Haare. Die gleichen Farben, die auch er besaß, und trotzdem könnte er ihnen nicht ferner sein. Solch furchterregende Gestalten! Sie waren seinetwegen hier, was kaum zu begreifen und noch weniger zu ertragen war. Er war ein Nichts, ein Niemand …
„Schwärmt aus!“, befahl einer der Männer. „Der Junge muss in der Nähe sein, sonst hätte der Blutfluch uns nicht hierher geführt.“
Ein Blutfluch. Kiomy wollte sich nicht ausmalen, wie viele Leben geopfert werden mussten, um hundert Magier zielgenau durch Raum und Zeit an diese Stelle zu transportieren, wo er zu finden war. Vorbei an Khun und dem Greif, die tagelang gekämpft hatten, um ihn zu beschützen.
„Ein gesamter Koboldstamm ist dafür ausgeblutet“, flüsterte Maondnys Stimme in seinem Kopf. „Vom ältesten Greis bis zum letzten Säugling. Alle ausgelöscht.“
Ein ganzer Stamm. Hunderte Lebewesen. Sie mussten seinetwegen sterben. Kiomy begann zu wimmern. Nakoio legte ihm eine Hand auf den Mund und presste ihn rücklings an sich.
„Keinen Laut!“, zischte er erneut. Das war schwierig, denn in diesem Moment liefen dutzende Magier an ihnen vorbei. Kaum eine Armlänge entfernt, offenkundig ohne zu bemerken, wie der Zauber der Blütenfeen sie zwang, den Schutzkreis zu umgehen. Es war unglaublich beängstigend – die Feinde marschierten an ihnen vorüber, einer nach dem anderen. Kiomy starrte ihnen direkt in die Augen und sie konnten ihn dennoch nicht sehen.
Nakoio hinter ihm kannte anscheinend keine Angst. Er zitterte jedenfalls nicht wie er, sein Atem ging ruhig, sein Herz schlug langsam und gleichmäßig. Kiomy spürte den Puls des Gottes an seinen Schulterblättern.
Der Luchs hatte bis jetzt zu seinen Füßen ausgeharrt und floh nun fauchend. Er konnte nicht wissen, dass er im Schutzkreis sicherer gewesen wäre. Kiomy wollte ihn im Reflex festhalten, was Nakoio mit müheloser Gewalt zu verhindern wusste. Glücklicherweise beachteten die Magier das Tier nicht, ließen es ungehindert passieren. Stillschweigend suchten sie im Gras nach einem Jungen, der es gewagt hatte, ihnen zu entwischen. Nach und nach verschwand die goldene Horde im hohen Gras. Kiomy wusste, dass es kein Grund zum Aufatmen war. Trotzdem ließ Nakoio ihn los.
„Sie werden zurückkommen“, sagte er leise. „Lass uns ins Zelt gehen. Es ist sicherer, wenn wir nicht hier draußen herumlungern.“
Kiomy nickte und folgte ihm gehorsam. Er wollte sich in eine Ecke verkriechen, so klein wie möglich zusammenrollen und sich in sein Innerstes zurückziehen, wo niemand ihn berühren konnte. Magier! Nie würde er sich als Teil dieses Volkes fühlen, nie! Sie bedeuteten Tod, Schmerz, Grausamkeit, sonst nichts …
Sayid war enttäuscht. Er hatte gehofft, dass sie nach der erfolgreichen Initiierung des vierten Zeichens des Zoi’ron wieder für ein bis zwei Wochen auf die einsame Insel gehen durften, wie bislang auch. Die Erholung wäre ebenso willkommen wie notwendig gewesen. Stattdessen hatte Maondny sie lediglich eine Nacht in der Höhle schlafen lassen, die als Weihestätte diente und jetzt befanden sie sich bereits wieder auf dem Marsch. Maondny hüllte sich in Schweigen, wenn man sie nach dem nächsten Etappenziel fragte. Still wie ein Mäuschen ließ sie sich abwechselnd von jedem Mitglied der Gemeinschaft durch die Lande tragen und tauchte bloß gelegentlich aus ihrer goldenen Trance auf, um ihnen kurze Kommandos zu geben.
„Mehr links“ oder „Hier warten wir einige Minuten“, das war alles, was sie in den vergangenen zwei Tagen zu ihnen zu sagen gehabt hatte. Eine versunkene Stadt sollten sie für das fünfte Zeichen finden. Es gab Geschichten von Dörfern, die vom Meer oder einem Sumpf verschlungen worden waren, auch von Städten, die von Erdbeben zerstört oder Lava und Asche eines Vulkanausbruchs verschüttet wurden, hatte er gehört. Sayid glaubte allerdings nicht, dass die Lösung des Rätsels so einfach sein konnte.
„Weißt du von einer Stadt, die nach einer magischen Attacke verschwunden ist?“, fragte er Anthanael. Der hatte schließlich das gesamte Nordernreich gleich mehrfach durchwandert und kannte zahllose Legenden.
„Ich bin nicht sicher“, erwiderte sein Bruder zögerlich. „Ich weiß, dass es Erzählungen von einer Stadt gibt, die in einer anderen Welt liegt und nur an nebligen Tagen mal hier, mal dort erscheint, um Wanderer mit dem Versprechen auf sichere Unterkunft zu locken und die Unglücklichen in dieses andere Reich zu verschleppen. Wer diese Stadt in den Nebeln einmal betreten hat, kann sie niemals wieder verlassen. Aber das ist eine Legende der Menschen und klingt eher nach einer ihrer üblichen Kindergeschichten.“
„Bei uns gibt es eine ähnliche Erzählung“, meldete Hojin sich zu Wort. „Eine Stadt, die ausschließlich über ein verstecktes Tal zu erreichen ist. Man findet sie nicht, wenn man nach ihr sucht, nicht einmal mit Magie. Man stolpert stattdessen in sie hinein, wenn man während eines Gewitters oder bei starkem Nebel umherwandert. Wer sie betritt, bleibt auf ewig ein Gefangener. Auch das dient bloß als Warnung für Kinder, nicht bei schlechtem Wetter herumzulaufen.“
„Weißt du vielleicht mehr, Illoziz?“, fragte Yllanya, die gerade an der Reihe war, Maondny zu tragen.
„Seltsamerweise nein“, erwiderte der Dämon. „Es gibt neben den von euch erwähnten Geschichten noch lustige Legenden bei den Fremdvölkern. Kobolde etwa glauben an Städte, die in unterirdischen Riesenpilzen heranwachsen. Und die Wüstenvölker im fernen Osten berichten von fliegenden Städten in den Wolken, die man über Sonnenstrahlbrücken erreichen kann. Nichts davon ist wahr, auch eure Nebelstädte aus anderen Welten nicht. Eigentlich müsste ich dieses versunkene Reich kennen, aber Maondny weiß ja grundsätzlich mehr als jeder andere, darum ist das in Ordnung.“
„Quält euch nicht“, murmelte Maondny und blinzelte verträumt. „Der versunkenen Stadt nähern wir uns heute noch nicht. Heute werden wir kämpfen müssen.“
„O welch Freude“, brummte Sayid wenig begeistert. „Gegen wen und warum?“
„Gegen Pashatvas, die ein Menschendorf besetzt haben“, erwiderte sie. „Anash weiß, dass wir regelmäßig zur Weihestätte zurückkehren. Darum hat er Siedlungen im weiten Umkreis in Besitz genommen, um Leute vor Ort zu haben. Die Menschen wurden größtenteils nicht getötet, weil man Sklaven braucht, die den Magiern zu Diensten sind und sie ernähren. Was das für die Bevölkerung bedeutet, könnt ihr euch natürlich denken.“
„Das Übliche. Diebstahl, Folter aus Langeweile, Massenvergewaltigungen, Gräueltaten jeder Art, Mord“, knurrte Yllanya angewidert. „Dafür extrem üppige Ernten und besonders fettes Vieh, sowie Hühner, die sich beim Eierlegen geradezu doppelt schlagen. Die Tyrannen wollen schließlich volle Bäuche und können die Menschen nicht gänzlich verhungern lassen, sonst hat man ja keine Sklaven mehr.“
„Exakt. Illoziz, du wirst dich aus den Kämpfen raushalten. Deine Dienste werden anderweitig benötigt. Ihr anderen lauft bitte noch zwei Meilen weiter strikt nach Norden. Dort könnt ihr mich zurücklassen und das Dorf befreien.“
„Soll es bei den Pashatvas Überlebende geben?“, fragte Sayid betont sachlich und tastete nach seinen Kampfmessern.
„Nein. Sie sollen alle sterben.“ Maondnys Augen glühten im goldenen Licht des Schicksalsstroms. Sayid erschauderte. Etwas an ihrem Unterton verriet, dass heute noch mehr geschehen würde, als lediglich einige dutzend Feinde zu töten. Wie viel mehr, blieb abzuwarten.
Kapitel 2
„Wenn du weißt, wo das Herz eines Wesens liegt, kannst du es töten. Unerheblich welcher Rasse es angehört. Magie ist dabei nichts weiter als ein Schild, den es zu beseitigen gilt.“
Zitat aus „Das Komplott“, kriminalistisches Theaterstück von Yubeck Haradstochter; uraufgeführt 297 vor dem Krieg
akoio wühlte in den zahllosen kleinen Truhen herum, die Illoziz in dieser Behausung platziert hatte. Der Dämon hatte den Auftrag gehabt, sie mit jedem erdenklichen Luxus auszustatten. Vieles davon war augenfällig und selbsterklärend – Bad und Küche mit all diesen magischen Gerätschaften, die dabei halfen, jedes menschliche Bedürfnis zu stillen. Bücher, Spielzeug, Zeitvertreib jeglicher Art, Kleidung, Schmuck – es gab nichts, was es nicht gab. Jedes einzelne Stück war individuell sehr liebevoll im Detail gestaltet und von höchster Qualität. Manches musste allerdings erst einmal entdeckt werden und bei einigen Gegenständen erschloss sich der Nutzen nicht sofort. Während einige der Truhen und Kisten rein dekorativ und somit leer waren, befanden sich in vielen die erstaunlichsten Gegenstände. Die Fantasie des Dämons schien keine Grenzen zu kennen, was bewies, dass er seinen halbgöttlichen Status mehr als verdient hatte.
„Was suchst du?“, erklang Kiomys scheue Stimme, als Nakoio ein weiteres Kästchen in das Regal zurückstellte, aus dem er es zuvor gezogen hatte. Nakoio lächelte. Der Junge hatte sich vor Angst zitternd in der hintersten Ecke des Wohnraumes versteckt, nachdem er die Ankunft der Pashatvas verfolgt hatte. Es war gut, dass er sich langsam wieder fing.
„Ich suche ein Hilfsmittel, mit dem ich beobachten kann, was die Feinde außerhalb des Schutzkreises treiben“, erwiderte er und stopfte ein seltsames Metallding zurück in das nächste Kästchen. Es zeigte ihm die Tageszeiten in sämtlichen Zeitzonen dieser Welt an. Nicht uninteressant, im Moment aber überflüssig. „Ich weiß nicht, ob wir so etwas hier haben, auch wenn es Illoziz zuzutrauen ist. Der Dämon ist unglaublich kreativ und findungsreich.“
„Ich könnte einen Golem schnitzen, der ein solches Gerät finden kann“, sagte Kiomy schüchtern.
„Das ist eine großartige Idee, es würde mir Stunden fruchtloser Suche ersparen. Besonders dann, wenn es dieses Gerät nicht geben sollte. Also bitte, tue es für mich.“ Nakoio brachte dem Jungen Holz und Schnitzwerkzeug und setzte sich mit einem Buch neben ihm nieder. Sie hatten gemeinsam herausgefunden, dass Kiomy besser und schneller arbeiten konnte, wenn ihm vorgelesen wurde. Da Nakoio sonst nicht viel ohne seine Magie beitragen konnte, übernahm er diesen Dienst gerne. Kiomy schnitzte, dass die Späne flogen. Eine Aufgabe für den Reinigungsgolem, der sich unverzüglich in Bewegung setzte. Man durfte keine wichtigen Kleinigkeiten am Boden liegen lassen – das steinerne Kerlchen, das exakt wie ein Schadensdämon in Handspannengröße aussah, fraß unersättlich alles bis zum maximalen Durchmesser einer Kupfermünze. Die Überreste wurden anscheinend in Wärme und Luft umgewandelt, man musste nichts entleeren.
Kiomy fertigte einen zeigefingerlangen Golem, der ihm selbst ähnelte. Man musste ihm nicht befehlen, was er zu tun hatte, das erledigte Kiomys seltsame Magie bereits während der Erstellung. Der Junge setzte den Golem auf den Boden. Sofort rannte die magisch belebte Holzfigur los. Sie folgten ihr in den Schlafraum, wo sie gerade der Schwerkraft trotzend die Wand hochlief, bis zu einem Regal, auf dem einige der allgegenwärtigen Kästchen standen. Es gab keine zwei, die sich glichen. Alle waren prächtig, aus unterschiedlichen Hölzern, Gesteinsarten oder Elfenbein gefertigt, mit Edelsteinen, Buntglas oder schönen Schnitzereien verziert. Das Kästchen, auf das der Golem zusteuerte, bestand aus Jade und war wie ein Drache geformt. Drachen waren eindeutig Illoziz‘ Lieblingsgeschöpfe, denn dieses Motiv fand sich auf vielfältigste Weise in der gesamten Behausung.
Nakoio nahm den Golem, der zusammengesunken auf dem Kästchen hockte, und setzte ihn vorsichtig daneben auf das Regal. Diese Figur hatte ihre Lebensaufgabe erfüllt, sie würde sich niemals wieder aus eigener Kraft bewegen. Aus irgendeinem Grund berührte ihn das. Seine Menschlichkeit trieb höchst ärgerliche Blüten! Rasch öffnete Nakoio das Kästchen, in dem sich eine Wasserblüte aus durchsichtigem wie auch milchigem Kristallglas befand. Sie war geschlossen und besaß keinen offensichtlichen Nutzen, abgesehen von ihrer atemberaubend perfekten Schönheit.
„Bist du sicher, dass dein Zauber exakt formuliert war?“, fragte er Kiomy, der prompt den Kopf einzog.
„Ich weiß es nicht, nein.“
„Dann lass es uns ausprobieren.“ Nakoio spürte, dass diese Blüte Magie enthielt, es war wohl nur die Frage, wie man sie erwecken konnte. Er ging in den Wohnraum zurück, legte die Blüte auf dem Esstisch ab und fuhr mit der Hand darüber.
„Offenbare, was unsere Feinde tun!“, befahl er. Nichts geschah.
„Also gut, dann höflicher … O Wunderblume des einzigartigen, fast allmächtigen Illoziz, herausragend unter den Dämonen, ich erbitte demütig zu erfahren, was unsere Feinde treiben.“
Sofort öffneten sich die Kristallblätter, die eine Halbkugel beschützt hatten. Über dieser Kugel lag Nebel, der sich rasch zu lichten begann. Nakoio sah den Anführer der Pashatvagruppe, die nach Kiomy suchte. Der Mann befand sich im nah gelegenen Wald, kniete auf der blanken Erde und zerrte an einem Gegenstand, der im Boden steckte. Die ihn umstehenden Magier riefen aufgeregt etwas, das nicht zu verstehen war.
„O Wunderblume des Illoziz, lass mich hören, was unsere Feinde sprechen“, murmelte er.
„… gefährlich. Der Fluch hat uns fehlgeleitet, Herr.“
„Sei nicht lächerlich“, rief der Anführer. „Der Fluch sollte mir eine Hilfe zeigen, um den Jungen zu finden. Was immer es ist, es wird uns zu ihm führen. So funktioniert Magie, sie ist stets einfach.“
„Oh, ihr Narren, genau darin liegt euer Verderb“, murmelte Nakoio kopfschüttelnd. Magie war dumm, aber niemals einfach. Sie reagierte wortwörtlich auf den Befehl des Zauberers, gleichgültig, welche komplexen Folgen dies für die Welt hatte. Wer diesen Grundsatz nicht begriff, war nicht lebensfähig. Einer der Gründe, warum er sich seinen göttlichen Pflichten einst verweigert hatte – er empfand es als Fehler, ahnungslose Sterbliche mit der Magie spielen zu lassen.
Was ihm gerade noch mehr Sorge bereitete, war allerdings der Gegenstand, den der Pashatva aus der Erde zu holen versuchte.