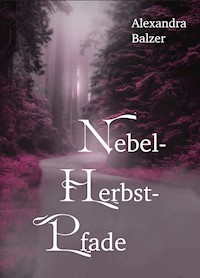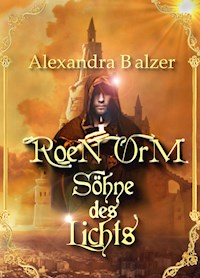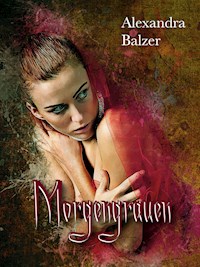6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein Dieb, ein Elf, ein Mischling, eine Bestie und ein Verräter – eine seltsame Truppe ist es, die von der Traumseherin Maondny zusammengebracht wird. Sie sollen die sieben Zeichen des Zorns finden, um die Tyrannei der Magier zu beenden. Doch ein jeder von ihnen hat mit Schuld und Trauer aus der Vergangenheit zu kämpfen und ihre Völker sind zutiefst verfeindet. Wenn das Schicksal sich mit jedem Atemzug aufs Neue wendet und man nicht einmal sich selbst vertrauen kann, wie soll man da seinem Todfeind die Hand reichen? Es gilt Flüche zu brechen, Magie zu finden, mit Göttergesandten zu verhandeln und mit Dämonen zu kämpfen – echten Dämonen und den eigenen tief in der Seele. Nicht weniger als das Wohl der gesamten Welt steht auf dem Spiel – ein Spiel, das Maondny besser beherrscht als die Götter, die sie gerufen haben. Ca. 388.000 Wörter Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte diese Gesamtausgabe von sieben Romanen ca. 1900 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ein Dieb, ein Elf, ein Mischling, eine Bestie und ein Verräter – eine seltsame Truppe ist es, die von der Traumseherin Maondny zusammengebracht wird. Sie sollen die sieben Zeichen des Zorns finden, um die Tyrannei der Magier zu beenden. Doch ein jeder von ihnen hat mit Schuld und Trauer aus der Vergangenheit zu kämpfen und ihre Völker sind zutiefst verfeindet. Wenn das Schicksal sich mit jedem Atemzug aufs Neue wendet und man nicht einmal sich selbst vertrauen kann, wie soll man da seinem Todfeind die Hand reichen?
Es gilt Flüche zu brechen, Magie zu finden, mit Göttergesandten zu verhandeln und mit Dämonen zu kämpfen – echten Dämonen und den eigenen tief in der Seele. Nicht weniger als das Wohl der gesamten Welt steht auf dem Spiel – ein Spiel, das Maondny besser beherrscht als die Götter, die sie gerufen haben.
Ca. 388.000 Wörter
Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte diese Gesamtausgabe von sieben Romanen ca. 1900 Seiten
Ein Dieb, ein Elf, ein Mischling, eine Bestie und ein Verräter – eine seltsame Truppe ist es, die von der Traumseherin Maondny zusammengebracht wird. Sie sollen die sieben Zeichen des Zorns finden, um die Tyrannei der Magier zu beenden. Doch ein jeder von ihnen hat mit Schuld und Trauer aus der Vergangenheit zu kämpfen und ihre Völker sind zutiefst verfeindet. Wenn das Schicksal sich mit jedem Atemzug aufs Neue wendet und man nicht einmal sich selbst vertrauen kann, wie soll man da seinem Todfeind die Hand reichen?
Ca. 57.000 Wörter
Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieser Roman ca. 285 Seiten
von
Alexandra Balzer
Kapitel 1
„Selbstverständlich kann man seinem Schicksal entfliehen. Wer etwas anderes behauptet, hat nichts verstanden. Man muss allerdings mit dem neuen Schicksal fertig werden, das einem unterwegs begegnet; darin liegt das wahre Problem.“
Zitat von P’Maondny, elfische Traumseherin; Datum unbekannt
ayid blieb stehen. Rund zwanzig Schritt unter ihm befand sich die Hauptstraße dieser Stadt, deren Namen er vergessen hatte. Um diese Tageszeit, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, bot sie ein anderes Bild als zur Mittagsstunde. Da hatte sie vor emsig wimmelnden Menschen pulsiert und ihm reichlich Gelegenheit geboten, sich an den Münzbeuteln der Leute zu bedienen. Von irgendetwas musste er sich ernähren, während er sein Dasein in den Schatten fristete. Nun, dieses Dasein fristete er bis auf wenige Unterbrechungen bereits sein gesamtes Leben. Er war es leid, schon viel zu lange. Müde, so müde …
Wenn es wenigstens einen Unterschied machen würde, dann könnte er sich einfach in die Tiefe stürzen. Ein kurzer Schrei, einige Herzschläge grausamer Schmerz. Danach Dunkelheit, Vergessen. Nahezu alle Kreaturen dieser von den Göttern verfluchten Welt hätten damit jegliches Leid und Elend hinter sich gelassen. Der Tod war eine Gnade.
Etwas, was die Sterblichen leider nicht zu schätzen wussten.
Auf Sayid wartete kein ewiger Frieden. Er würde von Neuem erwachen und weder Narben noch gebrochene Knochen würden an Sturz, Tod und Wiedergeburt erinnern.
„Da ist er!“
Der Ruf seines Verfolgers riss ihn aus seiner schwermütigen Tändelei mit Goyash, der Herrin der Jenseitswelt. Stattdessen hastete er einige Schritte zurück, nahm Anlauf und sprang auf das nächste Dach. Verflucht! Er hatte seinen mühsam erkämpften Vorsprung eingebüßt, die Meute war ihm dicht auf den Fersen.
Was genau das halbe Dutzend schwerbewaffneter Krieger von ihm wollte, wusste er nicht. Grundsätzlich könnte er sich ihnen stellen, doch Sayid konnte ihre Fähigkeiten nicht einschätzen. Sollte einer von ihnen ein wirklich begabter Schwertkämpfer sein, oder – was wahrscheinlicher wäre – diese Kerle mit schmutzigen Tricks und Messern aus dem Hinterhalt angreifen – dann könnte er tödlich verletzt werden. Das wäre nicht bloß äußerst unangenehm, es würde sein Geheimnis offenbaren. Zu viele waren da draußen, die sein Mal als das erkennen konnten, was es war. Es würde die Tyrannen auf seine Spur locken. Über ein Jahrhundert war es ihm gelungen, sich vor ihnen zu verstecken. Es gab keinen Grund, ausgerechnet heute Nacht damit aufzuhören. Darum rannte er, so rasch er konnte, sprang von Dach zu Dach, duckte sich in die Schatten, schlug Finten, kehrte für eine Weile auf den Boden zurück, um sein Glück in den engen Gassen der Unterstadt zu versuchen. Unrat, hingestreckte Körper schlafender Bettler, Ratten und halbverhungerte Hunde erschwerten zwar sein Fortkommen, behinderten seine Verfolger jedoch gleichermaßen. Sayid steuerte auf den Kanal zu, der die nahe am Westmeer gelegene Stadt teilte. Das schmutzige Gewässer war die beste Möglichkeit, die Feinde abzuschütteln. Kein Sterblicher konnte ähnlich lange tauchen wie er und die Dunkelheit der lauen Spätfrühlingsnacht würde ihm Schutz bieten.
Unter den Gestank von menschlichem Verfall, Exkrementen, Rauch und Verwesung mischte sich der leichtere Geruch von Wasser, Fisch und nassem Gestein. Nur sehr schwach nahm Sayid die ätzenden Ausdünstungen der Gerbereien wahr, die am südlichen Ende des Kanals in Hafennähe angesiedelt waren. Das war gut, er schwamm ungern in der Brühe, die die Gerber ins Wasser leiteten. Da es im Gassengewirr gerade keine Möglichkeit gab, sich noch weiter nördlich zu halten, kletterte er die nächstgelegene Häuserwand hinauf. Spalten und Risse im Fundament boten sich willig dar, das halb verfallene Gebäude ließ sich leichter besteigen als jede Hafenhure. Die Schritte und Rufe seiner Verfolger, das Klirren ihrer Waffen klangen beunruhigend nah. Warum jagten sie ihm derart beharrlich nach? Warum jagten sie ihm überhaupt nach? Sayid hatte heute keine hochgestellte Persönlichkeit beraubt, das wusste er sicher. Nach rund hundert Jahren konnten Menschen ihn nicht mehr ohne Weiteres zum Narren halten. Armselige Kleidung und Schmutz im Gesicht waren nicht die bedeutsamen Hinweise, zu welchem Stand ein Mann gehörte. Frauen bestahl er aus Prinzip nicht, da diejenigen, die auf offener Straße Geld bei sich trugen, entweder Huren, reich und adlig oder im Auftrag einer reichen und adligen Persönlichkeit unterwegs waren. Zu riskant für jemanden wie ihn, der auf dieser Welt nichts mehr fürchtete als Aufmerksamkeit.
Die wenigen Silber- und Kupferstücke, die er heute entwendet hatte, um sich davon Brot und Fisch kaufen zu können, konnten nicht der Grund für diese entschlossene Hetzjagd sein. Was also dann? Wodurch hatte er sich verraten? Die Kerle hatten ihn aus seinem Versteck im Keller eines verlassenen Hauses aufgescheucht. Bevor er sich durch eines seiner für genau solche Fälle bestimmte Fluchtlöcher gequetscht hatte, war ihm lediglich Zeit für einen kurzen Blick auf Bewaffnung und Kleidung der Feinde geblieben. Diese Männer waren wahrscheinlich Söldner. Kopfgeldjäger. Muskulöse, recht wohlgenährte Bastarde mit Schwertern und guter Lederrüstung. Kein Wappen, das sie als Leibwächter eines der hiesigen Adelshäuser offenbarte, und mindestens einer von ihnen besaß die dunkle Haut eines Südländers aus der Provinz Derkmon. Verflucht, das alles schmeckte ihm gar nicht!
Mit zusammengebissenen Zähnen überwand Sayid die letzte Hürde und zog sich auf das Dach. Ein Pfeil kam aus dem Nichts geschossen – auf dem Nachbargebäude hockte ein Angreifer! Er duckte sich im letzten Moment und flüchtete hinter einen Vorsprung. Seine Verfolger waren keine Narren, sie machten absichtlich solchen Lärm, um ihn in eine bestimmte Richtung abzudrängen. Trotzdem erstaunlich, dass sie ihn ausgerechnet an diesem Gemäuer abgepasst hatten. Er nahm sich einen Moment, um seine Feinde nach Gehör zu orten. Der Bogenschütze war gefährlich gut, er hätte ihn trotz mondloser, wolkenverhangener Finsternis beinahe getroffen. Ein Meister seines Fachs. Schlimmstenfalls ein Halbelf. Die restlichen Feinde waren stehen geblieben und er konnte bloß zwei anhand ihrer Atmung und leiser Bewegungen eindeutig zuordnen. Drei weitere hielten sich in der Nähe auf. Nakoio hilf! Er hatte ein mieses Gefühl bei der Sache …
Und bislang hatte der Schutzheilige der Diebe es nie für notwendig gehalten, auch nur einen Finger für ihn zu rühren.
Sayid beschloss, dass eine überraschende Attacke besser war als zu warten, bis die Feinde ihn erschlugen. Er rollte sich vom Dach, hinab in die finstere Gasse. Unten stieß er wie erwartet auf einen seiner Verfolger. Ein Fausthieb ins Gesicht, ein weiterer Hieb in den Nacken. Ohne zu prüfen, ob sein Gegner außer Gefecht gesetzt war, hetzte Sayid weiter. Zwei Männer mit Fackeln blockierten den Ausgang der Gasse. Innerlich fluchend warf er sich nach rechts durch einen geborstenen Fensterladen, lief durch das dunkle Haus. Schreie der Bewohner folgten ihm, die er ignorierte. Eine Tür – sein Tritt ließ sie aus den Angeln fliegen. Rufe in mindestens drei verschiedenen Sprachen, von denen er lediglich eine beherrschte. Schwere Schritte seiner Verfolger.
Sayid prallte gegen einen muskulösen Körper. Der Lederpanzer verhinderte die meisten effektiven Attacken, darum packte er die rechte Hand des Gegners, brach ihm zwei oder drei Finger, rannte weiter. Hundegebell. Beinahe wäre er über ein Straßenkind gefallen, das am Boden geschlafen hatte und urplötzlich aufsprang. Der Schreck in den weit aufgerissenen, riesigen Augen, beleuchtet von einer feindlichen Fackel, weckte unangenehme Erinnerungen. Keine Zeit dafür!
Er warf sich herum, rannte den Angreifer über den Haufen, der von seiner Aktion zu überrascht war, um reagieren zu können. Dort drüben, zur rechten Hand, entdeckte er einen besonders schmalen Spalt zwischen zwei Häusern. Zu wenig, um Gasse genannt werden zu dürfen. Er würde sich durchquetschen können, da er hoch gewachsen und auf Grund lebenslanger Entbehrungen sehr schlank war. Seine muskelbepackten, mit Ausrüstungen beschwerten Feinde konnten ihm da hinein nicht folgen. Sayid schlüpfte unter den Armen eines Angreifers hindurch, der ihn zu packen versuchte, und eilte seitwärts in den Spalt. Es war riskant, das wusste er. Sollten die Kerle ihn töten wollen, konnte er hier nicht ausweichen und wenn sie am anderen Ende auf ihn lauerten … Mit zusammengebissenen Zähnen gab er alles. Der Stoff seiner gestohlenen Kleidungsstücke riss, er büßte mehr als einen Hautfetzen an Armen, Brust und Schultern ein. Sein nackenlanges schwarzes Haar klebte in schwitzigen Strähnen an seiner Stirn und er war nicht mehr in der Lage, Herzschlag und Atmung zu kontrollieren. Was, in Shilautys heiligem Namen, wollten diese Bastarde bloß von ihm? Es war zu eng, er kam kaum voran. Schneller!
Brennender Schmerz, als sich eine Pfeilspitze tief in seinen rechten Oberarm bohrte. Sayid stöhnte, hielt jedoch nicht inne in seinem Mühen, sich auf den helleren Fleck zuzuschieben. Noch zwei Schritte … Noch einer … Ein zweiter Pfeil, diesmal in den Oberschenkel.
„Ihr feigen Hunde!“, brüllte er wütend. Endlich, endlich war er durch! Er riss sich die Pfeile aus dem Leib, duckte sich in derselben Bewegung unter einem mörderischen Hieb mit einer Keule. Offenkundig war es gleichgültig, ob er lebend oder tot gestellt wurde. Seine Verletzungen behinderten ihn, der zweite Pfeil musste eine große Ader getroffen haben, denn das Blut spritzte mit jedem fiebrigen Herzschlag aus der Wunde. Es kümmerte ihn wenig, abgesehen von dem Ärgernis, dass diese Hose endgültig ruiniert war. Das Loch hätte er flicken können, aber getränkt von einem halben Maß Blut konnte er sie nicht länger tragen. Verflucht! Sie hatte wirklich perfekt gepasst. Es war mühsam, geeignete Kleidung zu stehlen.
Mit einem kaum weniger heimtückischen Schlag gegen den Kopf des Angreifers schaffte er sich den Keulenschwinger vom Hals. Allmählich reichte es ihm! Normalerweise vermied er es, Gegner schwer, geschweige denn tödlich zu verletzen. Es zog einfach zu viel Aufmerksamkeit mit sich. Wenn diese Bastarde es allerdings nicht anders haben wollten …
Sein Manöver hatte ihn in die Nähe des Kanals gebracht. Stur kämpfte Sayid sich den Weg frei, wobei er drei Schwertkämpfer überwinden musste, die sich dankbarerweise gegenseitig behinderten. Da vorne war das Wasser, Shilauty sei dank! Er nahm Anlauf, freute sich darauf, in das kühle Nass einzutauchen – und fand sich plötzlich auf dem Boden wieder, gefangen in einem Netz.
„Wir haben ihn!“, brüllte jemand triumphierend. Sayid trat dem Angeber vors Schienbein, zu mehr war er nicht mehr in der Lage. Einen Moment später explodierte etwas in seinem Schädel, und es wurde dunkel um ihn.
VERFLUCHT!
Kapitel 2
„Elfen sind unsterblich, sofern sie nicht getötet werden, und drei Dinge, abgesehen von ihrem Leben, sind für die Ewigkeit gemacht: Ihre Erinnerung, ihre Liebe und ihr Hass.“
Keszay von Onara, Verfasser von „Elfen der Nordernreiche“ im Jahre 318 vor dem Krieg
nthanel kniete vor der lebensgroßen Statue nieder und legte den Blütenkranz ab. Ein weiteres Jahr war verflossen, ohne seinen Schmerz zu lindern. Ein weiteres Jahr unter der Schreckensherrschaft der Tyrannen. Einhundertneunzehn Winter waren gekommen und gegangen, seit die Magier beschlossen hatten, dieses Land an sich zu reißen. Vom Upakani-Gebirge waren sie gekommen, tausende Vertreter eines mysteriösen Volkes, über das bis heute niemand etwas wusste. Außer, dass sie wie Menschen aussahen, unsterblich wie Elfen waren, mittels Magie Dinge tun konnten, die allenfalls den Göttern zustanden, und nichts und niemand sie aufhalten konnte. Die einzigen, die es eventuell vermocht hätten, waren die Drachenreiter gewesen.
Er hasste die Drachenreiter! Die vollständige Vernichtung dieses Volkes war das einzig Gute, was aus dem Magierkrieg entstanden war. Keiner dieser treulosen Verräter hatte überlebt, denn die Magier, auf deren Seite sie sich geschlagen hatten, kannten ebenfalls keine Treue. Sie hatten die Drachenreiter benutzt, um alle Völker der Nordernreiche von Küste zu Küste zu unterwerfen. Anschließend hatten sie die Reiter wie auch die Drachen mit ihrer Magie ausgerottet. Jahrtausendelang waren die Drachenreiter unüberwindbar gewesen. Keine Verletzung hielt länger als zwölf Stunden vor, und wenn sie eine tödliche Wunde erlitten, starben sie zwar, doch nur, um innerhalb von vierundzwanzig Stunden wieder unversehrt aufzuerstehen. Man musste ihnen die Köpfe abschlagen und diese mitsamt den Körpern verbrennen, um sie tatsächlich zu vernichten. Ihre Kraft war legendär gewesen, genau wie ihre Ausdauer und Waffenkunst und nicht zuletzt die Tatsache, dass ein jeder von ihnen einen Drachen als persönlichen Gefährten besaß. Rund tausend von ihnen hatte es gegeben, sie waren die Hüter und Wächter der Nordernreiche gewesen. Vollkommen unbegreiflich ihr Verrat, als sie sich den Magiern anschlossen …
Er zwang seine Gedanken fort von dieser Erinnerung.
Die Hüter waren fort, die Magier waren geblieben. Sie regierten das Land mit eiserner Faust. Menschen waren ihr Spielzeug, die Sterblichen ihnen hilflos ausgeliefert. Not und Elend herrschten in den einst blühenden Handelsstädten. Hunger war die wirksamste Waffe, um die Menschen zu kontrollieren. Wer zu rebellieren versuchte, wurde mit magischen Flüchen belegt.
Weniger schlimm war die Lage für die Bauern, da die Tyrannen ihre Fähigkeiten nutzten, um die Ernten zu beschleunigen und die Tiere gesund zu halten. Doch auch hier galt: Wer aufbegehrte, fand den Tod, zumeist gemeinsam mit jedem, den er jemals gekannt hatte.
Die Elfen hatten einen wackligen Frieden mit den Magiern erwirkt, nachdem sie einen nahezu unermesslichen Blutzoll bis an den Rand der vollständigen Vernichtung leisten mussten. Er beruhte größtenteils auf „tu mir nichts, ich tu dir nichts“. Zusammen mit jährlichen Zahlungen an die Tyrannen, die zwar keine Garantie dafür waren, dass diese niemals versuchen würden, die letzten Elfen aufzuspüren, doch bislang funktionierte der Handel.
Traurig strich Anthanael über das steinerne Ebenbild einer Elfin, die ihm einst die Welt bedeutet hatte. Zu viele dieser Statuen standen in seinem Haus. Er ertrug es kaum, morgens die Augen aufzuschlagen und gleichgültig, wohin er sich wandte, ihm begegnete Trauer und Erinnerungen an eine Vergangenheit, in der alles Schöne und Gute begraben lag. Wie oft schon hatte er fortgehen wollen! Fliehen vor den Erinnerungen, die niemals verblassten. Er wollte zu gerne einen Tag verbringen, an dem etwas Neues geschah. Etwas Überraschendes, gleichgültig ob gut oder schlecht. Sein Leben verrann ohne Nutzen, mit nichts als Tränen und dem Wunsch, er hätte damals ebenfalls sterben dürfen.
Es galt als untragbare Sünde, wenn sich ein Elf das eigene Leben nahm. Zu viele seines Volkes hatten es bereits getan. Gefangen in Schmerz und vergangenes Leid waren sie unfähig geworden, die Schöpfung zu genießen, zu lachen, zu leben. Es wurden kaum noch Kinder geboren, da man sie nicht dazu verdammen wollte, Teil dieses Leids zu werden, in einer Welt, die von Magiern geknechtet wurde.
„Es ist dein Schicksal, Anthanael“, flüsterte eine zarte Mädchenstimme hinter ihm. Er hatte gehört, wie sie sich ihm näherte, darum fuhr er nicht erschrocken zusammen, sondern drehte sich langsam und beherrscht zu seinem Gast um.
„Maondny, du weißt, dass ich es nicht schätze, wenn du ohne zu klopfen in mein Haus kommst“, tadelte er das Kind. Sie war gerade einmal acht Jahre alt, doch in dem winzigen Körper steckte eine uralte, bereits mehrfach wiedergeborene Seele. Sie war ein Mysterium, eine Traumseherin und die einzige Hoffnung, die ihr Volk überhaupt besaß.
„Ich weiß das. Du weißt dafür, dass ich es nicht schätze, wenn du meinen Namen verstümmelst. Ich heiße P’Maondny. Pe-Ma-Ont-Ni. Nicht einfach Maondny.“
„Wenn du mir vergibst, vergebe ich dir“, sagte er und neigte respektvoll den Kopf. Anthanael versuchte erst gar nicht zu verbergen, dass er sich vor diesem Mädchen fürchtete. Sie sah hübsch aus, hatte taillenlanges schwarzes Haar mit einer einzelnen silbernen Strähne. Ihre Augen erstrahlten blau, wenn sie sich geistig voll und ganz in Tan’aara, dieser Welt befand, und golden, wenn sie sich am Schicksalsfluss aufhielt und das zukünftige wie vergangene Geschick sämtlicher Lebewesen studierte. Maondny wusste alles über jeden, vom Tag seiner Geburt bis zu seinem Tod, einschließlich sämtlicher Gedanken, die jemals gehegt und aller Sätze, die irgendwann gesprochen wurden. Sie wusste genau, welche alternativen Schicksale die Person, die ihr gegenüberstand, haben konnte oder hätte haben können. Einen Becher mit der linken statt der rechten Hand zu ergreifen konnte eine Kette von Auswirkungen nach sich ziehen, die zur Auslöschung eines gesamten Volkes führte. Allein darüber nachzudenken verursachte ihm Kopfschmerzen. Für Maondny war es müßiges Tageswerk.
Anthanael wusste nicht, warum sie seit einigen Wochen immer wieder in sein Haus kam. Meist sprach sie nicht einmal zu ihm, sondern starrte ihn bloß für eine Weile mit ihren goldfarbenen Augen an, bevor sie von ihrer Mutter geholt wurde. Die Kleine brauchte intensive Betreuung, sie neigte dazu, in ihren Visionen verloren zu gehen und dabei essen, trinken, Schlaf und sämtliche reale Gefahren ihrer Umgebung zu vergessen. Es machte ihm Angst, was ihre Anwesenheit bedeuten könnte. Sie sprach zu kaum jemandem, außer um gelegentliche Warnungen vorzubringen; unendliche Variationen von „Wenn du beschließen solltest, diesen Weg zu nehmen, dann warte noch einige Minuten“. Erklärungen gab es nie, manchmal wurde im Nachhinein offensichtlich, dass sie damit das Leben desjenigen gerettet hatte.
„Ich habe den Segen des Weltenschöpfers, im kleinen Rahmen einzugreifen“, flüsterte Maondny, den Blick an die Decke gerichtet, die Finger in ihr weißes Leinenkleid verkrallt. „Das habe ich schon immer getan und er zürnt mir nicht, dass ich damit manchmal für Unordnung sorge. Chaos ist es, was er liebt …“
„Und was liebst du?“, fragte Anthanael impulsiv.
„Ich liebe es, wenn aus Chaos neue Ordnung entsteht, und Ordnung, die in Chaos zerfällt.“ Sie lächelte, ihre Iriden nahmen einen blauen Schimmer an. „Ich mag dein Haus. All diese hübschen Möbel und Statuen, Blumen und Fenster. Es ist eine Gruft, wie alle Häuser hier, aber bei dir spürt man wenigstens noch die Sehnsucht nach Leben. Das ist der Grund, warum ich zu dir komme, Anthanael. Während die anderen in unserem Dorf längst innerlich tot sind, begraben unter ihrer Trauer, besitzt du noch Hass, Zorn und Hoffnung auf Zeiten, in denen es Gutes geben könnte.“
„Die Seele deiner Mutter ist nicht tot“, erwiderte er, bemüht nicht zu zeigen, wie verstörend er ihre Worte empfand. „Sie liebt dich, sorgt sich um dich und würde alles für dich tun.“
„Sie ist tot. Ich bin es, die sie mit Träumen am Leben erhält, damit ich selbst nicht zugrunde gehe.“
Er wandte sich ab von ihr, konnte es kaum ertragen, welch schreckliche Dinge sie gänzlich emotionslos sagte.
„Siehst du, diese Fähigkeit, noch irgendetwas als schrecklich wahrzunehmen, genau das meine ich. Aber genug davon. Ich bin nicht hier, um dich zu quälen.“
„Warum dann?“, fragte er bitter und drehte sich zurück zu ihr.
„Ich wurde von den Göttern nach Tan’aara geholt, damit ich das Gleichgewicht zwischen den Kräften beeinflusse. Die Magier haben es gestört, es war weder ihr Recht noch der richtige Zeitpunkt, um die Macht an sich zu reißen. Die Herrschaft der Drachenreiter hätte erst in mehreren hundert Jahren enden dürfen und das Volk der Elfen noch lange blühen und gedeihen müssen. Es ist meine Aufgabe, dem Schicksal einen neuen Takt aufzuzwingen, damit die Schöpfung wieder in Harmonie schwingen darf. Viel ist es nicht, was ich tun kann. Einer der notwendigen Schritte besteht darin, dich auf den Weg zu schicken.“
„Wohin?“, fragte er erschrocken und wich vor ihr zurück. Sein Haus verlassen? All die Erinnerungen, die ihn fesselten abschütteln? Wenn es leicht wäre, hätte er es längst getan!
„Nicht weit. Du kennst das Wäldchen, zwei Meilen nordöstlich von uns.“
Anthanael nickte matt. In dieses Wäldchen ging er gelegentlich, um Heilkräuter zu sammeln. Auch in Trauer erstarrt erfüllte ein jeder in diesem Dorf seine Pflichten für die Gemeinschaft. Sie waren mehr als lebendige Statuen. Nicht viel mehr, aber immerhin …
„Folge dem Pfad, der aus diesem Wäldchen hinausführt. Du wirst deinem Schicksal begegnen, wenn du es tust, sofern du innerhalb der nächsten halben Stunde aufbrichst.“
„Und wenn ich es nicht tue?“, fragte er schwer atmend.
Maondnys Augen loderten golden auf, wie flammende Sonnen. „Dann besteht deine wahrscheinlichste Zukunft darin, zu Füßen von Ellianars Statue auszubluten, weil du in fünf bis zehn Jahren nicht mehr die Kraft hast, dich gegen die Verlockung des Todes zu stemmen.“
„Selbstmord also? Nichts Besseres als das? Es gibt sicherlich andere Männer oder Frauen, die du für deinen Tanz mit dem Schicksal auswählen könntest. Wenn die Tyrannen gestürzt sind …“
„… würde das nichts für dich ändern, Anthanael.“ Sie lächelte traurig und ergriff seine Hand. „Es gibt viele dort draußen, die deine Aufgabe übernehmen könnten. Genug, die sich glücklich und geehrt fühlen und mit Begeisterung die Waffen an sich reißen würden. Helden, die nicht von der Last der Erinnerungen zermalmt werden. Männer wie Frauen, die es verdient hätten, diesen Weg zu wagen, der sowohl zu unsterblichem Ruhm als auch einem frühzeitigen, grausigen Tod führen kann. Ich will, dass du es bist, Anthanael. Ich will dich retten, denn du bist der Letzte in diesem Dorf, für den ich Hoffnung sehe. Ob du siegst oder nicht, wird für die Welt einen riesigen Unterschied machen. Für unser Volk gar keinen. Sie sind längst verloren. Du bist mit mir der letzte lebendige Elf des Nordernreiches.“
Er begann zu zittern, musste sich für einen Moment Halt suchend an diesem Kind festklammern, das keines war.
„Wie konnte das geschehen, Maondny? Warum?“
„Weil ein Volk zu viel Macht erlangt hat und diese weder weise nutzen noch Rücksicht auf die Schwachen üben will. Das ist der Lauf der Welt. Nun entscheide dich, Anthanael. Geh und begegne einem neuen Schicksal. Ich kann nicht weit vorausschauen, wie es sich entwickeln wird, es gibt zu viele Möglichkeiten, die danach entstehen werden. Doch es wäre das, was du dir seit viel zu langer Zeit vergeblich gewünscht hast: Etwas zu tun, was du noch niemals getan hast, abseits dieser Gruft und der ausgetretenen Wege. Oder bereite deinem Elend ein Ende und stirb. Wenn du wünschst, könnte ich dich töten, dann wäre es kein direkter Selbstmord.“
„Ich gehe“, rief Anthanael entsetzt. Solange der Weg ihn möglichst weit fort von diesem Kind führte, musste es ein guter Weg sein!
„Meinst du, das war die beste Wahl, die du treffen konntest?“
P’Maondny löste den Blick nicht vom Schicksalsstrom. Im Laufe ihrer Existenz hatte sie jegliche Angst vor diesem Geschöpf verloren, das sie gerade aufsuchte, auch wenn es im gesamten Universum keines von größerer Macht gab. Es war eine Eule, klein und ein wenig zerzaust, die sich auf ihrer Schulter niederließ. In dieser Gestalt schickte der Weltenschöpfer seine Gedanken aus. Warum genau es ein solcher Vogel sein musste, der zwar ein furchterregender Jäger der Nacht, aber keineswegs herausragend klug oder stark war, wusste nur er selbst.
„Es war nicht die beste Wahl“, erwiderte P’Maondny langsam. „Es gibt genug, die besser geeignet wären. Die Wahrscheinlichkeit, dass er helfen kann, das Gleichgewicht wieder herzustellen, ist sehr gering, doch zumindest vorhanden. Vorausgesetzt, er begeht nicht den größtmöglichen Fehler … Was leider sehr, sehr wahrscheinlich ist. Dennoch, ich mag ihn.“
„Wenn du versagst, oder vielmehr deine favorisierten Helden, stehen dir viele Jahre Leid auf dieser Welt bevor, um alles zu richten“, sagte die Eule und kicherte leise.
„Ich kann mir Schlechteres vorstellen. Diese Welt ist jung, sie hat großes Potential, einen Haufen streitsüchtiger Götter und starke magische Strömungen. Hier mit dem Schicksal zu spielen ist amüsant.“
„Ah, kleine Maondny, du bist und bleibst mein Liebling. Du benimmst dich genauso schlecht wie ich es tue.“
„Mein Name ist P’Maondny“, erwiderte sie steif. Die Eule kicherte lediglich albern und flatterte davon. Seit Jahrtausenden weigerte sie sich, diesen einfachen Namen richtig auszusprechen. Warum P’Maondny diesen dummen Scherz nicht längst müde war? Sie wusste es nicht, und das allein gefiel ihr gut genug, um ihn aufrecht zu erhalten.
Kapitel 3
„Keine noch so tiefe Wunde kann eine Narbe hinterlassen. Verlieren sie ein Auge, wächst ein neues, verlieren sie eine Hand, kehrt sie binnen weniger Stunden zurück. Unnatürliche Geschöpfe scheinen sie zu sein, diese Drachenreiter, deren wahrer Name niemand außer ihnen kennt. Sie sehen wie gewöhnliche Sterbliche aus und nur wer empfindsam dafür ist, spürt eine Aura von großer Macht an ihnen. Lediglich ein einziges Mal unterscheidet sie und macht sie leicht erkennbar für jeden: Etwa daumengroß und schwarz, auf der Brust direkt über dem Herzen gelegen, prangt bei Männern wie Frauen etwas, das wie eine Drachentatze geformt ist. Weder Klingen noch Feuer noch irgendetwas sonst kann dieses Mal entfernen, auch wenn die Drachenreiter es sicherlich oft genug versucht haben.“
„Von den Drachenreitern: Wächter des Nordernreiches“. Verfasser und Datum unbekannt.
ayid schlug die Augen auf. Er lag in Ketten, das war das erste, was er bewusst wahrnahm. Man hatte ihm sein Hemd gestohlen, das war seine zweite Erkenntnis. Es musste seit seiner Gefangennahme genügend Zeit vergangen sein, denn er hatte keinerlei Schmerzen. Also war die Kopfverletzung vermutlich tödlich gewesen, andernfalls würde er jetzt noch etwas von der Pfeilwunde spüren. Modriger Gestank und flackerndes Licht gaben ihm den Hinweis, dass er sich in irgendwelchen Katakomben befinden musste. Das alles sprach dagegen, dass er von Handlangern der Tyrannen gejagt und entführt worden war – die Magier hätten ihn nicht in Eisenketten gelegt, da an diesem Material magische Flüche schlecht haften blieben. Außerdem würde er jetzt über einem Pferderücken hängen, um so rasch wie möglich in die Hauptstadt gebracht zu werden.
Wer also waren diese Kerle, die ihn durch die Nacht gehetzt hatten?
Sayid wusste lediglich, dass er allein in diesem Raum lag – diesem Kerkerloch mit vergittertem Fenster und eisenbeschlagener Tür, wie er nach einem prüfenden Rundblick feststellen musste. Er überlegte, ob er nach seinen Entführern rufen sollte. Andererseits war es im Moment schön ruhig hier. Nur er, die eine oder andere Ratte, und das feuchte Stroh, das als seine Bettstatt diente. Warum sollte er es eilig damit haben, seine Folterknechte herbeizuholen? Leiden würde er noch früh genug und herausfinden, warum sie ihn haben wollten auch. Wenn er es recht überdachte, gab es nicht viele Möglichkeiten. Diese Leute hatten ihn gnadenlos gehetzt, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben – oder seines. Da er persönliche Rache ausschloss und man einen Mann seines Alters nicht mehr für die Bordelle jagte, auch wenn er eher wie Mitte zwanzig als über hundert aussah … Nein, offenkundig hatten sie genau gewusst, wer und was er war.
Als Sayid sich weiter gründlich umschaute, fiel ihm auf, was mit diesem Raum nicht stimmte. Er kannte Kerkerzellen, hatte in seiner Jugend einige Male Freunde aus dem Gefängnis befreit. Selbst im Loch zu landen, hatte er bis zum heutigen Tag vermeiden können. Genauso, wie er es heutzutage vermied, sich Freunde aufzuhalsen. Irgendwann wurden eben Fragen gestellt, die nicht beantwortet werden konnten und die Lüge, dass er Elfenblut in sich trug und deshalb nicht alterte, hatte auch nie ewig vorgehalten. Darum bevorzugte er nun die vollständige Einsamkeit. An manchen Tagen gefiel sie ihm sogar.
Nun: Jedes Gefängnis sah anders aus, doch es gab grundlegende Gemeinsamkeiten. Den Gestank nach Exkrementen, alten Schweiß und Schimmel zum Beispiel. Dieser Raum roch einfach bloß feucht. An den Wänden waren keine Kratzspuren von Insassen, die versucht hatten die Tage zu zählen oder Nachrichten zu hinterlassen. Demnach befand er sich in irgendeinem Kellergewölbe, nichts weiter. Sayid entspannte sich, so gut das mit angeketteten Hand- und Fußgelenken möglich war. Sich Sorgen machen würde er, wenn er mehr über seine Gegner wusste.
Nach einer Weile hörte er Stimmen in der Ferne. Eine Frau sagte:
„Warum zweifelst du noch? Das Mal ist echt. Keine Tätowierung, kein Brandzeichen. Er wurde damit geboren. Glaub mir, ich folge ihm bereits lange genug und ich weiß, was ich tue. Er ist es, den wir suchen.“
„Ich meine ja nur …“
„Geh und schau ihn dir an! Du hast gesehen, dass er tot war. Wenn er nun wieder lebendig sein sollte, gibt es keine andere Erklärung, oder? Selbst Elfen kehren nicht mehr zurück, sobald ihr Herz einmal das Schlagen aufgegeben hat.“
Die Stimmen näherten sich. Sayid hatte sehr viel schärfere Sinne als ein normaler Mensch, doch es genügte nicht, um durch die eisenbeschlagene Tür hindurch die Anzahl der Leute zu bestimmen, die sich davor aufhielten.
Ein Riegel wurde geöffnet, Schlüssel klapperten im Schloss. Man hatte sich Mühe gegeben, ihn gut wegzusperren, alle Achtung.
„Wie erwartet: Er ist gesund, munter und vollkommen unversehrt. Lediglich ein bisschen blutverschmiert.“ Eine junge Frau in braunem Lederharnisch und grüner Tuchhose schob sich in das Halbdunkel des Kerkers. Das dunkle Haar trug sie zu einem strengen Zopf nach hinten geflochten. Sehr schlank, beinahe zerbrechlich wirkte sie, war ungewöhnlich groß für einen Menschen. Die stählerne Härte in ihren schwarzen Augen zeigte, dass der Eindruck von Zerbrechlichkeit trog, genau wie der geringschätzige Zug um ihre Mundwinkel. Trotz ihrer perfekt gerundeten Ohren und dem sonstigen menschlichen Äußeren wusste Sayid, dass sie ein Elfenmischling sein musste. Schon allein, weil sie als einzige von der Gruppe, die sich um ihn scharte, einen Bogen trug und damit die Schützin sein musste, die ihn trotz der Dunkelheit beinahe erwischt hatte.
„Ein bisschen blutverschmiert ist untertrieben“, sagte er und lächelte möglichst charmant. Das würde sie vielleicht wütend machen und zu einem Fehler hinreißen, der ihm nützlich werden konnte. Oder schmerzhaft enden. „Ich sehe aus, als hättest du mir ein Schwein auf den Bauch gebunden und abgeschlachtet. Ich vermute doch richtig, dass du es warst, die mir den Schädel eingeschlagen hat?“
„So ist es, Drachenreiter“, erwiderte sie eisig. „Ich habe deine hübsche Hülle auch mit Pfeilen gespickt. Du hast meine Leute verletzt.“
„Vergib mir, meine Schöne. Deine Leute waren leider ein wenig aufdringlich.“
Sie ging neben ihm in die Hocke, strich mit einer Fingerkuppe über das Drachenmal. Ihr schmales Gesicht zeigte vollkommene Beherrschung. Sie ließ sich nicht leicht provozieren und würde ihm nicht freiwillig Gelegenheit bieten, ihren Schwachpunkt herauszufinden.
„Ich suche dich bereits seit dreißig Jahren. Und spar dir die Kommentare über mein Aussehen. Ja, ich sehe aus wie Anfang zwanzig, bin aber bereits knapp zweihundert Jahre alt. Und ja, ich habe Elfenblut in mir. Meine elfische Großmutter hatte eine fruchtbare Beziehung zu einem Menschen. Meine Mutter ebenfalls. Ich bin also zu einem Viertel Elfin. Das macht mich unsterblich. Keine weiteren Vorteile oder Fähigkeiten.“
„Dann überschätzt du die Nachtsicht eines gewöhnlichen Menschen, meine Liebe“, erwiderte Sayid. An der Art, wie sich ihre Augen verengten erkannte er, dass er keinen Zugang zu dieser Frau bekam, solange er nicht in ihr Spiel einstieg.
Bevor er etwas sagen konnte, meldete sich einer der schwer bewaffneten, finster dreinstarrenden Männer an ihrer Seite zu Wort.
„Yllanya, bist du dir wirklich sicher, was diesen Kerl angeht? Ich meine, er ist nicht schlecht, hat gut gekämpft, ist schnell und alles, aber schau ihn dir an! Diese zerrupfte, dreckige, hagere Gestalt hat nichts mit den Bildern und Statuen der Drachenreiter zu tun, die man noch finden kann. Und was er auf der Straße geboten hatte, sah nicht nach der legendären Kraft und Ausdauer aus, die ich mir vorgestellt habe.“
„Er ist eine Straßenratte, was erwartest du?“, erwiderte Yllanya gelassen. „Seit einhundertneunzehn Jahren versteckt er sich vor den Magiern und deren Häschern, die genau wissen, dass er noch lebt. Aus dem einfachen Grund, weil man seine Leiche nirgends gefunden hat. Ich bin ihm drei Jahrzehnte gefolgt, jedem windigen Gerücht nachgegangen und ihm dabei einige Male nahe gekommen.“ Sie wandte sich ihm wieder direkt zu. „Vielleicht erinnerst du dich an das Feuer vor zwei Jahren, in dem Haus, in dem du untergekrochen warst? Das hatte ich gelegt, um dich zu töten und anschließend deiner Leiche habhaft zu werden.“
Sayid zog verblüfft die Augenbrauen hoch – das war ziemlich radikal. Das Feuer hatte sieben Menschenleben gefordert, er selbst war mit schwersten Verbrennungen davongekommen. „Ein gewitzter Dieb ist er, sein größtes Talent besteht im Überleben und Fliehen. Er hat sich in den Gassen sämtlicher Städte des Reiches in die Schatten gekauert, von Abfällen ernährt. Niemand hat ihm beigebracht, wie ein Krieger zu kämpfen, niemand hat sich je um ihn gekümmert. Und auch er kümmert sich um nichts und niemanden als sich selbst. Und das Wichtigste: Er hat keinen Drachen zum Gefährten, von dem er die Hälfte seiner Kraft beziehen würde. Ist es nicht so, Drachenreiter?“
„Mein Name ist Sayid und mir ist nie eine geflügelte, feuerspeiende Riesenechse begegnet, die sich mit meiner Seele verbinden wollte, Shilauty sei Dank“, entgegnete er würdevoll. „Höre ich richtig heraus, dass ich gerade die Aufnahmeprüfung verfehlt habe?“ Nicht, dass er zu irgendeiner Gruppe dazugehören wollte.
„Du hast mit Glanz und Glorie bestanden, Sayid. Schon allein, weil du der einzige Anwärter bist und wir dich brauchen.“
„Ah, das ist der Punkt, an dem wir zum Geschäftlichen kommen? Hervorragend. Ich liege zwar gerne angekettet und halbnackt zu Füßen einer atemberaubend schönen Frau, aber mir sind entschieden zu viele Zuschauer dabei.“
Yllanya zwinkerte ihm zu, statt pikiert aufzustehen und sich von ihm zu entfernen. Ein gutes Zeichen, wenigstens war sie nicht gänzlich humorlos und verbittert, wie so viele andere Elfenmischlinge, die ihm bislang begegnet waren.
„Erzähl mir, meine Schöne, warum hast du mich dreißig Jahre lang gejagt? Und dabei das Leben jedes armen Tropfes riskiert, der das Unglück hatte, sich in meiner Nähe aufzuhalten?“
„Es gibt unter den Elfen eine Prophezeiung“, begann sie. Sayid verdrehte stöhnend die Augen.
„Himmlische Gnade, es gibt immer irgendwelche Prophezeiungen unter den Elfen! Genau wie Legenden, Visionen, Gedichte und traurige Lieder!“
„Das ist ihre Aufgabe in dieser Welt“, fauchte Yllanya. „Und du weißt genau, dass alle elfischen Prophezeiungen wahr werden können!“
„Wenn man sich sklavisch an jeden Punkt hält, der Wind niemals von Norden weht und keine Sonnenfinsternis in den Weg kommt, ja, dann schon! Aber auch nur, wenn man den richtigen magischen Spruch zur rechten Zeit am rechten Ort zu zitieren weiß und man niemals an Shilautys heiligen Tag Fisch verspeist hat. Oh, und was soll ich sagen? Der war vergangene Woche und ich hatte eine halbe, fast frische Makrele.“
Sayid zwang sich, tief durchzuatmen, statt weiteren Unsinn zu plappern. Er hasste elfische Prophezeiungen. Zu viele Menschen, die er geliebt hatte, waren auf Grund irgendwelcher Prophezeiungen und Legenden gestorben, seine Eltern an erster Stelle. Die meisten, weil sie geglaubt hatten, sie könnten die Vorherrschaft der Magier brechen.
In Yllanyas Blick flackerte etwas. Mitleid? Verständnis? Nichts davon wollte er haben, darum kämpfte er, bis er seine Maske zurückerobert hatte. Mit gelassenem „Was kümmert mich die Welt?“-Lächeln blickte er zu ihr auf. Mit etwas Glück stand sie auf Kerle mit blauen Augen und schwarzen Haaren und ließ sich davon blenden; manche Frauen liebten ja den Kontrast.
„Erzähl mir von deiner Prophezeiung, Schätzchen. Welche Rolle spiele ich darin?“, fragte er.
„Die Hauptrolle, Schätzchen. Was sonst? Du bist der Letzte deiner Art. Es heißt, dass es einen Drachenreiter braucht, um die sieben Zeichen des Zorns zu initiieren.“
„Das ist dein großer Plan, ja?“ Erneut musste er tief durchatmen, um nicht wieder die Selbstbeherrschung zu verlieren. Die sieben Zeichen des Zorns … Welch ein Wahnsinn!
„Der personifizierte Zorn ist als einziger in der Lage, die Tyrannen zu vernichten.“
„Ja, mitsamt sämtlicher magischen Kreaturen und Lebewesen dieser Welt. Ein hoher Preis!“ Es war eine der seltsameren Legenden der Elfen, dass Shilauty, der Schöpfergott ihrer Welt, seinen Kindern die Magie geschenkt hatte. Die Fähigkeit, über die Elemente zu herrschen, die Welt und das Schicksal nach ihrem Willen zu beugen und verändern. Sollte sich dabei je ein Volk über die anderen erheben und mittels ihrer Kraft versklaven und knechten, so gab es einen Wächter. Der leibhaftige Zorn, der mit Hilfe von sieben Zeichen erweckt werden konnte. Wenn das geschah, würde er sämtliche Magie von Tan’aaras Antlitz wischen und die Macht aller unsterblich Geborenen brechen.
„Was sollte an dem Preis zu hoch sein?“, fragte Yllanya bitter. „Die Elfen sind bereits ausgerottet, auch wenn noch einige hundert von ihnen lebendig durch die Wälder streifen und Trauerlieder auf ihren Harfen komponieren. Die Drachen sind fort, du bist der letzte der Reiter. Das einzige magische Volk, das Bestand hat, sind die Tyrannen, die uns ausbluten lassen.“
„Yllanya, selbst angenommen, ich könnte diese wahnwitzige Prophezeiung erfüllen und es irgendwie schaffen, die sieben Zeichen zu initiieren – mit welchem Recht darf ich das Todesurteil über jeden fällen, der Elfenblut in sich trägt? Es betrifft ja nicht bloß die reinblütigen Spitzohren, sondern auch sämtliche Mischlinge. Deren Anzahl mag in die zehntausende gehen! Du bist eine davon.“
„Exakt. Ich bin eine davon.“ Sie erhob sich mit der leichten Anmut, die kein Mensch jemals meistern könnte, und begann, in dem engen Kerker auf und ab zu laufen. „Ich bin älter als du, Sayid. Du kannst dich nicht an die Zeit vor dem Magierkrieg erinnern, ich hingegen schon. Meine Mutter hatte mich bei den Elfen abgeliefert, kaum dass sie nach der Geburt aufgehört hatte zu bluten. Ich bin unter ihnen aufgewachsen und weiß, was für ein starkes, großartiges Volk es einst war. Wie viel Macht es besaß, wie eng es mit den Drachenreitern verbündet war. Die Elfen herrschten über Erde und Wasser und nutzten ihre Magie, um Tan’aara erblühen zu lassen. Ihr Wille lag über jeglichen Dingen und durchströmte die Schöpfung und die Menschen waren ihre Schäfchen, die sie treu und voller Liebe hüteten. Die Drachenreiter hingegen herrschten über die Elemente Feuer und Wind und verteidigten alles Leben mit ihrem Blut. Ich sage nicht, dass damals grundsätzlich alles besser gewesen ist. Oder frei von Sorgen, Hass, Neid, Gier, Intrigen, Verrat, Mord. Meine Mutter hat sich einen Dreck um mich geschert und mich bei einem Volk zurückgelassen, das nie aufhörte, mich wie einen hilflosen Säugling zu behandeln. Aber es gab eben Schönheit, Frieden, Wachstum, Gutes und Liebe, Ehre und Freundschaft. Bis die Magier kamen und das vernichtet haben.“
Sie stürzte sich auf ihn, griff in sein Haar und riss ihn daran hoch.
„Ich habe Menschen, Reiter, Drachen und Elfen zu tausenden sterben sehen. Und miterlebt, was danach mit Tan’aara geschah. Du erinnerst dich sicherlich auch an die Anfänge? An die Zeit, als es noch gar nicht so schlimm war?“
Widerwillig nickte er ihr zu, während ihr heißer Atem gegen sein Gesicht schlug. Mit jeder neuen menschlichen Generation war es schlimmer geworden. Die heutigen Menschen kannten keine Zeit ohne die Tyrannen. Zeiten ohne Hunger, ohne Angst und Hoffnungslosigkeit. Wie die Tiere hausten die Armen, deren Anzahl jedes Jahr größer wurde, gnadenlos geknechtet von den Reichen und Adligen, die Tribut an die Magier zahlten und damit ihre Vormachtsstellung sicherten. Verrat und Hass war weiter verbreitet als Treue und Liebe, Familie kein Garant für Sicherheit. Jegliches Wissen starb mit jedem neuen Winter ein Stück weiter aus. Handwerkliches Geschick, Kunst, Theater, Lyrik, Musik – die Magier untersagten nichts davon, doch in dem Dreck der Städte und der Hoffnungslosigkeit der Massen gediehen keine Künstler mehr.
„Es überrascht mich, wie stark und gut du bei Sinnen bist, Sayid“, sagte Yllanya leise. „Ich hatte Schlimmeres erwartet, nachdem du ein volles Jahrhundert damit zugebracht hast, nichts zu tun, als um dein Leben zu kämpfen.“
„Du kennst meine Geschichte, oder?“, fragte er.
„Das, was man sich erzählt, ja.“
„Dann weißt du auch, dass ich geliebt wurde. Die ersten zwölf Jahre meines Lebens durfte ich im Schutz einer Familie verbringen, die mich bedingungslos geliebt hat. Ich hatte in den Zeiten danach immer wieder Freunde und Gefährten, deren Liebe und Treue für ein ganzes Äon hätte reichen können, wäre da nicht dieses eine finstere Geheimnis meiner wahren Existenz, das alles zerstört. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden, Yllanya. Du weißt nicht, was Liebe und Familie ist, du warst bloß ein Mensch unter Elfen, mit zu wenig Blut der Unsterblichen in deinen Adern, als dass sie dich hätten akzeptieren können.“
Feuer loderte in ihrem Blick auf – da war er, ihr wunder Punkt. Sie stieß ihn brutal zurück zu Boden und erhob sich erneut, ließ sich allerdings zu keiner weiteren Dummheit hinreißen. Sayid beschloss, sie erst einmal nicht weiter zu reizen. Durchaus möglich, dass sie ihn gehen ließ, wenn er so tat, als würde er mitspielen.
„Was nun deine wahnsinnige Mission betrifft …“, begann er.
„Spar dir den Atem!“, zischte sie. „Glaub nicht, ich wäre eine Närrin. Mir war von Anfang an klar, dass du nicht zu überzeugen bist. Du hast über ein Jahrhundert ohne Ziel, Sinn und Zweck dein Dasein gefristet und es war dir genug. Warum solltest du das aufgeben und dich gegen die Feinde stellen? Dich mit Herz und Seele der richtigen Sache verschreiben? Du bist kein Held, Sayid. Du bist nicht einmal ein wahrhaftiger Drachenreiter. Du bist einfach bloß eine Straßenratte, die nicht sterben will. Darauf war ich vorbereitet.“ Sie zückte einen schlichten schwarzen Stein aus einem Lederbeutelchen an ihrem Gürtel.
„Ist das …?“ Sayid rüttelte unwillkürlich an seinen Ketten, versuchte sich aufzurichten, zu fliehen, obwohl er wusste, wie sinnlos das war.
„Halt ihn fest!“, befahl Yllanya einem ihrer Helfer. Ein bulliger Kerl, der Sayid an der Kehle packte und ihn bewegungsunfähig zu Boden drückte. Er konnte nicht einmal mehr schreien, geschweige denn atmen, als diese Wahnsinnige sich auf seinen Bauch setzte und den Stein über seinem Mal schweben ließ. Ein Fluchstein, wie die Magier sie myriadenfach in Umlauf brachten, um Chaos zu stiften. Jeder, egal ob Mensch oder Elf, ob mit eigener Magie gesegnet oder nicht, konnte ein solches Objekt benutzen, um seinen Nächsten mit einem Fluch zu belegen. Reinrassige Elfen und die Magier selbst wurden davon nicht weiter beeinflusst und wäre Sayid mit einem Drachengefährten verbunden, würde ihn ein solcher Fluch nicht einmal kitzeln. So aber war er Yllanyas Willkür ausgeliefert.
„Ich verfluche dich“, sprach sie langsam und betont und starrte ihm dabei regungslos in die Augen. „Du wirst zu den letzten Elfen des Nordernreiches gehen und alles versuchen, um das erste Zeichen des Zorns zu finden.“ Sie holte aus, um ihm den Stein auf das Mal zu pressen, doch einer der Söldner fing sie am Handgelenk ab.
„Das reicht nicht, Weib!“, grollte er mit tiefer Stimme. „Er muss gezwungen werden, alle Zeichen zu initiieren!“
„Du weißt nicht, wovon du redest.“ Yllanya packte ihn mit der freien Hand und brach ihm trotz ihrer ungünstigen Haltung mühelos den Arm. Ohne sich um seine Schreie zu kümmern, beendete sie den Fluch, indem sie den Stein auf Sayids Brust drückte. Es schmerzte unerwartet heftig. Flammen loderten vor seinem inneren Auge, sie verbrannten ihn, versengten sein Fleisch. Schmerz …
Als er wieder bei Sinnen war, fühlte er die Wirkung des Fluches, der in ihm wütete wie unerträglicher Durst. Er musste zu den Elfen, um jeden Preis!
Yllanya stand schwer atmend über ihm, während ihre Gefährten sich auf dem Boden krümmten.
„Es ist unglaublich schwer, geeignete Diener zu finden“, erklärte sie lächelnd. „Wenn diese Narren doch begreifen würden, dass sie ahnungslos sind und es besser ist, mir zu vertrauen! Diese Fluchobjekte sind zu schwach, um einen komplexen Zauber zu wirken. Würde ich versuchen, dich damit an die gesamte Mission zu binden, wäre das dein sicherer Tod. Beim geringsten Widerstand, bei jedem Hindernis, das dich davon abhält, zügig voranzuschreiten, würde sich der Fluch in deinen Verstand brennen, bis er dich letztendlich als ein heulendes, greinendes Bündel Wahnsinn zurückließe. Mehr als das, was ich dir aufgebürdet habe, kannst du nicht tragen, Sayid. Möglicherweise war es bereits zu viel. Das ist ein Risiko, das ich eingehen muss … Die Hoffnung, dass du obsiegen wirst, ist sehr, sehr gering.“
„Mach mich los!“, stieß er keuchend hervor. Die Schmerzen waren grausam, heftiger als alles, was er jemals hatte ertragen müssen – was wirklich viel gewesen war.
Yllanya zog einen Schlüssel hervor und beugte sich über ihn.
„Ich wünsche dir Glück, Sayid, letzter Drachenreiter von Tan’aara. Mögen die Götter auf deiner Seite sein und dein Schicksal lenken. Und möge kein Hass zwischen uns herrschen, sollten wir uns jemals wiedersehen.“ Sie gab ihm einen Kuss auf die Stirn, für den er sie stumm hasste, bevor sie seine Fesseln löste. Seinen stümperhaften, unkoordinierten Angriff wehrte sie mit Leichtigkeit ab.
„Ezron, gib dem Mann frische Kleidung, Waffen, Ausrüstung und Geld. Und was immer er sonst noch verlangt, um seine Aufgabe erfüllen zu können. Sei unbesorgt, er wird dich weder ernstlich attackieren noch irgendetwas versuchen, um seiner Pflicht zu entkommen.“
„Ja, Herrin.“ Einer der Söldner raffte sich vom Boden hoch und eilte mit gesenktem Kopf davon.
„Du hast mich gehört, Sayid?“, fragte sie. „Ezron wird deinen Weg nicht behindern, sondern dir helfen. Die kurze Wartefrist wird dir Gutes bringen.“
Ihre Worte genügten, um den Fluch zu besänftigen. Das grausame Brennen ließ nach, das unstillbare Verlangen, sich mit aller Gewalt einen Weg hinaus zu erkämpfen, verschwand völlig. Zittrig lehnte sich Sayid gegen die modrige Kerkerwand und rang um Atem. Das war heute kein guter Tag, o nein …
Kapitel 4
„Die Elfen zogen aus, in Erwartung eines ehrlichen Kampfes. Doch die Magier stellten sich ihnen nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern sie schickten ihre Hunde. Grausige Bestien, zu einem einzigen Zweck gezüchtet: töten.“
„Vom Krieg gegen die Magier“, Verfasser und Datum unbekannt
nthanael hatte vergessen, wie sich Furcht tatsächlich anfühlte. Das sollte unmöglich für jemanden sein, der niemals irgendetwas vergaß, doch er war schier überwältigt von Angst, seit er die Grenze überschritten hatte. Bei seiner kopflosen Flucht vor Maondny – die Götter mochten wissen, wie dieses Kind es fertig gebracht hatte, dass er mit minimaler Ausrüstung und Bewaffnung in die Wildnis losgerannt war! – hatte er nicht einmal bemerkt, wie er die unsichtbare Linie erreichte.
Die Magier gestanden seinem Volk ein kleines Territorium zu, gerade einmal zehn Meilen im Durchmesser. Solange sie innerhalb dieser Grenzen blieben und jährlich ihren Tribut zahlten, hatten sie vor den Tyrannen nichts zu befürchten. Wer die Grenze jedoch überschritt, wurde umgehend zum Freiwild.
Ein Jahrhundert lang hatte kein reinblütiger Elf mehr dieses Gefängnis verlassen. Für Mischlinge galt die Einschränkung nicht, die Magier hatten kein Interesse an Halbblütern, die fast nie Talente besaßen, die dem Feind gefährlich werden könnten.
Wozu sollten die Elfen auch ausbrechen wollen? In ihrem Gebiet fanden sie alles, was sie zum Leben benötigten, waren in ihren Wäldern abgeschieden von der Welt und deren Leid. Die ewige Trauer fesselte sie unnachgiebig an ihre Häuser und ließ keinen Raum für den Wunsch nach Freiheit oder gar Rebellion.
Noch immer war Anthanael fassungslos über das, was Maondny mit ihm angestellt hatte. Ob da Magie im Spiel gewesen war? Unentwegt ging er im Geiste jedes Wort durch, das zwischen ihnen gefallen war, aber er konnte keinen Auslöser dafür finden, warum er plötzlich loslaufen musste. Die Angst davor, an seiner Verzweiflung zugrunde zu gehen und Selbstmord zu verüben, das konnte unmöglich genug gewesen sein, oder? Genug, um ihn hinaus aus seinem sicheren Kokon zu treiben, hin zu einem anderen Schicksal, das mit großer Wahrscheinlichkeit seinen vollkommen sinnlosen Tod beinhaltete.
Was sollte er jetzt tun? Umkehren? Er war durchaus neugierig, welches andere Schicksal ihn erwartete, zudem war er fern von daheim, nah einem Ort, den er niemals wiedersehen wollte. Er hatte Angst. Nur wenige Meilen von hier befand sich die Stelle, an der seine Eltern erschlagen worden waren. Seine jüngere Schwester, seine beiden älteren Brüder. Ihre Statuen füllten sein Haus mit Erinnerungen, mehr gab es nicht für ihn.
Was ihn schockierte und aufwühlte war die Tatsache, dass einige wenige Jahre genügt hatten, das Angesicht der Landschaft vollständig zu verändern. Anthanael erkannte keinen einzigen Baum wieder und selbst die Silhouette der Gothorlin, einer niedrigen Hügelkette im Südosten, deckte sich nicht gänzlich mit seiner Erinnerung. Die Welt dort draußen hatte sich gewandelt, ohne auf ihn zu warten, während er im Wachschlaf dahingedämmert war.
Einst war das gesamte Nordernreich sein Zuhause gewesen. Die Wälder und Seen sein Garten, der sternenübersäte Nachthimmel seine Bettdecke. Jeder Zweig, jede Blume war ihm vertraut gewesen und geringfügige Veränderungen erzählten ihm Geschichten über das Werden und Vergehen aller lebendigen Wesen und Dinge.
Verwirrt berührte Anthanael den Stamm einer toten Birke und durchforstete sein Gedächtnis. Als er das letzte Mal an dieser Stelle gestanden hatte, gab es keinen Schössling, nicht einmal andere Bäume, sondern einen flachen Tümpel. Von diesem Gewässer war keine Spur zurückgeblieben.
„Es war doch bloß solch eine kurze Zeit, kaum genug für ein Blinzeln und ein Seufzen“, murmelte er fassungslos. „Kaum genug, um die Trauer wirklich zu spüren …
Erneut erwog er, in die Sicherheit und Abgeschiedenheit des Dorfes zurückzukehren. Dort veränderte sich wenig. Die Blumen, die er täglich zu Füßen der Statuen niederlegte, wandelten sich im Lauf der Jahreszeiten, doch in einem berechenbaren Rhythmus. Es gab Regen und Sonnenschein, Schnee und Nebel, Gewitter und Sturm. Mal blies der Wind sanft, mal tobte er mit vernichtender Macht. Alles andere blieb unausweichlich und gnadenlos auf ewig gleich.
Nun – abgesehen von P’Maondny. Dieses Kind hatte vom Tag seiner Geburt an den Frieden gestört. Schon allein, weil es keinen Vater zu geben schien und ihre Mutter nicht wusste, wann und wie sie die Kleine empfangen hatte. Da Karalyn die größte Anzahl von Statuen im Haus besaß und niemand schwerer an Trauer zu tragen hatte als sie, war man davon ausgegangen, dass sie die notwendige Liebesnacht schlicht vergessen oder verdrängt hatte. Bis sich Maondnys besondere Fähigkeiten offenbarten …
Anscheinend musste Anthanael ihr dankbar sein. Er fühlte sich lebendig wie seit einhundertneunzehn Jahren nicht mehr. Die Angst vor dem Unbekannten, vor einer ungewissen Zukunft, vor lauernden Feinden, sie belebte ihn.
Den gesamten Tag über wanderte Anthanael zwischen den Bäumen umher, folgte mal dem Pfad, der sich halb vergessen durch das Dickicht schlängelte, mal irrte er tief ins Unterholz. Unentwegt verglich er dabei das Damals mit dem Heute, entdeckte staunend eine Schmetterlingsart, die er nie zuvor erblickt hatte, und lauschte dem Gesang eines Vogels, der ihm vollkommen fremd war; bewunderte hunderte Blumen und Bäume, die er länger als ein Jahrhundert nicht mehr sehen durfte, und erfreute sich an Tieren, die sich ihm vertrauensvoll näherten.
Als die Schatten länger wurden und sich die Dämmerung ankündigte, hielt Anthanael Ausschau nach einem geeigneten Ort für ein Nachtlager.
In diesem Moment hörte er es. Den Laut, vor dem er sich die ganze Zeit über gefürchtet hatte: Ein Heulen, ähnlich dem eines Wolfes, doch tiefer und unheilverkündend. Die namenlosen Bestien der Magier, sie waren ihm auf der Spur!
Anthanael atmete tief durch, zwang sich zur Ruhe. Die Hunde des Feindes hatten seine Geschwister getötet. Vielleicht war dies das Schicksal, das Maondny für ihn erblickt hatte? Kämpfend unterzugehen und dabei Rache an diesen verdorbenen Kreaturen zu nehmen, die ihm seine Familie gestohlen hatten. So viele wie möglich von ihnen mitzunehmen, ja, der Gedanke gefiel ihm gut.
Wieder erscholl der Ruf einer dieser Bestien, näher diesmal. Er wurde von sämtlichen Seiten beantwortet, es handelte sich demnach um ein großes Rudel.
Hervorragend.
Lächelnd schwang er sich auf eine gewaltige Eiche, eine der wenigen Bäume in diesem Wald, an die er sich aus besseren Tagen erinnern konnte. Leichtfüßig kletterte er so hoch es ging. Auf einer Astgabel nahm er Platz, ergriff seinen Bogen, legte die Pfeile bereit. Die Bestien waren schwierig zu töten. Unheilvolle Magie panzerte ihre Körper. Ein Schuss durch das Auge konnte sie töten, und mit der richtigen Waffe war es möglich, sie zu köpfen. Nichts anderes wirkte, ausgenommen noch ertränken. Tatzen und Gebiss der Tiere waren giftig. Drei bis vier Wunden, gleichgültig wie geringfügig, genügten bereits, um einen Elf zu töten.
„Es war gut, noch einmal aufzuwachen“, sagte Anthanael und blickte zum Sonnenuntergang, den er viel zu lange nicht mehr hatte beobachten können – die Bäume vor seinem Haus wuchsen zu hoch und dicht und verstellten die Aussicht. „Es ist gut, in einer Nacht wie dieser zu sterben. Ich danke dir, P’Maondny, für dieses besondere Geschenk.“ Die letzten Worte ließ er mittels Magie durch den Stamm der Eiche in die Erde fließen und von dort aus in Richtung Dorf treiben; in der Hoffnung, dass Maondny sie auffing. Eine Antwort erwartete er nicht, es wäre auch keine Zeit, ihr zu lauschen. Denn er hatte die dunklen Schatten bereits bemerkt, die sich knurrend hinter Bäumen und Gesträuch duckten. Gelassen spannte er den Bogen.
„Kommt her, ihr Hunde!“, rief er. „Ich bin bereit für euch!“
Sayid rannte einmal mehr, so rasch er konnte. Diesmal waren ihm Magierhunde auf den Fersen, die aus dem Nichts aufgetaucht waren. Zwei der Bestien hatte er bereits erschlagen, vier weitere hingen hartnäckig an seinen Fersen. Sie trieben ihn auf das Hauptrudel zu, wie ihm anhand des Geheuls vollkommen bewusst war. Irgendetwas dagegen tun konnte er nicht. Die Bäume um ihn herum waren zu niedrig und zu dünn, um ihm Schutz zu bieten, denn die Magierhunde konnten verflucht hoch springen und mit ihrem Gewicht entwurzelten sie selbst alte Bäume.
Eine Woche war mittlerweile vergangen, seit Yllanya ihm den Fluch auferlegt hatte, und seinem Empfinden nach musste er den Elfen nahe sein. Der Fluch wirkte in dieser Hinsicht wie ein Wegweiser: Entfernte er sich vom richtigen Pfad, setzte der brennende Schmerz ein, den er gründlich zu hassen gelernt hatte. Genau wie das Geifern und Knurren der Bestien, die ihm mit unheilvoller Intelligenz zusetzten, ohne ihn zu verletzen oder ein Ziel für eines seiner Kampfmesser zu bieten.
Diese Viecher witterten, was er war. Sie wussten genau, ein Drachenreiter war weitestgehend immun gegen ihr Gift, darum wollten sie ihn im Rudel niedermachen. Nun, sollten sie es ruhig versuchen. Er hatte keine Zeit zum sterben. Der Fluch wütete in ihm, weil er sich vom richtigen Pfad entfernte.
Plötzlich drängten sich die vier Bestien an ihm vorbei, eine sprang sogar über seinen Kopf hinweg. Sie stießen heisere, wütende Laute aus und hatten ihn offenbar von jetzt auf gleich vergessen. Verblüfft blieb Sayid stehen, heftig nach Atem ringend, und wischte sich den Schweiß von der Stirn und aus den Augen. Die Magierhunde ließen bloß aus einem Grund von einem einmal anvisierten Opfer ab: Wenn sich ihnen ein wichtigeres Ziel anbot. Das einzige, was die Biester von der Fährte eines Drachenreiters abbringen konnte, war ein reinblütiger Elf. Zumindest war es das, was er vom Hörensagen her wusste.
„Nassar erleuchte mich mit deiner Weisheit“, murmelte er, obwohl er für gewöhnlich eher zu Nakoio und nicht zum Gott der Schreibkunst und Legenden betete. Es erschien gerade angemessen …
Der Fluch drängte ihn, die Gelegenheit zu nutzen. Wieder auf die verborgene Siedlung zuzuhalten, da seine Verfolger abgelenkt waren. Doch falls dort vorne tatsächlich ein Elf in Schwierigkeiten steckte und womöglich allein war, hatte er den Bestien wenig entgegenzusetzen. Ihn zu retten könnte Sayid einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Eventuell reichte es aus, dass die Elfen ihn nicht sofort töteten, sobald sie erkannten, was und wer er war.
Wen belügst du hier?, dachte er, während er die Schmerzen verdrängte und seine beiden Kampfmesser zog. Sie waren länger als seine Unterarme, beinahe schon Kurzschwerter, aber deutlich leichter und handlicher. Zudem hart und extrem scharf. Alte Elfenschmiedekunst – Yllanya hatte ihm das Beste an Ausrüstung gegeben, was Geld kaufen und Skrupellosigkeit stehlen konnte. Sayid wusste, dass die Elfen ihn töten würden, gleichgültig, was er vorher für einen der ihren getan haben mochte. Warum also nicht einfach tun, was sein Herz ihm befahl? Das dumme Ding hatte ihn viel zu oft in Schwierigkeiten gebracht, wenn er mal wieder nicht auf die Stimme der Vernunft hörte. In diesem Punkt hatte das Weib ihn falsch eingeschätzt: Er besaß kein Talent darin, zu überleben und sich zu verbergen. Sein wahres Talent lag darin, sich in Schwierigkeiten zu bringen.
So wie jetzt.
Sayid schlich sich geduckt an das Grollen, Fauchen und Knurren an, das mit jedem Schritt lauter wurde. Er schob dicht gewachsene Zweige beiseite, und dann sah er ihn: Ein männlicher Elf, mit langen goldblondem Haar, gehüllt in jenen grünlichen Stoff, der ihn im Wald vor jedem Hintergrund verschwimmen ließ. Auch Sayid war in diesen Stoff gekleidet. Der Mann hockte auf einem Baum und hatte unübersehbar große Probleme. Die Bestien sprangen unentwegt in die Höhe und schnappten nach ihm. Auch wenn er bereits drei von ihnen mit meisterlichen Bogenschüssen in die Augen erlegt hatte, blieben über zwanzig übrig. Mindestens ein Hund hielt ihn unentwegt beschäftigt, derweil sprangen die anderen in Gruppen von vier bis sechs Tieren gegen den unteren Stamm der Eiche. Unter ihrem enormen Gewicht und ihrer Kraft war es nur eine Frage der Zeit, bis sie sogar diesen stolzen Baum gefällt hatten. Soweit Sayid es im schwindenden Tageslicht erkennen konnte, blutete der Elf bereits aus mindestens zwei Wunden. Einer, höchstens zwei weitere Treffer und ihm war nicht mehr zu helfen.
Sayids Instinkte verbündeten sich mit dem Fluch und brüllten ihn an, endlich zu fliehen. Die Schmerzen machten ihn halbblind und zu verschwinden, bevor die Viecher ihn bemerkten, war das Klügste, was er tun konnte. Stattdessen packte er einen der Hunde am Hinterlauf, zerrte ihn mit roher Gewalt herum und köpfte ihn mit einem einzigen wuchtigen Hieb.
„Hey, ihr süßen, flauschigen Wollkätzchen! Wollt ihr spielen?“ Lachend vor Verzweiflung und Pein hob er seine blutbefleckte Klinge und tötete im Vorbeigehen den nächsten Hund. Es brachte ihm eine klaffende Krallenwunde am Arm ein, zusammen mit der ungeteilten Aufmerksamkeit der Bestien. Achtzehn schwarzfellige Kreaturen, eine jede mit über einem Schritt Schulterhöhe, duckten sich geifernd in seine Richtung.
Und dann brach die Niederhölle über ihn herein.
Anthanael starrte fassungslos auf den Fremden, der wie ein Berserker unter den Magierhunden wütete. Auch wenn er wie ein Mensch aussah, er bewegte sich viel zu schnell und seine kraftvollen Hiebe mit den Kampfmessern waren mehr, als ein Sterblicher jemals vollbringen könnte. Waffen und Kleidung sprachen ebenfalls dafür, dass es sich um einen Halbelf handeln musste. Ein ungewöhnlich mächtiges und kriegerisches Exemplar seiner Art, wie es schien. Das Gift der Hunde wirkte nur schwach auf Menschen, darum konnten Halbelfen mehr einstecken. Dennoch würde es ihn letztendlich töten, wenn ihn nicht zuvor die schiere Masse der Bestien überwältigte. Er brauchte Hilfe!
Anthanael konzentrierte sich. Elfenmagie war vollkommen ungeeignet für den Kampf, da sie darauf ausgelegt war zu heilen und Leben zu bringen, statt es zu vernichten. Es gab allerdings einige Tricks, die man anwenden konnte, sofern genug Zeit und Konzentration blieb. Ein Schwachpunkt der Magie als solche, selbst unter den Tyrannen gab es wenige, die mächtig genug waren, binnen einiger Herzschläge einen Zauber zu wirken.
„Inono wocco halliel“, flüsterte er, und wiederholte diese Silben drei Mal. Magische Energie begann ihn zu durchströmen, von der Erde in seinen Körper und hinein in den Baumstamm, auf den er beide Hände gelegt hatte. Ein unirdisches Grollen erklang in der Tiefe.
„Weiter, weiter!“, rief er. „Inono wocco halliel!“
Einen Atemzug später musste er sich mit aller Kraft festklammern, denn die Eiche erwachte gewaltsam zum Leben. Sie schüttelte sich, ließ alle Äste rascheln und knacken. Die Bestien verharrten in ihren Angriffen auf den Krieger. Anthanael spürte ihre Angst. Sie befriedigte ihn zutiefst.
„Hoy ryet!“ Mit diesem Befehl übermittelte er das Bild, wie der Baum ausholte und auf sechs der Magierhunde einschlug, die sich ein wenig abseits hielten. Die gesamte Eiche geriet in Bewegung, als wäre ihr Stamm biegsam wie ein Weidenzweig, als sie sich seinem Willen unterwarf. Anthanael musste sich im richtigen Moment in die Höhe katapultieren, als die Baumkrone auf den Bestien niederging; andernfalls hätte die Wucht des Aufpralls ihn fortgeschleudert. Er landete sicher wieder auf seinem Ast, sobald die Eiche sich aufrichtete. Der Kontakt zum Baum durfte nicht für länger als ein Dutzend Atemzüge unterbrochen werden, andernfalls verlor der Zauber seine Wirkung – alte Bäume wie dieser besaßen ein zu starkes Bewusstsein, um sich länger gefangen nehmen zu lassen.