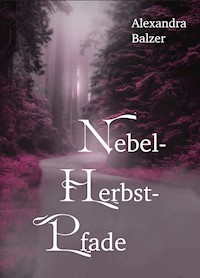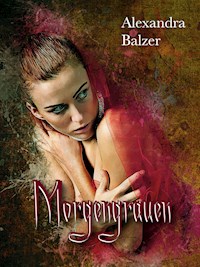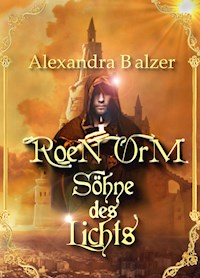
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Roen Orm - das Zentrum der Macht. Mit dem Tod des Königs und des alten Erzpriesters droht Inanis Leben zu zerbrechen, denn ihr werden Entscheidungen aufgezwungen, die ihre Kräfte übersteigen. Ilat übernimmt nun den Thron und verlangt nach Krieg. Thamar hingegen verlässt sein Exil und zieht für Maondny ins Ungewisse. Auch der junge Sonnenpriester Janiel muss schicksalshafte Entscheidungen treffen, denn er entwickelt Fähigkeiten, für die ein wahrer Sohn des Lichts mit dem Tode bestraft wird ... Zweiter Band der vierteiligen Fantasy-Saga über Magie, Macht, Schicksal und Liebe. Ca. 79.000 Wörter Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieses Buch ca. 380 Seiten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Roen Orm - das Zentrum der Macht.
Mit dem Tod des Königs und des alten Erzpriesters droht Inanis Leben zu zerbrechen, denn ihr werden Entscheidungen aufgezwungen, die ihre Kräfte übersteigen. Ilat übernimmt nun den Thron und verlangt nach Krieg. Thamar hingegen verlässt sein Exil und zieht für Maondny ins Ungewisse. Auch der junge Sonnenpriester Janiel muss schicksalshafte Entscheidungen treffen, denn er entwickelt Fähigkeiten, für die ein wahrer Sohn des Lichts mit dem Tode bestraft wird ...Zweiter Band der vierteiligen Fantasy-Saga über Magie, Macht, Schicksal und Liebe.
Ca. 79.000 Wörter
Im gewöhnlichen Taschenbuchformat hätte dieses Buch ca. 390 Seiten
Roen Orm
2.Teil
Söhne des Lichts
Für Moni, die mir über die letzten Hürden geholfen hat.
Der feurige Gott sieht alles, vergibt alles, doch vergisst nichts.
1.
„Feuersbrünste, Sturmfluten, Erdbeben, Wirbelstürme – ich habe den Zorn der entfesselten Elemente gesehen und fürchte sie. Doch mehr als dies fürchte ich den Zorn einer Frau.“
Zitat aus „Jianmaco“, Theaterstück, uraufgeführt in Roen Orm,
2034 n. Gründung
chlecht gelaunt trieb Inani die Gruppe durch den Nebel vor sich her. Sie mochte diese Männer nicht – Söldner aus Akanor am Südmeer. Die Kämpfer hatten Thamar zwar schon vor Jahren die Treue geschworen, doch sie galten als wenig zuverlässig. Man musste sich ständig Aufgaben für sie ausdenken, damit sie sich nicht langweilten und unruhig wurden, oder sogar einen anderen Herrn suchten. Akanor war eine zu wichtige Macht, als dass man sie außen vorlassen durfte.
Thamar hatte sie nach Briol geschickt, um Vieh zu stehlen. Briol war eine reiche, stark befestigte Stadt, deren Bewohner an Wegelagerer gewöhnt waren und ihr Hab und Gut zu verteidigen gewusst hatten. Die erbeuteten Rinder und Schafe waren die Mühe durchaus wert gewesen. Einige Männer des kleinen Söldnertrupps waren verletzt worden, sie fühlten sich jetzt als Helden – und damit war der Hauptzweck der Unternehmung erfüllt.
Inani hasste es trotzdem, diese grölende Bande führen zu müssen. Sie war mittlerweile einundzwanzig Jahre alt und Mittelpunkt der männlichen Aufmerksamkeit, wohin auch immer sie ging. Ihre flammendroten Haare zogen alle Blicke auf sich – bewundernde wie verängstigte. Der Aberglaube, dass rothaarige Frauen Anhänger des Finsterlings waren, hatte sich in den letzten Jahren eher noch verstärkt. Am Königshof war Inanis Stellung davon allerdings nicht beeinträchtigt, im Gegenteil: Viele adlige Männer versuchten ihr nahe zu kommen.
Als sie endlich die Holzhütten von Thamars Siedlung erreicht hatten, atmete sie erleichtert auf.
Die Söldner waren schwieriger zusammenzuhalten gewesen als die Tiere, mehr als einmal wäre ihr beinahe einer der Männer im Nebel verloren gegangen. Wie sehr sie ihre Vertraute vermisste! Mit ihr zusammen wäre das wesentlich angenehmer verlaufen, keiner der Kerle hätte gewagt, vom Weg abzuweichen. Aber die Leopardin hatte im Frühjahr Junge geworfen und konnte Inanis Ruf nicht folgen, ohne die Kleinen zu gefährden. In höchster Not würde die Raubkatze ihre eigenen Jungen im Stich lassen, um Inani beizustehen. Doch das war ein Opfer, das sie nicht annehmen wollte, sollte es irgendwie zu vermeiden sein. Wenn sie durch den Nebel wanderte, besuchte sie die Leopardin dafür bei jeder Gelegenheit. Die zwei Kätzchen akzeptierten Inani wie eine zu groß geratene Schwester, versuchten mit ihr zu balgen und attackierten mit ihren nadelspitzen Zähnchen ihre Stiefel. Es waren wundervolle Momente des Friedens, die Inani sich erschlich. Im Augenblick hätte sie ihren rechten Arm dafür gegeben, bei ihrer Seelenschwester sein zu dürfen.
„Du siehst etwas unfröhlich aus.“ Corin empfing sie mit sanftem Lächeln und tatkräftigen Händen. Innerhalb weniger Minuten hatte die blonde junge Frau das Vieh auf eine Weide geführt, Platz in den Ställen für eine Kuh gefunden, die bald kalben würde, und die Söldner fortgescheucht.
„Die Kerle sollen selbst für sich sorgen, die wissen ja, wo alles zu finden ist.“ Corin lachte und umarmte Inani herzlich. Es war einige Wochen her, seit sie sich zuletzt getroffen hatten.
„Pya weiß, du hast mir gefehlt“, erwiderte Inani seufzend und lächelte endlich. „Es ist unruhig in Roen Orm. Maondny hat sich noch nicht geäußert, trotzdem bin ich sicher, der König wird bald sterben. Die Priester schwärmen wie die Motten durch den Palast, es sind mehr Adlige versammelt, als ich es jemals erlebt habe. Ich schaffe es kaum, mich für eine halbe Stunde zu Niyam zu schleichen, alle paar Augenblicke klopft jemand an meine Tür.“
Corin nickte nachdenklich. „Ja, man spürt selbst hier, dass irgendetwas anders ist. In Bewegung, könnte man sagen. Thamar wird Tag und Nacht belagert, Kythara schleppt Männer heran, die ich vorher nie gesehen habe. Viele bleiben nur wenige Momente und werden sofort wieder fortgebracht. Ich wage kaum, Kythara anzusprechen, sie ist schrecklich gereizt. Und Thamar will ich auch nicht belästigen, er ist sehr angespannt.“
„Es wird höchste Zeit, dass die Sache sich entwickelt, wir warten bereits lange genug.“ Inani umarmte sie und wollte dann gehen, doch Corin hielt sie fest.
„Bitte, bleib wenigstens heute Nacht. Du bist das erste freundliche Gesicht seit Wochen. Niemand hat Zeit, mit mir zu reden, es sei denn, um mir einen Auftrag zu geben. Thamar und seine engsten Vertrauten essen gerade zu Abend. Er würde sich bestimmt freuen, wenn du dich dazu gesellst.“
Inani zögerte kurz. Sie hatte ihre eigenen Gründe, warum sie es vermied, mit Thamar zusammenzutreffen. Aber so inständig, wie Corins Augen flehten, konnte sie nicht anders als schließlich zu nicken.
„Danke!“ Corin strahlte so glücklich, dass es Inani einen Stich gab – sie hatte ihre Freundin wirklich vernachlässigt. Die Ärmste lebte seit Jahren mehr oder weniger abgeschoben zwischen Scharen von raubeinigen Kriegern.
Thamar lächelte ihr zu, als sie Arm in Arm mit Corin eintrat. Etwa dreißig Männer waren mit ihm in der Hütte versammelt, sie saßen um einen riesigen Holztisch und aßen gemeinsam. Inani erkannte Freunde, die den Prinzen von Anfang an begleitet hatten, genauso wie ihr fremde Gesichter auffielen.
„Inani! Es ist schön, dich zu sehen“, begrüßte Thamar sie freundlich. Den unsicheren, tief verletzten Jungen von einst gab es nicht mehr. Aus ihm war ein Mann geworden, mit breiten Schultern und dem kräftigen, durchtrainierten Körper eines Kriegers. In seiner ruhigen Art strahlte er eine natürliche Autorität aus, die ihm sofort Respekt verschaffte. Inani gelang es, das Lächeln und den Gruß unverfänglich zu erwidern. Sie wusste, man sah ihr an, wie sehr sie diesen Mann mochte, aber bislang hatte sie es geschafft, das wahre Ausmaß ihrer Zuneigung zu verbergen. Wenn sie von schwesterlicher Liebe sprach und sich bei jeder Gelegenheit mit Thamar neckte, täuschte sie damit sogar Corin, die ihr doch so nahe stand – und am wichtigsten war, sie täuschte Thamar selbst. Seine Liebe gehörte ausschließlich P’Maondny, gleichgültig, wie unerreichbar sie war. Inanis Kopf wusste es. Ihr Herz war leider anderer Meinung.
„Erzähl, was gibt es Neues aus dem Palast?“, fragte er und gab dem Mann rechts neben sich einen Schubs. Kýl, einer seiner ältesten Freunde und Vertrauten, grinste nur, machte allerdings bereitwillig Platz für Inani und Corin, die sich mühelos beide auf dem breit gezimmerten Stuhl niederlassen konnten. Während Corin mit der Lehne zu verschmelzen schien und von niemandem weiter wahrgenommen wurde, hingen die Blicke aller Männer an Inani. Sie war daran gewöhnt, es störte sie längst nicht mehr so wie früher. Genießen würde sie diese Art von Aufmerksamkeit wohl nie.
Eine Weile tauschten sie sich über Klatsch und Tratsch, Gerüchte und Intrigen des Königshofs aus. Sie vermieden dabei sensible Themen wie die schwindende Gesundheit des Königs.
„Du Schöne, wann erhörst du mich endlich?“ Einer der Krieger jammerte plötzlich mit dramatischem Unterton und übertriebener Gestik von seiner Liebe zu ihr. Er war ein wenig betrunken, sichtlich auf Spaß aus und glücklicherweise Herr seiner Sinne.
„Falls du meinst, wann ich zu dir ins Bett komme – nun, wenn du stirbst, dann setze ich mich freudig neben dich und flüstere dir ein paar tröstliche Worte ins Ohr, bis Geshar deine Seele holt“, erwiderte Inani geziert. Sie war eine Meisterin in dem Spiel mit doppeldeutigen Worten und belanglosem Plänkeln. Am Königshof half es, um Intrigen zu überleben. Hier, inmitten von raubeinigen Kerlen, konnte sie es entspannt genießen. „Falls du Hilfe brauchst, um Geshar zu locken, bin ich jederzeit die deine.“
Der Krieger lachte und wollte etwas erwidern, als sich einer der fremden Söldner vorbeugte: „Warum packste dir das Weib nich‘, Harko?“
„Weil sie, werter Arlan, eine Hexe ist, und ich gerne noch ein wenig leben möchte!“
„Das’n Weib, ist alles dran, was dazu gehört. Hexen, ist doch alles gelogen, die Priester sagen’s!“ Der Söldner lallte, er hatte bereits mehr getrunken als ihm gut tat. Inani spürte, wie die Männer interessiert auf ihre Reaktion warteten – sie war berüchtigt für nahezu unkontrollierbare Wutausbrüche. Bei solch einem Schwachkopf gab es dazu keinen Grund, sie wollte ihn verspotten und danach die Runde verlassen. Bevor sie allerdings antworten konnte, ergriff Thamar das Wort:
„Arlan, ich für meinen Teil glaube gerne an das, was ich sehe. Eine Frau, die im heiteren Sonnenschein Nebel rufen kann, welcher eine ganze Armee innerhalb weniger Herzschläge von einer Ecke des Kontinents an die andere bringt, das ist wohl keine Lüge. Und ich habe noch keinen Priester erlebt, der etwas Ähnliches geschafft hat.“
„Sind die zu was mehr fähig, außer schmierigen Nebel zu rufen?“ Der Betrunkene grölte vor Lachen. „Nebel is’ nich’ gefährlich, oder? Warum nimmst dir das Hexenweib nich’, du willst’se, oder?“
Kýl gab dem schwankenden Mann einen Schubs, sodass der beinahe vom Stuhl gefallen wäre. „Die haben noch mehr Tricks drauf, Arlan, glaub’s mir. Es sind die Augen, verstehst du? Alles ist gut, solange du einer Hexe in die Augen siehst und ein Mensch schaut zurück. Selbst wenn die wütend sein sollte, alles ist gut. Falls sie dich aber anstarrt und die Pupillen sind geschlitzt, oder gelb wie bei einer Katze, dann solltest du rennen! Ich bin schon ein paar Jahre länger hier als du, ich weiß, was Hexen können.“ Er erschauderte unwillkürlich und warf Inani einen leicht nervösen Blick zu.
„Die Blonde da nich’, oder?“ Der Söldner wies unsicher auf Corin, die er wahrscheinlich mindestens zwei Mal vor sich sah. „Die ist weich.“
Inani ballte gereizt die Fäuste, bereit, ihre Freundin zu verteidigen, doch wieder erhob Thamar die Stimme: „Corin gehört zu der seltenen Sorte Hexe, die immer gefährlich ist, egal, wie ihre Pupillen geformt sind. Je sanfter sie lächelt und je unscheinbarer sie aussieht, desto gefährlicher ist sie. Sie findet jede Schwäche und weiß von all deinen Ängsten, Arlan. Sie ist allerdings klug genug, dir das erst zu verraten, wenn sie dich vernichten will.“ Er nickte Corin respektvoll zu, und sie lächelte mysteriös. Vor sich hinmurmelnd wandte sich Arlan seinem Trinkbecher zu, die anderen lachten – einige von ihnen übertrieben heiter. Hexen waren nun mal anders.
Plötzlich spürte Inani, wie sich Corin versteifte. Sofort waren ihre Sinne hellwach, sie wusste, dass ihre Freundin den Raum und sämtliche Anwesenden aufmerksam beobachtet hatte.
„Was ist los?“, fragte sie geistig.
„Ich weiß es nicht. Irgendetwas … einer der Söldner, die du mitgebracht hast. Ich sehe einen Schatten, Hass, ich weiß es nicht!“
„Konzentrier dich. Löse dich von mir und sage mir, welcher der Männer eine Gefahr ist. Du kannst ihn finden!“
Thamar griff nach ihrem Arm, beunruhigt von ihrer geistigen Abwesenheit, doch Inani schüttelte nur leicht den Kopf. Aufmerksam beobachtete sie Corin, die mit geschlossenen Augen dasaß, tief in sich selbst versunken. Dann wies sie mit ausgestrecktem Finger auf einen Mann mit grauen Haaren und Vollbart, der am unteren Ende des Tisches saß und scheinbar angeregt in ein Gespräch mit seinem Sitznachbarn vertieft war.
Schlagartig wurde es still im Raum. Der stämmige Bärtige sah auf, starrte verwundert um sich, als er sich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit fand.
„Wo ist die Gefahr, Corin?“, flüsterte Inani hastig. Der Blick des Mannes flackerte zu Thamars Kelch, den dieser seit Minuten hielt, ohne daraus zu trinken, und sie reagierte sofort: Mit einer fließenden Bewegung riss sie den Weinkelch an sich, drückte ihn Corin in die Hände, sprang auf den Tisch und kniete vor dem Mann nieder. Mit einem Dolch an seiner Kehle verhinderte sie Fluchtgedanken. Sofort hielt sie einen zweiten Dolch bereit und zielte damit auf das Herz eines Mannes zu ihrer Linken, dessen Hand zum Griff seines Schwertes geirrt war. Die Waffe des Bärtigen riss Kýl an sich und warf sie in die hintere Ecke des Raumes, bevor er mit erhobenen Händen vom Tisch zurückwich.
„Ich habe nichts damit zu tun“, stammelte er. Inani fixierte die beiden verdächtigen Männer und sicherte den Raum mit ihrem unmenschlich geschärften Gehör.
„Gebt mir einen Grund, wagt es falsch zu atmen, und ihr seid sofort tot!“, zischte sie drohend. Sie hörte, wie ihre Stimme eine ganze Oktave tiefer sackte und wusste, die Raubkatze in ihr war vollends erwacht. Das Blut rauschte in ihren Ohren, vertrauter Zorn kämpfte gegen ihre Barrieren.
Es wäre so leicht, sich überwältigen zu lassen und zu einem gierig tötenden Monster zu werden, einer Bestie, die weder mit einem Panther noch einem Menschen etwas gemeinsam hatte. Zu oft hatte sie bereits an dieser Grenze gestanden und jedes Mal nur knapp den Sieg gegen sich selbst davongetragen.
„Inani, beruhig dich.“ Sie hörte, Thamar war im Begriff, sich zu erheben.
„Bleib wo du bist. Das gilt für jeden hier“, knurrte sie. „Corin, teste den Wein, ob Gift darin ist.“
„Nicht nötig. Es ist Wilder Blauhut, ich erkenne den Geruch“, erwiderte Corin leise. Einige Männer schnappten nach Luft, es war ein weithin bekanntes, starkes Pflanzengift. Einen langsamen und qualvollen Tod brachte es mit sich.
„Du Hund, das wirst du büßen!“ Kýl zog seine Waffe und wollte auf den Söldner losgehen, den Inani vor sich in Schach hielt; doch sie fauchte so drohend, dass alle erstarrten: „Du bleibst, wo du bist!“
Als Kýl gehorchte, richtete sie ihre Raubtieraugen auf den zweiten Mann, ohne dabei den Druck ihrer Klinge auf die Kehle des Bärtigen zu lösen.
Für einen langen Moment suchte sie in der angstvollen Miene des Söldners nach Zeichen, ob er eine Gefahr darstellte. Dann zog sie die Waffe von seiner Brust zurück.
„Ist das ein Freund von dir?“, fragte sie mühsam beherrscht. Töte ihn!, schrie ihr Instinkt, töte ihn sofort! Es war ihr Raubtierinstinkt, nicht das, was ihr menschlicher Verstand ihr sagte. Ihr Instinkt, der ihr befahl, einen unbewaffneten Mann in Stücke zu reißen dafür, dass er Thamar hatte töten wollen. Thamar ...
„Mein Vetter. Bitte, ich verstehe nicht! Nios würde niemals einen Giftanschlag ...“
„Das reicht. Lass deine Hände da, wo ich sie sehen kann, verstanden? Corin, achte auf ihn.“
Inanis ganze Aufmerksamkeit gehörte nun Nios.
„Sprich, und wage nicht, mich anzulügen. Warum? Wer hat dich geschickt?“
Einige Augenblicke lang schwieg der bärtige Mann. Ein höhnisches Grinsen breitete sich über sein Gesicht aus.
„Niemand hat mich geschickt! Ich bin es einfach nur leid gewesen, einem Jungen zu dienen, der sich im Nirgendwo versteckt und von Weibern den Arsch abwischen lässt! Lieber einem Herrn dienen, der wahnsinnig ist, als so einem Feigling, der sich jahrelang verkriecht! Ich werde mich Ilat anschließen. Ich will nicht mehr durch Nebelschwaden waten und mir von kleinen Mädchen sagen lassen, wie man kämpft! Hexe oder nicht, du bist ein Weib, und Weiber gehören gefickt. Stoß mir ruhig deinen Zahnstocher in den Hals, es ändert nichts an der Wahrheit!“ Er spuckte Inani ins Gesicht, und es kostete sie jeden Funken Selbstbeherrschung, ihm dafür nicht die Kehle zu zerfetzen. Etwas von ihrer Mordlust musste sich in ihrem Gesicht spiegeln, sodass er unwillkürlich vor ihr zurückzuckte. Langsam, sehr langsam hob sie die freie Hand und wischte den Speichel fort. Es war totenstill im Raum, alle hielten den Atem an.
Zerfetz ihn! Reiß ihm die Eingeweide raus! Trink sein Blut und friss sein Herz, während es noch schlägt!
Bilder von grausiger Gewalt flackerten durch Inanis Raubtierbewusstsein, der Blutdurst ertränkte langsam ihre menschlichen Sinne. Zwei Menschen näherten sich ihr. Langsam, wohl um sie nicht zu reizen, laut genug, um ihr zu zeigen, dass keine Gefahr drohte. Ihr gesamter Körper zitterte leicht vor Anspannung, um diesem Mann vor ihr nicht den Kopf abzubeißen. Nios war bleich geworden. Sie roch seine Angst, es peitschte ihre Instinkte noch weiter auf. Nadelspitze lange Krallen formten sich dort, wo Fingernägel sein sollten. Schweiß stand auf der Stirn des anvisierten Opfers, sein Herzschlag dröhnte in ihren Ohren, so laut ... Du wirst sterben!
Da spürte sie eine federleichte Berührung am Rücken, zugleich ein vertrautes Bewusstsein, das nach dem ihren suchte.
Ihr Blick irrte zur Seite, nur einen Moment lang. Taube. Zart. So süß …
Inani schloss die Augen, sie spürte, wie sie kurz in sich zusammensackte. Als sie langsam den Dolch sinken ließ, hatte sie sich wieder in der Gewalt. Die Gefahr, wie eine tollwütige Bestie über alles und jeden, sogar über ihre beste Freundin herzufallen, war gebannt. Sie bewunderte Corins Mut, sich ihr zu nähern. Corin hatte genau gewusst, wie gefährlich es war, Inani in diesem Zustand anzufassen.
Thamar stand rechts neben ihr und umfasste ihre Schulter.
Inani nickte ihm zu und setzte sich zurück auf ihre Fersen, die Klinge weiterhin bereit.
„Danke“, wisperte sie in Is’larr, der geheimen Sprache der Hexen. Thamar verstand ein wenig davon, als einziger Mann seit unendlichen Zeiten war ihm dieses Wissen erlaubt worden. Er seufzte und sagte:
„Nios, du glaubst also, ich würde mich verkriechen? Ich würde mich an den Rockzipfel von Weibern klammern? Nun, wie du gerade erlebt hast, tragen Hexen vielleicht Frauenkleider, wenn sie Lust dazu haben, doch man sollte sie nicht für harmlose kleine Mädchen halten. Du hast eine hoch geschätzte Verbündete beleidigt, eine langjährige Freundin. Du hast versucht, mich zu vergiften, eine hinterhältige, feige Tat, für die du den Tod verdient hast. Ich könnte dich Inanis Gnade überlassen und zusehen, wie sie dich mit bloßen Händen zerreißt, aber weißt du was, Nios?“ Thamar packte den Söldner unvermittelt am Kragen und zog ihn dicht zu sich heran. „Das wirklich Gute daran, dass ich noch kein König bin ist, dass ich mir viele Freuden gönnen darf, die mir auf dem Thron verwehrt bleiben werden. Eine davon ist, ich kann mit dir machen, was immer ich will.“ Er ließ diese Drohung wirken, bis Nios schwer atmend versuchte, aus seinem Griff zu entfliehen.
„Sag mir eins: Hast du das Wissen, wo ich mich aufhalte, verkauft, oder irgendetwas anderes von dem, was du geheim zu halten geschworen hast? Ja oder nein?“
Hastig schüttelte Nios den Kopf. Thamar starrte ihn drohend an, bis Inani und Corin gleichzeitig riefen: „Er sagt die Wahrheit.“
„Ich wollte nur dafür sorgen, dass Ihr nicht mehr kommen und Ilat herausfordern könnt. Wer seinen Herrn betrügen will, sollte sicherstellen, dass der sich nicht mehr dafür rächen kann“, murmelte Nios. Es sollte vermutlich provozierend klingen, aber seine Stimme schwankte und er wagte nicht, Thamar anzusehen.
Noch einen Moment lang hielt Thamar den Mann fest. Dann stieß er ihn von sich und wandte sich zu Kýl, der unmittelbar hinter ihm stand: „Mein Freund, leih mir dein Schwert. Und du“, er wies auf den unglücklichen Vetter des Attentäters, „du gibst deine Waffe an diese Ratte. Er soll im Duell beweisen, wer von uns beiden das Recht hat zu leben.“
„Hoheit, nein! Wenn er Euch tötet ...“
Mit einer ungeduldigen Geste brachte Thamar die Männer zum Schweigen.
„Falls ein Feigling wie er es schaffen sollte, mich zu töten, habt ihr alle eure Zeit verschwendet, denn wie hätte ich so jemals hoffen können, meinen Bruder zu bezwingen? Sollte Nios mich besiegen, ist er frei. Niemand wird ihn hindern zu gehen, egal wohin er will. Sollte ich ihn töten, zweifelt nie wieder an mir, meinem Mut oder der Wahl meiner Verbündeten!“
Thamar sprach ruhig, ohne Zorn oder Hass. Gerade dadurch wirkten seine Worte umso tiefer.
„Glaubt ihm nichts! Sobald ich einen Kratzer in unseren hochwohledlen Prinzen ritze, wird die Wildkatze da über mich herfallen! Ein gerechter Kampf, daran glaubt ihr doch selbst nicht!“, rief Nios hastig.
Inani stieg mit langsamen Bewegungen vom Tisch, schüttelte kurz den Kopf, und ihre langen Haare färbten sich rot.
„Ich schwöre bei Pyas Tränen, ich werde nicht eingreifen, egal, was geschieht.“
„Geh vor die Tür, Nios, dich erwartet ein ehrlicher Kampf.“ Thamar wog Kýls Schwert in der Hand und schritt voraus zur Tür. Nios wandte sich zu seinem Vetter. Der bewegte sich mit einem Mal schneller, als irgendjemand reagieren konnte: Er gab seine Waffe nicht weiter, sondern stieß sie in Nios’ Brust. Nios brach sofort tot zusammen. Sein Mörder warf sich Thamar zu Füßen.
„Majestät“, stammelte er, „mein Prinz, ich zweifle nicht an Eurem Mut, Eurer Kampfkunst oder an Eurer Ehrlichkeit. Aber ich musste an meinem Vetter zweifeln, ob er Euch einen ehrlichen Kampf geliefert hätte. Lieber wollte ich ihn selbst umbringen als mit anzusehen, wie er Euch vielleicht hinterrücks erschlägt, nachdem Ihr ihm Gnade gezeigt habt ...“ Seine Worte verloren sich. „Macht mit mir, was Ihr wollt. Ich fürchte den Tod nicht.“
Thamar beugte sich zu ihm hinab und zog ihn auf die Füße.
„Du magst den Tod nicht fürchten, doch ich fürchte, einen guten Mann zu verlieren. Es ist Blut geflossen, in meinem eigenen Haus. Du hast die Schande von dem Namen deiner Familie gewaschen, mehr gibt es nicht zu tun in dieser Sache.“
Er drückte ihm die Schulter und wandte sich nun an alle, die im Raum anwesend waren.
„Wenn es noch jemanden gibt, der an mir, meinen Taten oder meinen Verbündeten zweifelt, dann soll er es jetzt sagen. Er braucht keine Strafe zu fürchten. Die Hexen werden ihm die Erinnerung nehmen, wo wir uns befinden und ihn an jeden Ort in Enra bringen, den er sich wünscht – Roen Orm eingeschlossen. Ein aufrichtiger Rückzug ist besser als das, was gerade geschehen ist.“
Er sah jedem Mann in die Augen. Keiner senkte den Blick, keiner wich vor ihm zurück. Niemand regte sich.
„Wir sind käufliche Krieger, aber wir sind treu, solange unser Herr uns bezahlt und anständig behandelt. Wir folgen Euch, Thamar“, sprach einer von ihnen, ein bulliger Axtkämpfer mit vernarbtem Gesicht. „Und gegen die Hexen haben wir auch nichts, solange sie ihre Krallen bei sich lassen und wir sie wenigstens angaffen dürfen“, fügte er grinsend hinzu, und löste damit ein wenig die Anspannung.
„Gaffen ist erlaubt. Anfassen nur, wenn du deine Fratze weiter verschönern lassen willst.“ Inanis Worte klangen drohend, ihr schmales Lächeln wirkte beruhigend, und alle lachten. Die Gefahr war gebannt. Der Zorn war besiegt.
Doch es war knapp gewesen. Wieder einmal. Zu knapp …
2.
„Bitte Elfen niemals, etwas zu erklären. Du wirst kein Wort verstehen, sie werden lachen, und du wirst dich dümmer fühlen als zuvor.“
Sinnspruch der Famár
ordre wünschte, der Boden würde sich endlich auftun und ihn verschlingen. Oder dass ein Blitz ihn traf und sein Elend beendete. Egal was, alles wäre besser, als noch länger von Ivron niedergestarrt zu werden. Peras Bruder. Der Bruder der Frau, die er gleich heiraten sollte. Die er ausgesprochen grob behandelt hatte, ohne es zu wollen. Als er es schließlich nicht mehr ertragen konnte, hielt er seinem Gegenüber das Gesicht entgegen und murmelte: „Nun mach schon. Schlag endlich zu, ich will es hinter mir haben! Lass mich nicht warten.“ Verkrampft schloss er die Augen und erwartete den Fausthieb. Ivron trat näher zu ihm heran.
In Ordnung, soll er mir die Nase brechen. Aber bitte, meine Zähne brauche ich noch!
Plötzlich wurde er gepackt und nach vorne gerissen. Überrumpelt schrie Jordre auf. Er fand sich in einer rippenbrechenden Umarmung wieder, spürte mehr das Gelächter des Mannes, als dass er es hörte. Dann wurde er losgelassen, und ein herzhafter Schlag auf die Schultern trieb ihn fast zu Boden.
„Du hast Mut, Kleiner! Du wirst jedes bisschen davon benötigen, wenn du meine Schwester überleben willst.“
Misstrauisch öffnete Jordre die Lider und starrte in das lachende Gesicht seines künftigen Schwagers.
„Entschuldige, ich musste meinem Vater versprechen, dich ein wenig zu erschrecken. Pera spuckt Feuer vor Wut.“ Ivron grinste breit. Es wirkte freundlich, also entspannte Jordre sich langsam.
„Ich kann gar nicht sagen, wie leid es mir tut, sie hatte mich völlig überrascht“, sagte er leise.
„Mach dir nichts draus. Sie wird sich schnell beruhigen, so ist sie nun mal. Schwieriges Temperament, aber nicht nachtragend. Gut, die Sache mit der Hochzeit, das wird wohl länger dauern ... Wahrscheinlich sieht sie schnell ein, dass es unmöglich deine Schuld ist, und dafür eben Vater und diese Famár hassen.“
Jordre nickte nur. Er war immer noch erschöpft, und die ganze Situation zerrte an seinen Nerven. Ivron schien das zu spüren, er legte ihm eine Hand auf den Arm und drückte ihn beschwichtigend.
„Du wärst gerade vermutlich gerne irgendwo anders, nicht wahr? Ich beneide dich wahrlich nicht.“ Neugier blitzte in seinen dunklen Augen auf, und er fragte in verschwörerischem Ton: „Sag, die Famár, ist sie wirklich deine Adoptivmutter?“ Als Jordre wieder bloß stumm nickte, bohrte er nach: „Nun erzähl schon, wie ist das denn passiert? Und was für Abenteuer hast du da draußen erlebt? Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor du heiraten musst, mein Vater beschwichtigt gerade die Leute. Hier, ich habe Frühstück dabei, und jetzt erzähl! Ich habe schließlich nicht mal eine Stunde Zeit, den Mann kennen zu lernen, der mir meine Schwester stiehlt, du bist mir verpflichtet!“
Jordre setzte sich seufzend zu Boden und nahm die Schüssel mit der Hafergrütze an, die Ivron ihm unter die Nase hielt. Er war sich nicht ganz sicher, ob es ihm nicht doch lieber gewesen wäre, sich die Nase brechen zu lassen. Ergeben fügte er sich seinem Schicksal und begann, ein wenig von sich zu erzählen.
P‘Maondny beobachtete, was dort in Anevy geschah. Sie erlebte mit, wie Chyvile einen Blick in den Raum warf und sich lächelnd zurückzog, als sie die beiden jungen Männer in freundschaftlicher Zweisamkeit miteinander sah.
P‘Maondny hatte dieses Gespräch lange vor sich hergeschoben. Es half nichts, sie musste endlich die Wahrheit offenbaren. Egal, wie übel die Famár ihr das nehmen würde.
„Chyvile, ich muss dir etwas Schwieriges erklären.“
„Ich höre, fang an.“
„Genau das ist schwierig, ich weiß nicht, wo.“
„Du vermagst in die Zukunft schauen, also wo liegt das Problem? Erwäge alle Möglichkeiten und nimm diejenige, die am besten scheint.“
„Alle sind gleichermaßen schlecht.“ P‘Maondny seufzte und riss sich dann zusammen.
„Es gibt eine Schwierigkeit, die ich vorausgesehen und in meine Berechnungen eingeschlossen hatte. Da du von deiner Seite aus nichts unternehmen kannst, hatte ich dir vorher nichts gesagt. Aber nun musst du darüber Bescheid wissen, damit du richtig handeln wirst.“
„Sprich weiter.“ Chyviles Tonfall fror langsam ein.
„Von Anevy aus betrachtet ist es erst drei Tage her, seit wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, nicht wahr?“
„Worauf willst du hinaus?“
„Für mich war es eine weit längere Zeit.“
„Was meinst du? Enra und Anevy haben den gleichen Zeitverlauf.“
„Das war lange so, ja. Nun haben die Dinge sich geändert. Für Enra sind über neun Jahre vergangen in der Zeit, die für euch gerade einmal drei Tage bedeutete.“ P‘Maondny wartete kurz, ob Chyvile etwas fragen würde, doch ihr begegnete nur eisiges Schweigen. Es war ungewohnt für sie, ein Gespräch zu führen, dessen Verlauf sie nicht bereits Ewigkeiten zuvor in allen denkbaren Varianten durchlebt hatte. In diesem Fall hatte ihr tatsächlich der Mut gefehlt.
„Vor neun Jahren wurde deine Welt von unsichtbaren Energien getroffen. Eine Sonne ist explodiert, und …“
„Die Sonne ist in wunderbarer Ordnung, danke schön!“
„Nein, Chyvile, nicht Anevys Sonne, sonst wäre deine Welt jetzt Staub und Asche. Eine andere Sonne, weit entfernt, doch nahe genug, dass euch noch Energiewellen getroffen haben. Es hatte bloß eine einzige spürbare Auswirkung, die ist dafür tragisch genug: Der Teil des Weltenstrudels, der unsere beiden Welten verbindet, wurde zerstört. Der Weg zwischen uns ist fort.“
„Sprich klar und verständlich mit mir, was bedeutet das?“ Chyvile knurrte drohend, dennoch war ihre Angst deutlich zu hören. Allein die Behauptung, dass es mehr als eine Sonne gab, überforderte sie; P‘Maondny zwang sich, einfachere Worte zu wählen.
„Der große Strudel ist nicht zerstört, das ist nicht möglich, da er von Pya selbst stammt. Aber der Nebenpfad, den mein Vater erschuf, verbindet unsere Welten nicht mehr länger miteinander, und nun läuft die Zeit unterschiedlich für uns.“
„Mit anderen Worten, selbst wenn die Tänzerin das Siegel zerbricht, kann dein Volk nicht zu uns kommen, weil es keinen Weg mehr gibt?“
„Nein, so schlimm ist es nicht. Ich werde dafür sorgen, dass die Verbindung neu geschaffen wird.“
„Ich soll also die gesamte Reise der Tänzerin verzögern? Damit du genug Zeit hast?“
„Das wäre die falsche Reaktion, Chyvile. Im Gegenteil, du musst Pera und Jordre vorantreiben, so schnell es nur geht! Zögere eine einzige Stunde, und sei es aus Mitleid mit ihren schwachen Körpern, und die Prophezeiung schlägt fehl. Ihr seid jetzt auf einem Weg, von dem ihr nicht mehr abkehren könnt. Wenn ihr die Tänzerin nicht rechtzeitig zum Siegelstein bringt, ist alles verloren, alles!“
„Ich verstehe nicht. Wenn es keinen Verbindungsweg gibt, was soll die Eile dann bewirken?“
„Du musst es nicht verstehen. Sorge dafür, dass die Gefährten auf den Weg kommen. Um das andere kümmere ich mich.“
„Du strapazierst meine Geduld!“
„Ich weiß, es tut mir leid. Es wäre müßig, dir von Zeitblasen, himmlischen Energien, Kreuzwirkungen wirrläufiger Schicksalsverschiebungen und der besonderen Magie von Prophezeiungen zu erzählen. Ich werde sterben, wenn ich es nicht fertig bringe, die Verbindung neu zu erschaffen, und Anevy wird untergehen. Zweifle nicht, ich werde alles tun, was nötig ist!“
„Zweifle du nicht, dass ich dich auf keinen Fall in Stich lassen werde. Aber, Maondny?“
„Hm?“
„Keine weiteren Überraschungen mehr, ja? Versprichst du mir das?“
Lange Zeit herrschte Schweigen. Schließlich flüsterte P‘Maondny ängstlich:
„Vergib mir, Chyvile. Ich will nichts versprechen, was ich nicht halten kann.“
Damit löste P‘Maondny sich aus dem Gespräch und ließ ihr Bewusstsein wieder in Enra auftauchen. Sie musste mit Inani reden, und zwar sofort.
3.
Rache, Krieg, Liebe, es ist gleich, welchen Namen man der Sache gibt. Es geht darum zu gewinnen. Wer schwach ist, wird untergehen. Wer stark ist, bleibt Sieger. In gewisser Hinsicht verlieren beide, denn nach dem Sieg ist das Spiel vorbei.
Sinnspruch, Urheber unbekannt
chleppend lenkte Inani ihre Schritte durch den Nebel. Sie hatte es wirklich nicht eilig, zurück nach Roen Orm zu gelangen, wo heute Abend der nächste große Ball geplant wurde. König Darudo war inzwischen für alle Welt sichtbar erkrankt, er verfiel von Woche zu Woche stärker. Gerade deswegen fanden unentwegt Feste, Bälle und Wettbewerbe statt. Künstler aus ganz Enra wurden in die Stadt geholt, um Adel wie Volk beschäftigt zu halten. Niemand sollte zu sehr darüber nachdenken, ob der König vielleicht besser von seinem Leid erlöst werden sollte. Inani wusste, Darudo gab seine letzte Kraft, um das Königreich geordnet zu verlassen. Ein sinnloser Aufwand, denn Ilat war zu instabil, zu unberechenbar, um Roen Orm führen zu können. Jeder wusste das. Was es für die Zukunft bedeuten würde, ahnten nur die wenigsten in voller Konsequenz, und so tanzte die Stadt, taumelte auf der Suche nach Ablenkung und Freude wie ein Schmetterling dahin. Überall heirateten die Menschen, die Straßen waren erfüllt von Schwangeren, die nicht wie sonst üblich in den Häusern versteckt wurden, sondern ihre prallen Leiber stolz vorzeigten. Jeden Tag schienen die Röcke der jungen Mädchen kürzer zu werden, das Lachen der Männer lauter, die Blicke der Alten hoffnungsloser. Lebensdurst und Leidenschaft summte zwischen den Häuserwänden, Verbrechen jeder Art geschahen vor den Nasen der Stadtwachen. Tag wie Nacht waren Todesschreie zu vernehmen, vermischt mit lustvollem Stöhnen von Liebenden. Roen Orm war schon immer eine Stadt gewesen, in der selbst die Felsen, in die man sie hinein geschlagen hatte, vor Leben zu pulsieren schienen. Das Herz der Welt. Dieses Herz schlug nun wie rasend vor Angst.
Inani seufzte.
Graf Orel hatte unmissverständlich klar gemacht, dass er heute Abend ihre Gunst verlangen würde. Wenn sie nicht wenigstens zwei Tänze für ihn reservierte, würde er ihr Probleme bereiten. Leider war er in der Position, um ihr Leben am Hof in einen Alptraum zu verwandeln, denn er hatte es geschafft, ein gerne gesehener Gast an Kronprinz Ilats Seite zu werden.
Da auch verschiedene andere Adlige um Inanis Gunst buhlten, würde sie heute wohl ununterbrochen tanzen müssen, um alle zufrieden zu stellen.
Sicherlich würde Graf Orel heute Nacht mit Tänzen nicht zufrieden sein. Inani versuchte sich zu entscheiden, ob sie solch ein Opfer auf sich nehmen wollte.
Nichts da. Nicht mit diesem Widerling!
Sie hatte schon mit einigen Höflingen das Bett geteilt, niemand blieb am Königshof lange jungfräulich, wenn er im Spiel der Macht vorankommen wollte. Inani empfand wenig Interesse oder Vergnügen dabei. Nur ihr allererster Gefährte hatte es überhaupt geschafft, ein wenig Leidenschaft in ihr zu wecken, aber er war ihr durch die Magie des Mittsommerfestes gewiesen worden. Alle Hexen, die als mündig galten, durften in jener besonderen Nacht ein Ritual wirken, das sie direkt in die Arme eines passenden Gefährten führte. Inani erinnerte sich gerne an den Jungen … Ein Hirte, vielleicht zwei Jahre älter als sie. Er hatte ihr nicht einmal seinen Namen genannt, bis zum Schluss hatte er geglaubt, er würde träumen. Seine schwieligen Hände waren mit solcher Andacht über ihren mädchenhaften Körper gewandert, sie hatte sich in seinen Armen wie eine Prinzessin fühlen dürfen. Seine Küsse waren scheu und süß gewesen, ihre Vereinigung kurz, dafür zärtlich und liebevoll. Inani hatte ihm den größten Teil seiner Erinnerung an diese Nacht verschleiert, dafür Gesundheit und Kraft geschenkt. Manchmal dachte sie daran, nach ihm zu sehen, ob es ihm gut ging, hinderte sich jedoch jedes Mal selbst daran. Es wäre falsch, noch einmal in das Schicksal des jungen Mannes einzugreifen. Er sollte sie für einen Traum halten, nichts sollte ihn hindern, sein Leben ohne sie fortzuführen. Es gab keine Liebe zwischen ihnen, keinen Bund. Er sollte eine Erinnerung bleiben, von einer zärtlichen ersten Begegnung mit Männern.
Ihre weiteren Erfahrungen waren anderer Art gewesen. Leise stöhnend dachte Inani an ihren letzten Bettgefährten, ein schwitzender Fürstensohn, der ihr unerträgliche Albernheiten ins Ohr geflüstert hatte. Manche davon sogar gereimt. Am liebsten hätte sie ihm Warzen an sein bestes Stück gehext, damit er niemals wieder wagen würde, eine Frau im Bett zu langweilen, aber so etwas wäre in Roen Orm tödlicher Leichtsinn. Also hatte sie seine schwammigen Berührungen geduldet und das Liebesgestammel über sich ergehen lassen, um ihn als Fürsprecher zu gewinnen. Ihre Rache war grausam: Sie hatte ihm die Erfüllung beinahe eine Stunde lang vorenthalten. Erst als er schon weinend um Gnade flehte und kurz vor einem Herzschlag zu stehen schien, ließ sie ihn kommen. Sie genoss die Macht, die sie über Männer besaß.
Graf Orel würde sie heute allerdings nicht ertragen.
Inani tanzte durchaus gerne, selbst die steifen zeremoniellen Tänze des Königshofs. Doch heute wollte sie lieber irgendwo anders sein. Irgendwo. Egal wo, solange es nicht in Roen Orm war.
Ich muss mit Mutter reden, es wird langsam Zeit, den nächsten Schritt zu planen. Unter Ilat kann ich nicht länger eine einfache Hofdame bleiben, er wird auf die Priester hören. Und die werden mich entweder verbrennen oder aus der Stadt jagen wollen, oder noch schlimmer, an irgendeinen verdienten Adelssohn verheiraten!
Durch geschicktes Taktieren hatte Shora es bislang geschafft, die unzähligen Heiratsanträge, die man ihr, Alanée und ganz besonders Inani zugetragen hatte, so abzulehnen, dass niemand beleidigt worden war. Inzwischen musste Inani meistens allein am Hof zurechtkommen, denn es wäre auffällig geworden, dass die beiden erwachsenen Frauen in den vergangen Jahren um keinen Tag gealtert waren. Keine Falte, keine graue Strähne, nichts, was dem natürlichen Verlauf der Dinge entsprach. Shoras und Alanées Luftmagie war zu schwach, um Illusionen zu wirken, die von den Sonnenpriestern nicht sofort durchschaut werden könnten. Sie traten nur noch ganz selten öffentlich auf, stets von dunklen Schleiern verhüllt. Jedermann glaubte, sie wären als Büßerinnen in den Tempel der Heiligen Mutter gegangen. Ein Ort für Frauen, die sich dem Ti-Glauben hingeben wollten. Pya hatte dort ebenfalls einen Schrein, wurde allerdings nicht als Schwester, als gleichrangige Göttin verehrt, sondern als eine Art mütterliche Schutzheilige, die über Tis Schöpfung wachte, von ihm selbst erschaffen. In der Regel begaben sich Witwen in jene kleinen Tempel, die im ganzen Reich zu finden waren; Frauen, die sich vor der Zwangsverheiratung versteckten; manchmal auch junge Mädchen, die auf dem falschen Laken ein Kind empfangen hatten. Solche Kinder wurden danach als vorgebliche Waisen im Tempel aufgezogen.
Es war nicht leicht, ohne Shoras Schutz auszukommen. Immer wieder geriet Inani in Situationen, in denen Wut oder Hass sie zu überwältigen drohten, in denen sie unwillkürlich nach ihren Seelenvertrauten griff. Shora hatte es fertig gebracht, eine neue Mode einzuführen: aufwändig bestickte Kopftücher, unter denen das Haar versteckt werden konnte. Mit allerlei Juwelen, Blumen und sonstigem Zierrat veredelt, hatten die Hofdamen sich begeistert davon anstecken lassen und wetteiferten darum, wer den schönsten Kopfputz trug. Für Inani war dies oft genug die einzige Rettung, denn Raubtieraugen mochte sie für einige Minuten verbergen können, Haare hingegen, die von leuchtendem Rot zu tiefem Schwarz wandelten, nicht. Zum Glück hatte sie Maranis, eine treue Zofe, die kaum jemals von ihrer Seite wich und ein unvergleichliches Geschick darin besaß, solche gefährlichen Momente zu erahnen und ihre Herrin rechtzeitig außer Gefahr zu bringen.
Wie sollte es nun weiter gehen? Ilat musste eng beobachtet werden. Wie würde ihre Zukunft in Roen Orm also aussehen?
Unschlüssig blieb Inani stehen, obwohl das im Nebel leichtsinnig war. Wollte sie jetzt nach Roen Orm oder in das Reich der Hexen? Stellte sie sich der Pflicht, oder suchte sie lieber den Rat ihrer Mutter?
Wenn ich noch lange in der Stadt bleiben will, muss ich wohl oder übel heiraten …
Als sie sich gerade auf das Haus ihrer Mutter konzentrieren wollte, hörte sie eine Stimme hinter sich und fuhr erschrocken herum.
„Inani, es ist zu lange her.“ Maondny stand vor ihr und lächelte geistesabwesend.
„O Pya! Du darfst dich nicht im Nebel an mich heranschleichen, das ist gefährlich!“, rief sie, doch zugleich musste sie lächeln.. Es war tatsächlich schon viel zu lange her, dass sie Maondny zuletzt gesehen hatte, die sie wie eine Schwester liebte.
„Verzeih mir, ich musste kommen. Du brauchst Hilfe, um den richtigen Pfad für die Zukunft zu wählen.“ Abwartend nickte Inani ihr zu, sie wusste, niemand war besser geeignet ihr zu raten als die Traumseherin.
„Gehe nach Roen Orm. Du hast dort ein Spiel begonnen, das dringend beendet werden muss.“
„Garnith? Nun ja, er ist halb wahnsinnig geworden mittlerweile und verlässt den Gebetsraum nur noch, wenn man ihn bewusstlos in seine Kammer trägt. Aber er will nicht aufgeben.“
„Er darf nicht mehr leben, wenn Darudo stirbt. Garnith hat den Verstand des Kronprinzen mit Hass und Angst gegen Hexen, Magie und Frauen als solches erfüllt. Du weißt, dass Ilat sich weigert, eine Gefährtin zu wählen.“
Inani nickte verbittert. Ein Großteil ihrer Intrigen zielte darauf ab, junge Hofdamen vor dem Zugriff des Kronprinzen zu retten. Ilat war bekannt dafür, wehrlose Mädchen zu sich zu locken und zu verführen. Da sein Vater zu krank und zu schwach war, gab es niemandem mehr, der ihm offiziell Einhalt gebieten konnte.
Königin Rosanna war ihre Gönnerin, sie schützte Inani und half ihr, Ilat immer wieder zu übertölpeln. Doch sie besaß weder die Macht noch den Willen, ihren Sohn wirklich aufzuhalten.
„Beende dein Spiel. Beende es heute Nacht. Bitte Maranis, dich beim Ball zu entschuldigen und gehe danach ins Viertel der Künstler. Es ist das Beste für ganz Roen Orm, du musst Ilat von diesem Mann befreien.“
Maondnys goldschimmernde Iriden wandelten zu einem intensiven blauen Ton, als sie sich von dem magischen Zeitenfluss trennte. Strahlend lächelte sie Inani an und griff nach ihrer Hand.
„Lass mich zusehen! Ich will mit eigenen Augen miterleben, wie du ihn vernichtest!“, rief sie aufgeregt. Inani umarmte die junge Elfe impulsiv und drückte sie an sich.
„Für Thamar! Heute Nacht wird Garnith sterben!“
Beschwingt rannten sie los, bereit, Roen Orm den Ersten Sohn des Lichts zu entreißen.
„Gib mir meinen Mantel!“, wiederholte Garnith duldsam, als wäre er davon überzeugt, der junge Mann vor ihm wäre taub oder zu dumm, um ihn zu verstehen. Janiel zögerte weiterhin, doch er wollte sich dem Erzpriester nicht widersetzen und öffnete schließlich die Truhe, die neben dem Bett stand und alle wichtigen persönlichen Gegenstände enthielt. Der nachtschwarze Mantel roch intensiv nach den Lavendelsäckchen, mit denen man die Motten fernhielt, er war staubig und zerknittert.
„Euer Gnaden, lasst mich Ersatz holen, dieser Mantel ist Eurer nicht würdig ...“, begann Janiel. Garnith schlug ungeduldig mit seinem Gehstock auf den Boden und riss das Kleidungsstück an sich.
„Wenn ich einen Priestermantel wollte, hätte ich dir befohlen, mir einen zu bringen“, knurrte er Janiel an. „Ich muss ungesehen aus dieser Gruft entkommen, heute Nacht steht das Auge der verfluchten Göttin voll am Himmel! Sie wird wieder kommen, ich spüre es. Sie wird kommen und mit mir spielen wollen!“
Seine Stimme brach. Wie dünn sie geworden war, die Stimme eines alten Mannes. Garnith war ein hinfälliger Greis geworden, egal wie sehr er sich dagegen wehrte. Janiel starrte ängstlich zu Boden. Er war der Einzige, der von den Drohungen der Pya-Tochter wusste. Garnith hatte ihn zu Stillschweigen verpflichtet und dafür gesorgt, dass Janiel sein persönlicher Diener wurde. Niemals in all den Jahren, die seither vergangen waren, hatte Janiel den Anblick der Hexe vergessen, ihre Macht, die Kraft ihrer Berührungen, die panische Angst, die er gespürt hatte, als sie sein Leben bedrohte, den Hass, als sie ihm so spöttisch zugewinkt hatte. Er hatte sie seither nicht mehr gesehen, doch allzu oft die Kammer seines Herrn betreten, um dort Spuren ihrer Anwesenheit zu finden: Mit Blut geschriebene Warnungen, Pya-Zeichen an Wänden und Boden, Krallenspuren, als wäre eine Raubkatze hier oben eingedrungen, obwohl Fenster und Türen fest verriegelt gewesen waren ... Garnith kannte seine Ängste, darum vertraute er darauf, dass Janiel ihn nicht verraten würde. Es würde ihn sein Amt als Erzpriester kosten, wenn noch jemand von der Hexe wüsste!
„Herr, Ihr könnt nicht allein durch die Stadt laufen, solange man Euch nicht als Priester erkennt. Sollten Räuber Euch überfallen, weil sie Euch für einen harmlosen Alten halten, was wäre dann gewonnen?“, fragte Janiel besorgt.
„Ich beherrsche noch genug Magie, um mich gegen den Pöbel durchzusetzen, merk dir das! Gegen das Dunkelgezücht der Pya mag ich wehrlos sein, aber bilde dir nicht ein, ich wäre ein verrückter, gebrechlicher alter Schwachkopf!“
Er stieß Janiels helfende Hand zur Seite und humpelte auf die Tür zu, den Blick so drohend, dass Janiel freiwillig zurückwich. „Wag es nicht, mir zu folgen oder irgendwelche Beschützer hinter mir herzuschicken! Ich werde sie bemerken und aus der Gnade Gottes reißen lassen!“
Mit diesen Worten verließ Garnith den geschützten Tempel – allein. Seit Jahren hatte er das nicht mehr gewagt, war immer nur zu den vorgeschriebenen Prozessionen im Schutz seiner Brüder durch die Tore geschritten.
Verflucht seien die Hexen! Sie mögen es wagen, in den Tempel einzudringen, ja, aber sie können nicht die ganze Stadt nach mir absuchen. O Ti, ich habe gesündigt, ich habe deinem Wort nicht gehorcht. Hast du deshalb zugelassen, dass die verfluchten Töchter Pyas deinen Hort des Lichts schänden? Deinen Tempel mit ihrer lästerlichen Magie besudeln?
Wie oft hatte er diese Gedanken gewälzt? Ti um Gnade angefleht, ohne jemals Antwort zu erhalten?
Sei unbesorgt, Herr. Die Saat ist gelegt. Ilat hasst Pya und ihr Gezücht. Meine jungen Geweihten und Novizen sind sorgsam geschult, jeder, der als Nachfolger für mein Amt in Frage kommt, ist bereit, die Dunkelheit mit gebührender Härte zu bekämpfen. Ja, ich habe gesündigt, Ti, doch nur, um die Herrschaft des Lichts vorzubereiten! In deinem Namen habe ich alles getan, alles, um den Sieg für dich zu erringen, den Sieg über die sündigen Kräfte der Pya. Ich habe den Namen der schändlichen Göttin bannen lassen, wie schon mein Meister Cirith. Das einfache Volk beginnt, sie zu vergessen. Die Hexen, sie werden das Angesicht der Welt verlassen. Wenn niemand mehr an sie glaubt, wenn niemand mehr seine magischen Bastardtöchter in den Wald legt, kann es keine neuen Hexen geben. Ich werde sie ausrotten!
Ungehindert lief Garnith durch die dämmrige Stadt. Man wollte ihn an den Toren zwar aufhalten, doch ein Blick in das Gesicht unter der dunklen Kapuze, und jeder Wächter erkannte ihn als das, was er war. Langsam humpelte er die serpentinenartigen gepflasterten Straßen bergab. Je tiefer er kam, desto belebter wurden die Viertel, bis er sich seinen Weg durch dicht gedrängt stehende Menschengruppen bahnen musste. Garnith befand sich nun im Künstlerviertel, und hier wurde das Leben gefeiert. Missbilligend starrte er auf die halbnackten Frauen, die lachend in den Armen betrunkener Männer einherschritten; so stolz, so jung, so sicher, dass die Welt ihnen gehörte. Maler hatten ihre Ateliers nach draußen in die laue Sommernacht verlegt und schufen Kunstwerke unter den Augen ihrer Bewunderer und Gönner, während ihre schamlosen Musen sich in allen möglichen Posen auf der Straße rekelten – die meisten nackt, manche mit Blut verschmiert, bizarr gefesselt oder in den Armen anderer Weiber. Schriftsteller lasen ihre Verse an jeder Straßenecke, lieferten sich Wettkämpfe mit Sängern und Musikern. Philosophen forderten Diskussionen zu ihren lästerlichen Gedanken über Gott, der Welt, der Magie und dem König, während die Stadtwachen tatenlos zusahen.
Garnith war entsetzt. Wie hatte das geschehen können? Er wusste, Darudo war kein gottesfürchtiger Mann und hatte nie genug getan, um der Zügellosigkeit, die schon immer unter Roen Orms Oberfläche gebrodelt hatte, Einhalt zu gebieten. Dieses unglaublich gottlose Verhalten, wider allen Geboten des Herrn, das durfte nicht hingenommen werden!
„Reinige deinen Körper, denn der Herr gab ihn dir in seiner Gnade. Halte ihn gesund und pflege ihn, so ehrst du deinen Gott.
Halte Maß bei allen Freuden, betrinke dich nicht, überfülle dich nicht mit Speisen, liege nicht zu oft deinem Bundpartner bei.
Genieße die Gaben der Schönheit, die Ti uns sandte, aber berausche dich nicht daran. Nur so wirst du eins sein mit deinem Gott, der das Gleichmaß aller Dinge bedeutet.
Doch weise seine Gaben auch nicht gänzlich zurück, sonst beleidigst du ihn, deinen Gott.“
Garnith atmete tief durch. Es tat ihm gut, den Kanon der Gebote zu rezitieren, während er durch das entfesselte Treiben irrte; es beschäftigte seinen überreizten Verstand.
Jugend ist schamlos. Man sollte die jungen Leute allesamt in die Minen und auf die Galeeren schicken, bis ihre sündigen Kräfte verbraucht sind! Erst danach sollte man ihnen gestatten, ein freies Leben zu führen. Künstler wollen sie sein? Was ist daran kunstvoll, sich mit Brandwein vollzuschütten, alles wieder zu erbrechen und zwischendurch Reime zu stammeln, die so schlecht klingen wie diese ungewaschenen Leiber stinken? Ti, hast du deine Stadt vergessen? Wie kannst du so etwas zulassen? Ich muss Ilat sprechen. Ich muss ihn dazu bringen, das ganze Viertel auszuräuchern, der Junge wird auf mich hören … Gleich morgen früh.
In diesem Moment bemerkte er eine junge Frau, die seltsam deplatziert wirkte. Er wusste nicht warum, aber sie schien hier ebenso wenig hinzuzugehören wie er selbst. Ein schwarzes Gewand verhüllte ihren Körper, sie saß ruhig und unbeweglich auf einer niedrigen Mauer. Wie eine Katze, elegant und entspannt und dennoch sprungbereit. Schwarzes lockiges Haar umrahmte das junge Gesicht. Garnith blieb stehen und erschauderte. Warum kam sie ihm bekannt vor? Wer war das Weib? Da wandte sie den Kopf, blickte ihn an, ernst und ruhig.