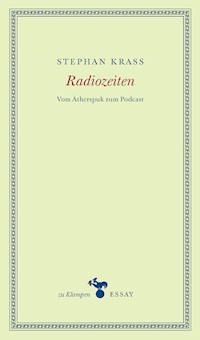Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die Buchstaben sind wie Ameisen und haben ihren eigenen geheimen Staat.« Dass Elias Canetti damit recht hatte, können alle bestätigen, die täglich mit Text zu tun haben. Buchstaben sind nicht nur vielseitig einsetzbare Schriftzeichen, die unter dem Dach des Alphabets ihr semantisches Potenzial entfalten, sie sind auch eigenwillige Gesellen, die uns häufig nur allzu gern durch die Finger schlüpfen und Schabernack treiben. Stephan Krass’ ebenso kluges wie unterhaltsames Buch stellt die Buchstaben nun aufs wohlverdiente Podest und weckt Entdeckerfreude: Wussten Sie eigentlich, welche Strafe die unterlegenen Poeten bei den regelmäßigen Dichterwettkämpfen am Hofe des Tyrannenkaisers Caligula zu erdulden hatten?* Oder welcher deutsche Schriftsteller für den Suppenhersteller Maggi Werbeslogans dichtete?** Die Spur der Buchstaben ist jedoch nicht allein eine Spielanleitung. Die 26 Kapitel über Alphabet, Blaupause, Code und vieles mehr sind trotz ihrer Kürze von beeindruckender poetologischer Tragweite und schrifthistorischer Tiefe. Man wird nach der Lektüre einmal mehr zu dem Schluss kommen, dass Sprache und Schrift unsere Realität nicht nur abzubilden, sondern auch zu formen vermögen. * Sie mussten so lange ihre Wachstafeln ablecken, bis alle Inskriptionen wieder verschwunden waren. ** Frank Wedekind, Ende des 19. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Stephan Krass
Die Spurder Buchstaben
Alphabet Blaupause Code
Stephan Krass, geboren 1951 in Ochtrup / Westfalen, studierte Literaturwissenschaft, Philosophie und Soziologie und promovierte mit einer poetologischen Arbeit. Bis 2017 war er Rundfunkredakteur beim SWR. Seit 2005 lehrt Krass Literatur an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, ab 2015 als Honorarprofessor für literarische Kunst. Krass ist außerdem Lehrbeauftragter am Institut für literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft an der Universität Hildesheim. 2007 wurde er mit dem Hörspielpreis der Akademie der Künste Berlin ausgezeichnet. Krass lebt in Karlsruhe und New York City.
Inhalt
Cover
Titel
Prolog im Wörterhimmel
Alphabet
Buch
Code
Digitus
Erzählen
Feder
Gedicht
Handschrift
Inskription
Jota
Konsonant
Lesen
Medium
Note
Ostrakon
Passwort
Quadrat
Rhapsodie
Stimme
Typographie
Unsinnspoesie
Vogel-V
Würfel
Faktor X
YScheideweg
Zunge
Bonustrack für George Bernard Shaw
Äther
Öffentlichkeit
Übersetzung
Literaturverzeichnis
Impressum
Für seinen Roman Rayuela. Himmel und Hölle schlägt Julio Cortázar zwei Lesarten vor. Zum einen die fortlaufende Lektüre von Kapitel zu Kapitel, zum anderen eine nicht-lineare, die den Textparcours im Rösselsprung absolviert. Beide Möglichkeiten sind auch hier gegeben.
In der Eingangsszene von Woody Allens Film Celebrity (1998) schwebt hoch über dem Verkehrsgewühl von Midtown Manhattan eine Flugzeugstaffel am leergefegten Großstadthimmel. Aus Druckkammern hinter dem Cockpit lassen die Piloten leuchtend weiße Kondensstreifen entweichen, die sich zu Buchstaben formieren. Drei Lettern haben sie bereits in das klare Licht des Himmels geschrieben: HEL. Als die Flugzeuge zum nächsten Buchstaben ansetzen, fragen sich die Passanten, die das Schauspiel gespannt verfolgen, wie es weitergehen mag. Kommt ein zweites L? Dann lassen die Flugzeuge erneut Dampf aus ihren Druckbehältern, und es formiert sich ein P. Der Himmel bleibt – Gott sei Dank – ein Ort, von dem wir Hilfe erwarten können. Nach wenigen Minuten hört man nur noch das schwächer werdende Brummen der Flugzeuge, während sich die Buchstaben langsam in Luft auflösen. Skytyping heißt das Geschäft der Piloten, die das Firmament beschriften. Für einen Moment können wir die Zeichen lesen, dann verschwimmen sie in weißem Gewölk. Die Lettern aus Dampf sind temporäre Luftskulpturen, und der Himmel ist ein transitorischer Ort. Wer ihn »beschreiben« will, muss wissen, dass die Zeichen in den Wind geschrieben sind.
Der Luftraum über uns ist von Anbeginn ein Licht-, Laut- und Letternkosmos, der von Zeichen erfüllt ist, die die Menschen in Schrift und Sprache übersetzt haben.
»Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde«, heißt es in der Genesis, »und Gott sprach: Es werde Licht.« Gott nannte das Licht »Tag« und die Finsternis »Nacht«, und aus Abend und Morgen formte sich der erste Tag. Mit dieser Ur-Szene wurde der Himmel zum Projektionsraum. Dass man am Firmament lesen kann, erzählen schon die Kalender. Sie orientieren sich am Lauf der Gestirne. Aber auch Buchstaben sind zu allen Zeiten am Himmel verortet worden. Die Babylonier bezeichneten die Sterne als Himmelsschrift; Stéphane Mallarmé sprach vom »Alphabet der Sterne« und nannte seine Gedichte »Konstellationen« – vom lateinischen Wort stella / Stern. Die Zeichen des Himmels zu lesen, galt in allen Zeiten als eine Kunst. Seit alters betrachten Astrologen Gestirnsformationen als Chiffren für Weissagungen, in der Bibel empfingen die Heiligen Drei Könige eine göttliche Botschaft von den Himmelskörpern, und in frühen Alphabetschriften dienten Sternzeichen als Vorlage für die Gestaltung von Buchstaben.
In jedem Fall wollen die Zeichen gedeutet werden. Der Himmel aber kennt viele Antworten. Das gilt heute mehr denn je. Die Erfindung der drahtlosen Kommunikation hat jeden Erdenbürger in einen Sender und einen Empfänger verwandelt und das Universum in ein vibrierendes Netzwerk von Informationen. Nie waren dort mehr Buchstaben versammelt. Von jeher auf Sendung eingestellt, ist der Himmel zum größten offenen Kanal aller Zeiten geworden, und der Mensch ist auf Empfang. Wo früher ein verbindliches Programm sendete, konkurriert heute eine Vielzahl von Anbietern, die ein breites Spektrum an Botschaften offerieren. Unterdessen stoßen auch die Bildschirmoberflächen immer neue Horizonte auf, und die illuminierten Tastaturen lassen die Buchstaben leuchten wie Gestirne.
Bei den Buchstaben sprechen wir ebenso von Zeichen wie bei den Sternen. Doch Buchstaben und Sternzeichen sind keine statischen Fixpunkte. Wie die Sterne am Himmel wandern, gehen auch die Schriftzeichen von Wort zu Wort ständig neue Verbindungen ein. Jede Nacht zeigt ein anderes Sternbild, jeder Text zeigt eine andere Letternkonstellation. Diese Dynamik macht unser Alphabet so vielseitig. Die 26 Buchstaben bilden ein geschlossenes Arsenal von Zeichen-Modulen, deren Kombinatorik eine unendliche Textmaschine in Gang setzt. Basiselement ist immer der einzelne Buchstabe. Als Träger von Informationen tritt er im Verbund mit anderen Schrift- und Lautzeichen auf. Gemeinsames Haus ist das Alphabet, unter dessen Dach die Buchstaben ihr semantisches Potenzial entfalten. Darin liegt der unschlagbare Vorzug der Buchstabenschrift: Die einzelnen Elemente sind flexibel, frei flottierend und austauschbar. Kurzum, Buchstaben sind arbiträre Gesellen. Sie haben die Freiheit, in immer neue Figurationen einzutreten und damit neue Bedeutungsfelder abzustecken. Dennoch bleiben sie dieselben Zeichen. Wäre das nicht so, würden wir sie nicht wiedererkennen und könnten auch ihre kombinatorischen Fähigkeiten nicht abrufen. Am Anfang ist der Buchstabe.
Zwei Eigenschaften sind es vor allem, die das Alphabet, das mit abstrakten Zeichen arbeitet, gegenüber einem Schriftsystem, das auf konkreten Symbolen oder Piktogrammen basiert, auszeichnet: Jedes Lettern-Modul ist ein autarker Baustein. Darin liegt sein monadischer Charakter. Sein energetisches Kraftfeld als Medium und Movens unserer Kommunikation entfaltet sich aber erst dadurch, dass die einzelnen Buchstaben-Elemente anschlussfähig sind und in ganz unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden können. Das macht ihren nomadischen Charakter aus. Diese Eigenschaften unseres alphabetischen Zeichensystems bringen es mit sich, dass ein Leseerfolg erst eintritt, wenn die Modulreihe bei einer Wortbildung abgeschlossen ist. Oft hängt es nur an einem einzigen Zeichen. Der Himmel ist unser Zeuge. Ob die Buchstaben-Konstellation den Schriftzug HELL oder HELP aufscheinen lässt, bleibt bis zum letzten Moment ungewiss. Insofern handelt es sich bei der Arbeit mit Buchstaben wie bei der Beschreibung des Himmels um ein riskantes Unterfangen. Nicht nur für Piloten.
Der 10. August 2015 fiel auf einen Montag. Man schrieb den 222. Tag des gregorianischen Kalenders, und die Luft roch nach Sommer. Vor 496 Jahren war Magellan zu seiner ersten Weltumsegelung aufgebrochen, vor 223 Jahren war die Monarchie in Frankreich zu Ende gegangen, und der Wetterdienst meldete für Palo Alto, California einen stabilen Tagesmittelwert von 26 Grad Celsius. An diesem Montag im August, an dem im Silicon Valley die astronomische Morgendämmerung um 4:40 Uhr eingesetzt hatte, kündeten die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin auf der Website ihres Unternehmens an, dass die vormalige Google Inc. in einer neugegründeten Holding mit dem Namen Alphabet Inc. aufgehen solle. Den Namen der neuen Gesellschaft habe man gewählt, weil das Alphabet für »eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit überhaupt« stehe. Als Webadresse sicherte sich der Konzern die komplette Buchstabenfolge abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.com.
Das größte Suchmaschinen-Imperium der Welt, das seine Aktivitäten längst auch auf andere Geschäftsbereiche ausgedehnt hat, benennt sich nach jenem Zeichensystem, das die Elemente unserer Schrift und Sprache in einem jahrtausendealten Letternkorpus versammelt, und erklärt damit den Weltstoff der Buchstaben, eine der erfolgreichsten Kultur- und Zivilisationstechniken, zu seinem Firmenpaten. Für diesen Coup werden in der Webadresse alle 26 Buchstaben des Alphabets als Zeugen aufgerufen. Die Lesbarkeit der Welt ist von nun an eine Domäne von Google geworden. Wo bei der Bibel, dem Talmud, dem Koran und anderen heiligen und weltlichen Schriften die Erklärung und Auslegung der Welt im Zentrum des Bemühens stand, Sein und Sinn in Bezug zu setzen, poppt heute das Eingabefenster einer Suchmaschine auf, um in Bruchteilen von Sekunden für Anfragen aller Art Lösungen zu präsentieren.
Noch erscheint bei der Google-Eingabe des Wortes »Alphabet« in deutschsprachigen Ländern an erster Stelle ein Hinweis auf unser Zeichensystem, erst dann folgt die Alphabet Inc. Man darf gespannt sein, wie lange diese Reihenfolge anhält. Aufgegeben wurde im Rahmen der Restrukturierung von Google Inc. das interne Firmenmotto Don’t be evil zugunsten des neuen Slogans Do the right thing. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Konsequent ist die Umbenennung des Weltkonzerns im Namen des am weitesten verbreiteten Zeichensystems allemal, vollzieht sie doch etwas nach, was Suchmaschinen leisten: das globale Aufspüren von Informationen, die buchstabenbasiert erfasst sind.
Sogar ins Wörterbuch hat der Begriff »googeln« Aufnahme gefunden. Seit 2004 steht das transitive Verb im Duden. Nur mit der Konjugation im Deutschen tut man sich noch etwas schwer. Heißt es nun »ich googele« oder »ich google«? Das Partizip Präsens lautet jedenfalls »googelnd«. Diesen Treffer hat man schnell »gegoogelt«. Ganz konfliktfrei ging die Aufnahme des Neologismus »googeln« in den Duden allerdings nicht vonstatten. Denn als Bedeutung wurde zunächst »im Internet suchen« angegeben. Der Suchmaschinen-Betreiber monierte diese Definition mit dem Hinweis auf seinen Markenschutz. Denn schließlich könne ja auch mithilfe einer anderen Suchmaschine im Netz recherchiert werden. Und das sei dann kein echtes Googeln mehr. Also wurde der Eintrag für das neue Verb in der 24. Auflage des Dudens angepasst. Dort heißt es nun: »mit Google im Internet suchen«. Ob der allgemeine Sprachgebrauch sich die Argumente des Markenschutzes zu eigen macht, darf bezweifelt werden. Denn längst hat sich das Verb »googeln« als Synonym für jede Form der Internet-Recherche durchgesetzt. Tautologen befinden sich jedenfalls bei Suchmaschinen im Internet in guter Gesellschaft. Wer bei Google das Suchwort »Google« eingibt, landet den ersten Treffer wieder bei Google.
Googelt man den Buchstaben A, so erfährt man, dass es sich um den ersten Buchstaben des modernen lateinischen Alphabets handelt, der dem griechischen Alpha sowie dem A im kyrillischen Alphabet entspricht. Nach der Häufigkeitsverteilung der Buchstaben in der deutschen Sprache steht das A mit einer Quote von 6,51 Prozent an sechster Stelle. Die Rangliste nach der Häufigkeit wird unangefochten von dem Buchstaben E angeführt. Buchstabenbasierte Schriftsysteme, wie sie heute in großen Teilen der Welt gebräuchlich sind, haben sich aus Piktogrammen und Hieroglyphen, die im alten Ägypten seit etwa 3 000 v. Chr. in Gebrauch waren, entwickelt. Als älteste Alphabetschrift gilt die phönizische Schrift, deren erste Quellen auf die Zeit um 1 700 v. Chr. zurückgehen. Im Gegensatz zu den Hieroglyphen, deren Repertoire aus mehreren tausend Zeichen bestand, kam die buchstabenbasierte Schrift mit 22 Zeichen aus. Aleph ist der erste Buchstabe des phönizischen und des hebräischen Alphabets. Er zeigt in seiner ursprünglichen Form einen um 90 Grad gedrehten Ochsenkopf und trägt somit noch die Spur eines bilderbasierten Zeichenkosmos in sich. Der Buchstabe »Aleph« stand für einen konsonantischen Knacklaut. Als die Griechen das phönizische Alphabet an ihre Sprache anpassten, setzten sie das »Aleph«-Zeichen für den Vokal »Alpha« ein. Eine andere Hieroglyphe, die ein Haus darstellte, bekam den Namen »Beth«, das semitische Wort für Haus. Aus diesen Anfängen entwickelte sich das griechische Alphabet, das um 400 v. Chr. standardisiert und in ganz Griechenland eingeführt wurde.
Dem Mythos nach, so berichtet jedenfalls Herodot, soll es der Königssohn Kadmos gewesen sein, der auf der Suche nach seiner von Zeus geraubten Schwester Europa das phönizische Alphabet nach Griechenland brachte. Tatsächlich hat sich die Herausbildung der Alphabetschrift in vielen kleinen Schritten über einen langen Zeitraum vollzogen. Im fünften Jahrhundert v. Chr. erreichte die Alphabetisierungswelle schließlich einen ersten Höhepunkt. Man schätzt, dass zu dieser Zeit etwa 15 Prozent der Männer lesen konnten und 10 Prozent auch des Schreibens mächtig waren. Aber die Entwicklung der Schriftkultur galt nicht allen als Fortschritt. Im Phaidros-Dialog berichtet Platon von der Schrift-Skepsis des ägyptischen Königs Thamos. Als Theuth, der »Vater der Buchstaben«, dem Herrscher seine Erfindung vorführt und versichert, durch die Schrift werde das Volk »weiser und erkenntnisreicher«, lässt Platon den König einwenden, diese Erfindung werde die Vergesslichkeit unter den Menschen fördern, »weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur von außen vermittels fremder Zeichen, nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden«. Im Zeitalter von Suchmaschinen, die uns erlauben, der Vergesslichkeit elektronisch auf die Sprünge zu helfen, kann man diesem Einwand des Königs auch eine aktuelle Lesart abgewinnen.
Was die Herkunft der Buchstaben und die Kulturleistung der Phönizier betrifft, ein abstraktes Zeichensystem zu entwickeln, herrscht unter Sprachwissenschaftlern nicht nur Einmütigkeit. Weil die antiken Quellen unvollständig und interpretationsbedürftig sind, bleibt die Forschung darauf angewiesen, mit Wahrscheinlichkeitsmodellen zu arbeiten. Noch in jüngerer Zeit meldete sich mit Karl-Theodor Zauzich ein emeritierter Ägyptologe zu Wort, der die herrschende Lehrmeinung für korrekturbedürftig hält. Demnach seien »Aleph« und »Alpha« nicht auf einen stilisierten Ochsenkopf, sondern auf das ägyptische Zeichen für »Wort« bzw. »Ausspruch« und »Beth« / »Beta« auf das ägyptische Zeichen für »Schnur« zurückzuführen. Theologische Ursprungslegenden haben es da leichter. So gibt es im Islam die Lehre, Gott selbst habe die Buchstaben geschaffen und Adam das Alphabet diktiert. Wir wollen aber den Stab über die Ursprungsfrage der Buchstaben nicht zu früh brechen und im Zweifelsfall den Rat jenes Weisen beherzigen, der den römischen Kaiser Theodosius ermahnte, bevor er einen Urteilsspruch fälle, solle er seine innere Stimme alle Buchstaben des Alphabets hersagen lassen, um so zu einer umfassenden Lagebeurteilung zu kommen.
Dass das Aufsagen des Alphabets der Erbauung dient, wusste auch Wilhelm Busch. In seinem Naturgeschichtlichen Alphabet (1865) heißt es bei dem Buchstaben N: »Die Nachtigall singt wunderschön, / das Nilpferd bleibt zuweilen steh’n.« Solche nach dem Alphabet aufgebauten Texte sind unter dem Namen »Abecedarium« bis heute als Eselsbrücken für Erwachsene und Lernhilfen für Kinder beliebt. Das Ordnungsprinzip des Abecedariums diente schon in mittelalterlichen Rechtsbüchern als probates Mittel, einen Text zu strukturieren. Bei einem Wörterbuch ist ein alphabetischer Aufbau unmittelbar plausibel. Jacob Grimm, der mit seinem Bruder Wilhelm das Großprojekt des Deutschen Wörterbuchs in Angriff nahm, fügte in seiner Vorrede aus dem Jahr 1854 aber noch ein inhaltliches Argument an: »alphabetische folge allein, möchte man sagen, sichert den einzelnen Wörtern ihre vorläufige unabhängigkeit und neutralität.«
Auch in dem Erfolgsroman Die unendliche Geschichte von Michael Ende aus dem Jahr 1979 beginnen die einzelnen Kapitel in fortlaufender Reihenfolge mit den 26 Buchstaben des lateinischen Alphabets. Die Entscheidung, die alphabetische Ordnung auch zur Folie der hier vorliegenden Betrachtungen zu machen, lag also nahe. Repräsentiert das Alphabet doch selbst eine unendliche Geschichte. Es trägt alle möglichen Buchstabenpermutationen aus 26 Lettern in sich und stellt so eine schier unerschöpfliche Quelle der Textkombinatorik dar.
Die im Alphabet in eine kanonische Ordnung gebrachten Buchstaben können indessen mehr als das, was wir gemeinhin mit ihnen anstellen. Wir stecken sie in ein Korsett von Sinn, Logik und Kohärenz und begrenzen ihren Geltungsradius auf möglichst eindeutige Aussage-Konzepte. Für den Wortschatz, der unsere Alltags-Kommunikation reguliert, also auf Verständlichkeit ausgelegt ist und Fehlinterpretationen zu vermeiden trachtet, mag das opportun sein. Die Poesie erkundet hingegen in der Sprache gerade solche Areale, in denen jenseits semantischer Engführung neue, unbetretene Bedeutungsfelder aufscheinen. Das Nützlichkeitsdiktat zu unterlaufen, die Grenzen der auf Gemeinverständlichkeit ausgerichteten Kommunikation zu verschieben und Störungen in die geläufigen Sprachstrukturen einzubauen, gehört zu den Antriebskräften poetischer Textarbeit. Wer literarisches Neuland betreten und den Atlas der Sprache erweitern will, muss sein Werk für verschiedene Lesarten offenhalten.
Dem Buchstaben-Universum kommt das entgegen. Denn es ist durch seine unendlichen Kombinationsmöglichkeiten viel weiter ausgedehnt als die durch Konventionen oder festgemauerte Regeln abgesteckten Sinnreservate. Ebenso wie unsere Buchstaben als abstrakte Zeichen die frappante Eigenschaft in sich tragen, komplexe und kohärente Botschaften zu übermitteln, führen sie auch das Potenzial mit sich, Doppelsinn, Unsinn, Nonsens oder Salat zu produzieren. In der experimentellen Dichtung, die sich als Spiel versteht, finden die Buchstaben einen Freiraum, in dem Konstellationen, die aus der Reihe tanzen, poetische Gestalt annehmen und literarisch produktiv werden können. Man muss nur das Anagramm befragen. Chaos / Ach so.
Siehe Code| Gedicht| Würfel
In seiner Erzählung Das Sandbuch aus dem Jahre 1975 berichtet Jorge Luis Borges von einem bibliophilen Leser, der sich über einen Tauschhandel in den Besitz eines geheimnisvollen Buches bringt. Ist der so erworbene Band zunächst ein Objekt größter Leidenschaft, weiß sich sein Besitzer bald nicht mehr anders zu helfen, als das Werk und mit ihm die monströse Herausforderung, die es darstellt, möglichst schnell wieder loszuwerden. Borges erzählt von einem unendlichen Buch, das jedes Mal, wenn man es aufschlägt, ein anderes Repertoire an Texten bereithält. So wenig der Sand der Wüste einen Anfang und ein Ende hat, so gering mithin die Chance wäre, auf ein einzelnes Sandkorn ein zweites Mal zu stoßen, so unmöglich ist es, auch in diesem Buch noch einmal auf denselben Text zu treffen. »Dieses Buch hat nämlich eine unendliche Zahl von Seiten. Keine ist die erste, keine die letzte.«
Schließlich kapitulierte der passionierte Büchernarr vor jenem Band, der ihn anfänglich so in den Bann gezogen hatte, dass er dem fliegenden Händler, von dem er ihn erhielt, seine kostbarste Bibelausgabe überließ. Das unergründliche Buchstabenuniversum hat ihn zu einem Gefangenen des Textes gemacht. Also beschließt er, das Sandbuch ebenso fachgerecht wie unauffällig zu entsorgen. Dabei kommt ihm die Erinnerung an eine Textpassage gelegen, wonach das beste Versteck »für ein Blatt der Wald ist«. Ohne zu zögern trägt er das Buch in die Nationalbibliothek, in der er bis zu seiner Pensionierung gearbeitet hat, und deponiert es an einem wenig frequentierten Ort im Keller. Hier im Tempel der Buchkultur, auf dem Altar des Wissens, wo der Traum vom absoluten Buch begonnen hat, soll auch das unendliche Buch, das keiner mehr lesen, keiner mehr bewältigen kann, seine letzte Ruhestätte finden. Mit dieser ironischen Wende entlässt Borges die Leser aus seiner Geschichte. Nicht ohne allerdings seinem Protagonisten die Beteuerung in den Mund zu legen, nie wieder die Straße zu betreten, in der sich das Bibliotheksgebäude befindet.
1975 – im Erscheinungsjahr dieser Erzählung – zeichnete sich die neue Ära der digitalen Medien und mit ihr das allgegenwärtige Aufscheinen der Buchstaben auf Bildschirmen bereits ab. Ob der Seher Borges bei der Konstruktion seiner Erzählung an das Internet als ubiquitäre Textmaschine gedacht hat? Der Künstler Micha Ullman, der die Installation zum Gedenken an die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 in Berlin gestaltet hat, ließ sich von Borges’ Erzählung zu einem Zyklus mit dem Titel Sandbuch I–V anregen. Dort sieht man eine Reihe von rechteckigen Gegenständen, die in Größe und Form an aufgeschlagene, zugeklappte oder einfach nur daliegende Bücher erinnern. Die schweren Einbände sind aus rotem Stahl; dazwischen, wo sonst die Seiten sind, nichts als Sand, flüchtig und unendlich wie der Sahara-Staub. Diese Bücher enthalten keinen Text, keine Buchstaben, keinen Anfang und kein Ende. Alles ist in den Sand geschrieben.
Vorläufer dessen, was wir heute als Buch kennen, waren die Papyrusrollen der Ägypter, die bis ins dritte Jahrtausend v. Chr. zurückreichen. Papyrus war im Pharaonenreich der beliebteste Trägerstoff für Piktogramme, Schriftzeichen oder Bemalungen und wurde, wie der Sprachforscher Harald Haarmann in seiner Geschichte der Schrift berichtet, noch bis ins 11. Jahrhundert von der päpstlichen Kanzlei in Rom für Urkunden verwendet. Das deutsche Wort »Buch«, mittelhochdeutsch buoch, hat seinen Ursprung in dem gleichnamigen Baum. Zuerst war die Buche, dann kam das Buch. In die glatte Oberfläche von Baumrinde, die sie zu kleinen Tafeln formten, ritzten die Germanen ihre Mitteilungen in Form von Runen. Auch die Römer beschrifteten Holz und Rinde. In dem lateinischen Wort caudex für Spross oder Stamm, von dem sich das Wort »Codex« herleitet, scheint die Herkunft des Holzes als Träger für Inskriptionen noch auf. In der Spätantike setzten sich von Holztafeln blockweise zusammengehaltene Papyrusblätter gegenüber der Schriftrolle endgültig durch. Als an die Stelle der meist gefalteten Papyrusblätter geheftete Seiten aus Pergament traten, wurde es möglich, durch den Text zu blättern, wichtige Stellen schneller wiederzufinden und zu markieren. Diese Eigenschaft war besonders beim philologischen Studium der heiligen Schriften von Vorteil.
Ein Text war in der Frühzeit der Schrift überhaupt viel weniger determiniert und konsistent, als es unser heutiges Verständnis nahelegt. Ein Beispiel bilden die Runentafeln der Germanen, die nicht nur der Sicherung oder Weitergabe von Informationen dienten, sondern auch zur Weissagung herangezogen wurden. Die Runen spielten Schicksal. Und das buchstäblich. Denn neben den kultischen Täfelchen wurden auch Buchen-Stäbe (gotisch boka), ähnlich wie später die Tarot-Karten, für Voraussagen oder Verheißungen konsultiert. Die germanische Buchstaben-Kunst hatte also neben ihrer pragmatischen auch eine spekulative Seite. Da kam es auf die Interpretation der Zeichen an, auf den Kontext und unterschiedliche Lesarten, weniger auf das monokausale Verstehen einer Mitteilung. Das Verständnis von Texten war nicht kanonisch oder dogmatisch, sondern situativ und verhandelbar. Letternkonfusion / in Not funkelt Rose
So bildete der Buchstaben-Kosmos in der germanischen Schriftkultur ein Arsenal mehrdeutiger Zeichen aus. Diese wollten entziffert und auch in dem, was zwischen den Zeilen stand, erfasst werden. Den Runentafeln der Germanen liegt noch kein Textverständnis zugrunde, wie es sich mit der Erfindung des Buchdrucks entwickelt hat. Erst aus einer Schriftkultur, in die sich die Geltung und die Autorität gedruckter Buchstaben eingeprägt haben, kann eine Aussage wie die aus Fausts Studierzimmer kommen: »Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen.«