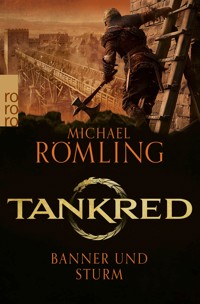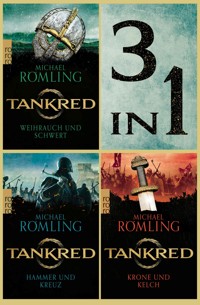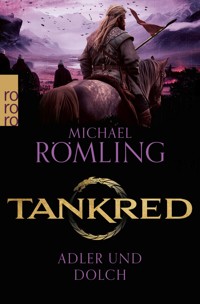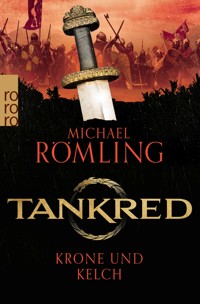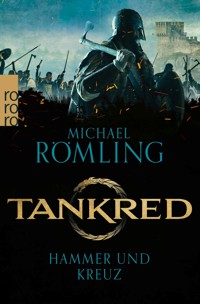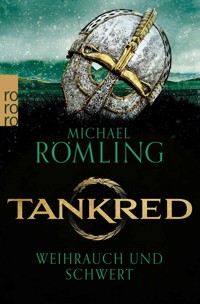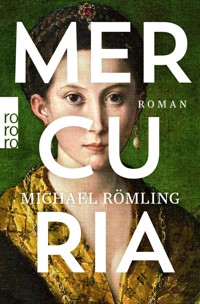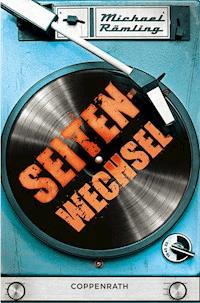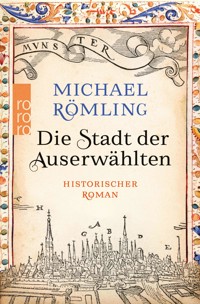
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Wiedertäufer in Münster: Sie wollen Freiheit und Gerechtigkeit, doch sie bringen Gewalt, Willkür und Terror. Der große historische Roman über eine Idee und ihre Wirklichkeit – und über einen Mann und eine Frau zwischen den Fronten. Der Roman des mit dem Goldenen Homer ausgezeichneten Autors erscheint zum 500-jährigen Jubiläum der Täuferbewegung. 1534: Die Bewegung der Täufer wächst von Tag zu Tag. Ihre Ideen von einer neuen religiösen Gemeinschaft, die Gerechtigkeit und Freiheit von den Zwängen der etablierten Kirche verspricht, ziehen viele an, die an den unruhigen Zeiten verzweifeln. Maria, die Schwester des Kaisers, bekämpft die Bewegung mit aller Macht. Eines Tages erteilt sie ihrem Leibwächter Jakob einen brisanten Auftrag: Er soll ein Mädchen aufspüren, das sich der Glaubensgemeinschaft angeschlossen hat. Jakob folgt ihrer Spur nach Münster, wo die Täufer unter der Führung ihres Propheten Matthys das Jüngste Gericht erwarten. Jakob gibt sich als Anhänger aus und kommt bei dem Schmied Andreas unter, einem Mitglied der Gemeinde. Während Matthys ein Terrorregime errichtet und der Bischof die Stadt belagert, verliebt sich Jakob in Katharina, die Schwester von Andreas, die an der Bewegung zweifelt. Als er erfährt, wer das gesuchte Mädchen wirklich ist, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Kann er sie retten, bevor die Täufer von ihrer Identität erfahren? Und kann Katharina den verblendeten Bruder zur Umkehr bewegen, bevor in der Stadt ein Blutbad angerichtet wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 724
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michael Römling
Die Stadt der Auserwählten
Historischer Roman
Über dieses Buch
Die Wiedertäufer in Münster: Sie wollen Freiheit und bringen Gewalt und Willkür.
1534: Maria, die Schwester des Kaisers, erteilt ihrem Leibwächter einen brisanten Auftrag: Jakob soll Ernestine aufspüren, ein Mädchen aus adliger Familie, das sich der Bewegung der Wiedertäufer angeschlossen hat. Die Spur führt ihn nach Münster, wo die Täufer das Jüngste Gericht erwarten. Er kommt bei einem Schmied unter, einem Mitglied der Gemeinde. Während Täuferanführer Matthys eine Schreckensherrschaft errichtet und der Bischof die Stadt belagert, verliebt sich Jakob in Katharina, die Schwester des Schmieds. Als er erfährt, wer Ernestine wirklich ist, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Kann er sie retten, bevor die neuen Herrscher der Stadt von ihrer Identität erfahren? Und kann Katharina den Bruder zur Umkehr bewegen, bevor in der Stadt ein Blutbad angerichtet wird?
Der große historische Roman über die dramatische Zeit der Täufer in Münster.
Vita
Michael Römling, geboren 1973 in Soest, studierte Geschichte in Göttingen, Besançon und Rom, wo er acht Jahre lang lebte. Nach der Promotion gründete er einen Buchverlag und schrieb zahlreiche stadtgeschichtliche Werke und historische Romane (u.a. «Pandolfo» und «Mercuria»). Die ersten drei Bände der historischen Romanserie um den Kämpfer und Gelehrten Tankred wurden 2024 mit dem Goldenen Homer ausgezeichnet.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright © 2025 by Michael Römling
Redaktion Tobias Schumacher-Hernández
Karte @ Peter Palm, Berlin
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg
Coverabbildung fine art images/Interfoto; akg-images; Shutterstock
ISBN 978-3-644-02143-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
März 1534
Katharina hatte sich überwinden müssen, an diesem Tag auf den Domplatz zu gehen. Ganz Münster war auf den Beinen, um der Musterung beizuwohnen, zu der die Führer der Wiedertäufer gerufen hatten, um die Streiter Gottes durchzuzählen, zu bewaffnen und auf den Kampf einzuschwören. Diese Männer würden die Stadt der Auserwählten gegen das Belagerungsheer des Bischofs verteidigen, das jenseits der Mauern Straßensperren aufbaute, Gräben aushob, Palisaden errichtete und Kanonen in Stellung brachte.
Um die zweitausend mochten es sein, die sich an diesem sonnigen Märztag vor der Kathedrale versammelt hatten. Sie waren in der Unterzahl, aber sie hatten Mauern, Türme, Bastionen und Gräben, die die Belagerer auf Abstand hielten. Vor allem aber hatten sie ihren Glauben und ihren Propheten: Jan Matthys, den riesigen Holländer mit der Donnerstimme, der ihnen einredete, dass sie nur noch vier Wochen lang würden standhalten müssen, bis das Jüngste Gericht über die Welt hereinbrechen und alle Gottlosen vernichten würde.
Die Frühlingssonne strahlte die Flanke der Kathedrale an, das Hauptschiff und den südlichen Kreuzarm, das Paradies mit dem von Maßwerkfenstern eingerahmten Portal und vor allem das Gerüst mit der Bühne, das davor aufgebaut worden war. Die anderen drei Seiten des Platzes wurden von den ummauerten Anwesen der adligen Domherren gesäumt, die die Stadt längst verlassen hatten und jetzt auf der Seite der Belagerer ihre Gefolgsleute sammelten.
Die Stimmung auf dem Platz war heiter und gelassen, und Katharina fragte sich, woher diese Menschen eigentlich ihre Sorglosigkeit nahmen. Das Jüngste Gericht war schließlich nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen konnte, selbst wenn man daran glaubte wie ihr Bruder Andreas – dafür hatten Matthys und seine Prediger sie viel zu sehr eingeschüchtert mit ihren Drohungen und Ankündigungen von Verdammnis und Höllenfeuer für alle, die nicht ausreichend Buße getan hatten. Niemand konnte sicher sein, zu den Auserwählten zu gehören, selbst wenn er sich aus Überzeugung hatte taufen lassen und nicht unter Zwang, so wie Katharina. Wer damit nichts anfangen konnte, war an diesem Tag gleich zu Hause geblieben. Aber Katharina hatte sich durchgerungen, auf den Platz zu kommen, weil es ihr keine Ruhe ließ, dass ihr eigener Bruder jetzt auf der anderen Seite stand. Sie musste ein Auge auf ihn haben. Sie war schließlich die Ältere.
Andreas. Da stand er, halb verdeckt von den waffenstarrenden Reihen, die vor ihm Aufstellung genommen hatten, ergriffen und voller Erwartung, stolz, einer von denen zu sein, die in das kommende Reich Gottes eingehen würden. Katharina hatte sich links von der Bühne unter die Zuschauer gemischt, die den Platz säumten. Es waren vor allem Frauen, von denen die Stadt voll war, seit die Wiedertäufer ihre Anhänger hier zusammengerufen hatten. Frauen aus Holland, Friesland und Westfalen vor allem, aber auch ein paar Einheimische, deren Männer jetzt mit ihren geschulterten Waffen kompanieweise angetreten waren. Einige hatten ihre Kinder mitgebracht. Jungen balgten sich am Rand der Versammlung und spielten mit Stöcken Soldaten. Ihre Mütter riefen sie zur Ordnung.
Rechts und links der Bühne standen Wagen aufgereiht, bis oben vollgepackt mit Arkebusen, Schwertern, Hellebarden, Piken, Helmen und Harnischen, die an alle verteilt werden sollten, die keine eigene Ausrüstung hatten.
Sie wollte nicht, dass Andreas sie sah, deshalb hielt sie Abstand. Er wusste, wie sie dachte, aber er hoffte, dass sie auch noch auf den rechten Weg finden würde, bevor es zu spät war.
Nachdem die Männer sich kompanieweise nach der Ordnung der Stadttore aufgestellt hatten, hatte Bernd Knipperdolling, der fette Bürgermeister, dessen Bauch unter dem Harnisch hervorquoll, eine Ansprache gehalten, um die Versammelten in Stimmung zu bringen. Er hatte die Gegner als eine Bande von Hurenböcken verspottet, die für Geld und irdisches Vergnügen kämpften und schon allein deshalb unterliegen mussten. Dann hatte Matthys übernommen. Jetzt redete also der Prophet, nachdem er sich eine Weile in theatralischem Schweigen gesammelt hatte. Die Sonne strahlte ihm genau in das vom schwarzen Bart umwucherte Gesicht, die langen Haare hatte er nach hinten gestrichen, sodass sie ihm über die Schultern fielen.
Um Katharina herum war es still geworden. Sogar die Kinder hatten mit dem Herumtoben aufgehört.
Matthys zitierte wie üblich ein paar Bibelstellen, dann brüllte er los: «Denn unser Kampf ist ein Kampf der Gerechtigkeit gegen das Unrecht. In dieser Stadt regiert die Frömmigkeit, jenseits ihrer Mauern die Gottlosigkeit! Hier der Verstand, dort die Einfalt! Hier die Bescheidenheit, dort die Prahlerei! Hier die Enthaltsamkeit, dort die Unzucht!»
Plötzlich lachte jemand. Es war wie bei einem Theaterstück, bei dem ein neuer Charakter auftritt, der dem Geschehen eine andere Wendung gibt und noch aus der Kulisse heraus seine ersten Sätze deklamiert.
Alle reckten die Hälse.
Wieder das Lachen. Länger, lauter, höher, fast kreischend.
«Enthaltsamkeit? Du?»
Eine Gestalt hatte sich aus der Menge gelöst. Katharina kannte den Kerl. Es war der Schmied Hubert Rüscher, der Geselle von einem der Meister aus der Gilde ihres Bruders, einer, der immer Ärger machte. Er schwankte. Offenbar war er völlig betrunken.
«Hör auf, Hubert!», schrie jemand.
Aber der dachte gar nicht daran.
«Bescheidenheit? Du?» Er stolperte ein paar Schritte vor und zeigte auf den Propheten. «Was soll an diesem ganzen Mummenschanz denn bescheiden sein? Und was ist enthaltsam an dem, was ihr da jeden Abend mit euren Flittchen im Badehaus treibt, du und deine Freunde?» Er kreischte noch etwas, was sie nicht verstand, dann krümmte er sich vor Lachen und wandte sich an die Versammelten. «Merkt ihr’s nicht, wie diese Holländer euch bescheißen?»
Die Bestürzung über den peinlichen Auftritt hatte alle gelähmt, doch der Prophet, der die ersten Sätze noch mit unbewegter Miene angehört hatte, gab jetzt ein kurzes Handzeichen. Zwei Bewaffnete, die neben dem Gerüst gestanden hatten, traten vor, packten den betrunkenen Schmied, zerrten ihn hoch und rissen ihm den Kopf nach hinten, sodass er würgend zum Himmel starrte, als wollten sie ihm zeigen, gegen wen er sich da gerade versündigte.
Matthys sprang von der Bühne, baute sich vor Rüscher auf und packte ihn mit seiner Pranke am Kinn.
«Hört euch den Frevler an!», donnerte er.
Rüscher kicherte wieder. Er konnte offenbar nicht anders.
«Du glaubst, du beleidigst mich?», fragte Matthys. «Du beleidigst den Herrn! Du lästerst Gott!»
Er ließ seinen Blick über die Menge schweifen. «Was sagt die Heilige Schrift dazu? Weiß es jemand?»
Niemand gab Antwort, stattdessen kam Bewegung in die Bewaffneten. Hinrich Mollenhecke, der als Aldermann die Gilde der Schmiede führte, trat vor, griff aber noch nicht ein. Alle Blicke ruhten derweil auf dem Propheten.
«Wer den Namen des Herrn schmäht, wird mit dem Tod bestraft!», rief Matthys.
Rüscher spottete nicht mehr, er musste begriffen haben, dass es diesmal ernst war. Allerdings hätte er auch kaum verständlich reden können, denn die Finger des Propheten quetschten seinen Mund zusammen, sodass seine Lippen aussahen wie ein Hühnerhintern. Er stieß ein paar unverständliche Laute hervor. Diesmal klang es flehentlich.
«Gnade?», brüllte der Prophet. «Es gibt keine Gnade für einen wie dich! Die Rache ist mein, spricht der Herr!»
Katharina reckte den Hals und sah zu ihrem Bruder. Andreas war wie erstarrt, Mund und Augen standen weit offen.
Matthys schnippte hinter seinem Rücken mit den Fingern. Ein weiterer Wächter trat vor, er trug eine Hellebarde, und kaum war er herangekommen, da schleuderte der Prophet den Schmied von sich und entriss dem Wächter die Waffe. Rüscher ging zu Boden und landete auf dem Rücken. Er versuchte, auf die Beine zu kommen, schaffte es aber nicht.
Alle hielten den Atem an. Der Prophet drehte die Hellebarde um, sodass die Spitze nach unten zeigte. Holte aus. Stach zu.
1
Wenn man ein paar Jahre auf den italienischen Schlachtfeldern gedient hat, morgens gegen den Kugelhagel der Schweizer angerannt ist und mittags einer Walze aus französischen Panzerreitern standgehalten hat, nur um abends beim Lagerfeuer in eine Messerstecherei betrunkener Landsknechte zu geraten, dann ist man, so sollte man meinen, mit dem Tod so oft und auf so vielfältige Weise in Berührung gekommen, dass einen nichts mehr schreckt.
Und doch war Jakob van Heemskerk seinem eigenen Tod selten so nah gekommen wie an jenem Dezembermorgen des Jahres 1533 in einem friedlichen Wald südlich von Brüssel.
Jeder weiß, dass mit Schweinen in der Paarungszeit nicht gut Kirschen essen ist und dass ein verletzter Keiler kaum leichter aufzuhalten ist als ein französischer Panzerreiter. Aber diesen Keiler hatte Jakob schlicht und einfach nicht gesehen. Sein dreckverschmiertes Borstenkleid war im Unterholz nicht vom schwarzgrauen Waldboden zu unterscheiden gewesen.
Als der Keiler, aus dessen Flanke der Bolzen von Marias Jagdarmbrust ragte, plötzlich losstürmte, hatte Jakob nicht mehr die Zeit, sein Pferd herumzureißen.
Wie ein Rammbock traf der Schweinekopf das linke Vorderbein des Hengstes; das Tier knickte ein, stürzte, warf Jakob aus dem Sattel, sprang wieder auf und floh. Das wütende Grunzen des Keilers mischte sich unter das panische Wiehern des Pferdes, Jakob rollte sich ab, wollte wieder auf die Beine kommen, aber da war das Vieh schon bei ihm, rammte ihm die Hauer in den Oberschenkel und riss den Kopf hoch. Jakob sah zwei glänzende Augenperlen in einem Gestrüpp aus erdverkrusteten Borsten, darunter nichts als Muskeln, dann reißender Stoff, ein Blitz aus Schmerzen, spritzendes Blut und das zentnerschwere Gewicht auf Jakobs Brust, stinkender Atem, Huftritte wie Hammerschläge, Röcheln, Schnaufen und zwei wirbelnde Elfenbeinklingen, die sich auf dem Weg zu Jakobs Hals für einen Augenblick in einer Schnalle seiner Jacke verhakten.
Dieser Umstand war es, der ihm das Leben rettete.
Ein Jagdspeer zischte heran und traf.
Der Keiler stieß ein fürchterliches Geräusch zwischen Quieken und Brüllen aus, wurde zur Seite gerissen, überschlug sich, zuckte, krampfte und lag dann still. Irgendwo in der Ferne bellten die Hunde. Ein Hornsignal erklang.
Jakob setzte sich auf. Unter den Fetzen der Hose sah er eine lange Fleischwunde, die im Takt seines Herzschlags von kleinen Blutschwällen durchpulst wurde. Säubern, dachte er mechanisch. Mit Kräutersud auswaschen, nähen, verbinden, hochlegen.
Das Schmatzen von Pferdehufen auf dem aufgeweichten Waldboden näherte sich.
«Muss nicht amputiert werden, oder?», fragte Maria.
So redeten Soldaten. Antonio de Leyva hatte so geredet, wenn sie nach einem Gefecht zwischen den Toten herumgestapft waren und einen Verwundeten angetroffen hatten, dem nicht gleich das halbe Bein oder der ganze Arm weggeschossen worden war. Königinnen redeten nicht so. Sie konversierten und musizierten, anstatt zu jagen und zu schießen, und wenn sie ritten, dann nicht im Herrensitz.
Bis auf diese hier, die zwar nicht aussah wie eine und auch keinen Thron mehr hatte, aber immer noch den Titel trug, weil sie vor Jahren Königin von Ungarn gewesen war. Die Haare hatte sie unter einer Wollkappe zusammengesteckt, und in der Lederkleidung, die Armbrust lässig auf dem Knie abgestützt, hätte sie auf den ersten Blick auch für einen Mann gehalten werden können. Eine Schönheit war sie weiß Gott nicht mit dem ausladenden Kinn, den hervortretenden Augen und den grauen Zähnen, die sie älter aussehen ließen, als sie war. In ihren achtundzwanzig Jahren hatte sie mehr erlebt als andere in achtundachtzig, und in den zwei Jahren, die Jakob nun in ihren Diensten stand, hatte sie ihm ihr ganzes Leben erzählt: mit neun Jahren nach Wien, mit elf nach Innsbruck, mit sechzehn als Braut des ungarischen Königs nach Buda, bis das Land von den Türken überrannt wurde; mit einundzwanzig zurück nach Österreich, der Ehemann auf der Flucht ertrunken, das Reich verloren; mit fünfundzwanzig als Statthalterin der Niederlande nach Brüssel, im Auftrag des Kaisers, ihres Bruders Karl, des mächtigsten Mannes der christlichen Welt.
Maria schwang sich vom Pferd.
«Wer ist hier eigentlich wessen Leibwächter?»
Sie kniete sich neben Jakob in den Schlamm und besah sich die Wunde. Das Kläffen der Hunde wurde lauter. Die Meute wirbelte heran und scharte sich hechelnd, schnuppernd und bellend um den Kadaver. Weitere Reiter näherten sich, der Marschall, der Oberjäger und ein paar Herren und Damen der Jagdgesellschaft, die wie immer nicht hinterhergekommen waren, bleiche Gesichter im Morgennebel, Atemwolken.
Mit einem Pfiff rief Maria die wimmelnden Hunde zur Ordnung, dann begutachtete sie den Keiler. «Dich pökeln wir ein», sagte sie zu dem Kadaver.
Und zum Marschall: «Sorg dafür, dass das Pferd wieder eingefangen wird.»
Und zum Oberjäger: «Lass das Stück nicht hier im Wald ausbluten, das lockt nur die Wölfe an.»
Und zu Jakob: «Giscard flickt das wieder zusammen.»
Das war die Reihenfolge, in der die Statthalterin der Niederlande ihre Aufmerksamkeit und ihre Zuwendung verteilte: zuerst die Tiere, dann die Menschen. Zuerst die Toten, dann die Lebendigen.
Die Wunde entzündete sich nicht, Jakob bekam noch nicht einmal Fieber. Schon am selben Abend saß er mit der Frau, für deren Sicherheit er verantwortlich war, vor dem Kamin. Von draußen drangen die Rufe der Bediensteten herein, die die Sperrstunde verkündeten und die letzten Besucher aus dem Palast komplimentierten.
Sie saßen auf Lehnstühlen, deren golddurchwirkte Brokatbespannung im Feuerschein schimmerte. Jakobs Bein ruhte auf einem Schemel. Der Burgunderwein machte die Schmerzen erträglich.
An den Wänden hingen die Porträts der Familie aufgereiht, vor jedem Rahmen eine Kerze, grauschwarz für die Verstorbenen, wachsgelb für die Lebenden: Marias Vater Philipp, den sie nie kennengelernt hatte, ihre Mutter Johanna, die umnachtet in Spanien vor sich hin vegetierte, dann die Tanten und Onkel, die Geschwister, Neffen und Nichten. Kaiser, Könige, Herzöge; Hermelinborten, Ordensketten, Reichsäpfel, Agraffen, Siegelringe, Diamanten, ins Bild ragende Schwertgriffe, von spinnendünnen Fingern umklammerte Gebetbücher.
Maria trug Schwarz, wie immer, wenn sie nicht im Sattel saß. Auf ihrer Brust glänzte an einer Kette das goldene Herz, das man vor sieben Jahren bei der Leiche ihres Mannes gefunden hatte.
«Es ist beschlossen», sagte Maria. «Christina wird im Frühling nach Mailand abreisen.»
Christina war ihre Nichte. Maria hing an dem Kind, als wäre es ihre eigene Tochter, wahrscheinlich erkannte sie sich selbst in dem Mädchen wieder. Christina ritt wie der Teufel, sie verstand, den Jagdbogen in vollem Galopp zu handhaben, konnte Hunde abrichten und wusste, wann man dem Falken die Haube abnahm. Aber der Kaiser, der die Mitglieder seiner Familie wie Schachfiguren auf dem europäischen Brett hin und her schob, hatte sie mit dem Herzog von Mailand verheiratet, damit Francesco Sforza sich nicht noch einmal mit den Franzosen verbündete.
Der Gedanke an Mailand genügte, um Jakob in eine ebenso düstere Stimmung zu versetzen wie Maria.
«Haben Sie diesen Sforza eigentlich mal kennengelernt?», fragte sie.
Jakob mochte die höfliche Anrede. Sie brachte Respekt und Achtung zum Ausdruck und gerade angesichts ihres Rangunterschiedes eine Vertraulichkeit, die Maria sich sonst niemandem gegenüber erlaubte.
«Nein», sagte Jakob. «Nur seine Kugeln.»
Maria schluckte. «Das Mädchen ist zwölf. Wenn er …»
«Das wird er nicht. Es heißt, er ist ein Mann mit Anstand.»
Maria warf Jakob einen ungehaltenen Blick zu, nicht weil es ihm nicht zustand, sie zu unterbrechen, sondern weil sie den Gedanken aussprechen wollte, der sie umtrieb.
«Wenn er versucht, sie zu schwängern, könnte sie daran sterben.»
«Er kann gar nicht. Er ist halb gelähmt.»
«Er braucht einen Erben.»
«Aber Ihr Bruder will nicht, dass er einen bekommt. Wenn Sforza ohne Nachkommen stirbt, wird Mailand eingezogen. Das ist es, was Ihr Bruder will. Wahrscheinlich hat er ihm verboten, sie anzurühren. Er wird es nicht wagen.»
«Dafür, dass Sie nur seine Kugeln kennen, wissen Sie ja gut Bescheid», sagte sie spöttisch.
Mailand. Jakob versuchte die Erinnerungen beiseitezuschieben, aber es gelang ihm nicht. Nach der Schlacht von Pavia hatten sie Sforza aus Mailand vertrieben, die Stadt besetzt und sich mit Einquartierungen und Abgabenforderungen unbeliebt gemacht. Es hatte einen Aufstand gegeben, doch Antonio de Leyva, der Gouverneur, war kein Mann, der den Kopf einzog, wenn er mit Steinen beworfen wurde. Er hatte eine Eskorte zusammengestellt und war zum Kastellplatz geritten, um die aufgebrachten Leute auseinanderzutreiben, aber auf einmal waren sie aus sämtlichen Seitenstraßen auf sie zugestürmt. Von Dächern und Balkonen hatte es Steine gehagelt. Sie hatten in die Menge gefeuert. Auch Jakob hatte geschossen, ohne richtig zu sehen, wohin.
Die Leute waren zurückgewichen.
Der Pulverdampf hatte sich verzogen.
Und dann hatte da dieses Mädchen gelegen.
Das Kleid zerfetzt von der Arkebusenkugel. Überall Blut.
Sie mochte drei oder vier Jahre alt gewesen sein, wie seine Tochter Elske.
Was für ein Schwachkopf musste man sein, dass man ein kleines Kind mitschleppte, wenn man sich mit Antonio de Leyva und seiner schießwütigen Eskorte anlegte?
Am nächsten Tag hatte er der Stadt den Rücken gekehrt und war nach Norden aufgebrochen, verwirrt, verzweifelt, voller Schuldgefühle und erfüllt von der Gewissheit, dass er derjenige gewesen war, der dieses kleine Leben ausgelöscht hatte. Tausende von Toten hatte er gesehen, aber das Bild dieses einen Kindes in seinem Blut hatte den Panzer seiner Abgestumpftheit gesprengt wie eine Pulverladung.
Auf dem Weg waren ihm Landsknechte entgegengekommen, Tausende, Kompanie auf Kompanie, lachend, singend, polierte Harnische, wippende Federbarette, geschlitzte Pluderhosen, geschulterte Spieße, Trossfuhrwerke voller Fässer, achtspännig gezogene Kanonen, Marketenderwagen, mit schepperndem Geschirr behängt. Sie konnten es gar nicht abwarten, in den Krieg zu ziehen, der dort unten schon wieder in die nächste Runde ging.
Jakob schwor sich, dieses Land nie wieder zu betreten. Er wollte nach Hause, zu seiner Frau und seiner Tochter. Und dann weitersehen. Vielleicht doch das Geschäft seines verstorbenen Vaters in Amsterdam übernehmen? Im Nachhinein konnte er es nur als die dümmste Entscheidung seines Lebens bezeichnen, nach der Geburt von Elske noch einmal aufgebrochen zu sein, aber wenn man dieses Leben jahrelang geführt hat, dann kann man schlecht davon lassen, fühlt sich gegängelt und eingesperrt, verachtet die engstirnige Geschäftigkeit der Bürger und ihr pikiertes Erschauern vor nackter Gewalt, weiß den Wert eines eigenen Hauses nicht zu schätzen. Und mit seiner Frau war es auch nicht immer einfach gewesen.
Doch als er an einem Herbstabend zwei Monate nach seinem Aufbruch in Mailand vor seiner Haustür stand und niemand ihm öffnete, als er dann von den Nachbarn erfuhr, dass die einzigen beiden Menschen, die er liebte, an einer aus England herübergeschwappten Fieberseuche gestorben waren, da war ihm, als stürzte er in ein riesiges Loch, und auf dem Grund dieses Lochs lagen das Mädchen aus Mailand und seine Tochter nebeneinander und warteten, dass er sich dazulegte.
Er war überzeugt, dass der Tod von Frau und Tochter eine Strafe Gottes war. Nachdem er sich monatelang Tag für Tag bis zur Besinnungslosigkeit betrunken hatte, glaubte er an gar nichts mehr. Eine Zeit lang hasste er Gott, aber nach und nach wurde Gott ihm gleichgültig. So oder so fand er nicht mehr zu ihm zurück.
Stattdessen traf er einen alten Bekannten aus Landsknechtszeiten wieder. Der Krieg in Italien war inzwischen vorbei, aber die neue Statthalterin in Brüssel brauchte einen Kommandeur für ihre Leibwache. Der Bekannte hatte gute Kontakte zum Hof, und als der Mann, der dem französischen König in der Schlacht von Pavia das Schwert abgenommen hatte, genoss Jakob immer noch einen gewissen Ruf. Für sein Verschwinden aus Mailand fand sich eine Erklärung.
So kam Jakob in Marias Dienste. Die Königin und der Söldner erkannten sich, wie Menschen einander erkennen, die das Leben ausgekostet und Verluste erlitten haben, denen alles entrissen wurde und die nicht mehr wissen, woran sie glauben sollen. Jakob wurde Marias Vertrauter, ihr Berater und ihr Freund. Und er träumte nicht mehr jede Nacht von toten Kindern.
«Mal was ganz anderes», sagte Maria. Draußen schlug die Turmuhr, und erst jetzt wurde Jakob klar, wie lange er schweigend dagesessen und dem Echo der Vergangenheit gelauscht hatte.
«Die Wiedertäufer in Holland werden schon wieder übermütig», fuhr sie fort. «Wenn wir nicht aufpassen, schwappt das nach Brabant rüber.»
«Ach ja?», fragte Jakob. Seitdem er sich von Gott abgewandt hatte, beschäftigte er sich überhaupt nicht mehr damit, was irgendwelche Schwärmer umtrieb. Nach dem Bauernkrieg waren diese Wiedertäufer plötzlich hier und da aufgetaucht, aber zu jener Zeit hatte er den französischen König in die Gefangenschaft nach Madrid begleitet, und danach war er schon bald wieder in Italien gewesen. Später hatte er aus Flugblättern von verschrobenen Sektierern erfahren, die sich in Straßburg und anderswo gesammelt hatten und in geheimen Zirkeln über Taufe und Abendmahl debattierten. Wenn man sie erwischte, jagte man sie fort, zwang sie zum Widerruf und richtete die Anführer hin, damit die anderen Ruhe gaben. Aber nach allem, was man so hörte, waren die Wiedertäufer letztlich friedliche Spinner. Sie leisteten keinen Widerstand und rührten keine Waffen an. Manchmal sangen sie sogar, wenn sie zu den Scheiterhaufen gekarrt wurden, und das war für ihre Verfolger ein größeres Ärgernis als ihre Lehren. Wenn Jakob sich richtig erinnerte, war dieser Straßburger Prophet vor ein paar Monaten verhaftet worden. Hoffmann oder so, den Vornamen hatte er vergessen.
Maria blickte ihn missbilligend an. «Ihr demonstratives Desinteresse in allen Ehren, aber diese Leute stiften Unruhe, und deshalb müssen wir uns mit ihnen beschäftigen. Es interessiert mich nicht, was sie hinter verschlossenen Türen treiben, aber neuerdings kommen sie wieder aus ihren Löchern, stören Messen und Prozessionen und machen die Sakramente lächerlich. Sie beschädigen Heiligenbilder und schänden Hostien. Sie verweigern die Taufe ihrer Kinder und taufen sich stattdessen gegenseitig.»
«Warum eigentlich?», fragte Jakob. Zu seinem eigenen Erstaunen hatte sie sein Interesse geweckt. Da forderte jemand die Kirche heraus, die von sich behauptete, den Gott zu vertreten, der ihn selbst so maßlos enttäuscht hatte.
«Weil sie der Ansicht sind, dass Buße und Einsicht die Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zur Gemeinde sind», antwortete Maria. «Sie berufen sich auf den Missionsbefehl im Matthäusevangelium. Gehet hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret und taufet. Einen Säugling kann man nichts lehren, also soll man ihn nach ihrer Ansicht auch nicht taufen. Die Theologen halten wiederum mit Markus dagegen: Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich.»
«Schwaches Argument», sagte Jakob, der, wohl auch angeregt durch den Loirewein, auf einmal Lust bekam, sich auf solche Gedankenspielereien einzulassen. «Wenn den Kindern das Himmelreich sicher ist, dann muss man sie auch nicht taufen.»
Maria blickte ihn säuerlich an. «Wie schön, dass Sie sich so schnell in die Logik dieser Leute hineindenken können. Aber Sie werden begreifen, dass wir uns auf solche Wortklaubereien nicht einlassen können. Diese Leute kennen die Heilige Schrift ziemlich gut. Nach ihrer Ansicht darf jeder sie auslegen, der sich dazu berufen fühlt. Einige meinen sogar, dass man die Bibel gar nicht mehr braucht, weil Gott sich ihnen in Visionen offenbart. Verstehen Sie, was das bedeutet? Wenn jeder herauskrakeelen darf, was er will, und wenn jeder überall beitreten kann, dann hat bald jede Stadt ihre eigene Sekte. Zuerst sprengen sie die Kirche und dann die staatliche Ordnung. Mit den Lutheranern können wir inzwischen umgehen, aber die Wiedertäufer erkennen gar keine Obrigkeit an. Sie leisten keine Eide und nehmen keine Waffe in die Hand.»
«Hat Jesus uns nicht genau das gelehrt?», fragte Jakob. «Dass man die Welt ohne Waffen verändern kann?» Er suchte in seiner Erinnerung nach einer passenden Bibelstelle, aber die Zeit, in der er Kirchen besucht und Predigten gelauscht hatte, war schon zu lange her.
Maria, die während ihrer Tirade erneut ins Feuer geblickt hatte, wandte sich ihm wieder zu, leicht irritiert diesmal, als wäre sie nicht sicher, ob er sie ernsthaft provozieren wollte oder nur sagte, was ihm gerade durch den Kopf ging. «Sie wollen es heute aber wissen, was?» Sie beugte sich vor und sah ihn kalt an. «Wir wollen doch gar nicht, dass die Welt verändert wird.»
Nein, dachte Jakob. Vor allem dein Bruder will das nicht.
«Und wissen Sie, was das Problem ist?», setzte Maria nach. «Die Wiedertäufer wollen sie auch nicht verändern, weil sie ihrer Ansicht nach ja ohnehin bald untergeht. Das behauptet jedenfalls dieser Melchior Hoffmann in Straßburg.»
Richtig, Melchior.
«Haben sie den nicht verhaftet?», fragte Jakob.
Maria lachte verächtlich auf. «Schon, aber sie haben ihm in den ersten Wochen eine Zelle mit einem Gitterfenster zur Straße gegeben, sodass er munter weiterpredigen und das Jüngste Gericht zum Ende dieses Jahres ankündigen konnte. Und draußen standen seine Jünger und plapperten es nach. Den Termin hat er mit Angaben aus der Bibel errechnet. Diese Leute haben für alles eine passende Bibelstelle parat. Merken Sie sich das schon mal.»
Diese letzte Bemerkung ließ in Jakobs Kopf eine kleine Glocke klingeln. Da kam noch etwas.
«So weit, so gut», sagte Maria und nahm einen Schluck Wein aus dem Glas, das sie die ganze Zeit über im Schoß gehalten hatte. «Der Termin für das Jüngste Gericht rückt also näher, und das meinte ich, als ich sagte, dass die Wiedertäufer wieder übermütig werden. In Amsterdam ist ein gewisser Jan Matthys aufgetaucht, ein Bäcker aus Haarlem, den wir vor ein paar Jahren schon mal am Wickel hatten, weil er die Realpräsenz bei der Eucharistie geleugnet hat. Das war, bevor mein Bruder die neuen Gesetze erlassen hat, deshalb wurde ihm nur die Zunge durchstochen, anstatt ihn gleich einen Kopf kürzer zu machen. Jetzt ist er wieder da. Ein Riese mit Zottelbart und Donnerstimme, einer, von dem alle sagen, man muss ihn erlebt haben. Er tauft wie verrückt, aber für ihn ist die Taufe kein Zeichen der Zugehörigkeit, sondern ein Akt der Versiegelung. Er sammelt die hundertvierundvierzigtausend Gerechten der Apokalypse für den Tag des Jüngsten Gerichts. Er macht die ganze Stadt irre und gefährdet die öffentliche Ordnung. Er schickt Sendboten durchs Land, die die Leute aufstacheln.»
Maria stellte ihr Glas auf das Tischchen, das zwischen ihnen stand.
«Und jetzt kommen Sie ins Spiel», sagte sie. «Sie müssen etwas für mich erledigen, sobald das Bein so weit geheilt ist, dass Sie wieder reiten können. Sie haben die Fähigkeiten dazu, Sie haben mein Vertrauen, und Sie kennen sich in Amsterdam aus.»
Was kommt denn nun, dachte Jakob. Seit er in Marias Diensten stand, war er nur selten von ihrer Seite gewichen.
Sie blickte zum Kamin, als spräche sie mit dem Feuer.
«Hoogstratens Tochter ist mit diesem Matthys durchgebrannt.»
«Ach du Scheiße», sagte Jakob sehr langsam und sehr leise.
Antoine de Lalaing, Graf von Hoogstraten, Ritter des Goldenen Vlieses, kaiserlicher Statthalter in Den Haag. Nach Maria der zweitmächtigste Mann in den Niederlanden, wie man scherzhaft zu sagen pflegte.
«Ich wusste gar nicht, dass Hoogstraten eine Tochter hat», sagte Jakob nach einer Weile.
«Jetzt wissen Sie’s. Holen Sie sie zurück.»
2
Andreas hatte gerade die Werkzeuge gereinigt und war dabei, alles wegzuräumen, als es vorn an der Tür klopfte. Bruno, der Geselle, hatte sich schon verdrückt und trieb sich wahrscheinlich in irgendwelchen Kneipen herum; die beiden Lehrlinge Ernst und Ludger, die eigentlich für das Aufräumen zuständig waren, hatten sich in ihre Kammer unter dem Dach verzogen. Denen würde er nachher ein paar hinter die Löffel geben müssen, wenn auch nur der Form halber, denn eigentlich blieb Andreas am Ende des Arbeitstages gern noch eine Weile ungestört in der Schmiede. Er mochte die Wärme der erlöschenden Esse, und er mochte sogar den Geruch nach Kohlenrauch, Eisen und Schlacke.
Es klopfte wieder, lauter und drängender. Eine Männerstimme rief etwas. Andreas löschte die Laterne, hängte die letzte Zange an das Brett über der Werkbank, nahm die Lederschürze ab, legte sie auf einen Schemel und verließ die Werkstatt.
Auf dem Korridor, der von der Werkstatt durch das Wohnhaus zur Eingangstür führte, empfing ihn der Duft von gebratenem Speck. Wenn er Glück hatte, machte Katharina selbst das Abendessen und nicht Elsa, die alles zerkochte und Petersilie nicht von Kerbel unterscheiden konnte.
Es rappelte an der Tür.
«Verdammt, mach auf!»
Das war die Stimme von seinem Freund Gisbert Boland, rau und ungehalten. Zum Plaudern war der wohl nicht gekommen.
Als Andreas öffnete, schwappte ihm eiskalte Dezemberluft entgegen. Ein Vorteil seines Berufs war, dass man bei der Arbeit nie fror. Ein Nachteil war, dass man die feuchte Münsteraner Kälte nicht mehr vertrug.
Gisbert war außer Atem. Er trug noch nicht einmal einen Mantel, offenbar hatte er alles stehen und liegen gelassen. Hinter ihm rannten ein paar Leute durch die Dunkelheit. Vom Hauptmarkt her drang Geschrei herüber.
«Komm rein», sagte Andreas und trat einen Schritt zurück.
«Keine Zeit. Du musst mitkommen. Rüscher dreht schon wieder durch.»
Andreas rührte sich nicht. Gisbert nieste, dass die Tropfen sprühten. Der erkältete sich immer sofort.
«Das ist ja nun nicht unser Problem», sagte Andreas. «Der soll einfach weniger saufen.»
Gisbert, grauer Bart, strubbelige Haare, ein Geäst von kleinen Falten auf den Wangen, zog ihn am Ärmel.
«Es wird aber unser Problem. Angeblich will der Rat ein paar Leute losschicken, die ihn einsperren sollen.»
Andreas schüttelte die Hand ab, er mochte es nicht, wenn man an ihm herumzerrte.
«Eine Nacht in der Zelle wird Rüscher nicht schaden.»
«Ohne Rücksprache mit den Alderleuten der Gilden? Wo kommen wir denn hin?»
«Ja, wo kommen wir denn hin», murmelte Andreas. Gisbert hatte leider recht. Hubert Rüscher war ein Schwachkopf und ein Unruhestifter, aber er war einer von ihnen, Geselle bei einem ihrer Gildebrüder, also konnten sie ihn nicht hängen lassen. Es gab Vereinbarungen und Gepflogenheiten, und eine davon besagte, dass der Rat ohne das Einverständnis der Gildevertreter niemanden verhaften durfte. Wenn man es den Herren einmal durchgehen ließ, konnte das ganz schnell zur Gewohnheit werden.
Andreas griff sich seine Jacke vom Haken neben der Tür und folgte Gisbert nach draußen. Kalter Wind wehte durch die Salzstraße. Erneut rannten Leute vorbei in Richtung Markt.
«Na dann», sagte Andreas und schloss die Tür hinter sich. Wieder nieste Gisbert.
Die Straße lag im letzten Dämmerlicht des Tages da. An den meisten Häusern waren die Läden geschlossen, aber da und dort drang Kerzenschein zwischen den Ritzen und durch die Oberlichter heraus.
Bis zum Markt waren es nur ein paar Hundert Schritte. Andreas rannte etwas unwillig hinter Gisbert her. Er sah es immer noch nicht so ganz ein, für Rüscher in die Bresche springen zu müssen, nur weil der sich wieder nicht im Griff hatte.
Rüschers Stimme war schon aus der Ferne zu erkennen, schrill und durchdringend, wie immer, wenn er besoffen war.
Sie erreichten den Markt. Die Treppengiebel der Kaufmannshäuser zeichneten sich vor dem schwarzgrauen Himmel ab wie ausgeschnitten. Rüscher war nicht zu übersehen, trotz der Dunkelheit: Offenbar hatte er ein Fass oder eine Kiste bestiegen, sodass er die Menge, die ihn umlagerte, deutlich überragte. Seine Jacke hatte er schief zugeknöpft, das Hemd hing heraus. In der einen Hand schwenkte er einen Bierkrug, in der anderen eine Laterne, die unstete Schatten auf sein Gesicht warf. Er war richtig in Fahrt.
«Und ich sah einen Acker voller toter Männer, verbrannt, erschlagen, erstochen! Und der Satan kam auf einem Ziegenbock über das Feld geritten, auf einem Ziegenbock mit goldenen Hörnern, und aus seinem Rücken wuchs eine riesige Kröte, die spuckte abwechselnd Feuer und Eis! Und als er zwischen den Leichen hindurchritt, da standen sie auf, als hingen sie an Fäden!»
Gisbert und Andreas drängten sich durch die Zuhörer zu Rüscher vor, der tatsächlich auf einem Fass stand und jetzt ein wildes Fauchen und Zischen ausstieß, wohl um die Geräusche der spuckenden Kröte nachzuahmen. Aus allen Richtungen kamen die Leute herbeigelaufen, Männer zumeist und auch ein paar Frauen, in der Dunkelheit kaum zu unterscheiden. Im schwankenden Laternenlicht sah Andreas in den Gesichtern vor allem Erheiterung, hier und da auch Besorgnis.
«Und wie machte der Ziegenbock?», schrie einer. Ein anderer begann zu meckern, ein paar Leute lachten laut.
Rüscher kniff die Augen zusammen und beugte sich in die Richtung, in der er den Zwischenrufer vermutete. Fast wäre er dabei von dem Fass gefallen. Bier schwappte aus dem Krug, dann fing er sich wieder, nahm einen tiefen Zug und grölte weiter: «Und die Tore der Stadt öffneten sich! Und ein Ungeheuer trat heraus, halb Mensch, halb Skorpion! Und vom Himmel senkte sich eine Krone herab auf sein Haupt!»
«Ist gut», sagte Gisbert. «Komm da runter!»
Rüscher wich zurück und fand gerade noch rechtzeitig das Gleichgewicht, sodass er nicht hintenüberfiel. «Und der Klang der Posaune schallte über das Feld!», rief er kichernd. «Und der Mond verfinsterte sich! Und vom Himmel hagelte es glühende Kohlen!»
«Schluss jetzt!», rief Gisbert und griff mit seiner mageren Hand nach Rüschers Knöchel.
«Lasst ihn doch reden!», rief einer. Ein paar Männer drängten Gisbert ab, Gerangel entstand, doch plötzlich ging ein Murmeln durch die Menge, und alle Köpfe wandten sich in die Richtung, in der das Rathaus lag. Nur einen Augenblick später bildete sich eine Gasse, durch die vier mit Hellebarden bewaffnete Stadtknechte stapften. Gisbert ließ von Rüscher ab, die Umstehenden ließen von Gisbert ab. Andreas hielt seinen Freund am Arm fest wie ein Kind, das nicht auf die Straße laufen soll.
«Und da sind ja auch schon unsere Büttel!», rief Rüscher den Bewaffneten angriffslustig entgegen. «Gesellt euch dazu und sperrt die Ohren auf! Hier wird Gottes Wort gepredigt, ungetrübt wie Gebirgswasser! Reinigend wie Feuer! Klar wie …» Er stockte kurz, suchte nach einem neuen Vergleich.
«Wie Eis!», schlug einer der Umstehenden vor.
«Klar wie Eis!», echote Rüscher. «Und so wahr wie die Heilige Schrift selbst!»
Andreas sah die nervösen Blicke, mit denen die Stadtknechte die Bereitschaft der Menge einzuschätzen versuchten, sich ihnen zu widersetzen. Rüscher hatte die Meute auf seiner Seite, und Krawall lag in der Luft. Entweder gingen sie schnell und entschlossen vor, oder sie machten sich lächerlich. Jedes Zögern verschlechterte ihre Chancen, die Sache gesichtswahrend zu Ende zu bringen.
«Runter da», sagte einer der Knechte scharf. «Deine Predigt ist zu Ende.»
Er war älter als die anderen und schien der Anführer des Trupps zu sein. Sein Bart war grau und ausladend.
Doch Rüscher dachte nicht daran. «So wahr wie die Heilige Schrift!», wiederholte er provozierend. «Und so köstlich wie frisch gezapftes Bier!» Und dann, lauter und an die Zuhörer gewandt: «Wollt ihr zulassen, dass ihre Priester euch das Bier mit dem Brackwasser ihrer Lehren verderben und den guten Wein selber saufen? Euch trockene Pappscheiben als Leib des Herrn zu fressen geben? Geld für sinnloses Gebrabbel kassieren?»
Erneute Zwischenrufe bestätigten, dass man das nicht zulassen wollte.
«Zum letzten Mal», sagte der Anführer. «Sofort runter da!»
Doch Rüscher hatte sich schon wieder zu voller Größe aufgerichtet und krakeelte weiter: «Wollt ihr zulassen, dass sie eure Kinder der Verdammnis anheimgeben? Gott wünscht nicht, dass Säuglinge getauft werden! Zerschlagt die Taufbecken! Und die Altäre und die Beichtstühle gleich mit!»
«Das reicht!», knurrte der Graubärtige, langte nach oben und bekam Rüscher am Gürtel zu fassen. Der warf sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen und brüllte: «Ich zeige euch jetzt mal, wie man tauft!» Mit diesen Worten kippte er sich den restlichen Inhalt des Bierkrugs über den Kopf.
Keine Sekunde später landete er auf dem Boden zwischen den Stadtknechten. Laterne und Bierkrug kullerten den Zuschauern vor die Füße.
Während zwei der Büttel mit den Schäften ihrer Waffen die Schaulustigen auseinanderschoben, packten die anderen beiden den zeternden Rüscher, zerrten ihn auf die Beine und schleppten ihn weg.
«Das dürft ihr nicht!», rief Gisbert.
Statt einer Antwort drehten die anderen beiden Knechte ihre Hellebarden um und richteten die eisernen Spitzen auf Gisbert, während sie sich rückwärtsgehend langsam entfernten. Andreas packte ihn am Arm. Keine Dummheiten jetzt.
«Das hat ein Nachspiel!», schrie Gisbert ihnen hinterher.
«Die fette Sau in Rom und die fette Sau in Wittenberg kommen beide aus der gleichen Suhle!», war Rüschers Stimme aus der Dunkelheit zu vernehmen.
Der Rest seiner Schimpftirade ging im aufgeregten Durcheinanderreden der Menge unter. Ein paar Leute schüttelten die Fäuste, aber eine Zusammenrottung blieb aus. Niemand nahm die Verfolgung auf. An den Häusern, die den Markt säumten, klappten immer mehr Fenster auf.
«Rüscher wieder?», rief jemand von oben.
«Wer sonst?», antwortete einer aus der Menge.
Gisbert war immer noch aufgebracht. «Die hätten uns das regeln lassen sollen», sagte er finster. «Das werden sie noch bereuen.»
«Wir sollten Hinrich Bescheid sagen», schlug Andreas vor. Hinrich Walraven war der Schmiedemeister, bei dem Hubert Rüscher beschäftigt war. Er hatte seine Werkstatt in der Hörster Straße, nur ein paar Minuten entfernt. Unterwegs würde Gisbert sich etwas beruhigen, und dann konnte man alles besprechen. Gisbert war ein Hitzkopf, und angesichts der angespannten Stimmung, die schon seit Wochen in der Stadt herrschte, war es ganz gut, dass jemand einen mäßigenden Einfluss auf ihn ausübte. Gisbert war ein paar Jahre älter als Andreas, aber er hörte auf ihn. Allerdings war auch Andreas klar, dass man dem Rat diesen Gewaltstreich nicht durchgehen lassen durfte.
Als sie bei Hinrich ankamen, war schon die halbe Schmiedegilde in seiner Werkstatt versammelt: Hermann Reinig, der Riese mit dem Zwirbelbart, die beiden fetten, immer zu Keilereien aufgelegten Potthoff-Brüder, Johann Hocke, der mit der Tochter eines Erbmannes verheiratet war und sich seitdem wie ein hoher Herr aufführte, Hermann Remeken, einäugig und bärenstark und darum Zyklop genannt, der Polterer Heinrich Steinkamp, die Lästerzunge Arnd Rotland und noch ein Dutzend andere, die sich im Schummerlicht einiger Kerzen zwischen Esse, Amboss und Werkbank drängten. Alle wussten schon Bescheid. Die Nachricht von Rüschers Verhaftung war schneller durch die Straßen geschwappt, als Andreas und Gisbert gelaufen waren.
Hinrich Walraven hatte ein Bierfass angestochen, was nicht dazu beitrug, dass die besonnenen Stimmen Gehör fanden. Dass Hubert Rüscher ein Idiot war, spielte keine Rolle. Es war, als wäre seine Verhaftung das Meisterstück, mit dem er zum vollwertigen Mitglied der Gilde geworden war.
«Wir holen ihn da raus!», rief Steinkamp.
«Das mit der Taufe hätte er sich sparen sollen», gab Hocke zu bedenken.
«Warum denn?», fragte Rotland aufreizend. «Nenn mir einen Grund …»
«Darum geht’s doch gar nicht», unterbrach ihn Remeken. «Rüscher ist einer von uns. Wir lassen uns das nicht bieten!»
Hinrich Walraven arbeitete sich mit zwei Bierkrügen zu Gisbert und Andreas durch, die noch in der Tür standen. Auch hier waberte der typische Schmiedegeruch durch die Luft, aber mit einer leichten Kupfernote. Andreas wunderte sich immer wieder darüber, dass jede Schmiede in der Stadt ein bisschen anders roch. Man hätte es zum Gegenstand einer Wette machen können, sie alle mit verbundenen Augen zu erschnuppern.
«Hier», sagte Walraven und reichte ihnen die Krüge. «Habt ihr’s schon mitbekommen?»
«Darum sind wir ja hier», sagte Andreas.
Die Tür öffnete sich, zwei weitere Schmiedemeister betraten die Werkstatt und wurden mit Gejohle begrüßt: Johann Balke, den sie wegen seines Stotterns Bababalke nannten, und Johann Schröder, das Großmaul mit den eng stehenden Augen.
Sie tranken. Gisbert grüßte hierhin und dorthin, Andreas erkannte weitere Gesichter. Alle wirkten aufgebracht und entschlossen. Sie brannten darauf, dem Rat einmal so richtig heimzuleuchten. Die Herren hatten sich in den vergangenen zwei Jahren zwischen alle Stühle gesetzt. Zuerst hatten sie die Einführung der lutherischen Lehre verschleppt, um den Bischof nicht gegen sich aufzubringen. Als die Gilden dann kurzerhand den Kaplan Bernhard Rothmann in die Stadt geholt hatten und dieser seine katholischen Gegner in Grund und Boden disputiert hatte, hatte der Rat notgedrungen die Wahl neuer Prediger durch die Gemeinde geduldet. Bald darauf hatten beide Bürgermeister sich davongestohlen. Bei der Ratswahl im vergangenen März hatten die Lutheraner zwar die Mehrheit gewonnen, bald darauf aber schon wieder vor den Theologen gekuscht, die Rothmanns neue Kirchenordnung verworfen hatten. Und als der im Sommer auch noch begonnen hatte, die Gottgefälligkeit der Kindertaufe anzuzweifeln, waren sie in Panik verfallen, hatten Pfarrer ausgewiesen und Predigtverbote ausgesprochen, diese aber nicht durchzusetzen gewagt. Stattdessen hatten sie zwei neue Prediger aus Hessen angefordert, deren Gottesdienste nun ständig durch Geschrei und Krawall gestört wurden, ohne dass der Rat etwas dagegen unternahm. Und um dieses peinliche Führungsversagen auszugleichen, hatte er nun einen Schmiedegesellen verhaftet, weil der ein bisschen herumgeschrien hatte. Ohne Rücksprache mit den Alderleuten, wohlgemerkt. Das war zu viel.
Nachdem alle eine Weile durcheinandergeredet und sich mit Verwünschungen gegen Rat und Bürgermeister gegenseitig übertroffen hatten, schnitt ein Pfiff durch die Werkstatt. Die Gespräche verstummten.
«Hört mal alle zu!», rief Reinig, aus dessen Zwirbelbart das Bier tropfte, über die Köpfe hinweg. «Ich schlage vor, wir klopfen jetzt mal beim Rathaus an.»
«Genau!», schrie Cord Potthoff, der weit hinten bei der Werkbank stand, griff sich einen Hammer und reckte ihn in die Luft. «Und zwar damit!»
Pfeifen und Beifall.
«Und wenn sie nicht aufmachen?», rief einer.
«Dann rammen wir die Tür auf!», grölte Hinrich Potthoff und wuchtete einen Amboss in die Luft. Dabei rutschte das Hemd hoch und gab seine riesige Wampe frei.
Wieder flogen zustimmende Kommentare und Pfiffe durch die Luft. Und obwohl Andreas kein Freund von großmäuligem Geschrei und unüberlegten Handlungen war, spürte er mit einem Mal einen unbändigen Stolz, zu diesen Männern zu gehören, die so kompromisslos füreinander einstanden. Die Gewissheit, dass sie für ihn jederzeit dasselbe tun würden, war erhebend.
«Dann trinkt mal aus und schnappt euch ein paar Werkzeuge!», rief Walraven.
Ein paar Minuten später stapfte die ganze Gruppe mit weit ausholenden Schritten, die Hämmer geschultert, die Kappen tief ins Gesicht gezogen, über den Markt. Dort standen noch immer ein paar kleinere Grüppchen herum, aber der größte Teil der Zuhörer von Rüschers Darbietung hatte sich verzogen. Das verwaiste Fass schien auf einen neuen Redner zu warten.
Als die Schmiede, angeführt von Walraven und Reinig, sich zum Rathaus wandten, schlossen sich ein paar Neugierige an, der schlichten Kleidung nach Dienstpersonal der Kaufleute, die hier ihre Häuser hatten. Die Herrschaften selbst hielten sich natürlich zurück.
Wieder erschienen Gesichter in den Fenstern. Am Ende war der Pulk auf etwa fünfzig Personen angeschwollen. Schräg gegenüber dem Michaelistor, das vom Markt auf den Domplatz führte, erhob sich die Fassade des Rathauses mit den Maßwerkgiebeln und Fialtürmen als Schattenriss vor dem tief stehenden Mond. Auch hier waren einige Fenster erleuchtet, aber die Türen unter dem Bogengang waren verschlossen. Rechts und links des Rathauses mündeten Gassen ein, gegenüber wurde der Platz von prachtvollen Kaufmannshäusern gesäumt. Treppengiebel reihten sich im Mondlicht aneinander wie eine Spitzenborte.
Andreas fragte sich, wo sie Rüscher wohl hingebracht hatten. Entweder er saß schon in einer der Arrestzellen im Keller, oder sie verhörten ihn gerade, wobei nicht zu erwarten war, dass viel dabei herauskommen würde, so betrunken wie der war.
«Rückt ihn raus!», schrie Reinig zu den Fenstern in den oberen Stockwerken hoch. «Sonst kommen wir rein und holen ihn!»
Eine Weile lärmten alle durcheinander, pfiffen, johlten, schwangen Hämmer und Zangen. Wieder klappten hier und da die Läden auf, wieder kamen ein paar Leute gelaufen, aber anders als bei Rüschers Predigt auf dem Markt hielten sie Abstand. Wenn der Rat bewaffnete Knechte auf die Straße schickte, um den Auflauf zu zerstreuen, wollte niemand im Weg stehen, so weit ging die Neugier dann doch nicht. Auch Andreas war nicht wohl bei dem Gedanken an einen Zusammenstoß mit den Bütteln des Rates, aber die Entschlossenheit der anderen war ansteckend.
Ein Fenster im oberen Stock des Rathauses klappte auf, und ein Mann erschien. Er trug ein ausladendes Barett.
«Das ist Jodefeld!», schrie Hinrich Potthoff. Ob es wirklich der Bürgermeister war, konnte Andreas nicht erkennen. Der Raum hinter der Gestalt war von Kerzen erhellt, sodass nur die Silhouette des Mannes erkennbar war.
«Geht nach Hause!», rief er. Es war tatsächlich Jasper Jodefeld. Die kratzige Stimme war unverkennbar.
«Erst wenn ihr Rüscher gehen lasst!», schrie Reinig.
«Der liegt im Keller und schläft seinen Rausch aus», rief Jodefeld herunter. «Das ist besser für ihn und besser für euch alle. Wollt ihr, dass er sich noch tiefer in die Scheiße reitet? Lasst ihn bloß schlafen!»
Hinter dem Portal unter den Bögen erklang nun ein gedämpftes Rumpeln und Knirschen, als würden Fässer über den Boden gerollt und Möbel verschoben. Sie verrammelten die Türen. Andreas fragte sich, wie viele Männer der Rat wohl zur Verteidigung des Gebäudes aufbieten konnte, wenn es wirklich zum Äußersten kam. Wenn sie versuchen würden, das Rathaus zu stürmen, würde er mitmachen müssen. Bei dem Gedanken wurde ihm mulmig zumute.
«Ihr durftet ihn gar nicht verhaften!», rief Walraven. «Die Alderleute müssen zustimmen!»
«Nicht bei Gefahr im Verzug», antwortete Jodefeld.
So ging es eine Weile hin und her. Jodefeld zitierte aus irgendwelchen Verträgen, Walraven hielt mit dem Gewohnheitsrecht dagegen. Währenddessen ging das Gerumpel hinter dem Portal weiter. Andreas begriff, dass Jodefeld sie nur hinhalten wollte, bis seine Leute das Rathaus vollständig verbarrikadiert hatten.
«Morgen wird er dem Gericht vorgeführt», sagte Jodefeld. «Geht jetzt endlich nach Hause!»
Walraven wollte etwas erwidern, aber Steinkamp legte einen Finger auf den Mund und sagte halblaut: «Lass mal. Wir informieren die anderen Gilden und kommen im Morgengrauen wieder. Und dann stehen hier keine fünfzig Leute, sondern fünfhundert. Warten wir mal ab, was er dann sagt.»
Walraven nickte widerwillig. Auch bei den meisten anderen setzte sich die Einsicht durch, dass man an diesem Abend nicht mehr viel ausrichten würde.
Der Schattenriss des Bürgermeisters verschwand, das Fenster wurde geschlossen. Irgendjemand schlug vor, in den Glockenschwengel in der Jüdefelderstraße zu ziehen. Theo, der Wirt, war einer von ihnen. Vor ein paar Jahren hatte er das Handwerk wegen seines kaputten Rückens an den Nagel gehängt, die Schmiede verkauft und die Kneipe in der Nähe des Gildehauses gemietet, und obwohl er seitdem immer fetter wurde, machte der Rücken ihm plötzlich keinerlei Schwierigkeiten mehr, als hätte er endlich seine wahre Bestimmung gefunden.
Es dauerte eine Weile, bis auch die Potthoff-Brüder davon überzeugt waren, dass es besser war, am kommenden Morgen die Freilassung von Rüscher mit umso größerem Nachdruck zu fordern. Was sie schließlich überzeugte, war die Aussicht, dass die ganze Stadt bei der Demütigung des Rates zusehen würde. Auch Gisbert hatte sich wieder beruhigt.
Sie fielen in den Glockenschwengel ein wie in eine eroberte Stadt, deren Einwohner geflohen waren. Kerzen flackerten, Hocker polterten. Theo fing an zu zapfen.
Auch er hatte schon von Rüschers Auftritt und seiner Verhaftung gehört. Als er vom Vorhaben der Schmiede erfuhr, sagte er: «Den Spaß werden sie euch nicht gönnen. Die hoffen, dass ihr euch ordentlich besauft, und lassen ihn raus, bevor ihr eure Ärsche aus den Betten gewuchtet habt. Und dann hoffen sie, dass ihr euch an nichts mehr erinnert.»
«Die erste Runde geht auf mich!», schrie Walraven von hinten.
Die zweite Runde ging auf Reinig, die dritte auf Hocke, die vierte auf Steinkamp, die fünfte auf Rotland, die sechste auf Remeken. Danach gab es keine Runden mehr, von irgendwoher wurden immer neue Krüge durchgereicht, Theo holte eine Sackpfeife hervor und blies schräge Melodien.
Irgendwann setzte eine gewisse Ermattung ein.
Doch dann flog plötzlich die Tür auf. Und da stand Rüscher.
«Wusste ich doch, dass ihr hier seid!»
«Was hab ich gesagt?», brummte Theo.
«Bist du ausgebrochen?», rief Reinig verwirrt.
Rüscher grinste schief. Er hatte gerötete Augen und schwankte im Türrahmen, als hätte er in seiner Zelle weitergesoffen. «Die haben gesagt, ich soll nach Hause gehen und mich ins Bett legen.»
«Am Arsch die Räuber!», schrie Rotland. «Du gibst jetzt erst mal einen aus!»
Rüschers Erscheinen gab der Stimmung einen geradezu unheimlichen Auftrieb. Theo stach ein neues Fass an, die Potthoff-Brüder wuchteten den Gesellen auf ihre Schultern und trugen ihn schwankend durch die Gaststube, während er sich das Bier in die Kehle laufen ließ, als hätte er seit Tagen nichts mehr zu trinken bekommen.
Remeken stieg auf einen Hocker, legte die Hände zu einem Trichter um den Mund und brüllte: «Die haben die Schwänze vor uns eingekniffen! Und hoffen, dass es keiner mitkriegt!»
Alle schwenkten die Krüge und jubelten. Doch nach ein paar weiteren Runden durch den Gastraum klappte Rüscher zusammen. Er gab einen gurgelnden Laut von sich, dann kippte er von den Schultern der Potthoff-Brüder. Walraven zog ihn hoch, aber Rüscher stöhnte nur und hing im Arm seines Brotgebers wie ein schlaffer Sack.
Da nun der Narrenkönig ausgefallen war, kam der Spaß an sein Ende wie eine Welle, die sich am flachen Ufer totläuft. Steinkamp gähnte. Schröder winkte in die Runde und schwankte davon, Balke stotterte sich einen Abschiedsgruß zusammen und verschwand ebenfalls. Aldermann Mollenhecke und ein paar andere schlossen sich an.
«Andreas, Gisbert! Könnt ihr mir helfen, ihn nach Hause zu tragen?», fragte Walraven, der unter dem Gewicht von Rüscher in die Knie gegangen war. Als Bierleiche schien der Geselle doppelt so schwer zu sein wie im normalen Zustand.
Andreas und Gisbert hängten sich die Arme von Rüscher über die Schultern, der irgendetwas vor sich hin brabbelte. Sie schleiften ihn nach draußen.
Die Kälte war wie eine Backpfeife, die Andreas ein bisschen von der dumpfen Benommenheit nahm. Als sie endlich bei Walraven ankamen, fühlte er sich schon fast wieder nüchtern. Walraven führte sie mit einer Kerze in der Hand zu Rüschers Kammer. Sie luden ihn auf seinen Strohsack ab und warfen eine Wolldecke über ihn. Der Kaminschacht an der Rückwand strahlte noch etwas Wärme ab. Rüscher schnarchte bereits.
«Dreht ihn auf die Seite, falls er im Schlaf kotzt», sagte Walraven geschäftsmäßig. Dann stellte er die Kerze auf den Tisch und verschwand.
Während Gisbert sich an dem Schlafenden zu schaffen machte, fiel der Blick von Andreas auf ein Buch, das auf dem Tisch lag. Er hatte gar nicht gewusst, dass Rüscher überhaupt lesen konnte, und dass er sich für irgendetwas anderes als Bier und Radau interessierte, schien fast undenkbar.
Andreas schlug das Buch auf. Prophetische gesicht und Offenbarung der götlichen würckung zu diser letsten zeit, die vom XXIIII. jar biß in dz XXX. einer gottesliebhaberin durch den heiligen geist geoffenbart seindt, welcher hie in disem büchlin LXXVII verzeichnet seindt.
«Was ist das?», fragte Gisbert, der dazugetreten war. Rüscher schnarchte.
«Keine Ahnung.»
Unter der Vignette mit dem Titel war eine Frau mit einer Krone abgebildet, die auf einem siebenköpfigen Drachen ritt. Rechts und links der Schrift standen zwei bärtige Männer, die durch Schriftbänder als Elias und Henoch bezeichnet waren. Ganz oben thronte Jesus im Himmel, flankiert von zwei Posaunenengeln.
Prophetie. Offenbarung. Heiliger Geist. Und darunter ein Name: Melchior Hoffmann. Der Straßburger Endzeitprediger, den sie eingekerkert hatten. Hatte der nicht das Jüngste Gericht zum Ende dieses Jahres vorhergesagt?
Andreas blätterte weiter. Es handelte sich um eine Aneinanderreihung von Visionen, die aber nicht Hoffmann selbst gehabt hatte, sondern eine Frau, die im Titel genannte Gottesliebhaberin. Mal war ihr der Heiland selbst erschienen, mal hatte sie Bilder gesehen: Landschaften, Scharen von Reitern und Fußvolk, Felder voller Leichen, die sich erhoben, Ungeheuer, die sich in Menschen und wieder zurückverwandelten. Ständig regnete etwas vom Himmel, ständig ging irgendetwas in Flammen auf. Schöne Jünglinge und Mädchen traten auf und vergreisten von einem Augenblick zum anderen. Posaunen erklangen, Sonne und Mond erloschen. Von Kröten war die Rede, von Skorpionen und Ziegenböcken.
Kröten. Skorpione. Ziegenböcke.
«Mein Gott», murmelte Gisbert und bekreuzigte sich. «Genau das hat Rüscher gepredigt.»
Andreas verzog den Mund. Rüscher war ein Säufer und kein Prophet.
Gisbert war sichtlich beunruhigt. Er fasste Andreas am Arm. Seine Hand zitterte.
«Rüscher hat dasselbe gesehen wie diese Frau», flüsterte er bange. «Er hatte dieselben Visionen.»
Erstaunlich, wie eingeschüchtert der sonst so großmäulige Gisbert auf einmal war.
«Der hatte keine Visionen, der hat einfach nachgeplappert, was in diesem Buch stand», sagte Andreas.
Gisbert ging nicht auf den Einwand ein. Er blickte auf den schlafenden Rüscher, der sich schon wieder auf den Rücken gedreht hatte.
«Und wenn das alles doch stimmt?»