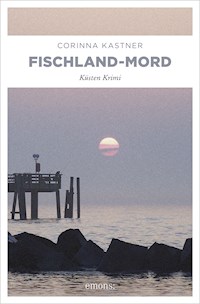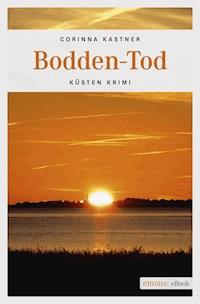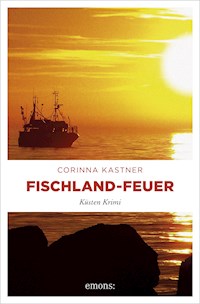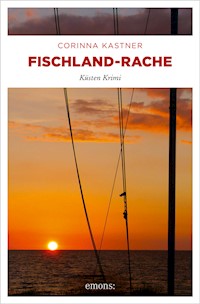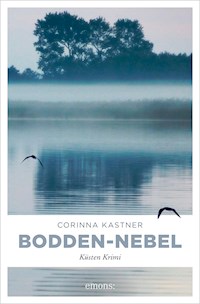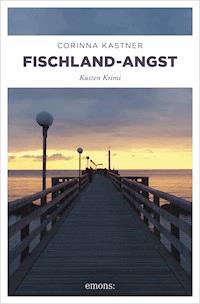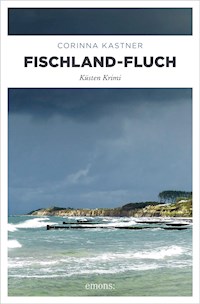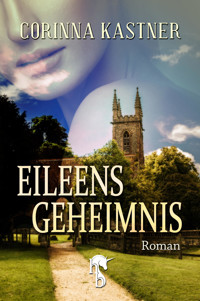4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach dem Tod seiner Mutter wird Pierre in eine jahrhundertealte Fehde zwischen zwei verfeindeten Völkern hineingezogen: den Steinmenschen und den Steinbrechern. Pierre weiß noch nicht, dass nur er den Untergang des ganzen Volkes verhindern kann, indem er die Prinzessin der Steinmenschen befreit. Mitten in dieser magischen Welt gerät Pierre in einen gnadenlosen Kampf zwischen Gut und Böse. Wird es ihm gelingen, die Steinwelt zu retten?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Jörg & Corinna Kastner
Die Steinprinzessin
Roman
Für Ursula und Horst mit Liebe und Dank
Prolog
Mit weit geöffneten Augen lag sie auf der kalten Steinplatte und starrte in die Dunkelheit. Es brannte keine einzige Fackel, kein noch so schwaches Licht drang von irgendwoher in ihr Gefängnis. Dennoch brauchte sie nicht viel Fantasie, um sich ihre Umgebung auszumalen.
All die vergangenen Jahre hatte sie geahnt, was eines Tages auf sie zukommen würde. Nun sah sie ihre schlimmsten Befürchtungen wahr werden und trotzdem bereute sie nichts. Sollte Silex mit ihr tun, was er wollte, wenn es ihm irgendeine Befriedigung verschaffte. Ihr war es egal. Sie mochte viel aufgegeben, vieles unwiederbringlich verloren haben. Sie hatte dafür etwas unschätzbar Wertvolles bekommen.
Das allerdings war nur die eine Seite der Medaille. Je länger sie hier festgehalten wurde, desto klarer wurde ihr, dass es möglicherweise nicht nur um ihr persönliches Schicksal ging – sonst hätte Silex längst seine Rache genommen und ihr Leben ausgelöscht.
Als sie damals diese Welt verlassen hatte, hatte sie um das Risiko gewusst, das sie einging. Ihr war bewusst gewesen, dass sie Silex vermutlich in die Hände fallen würde, wenn sie bei der Rückkehr das Tor durchschritt. Und sie war sich im Klaren über die Konsequenzen: Sie einfach zu töten hätte zu dem gepasst, was man über seinen jähzornigen und blindwütigen Charakter sagte. Damit hatte sie sich abgefunden. Aber nun wollte er anscheinend etwas anderes.
Sie zermarterte sich den Kopf darüber, was es sein mochte. Vor langer Zeit hatten diese Höhlen einen Gefangenen beherbergt, der beinahe so wichtig gewesen war wie sie. Wichtiger sogar, wenn man sein unschätzbares Wissen berücksichtigte. Die Steinbrecher hatten versucht, ihm sein Geheimnis zu entreißen, doch niemals hätte dieser Mann mit ihnen kooperiert, um keinen Preis. Es war ihm gelungen zu fliehen, aber er hatte trotz allem nicht verhindern können, dass seine Feinde triumphierten und fanden, was sie suchten: Die Macht, die Oberfläche zu durchdringen.
Was also konnte auch nur ansatzweise so bedeutend sein wie diese Macht? Was war es diesmal, das Silex wollte – über hundertfünfzig Jahre später?
*
Irgendwo vor sich hörte sie ein Geräusch. Eine Tür öffnete sich, durch den Spalt drang gedämpfter Feuerschein. Dann wurde es noch heller. Die Gestalt, die eintrat, trug eine Fackel bei sich, deren Flammen unruhige Schattenspiele an die Felswände warfen. Der Mann kam näher, blieb schließlich neben ihr stehen und schaute auf sie herunter.
Langsam richtete sie sich auf. Sie war nicht auf die Steinplatte gefesselt, wozu auch? Hier unten gab es nichts, womit sie sich hätte befreien können. Sie bot in ihrem Zustand vermutlich ein jämmerliches Bild, dennoch versuchte sie so viel Würde wie möglich auszustrahlen, als ihr Gegenüber zu sprechen begann.
»Da bist du also. Wir haben dich schon erwartet.«
Sie antwortete nicht.
»Du weißt, wer ich bin?«
Sie hatte Silex noch nie zuvor gesehen, und die zweifelhaften Beschreibungen, die kursierten, nicht für wahr gehalten. Es gab zu viele davon und jede widersprach der anderen. Aber auch wenn die eine ihm einen Buckel, die nächste ihm jede nur erdenkliche Missgestaltung des Gesichts verpasste, eines hatten alle gemeinsam: Silex war ein hässlicher Mann mit einer noch hässlicheren Seele.
In der Tat gab der Fackelschein seinen Zügen etwas Unheimliches, doch soweit sie erkennen konnte, war Silex alles andere als hässlich. Er trug seine schwarzen Haare kurz, zu kurz für diese Welt, die Farbe der Augen schien entweder braun oder ein sehr dunkles Blau zu sein. Im ersten Moment dachte sie, er sei ihr auf merkwürdige Weise vertraut, hatte aber keinerlei Vorstellung, weshalb oder woher. Und doch …
Jetzt umspielte ein Lächeln seine Lippen. »Enttäuscht, dass ich kein Monster bin? Nun, du hast bestimmt schon davon gehört, dass man nie nach Äußerlichkeiten urteilen soll. Da ist viel Wahres dran.«
Sein Ton klang ruhig und fast neutral. Fast. Unterschwellig spürte sie aber eine Welle ungeheurer Energie, als müsse er sich zusammenreißen, um sich ihr gegenüber zurückzunehmen. Ein Blick in seine Augen allerdings ließ sie erahnen, dass ihre Anwesenheit in ihm, seiner zur Schau getragenen Gleichgültigkeit zum Trotz, starke Emotionen weckte. War es unterdrückter Hass, der darin lag? Die geheime Befriedigung, endlich sein Ziel erreicht zu haben? Die perverse Vorfreude auf das, was nun bevorstand? Oder etwas vollkommen anderes?
Obwohl keine Riemen um ihre Hände und Füße gebunden waren, schob sie den Gedanken an Flucht gleich wieder als absurd beiseite. Sie hätte keine Chance. Trotzdem wünschte sie verzweifelt, es wäre anders, wünschte, sie würde einen Weg finden, um allem hier ein Ende zu bereiten und Silex an den Punkt zurückzuschicken, an dem er bisher – bis zu ihrer Ankunft – gestanden hatte.
»Saphir wird sich nicht provozieren lassen. Ich bin also wertlos als Geisel«, waren ihre ersten Worte. Sie war sich dessen keineswegs so sicher, wie sie klang.
Silex antwortete nicht sofort. Er runzelte die Stirn, als überlege er genau, was er als Nächstes sagen solle. »Du warst nie wieder hier, seit du unsere Welt verlassen hast.«
Sie reagierte nicht auf seine Feststellung, schüttelte nicht mal den Kopf. Sie hatte damals ein Leben gewählt und es war das Leben, das sie wollte.
»Offensichtlich hat sich auch niemand die Mühe gemacht, dich auf dem Laufenden zu halten«, fuhr Silex ungerührt fort. »Sieht so aus, als müsste ich das nun tun: Saphir ist tot. Diamant wurde sein Nachfolger.«
Damit hätte sie rechnen sollen, trotzdem traf es sie, die Tatsachen aus Silex’ Mund zu hören. Dann holte sie tief Luft. »Das spielt keine Rolle. Auch Diamant lässt sich nicht erpressen.«
»Du meinst also, ich sollte dich lieber töten?«, fragte Silex spöttisch. »Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Mein Plan gefällt mir viel besser. Wir werden sehen, wer von uns beiden Recht hat.« Er machte eine kurze Pause, bevor er im selben spöttischen Ton fortfuhr: »Ich habe lange darauf gewartet, das Reich der Steinmenschen zu vernichten – und seinen Fürsten mit ihm. Es wäre doch schade, wenn du das verpasst.«
Silex streckte die freie Hand nach ihr aus und berührte ihr Gesicht. Sie wollte zurückweichen, hatte aber dafür nicht genug Spielraum. Als seine Fingerspitzen ihre Wange trafen, dachte sie, ihr müsse schwarz vor Augen werden. Sie spürte etwas, das einem elektrischen Schlag gleichkam. So etwas kannte man in dieser Welt nicht, doch für sie war es nichts Fremdes und ihr drängte sich der Vergleich unmittelbar auf.
Silex zog die Hand zurück und blickte einen Herzschlag lang verblüfft auf seine Finger, als hätte er etwas Ähnliches gespürt. Dann hob er den Blick und starrte die Gefangene mit zusammengekniffenen Augen prüfend an, bis er sich wortlos umdrehte. Mit ihm verschwand das wenige Licht, das die Fackel gebracht hatte.
Sie hörte ihr eigenes Atmen, das in dieser beinah vollkommenen Stille sehr laut klang. Langsam ließ sie sich auf die Steinplatte zurückgleiten und lag da wie zuvor, ihre Augen auf das Dunkel um sie herum gerichtet. Durch Silex’ Fackel hatte sie nur die Umrisse ihrer Umgebung wahrgenommen, aber immerhin wusste sie jetzt, dass ihre Vorstellungskraft sie nicht trog. Ihr Gefängnis war tatsächlich eine Höhle, vermutlich tief in den Fels gehauen. Irgendwo nahe einer Wand hatte sie schemenhaft einen Tisch ausmachen können, auf dem ein Krug mit Wasser und ein Becher standen. Seit sie hierher gebracht worden war, war zweimal jemand gekommen, um ihr etwas zu trinken zu bringen. Ansonsten schien es außer der Steinplatte, auf der sie lag, nichts zu geben.
*
Allmählich begann sie zu verstehen, was Silex tatsächlich wollte: unendlich viel mehr als jenes Wissen, das seinem Vorgänger so wichtig gewesen war. Sie fing auch an zu begreifen, dass das, was sie einmal für eine Entscheidung über ihr eigenes Leben gehalten hatte, in Wirklichkeit die Entscheidung über das Leben sehr, sehr vieler bedeutete. Sie hatte Silex in die Hände gespielt, ohne es zu wollen. Sie verfluchte sich selbst dafür, denn wenn sie das damals auch nur geahnt hätte, wäre sie niemals fortgegangen.
Sie schloss die Augen und beschwor die Erinnerung an glücklichere Zeiten herauf. Eine Weile funktionierte es, doch plötzlich erklang Silex’ Stimme in ihr und sie hörte seine letzten Worte ein zweites Mal, die erst jetzt eine entscheidende Frage aufwarfen. Silex hatte lange gewartet. Damit konnte er nicht die lächerlichen achtzehn Jahre gemeint haben, die sie fort gewesen war. Es musste weiter zurückreichen. Immerhin stand Silex schon seit fast sechzig Jahren an der Spitze der Steinbrecher. Unterschätzte ihr eigenes Volk, die Steinmenschen, Silex, wenn es ihm blinden Hass und Willkür unterstellte? Hatte er stattdessen geschickt und geduldig Pläne geschmiedet? Und war ausgerechnet sie, die Steinprinzessin, zur Handlangerin dieser Pläne geworden?
1
Stumm und äußerlich unbewegt stand Pierre unter dem schwarzen Regenschirm und starrte ins Nichts. Niemand aus der Traube der umstehenden Menschen konnte erkennen, woran er dachte, und das war gut so. Seine Gedanken und vor allem seine Gefühle gingen keinen etwas an, obwohl sich vermutlich eine Menge Leute um ihn sorgten. Um ihn und seinen Vater Christophe, der sich nicht so abzuschotten vermochte wie Pierre.
Der leichte Nieselregen passte zu all dem Grau um sie herum, passte zur Stimmung und passte zu dem Gemurmel des Pfarrers, das tröstend sein sollte, aber für Pierre nur aus leeren Worthülsen bestand. Er hörte schon längst nicht mehr zu. Es kostete ihn genug Anstrengung, nicht nach unten in dieses Loch zu blicken, in das der schlichte helle Sarg aus Esche vor ein paar Minuten hinabgesenkt worden war. Obwohl er den Blick mit aller Kraft vermied, konnte er nicht verhindern, dass vor seinem inneren Auge unwillkürlich ein Bild entstand. Er sah seine Mutter dort im Sarg liegen, ihr Gesicht nicht wie gewohnt heiter und gelassen, sondern bleich und wächsern, eine starre Maske. Dann, genau in dem Moment, als der Sargdeckel geschlossen wurde, öffneten sich ihre grünen Augen und ihre Lippen teilten sich zu einem lautlosen Schrei.
Christophe stupste ihn an. Noch immer leicht zitternd von der Horrorvision, die ihn gerade heimgesucht hatte, bewegte sich Pierre schwerfällig ein paar Schritte vorwärts, um am Grab die Beileidsbezeugungen an der Seite seines Vaters entgegenzunehmen. Er schüttelte Hände, nickte und sagte heiser unzählige Male »Danke«. Doch er nahm nicht die Gesichter der Menschen wahr, hörte auch nicht die Stimmen, schaute nur auf die Hände, die sich seiner Rechten entgegenstreckten. Er wünschte sich weit weg in eine andere Welt, in der die Sonne schien und in der es immer warm war, in der er nicht frieren und sich nicht alleine fühlen würde. In der vor allem Ärzte einen niemals mitleidig ansahen und sagten, dass sie nichts tun könnten. In der Menschen nicht einfach so starben.
Für eine kleine Weile gestattete er sich, in die Vergangenheit einzutauchen, als er noch ein Kind war und nicht ahnte, was die Zukunft für ihn bereithielt. Ein warmes Gefühl durchströmte ihn, während er an seine Mutter dachte und ihre sanfte Hand an seiner Wange zu spüren glaubte. Aber er war kein Kind mehr, er war sechzehn; erwachsen also. Und er wusste, dass es nichts brachte, sich in Träume oder irgendwelche Fantasiewelten zu flüchten. Pierre richtete sich auf und blickte dem Mann in die Augen, der jetzt vor ihm stand. Er hatte ihn noch nie vorher gesehen, ganz sicher war er kein Verwandter. Trotzdem ergriff er dessen Hand und nickte, als der Fremde sagte: »Ich weiß, das ist schwer. Aber du wirst jetzt gebraucht.«
Erst als sich der Mann, der einen langen grauen Mantel trug und beim Gehen einen Stock mit silbernem Knauf schwang, ein Stück entfernt hatte, wurde Pierre bewusst, wie merkwürdig diese Worte klangen. Was war damit gemeint? Wer sollte ihn brauchen? Christophe? Es gab sonst niemanden, es gab nur sie beide. Unsicher schielte er zu seinem Vater hinüber. Dessen gerötete Augen bildeten in seinem ansonsten sehr blassen Gesicht einen harten Kontrast. Einen Moment lang passte Pierre nicht auf, achtete nicht auf den nächsten Beileidsbekunder, sondern schaute wieder dem fremden Mann hinterher. Ruhig und bedächtig schritt er den Weg entlang zum Ausgang. Er drehte sich nicht noch einmal um.
»Wer war das?«, flüsterte Pierre seinem Vater zu.
Der sah schwerfällig auf, als würde er aus einer Trance erwachen. Trotzdem wusste er sofort, wen sein Sohn meinte. Er runzelte kurz die Stirn, dann zuckte er die Schultern. »Keine Ahnung. Vielleicht jemand vom Krankenhaus.«
Sie hatten keine Zeit, sich weiter zu unterhalten. Pierres Mutter war nicht nur sehr beliebt gewesen, sondern auch viel beschäftigt in einer ganzen Anzahl von Vereinen und Stiftungen. Der kleine Friedhof schien übervoll zu sein mit Trauergästen. Als sich endlich die Reihen zu lichten begannen, seufzte Pierre erleichtert auf. Er sehnte sich nach der Ruhe und Zurückgezogenheit seines Zimmers über Christophes Werkstatt. Doch dann fiel ihm siedend heiß das Kaffeetrinken ein, das er noch über sich ergehen lassen musste. Nur ein kleiner Kreis Trauernder sollte daran teilnehmen, aber für seinen Geschmack waren selbst diese zwanzig Leute noch zu viel. Man saß da zusammen bei Kuchen und belegten Broten und tat so, als wäre die Welt in Ordnung, als wäre nichts passiert. Nur die dunkle Kleidung ließ erkennen, dass es nicht so etwas Profanes wie ein Geburtstag war, der die Verwandtschaft zusammengeführt hatte.
Pierre dachte kurz daran, diese Veranstaltung zu boykottieren, doch dann fielen ihm die Worte des Fremden wieder ein. Vielleicht war etwas dran gewesen. Vielleicht brauchte ihn sein Vater tatsächlich, der merkwürdig zerbrechlich wirkte. Möglicherweise brauchten sie einander und konnten sich in den Monaten, die vor ihnen lagen, eine gegenseitige Stütze sein. Es wäre kein guter Anfang dafür, sich jetzt auszuklinken.
In einem Hinterraum des Café Point Vert trafen nach und nach alle ein, setzten sich und begannen, mit gedämpften Stimmen zu sprechen. Martin, der Bruder seines Vaters, gesellte sich an denselben Tisch.
»Wenn du irgendwas brauchst, Christophe … Du weißt, dass wir immer für dich und den Jungen da sind.«
Pierres Vater nickte, zeigte aber wenig Begeisterung. Das lag nicht daran, dass er seinen Bruder nicht mochte, nur mit dessen Frau Thérèse gab es hin und wieder Schwierigkeiten. Pierre ahnte, sein Vater würde vermutlich auf das Angebot Martins verzichten. Außerdem ärgerte er sich über den Ausdruck »Junge«. Er war kein Junge mehr. Dass er sich gerade vorhin noch zurückgesehnt hatte in seine Kindheit, verdrängte er schnell wieder.
Dankbar sah er unter den Neuankömmlingen im Café nun auch René, seinen besten Freund aus der Schule. Renés Mutter Monique leitete die hiesige Rote-Kreuz-Niederlassung und war sehr eng mit Pierres Mutter befreundet gewesen. Tatsächlich waren sie und ihr Sohn die einzigen Gäste, die nicht zur Verwandtschaft gehörten. René winkte zurückhaltend zu Pierre herüber, als wisse er nicht so recht, wie er sich verhalten sollte. Pierre winkte zurück und deutete auf einen leeren Platz neben sich.
»Ziemlich viel los hier, oder?«, fragte René, als er herangekommen war.
Pierre nickte. »Maman würde sich freuen.«
»Sind das alles Familienangehörige?«
Wieder nickte Pierre. »Die meines Vaters. Willst du lieber Kuchen oder ein Brot?« Seine Mutter hatte keine Verwandten, jedenfalls wurde nie über sie geredet, es gab auch keine Fotos oder sonst irgendwas, das an ihre Familie erinnerte.
»Die mit Schinken sehen gut aus.«
Pierre reichte seinem Freund den Teller, der sich davon bediente. Dabei streifte sein Blick Martin, der nach seinem Angebot, zu helfen, in betretenes Schweigen verfallen war. Wahrscheinlich, weil Christophe sich nicht gerade vor Dankbarkeit überschlagen hatte.
»Kommst du morgen wieder zur Schule?«, lenkte René Pierre ab.
»Mhm. Muss ja. Hab keine Lust, diese blöde Mathearbeit nachzuschreiben.«
»Vielleicht machen sie eine Ausnahme in deinem Fall. Ich meine, passiert schließlich nicht jeden Tag, dass …« Betroffen hielt René inne, als ihm bewusst wurde, was er im Begriff war, zu sagen.
»Dass die eigene Mutter stirbt?«, beendete Pierre den Satz.
»Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ich will keine Extrawürste. Ich schreib das Ding, und wenn ich’s verhaue, dann ist es auch okay.«
»Na ja, musst du wissen.« René biss in das Schinkenbrot und kaute nachdenklich. Er kannte Pierre sehr gut. Dessen lässiger Ton eben spiegelte nicht wirklich seine Gefühle wider. René hatte ihn weinen sehen am Tag, als seine Mutter starb, ohne dass auch nur ein einziger Arzt herausfinden konnte, woran eigentlich. Die Medizin stand vor einem Rätsel. Das schien Pierre mehr wütend als traurig zu machen, vielleicht waren es also damals Tränen des Zorns gewesen. Trotzdem wurde es dadurch nicht leichter, besonders da er sich jetzt dazu entschlossen zu haben schien, keine Gefühle mehr zuzulassen. Oder zumindest niemanden mehr in sie einzuweihen, nicht mal seinen besten Freund. René hätte Pierre gern etwas aufgemuntert, aber jede Bemerkung, die ihm einfiel, schien ihm irgendwie unpassend, und so schwieg er.
Obwohl Pierre sich nicht sehr bemühte, ein Gespräch in Gang zu halten, war er froh, dass René da war. Er symbolisierte in dieser unwirklichen Situation ein Stückchen normale Welt, an dem er sich festklammern konnte. Das war auch der Grund, weshalb er morgen unbedingt wieder zur Schule wollte. Früher oder später musste er sich wieder in sein Leben einfinden und je eher das geschah, desto besser.
2
Pierre lief durch ein riesiges Sonnenblumenfeld. Der Himmel war blau, keine Wolke zu sehen, die Sonne wärmte seine Schultern. Am Horizont sah er seine Mutter stehen, die auf ihn wartete. Er lief auf sie zu, doch seltsamerweise verkleinerte sich der Abstand zwischen ihnen überhaupt nicht. Langsam wurden die Strahlen der Sonne zu heiß, Pierre geriet außer Atem, während er weiter und weiter rannte. Der Schweiß brach ihm aus und plötzlich wurde ihm schwarz vor Augen. Er stolperte, fiel hin und stieß sich dabei die Knie blutig. Die Wunde brannte. Zu der Schwärze vor seinen Augen kam ein Hämmern in seinem Kopf, das immer lauter wurde, bis es alles um ihn herum ausfüllte.
Mit schreckgeweiteten Augen fuhr Pierre im Bett hoch. Der Schweiß rann ihm tatsächlich den Nacken hinunter, Dunkelheit umhüllte ihn. Sein Atem ging so schnell, als wäre er wirklich durch dieses Feld gelaufen.
Doch während er sich langsam wieder beruhigte und ihm klar wurde, dass er nur geträumt hatte, bemerkte er, dass das Hämmern noch immer zu hören war. Es kam von unten, aus der Werkstatt seines Vaters. Christophe war Steinmetz, und ohne zu sehen, woran er jetzt mitten in der Nacht arbeitete, wusste Pierre, was es war: Der Grabstein für seine Mutter. Unablässig erklang das mal dumpfe, mal helle Geräusch des Hammers und des Meißels, die den Stein bearbeiteten. Pierre lag auf dem Rücken und starrte an die Decke seines Zimmers, im Rhythmus des Meißels begannen seine Finger auf das Bettlaken zu klopfen. Einen Augenblick lang überlegte er, ob er zu seinem Vater hinuntergehen, ihn dazu bringen sollte, sich schlafen zu legen. Dann ließ er es bleiben. Nichts würde Christophe Marchand von seiner Arbeit abhalten. Es geschah manchmal, dass Pierres Vater wie besessen an einem Stück meißelte, bis es perfekt war. Tagelang, auch nächtelang. Nicht einmal Sylvie hatte ihn in solchen Phasen zur Vernunft bringen können. Und jetzt, wo er an Sylvies Grabstein saß, gab es erst recht keinen Grund für Christophe, in ein kaltes und leeres Bett zurückzukehren.
Für einen kurzen Moment herrschte Ruhe von unten, dann begann das Hämmern erneut. Wieder eine Unterbrechung, etwas länger diesmal, in der Pierre meinte, eine Stimme wahrzunehmen. Hielt sein Vater Selbstgespräche? Pierre setzte sich auf und lauschte angestrengt, doch bevor er aus dem Gemurmel ein Wort heraushören konnte, bereitete das Wiedereinsetzen des Hämmerns jedem weiteren Versuch ein Ende.
Irgendwann schlief Pierre ein. Als er das nächste Mal erwachte, graute der Morgen. Er warf einen Blick auf den Wecker neben seinem Bett. Fast fünf. Von unten drang kein Ton mehr herauf. Eigentlich hätte sich Pierre noch einmal umdrehen und anderthalb Stunden schlafen können, aber das ging nicht. Er wälzte sich von einer Seite auf die andere, bis er begriff, dass es sinnlos war. Er stand auf und begann, seine Tasche zu packen. Dabei fiel ihm das Mathebuch in die Hände, in das er vor zwei Wochen noch die Lösung für eine besonders komplizierte Algebra-Aufgabe hineingekritzelt hatte. Damals war seine Mutter noch kerngesund gewesen, niemand hätte geglaubt, dass sie neun Tage später einfach nicht mehr existieren würde.
Leise schlich Pierre die Treppe hinunter und öffnete vorsichtig die Tür zur Werkstatt. Eigentlich hätte er erwartet, sie leer zu finden. Er wollte nur nachsehen, wie weit Christophe in der Nacht gekommen war, besonders da er keine Vorstellung hatte, wie der Stein für Sylvie aussehen sollte. Zu seiner Überraschung fand er seinen Vater schlafend vornübergebeugt am einzigen Tisch vor, eine leere Flasche Rotwein neben sich, im Glas nur noch ein Schluck. Pierres Blick glitt über die Gestalt seines Vaters hinweg zu dem überdimensionalen Stein im Hintergrund. Er war noch nicht fertig, aber die Figur ließ sich schon im Umriss erkennen. Es würde ein Engel werden. Ein Engel mit langem Haar und nur kleinen Flügeln. Die Gesichtszüge waren erst grob herausgehauen, trotzdem zuckte Pierre leicht zusammen. Sie erinnerten ihn an seine Mutter. Er starrte die Figur an und auf einmal schienen sich die kleinen Flügel zu bewegen. Ein winziges Stück nur, und der Kopf schien sich in seine Richtung zu drehen. Die Augen, die noch kaum auszumachen waren, wirkten plötzlich lebendig und zwinkerten ihm zu.
Pierre schüttelte sich, um diesen verstörenden Eindruck loszuwerden. Er schaute noch einmal hin und jetzt stand die Figur ganz still und regungslos da und wartete darauf, weiter mit einem Meißel bearbeitet zu werden.
Beim Verlassen der Werkstatt schloss Pierre behutsam die Tür hinter sich, damit sein Vater nicht aufwachte. In der Küche trank er ein Glas Orangensaft, aß ein Stück trockenes Baguette vom Vortag, und schnappte sich seine Tasche. Er war noch immer viel zu früh dran für den Bus. Um diese Zeit fuhr überhaupt noch keiner, aber dann würde er eben zu Fuß gehen. Vielleicht tat die Luft draußen ihm gut.
*
Trotz der frühen Stunde war es schon recht warm. Das schlechte Wetter des vergangenen Tages hatte sich nicht in den nächsten hinüberretten können. Fast kam es Pierre so vor, als hätte der Himmel absichtlich genau gestern geweint und nun alle Tränen vergossen. Exakt vierundzwanzig Stunden Pause im ansonsten herrlichsten Sommer seit Jahren. Langsam schlenderte er die Straße entlang, er hatte es nicht eilig. Er bemühte sich, an die anstehende Klassenarbeit zu denken, aber es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren. Besonders als er merkte, dass er ganz unbewusst den Weg eingeschlagen hatte, der ihn am Friedhof vorbeiführte. Eigentlich führte im kleinen Ort Rocaille jede Straße irgendwie ans Ziel. Aber es hätte auch einen anderen, sogar kürzeren Weg zum Gymnasium gegeben.
Nur einen Augenblick lang blieb Pierre vor dem mit Eiben gesäumten Eingangstor stehen. Er zögerte, machte einen Schritt hinein, blieb wieder stehen. Dann straffte er entschlossen die Schultern und ging zielsicher den breiten Pfad entlang, an vier Grabreihen vorbei, bis er in ein paar Metern Entfernung den großen Blumenberg ausmachte, unter dem seine Mutter lag. Er hielt erneut inne. Er war gestern nicht noch einmal hergekommen, das hätte er einfach nicht gekonnt. Dafür war er eben jetzt hier. Der Morgendunst lag über den Hecken und den Gräbern. Wenn es dunkler gewesen wäre, hätte es unheimlich ausgesehen. So wirkte es jedoch nur friedlich.
Gerade wollte er sich wieder in Bewegung setzen, als er eine Gestalt wahrnahm, die sich von der Steineiche löste, unter der sie schon eine Zeit lang gestanden haben musste. Der Mann trat an das Grab, bückte sich, pflückte eine einzelne weiße Rose aus einem Gesteck und drehte sich dann zu Pierre um, als habe er gewusst, dass er beobachtet wurde.
Eigentlich war Pierre noch zu weit entfernt, um den Mann genau erkennen zu können, doch er spürte instinktiv, dass es der Fremde von gestern war, der mit ihm gesprochen hatte. Jetzt stand er abwartend da und sah ihm erwartungsvoll entgegen. Neugierig und zugleich misstrauisch kam Pierre näher. Er hätte zu gern gewusst, was es mit diesem Mann auf sich hatte, ahnte er doch, dass die Vermutung seines Vaters nicht zutraf. Der Fremde sah nicht aus wie jemand vom Krankenhaus.
Nur noch ein halber Meter trennte die beiden, niemand sagte ein Wort. Jeder musterte den anderen abwartend, abschätzend. Bis der Mann, der auch heute wieder den langen grauen und sehr weiten Mantel trug, plötzlich lächelte. »Du bist ihr sehr ähnlich.«
Einen winzigen Moment lang wollte Pierre ihn bitten, seine Worte zu wiederholen, weil sie fremdartig klangen und er sie nicht verstand. Doch gleich darauf hatte er den Gedanken schon wieder vergessen, wusste er, was der Fremde gesagt hatte. Pierre räusperte sich. »Sie … Sie kannten meine Mutter?«
»Oh ja …« Mehr sagte er nicht. Offenbar wartete er, dass Pierre noch eine Frage stellte, die nächstliegende. Aber Pierre tat ihm den Gefallen nicht, obwohl sie ihm auf der Zunge brannte. Das schien sein Gegenüber zu amüsieren. Sein Lächeln wurde breiter.
»Das hast du auch von ihr!«, stellte er fest.
»Was?«, fragte Pierre zurück, bevor er sich beherrschen konnte.
»Den Dickkopf. Wenn deine Mutter nicht wollte, dann wollte sie nicht. Und nichts und niemand konnte sie vom Gegenteil überzeugen. Du willst nicht fragen, wer ich bin und woher ich Emeraude kannte?«
»Wer ist Emeraude?« Auch diese Frage rutschte Pierre wider Willen heraus, obwohl er ahnte, von wem der Mann sprach.
»Du meinst, deine Mutter hieß eigentlich Sylvie? Ja, das ist wohl richtig. Aber Emeraude ist der Name, den sie bekam, als sie geboren wurde. Und Emeraude wird sie immer für mich sein. Es passt zu ihr, findest du nicht?«
Pierre wurde ein bisschen schwindelig. Er begriff nicht die Hälfte von dem, was der Mann sagte. Trotzdem musste er zugeben, dass der andere recht hatte. Emeraude bedeutete »Smaragd«, und tatsächlich waren die Augen seiner Mutter smaragdfarben gewesen, ein tiefes, dunkles Grün, wie er es niemals bei irgendjemand anderem gesehen hatte. Auch seine eigenen Augen waren grün, aber heller, mehr wie ein Frühlings-, nicht wie ein Sommergrün.
Er merkte, wie er abwesend nickte. Das Schwindelgefühl schwand langsam. Er sah vom frisch aufgeschütteten Grab mit den vielen Kränzen wieder hoch zu dem Mann in Grau, der ihn fixierte, die Brauen hochgezogen. »Stimmt was nicht?«
»Doch, doch«, murmelte Pierre. »Ich … ich war nur einen Moment …«
»Natürlich, entschuldige. Du wolltest dich verabschieden und ich komme daher und rede allen möglichen Unsinn, der dich nur verwirren muss. Wirklich, ich hätte mir auch einen günstigeren Augenblick aussuchen können, dich kennenzulernen.«
»Warum sollten Sie mich kennenlernen wollen?«
»Tja, warum?« Das ist eine gute Frage, die der Fremde offenbar nicht beantworten wollte. Er verstummte und schaute auf Sylvies Grab hinunter. »Vielleicht, weil ich Emeraude vermisse.«
Dieses seltsame Eingeständnis kam so überraschend, dass Pierre eine Weile brauchte, um darauf die passende Erwiderung zu finden. Er war sich bewusst, dass er dauernd diese Was-wer-warum-Fragen stellte und sich anhörte wie eine auf Endloswiederholung programmierte CD. Aber etwas ging ihm bei der letzten Bemerkung des Mannes nicht aus dem Kopf.
»Wenn Sie sie so vermissen«, begann Pierre, »wieso kommen Sie dann erst jetzt, wo es zu spät ist?«
Er war ungeheuer gespannt auf die Antwort, aber zugleich wollte er auch einen coolen Abgang haben, einen, der ihn nicht wie einen dummen Jungen dastehen ließ, der nicht wusste, wie ihm geschah. Nur eine Sekunde lang wägte er ab, was ihm wichtiger war, und entschied sich für den coolen Abgang. Er drehte sich auf dem Absatz um, ohne eine Entgegnung abzuwarten. Wenn der Mann tatsächlich so viel Wert auf seine Bekanntschaft legte, würde er die Antwort auf seine Frage früher oder später erhalten. Geduld war noch nie seine Stärke gewesen – und vermutlich wusste der Fremde, dass Pierre auch diese Eigenschaft von seiner Mutter hatte –, aber dieses eine Mal wollte er es sein, der das letzte Wort behielt. Am Toreingang kostete es ihn einige Anstrengung, unbeirrt weiterzugehen, als wäre nichts Ungewöhnliches geschehen. Doch den Eindruck, seine Gefühle im Griff zu haben, würde er nicht zerstören.
Hätte er sich umgedreht und wäre er dabei schnell genug gewesen, hätte er möglicherweise noch den sehr dünnen weißen Schleier aus feinstem Steinstaub gesehen, der sich jetzt auf die Blumen senkte wie Tau.
3
Die Klassenarbeit bereitete Pierre nicht sehr viel Mühe. Größere Schwierigkeiten hatte er damit, seinen Mitschülern zu begegnen, die ähnlich wie René am Tag zuvor etwas ratlos waren, was sie zu ihm sagen oder ob sie überhaupt mit ihm reden sollten. Ein Teil seiner Freunde dachte, er würde am liebsten in Ruhe gelassen werden, der andere Teil gab sich betont normal. Pierre war sich selbst nicht sicher, was er wollte. Das Dumme am Leben in einem so kleinen Ort bestand darin, dass immer alle alles wussten. Es gab niemanden in der Schule, der Pierre völlig ahnungslos begegnete und sich deshalb tatsächlich normal benahm. Zumindest nicht vor der dritten Stunde.
Die Neue wurde von Monsieur Lambert als Florence Duroc vorgestellt. Der Gegensatz zwischen ihren dunklen Haaren und dem fast durchscheinenden Teint ließ sie ein wenig zerbrechlich wirken, aber ihre Augen drückten Bestimmtheit und Willenskraft aus. Pierre erinnerten sie an die Farbe eines hellen Opals, der abwechselnd grünlich und fast ein wenig lila schimmerte. Zum ersten Mal seit dem Tod seiner Mutter dachte er komplette fünf Minuten an etwas vollkommen anderes.
Obwohl oder vielleicht weil Florence wissen musste, dass alle sie anstarrten, lächelte sie etwas schüchtern, senkte aber nicht den Blick, als sie sich auf den einzigen freien Platz setzte – neben René, dessen Wangen sich sofort tomatenrot färbten. Pierre nahm den leicht neidischen Seufzer seines Nachbarn wahr und fragte sich unwillkürlich, ob ihm etwas Ähnliches entschlüpft sein mochte.
In der Pause gesellte sich Pierre zu René, der ausnahmsweise mal gar nicht so begeistert darüber war. Trotzdem beeilte er sich, Pierre und Florence einander vorzustellen.
»Hallo«, sagte Florence lächelnd. »Ich habe das mit deiner Mutter gehört. Tut mir leid.«
Pierre wollte schon etwas düster nicken, als ihm der natürliche Tonfall des Mädchens auffiel. Sie klang weder überschwänglich mitfühlend noch zu gleichgültig. Sie hatte Sylvie nicht gekannt und sah Pierre gerade zum ersten Mal und sie tat nicht so, als wäre Pierres Tragödie ihre eigene.
»Danke«, antwortete Pierre.
Damit war für beide das Thema erledigt. »Ihr habt den kleinen Hof in der Nähe des Steinbruchs, oder?«, fragte Florence.
»Ja. Mein Vater ist Steinmetz, er bezieht von da sein Material. Und wo wohnst du?«
Es stellte sich heraus, dass Florences Familie ein Haus gekauft hatte, das genau auf der anderen Seite des Steinbruchs lag. Wenn es nicht durch ein paar vereinzelte Bäume verdeckt gewesen wäre, hätte Pierre es von seinem Zimmerfenster aus sogar sehen können. »Da wohnst du?«, fragte er zweifelnd.
»Wieso? Ist damit was nicht in Ordnung?«
René, der bisher geschwiegen hatte, warf Pierre einen warnenden Blick zu.
»Och nö, ist nur ein ziemlich alter Kasten«, beeilte sich Pierre zu sagen.
Mit einem Mal lachte Florence und ihr Lachen klang wie das Glockenspiel der Kirche im Nachbardorf Perrin. »Du glaubst doch wohl nicht an Gespenster, oder?«
»Quatsch! Wie kommst du darauf?«
»Na, ich dachte nur, weil du mich so entsetzt ansiehst. Natürlich haben wir von Caillou gehört, der angeblich in unserem Haus umgehen soll. Aber ehrlich, mir ist er noch nicht erschienen!«
»Sei froh«, mischte René sich ein. »Muss nicht gerade ein angenehmer Zeitgenosse sein.«
»Woher willst du das wissen? Bist du ihm schon begegnet?«, grinste Florence.
»Ich nicht, aber …«
»Aber jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt, stimmt’s?«
René kam sich ausgesprochen blöd vor, denn selbstverständlich hatte er genau das sagen wollen. Aber erst als Florence es aussprach, wurde ihm klar, wie bescheuert es klang.
»Jedenfalls, wenn Caillou auftauchen sollte, werdet ihr die Ersten sein, die es erfahren. Könnte doch ganz spannend sein.«
»Ich weiß nicht«, murmelte Pierre. Aus irgendeinem Grund kam ihm der Mann am Grab seiner Mutter plötzlich wieder in den Sinn. Wenn er genauer darüber nachdachte, war der vermutlich unheimlicher gewesen als irgendein Geist, der seit Jahrhunderten in einem alten Haus umgehen sollte. Er versuchte, sich an die Gesichtszüge des Fremden zu erinnern, und stellte erstaunt fest, dass er es nicht konnte. Er konnte nicht mal mehr mit Bestimmtheit sagen, ob er alt oder jung gewesen war. Immerhin fiel ihm der Stock mit dem Silberknauf ein. Wahrscheinlich war es also ein alter Mann gewesen.
»Sag mal, René, ist dir gestern auf der Beerdigung ein alter Mann in einem grauen Mantel aufgefallen, mit einem Spazierstock?«, erkundigte er sich.
René und Florence hatten offenbar ihr Gespräch fortgesetzt, während Pierre in Gedanken versunken war. Zumindest schaute René ihn etwas verwundert an, entschloss sich dann aber doch, darüber nachzudenken. »Nein«, sagte er schließlich. »Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, dass ich überhaupt jemanden kenne, der so aussieht.«
»Vielleicht war’s Caillou«, schlug Florence vor.
Unwillig schüttelte Pierre den Kopf. »Nein, Caillou geht bloß bei euch um, es hat ihn noch nie jemand woanders gesehen. Außerdem war das kein Geist. Ich bin ihm heute Morgen auf dem Friedhof schon wieder über den Weg gelaufen. Er kannte meine Mutter.«
»Er kannte deine Mutter?«, fragte René gedehnt. »Hast du mal deinen Vater gefragt? Der wird das doch sicher wissen.«
»Ich glaub nicht, dass ich den im Moment nach so was fragen sollte«, sagte Pierre leise, mehr zu sich selbst. Er dachte an die leere Weinflasche und die geröteten Augen Christophes – und zum wiederholten Mal fielen ihm die Worte des Fremden ein, der gesagt hatte, Pierre würde jetzt gebraucht. Vielleicht war es doch nicht so klug gewesen, auf dem coolen Abgang zu bestehen. Vielleicht hätte er den Fremden nach Strich und Faden ausquetschen sollen. Was, wenn er nun gar nicht so viel Wert auf Pierres Bekanntschaft legte, wie es den Anschein hatte? Dann war die Chance, herauszufinden, was der Mann mit Sylvie zu tun haben mochte, ein für alle Mal vertan.
»Du könntest auch die Familie deiner Mutter fragen.« Das kam von Florence. Pierre schüttelte den Kopf. »Geht nicht. Sie hatte keine.« Andererseits – wenn er genau darüber nachdachte, wusste er eigentlich sehr wenig über Sylvie. Im Gegensatz zu anderen Müttern hatte sie ihn nie mit Geschichten aus ihrer Kindheit gelangweilt, nur weil sie meinte, ihm ein Vorbild sein zu müssen. Möglicherweise gab es ja eine Familie, irgendwo weit weg. Möglicherweise gehörte der Fremde dazu. Immerhin hatte er diesen anderen Namen erwähnt, den Sylvie angeblich bei ihrer Geburt erhalten hatte.
Nach der Pause saß Pierre im Klassenzimmer und starrte vor sich hin, ohne zu sehen, was der Overheadprojektor an die Wand warf. Chemie war noch nie eines seiner Lieblingsfächer gewesen und außerdem gab es ein paar Dinge, die ihm im Kopf herumschwirrten. Schon komisch zum Beispiel, dass Florences Gegenwart so völlig normal schien während ihres Gesprächs. Da war nichts gewesen, das daran erinnerte, wie kurz sie sich erst kannten. Er warf einen Blick hinüber zu ihr. Ihre opalfarbenen Augen schauten unverwandt auf Madame Couvier, die vorn irgendein Experiment vorführte.
Dass Florence ausgerechnet in Caillous Haus lebte, war schon verrückt. Es stand seit ewigen Zeiten leer, Pierre konnte sich gar nicht mehr erinnern, wann zuletzt jemand dort gewohnt hatte. Man munkelte, dass der Makler mit der Zeit enorm mit dem Preis runtergegangen war. Dass sich eine Menge ursprünglicher Interessenten von Caillou oder besser dem Gerede über den angeblichen Geist hatte abschrecken lassen, führte dazu, dass das Haus immer mehr herunterkam. Florences Familie war offensichtlich hart im Nehmen. Ihr schienen weder der schlechte Zustand der Bausubstanz noch irgendwelche Gerüchte etwas auszumachen.
Pierre ließ sich beim letzten Klingeln reichlich Zeit damit, seine Sachen zusammenzupacken. Er war nicht sonderlich erpicht darauf, nach Hause zu kommen und seinem Vater gegenüberzutreten. Sicher ging es ihm nach der vergangenen Nacht noch ziemlich dreckig und Pierre wusste einfach nicht, was er tun konnte, um ihm zu helfen. Als er endlich doch das Schulgelände verließ, sah er zu seiner Verwunderung Florence auf der anderen Straßenseite stehen. Sie lehnte an einer Mauer, von der sie sich jetzt abstieß.
»Ich hab auf dich gewartet«, rief sie ihm zu und kam herüber, nachdem sie zwei Autos hatte vorbeifahren lassen. »Ich dachte, wir könnten ein Stück zusammen gehen.« Pierre nickte – einerseits dankbar, dass ihn Florences Begleitung von den Gedanken an seinen Vater ablenken würde, andererseits etwas unsicher, ob er ein Gesprächsthema finden würde. Darüber hätte er sich keine Sorgen machen müssen. Es war Florence, die die Unterhaltung in Gang brachte.
»Erzähl mir von Caillou.«
»Wieso?«, fragte er verständnislos. »Ich dachte, du weißt schon alles über ihn.«
»Na ja, nicht alles. Die Gerüchte reichten von Mitleid erregend bis hin zu furchtbar schauerlich. Niemand weiß was Genaues, oder?«
»Nein. Aber hauptsächlich gibt es zwei Versionen, da scheiden sich die Geister.«
Florence kicherte über das Wortspiel, unterbrach ihn aber ansonsten nicht.
»Also, es begann vor etwa hundertfünfzig Jahren. Da bestand Rocaille nur aus ein paar Bauernhöfen, einer kleinen Kirche, dem Steinbruch und ein paar armseligen Hütten, in denen die Arbeiter aus dem Steinbruch ihr Dasein fristeten– und Aigle Fauve.«
Aigle Fauve war das Haus, in das Florence mit ihrer Familie gezogen war. Der Name bedeutete Steinadler und passend dazu prangte oben auf dem Dach ein beeindruckender riesiger Adler aus Stein.
»Hast du von den Vincents gehört?«, fragte Pierre.
Florence nickte. »Das waren die Besitzer des Hauses, oder? Denen praktisch das ganze Dorf gehörte, der Steinbruch, die Arbeiter, einfach alles. Sie sollen die Arbeiter ziemlich ausgebeutet haben.«
»Richtig. Sagt jedenfalls die Legende. Den Vincents war die Kirche im Dorf zu klein, sie setzten sich in den Kopf, eine Kathedrale zu bauen, obwohl es gar nicht genug Menschen hier gab, um so ein Gebäude zu füllen. Das Baumaterial für die Kathedrale kam aus dem Steinbruch. Das war harte Arbeit und führte dazu, dass die Männer kaum älter als vierzig wurden.«
»Und Caillou war einer der Arbeiter.«
»Er tauchte eines Tages auf, ohne dass jemand wusste, woher er kam. Die Vincents haben sich auch nicht die Mühe gemacht, danach zu fragen. Jemand wollte Arbeit im Steinbruch, er bekam sie. Ganz einfach. Besonders, wenn die Lohnforderungen nicht zu hoch waren.«
»Wie viel Lohn wollte denn Caillou?«, fragte Florence.
Pierre zuckte mit den Schultern. »Weiß nicht. Manche sagen, er hätte umsonst gearbeitet, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn überhaupt was an der ganzen Geschichte dran ist, dann sicher nicht dieser Teil. Wer schuftet sich schon für nichts zu Tode? Jedenfalls verliebte sich Caillou in Sophie, die Tochter vom alten Vincent. Natürlich passte dem das nicht in den Kram, immerhin war Caillou bloß ein armer Schlucker.«
»Gut aussehend?«, grinste Florence. »Ich meine, nur für den Fall, dass er mir doch mal nachts begegnet, muss ich doch gewappnet sein …«
»Würdest du Wert darauf legen?«
»Kommt drauf an, wie er sich aufführt. Aber gutes Aussehen ist schon mal nicht die schlechteste Voraussetzung.«
Pierre schaute Florence von der Seite an. »Ich weiß nicht. Wie soll einer schon aussehen, der seit hundertfünfzig Jahren durch die Gegend spukt? Da ist garantiert nicht mehr viel Attraktives dran. Aber damals muss er wohl ein Bild von einem Mann gewesen sein.«
Mittlerweile waren sie beim Friedhof angekommen und auf einmal fühlte sich Pierre nicht mehr sehr wohl dabei, über Gespenster und Tote zu reden. Er hielt in seiner Erzählung inne und warf einen Blick durch das Tor auf den Friedhof. Florence bemerkte sein Zögern und blieb stehen.
»Willst du noch mal zu deiner Mutter?«, fragte sie leise. Die Fröhlichkeit, die sie gerade eben noch zur Schau getragen hatte, war wie weggeblasen. Ihre Stimme klang ruhig und ernsthaft.
»Ich …« Pierre wusste die Antwort darauf selbst nicht. Vielleicht war der Fremde wieder da. Aber nein, das war Unsinn. Der Mann würde wohl kaum den ganzen Tag damit verbringen, an einem Grab rumzustehen. Dann traf er eine Entscheidung. »Wenn es dir nichts ausmacht, geh allein nach Hause. Ich bin heute Morgen nicht dazu gekommen, mich richtig zu verabschieden.«
Pierre durchzuckte der Gedanke, dass sich das albern anhörte, aber Florence schien nicht dieser Meinung zu sein. Sie nickte. »Möchtest du, dass ich mitkomme?«
Daran hatte Pierre überhaupt noch nicht gedacht, doch auf einmal schien ihm das eine gute Idee zu sein. »Hast du denn noch so viel Zeit?«
Kommentarlos betrat Florence als Erste den Friedhof. Bis beide vor Sylvies Grab ankamen, schwiegen sie und auch dann herrschte noch eine ganze Weile Stille. Florence wartete ab, bis Pierre nach beinah zehn Minuten bereit schien, wieder in die Gegenwart zurückzufinden. »Vermisst du sie sehr?«
Pierre nickte und erinnerte sich gleichzeitig an die Worte des Fremden, der Sylvie – oder Emeraude, wie er sie nannte – demnach ebenso vermisste. »Es ist schwer, sich vorzustellen, dass sie nie mehr da sein wird.«
»Ja, das kann ich verstehen.« Sie sagte nicht so was Blödes wie »Die Zeit heilt alle Wunden« oder »Das wird schon wieder«. Sie war einfach nur da und konnte nachempfinden, wie er sich fühlte.
Pierre drängte die Tränen zurück, die ihm plötzlich in die Augen stiegen. Deshalb bekam er zuerst nur durch eine Art Nebelschleier mit, dass Florence sich bückte und etwas auf dem Boden zu betrachten schien. Sie richtete sich wieder auf und rieb etwas zwischen ihren Fingern, das aussah wie feiner weißer Staub.
»Was hast du da?«, fragte Pierre.
Florence gab keine Antwort, sondern starrte nur auf ihre Hand.
»Florence?« Pierre stupste sie leicht an, worauf sie zusammenzuckte.
»Schon gut, ist nichts«, murmelte sie abwesend.
Neugierig beugte sich Pierre zu Florence hinüber, nahm ihre Hand in seine und fuhr mit dem Finger über den Staub. »Was ist das?«
»Ach, nur Dreck.«
»Sicher? Sieht merkwürdig aus.« Der Staub war weich und geschmeidig, fast glatt, so als bestünde er nicht aus Tausenden von Partikeln, sondern aus einem einzigen Stück. Dann wurde er sich bewusst, dass er dastand und Florences Hand hielt. Abrupt ließ er sie los und schaute verlegen auf den Blumenberg, der sich auf dem Grab türmte.
Florence schien das überhaupt nicht wahrgenommen zu haben. Mit einer energischen Geste wischte sie sich die Hände an ihren Jeans ab, folgte Pierres Blick und stellte dann fest: »Deine Mutter war ziemlich beliebt.«
»Ja, war sie. Jeder hat sie gemocht.« Pierre stockte. »Lass uns gehen«, sagte er schließlich. »Wird Zeit, dass ich nach Hause komme.«
Wieder auf der Straße, verwirrte die nächste Frage des Mädchens Pierre zunächst. »Was passierte dann?« Doch nach einer Sekunde begriff er, dass sie Caillous Geschichte meinte, die er inzwischen völlig vergessen hatte.
»Kommt drauf an, wen du fragst. Bis zu dem Zeitpunkt, wo Caillou sich in Sophie verliebte, wirst du von allen das Gleiche hören. Von da an gibt es zwei Varianten. Eine besagt, dass Sophie nichts von Caillou wissen wollte, weil sie sich für was Besonderes und Caillou für einen Niemand hielt. Aus verschmähter Liebe ermordete Caillou Sophie, vergrub sie im Steinbruch und erhängte sich danach an dem großen Steinadler auf dem Dach von Aigle Fauve.«
»Klingt nicht sehr romantisch«, beklagte sich Florence.
»Kann man wohl sagen. Aber wenn du’s romantischer haben willst, bitte, kein Problem. Nach der zweiten Fassung nämlich verliebte sich auch Sophie und hörte nicht auf ihre Familie, die ihr jeglichen Umgang mit dem unerwünschten Steinhauer verbat. Trotzdem konnten sie die Finger nicht voneinander lassen, also fühlte sich Sophies Vater gezwungen, einzugreifen. Zusammen mit seinem Sohn brachte er Caillou kaltblütig um, verscharrte ihn im Steinbruch und erzählte Sophie, Caillou habe sich mit einer beträchtlichen Summe Bestechungsgeld aus dem Staub gemacht. Sophie wurde daraufhin wahnsinnig und stürzte sich kopfüber in den Steinbruch. Sie starb genau auf dem Stein, unter dem Caillou begraben lag.«
»Schon besser«, urteilte Florence lachend. »Und welche Version der Geschichte glaubst du?«
»Gar keine. Ich glaub nicht, dass davon auch nur eine Silbe wahr ist. Abgesehen davon vielleicht, dass irgendein Arbeiter damals aufgetaucht und wieder verschwunden ist, ohne einer Menschenseele zu sagen, wo er herkam und wo er hinging.«
»Und Sophie?«
Pierre rollte mit den Augen. »Was weiß ich? Vielleicht ist sie genau an dem Tag aus Langeweile gestorben, an dem der große Unbekannte verschwand. Muss ja damals ziemlich öde hier gewesen sein.«
»Vielleicht. Aber mir gefällt die Gespensterstory besser.«
»Klar. Mädchen eben …«, griente Pierre.
»Besten Dank auch! – Wir sehen uns morgen!«
Der Abschied kam so plötzlich, dass Pierre sich fragte, ob er sie mit seiner flapsigen Bemerkung verletzt hatte. Erst dann sah er, dass sie an der Weggabelung angelangt waren, an der Florence nach links und er nach rechts musste, um nach Hause zu kommen. Sie war schon ein paar Meter gegangen, als Pierre ihr hinterherrief.
»Florence! Danke.«
Florence drehte sich um und lächelte. Schließlich ging sie weiter und verschwand um die nächste Kurve aus Pierres Blickfeld.
4
»Du hast mit dem Jungen gesprochen?«, fragte Diamant fassungslos und wütend zugleich.
Der Mann, der aufrecht vor dem Fürsten stand, blieb unbeeindruckt. »Es war notwendig. Irgendwie müssen wir mit ihm Kontakt aufnehmen, jetzt wo Emeraude …«
»Das kann uns in enorme Schwierigkeiten bringen«, unterbrach Diamant.
»Der Junge nimmt es ziemlich schwer.«
Unwirsch murmelte Diamant etwas vor sich hin. Er war groß, größer als der Mann vor ihm. Seine langen Haare waren sehr blond, fast weiß, und hinten zusammengebunden, seine Augen blau wie helle Aquamarine. Er trug einen weißen Mantel, der ihm bis zu den Knien reichte, darunter ein weißes Hemd und eine weiße, weit ausladende Hose. Seine Hände, die er jetzt hob, um sich die Schläfen zu massieren, waren lang und feingliedrig. An seinem rechten Ringfinger blitzte ein weißgoldener Ring mit einem Diamanten.
»Natürlich«, sagte er jetzt. »Aber Emeraude hat gewusst, was sie tat. Und sie wusste auch, was passieren würde.«
»Seigneur, verzeiht, dass ich widerspreche«, sagte Diamants Gegenüber. »Niemand hat gewusst, dass das passieren würde. Ihr nicht, nicht der Rat der Steinweisen und ich nicht.« Dafür verfluchte er sich am meisten. Nun hielt er sich jedoch in respektvollem Abstand zu seinem Fürsten und wartete. Die Unterredung war noch nicht beendet, obwohl Diamant für eine Weile schwieg.
»Es geht nicht«, sagte er schließlich und richtete seinen Blick auf den Mann in Grau. »Wir können den Jungen nicht hierher bringen, das weißt du so gut wie ich.«
»Mit allem Respekt, Seigneur, wir müssen. Mir ist das Risiko für alle bewusst, aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir haben keine Wahl. Der Junge ist unsere einzige Möglichkeit, Emeraude vor Ablauf des Ultimatums aus den Klauen der Steinbrecher zu befreien. Ihr wisst, was unserem Volk und besonders Euch bevorsteht, wenn uns das nicht gelingt. Davon ganz abgesehen kann Euch, wenn Ihr mir die Bemerkung erlaubt, Emeraudes Schicksal auch nicht egal sein. Schließlich habt Ihr sie einmal geliebt.«
»Daran musst du mich nicht erinnern, Caillou!«, fuhr Diamant auf. Seine Stimme war lauter geworden, sicher lauter als er selbst es beabsichtigt hatte. Er erhob sich und Caillou bemerkte, dass Diamants Hände zitterten. »Sonst gäbe es da einiges, woran ich dich erinnern könnte.«
Caillou zuckte innerlich zusammen, hatte sich aber so weit unter Kontrolle, dass er sich nichts anmerken ließ. Diamant tat so etwas nur selten und vielleicht hatte Caillou es seiner Meinung nach in diesem Moment verdient. Das änderte nichts an den Tatsachen.
Im Saal schien es mit einem Mal dunkler geworden zu sein. Diamant schritt die große Halle hinunter bis zur kunstvoll geschnitzten hohen Holztür. Esche. Dasselbe Material, aus dem Emeraudes Sarg gezimmert war. Nein, nicht Emeraudes Sarg, korrigierte sich Caillou in Gedanken. Sylvies Sarg. Als hätte Christophe es gewusst. Nun ja, vielleicht hatte er es gewusst. Das war die zweite Gefahrenquelle. Denn obwohl Caillou Emeraude hin und wieder gesehen und sich über ihr Leben auf dem Laufenden gehalten hatte, hatte er niemals mit ihr gesprochen, sich ihr nicht einmal gezeigt. Er wollte sich nicht einmischen, sie hatte ihre Wahl getroffen, es war ihr Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Das allerdings barg den Nachteil, dass sie nie in Erfahrung bringen konnten, wie viel Emeraude ihrem Mann erzählte. Nur der Junge wusste ganz offensichtlich nichts.
Pierre. Diamants Widerstreben, Emeraudes Sohn hierher zu bringen, war verständlich. Je mehr Menschen von dem Leben, das sich direkt unter ihren Füßen abspielte, wussten, desto größer war die Gefahr für die Steinwelt. Die Gefahr, die ihnen in Gestalt von Silex entgegentrat, war jedoch ungleich größer.
Wie er nicht gerade zur Freude Diamants erwähnt hatte, kamen dazu noch die persönlichen Interessen des Fürsten. Emeraude war seine Braut gewesen, die Steinprinzessin. Auf der Oberwelt gab es ein Sprichwort, das besagte, die Zeit heile alle Wunden. Aber es war erst eine geradezu läppische Zeitspanne vergangen, seit Emeraude sich gegen ihn entschieden hatte. Für die Oberwelt mochten achtzehn Jahre lang sein, aber hier unten zählte man anders. Es gab nicht einmal Jahre in diesem Sinne. Selbst wenn es einen Kalender gegeben hätte, der sich am Mond, an der Sonne oder an Jahreszeiten orientierte – an all jenem also, was hier unten gar nicht existierte –, stellten Oberweltjahre eine zu kleine Maßeinheit für die Steinwelt dar, als dass sich damit zu rechnen gelohnt hätte. Stattdessen zählte man in Generationen und Anteilen von Generationen – und Emeraudes vergleichsweise kurzer Ausflug in die Welt über ihnen entsprach nur etwa einem Zehntel einer Generation. Für Diamant musste dieser Bruchteil absolut unbedeutend sein.
»Ich werde darüber nachdenken«, ließ Diamant vom anderen Ende der Halle vernehmen. Er öffnete die schwere Eschentür und verschwand.
»Dazu ist keine Zeit!«, hätte Caillou dem Herrscher über die Steinmenschen hinterherrufen müssen. Das Ultimatum lief bald ab. Doch er blieb still, weil er wusste, dass er mit Drängen bei Diamant gar nichts erreichte. Er seufzte und sah sich um. Das hier war der Empfangssaal, der an die dreihundert Leute fasste. Schon oft hatte Caillou miterlebt, dass der Saal trotz seiner Größe bis zum Bersten gefüllt war. Jetzt, da er allein darin stand, wirkten die Wände beinah bedrohlich, schienen auf ihn zuzukommen. Aber er wusste, das beruhte nur auf Einbildung. Die letzte Zeit war nicht einfach gewesen, die Steinbrecher bereiteten mehr und mehr Probleme. Außerdem hatte Caillou zweimal kurz hintereinander die Welt der Menschen da oben besuchen müssen. Er fühlte sich ein wenig erschöpft.
Langsam folgte er Diamant, wandte sich aber nicht wie der Fürst nach links, sondern schlug auf dem Gang die entgegengesetzte Richtung ein, die zum Tor des Palastes führte. Unterwegs begegneten ihm nur zwei Diener, die sich kurz im Vorbeigehen verbeugten. Abwesend erwiderte Caillou die Geste. Er hatte andere Dinge im Kopf. Silex zum Beispiel, der Emeraude gefangen hielt. Bei dem Gedanken an die Steinprinzessin musste er unwillkürlich an seine eigene Frau denken. Ein kurzes Lächeln glitt über seine Züge, dann wurde er wieder ernst.
Die Steinprinzessin. Diamant hatte sich nie eine andere Frau genommen. Caillou war beinah sicher, dass er Emeraude noch immer liebte. Sylvie – was für ein alberner Name!
Der lange Gang führte Caillou in den Hof und schließlich hinaus ins Freie. Er ließ die Stadt hinter sich und schritt den Weg entlang, der ihn an dem Stalagmitenwald und einem Felsvorsprung vorbei zu seinem Haus bringen würde. Hier unten gab es keinen unbegrenzten strahlenden Himmel wie in der Welt über ihnen. Stattdessen war der Himmel steinern und schimmerte rötlich oder braun oder grau, ganz selten schwarz. Es kam auf die Gesteinsschichten an, unter denen man sich gerade bewegte. Manchmal hatte Caillou das Gefühl, er könnte die Sonne der Oberwelt spüren, obwohl das natürlich nicht zutraf. Das Klima hier blieb immer gleich. Es herrschte eine angenehme Temperatur und Luftfeuchtigkeit, anders als auf der Oberwelt mit dem ständigen Wechsel des Wetters. Seit er als Kind das erste Mal von der Legende der Oberwelt gehört hatte, war er fast besessen von dem Wunsch gewesen, sie irgendwann zu sehen. Er hatte lange damit zugebracht, einen Weg zu finden. Schließlich fand er ihn. Und fragte sich am Ende, was daran so erstrebenswert gewesen sein sollte. Wenigstens kannte man in der Steinwelt seine Feinde, was sich von der Welt da oben nicht behaupten ließ. Aber er wollte nicht undankbar sein. Wäre er hier geblieben, hätte etwas sehr Wesentliches in seinem Leben gefehlt.
Caillou legte den Kopf in den Nacken. Das dunkelrote metallhaltige Gestein strahlte zumindest ein spärliches Licht aus, das Wärme verbreitete und ihm gut tat. Es fröstelte ihn noch immer, wenn er an sein Zusammentreffen mit Pierre dachte. Zweifellos hatte der Junge mittlerweile eine ganze Menge Fragen. Das lag durchaus in Caillous Absicht. Denn wenn es ihm gelingen sollte, Pierre hierher zu bringen, musste Emeraudes Sohn dazu bereit sein. Er sah nicht gerade aus wie jemand, der allzu wild auf Abenteuer war, aber er schien neugierig. Pluspunkt für Caillou, für die Steinwelt – und für Emeraude.
Was war sie schön gewesen damals! Schön und stur, er hatte nicht übertrieben mit dem, was er zu Pierre gesagt hatte.
Caillou seufzte. Genau genommen konnte er froh sein, dass Diamant seine Wut und Enttäuschung nicht an ihm ausgelassen hatte, denn ohne Caillou wäre auch Emeraude vermutlich nie auf die Oberwelt gekommen.
*
»Caillou, Caillou!«, hörte er ein kleines Mädchen rufen. Er sah sich um, doch da war niemand. Nur die Schatten seiner Erinnerung und die Stimme Emeraudes, damals noch ein Kind mit weißblondem Haar, fast so hell wie das von Diamant. Er sah sie vor sich, mit ihren hoffnungsvollen, unglaublich grünen Augen, die ihn dazu aufforderten, von der Welt über ihnen zu erzählen, die sie so unbedingt sehen wollte.
»Aber Emeraude«, lachte Caillou und strich ihr durch die blonden Haare. »Was willst du dort? Es ist …« nicht anders als hier, wollte er sagen. Aber das stimmte natürlich nicht. Es war ganz anders. Das Blau des Himmels beispielsweise, wenn die Sonne schien. Das Farbenspiel der Blätter im Herbst. All das würde Emeraude nie sehen. »Es ist nichts Besonderes«, schloss Caillou. »Wir gehören hierher, nicht dort oben hin. Die Menschen würden uns nicht verstehen, die Sonne ist zu grell und die Atmosphäre nicht gut für uns.«
»Aber du warst dort. Dir hat die Atmosphäre nichts getan.«
Emeraudes Vorstellung von dem, was Caillou Atmosphäre nannte, war äußerst vage, sie dachte nur an das Abenteuer. Sie wusste nichts von den Gefahren, die die Oberwelt barg, Gefahren, die man zunächst gar nicht bemerkte.
»Ich werde es schaffen«, sagte Emeraude. »Ich werde nach oben gehen und die Sonne sehen.«
»Aber …«, fing Caillou an.
»Ich weiß, was du sagen willst, Caillou, du hast es mir oft genug gepredigt.« Plötzlich klang Emeraudes Stimme erwachsener, fester – und noch sturer. Caillous Erinnerung machte einen Zeitsprung, ohne dass er sich dessen bewusst war. Emeraude war nun kein Kind mehr, sondern eine junge Frau, die wusste, was sie wollte. Unglücklicherweise nicht das, was von ihr erwartet wurde.
»Heiraten kann ich immer noch. Niemand sollte von mir verlangen, dass ich mich hier vergrabe, ohne vorher was erlebt zu haben.«
Emeraude und Caillou saßen auf einem Felsvorsprung und schauten hinunter in eine bräunlich rote Ebene, durch die ein Fluss verlief, dessen Wasser sich in der Farbe kaum von seiner Umgebung unterschied. Dort unten knieten ein paar Frauen und wuschen mühevoll ihre Wäsche. Kinder saßen daneben und halfen unter Aufbietung ihrer ganzen Kraft, die großen schweren Teile auszuwringen.
»Der Fluss dort«, fuhr Emeraude fort, bevor Caillou dazu kam, einzuwenden, dass eine Heirat wohl kaum damit gleichzusetzen sei, sich zu vergraben, »er kommt von irgendwo und fließt irgendwohin. Aber ich kenne nur dieses kleine Stück seiner Reise. Das ist mir zu wenig, kannst du das nicht verstehen?«