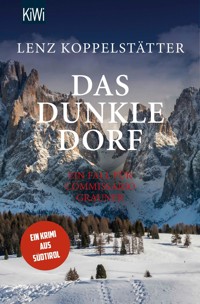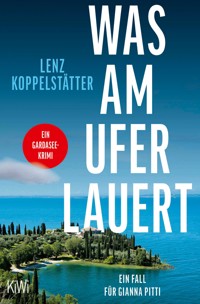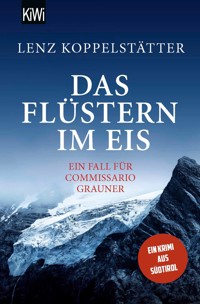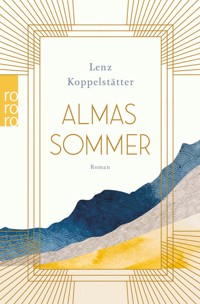9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Grauner ermittelt
- Sprache: Deutsch
Südtiroler Charme und ein hochspannender Fall aus einem Tal, das einst berühmte Schriftsteller beherbergte Am Rande eines 300-Seelen-Dorfes wird an einem Frühlingsmorgen die Leiche eines Mädchens entdeckt. Blutüberströmt liegt sie bei den Urlärchen von St. Gertraud, die jedes Kind in Südtirol kennt. Generationen lang haben die Bäume allem getrotzt, Wind, Wetter und den Menschen; unter ihren Wurzeln soll sich der Eingang zur Hölle befinden. In ihrem neuen Fall ermitteln Grauner und Saltapepe im Ultental, dessen Bewohner schweigsam, stolz und gottesfürchtig sind. Erstaunlich schnell ist ein Geständiger gefunden: Haller, ein zugezogener Architekt. Die Dorfgemeinschaft aber sagt: Haller deckt nur seinen Sohn Michl, der seltsam ist und niemandem geheuer. Und auch Grauner ahnt, dass alles komplizierter ist. Zumal unweit des Tatorts altertümlich anmutende Schriftstücke gefunden werden. Sie könnten aus den verschollenen Tagebüchern eines berühmten Gastes der Ultentaler Heilbäder stammen. Und sie berichten von einem kaltblütigen Mord, der vor über hundert Jahren geschah. Einem Mord, der das Dorf bis heute umtreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Lenz Koppelstätter
Die Stille der Lärchen
Ein Fall für Commissario Grauner
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Lenz Koppelstätter
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Lenz Koppelstätter
Lenz Koppelstätter, Jahrgang 1982, ist in Südtirol geboren und aufgewachsen. Er arbeitet als Medienentwickler und als Reporter für Magazine wie »Geo Special«, »Geo Saison« oder »Salon«. »Die Stille der Lärchen« ist nach »Der Tote am Gletscher« der zweite Band der beliebten Kriminalreihe um Commissario Grauner.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Am Rande eines Dreihundertseelendorfes wird an einem Frühlingsmorgen die Leiche der jungen Marie entdeckt. Blutüberströmt liegt sie bei den Urlärchen von St. Gertraud, die jedes Kind in Südtirol kennt. Generationen lang haben die Bäume allem getrotzt, Wind, Wetter und den Menschen; unter ihren Wurzeln soll sich der Eingang zur Hölle befinden. In ihrem neuen Fall ermitteln Grauner und sein neapolitanischer Kollege Saltapepe im Ultental, dessen Bewohner schweigsam, stolz und gottesfürchtig sind. Erstaunlich schnell ist ein Geständiger gefunden: ein zugezogener Architekt. Die Dorfgemeinschaft aber sagt: Dieser deckt nur seinen Sohn Michl, der seltsam ist und niemandem geheuer. Und auch Grauner ahnt, dass alles komplizierter ist. Zumal unweit des Tatorts altertümlich anmutende Schriftstücke gefunden werden. Sie könnten aus den verschollenen Tagebüchern eines berühmten Gastes der Ultentaler Heilbäder stammen. Und sie berichten von einem Geheimnis, das über hundert Jahre bewahrt wurde. Einem Geheimnis, das die Dorfbewohner noch immer umtreibt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2016, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © plainpicture/robertharding/Roberto Moiola
Karten zum Buch: Oliver Wetterauer
Illustration als Abschnittstrenner im Text: Oliver Wetterauer
ISBN978-3-462-31613-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-die-stille-der-laerchen
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Prolog
26. März
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
27. März
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
28. März
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
29. März
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Epilog
Danke
Leseprobe »Was der See birgt«
Die Handlung dieses Romans ist frei erfunden.
Auch alle Personen sind erfunden.
Nur die Lärchen gibt es wirklich.
Und sie werden noch sein, wenn wir längst nicht mehr sind.
Prolog
Die Stille gibt es nicht. Schon gar nicht jetzt, wenn es plätschert und taut. Glaubt man, es ist still, ganz still, dann rauscht immer noch ein Bach in der Ferne. Dann raschelt der Wind in den Baumwipfeln, dann springt ein Rehkitz durchs Gebüsch, dann haut ein Specht seinen Schnabel ins Holz, dann ruft ein Kuckuck, dann zwitschern sich frühlingsverliebt zwei Rotkehlchen zu.
Stille, absolute Stille, die gibt es nur im Himmel, sagten die Rosenkranzfrauen von St. Gertraud. Oben, hinter den Wolken, jenseits des Blaus. Oben, inmitten der Sterne, die da funkeln. Wenn es still ist, ganz still, dann bist du nicht mehr auf Erden, sagten die Frauen. Nur wenn einer stirbt, dann hält auch auf Erden die Totenstille Einzug. Dann plätschert einen Wimpernschlag lang nichts. Dann rauscht nichts, raschelt nichts. Dann klopft nichts, zwitschert nichts. Dann ist es still, still, lärchenstill.
Natürlich wird sie in den Himmel kommen, die Marie, sagten die Rosenkranzfrauen, die drei Tage und drei Nächte lang auf den Bänken der Pfarrkirche des Dreihundertseelenortes knieten, um für sie zu beten. Ein Vaterunser, ein Gegrüßet seist du, Maria, ein Glaubensbekenntnis und dann alles, all das Flehen, die Huldigungen, die Lobpreisungen, noch einmal von vorne.
Sie beteten noch, als ihre Knie längst taub geworden waren. Sie beteten noch, als sich das kantige Holz der Kirchenbänke bereits schmerzhaft in ihr Fleisch geschnitten hatte.
Die Bewohner des Ultentals waren gottesfürchtige Leut’ – und die Rosenkranzfrauen von St. Gertraud waren die allergottesfürchtigsten unter ihnen.
Natürlich wird sie in den Himmel kommen, flüsterten die Leut’ in St. Gertraud, als sie sich draußen vor dem Kirchentor begegneten. Weil wir sie salben, beweinen, beklagen. Weil wir sie in einen weißen Sarg legen, unschuldsweiß – weil sie fast noch ein Kind war.
Sie wird in den Himmel kommen, weil Kinder noch ohne Sünde sind. Weil der Herr Pfarrer sie segnen wird, die Marie, dies blutjung heimgeholte Gottesgeschöpf.
Schöne Haare hat sie gehabt, goldenschön, flüsterten die Leut’, und große blaue Augen, engelsblau.
Im Höllenschlund, der dort seinen Eingang hatte, dessen waren sich alle gewiss, wo eine der alten Lärchen unter ihrem Stamm ein sandiges Loch offenbarte – da war es nicht still. Da spürst du die hochkommende Hitze, sagten die Frauen, da erhascht dich der Funke der lodernden Feuer, da schreien die Seelen der Verdammten. Die der Todsünder. Die der Fleischeslüstigen. Die der Völlerer. Die der Gottesächter. Die der Mörder. Und all die Seelen jener, für die niemand gebetet hat.
Mancher Sünder mag in den Himmel kommen. Wenn er bereut, wenn er Buße tut, wenn die Frommen für ihn klagen. Doch manchem bleibt er verwehrt. Da hilft kein Klagen, keine Buße, keine Reue, kein Beten.
Für den Michl, sagten die Rosenkranzfrauen von St. Gertraud, wird es nicht reichen. Was der Michl getan hat, sagten sie, das kann ihm keiner verzeihen. Auch der liebe Gott nicht. Für den Michl beteten sie nicht. Der Michl sollte sterben. Und in die Hölle kommen. Hinab ins sandige Lärchenloch. Das sollte seine gerechte Strafe sein, das wünschten sie ihm.
Sie saß da, so schien es Benedikt Haller, als schliefe sie mit offenen Augen. Als träumte sie einen Tagtraum. Die Pupillen starrten ihn an. Er schauderte, und ihm war bewusst, dass er diesen Moment, diesen Blick aus diesen toten, offenen Augen, sein ganzes verdammtes restliches Leben lang nicht mehr vergessen würde.
Es schien ihm, als atmete sie noch. Doch es war nicht der Brustkorb, der ihr weißes Kleid und ihre Wolljacke hob und senkte. Es war der mit dem Stoff spielende Wind. Der Wind, er hob auch ihre blonden Strähnchen. Sie kitzelten ihr Gesicht. Aus ihrem offenen Mund war Blut gequollen. Es haftete verkrustet an ihrem Kinn. Rund um ihr Herz hatte es sich in die Fasern des Kleids und der Jacke gefressen.
»Marie!«, sagte Haller, »Marie!«
Er drückte das Gesicht gegen die Scheibe des bodentiefen Fensters und legte auch die Hände auf das kalte Glas. Kurz schloss er die Augen, fest, bis er hinter den geschlossenen Lidern Sterne sah. Je fester er drückte, so hoffte er, desto eher könne alles verschwunden sein, wenn er die Augen wieder öffnete – vielleicht, so dachte er, war alles nur ein kurzer, böser Traum.
Aber alles war noch da. Alles war real: der Wald, der hinter dem mit Moos überwachsenen Holzzaun begann. Das tote Mädchen, das am Stamm einer der alten Lärchen lehnte. Das Rot an ihrer Brust und um ihren Mund. Das Rot wirkte dunkler als Blut, so als hätte sie sich nur mit Kirschmarmelade befleckt.
Benedikt Haller nahm die Hände von der Fensterscheibe, blutrote Streifen blieben zurück. Dann ging er zum Glastisch, der neben den geschwungenen Sofasesseln in der Mitte des lichtdurchfluteten Raumes stand. Einige Architekturzeitschriften lagen darauf, akkurat gestapelt. Haller hasste es, wenn nicht alles seine Ordnung hatte. Er entdeckte einen Brotkrümel auf dem Tisch, schnappte mit zwei Fingern danach und ließ ihn in der Hosentasche verschwinden. Haller hasste Krümel. Er hasste Flecken. Haller hasste Schmutz. Er hasste es, wenn seine Schuhe von einer Staubschicht überzogen waren.
Haller wischte die Glaswand sauber und wusch sich die Hände, das dunkle Wasser verschwand im Abguss des Edelstahlwaschbeckens. Er rieb die Finger mit einem weißen Handtuch trocken und spürte Freude in sich hochkriechen, als er bemerkte, dass das Tuch dadurch zwar nass, aber nicht schmutzig geworden war. Er faltete es sorgsam und legte es auf die Marmorplatte neben dem Designerherd.
Haller war Perfektionist. Die Natur ist perfekt, auf ihre Weise, und der Mensch hat es auch zu sein, auf seine Weise, das sagte er oft, auch wenn ihm dabei niemand zuhörte. Haller bewunderte die Natur. Aber er verstand sie nicht. Sie faszinierte ihn, aber er traute ihr nicht. Sie zog ihn an, doch er hielt sie auf Distanz.
Haller lebte schon seit über einem Jahr in diesem hintersten Teil des Ultentals, aber noch nie war es ihm in den Sinn gekommen, sich ein Beil zu schnappen, um das gestapelte Holz zu hacken, auf einer Lichtung Beeren zu sammeln, im Winter eine Skitour zu unternehmen, sich im Sommer in eine ungemähte Wiese zu legen.
Haller verbrachte seine Zeit am liebsten im verglasten Wohnzimmer. Von einer Seite konnte er so in den Wald blicken, auf die drei Lärchen, die schon Hunderten Wintern getrotzt hatten. Von der anderen Seite reichte der Blick hinunter ins Tal.
Haller liebte es, hier zu stehen, sich im Kreis zu drehen, ein Glas Blauburgunder in der Hand, und rauszuschauen, auf diese wundersame Welt. Haller war anders. Das war ihm schon klar. Er war nicht Teil der Natur so wie die Menschen aus dem Tal. Er war nicht Teil der Wälder, nicht Teil der Gipfel, des Peilstein, der Gleckspitze, des Laugen und des Hasenöhrl. Er war nicht Teil des schwarzen Wassers im Zoggler-Stausee, das immerfort gegen die Ufersteine klatschte. Er war nicht Teil des Zwölf-Uhr-Mittags-Geläuts der Pfarrkirche, er war keiner der Männer, die im Schwarzen Adler ihre Wattkarten auf die Holztische knallten und nach der Bella – der Revanche der Revanche – noch ein paar schwere Kugeln in die Holzkegel der neuen Kegelbahn krachen ließen.
Haller war nicht Teil dieser Welt, das wollte er auch niemals sein. Aber sie zu beobachten, das gefiel ihm.
Haller nahm sein Smartphone in die Hand und wählte die Nummer der Questura in Bozen. Dann ging er über die frei hängende Treppe in den oberen Bereich des Glaskubus. Aus Michaels Zimmer tönte laute Musik.
26. März
1
Das Dorf war wie ausgestorben, als Grauner es erreichte. Er parkte seinen Panda vor der Kirche, die auf einer kleinen Anhöhe thronte. Er holte den Stein, den er neuerdings mit sich herumfuhr, aus dem Kofferraum. Die Handbremse hielt mittlerweile überhaupt nicht mehr, und er war es leid, immer und überall nach passenden Brocken oder Holzstücken zu suchen, um sie hinter eins der Räder zu legen.
Die goldenen Zeiger der Kirchturmuhr standen auf halb neun, es war noch etwas frisch, hier, auf tausendfünfhundert Meter Meereshöhe. Im Schatten der Wälder würde es den ganzen Tag über kühl bleiben, aber über den Bäumen würde die Sonne ihre weißgelben Strahlen in den wolkenlosen Himmel setzen.
Grauner blickte in die Höhe, in die sich der spitze Kirchturm mit seinen rotkäppchenroten Schindeln reckte, dann schaute er in die Tiefe, wo sich die Falschauer voller Gletscherwasser aus dem Tal hinauswand.
Es war ein typischer Südtiroler Frühlingsmorgen. Grauner war gut gelaunt, und das hatte damit zu tun, dass er inmitten dieses Dorfes im hintersten Ultental stand und den Tag nicht an seinem Schreibtisch verbringen würde, auf dem sich die Akten gipfelhoch türmten. Auf dieses Glück hatte er am frühen Morgen noch nicht zu hoffen gewagt. Die vergangenen Tage hatten an seinen lädierten Nerven gezerrt. Claudio Saltapepe, sein Ispettore, war vier Wochen lang in dessen Heimatstadt Neapel gewesen. Und so hatte Grauner das Büro zwar für sich alleine gehabt – aber auch die doppelte Arbeit.
Nun atmete er vergnügt die frische Bergluft ein. Doch gleichzeitig plagte ihn ob seiner guten Laune auch das schlechte Gewissen. Schließlich war ein Mord passiert. Zumindest hatte sich am Telefon alles danach angehört. Und nur dieser Mord hatte es ihm ermöglicht, nicht in der Questura schmachten zu müssen.
Grauner, der außer Commissario auch Viechbauer war, hatte die frühen Morgenstunden im Stall verbracht. Er hatte während des Ausmistens Mahlers Dritte gehört. Es war so, dass er immer eine Zeit lang von einer der Sinfonien nicht genug kriegen konnte, sie dann Woche für Woche hörte, bevor er sich von ihr erholen musste und ein anderes Stück an der Reihe war. Zum Ausmisten, dachte Grauner, passte die Dritte gut, besonders der vierte Satz, bei dem sich die Harfen wie ein Grauen hervortaten; und dann das liebliche Altsolo, das warnend riet: O Mensch! Gib acht! Die Welt ist tief … Tief ist ihr Weh …
Grauner flüsterte seinen Kühen währenddessen beruhigende Worte zu und klopfte ihnen liebevoll auf den Rücken. Der Mitzi, der Margarete, der Marta, der Josefine, der Olga, der Mara. Jeder gleich lang. Denn seine Kühe merkten genau, wenn er einer mehr Zuneigung schenkte als den anderen, und dann muhten sie protestierend. Nur wenn eine trächtig war oder gerade gekalbt hatte, wurde die Sonderbehandlung schweigend akzeptiert.
Der Commissario liebte den Geruch von Kuhmist am Morgen. Er atmete ihn tief ein, er konnte nicht genau sagen, welche Gefühle die dampfende Würze in ihm auslöste. Geborgenheit? Innere Ruhe? Kindheitserinnerungen? Draußen vor dem Stall mochte ein neuer Tag anbrechen, mit neuen Grausamkeiten, mit neuem Irrsinn. Drinnen im Stall war alles gut. Das Donnern der Geigen. Das Muhen der Kälber. So konnte der Tag erwachen.
Um sieben Uhr war Grauner vom Stall in die Stube gekommen, um mit seiner Frau Alba das Birnenkompott umzufüllen, welches sie aus den Früchten der drei Bäume, die an der Südseite des Graunerhofs standen, gemacht hatten. Ein zufälliger Blick auf sein Handy zeigte neun unbeantwortete Anrufe in Abwesenheit von Sovrintendente Piero Marché, einem seiner Mitarbeiter.
Der Commissario hatte den Klingelton nachts ausgeschaltet, nun stellte er ihn auf laut, suchte nach der Rückruffunktion, doch da rief der Sovrintendente schon zum zehnten Mal an.
»Hier ist Marché«, sagte Marché – und dann nichts mehr.
Er wartete auf eine Reaktion. Aber Grauner antwortete nicht. Er wartete ebenso. Darauf, was da noch kommen würde. Er wartete vergebens.
»Ja, Marché«, sagte er schließlich. »Sprich weiter! Warum rufst du mich an?«
»Weil wir im Ultental sind. Auf dem Weg nach St. Gertraud.«
Grauner hörte das Sirenengeheul im Hintergrund. Marché saß in einem der Polizeiwagen. Klar, dachte der Commissario, bin ich einmal nicht dabei, werden die Sirenen aufgedreht. Er mochte das nicht. Meistens waren Sirenen unnütz. Man machte sich bei der Bevölkerung nur unbeliebt. Die Sirene der Feuerwehr, das war die Sinfonie der Flammenhelden, das Geheul der Polizei, das Requiem der Spielverderber.
Grauner unterdrückte einen Flucher und sparte sich den süffisanten Unterton, den Marché ohnehin nicht heraushören würde: »Gut, und warum seid ihr alle unterwegs nach St. Gertraud?«
Es knisterte, die Sirenen stockten. Der Handyempfang in Südtirols Tälern ließ zu wünschen übrig.
»Äh, ja, ja, weil – – – einer hat uns angerufen. Da liegt ein totes Mädchen – – – erschossen.«
Dann brach die Verbindung ab.
Einige Minuten später bog Commissario Johann Grauner vom Graunerhof hoch über dem Eisacktal von den Serpentinen in die Staatsstraße ein und schleckte sich dabei das Birnenkompott von den Fingern. Auf der MeBo erreichte der Panda klappernd die hundert Stundenkilometer. Bei Lana bog die Straße links ab, über die Gaulschlucht hinweg zog sie sich im Zickzack den Hang empor. Oben angelangt, begann das ins Ortlermassiv eingebettete Tal, in dem sich bereits tausend Jahre vor Christus die ersten Menschen angesiedelt hatten.
Wilde Kirschbäume säumten die Leitplanken, die Stämme mächtiger Nussbäume waren mit Efeu bewachsen. Schilder warnten vor Steinschlag und Rotwild. Zwei Tunnel, finster wie Stollen, führten durch den Fels. Am Ende der Tunnel hingen die Kieferngewächse des Mischwalds in tausend grünen Farbschattierungen über die Fahrbahn. Farne und Rotklee wucherten. Knospen platzten. Bienen summten. Bauernhöfe und Heustadel am Straßenrand wechselten sich ab. Auf die Gemäuer der Häuser waren Jagdszenen gemalt, geschulterte Gewehre, prächtige Auerhähne, manchmal auch die Muttergottes.
Grauner ließ die Dörfer St. Pankraz und St. Walburg hinter sich und passierte die mit geschmolzenem Gipfelschnee gefüllten Stauseen; frisches Nass, es sorgte für grüne Frühlingswiesen, für saftiges Holz in den Wäldern, für satt gefressene Kühe, für dickflüssige Milch, für neues Leben.
Der Commissario erreichte Kuppelwies, St. Nikolaus und schließlich St. Gertraud. Die Dörfer waren zu Dörfchen geworden. Die Täler, das wusste Grauner, hatten eigene Gesetze. Und je tiefer sie lagen, je kleiner die Orte waren, desto schweigsamer, stolzer und gottesfürchtiger die Bewohner.
Der Commissario hielt sein Handy in die Höhe. Kein Netz. Er packte den Stein wieder in den Kofferraum, fuhr den Hügel wieder hinunter. Als er das Dorfgasthaus erreichte, hatte er immer noch keine Menschenseele gesehen. Wo waren die alle? Er trat ein.
Der Wirt stand alleine hinter dem Budl des Schwarzen Adler. Er hatte ein Küchentuch über die Schultern gelegt, mit einem zweiten polierte er Weingläser. Der Mann trug lange rauchgraue Haare und einen rauchgrauen Stoppelbart. Seine Unterarme waren mit verschwommenen Tätowierungen verziert.
»Grüß Gott«, sagte Grauner.
»Was darf’s sein?«, fragte der Wirt und musterte den Commissario dabei mit einem Blick, der sagte: Sei du dir mal nicht so sicher, dass du was bekommst. Wer bist du eigentlich? Und was willst du bei uns?
»Erst mal nichts, danke«, antwortete Grauner, der den Blick verstanden hatte. »Ich wollte …«
»Nichts gibt es nicht«, unterbrach ihn der Wirt.
Grauner nahm die Brieftasche in die Hand und fischte zwischen den Geldscheinen das Tesserino hervor, das ihn als Commissario auswies. Er hielt es dem Wirt hin, doch der schaute sichtlich bemüht nicht darauf und griff nach einem neuen Glas.
»Wo sind alle?«, fragte Grauner.
»Wer alle?«, erwiderte der Wirt.
»Na alle, die Dorfbewohner. Draußen …« Grauner zeigte zum Fenster raus, das mit blutroten Gardinen aus grobem Stoff behangen war, »… hier«, nun zeigte er auf die leeren Tische, die so wirkten, als ob gerade eben noch reges Gasthaustreiben geherrscht hätte. Es war gespenstisch: Halb leere Espressotassen standen herum, auch ein, zwei halb ausgetrunkene Weißweingläser. Wattkarten lagen ausgespielt in der Mitte der Tische. Ein Schellkönig, der den Herzober stach. Eine Laubacht, die den Schlag verriet.
Es war, als ob alle Dorfbewohner sich vom einen auf den anderen Moment in Luft aufgelöst hätten. Grauner spürte die Gänsehaut, die sich bei diesem Gedanken auf seinen Armen ausbreitete. Auch ein Polizeiauto hatte er nicht entdeckt. Marché, Saltapepe – die mussten doch schon längst hier sein. Gerade wollte er sein Handy aus der Jackentasche holen, um noch einmal zu versuchen, einen der beiden anzurufen, da stellte der Wirt das Glas ab und räusperte sich.
»Die sind alle hinauf zu den Lärchen.«
Grauner, der eben noch zum Fenster hinaus auf das Stillleben des Platzes geschaut hatte, drehte sich wieder zu dem Mann um.
»Die sind oben bei den Lärchen, da, wo die tote Marie liegt«, präzisierte der Wirt.
Dem Commissario kroch die Gänsehaut über den Nacken.
Der Wirt erklärte ihm in knappen Worten den Weg. »Ist ja logisch, dass die oben sind. Passiert nicht alle Tage so ein Mord bei uns«, sagte er.
Grauner bestellte einen Schwarzen, kippte ihn heiß in den Rachen, bezahlte, murmelte ein »Wiederschauen« und trat vor die Tür.
An der Bushaltestelle neben dem Gasthaus saßen ein paar Buben auf Vespas, die in knalligen Farben besprüht waren. Granny-Smith-Grün. Ferrari-Rot. Gewürztraminer-Gelb. Sie rauchten und schauten zum Commissario. Hatte er die vorhin übersehen? Waren die gerade erst gekommen? Hatte er sie überhört? Das war unmöglich. Die Vespas der Jugendlichen waren, wie in allen Dörfern, dermaßen illegal auffrisiert, dass selbst Polizeisirenen gegen den Lärm nicht ankamen.
Grauner machte einen Schritt auf die Buben zu, da warfen sie ihre Zigaretten auf den gepflasterten Boden, traten in ihre Anlasser und ließen die Motoren aufheulen. Dem Commissario war klar, dass er ihnen mit dem Panda nicht würde folgen können. Aber es war ihm auch egal. Er war schließlich kein Verkehrspolizist.
In dem Augenblick, als Grauner den Stein vom Hinterrad entfernte, um ihn in den Kofferraum zu hieven, ertönte ein Knall, das Echo der Berge multiplizierte ihn. Grauner kannte den Knall. Es war der einer Beretta, wie die Polizia di Stato sie benutzte. Wie er selbst eine im Handschuhfach liegen hatte.
2
Die Bewohner von St. Gertraud standen im Halbkreis um die Lärchen herum. Das halbe Dutzend Polizisten tat sich nicht leicht, sie auf Abstand zu halten. Schon von Weitem spürte Grauner die aggressive Stimmung. Es wurde geschoben und gestoßen, gedrückt und gezogen. Hunde bellten. Der Commissario kämpfte sich durch die Menge und bückte sich unter dem rot-weiß gestreiften Sicherheitsband hindurch.
Er blieb stehen und blickte auf ein paar alte Gehöfte, die sich in der Nähe befanden. Auf ihr sonnverbranntes Holz und die schweren Steine, die auf den Dächern lagen. Es waren Schindeldächer aus harzigem Lärchenholz, die hundert Jahre und mehr überdauerten. Die Häuser lagen am Hang, etwa zehn Meter tiefer als die versammelte Menge, die hinter dem Absperrband wütete. Daneben erhob sich ein Neubau aus Glas und Beton samt einem Flachdach ohne Schindeln; hineingepinselt in ein Historienaquarell.
Der Commissario wandte den Blick ab und schaute in die Gesichter der Menschen: Er blickte in verweinte Augen und in zornige Mienen. Einige Frauen, ganz in Schwarz gekleidet, hatten sich etwas abseits versammelt. Sie schienen zu beten. Neben ihnen stand ein dürrer Mann, auch er ganz in Schwarz, es musste der Pfarrer sein.
Grauner drehte sich um. Vor ihm erhoben sich die Giganten. Über dreißig Meter hoch. Über sieben Meter im Umfang. Jedes Kind in Südtirol kannte die Urlärchen von St. Gertraud. Bei einem 1930 umgestürzten Exemplar hatte man angeblich über zweitausend Jahresringe gezählt.
Der Commissario betrachtete das morsche Geäst, das sich in alle Richtungen streckte und Fledermäusen, Mardern und Eulen Unterschlupf bot. Er sah die Geschwülste, knollenförmige Wucherungen, die sich am oberen Teil der Stämme aufblähten, von Flechten, Pilzen, Algen und Moosen befallen.
Sie waren nicht schön, diese nimmertoten Ungetüme, und doch konnte Grauner den Blick kaum von ihnen abwenden. Er betrachtete sie, wie ein Enkelkind die faltige Haut des greisen Großvaters betrachtet – voller Faszination und Ehrfurcht.
Langsam senkte er den Kopf. Er sah das Stück Zaun, das der hinterste der Bäume in sich hineingefressen hatte. Daneben plätscherte Wasser in einem zum Brunnen ausgehöhlten Stamm.
Schließlich lenkte Grauner den Blick zu der vordersten Lärche, an der das tote Mädchen lehnte.
Die Lärchen und das tote Mädchen. Scheinbare Ewigkeit und plötzliche Vergewisserung der eigenen Vergänglichkeit. Der Commissario spürte einen Kloß im Hals. Die Haut des Opfers war unnatürlich blass, das Mädchen musste viel Blut verloren haben. Er berührte die Leiche nicht, aber er wusste, wie ihre Haut sich anfühlte. Kalt. Totenkalt.
Grauner ging hinüber zu den Polizeiautos, deren Blaulichter noch lautlos blinkten und bei denen Saltapepe und Marché standen.
»Lichter aus!«, raunte der Commissario den beiden anstatt einer Begrüßung entgegen. Er wollte die Ermittlungen auf keinen Fall mit einer Plauderei über Saltapepes Neapel-Aufenthalt beginnen, er hatte auch keine Lust, sich Saltapepes Geschichten darüber anzuhören, wie schön Süditalien war.
Bei jeder Gelegenheit verglich der Ispettore sein neues Dasein in Südtirol, wohin er ungewollt versetzt worden war, mit seinem alten Leben am Fuße des Stiefels. Beim Knödelessen sprach er davon, wie man Spaghetti al dente zubereitete, beim Weintrinken darüber, warum der Negroamaro aus Apulien besser schmeckte als der Südtiroler Vernatsch, und für Espressotrinker sei diese Provinz zwischen den Bergen – das wiederholte Saltapepe rund fünfmal täglich wie andere das Rosenkranzgebet – sowieso braches Land.
Grauner wollte gleich zur Sache kommen. »Was ist passiert? Wer hat vorhin geschossen?«
»Es, ähm, ging nicht anders.« Saltapepe schaute verlegen zu Boden. »Grauner, die haben uns alles zertrampelt. Wir konnten sie nicht weghalten. Die wollten die Tote gleich mitnehmen und in die Leichenkapelle der Kirche bringen, ich habe in die Luft geschossen, erst dann sind sie zurückgewichen.«
Grauner schaute Saltapepe böse an.
»Deshalb ballert man doch nicht gleich in der Gegend herum. Du bist nicht mehr in Neapel, falls du das noch nicht bemerkt haben solltest.«
Er drehte sich demonstrativ zu Marché um, der mit hochrotem Kopf dastand; es war ihm sichtlich unangenehm, zwischen die Fronten zu geraten.
»Was wissen wir bislang?«
Der Sovrintendente riskierte einen vorsichtigen Blick zu Saltapepe, bevor er den Commissario auf den Stand der Dinge brachte.
Zehn Minuten später hatte Grauner einen ungefähren Überblick darüber, was in den vergangenen Stunden passiert war: Ein gewisser Benedikt Haller, Architekt von Beruf, der in dem Kubus neben den Bauernhöfen wohnte, hatte um halb sieben Uhr morgens die Nummer der Questura in Bozen gewählt.
»Die Marie ist tot. Alles ist voller Blut. Kommen Sie schnell! Ich weiß nicht … kommen Sie!«, das waren die Worte, die der diensthabende Polizist sich notiert hatte.
Um kurz vor halb acht hatten die ersten beiden Einsatzwagen den Fundort erreicht. Da standen bereits einige Dorfbewohner an den Lärchen. Um kurz nach halb neun war Saltapepes Schuss gefallen.
»Wo ist Weiherer?«, fragte Grauner. Er hatte die Mitarbeiter der Spurensicherung bereits gesehen, den Chef aber noch nicht. »Und wo ist dieser Haller?«
»Weiherer streift im Wald umher. Die Kollegen von der Spurensicherung sind sich nach einer ersten Inspektion ziemlich sicher, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort ist. Das Mädchen muss hierher geschleppt worden sein. Warum auch immer.«
»Und Haller ist …« Marché sprach den Satz nicht zu Ende, sondern zeigte stattdessen auf eins der Polizeiautos.
Grauner konnte im Inneren die Umrisse eines Kopfes sehen. Er war an die Scheibe gelehnt. Ein Teil der Scheibe war vom warmen Atem angelaufen.
»Er hat übrigens bereits gestanden. Er sagt, er habe das Mädchen erschossen.«
3
Sie hatten sich im Wohnzimmer des verglasten Kubus versammelt. Wo hätten sie sonst mit Haller hinsollen? Grauner wollte ihn weghaben von den Menschen. Sieben Polizisten hatte der Commissario am Fundort der Mädchenleiche zurückgelassen. Sie sollten die Stelle an den Lärchen weiterhin sichern, bis der Wagen des Weißen Kreuzes die Tote nach Bozen in die Gerichtsmedizin bringen würde.
Aus der oberen Etage des Hauses erklangen dumpfe Bässe. Hallers achtzehnjähriger Sohn hatte sich in seinem Zimmer verschanzt. Kurz überlegte der Commissario, ihn runterholen zu lassen, dann verwarf er den Gedanken. Vielleicht war es besser, erst einmal mit dem Hausherren alleine zu sprechen.
Über das tote Mädchen hatten die Polizisten bislang herausgefunden, dass sie aus dem Dorf kam, Marie Bachlechner hieß und siebzehn Jahre alt war. Die Bewohner der umliegenden Höfe und Häuser wurden derzeit befragt. Auch zu Haller hatten sich die Polizisten schlau gemacht, der Mann war neunundvierzig Jahre alt und ein recht angesehener Architekt. Er war erst vor etwas über einem Jahr gemeinsam mit seinem Sohn von Meran ins Tal gezogen, in dieses Haus, das er selbst entworfen hatte.
Haller saß am Wohnzimmertisch und starrte scheinbar ins Nichts. Er hatte nicht verlangt, dass die Polizisten ihre Stiefel auszogen, aber da der Erste, der das Haus betrat, sich seiner entledigt hatte und Marché dem Beispiel gefolgt war, war es den anderen unangenehm gewesen, ihre Stiefel anzubehalten – und so saßen sie nun alle unten ohne da und versuchten, die Socken unter der Tischplatte zu verstecken. Ein unmögliches Unterfangen. Die Tischplatte war aus Glas.
»Sie hätten die wirklich nicht …«, sagte Haller, der als Einziger seine anbehalten hatte. Es waren hellbraune Wildlederschuhe.
»Schon gut«, sagte Grauner.
»Ist es nicht wie ein Abwägen zwischen Pest und Cholera?«, fuhr Haller fort. »Schmutz im Haus oder sich der entwürdigenden Lebensform hingeben und auf Socken herumlaufen?«
Kaum hatte er den Satz zu Ende gesprochen, schaute er auf Grauners Füße. Der Commissario tat es ihm gleich. Keine Löcher. Grauner atmete innerlich auf. Und es ärgerte ihn, dass er das tat. Diese ganze Situation ärgerte ihn. Grauner las Überlegenheit in Hallers Blick – was seinen Grimm noch verstärkte.
Das Haus, in dem sie saßen, diese Glaswände, diese Küche, die glänzte und mit ihrem Glanz ausdrückte, wie teuer sie war, dieser Hausherr, der sich, kaum hatte er den Mund aufgemacht, als Schnösel entpuppte, wie sie in Südtirol sonst nur in den gehobenen Kreisen von Bozen und Meran anzutreffen waren, das alles passte nicht hierher. Das alles passte nicht ins hinterste Ultental, in diese hinterste Ecke Südtirols. Es passte nicht in diesen urigen Ort, wo die schnelle, globalisierte, moderne Welt noch nicht so recht Einzug gehalten hatte, wo man hoch auf die Gipfel musste, um nach etwas Handynetz zu suchen.
Der Commissario schaute sich um. Er mochte keine Häuser mit Flachdach. Und er mochte die Leute nicht, die sie bewohnten. Er beobachtete den Architekten. Gleichzeitig rieb er mit dem einen Fuß über den Rücken des anderen.
»Herr Haller, Sie sagen, Sie haben Marie Bachlechner erschossen.«
Haller antwortete nicht. Er nickte nur.
»Ist das ein Ja?«, fragte Grauner laut, zwingend.
»Ja, ich habe sie umgebracht.«
»Warum?«
Haller ließ den Blick über die Gesichter der am Tisch versammelten Polizisten schweifen, dann blickte er zu Boden.
»Ich, äh … Wir hatten ein Verhältnis.«
Grauner wartete ein wenig, bevor er weitersprach.
»Herr Haller, das Mädchen war siebzehn.«
Der Architekt rührte sich nicht. Er schaute weiter zu Boden. Auf seine Wildlederschuhe. Wieder herrschte für einige Sekunden Stille.
»Ich bereue, was ich getan habe. Ich war außer mir. Ich kann es mir nicht erklären. Ich möchte ohne meinen Anwalt nichts mehr sagen.«
»Wo haben Sie das Mädchen getötet? Und warum um Gottes willen haben Sie die Leiche an die Lärchen vor Ihrem Haus gesetzt?«
Haller schwieg, Grauner fragte weiter.
»Wo ist es passiert? Und wo ist die Tatwaffe?«
»Nicht ohne meinen Anwalt«, antwortete der Architekt und schob Grauner eine Visitenkarte über den Tisch. Die Karte des Meraner Anwaltsbüros war aus eierschalenfarbenem festem Papier und mit fein gezogenen Buchstaben beschriftet.
Grauner versuchte einen letzten, oftmals bewährten Schachzug: »Ich kann Ihren Anwalt hierher bestellen, und wir unterhalten uns in der Zwischenzeit noch ein wenig.«
Er ließ zwei Sekunden verstreichen.
»Oder ich bestelle ihn nach Bozen – in Ihre Zelle.«
Haller antwortete, ohne zu zögern, und schaute Grauner dabei ausdruckslos ins Gesicht: »Sperren Sie mich bitte ein. Ich bin ein geständiger Mörder.«
Der Commissario übergab den Architekten zwei Polizisten, die ihn nach draußen zu einem der Einsatzwagen brachten.
4
Weiherer war aufgetaucht. Er stand in der Wohnungstür. Sein sonst stets glänzendweißer Schutzanzug war mit grasgrünen Streifen und waldbraunen Flecken versehen. An der Sohle seiner Bergschuhe klebte verkrustete Erde, selbst in seinen Haaren hatten sich Reste von Moos verfangen.
Grauner lachte lauthals auf. Wie oft war er vom Chef der Scientifica angeschnauzt worden, wenn er mit schmutzigen Schuhen an einem Tatort herumtrampelte? Nun war es Weiherer selbst, der das Wohnzimmer dieses sterilen Glashauses mit Dreck verschandelte.
»Wo warst du? Hast du dich im Wald verlaufen? Hast du die Tatwaffe gefunden?«
Weiherer setzte sich zwischen Saltapepe und Marché und räusperte sich. »Zuerst eine schlechte Nachricht«, sagte er. »Nein, wir konnten keine Waffe sicherstellen. Der Täter muss sie versteckt oder weggeworfen haben. Und jetzt eine noch schlechtere …«
Grauner warf ihm einen grimmigen Blick zu. Seine Lippen waren bereits in Stellung gebracht, um einen ordentlichen Flucher loszuwerden.
Doch Weiherer kam ihm zuvor: »Porco Tschiuda! Zio Hennen! Das ist mir in zwanzig Jahren Berufserfahrung noch nicht untergekommen! Diese Dorfdeppen haben mir den gesamten Fundort und alles drum herum zertrampelt. Puttaniga! Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen: Da wimmelt es nur so von Fußabdrücken, Fasern, Speichel, menschlicher DNA. Und mit Fingerabdrücken wird das da draußen eh schwierig. Der Fundort ist unbrauchbar für mich. Absolut unbrauchbar!«
»Warum sagen deine Leute, dass der Fundort nicht der Tatort ist?«, fragte Grauner. Er klang nun ganz ruhig.
»Wir haben eine Spur im Wald gefunden. Angeknackste Zweige. Blut. Die Spur verliert sich jedoch alsbald. Das Gelände wird unzugänglich, mit tiefen Felskluften und dickem Gebüsch. Aber …« Er hob bedeutsam den Zeigefinger. »Ich habe das hier entdeckt.«
Weiherer öffnete den silbernen Arbeitskoffer, den er vorhin neben sich gestellt hatte, holte drei durchsichtige Plastiktütchen hervor und legte sie auf den Tisch.
In dem ersten befand sich ein goldener Ohrring. In dem zweiten ein silberner Armreif. Im dritten eine bronzene Brosche mit rotem Stein.
»Das lag alles im Wald, wo wir auch die angeknacksten Zweige und das Blut gefunden haben. Von Marie scheint der Schmuck jedoch nicht zu sein. Zumindest hat das Mädchen keine Löcher in den Ohrläppchen. Aber dass der Fund ein Zufall ist, glaube ich trotzdem nicht.«
Grauner nickte zustimmend.
»Der Wald muss weiter abgesucht werden!«, befahl er.
»Das tun wir bereits«, sagte Weiherer.
»Findet den Tatort!«
»Wir werden ihn finden.« Weiherers Antwort hörte sich wie ein Versprechen an.
»Und findet die Tatwaffe! Sucht sie auch hier im Haus. Und, Weiherer, bring den Schmuck nach Bozen, lass ihn fotografieren und auf Fingerabdrücke untersuchen. Auch will ich wissen, was der hergibt. Ist es billiges Zeug oder so wertvoll, dass der eine oder andere dafür morden würde?« Kurz überlegte er. »Wir werden den Schmuck vorerst niemandem zeigen. Sprecht nicht darüber. Niemand weiß, dass wir ihn gefunden haben. Vielleicht bringt uns dieser Wissensvorsprung etwas. Einen Versuch ist es wert.«
Er schaute in die Runde, er meinte alle damit. Alle nickten.
Marché hatte vor zwanzig Minuten den Staatsanwalt Dr. Martino Belli ans Telefon bekommen und das Handy gleich an Grauner weitergereicht. Belli war in Mailand, auf einer Konferenz, Assemblea Mafia 2.0 lautete das Motto des Zusammentreffens. Ein Meeting von Staatsanwälten aus ganz Italien, die das organisierte Verbrechen bekämpften. Grauner konnte sich vage daran erinnern, dass Belli davon geredet hatte. Warum da allerdings jemand aus Bozen dabei sein musste, war ihm schleierhaft; aber er hatte ein Bild vor Augen, wie sich sein Vorgesetzter beim Gruppenbild in die erste Reihe drängte. Inmitten der Staatsanwälte italienischer Großstädte würde Belli in die Kamera strahlen, inmitten jener mutigen Männer, die ihr Leben dem Kampf gegen halb mafiöse Politiker und Unternehmer verschrieben hatten. Helden! Ganz anders als ihr Bozner Kollege, der sich lediglich ab und an mit einem Provinzmord zu beschäftigen hatte und ansonsten seine Tage im Schatten der Trauerweiden im Garten des Parkhotel Laurin verbrachte, die Mittagskarte bei einem Glas Sauvignon Blanc studierend.
Immerhin hatte Belli versprochen, ein Fax mit der Delega d’Indagine schicken zu lassen. Es summte soeben aus Hallers Gerät. Das Schreiben beinhaltete die Erlaubnis, das Haus zu durchsuchen und den mutmaßlichen Täter vorläufig in Haft zu nehmen.
»Dieser Haller ist unser Mörder«, hatte der Staatsanwalt abschließend ins Telefon geblafft, sodass Grauner das Gerät um eine Armlänge von seinem Ohr entfernte. »Bringen Sie ihn nach Bozen! Quetschen Sie ihn aus! Lassen Sie ihn das Geständnis unterschreiben, und dann präsentieren wir ihn den Zeitungen und machen ein paar schöne Fotos.«
Grauner war sich sicher: Was Belli noch mehr genoss als eine Bachforelle mit Petersilienkartoffeln und Bozner Soße im Laurin, war eine Bachforelle im Laurin und vor sich ausgebreitet die Tageszeitungen mit schönen Fotos von ihm darin.
Grauner stellte sich an die bodentiefe Fensterscheibe und starrte in das Tal hinaus. Es kam ihm so vor, als wäre dieser Fall falsch losgegangen. Erst gelangte er zu spät an den Ort des Geschehens, dann, er hatte noch nicht einmal zu ermitteln begonnen, war er bereits mit einem Geständnis konfrontiert. Eines, von dem er nicht recht wusste, was es wert war. Nicht, dass er jemals irgendetwas gegen schnelle Geständnisse einzuwenden gehabt hätte. Aber manchmal war es schwieriger, ein solches zu verifizieren, als einen ungeständigen Mörder zu überführen.
Saltapepe stellte sich neben ihn. »Worüber denkst du nach, Grauner?«, fragte er.
»Über den Fundort«, antwortete der Commissario. »Wenn das Mädchen irgendwo anders ermordet wurde, irgendwo im Wald, dann muss der Täter einen triftigen Grund gehabt haben, sie nach der Tat hierherzubringen. Welches Zeichen wollte er damit setzen? Den Verdacht auf Haller lenken? Wenn aber wiederum Haller tatsächlich der Täter ist, warum präsentiert er die Leiche dann vor seiner Haustür?«
»Als Trophäe? Vielleicht ist er eine kranke Bestie.«
»Vielleicht …«
Weiter kam Grauner nicht. Das Surren einer Klingel ertönte. Der Commissario ging zur Wohnungstür und öffnete sie.
Aus der Nähe glich das Gesicht des Pfarrers einem mit Haut überzogenen Totenkopf. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen. Wo andere Menschen rosige Wangen hatten, zog sich bei Hochwürden das Gesicht unterhalb aschfahler Knochen ins Innere. Die Lippen waren schmal und schwarzblau, wie mit Kajalstift gezogen, Zahnfleisch und Zähne waren allzeit zu sehen, auch wenn der Pfarrer weder sprach noch lachte. Dass er jemals in seinem Leben gelacht hatte, wagte Grauner zu bezweifeln.
Die in Schwarz gehüllten Frauen, die dem Commissario schon vorhin als des Pfarrers Geleitschutz aufgefallen waren, hatten sich erneut in einem Halbkreis um den Geistlichen formiert. Sie trugen bestickte Tücher über dem zum Dutt gebundenen Haar. Grauner vernahm leises Gebetsgegeflüster aus ihren Mündern.
Ein paar Schritte hinter diesem ehrfürchtigen Gestirn harrten immer noch einige Dorfbewohner aus. Es waren nicht mehr so viele wie vorhin, vielleicht zwei Dutzend Leute.
Einer stand etwas abseits. Grauners Blick fixierte ihn. Der Mann trug knabenhafte Züge. Seine Haare und Sommersprossen leuchteten rot wie Jonagold im September. Der Mann wirkte wie jemand, bei dem die Pubertät beschlossen hatte, bis in die Dreißiger hinein ihr Spiel zu treiben. Er schwitzte, seine Augen zuckten unsicher. Ein goldener Siegelring umschlang einen seiner Finger. Es musste sich um den Bürgermeister handeln.
Der Commissario kannte diese Phänomene aus fast allen Dörfern Südtirols, in denen er zu tun gehabt hatte. Einer hatte das Sagen: entweder der Bürgermeister oder der Pfarrer. Dass sie zusammenhielten, war ihm noch nie untergekommen. Auch hier war nun klar, wo die Geschicke des Tales bestimmt wurden: in der Kirche, hinter dem Altar, nicht im Gemeindehaus.
»Rücken Sie ihn raus!«, forderte der Pfarrer mit tiefer Stimme. »Rücken Sie ihn raus! Er hat Gottes Strafe verdient.«
»Und die wäre?« Jetzt entdeckte Grauner inmitten der rachsüchtigen Gesichter zu allem Überfluss auch noch das Konterfei von Charly Weinreich, dem von ihm verhassten Reporter des Südtirol Kurier.
Weinreich kritzelte seinen Notizblock voll. Grauner malte sich in Gedanken schon die fantasievollen Schlagzeilen aus: Mädchenmord im Ultental! Dorfbewohner fordern Selbstjustiz! Polizeibeamter feuert Waffe ab! Situation außer Kontrolle!
Der Commissario spürte, wie die Wut in ihm hochkroch, wie sich sein Magen zusammenzog.
»Er hat getötet, nun muss er sich dem Zorn der Lebenden stellen. Auge um Auge, …«
Der Pfarrer bäumte sich vor ihm wie ein Inquisitor auf.
»Schluss!« Grauner starrte auf die Zähne des Geistlichen und hob die rechte Hand. »Schluss mit dem Bauerntheater! Wir sind nicht im Mittelalter. Sie gehen jetzt alle schön brav nach Hause. Oder in die Kirche zum Rosenkranzbeten oder auf die Felder oder wohin auch immer. Sie gehen! Sofort! Benedikt Haller bleibt in Gewahrsam der Polizei. Er wird nach Bozen gebracht, wo wir ihn rechtmäßig verhören. Verstanden?«
Während sich die Männer zu Grüppchen formten und wütendes Diskutieren anhob, welches das Rosenkranzgebet der Frauen unter sich begrub, machte der Pfarrer einen weiteren Schritt auf den Commissario zu. Fast berührten sich nun ihre Gesichter. Grauner konnte seinen Atem spüren.
»Nein, Herr Kommissar. Sie haben nicht verstanden«, zischte der Pfarrer.
Grauner bemühte sich, nicht zu blinzeln und nicht zurückzuweichen, während die Augenhöhlen des Geistlichen immer näher kamen.
»Benedikt Haller interessiert uns nicht. Wir wollen seinen Sohn. Den Michl. Der Michl ist des Teufels.«
5
Die Spurensicherer hatten die Untersuchungen rund um die Leiche beendet, der Chef der Scientifica gab das tote Mädchen zum Abtransport frei. Sie trugen den Sarg an den Höfen vorbei, runter zur Straße. Die Hunde bellten nicht mehr. Endlich war Ruhe eingekehrt. Der Leichenwagen brachte die Tote in die Gerichtsmedizin. Auch Benedikt Haller war auf dem Weg nach Bozen – in die Zelle.
Die Ermittler standen vor Hallers Haus, das in der Zwischenzeit ebenfalls mit rot-weißem Sicherheitsband eingezäunt worden war. Einige Spurensicherer widmeten sich nun dort ihrem Werk, ein paar weitere waren unterwegs zu Bachlechners Haus, um Maries Zimmer zu inspizieren. Mit dem größten Trupp aber war Weiherer im Wald damit beschäftigt, eine Spur von den Lärchen bis zum Tatort zu finden.
»Was konnte in der vergangenen Stunde Neues über das Mädchen herausgefunden werden?«, fragte Grauner in die Runde.
Marché hatte sich telefonisch bei der Gemeindesekretärin im Hauptort St. Walburg kundig gemacht: Marie war Halbwaise. Sie lebte mit ihrem Vater Josef Bachlechner auf einem der Höfe am Hang, auf der anderen Talseite. Der Bürgermeister und der Pfarrer seien am Morgen bereits kurz beim Vater gewesen, um ihm die schreckliche Nachricht mitzuteilen und ihr Beileid zu bekunden.
Marché hatte auch die Schule in Meran informiert, die das Mädchen besucht hatte. Er versuchte nun, einige Lehrer ans Telefon zu bekommen und das Umfeld des Opfers weiter zu befragen. Klassenkameraden. Freunde. Beste Freundinnen.
Die Befragungen der Dorfbewohner hatten bislang wenig ergeben. Die Menschen in diesen hintersten Tälern Südtirols waren stolz und wortkarg, da ließ man sich nicht einfach von irgendeinem Polizisten auf der Straße anquatschen.
Die Bewohner der Nachbarhäuser wollten nichts gehört oder gesehen haben. Nur ein Mal, einen Knall, gegen drei Uhr nachts, doch sie hatten sich nichts dabei gedacht. Wilderer. Auch die Hunde hätten mehrmals gebellt. Aber das kam öfter vor, wenn sich die Rehe zu nah an die Höfe wagten. Sonst? Nichts. Erst morgens, als Haller bereits die Polizei verständigt hatte, waren sie zu den Lärchen gegangen, zu Marie, und danach hinunter ins Dorf, um Bescheid zu geben.
»Saltapepe«, sagte der Commissario. »Knöpf du dir noch mal diesen Pfarrer vor. »Koche ihn weich! Koordiniere außerdem weiter die Befragungen im Dorf. Und du, Marché«, fuhr Grauner fort, »kümmere dich um Infos rund um Haller und das Umfeld des Opfers. Und mach den Bürgermeister ausfindig, auch mit dem sollten wir uns unterhalten.«
Saltapepe nickte.
»Gut«, sagte Marché.
Grauner sah ihm an, dass eine Mischung aus Freude, Erleichterung und Aufgeregtheit in ihm wirbelte. Schließlich war es das erste Mal, dass der Commissario ihn am Ort des Geschehens mitarbeiten ließ. Bislang hatte er Marché, falls er den Tatort überhaupt zu Gesicht bekommen hatte, immer sofort zurück in die Questura geschickt, um die Telefon- und Papierarbeit zu leisten.
Aber der Sovrintendente hatte sich bewährt. Sein Handeln war zwar oftmals von einer unberechenbaren Schusseligkeit, die aber ab und an unverhoffte Ermittlungsergebnisse einbrachte.
»Was ist mit dem Jungen?«, fragte Saltapepe.
Der Commissario schaute auf die Glasfassade des Hauses. Hinter einem der Fenster saß er, in seinem Zimmer. Ein Mitarbeiter vom Psychologischen Dienst und zwei Polizisten waren bei ihm.
»Um den Jungen kümmere ich mich«, sagte Grauner und schluckte. »Nach dem Besuch beim Vater des Opfers.«
Alles Menschliche in ihm wehrte sich gegen den bevorstehenden Gang, diesen Akt, der die frische Trauer störte. Doch dem Polizisten in ihm war klar, dass Befragungen, je früher sie stattfanden, je schmerzlicher sie waren, umso mehr ans Tageslicht förderten.
Die Männer schwirrten aus. Grauner ging noch einmal die paar Schritte rüber zum Fundort der Leiche. Er schaute ins Geäst der Lärchen. Dahinter standen Tannen und Fichten, der Mischwald am Berghang war dicht und verwachsen. Keine zehn Meter konnte man in ihn hineinsehen. Grauner kannte die Tücken des Südtiroler Waldes, der so dunkel und unwegsam sein konnte, dass das Fortkommen darin, geschweige denn das Suchen nach Spuren, beinahe unmöglich war.
»Er ist des Teufels …«, wiederholte er die Worte des Pfarrers gedankenverloren. »Der Michl ist des Teufels.«
Was sollte das bedeuten?
Nun schaute er in Richtung Talende. Zur Kirche, zu den Gipfeln des Stilfserjoch-Nationalparks. Sein Blick wanderte zu den gegenüberliegenden Hängen, an denen die Wiesen fast senkrecht hinabfielen. Wie schwarzbraune Farbtupfer in einem Meer aus Grün klebten einzelne jahrhundertealte Bauernhöfe an ihnen, es kam ihm wie ein Wunder der Schwerkraft vor, dass sie nicht lawinengleich ins Tal rutschten.
Vielleicht war alles ganz einfach, dachte Grauner. Vielleicht hatten sie Maries Mörder tatsächlich schon. Sie konnten zurückkehren nach Bozen, Benedikt Haller würde ausführlich gestehen, das Geständnis unterschreiben, und die Ermittler konnten dieses Dorf, dieses Tal hinter sich lassen.
Aber vielleicht war auch alles ganz anders.
6
Der Commissario ließ sich von einem der Polizisten zum Bachlechnerhof fahren. Die Straße bog knapp einen Kilometer vor dem Dorf links ab, in den Wald hinein. Es war einer jener Schotterwege, die unmerklich steiler wurden, sodass der Motor des Streifenwagens bald nur noch im Bariton brummte und der Fahrer gezwungen war, vom zweiten in den ersten Gang zu schalten.