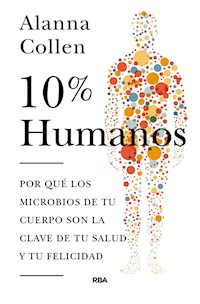17,99 €
Mehr erfahren.
Wer hat im Menschen die Hosen an?
Unser Körper besteht nur zu zehn Prozent aus menschlichen Zellen. Die eigentlichen Chefs unserer inneren Steuerungssysteme sind Billionen von Mikroben – Bakterien und Pilze, die einen enormen Einfluss auf unsere Gesundheit haben und sogar unser Denken beeinflussen. Die britische Wissenschaftlerin Alanna Collen zeigt, dass unsere moderne Lebensweise für Zivilisationskrankheiten wie starkes Übergewicht, Allergien, Autoimmunerkrankungen oder Verdauungsstörungen verantwortlich ist: Übertriebene Hygienemaßnahmen, ungünstige Ernährungsgewohnheiten und Antibiotika bringen den Mikrobenhaushalt empfindlich aus der Balance. In der Erforschung dieser bisher unterschätzten Zusammenhänge liegt jedoch auch eine große Chance: Eine maßgeschneiderte »mikrobenfreundliche« Ernährung könnte chronisch Kranken neue Hoffnung bringen und unser aller Wohlbefinden verbessern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Alanna Collen
Die stille Macht der Mikroben
Wie wir die kraftvollsten Gesundmacher bei der Arbeit unterstützen können
Aus dem Englischen von Friedrich Pflüger und Claudia van den Block
Die englische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »10% Human« bei Conville & Walsh Limited, London, England.
1. Auflage
Deutsche Erstausgabe
© 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
Riemann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
© 2015 by Alanna Collen
Lektorat: Werner Wahls / Verlagsservice Mihr, Tübingen
Umschlaggestaltung: Martina Baldauf, herzblut02 GmbH, München
Umschlagabbildung: © Mehau Kulyk/Science Photo Library/Corbis
Foto der Autorin: privat
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-641-15272-7
www.riemann-verlag.de
Für Ben und seine Mikroben.
Meinen liebsten Superorganismus.
Ich habe schon darauf hingewiesen, dass in der Wissenschaft ein Gleichgewicht zwischen zwei scheinbar einander ausschließenden Einstellungen von zentraler Bedeutung ist: zwischen der Offenheit gegenüber neuen Ideen, ganz gleich, wie bizarr oder uneinsichtig sie erscheinen mögen, und der rückhaltlosen skeptischen Überprüfung aller, alter wie neuer Ideen. Nur auf diese Weise lassen sich tiefe Wahrheiten von tiefem Unsinn unterscheiden.
Carl Sagan
Der Drache in meiner Garage oder Die Kunst der Wissenschaft, Unsinn zu entlarven
Inhalt
Vorwort: Geheilt
Einführung: Die anderen 90 Prozent
1 Krankheiten des 21. Jahrhunderts
2 Alle Krankheiten beginnen im Darm
3 Gedankenkontrolle
4 Die egoistische Mikrobe
5 Kampf der Bakterien
6 Man ist, was sie essen
7 Vom allerersten Atemzug an
8 Darmsanierung durch mikrobielle »Aufforstung«
Coda: Gesundheit im 21. Jahrhundert
Gesellschaftliche Veränderungen
Individuelle Veränderungen
Epilog: Die stille Macht der Mikroben
Dank
Abbildungsverzeichnis
Bildteil
Teil 1
Teil 2
Register
Vorwort
Geheilt
Nachts im Urwald auf dem Heimweg – 20 Fledermäuse in Baumwollbeuteln um den Hals gehängt und Myriaden von Insekten im Schein meiner Stirnlampe – fingen meine Fußgelenke plötzlich an zu jucken. Dabei hatte ich die Hosen extra mit Insektenschutzmittel getränkt und in die Blutegel-Socken gesteckt und trug zur Sicherheit ein zweites Paar darunter. Eigentlich hatte ich genug damit zu tun, mich in der tropischen Hitze – nass geschwitzt, in ständiger Angst vor Tigern und geplagt von Moskitos – über die matschigen Trampelpfade zu schleppen und in pechschwarzer Nacht die Fledermäuse aus den Fallen zu sammeln. Aber jetzt war auch noch etwas durch den Schutzschild aus Stoff und Chemie bis zu meiner Haut durchgedrungen. Und es juckte.
Mit 22 lebte ich für drei Monate, die mein Leben verändern sollten, im Herzen des Krau Wildlife Resort auf der Malaiischen Halbinsel. Für Fledermäuse begeisterte ich mich seit meinem Biologiestudium und hatte sofort zugegriffen, als sich die Gelegenheit bot, eine englische Koryphäe für Fledermäuse als Geländeassistentin zu begleiten. Dass ich in einer Hängematte schlafen und mich in einem Fluss voller Warane waschen musste, wurde von den Begegnungen mit Schlankaffen, Gibbons und einer unglaublichen Zahl von Fledermausarten mehr als aufgewogen. Ich musste allerdings feststellen, dass die Herausforderungen des Lebens in einem tropischen Regenwald auch nach dem Aufenthalt noch lange andauern können.
Zurück in unserem Lager auf einer Lichtung am Flussufer, streifte ich die Schutzschichten zurück. Was mich da so plagte, waren keine Blutegel, sondern etwa 50 Zecken, die sich in meine Haut gebohrt hatten oder an meinen Beinen heraufkrabbelten. Ich streifte die losen Tiere ab und widmete mich zunächst wieder den Fledermäusen, die ich so schnell wie möglich vermaß und die Daten aufzeichnete. Später – die Fledermäuse waren inzwischen wieder freigelassen und der pechschwarze Urwald vom Zirpen der Zikaden erfüllt – zog ich den Reißverschluss meiner kokonartigen Hängematte über mir zu und pulte im Licht der Stirnlampe restlos alle Blutsauger aus meiner Haut.
Zurück in London machte sich bei mir wenige Monate später eine von den Zecken übertragene tropische Krankheit bemerkbar. Ich bekam Krämpfe am ganzen Körper, und ein Zehenknochen schwoll an. Es zeigten sich immer neue, seltsame Symptome, die immer neue Blutuntersuchungen erforderten und im Krankenhaus immer neue Spezialisten auf den Plan riefen. Immer wieder brachten ohne Vorwarnung auftretende Schmerzen, Erschöpfung und geistige Verwirrung mein gewohntes Leben zum Stillstand und verflogen dann wieder, als wäre nichts geschehen. Es sollten Jahre vergehen, bis die wahre Ursache ermittelt wurde. Die Infektion hatte sich inzwischen so festgesetzt, dass eine lange und intensive Behandlung mit Antibiotika folgte, die auch zur Heilung einer Rinderherde ausgereicht hätte. Immerhin würde ich von nun an wieder ich selbst sein.
Zu meiner Überraschung war das aber nicht das Ende der Geschichte. Ich war nicht nur von der von den Zecken übertragenen Krankheit kuriert, ich war auch keimfrei wie ein Stück Pökelfleisch. Die Antibiotika hatten zwar ihr Wunderwerk vollbracht, aber bei mir stellten sich neue Leiden ein – in derselben Vielfalt wie zuvor. Meine Haut war wund, meine Verdauung empfindlich, und ich fing mir alle möglichen Infekte ein. Mit der Zeit kam mir der Verdacht, dass die Antibiotika nicht nur die schädlichen Bakterien ausgelöscht hatten, sondern auch die, die eigentlich in mich hineingehörten. Es kam mir vor, als wäre ich durch die Behandlung unwirtlich für Mikroben geworden und begriff, wie nötig ich die freundlichen 100 Billionen kleiner Kerlchen brauchte, die ich bislang in meinem Körper beherbergt hatte.
Wir sind nur zu zehn Prozent Mensch.
Auf jede einzelne Zelle des Gefäßes, das wir unseren Körper nennen, kommen neun Zellen, die wir mehr oder weniger unbemerkt als Trittbrettfahrer dabeihaben. Wir bestehen nicht nur aus Fleisch und Blut, Muskeln und Knochen oder Hirn und Haut, sondern auch aus Bakterien und Pilzen. Wir bestehen mehr aus »ihnen« als aus »uns«. Allein in unserem Darm leben 100 Billionen von ihnen wie ein Korallenriff auf dem zerklüfteten Meeresboden unserer Darmwand. In den Falten, denen unser anderthalb Meter langer Dickdarm etwa die Oberfläche eines Ehebetts verdankt, finden mehr als 4000 verschiedene Mikrobenarten jede ihre eigene ökologische Nische. Die Masse der Gäste, die wir beherbergen, summiert sich im Lauf unseres Lebens auf das Gewicht von fünf ausgewachsenen afrikanischen Elefanten. Unsere Haut wimmelt von ihnen. Allein auf der Fingerkuppe tragen wir mehr von ihnen, als Menschen in Großbritannien leben.
Widerlich, oder etwa nicht? Eigentlich sind wir doch viel zu kultiviert, zu hygienisch und zu hoch entwickelt, um uns in solcher Weise besiedeln zu lassen. Hätten wir die Mikroben nicht ebenso ablegen sollen wie Fell und Schwanz, als wir die Wälder hinter uns ließen? Gibt uns die moderne Medizin nicht die nötigen Mittel, um sie zu vertreiben, damit wir fortan sauberer, gesünder und unabhängiger leben können? Mit der Tatsache, dass unser Körper ein Mikrobenhabitat darstellt, haben wir uns abgefunden, da uns dadurch offenbar kein Schaden entsteht. Anders als bei Korallenriffen und dem tropischen Regenwald haben wir bislang allerdings nicht daran gedacht, dieses auch zu schützen – geschweige denn in seiner Bedeutung zu würdigen.
Als Evolutionsbiologin bin ich darauf trainiert, anatomische Eigenheiten und Verhaltensweisen von Organismen auf ihren Vorteil, ihre Bedeutung hin zu untersuchen. Wirklich schädliche Eigenheiten und Wechselwirkungen werden in der Regel bekämpft oder gehen im Lauf der Evolution verloren. Das ließ mich aufhorchen: 100 Billionen Mikroben könnten sich niemals bei uns einnisten, wenn wir nicht ebenfalls etwas davon hätten. Unser Immunsystem kämpft doch ständig gegen Krankheitserreger und heilt unsere Infekte – warum sollte es eine derartige Invasion dann widerstandslos geschehen lassen? Da ich meine eigenen Eindringlinge, und zwar die bösen wie auch die guten, in monatelangem Kampf mit Chemiewaffen vertrieben hatte, wollte ich mehr über den angerichteten Kollateralschaden wissen.
Wie sich zeigte, stellte ich diese Frage genau zum richtigen Zeitpunkt. Jahrzehntelang hatte die Wissenschaft nur mit mäßigem Nachdruck versucht, über Kulturen in Petrischalen mehr über Mikroben zu erfahren, aber inzwischen waren die technischen Möglichkeiten unserer Neugierde ebenbürtig geworden. Die meisten Mikroben, die wir in uns tragen, sterben bei Kontakt mit Sauerstoff, weil sie an die sauerstofffreie Umgebung in unseren Gedärmen angepasst sind. Es ist nicht einfach, sie außerhalb des Körpers zu kultivieren, aber das Experimentieren mit ihnen ist noch schwieriger.
Das Humangenomprojekt mit der Entschlüsselung aller menschlichen Gene hat Wissenschaftler in die Lage versetzt, auch große Mengen von DNA äußerst schnell und kostengünstig zu sequenzieren. Selbst tote Mikroben, die wir mit dem Stuhl ausscheiden, können nun identifiziert werden, weil ihre DNA intakt geblieben ist. Wir dachten, unsere Mikroben würden keine Rolle spielen, aber die Wissenschaft ist dabei, diese Vorstellung zu verändern: Unser Leben ist mit diesen Trittbrettfahrern eng verbunden. Mikroben bestimmen die Vorgänge in unserem Körper, und ohne sie kann man kein gesunder Mensch werden.
Meine Gesundheitsprobleme waren nur die Spitze des Eisbergs. Wie ich erfuhr, finden sich immer mehr wissenschaftliche Belege dafür, dass Beeinträchtigungen der Mikroben unseres Körpers nicht nur Störungen im Magen-Darm-Trakt auslösen können, sondern auch Allergien, Autoimmunerkrankungen und sogar Fettleibigkeit. Beobachtet werden aber nicht nur unsere körperliche Beeinträchtigungen, sondern auch geistige von Angststörungen und Depressionen bis zu Zwangsstörungen und Autismus. Viele Krankheiten, die wir als Teil des Lebens ansehen, scheinen ihre Ursache nicht in fehlerhaften Genen oder einem Versagen unseres Körpers zu haben, sondern müssen völlig neu bewertet werden, weil wir die Mikroben als seit Langem bestehende Erweiterung unserer eigenen menschlichen Zellen nicht genügend gewürdigt haben.
Ich hoffte, durch meine Forschung zu entdecken, welchen Schaden die von mir eingenommenen Antibiotika in meiner Mikrobenkolonie angerichtet hatten, wie mich das krank gemacht hatte und wie ich das mikrobielle Gleichgewicht von vor der Nacht mit dem Zeckenbiss acht Jahre zuvor wiederherstellen konnte. Um mehr zu erfahren, tat ich den ultimativen Schritt zur Selbstentdeckung: Ich meldete mich an für eine DNA-Sequenzierung. Statt meiner eigenen Erbanlagen wollte ich allerdings die Gene meiner persönlichen Mikrobenkolonie – mein Mikrobiom – bestimmen lassen. Wenn ich erst wusste, welche Arten und Stämme von Bakterien ich in mir trug, dann besaß ich einen Ansatzpunkt dafür, meine Gesundheit zu verbessern. Anhand aktueller Erkenntnisse darüber, was in mir leben sollte, konnte ich vielleicht besser bewerten, wie viel Schaden ich genau angerichtet hatte und wie sich die Scharte wieder auswetzen ließ. Ich meldete mich also beim American Gut Project, einem populärwissenschaftlichen Forschungsprogramm am Labor von Professor Rob Knight an der Universität von Colorado in Boulder. Dort kann jeder gegen eine Spende Proben mit Mikroben des menschlichen Körpers sequenzieren lassen und so mehr über die Spezies, die wir beherbergen, und ihren Einfluss auf unsere Gesundheit erfahren. Ich schickte also eine Stuhlprobe mit den Mikroben aus meinem Darm ein und erhielt einen Schnappschuss des Ökosystems in meinem Körper.
Zu meiner Erleichterung erfuhr ich, dass sich nach jahrelanger Therapie mit Antibiotika tatsächlich noch Mikroben in mir befanden. Und ich war froh, dass die nachgewiesenen Bakteriengruppen denen anderer Teilnehmer des American Gut Project doch im Großen und Ganzen glichen – und nicht die Mikrobenversion mutierter Lebewesen darstellten, die auf einer Giftmülldeponie ihr Leben fristeten. Wie vielleicht vorherzusehen gewesen war, hatte die Vielfalt der bei mir gefundenen Bakterien allerdings gelitten. Insbesondere in der höchsten taxonomischen Stufe war die Diversität vergleichsweise gering und wirkte im Vergleich mit den Darmbewohnern anderer Leute ein wenig eintönig. Mehr als 97 Prozent meiner Bakterien gehörten zwei großen Bakteriengruppen an; bei anderen Teilnehmern kamen diese beiden Gruppen nur auf etwa 90 Prozent. Möglicherweise hatten die Antibiotika bei mir einige dieser weniger zahlreich vertretenen Spezies ausgelöscht und nur die widerstandsfähigsten Arten übrig gelassen. Nun wollte ich natürlich wissen, ob dieser Verlust etwas mit meinen aktuellen Gesundheitsproblemen zu tun hatte. Was ließ sich anhand der Identitäten der Bakterien, die der Antibiotikabehandlung entweder widerstanden hatten oder danach zurückgekehrt waren, über meinen derzeitigen Gesundheitszustand sagen? Treffender ließe sich vielleicht fragen, was die Abwesenheit von Arten, die den von mir gegen sie eingesetzten chemischen Waffen zum Opfer gefallen waren, für mich bedeutete.
Ich war aber nicht nur entschlossen, mehr über uns – mich und die Mikroben – zu erfahren, ich wollte mein erworbenes Wissen auch anwenden und mit meinen Bakterien Frieden schließen. Wenn ich wieder eine Bakterienkolonie haben wollte, die harmonisch mit meinen eigenen Zellen zusammenwirkte, dann musste ich einiges an meinem Leben ändern. Wenn meine Krankheitssymptome tatsächlich auf den Kollateralschaden zurückzuführen waren, den ich bei meinem Mikrobiom verursacht hatte, konnte ich das Ganze nicht vielleicht wieder umkehren und damit meine Allergien, Hautprobleme und die ständigen Infekte wieder loswerden? Ich sorgte mich dabei nicht nur um mich, sondern auch um die Kinder, die ich in den folgenden Jahren bekommen wollte. Ich vererbte ihnen ja nicht nur meine Gene, sondern auch meine Mikroben, und ich wollte mir sicher sein, dass diese es auch wert waren, weitergegeben zu werden.
Um alles für meine Mikroben zu tun, beschloss ich, meine Ernährung ganz auf ihre Bedürfnisse einzustellen. Nach einiger Zeit, wenn mein veränderter Lebensstil etwas Wirkung hatte zeigen können, wollte ich eine zweite Probe sequenzieren lassen in der Hoffnung, dass sich meine Bemühungen in einer veränderten Diversität und einem größeren Gleichgewicht der Arten niedergeschlagen hatte. Und vielleicht, so hoffte ich, zeigte meine Investition dann ja greifbare Erträge in Form einer besseren Gesundheit und mehr Lebensglück.
Einführung
Die anderen 90 Prozent
Im Mai 2000, wenige Wochen vor der Ankündigung des ersten Entwurfs des menschlichen Genoms, machte bei den Wissenschaftlern, die in der Bar des Cold Spring Harbor Laboratory im US-Bundesstaat New York beisammensaßen, ein Notizbuch die Runde. In der nächsten Phase des Humangenomprojekts sollte der DNA-Strang in seine funktionellen Einheiten – die Gene – aufgeteilt werden, und verständlicherweise waren alle aufgeregt. Jeder der Spitzenwissenschaftler verzeichnete im Notizbuch seinen Tipp in einer Wette um eine einzige faszinierende Frage: Wie viele Gene braucht man, um einen Menschen zu bauen?
Lee Rowen, die eine Gruppe zur Decodierung der Chromosomen 14 und 15 leitete, nippte an ihrem Bier und ließ sich die Frage durch den Kopf gehen. Gene sind Blaupausen für Proteine, die Bausteine des Lebens, und die Komplexität des Menschen ließ daher eine große Zahl erwarten. Größer als bei der Maus jedenfalls, die bekanntermaßen 23.000 Gene besaß. Wahrscheinlich auch mehr als bei der Weizenpflanze mit 26.000 Genen. Und ohne jeden Zweifel auch mehr als beim »Wurm«, dem liebsten Labortier der Entwicklungsbiologen mit seinen 20.500 Genen.
Die Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 55.000 Genen, reichten aber bis 150.000. Rowens Erfahrungen auf dem Gebiet ließen sie tiefer ansetzen; sie wettete auf 41.440 Gene und legte ein Jahr später mit einem zweiten Tipp von nur 25.947 Genen nach. Als sich 2003 die tatsächliche Anzahl aus der eben erst vollendeten Sequenz ergab, gewann sie damit den Preis. Ihr Tipp war von allen 165 abgegebenen der niedrigste gewesen, und die aktuell ermittelte Zahl lag tatsächlich deutlich niedriger, als je ein Wissenschaftler prognostiziert hatte.
Mit nicht einmal 21.000 Genen ist das menschliche Genom kaum größer als das des Wurms (Caenorhabditis elegans). Es ist nur halb so umfangreich wie das der Reispflanze, und selbst der Wasserfloh lässt uns mit 31.000 Genen hinter sich. Keine dieser Spezies kann sprechen, schöpferisch tätig sein oder einen intelligenten Gedanken fassen. Man sollte erwarten, dass der Mensch deshalb deutlich mehr Gene hat als Gräser, Würmer oder Flöhe. Immerhin erzeugen Gene Proteine, und Proteine bauen die Körper der Lebewesen auf. Sollten für einen derart komplexen und ausgeklügelten Körper wie den unseren dann nicht mehr Proteine und damit auch mehr Gene nötig sein als für einen Wurm?
Diese knapp 21.000 Gene sind allerdings nicht die einzigen, die unseren Körper am Laufen halten. Wir leben nicht alleine. Jeder von uns ist ein Superorganismus, ein Kollektiv nebeneinanderlebender Arten, die gemeinsam den Körper betreiben, der uns alle unterhält. Unsere eigenen Zellen sind zwar nach Volumen und Gewicht sehr viel größer, gegenüber den in uns lebenden Mikroben gleichzeitig aber zehn zu eins in der Minderheit. Die 100 Billionen Mikroben – das sogenannte Mikrobiom – sind zum überwiegenden Teil Bakterien: mikroskopisch kleine Wesen, die nur aus einer einzigen Zelle bestehen. Neben den Bakterien gehören aber auch andere Mikroben dazu – Viren, Pilze und Archaeen. Viren sind so klein und einfach gebaut, dass sie an der Grenze dessen liegen, was wir als »Leben« bezeichnen. Für ihre Fortpflanzung sind sie völlig auf fremde Zellen angewiesen. Die Pilze in unserem Körper sind häufig Hefezellen; ihr Bauplan ist zwar komplexer als bei den Bakterien, sie sind aber ebenfalls sehr kleine einzellige Organismen. Die Gruppe der Archaeen scheint den Bakterien sehr ähnlich zu sein, stammesgeschichtlich unterscheiden sie sich von ihnen jedoch ebenso, wie sich Bakterien von Pflanzen oder Tieren unterscheiden. Alle Mikroben in unserem Körper zusammengenommen enthalten 4,4 Millionen Gene – das ist unser Mikrobiom: die vereinigten Genome der Mikroben. Diese Gene arbeiten beim Betrieb unseres Körpers mit den 21.000 menschlichen Genen zusammen. Nach dieser Zählweise sind wir nur zu einem halben Prozent menschlich.
Dieser vereinfachte Baum des Lebens zeigt die drei Domänen und die vier Reiche der Domäne der Eukaryota.
Wir wissen nun, dass die Komplexität des menschlichen Genoms nicht nur auf der Anzahl der enthaltenen Gene beruht, sondern auch auf der Vielzahl der möglichen Kombinationen der Proteine, die die Gene erzeugen. Genau wie andere Tiere entlocken wir unserem Genom sehr viel mehr Funktionen, als auf den ersten Blick darin verschlüsselt zu sein scheinen. Die Gene unserer Mikroben tragen allerdings zu dieser Komplexität bei und leisten dem menschlichen Körper Dienste, die sich mithilfe dieser einfachen Organismen schneller und – für uns – einfacher entwickeln konnten.
Noch vor Kurzem ließen sich Mikroben nur untersuchen, wenn sie in Petrischalen auf einem gelierten Gebräu aus Blut, Knochenmark oder Zucker kultiviert wurden. Das ist keine leichte Aufgabe: Für die meisten Arten aus dem menschlichen Darm ist die Berührung mit dem Luftsauerstoff tödlich – sie haben in ihrer Evolution einfach keine Toleranz dafür entwickelt. Außerdem muss man bei diesen Bakterienkulturen erraten, welche Nährstoffe, Temperatur und Gase für ihr Überleben erforderlich sein könnten. Wenn das nicht gelingt, erfährt man auch nichts über die betreffende Spezies. Beim Kultivieren von Mikroben ist es wie bei der Kontrolle anhand einer Liste, wer in einer Klasse anwesend ist: Wenn man den Namen eines Schülers nicht aufruft, dann weiß man auch nicht, ob er da ist. Mit den Möglichkeiten der DNA-Sequenzierung, die durch die Arbeit am Humangenomprojekt ungemein schnell und kostengünstig geworden ist, ist es dagegen eher, als würde man sich an der Tür die Ausweise zeigen lassen; es werden also auch die gezählt, die völlig unerwartet auftauchen.
Als sich das Humangenomprojekt seinem Ende zuneigte, waren die Erwartungen sehr hoch. Man sah darin den Schlüssel zum menschlichen Wesen, zu Gottes höchstem Werk, und eine Bibliothek, die die Geheimnisse der Krankheiten barg. Als im Juni 2000 der erste Entwurf vorgestellt wurde – innerhalb des Kostenrahmens von 2,7 Milliarden Dollar und mehrere Jahre schneller als erwartet –, erklärte US-Präsident Bill Clinton:
Heute erlernen wir die Sprache, in der Gott das Leben erschaffen hat. Die Komplexität, die Schönheit und das Wunder von Gottes höchstem und heiligem Geschenk versetzt uns nun noch mehr in Erstaunen. Diese Erkenntnisse werden der Menschheit schon bald umfassende neue Heilungsmöglichkeiten an die Hand geben. Die Genomforschung wird das Leben jedes Einzelnen von uns verändern – und erst recht das unserer Kinder. Es wird Diagnose, Vermeidung und Behandlung von Krankheiten der meisten, wenn nicht aller Krankheiten des Menschen grundlegend verändern.
In den Jahren, die folgten, äußerten Wissenschaftsjournalisten auf der ganzen Welt immer häufiger ihre Enttäuschung über die geringen Auswirkungen der Kenntnis unserer gesamten DNA-Sequenz auf die Medizin. Natürlich ist das Entziffern unserer persönlichen Bedienungsanleitung unbezweifelbar eine wichtige Errungenschaft, die sich auf die Behandlung mehrerer wichtiger Krankheiten ausgewirkt hat, aber wir haben doch weniger über die Ursachen vieler verbreiteter Erkrankungen erfahren, als wir erhofft hatten. Bei der Suche nach genetischen Abweichungen bei Menschen mit einer bestimmten Krankheit fanden sich in weniger Fällen als erwartet klare ursächliche Zusammenhänge. Viele Krankheiten zeigten eine schwache Verbindung zu Dutzenden oder Hunderten von Genvarianten, aber nur in seltenen Fällen führte es unausweichlich zu einer bestimmten Krankheit, wenn man eine entsprechende Genvariante besaß.
Damals um die Jahrtausendwende ist uns einfach entgangen, dass unsere 21.000 Gene nur einen Teil der ganzen Geschichte darstellen. Die für das Humangenomprojekt entwickelten Methoden für die Sequenzierung von DNA öffneten allerdings den Weg für ein anderes bedeutendes Gensequenzierungsprogramm, das in den Medien sehr viel weniger Aufmerksamkeit erregte: das Humanmikrobiomprojekt. Statt unserer eigenen DNA widmete sich das HMP den Genomen der Mikroben in unserem Körper, die anhand ihrer DNA identifiziert werden sollten.
Nun musste man sich bei der Forschung an unseren Mitbewohnern nicht mehr mit Kulturen in Petrischalen und dem allgegenwärtigen Sauerstoff herumschlagen. Dem HMP genügten Mittel in Höhe von 170 Millionen Dollar und fünf Jahre, um 1000-mal so viel DNA zu entschlüsseln wie im HGP – und das von Mikroben aus 18 verschiedenen Habitaten in unserem Körper. Es sollte zu einer sehr viel umfassenderen Studie der Gene werden, die einen Menschen ausmachen – und zwar der menschlichen und der mikrobiellen. Kein Staatenlenker gab am Ende der ersten Forschungsphase des Humangenomprojekts im Jahr 2012 triumphale Erklärungen ab. Nur eine Handvoll Zeitungen verbreiteten die Meldung, und doch sollten wir durch das HMP mehr darüber erfahren, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, als es aus unserem eigenen Genom jemals möglich gewesen wäre.
Seit dem Beginn des Lebens auf diesem Planeten haben verschiedene Arten einander ausgebeutet, und Mikroben haben sich als besonders findig darin erwiesen, auch an den seltsamsten Orten ihr Auskommen zu finden. Angesichts ihrer mikroskopischen Größe ist der Körper eines anderen Lebewesens – insbesondere eines großen Wirbeltiers wie des Menschen – für sie nicht nur eine Nische, sondern ein ganzes Universum von Habitaten, Ökosystemen und Möglichkeiten. Ganz wie unser taumelnder, dynamisch sich stetig verändernder Planet besitzt unser Körper ein chemisches Klima, das dem Wandel hormoneller Gezeiten unterworfen ist, voller komplexer Landschaften, die sich mit zunehmendem Alter immer wieder umgestalten. Für Mikroben sind wir ein Garten Eden.
Wir haben unsere Evolution schon gemeinsam mit Mikroben durchlaufen, lange bevor wir Menschen wurden – sogar schon bevor sich unsere Vorfahren zu Säugetieren entwickelten. Und jedes Tier, von der kleinsten Fruchtfliege bis zum größten Wal, stellt eine weitere Welt für Mikroben dar. Viele von ihnen haben wegen ihrer krankheitsauslösenden Eigenschaften bei uns einen schlechten Ruf. Dennoch kann es überaus lohnend sein, eine Population dieser winzigen Lebensformen in sich zu beherbergen.
Die hawaiianische Zwergsepia – ein bunter, großäugiger Tintenfisch wie aus einem Pixar-Animationsfilm – begegnet einer bedeutenden Gefahr für sein Leben dadurch, dass er eine einzige biolumineszierende Bakterienart in einer speziellen Körperhöhle an seiner Unterseite beherbergt. Dort wandelt das Bakterium Aliivibrio fischeri Nahrung in Licht um, sodass das Leuchtorgan des Tintenfischs von unten zu glimmen scheint. So ist sein Umriss von unten für Räuber gegen die mondbeschienene Ozeanoberfläche schwieriger auszumachen. Diesen Schutz verdankt der Tintenfisch seinen bakteriellen Bewohnern, und diese verdanken ihm ihr Zuhause.
Die Verwendung von Mikroben als Lichtquelle zur Steigerung der eigenen Überlebenschancen mag uns besonders einfallsreich erscheinen, aber es sind längst nicht nur Sepien, die den Mikroben in ihrem Körper ihr Leben verdanken. Für das Leben und Überleben gibt es viele und vielfältige Strategien, und die Zusammenarbeit mit Mikroben treibt das Spiel der Evolution voran, seit vor 1,2 Milliarden Jahren die ersten aus mehr als einer einzigen Zelle bestehenden Wesen auftauchten.
Je mehr Zellen einen Organismus aufbauen, desto mehr Mikroben können in ihm leben. Großtiere wie Rinder sind für ihre Gastfreundschaft gegenüber Mikroorganismen besonders bekannt. Kühe fressen Gras, eine ballaststoffreiche Nahrung, aus der sie mithilfe ihrer eigenen Gene nur sehr wenige Nährstoffe gewinnen könnten. Eigentlich benötigen sie spezielle Proteine, Enzyme genannt, welche die widerstandsfähigen Moleküle der Zellwände der Graspflanzen abbauen können. Solche Enzyme im Zuge der Evolution selbst zu entwickeln könnte Jahrtausende dauern, da sich passende Mutationen der DNA nur zufällig und nur beim Wechsel von einer Kuhgeneration zur nächsten ereignen.
Schneller lässt sich die Fähigkeit zum Aufschlüsseln der Nährstoffe im Gras durch Outsourcing erwerben, indem man die Aufgabe Spezialisten überlässt – eben den Mikroben. In den vier Kammern des Kuhmagens sind Billionen von Mikroben am Werk, um die Pflanzenfasern zu verdauen, die in Form kleiner Kugeln hin- und herwandern zwischen dem Maul, wo sie mechanisch zerkleinert werden, und den Magenkammern voller von Bakterien erzeugter Enzyme, welche die Fasern chemisch aufschließen. Mikroben können sich die dazu nötigen Gene sehr viel leichter beschaffen, denn ihr Generationswechsel dauert häufig kaum einen Tag und eröffnet damit ein Vielfaches an Möglichkeiten für Mutationen und evolutionäre Anpassung.
Wenn Zwergsepien und Kühe vom Zusammenschluss mit Mikroben profitieren, warum nicht auch der Mensch? Wir essen zwar kein Gras und haben keinen Magen mit vier Kammern, aber auch wir sind spezialisiert. Unser Magen ist klein und sehr einfach gebaut; er soll die Nahrung eigentlich nur etwas durchmischen, ein paar Verdauungsenzyme zufügen und dazu ein bisschen Säure, um ungewollte Erreger abzutöten. Wenn wir aber weiterreisen, dann gelangen wir in den Dünndarm. Hier wird die Nahrung durch andere Enzyme weiter zerlegt und durch einen Teppich von fingerartigen Ausstülpungen, die sich zur Fläche eines Tennisplatzes summieren, ins Blut überführt. Dann erreichen wir eine Sackgasse – eher so groß wie ein Tennisball als wie ein Tennisplatz, der den Beginn des Dickdarms markiert. Diese Ausbuchtung an der rechten unteren Ecke unseres Rumpfes ist der Blinddarm, das Herz der Mikrobengemeinschaft des Menschen.
Am Blinddarm baumelt ein Organ, dem nachgesagt wird, es sei nur dazu da, Schmerzen und Entzündungen hervorzurufen: der Appendix, wegen seiner charakteristischen Form auch Wurmfortsatz genannt; man könnte ihn aber ebenso gut mit einer Made oder Schlange vergleichen. Der Wurmfortsatz kann mit nur zwei Zentimeter Länge winzig sein oder fadenförmig ausgezogen bis zu 25 Zentimeter. Einige Menschen besitzen sogar zwei, anderen fehlt er ganz. Dem Volksglauben nach wären wir Menschen ohne Appendix besser dran, denn mehr als 100 Jahre lang hieß es, er habe eigentlich überhaupt keine Funktion. In die Welt gesetzt hat diesen Mythos offenbar der Mann, der die Formenvielfalt der Tiere mit der Evolutionstheorie in einen eleganten entwicklungsgeschichtlichen Rahmen gestellt hat: Charles Darwin. In seiner auf Über die Entstehung der Arten folgenden Abhandlung Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl erwähnte er den Appendix im Zusammenhang mit anderen »unterentwickelten« Organen. Der Vergleich mit den sehr viel größeren Wurmfortsätzen anderer Tierarten hatte Darwin dazu bewogen, ihn beim Menschen lediglich als Überrest anzusehen, der infolge des Wandels der Ernährung allmählich verkümmerte.
Da es keine weiteren Erkenntnisse gab, stellte in den folgenden 100 Jahren niemand den Status des Wurmfortsatzes infrage, und seine Neigung, Schwierigkeiten zu machen, hat den allgemeinen Eindruck seiner Nutzlosigkeit noch verstärkt. Das medizinische Establishment hielt ihn für so unnötig, dass seine Entfernung in den 1950er-Jahren in den entwickelten Ländern zu den häufigsten Operationen zählte. Häufig gab es die Appendektomie bei anderen Bauchoperationen sogar als Bonus dazu. Es gab Zeiten, da wurde einem von acht Männern im Lauf ihres Lebens der Wurmfortsatz entfernt, und sogar einer von vier Frauen. Etwa fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung erleiden irgendwann in ihrem Leben eine Blinddarmentzündung, häufig in den Jahrzehnten, bevor sie selbst Kinder bekommen. Unbehandelt würde annähernd die Hälfte dieser Menschen daran sterben.
Dies ist eigentlich paradox: Wäre die Appendizitis eine Krankheit, die natürlich vorkommt und bei jungen Menschen zum Tode führt, dann hätte die Evolution unseren Wurmfortsatz rasch eliminiert. Menschen, bei denen der Appendix so groß ist, dass er sich entzünden kann, wären häufig gestorben, bevor sie sich fortpflanzen können, und hätten ihre den Wurmfortsatz ausbildenden Gene nicht weitergeben können. So hätten im Lauf der Zeit immer weniger Menschen einen Appendix gehabt, und irgendwann wäre er ganz verschwunden. Die natürliche Auslese hätte Menschen ohne Appendix bevorzugt.
Wenn der Besitz eines Wurmfortsatzes nicht potenziell lebensgefährlich wäre, dann hätte Darwins Vermutung, dass es sich um ein Überbleibsel vergangener Zeiten handelt, eine gewisse Berechtigung. So brauchen wir eine andere Erklärung dafür, dass wir ihn noch immer haben, und es gibt tatsächlich zwei, die sich nicht notwendigerweise gegenseitig ausschließen. Die erste besagt, dass Blinddarmentzündungen ein modernes Phänomen sind, das durch einen wie immer gearteten Wandel unserer Umweltbedingungen ausgelöst wurde. So könnte selbst ein nutzloses Organ die Vergangenheit einfach dadurch überdauert haben, dass es keine besonderen Schwierigkeiten verursachte. Der anderen Erklärung zufolge ist der Wurmfortsatz alles andere als ein schädliches Erbteil unserer stammesgeschichtlichen Vergangenheit, im Gegenteil, er bringt uns einen gesundheitlichen Nutzen, der die dunkle Seite trotz des Risikos einer Appendizitis überwiegt. Das würde bedeuten, dass bei der Selektion diejenigen bevorzugt werden, die das Organ besitzen. Die Frage ist nur, warum?
Die Antwort gibt uns sein Inhalt. Der durchschnittliche Wurmfortsatz ist eine acht Zentimeter lange und einen Zentimeter dicke Röhre etwas abseits des Stroms von weitgehend verdauter Nahrung, die an seiner Öffnung vorbeizieht. Er ist aber beileibe kein verkümmertes fleischiges Häutchen, sondern bis an den Rand vollgepackt mit spezialisierten Immunzellen und -molekülen. Diese liegen dort nicht einfach untätig herum, sondern bilden einen entscheidenden Teil unseres Immunsystems, indem sie mit dem ganzen Kollektiv unserer Mikroben kommunizieren, sie schützen und kultivieren. Im Innern des Organs bilden die Mikroben einen Biofilm, also eine Schicht einzelner Zellen, die sich gegenseitig unterstützen und schädliche Bakterien fernhalten. Der Wurmfortsatz ist also nicht nutzlos, sondern wird unseren mikrobiellen Untermietern vom Körper offenbar eigens als Unterschlupf zur Verfügung gestellt.
Dieser Mikrobenvorrat ist für uns so etwas wie ein für schlechte Zeiten zurückgelegter Notgroschen, aus dem der Darm nach einer Lebensmittelvergiftung oder einem Magen-Darm-Infekt wieder mit seiner gewohnten Population besiedelt werden kann. Eine derartige körperliche Versicherung mag übertrieben erscheinen, aber schwerwiegende Darmkrankheiten wie Ruhr, Cholera und Giardiasis können erst seit wenigen Jahrzehnten und nur in der westlichen Welt wirkungsvoll in Schach gehalten werden. In den entwickelten Ländern werden Ausbrüche mithilfe sanitärer Schutzmaßnahmen wie dem Aufbau einer öffentlichen Kanalisation und Wasseraufbereitung vermieden; weltweit gesehen ist aber noch immer einer von fünf kindlichen Todesfällen auf Durchfallerkrankungen zurückzuführen. Wer eine solche Krankheit übersteht, dem kommt bei der Genesung sein Appendix zugute. Nur im Kontext eines relativ hoch entwickelten Gesundheitssystems hat es den Anschein, als hätte der Appendix keine Funktion. Die möglichen negativen Auswirkungen einer Entfernung des Organs werden durch unseren modernen, hygienischen Lebensstil nur überdeckt.
Dabei zeigt sich, dass Blinddarmentzündungen tatsächlich eine moderne Erscheinung sind. Zu Darwins Zeiten waren sie äußerst selten und verursachten nur sehr wenige Todesfälle. So können wir ihm nachsehen, dass er den Appendix für einen Überrest der Evolution hielt, der uns weder nutzt noch schadet. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts traten Entzündungen des Wurmfortsatzes häufiger auf und stiegen in einem englischen Krankenhaus von drei oder vier Erkrankten pro Jahr vor 1890 auf 113 Fälle im Jahr 1918 – eine Zunahme, die alle Industrienationen in gleicher Weise betraf. Die Diagnose war nie ein Problem gewesen. Schon vor der heutigen Häufigkeit der Krankheit gaben die Bauchkrämpfe – gefolgt von einer raschen Autopsie, wenn der Patient nicht überlebte – eindeutige Hinweise.
Für den Anstieg sind seither viele Erklärungen vorgeschlagen worden, vom vermehrten Verzehr von Fleisch, Butter und Zucker bis zu verstopften Nebenhöhlen und faulenden Zähnen. Seinerzeit einigte man sich auf den sinkenden Gehalt an Ballaststoffen in unserer Nahrung als Hauptursache, aber es herrscht kein Mangel an anderen Hypothesen. Manche suchen die Schuld beispielsweise bei der verbesserten Hygiene in unserer Wasserversorgung und damit gerade bei der Errungenschaft, die den Appendix bei uns seiner Aufgabe beraubt hat. Was auch immer der Grund sein mag – etwa um den Beginn des Zweiten Weltkriegs war die Vorstellung von einer Zunahme der Blinddarmentzündungen allgemein in Vergessenheit geraten, sodass wir die Krankheit heute als normale, wenn auch unwillkommene Tatsache unseres Lebens ansehen.
Dabei kann es selbst in unserer heutigen modernen Welt durchaus nützlich sein, den Appendix zumindest bis ins Erwachsenenalter zu behalten, da er uns vor chronischen Magen-Darm-Erkrankungen, Immunstörungen, Leukämie, einigen Autoimmunkrankheiten und sogar vor Herzinfarkten schützen kann. All dies hängt mit seiner Rolle als Rückzugsgebiet für Mikroben zusammen.
Aus der Tatsache, dass der Wurmfortsatz alles andere als nutzlos ist, lernen wir aber noch etwas sehr viel Wichtigeres: Die Mikroben sind für unseren Körper sehr wichtig. Sie fahren offenbar nicht nur auf dem Trittbrett mit, sondern sind für uns so nützlich, dass wir eigens für ihre Sicherheit einen speziellen Schutzbereich entwickelt haben. Die Frage ist nun, wer dort eigentlich ist, und was dort genau für uns getan wird.
Eigentlich wissen wir schon seit etlichen Jahrzehnten, dass wir aus der Anwesenheit von Mikroben in unserem Körper den einen oder anderen Nutzen ziehen: Sie synthetisieren einige für uns essenzielle Vitamine und bauen zähe Pflanzenfasern ab. Das wahre Ausmaß der Wechselwirkung zwischen unseren und ihren Zellen kennen wir allerdings erst seit Kurzem, denn erst Ende der 1990er-Jahre gelangen Mikrobiologen unter Einsatz neuer molekularbiologischer Verfahren entscheidende Entdeckungen über unsere seltsame Beziehung zum Mikrobiom.
Die DNA-Sequenzierung erlaubt es uns, die anwesenden Mikroben genau zu identifizieren und in den Baum des Lebens einzuordnen. Mit jeder Stufe in dieser Hierarchie – von der Domäne abwärts zu Reich, Stamm, Klasse, Ordnung und Familie und weiter zu Gattung, Art und Unterart – nimmt der Grad der Verwandtschaft der Lebewesen untereinander zu. Von unten nach oben gehören wir Menschen (der Gattung Homo und Art sapiens) zu den Menschenaffen (Familie Hominidae), die gemeinsam mit Affen und anderen die Gruppe der Primaten bilden (Ordnung Primates). Gemeinsam mit den Fell tragenden Milchtrinkern gehören wir Primaten zu den Säugetieren (Klasse Mammalia), die ihrerseits Teil einer Gruppe von Tieren sind, die über ein Rückenmark verfügen (Stamm Chordata). Mit allen Tieren zusammen (ob nun mit Rückenmark oder ohne – wie beispielsweise unser Tintenfisch) bilden wir das Reich Animalia, das seinerseits Teil der Domäne Eukaryota ist. Bakterien und andere Mikroben (die nicht in diese Kategorien passenden Viren einmal ausgenommen) sind dagegen an den anderen großen Ästen des Stammbaums der Arten zu finden. Sie gehören nicht zum Reich Animalia, sondern bilden in verschiedenen Domänen ihre eigenen Reiche.
Durch Sequenzierung lassen sich verschiedene Arten also genau erkennen und in der Hierarchie des Baums des Lebens einordnen. Dabei stellt ein besonders nützlicher DNA-Abschnitt, das Gen 16S rRNA, so etwas wie einen Barcode zur schnellen Erkennung der Bakterien dar, ohne dass gleich das ganze Bakteriengenom entschlüsselt werden muss. Je mehr sich die Codes der 16S-rRNA-Gene ähneln, desto enger sind die Arten miteinander verwandt und umso mehr Zweige und Äste haben sie am Baum des Lebens gemein.
Die DNA-Sequenzierung ist aber beileibe nicht das einzige verfügbare Werkzeug. Insbesondere zur Beantwortung von Fragen, was die Mikroben eigentlich tun, verwenden wir häufig Mäuse – insbesondere keimfreie Mäuse. Die ersten Generationen dieser Labortiere wurden per Kaiserschnitt geboren und in Isolationsbehältern aufgezogen, um zu verhindern, dass sie von Mikroben – nützlichen wie schädlichen – besiedelt werden. Weitere Generationen keimfreier Mäuse kommen als Kinder keimfreier Mütter in Isolation zur Welt und bilden eine sterile Generationsfolge von Nagern, die nie mit Mikroben in Kontakt kamen. Selbst ihre Nahrung wird bestrahlt und in keimfreien Behältern aufbewahrt, damit die Mäuse nicht kontaminiert werden. Der Wechsel der Mäuse von einem kugelförmigen Käfig zum anderen ist ziemlich aufwendig, da mit Vakuum und antimikrobiellen Chemikalien gearbeitet werden muss.
Was es ausmacht, ein Mikrobiom zu besitzen oder nicht, lässt sich nun am Vergleich der sterilen Mäuse mit normalen Vergleichstieren mit der vollen Bandbreite an Mikroben genau bestimmen. Man kann keimfreie Mäuse sogar mit Bakterien einer einzigen Art oder einer kleinen Gruppe von Arten besiedeln und dann beobachten, wie jede Art zur Biologie einer Maus beiträgt. Die Forschung an diesen »gnotobiotischen« (»bekanntes Leben«) Mäusen verschafft uns Einblicke in das, was Mikroben in uns selbst tun. Natürlich lässt sich nicht alles direkt übertragen und manchmal unterscheiden sich die Resultate zwischen Mäusen und Menschen ganz gravierend. Dennoch sind diese Mäuse für die Forschung überaus nützlich und liefern uns viele entscheidende Hinweise. Ohne diese Labor-Nager käme die medizinische Forschung nur mit einem Millionstel der Geschwindigkeit voran.
So überraschte es nicht, dass auch Professor Jeffrey Gordon von der University of Washington in St. Louis, Missouri, – so etwas wie der oberste Häuptling der Mikrobiomforschung – mit keimfreien Mäusen arbeitete, als er entdeckte, in welch grundlegendem Maß Mikroben am Unterhalt eines gesunden Körpers beteiligt sind. Er hatte den Darm keimfreier und normaler Mäuse verglichen und entdeckt, dass die Zellen, die die Darmwand auskleideten, unter Einfluss von Bakterien ein Molekül abgeben, das die Mikroben ernährt und sie dazu veranlasst, sich dort niederzulassen. Die Anwesenheit von Mikroben verändert aber nicht nur die chemischen Eigenschaften des Darms, sondern auch seine Morphologie. So werden die fingerartigen Ausstülpungen unter dem Einfluss von Mikroben länger, sodass eine größere Oberfläche für die Aufnahme der benötigten Energie aus der Nahrung zur Verfügung steht. Man hat geschätzt, dass Ratten ohne ihre Mikroben etwa 30 Prozent mehr Nahrung zu sich nehmen müssten.
Es profitieren aber nicht nur die Mikroben von der körperlichen Nähe, wir tun das ebenso. Mikroben werden von uns nicht nur toleriert, wir werben aktiv um sie. Diese Erkenntnis löste gemeinsam mit den technischen Möglichkeiten der DNA-Sequenzierung und der Arbeit mit keimfreien Mäusen eine wissenschaftliche Revolution aus. Dem von den nationalen Gesundheitsinstituten der Vereinigten Staaten betriebenen Humanmikrobiomprojekt verdanken wir die Einsicht, dass unsere Gesundheit und unsere Zufriedenheit entscheidend von unseren Mikroben abhängen.
Der menschliche Körper bildet sowohl im Innern als auch außen eine Landschaft von Habitaten, wie sie in der übrigen Welt kaum vielfältiger sein könnten. So wie die Ökosysteme unseres Planeten von verschiedenen Pflanzen und Tieren bevölkert werden, so beherbergt unser Körper eine Unzahl verschiedener Mikrobengesellschaften. Wie alle Tiere sind wir im Grunde nichts anderes als eine kunstvoll gestaltete Röhre. Nahrung geht an einem Ende hinein und kommt am anderen wieder heraus. Unsere Haut sehen wir als unsere äußere Oberfläche, aber auch die Innenfläche unserer Röhre ist eigentlich »außen«, da sie in ähnlicher Weise der Umwelt ausgesetzt ist. Die Schichten unserer Haut schützen uns vor den Elementen, vor eindringenden Mikroben und schädlichen Substanzen. Ebenso wichtig ist aber der Schutz durch die Zellen des Verdauungstrakts, der sich durch uns zieht. Unser »Inneres« ist nicht der Magen-Darm-Trakt, sondern unsere Gewebe und Organe, unsere Muskeln und Knochen, die zwischen dem Inneren und dem Äußeren unserer Röhre verstaut sind.
Zur Oberfläche eines Menschen gehört deshalb nicht nur die Haut, sondern auch die Schlingen und Windungen, Furchen und Falten der Röhre im Innern. Wenn man den Körper so betrachtet, dann zählen sogar die Lunge, die Vagina und auch der Harntrakt zur Außenseite und damit zur Oberfläche. Und ganz egal, ob innen oder außen: Unsere gesamte Oberfläche ist ein möglicher Siedlungsplatz für Mikroben. Die verschiedenen Grundstücke mögen sich in ihrem Wert unterscheiden. An gefragten, rohstoffreichen Orten wie im Darm bilden sich dichte, großstadtähnliche Kolonien, während »ländliche« oder lebensfeindliche Regionen wie die Lunge oder der Magen nur wenige Arten beherbergen. Diese Lebensgemeinschaften sollten im Rahmen des Humanmikrobiomprojekts beschrieben werden, anhand von Proben von 18 verschiedenen inneren oder äußeren Oberflächen des menschlichen Körpers, und das bei Hunderten freiwilliger Probanden.
Während der ersten fünf Jahre des HMP erlebten die beteiligten Molekular-Mikrobiologen ein rauschhaftes, biotechnologisches Echo des goldenen Zeitalters der Entdeckung neuer Arten, als Formaldehyd ausdünstende Schränke fast barsten vor Vögeln und Säugetieren, welche die biologischen Forschungsreisenden des 18. und 19. Jahrhunderts entdeckt und beschrieben hatten. Wie sich zeigt, ist auch der menschliche Körper eine Schatztruhe voller bislang unbekannter Unterarten und Arten; viele konnten nur bei einem oder zwei Teilnehmern der Studien überhaupt nachgewiesen werden. Es gibt nur sehr wenige Bakterienstämme, die jeder in sich trägt, und bei Weitem nicht jeder hat dieselbe Mikrobengesellschaft in sich. Unser Mikrobiom ist ebenso einzigartig wie unser Fingerabdruck.
So sehr sich die Bewohner bei jedem von uns im Detail unterscheiden, so sehr ähneln sie sich auf der höchsten hierarchischen Ebene. Die Bakterien in unserem eigenen Darm ähneln denen unseres Nebensitzers mehr als den Bakterien, die auf unseren eigenen Knöcheln sitzen. Doch obwohl die Mikrobengemeinschaften so unverwechselbar sind, lassen sich die Aufgaben, die sie verrichten, in der Regel nicht unterscheiden. Was Bakterium A für uns selbst tut, erledigt bei unserem Freund möglicherweise Bakterium B.
Jede Körperregion bietet Mikroben eine Heimstatt, wenn sie nur Gelegenheit haben, sich an die Ausbeutung ihrer Ressourcen anzupassen – von den kühlen, ausgedörrten Hautebenen unserer Unterarme und den feuchten Urwäldern der Leistengegend bis zur säurehaltigen und sauerstoffarmen Umgebung im Magen. Und in jedem dieser Habitate gibt es weitere Nischen mit unterschiedlichen Ansammlungen von Arten. Die zwei Quadratmeter unserer Hautoberfläche bieten ebenso viele Ökosysteme wie die Landschaften Nord- und Südamerikas, nur in Miniatur. Die Bewohner unserer talgreichen Haut an Gesicht und Rücken unterscheiden sich von jenen unserer trockenen, exponierten Ellenbogen ebenso sehr wie die tropischen Regenwälder Panamas von den Felslandschaften des Grand Canyon. Während im Gesicht und auf dem Rücken Arten der Gattung Propionibacterium dominieren, die sich vom Fett ernähren, das wir aus den dort sehr zahlreichen Hautporen abgeben, findet sich auf Ellenbogen und Unterarmen eine ungleich vielfältigere Gemeinschaft. Feuchte Gegenden im Nabel, in den Achselhöhlen und der Leiste sind besiedelt von Corynebacterium- und Staphylococcus-Arten, die Feuchtigkeit brauchen und vom Stickstoff in unserem Schweiß leben.
Die Mikroben bilden dabei eine zweite Haut, die unser Körperinneres schützt und die von unseren Hautzellen gebildete Barriere stärkt. Fremde Bakterien können in diesen stark befestigten Grenzstädten nur schwer Fuß fassen und werden beim Versuch mit den chemischen Waffen der Verteidiger konfrontiert. Anfälliger gegen Invasionen sind da die weichen Gewebe in unserem Mund, die sich einer Flut von mit der Nahrung hereingeschmuggelten und der Atemluft hereingeschwebten Eindringlingen erwehren müssen.
Die Forscher des Humanmikrobiomprojektes nahmen im Mund der Probanden nicht eine, sondern neun Proben, jede von einer etwas anderen Stelle. An diesen ließen sich, nur Zentimeter voneinander entfernt, tatsächlich neun erkennbar verschiedene Mikrobengesellschaften nachweisen, die aus jeweils etwa 800 von Streptococcus und einer Handvoll anderen Gruppen dominierten Arten bestanden. Streptokokken haben wegen der vielen krankheitsauslösenden Spezies einen denkbar schlechten Ruf – von der Halsentzündung bis zur fleischfressenden nekrotisierenden Fasziitis. Viele andere Spezies dieser Gattung verhalten sich jedoch völlig untadelig und verdrängen an diesem gefährdeten Eintrittstor üble Bösewichte. Der winzige Abstand zwischen den beprobten Punkten im Mund mag uns unbedeutend erscheinen, aber Mikroben erleben diese als ungeheuere Ebenen und Bergketten mit klimatischen Unterschieden wie zwischen Nordschottland und Südfrankreich.
Stellen wir uns nun eine Klimakarte vom Mund bis zu den Nasenlöchern vor. Hier ein gefährlicher See aus Speichel auf rauem Felsuntergrund, dort ein haariger Wald voller Schleim und Staub. Die Position der Nasenlöcher als Torhüter am Eingang zur Lunge lässt eine reiche Vielfalt an Bakteriengruppen erwarten; es finden sich etwa 900 Arten, darunter riesige Kolonien von Propionibacterium, Corynebacterium, Staphylococcus und Moraxella.
Vom Hals abwärts zum Magen nimmt die Artenvielfalt im Vergleich zum Mund dramatisch ab. Die starke Magensäure tötet die meisten mit der Nahrung aufgenommenen Mikroben ab, und nur eine einzige Spezies lebt nachgewiesenermaßen bei einigen Menschen ständig dort – Helicobacter pylori, dessen Anwesenheit dort sowohl Segen als auch Fluch sein kann. Von diesem Punkt an steigen auf dem weiteren Weg durch den Verdauungstrakt sowohl die Dichte als auch die Vielfalt der Mikroben immer weiter an. Der Magen mündet in den Dünndarm, wo die Nahrung durch körpereigene Enzyme rasch zersetzt und in den Blutstrom überführt wird. Auch hier finden sich Mikroben – am Beginn des sieben Meter langen Schlauchs etwa 10.000 Individuen auf jeden Milliliter Darminhalt, am Ende, wo der Dünndarm in den Dickdarm mündet, unglaubliche 10 Millionen pro Milliliter.
Direkt vor dem sicheren Unterschlupf, den der Wurmfortsatz bietet, befindet sich eine vor Mikroben nur so wimmelnde Metropole, die das Herz der Mikrobenlandschaft des menschlichen Körpers darstellt – der tennisballgroße Blinddarm, der sich in den Appendix fortsetzt. Hier liegt das Epizentrum des mikrobiellen Lebens, wo Billionen Bakterien von mehr als 4000 verschiedenen Arten möglichst viel aus der angedauten Nahrung herausschlagen, welche gerade im Dünndarm die erste Runde der Extraktion der Nährstoffe durchlaufen hat. Dem, was übrig geblieben ist – vor allem zähe Pflanzenfasern –, widmen sich nun in Runde zwei die Mikroben.
Der anschließende Grimmdarm macht den größten Teil des Dickdarms aus. Er führt an unserer rechten Rumpfseite aufwärts bis zur Leber, knickt seitlich ab und läuft hinüber in den linken Oberbauch und dann wieder abwärts ins Becken. Er ist die Heimat von Mikroben, die in den Falten und Vertiefungen seiner Wand eine Dichte von einer Billion (1.000.000.000.000) Einzelwesen je Milliliter erreichen. Diese picken die Reste unserer Nahrung auf, wandeln sie in Energie um und lassen die Abbauprodukte zurück, damit sie von den Zellen der Dickdarmwand aufgenommen werden können. Ohne die Darmmikroben würden die Zellen der Darmwand verkümmern und absterben, denn im Gegensatz zu den meisten Zellen unseres Körpers leben sie nicht vom Zucker, den das Blut heranschafft, sondern direkt von den Abfallprodukten der Mikroben. Die feuchte, warme, sumpfähnliche und in Teilen sauerstofffreie Umgebung des Grimmdarms bietet ihren Bewohnern nicht nur einen steten Zustrom an Nahrung, sie ist auch mit einer nährstoffreichen Schleimschicht ausgekleidet, in der die Mikroben Hungerperioden gut überdauern können.
Der Darm des Menschen
Um an Proben aus den verschiedenen Bereichen des Darms zu kommen, hätten die HMP-Forscher ihre Probanden eigentlich aufschneiden müssen. Weitaus praktischer war aber die Sequenzierung der in den Stuhlproben angetroffenen Mikroben. Die Nahrung, die wir essen, wird auf dem Weg durch den Darm größtenteils verdaut und absorbiert, und zwar sowohl von uns als auch von unseren Mikroben, sodass am anderen Ende nur ein kleiner Rest wieder herauskommt. Unser Stuhl besteht eigentlich nicht aus den Überresten unserer Nahrung, sondern größtenteils aus Bakterien, und zwar lebendigen wie abgestorbenen. Bakterien machen ungefähr 75 Prozent der feuchten Masse unserer Fäkalien aus; etwa 17 Prozent sind Pflanzenfasern.
Unser Darm enthält ständig ungefähr 1,5 Kilogramm Bakterien – was in etwa dem Gewicht der Leber entspricht. Diese besitzen lediglich eine Lebensdauer von Tagen, bestenfalls Wochen. Aus den in unserem Stuhl befindlichen 4000 Bakterienarten erfahren wir mehr über unseren Körper als aus allen anderen Probenahmestellen zusammengenommen. Diese Bakterien sind eine Art Ausweis für unseren Gesundheits- und Ernährungszustand – für uns als Art, als Gesellschaft und für uns persönlich. Von allen Bakterien der Gruppe Bacteroides sind die am häufigsten in unserem Stuhl anzutreffen, aber da unsere Darmbakterien das essen, was wir essen, unterscheiden sich die Bakteriengesellschaften von einem Menschen zum andern.
Die Darmbakterien sind aber beileibe nicht nur Aasfresser, die von unseren Abfällen leben. Auch wir haben gelernt, von ihnen zu profitieren, indem wir ihnen Aufgaben überlassen haben, die wir selbst uns nur über sehr viel längere Zeiträume hätten aneignen können. Wozu braucht man das Gen für ein Protein, das Vitamin B12 erzeugt, wenn Klebsiella das für uns erledigen kann? Und wer braucht schon Gene, die die Darmwand formen, wenn Bacteroides diese schon hat? Das ist viel billiger und einfacher, als sich das alles selbst durch Evolution anzueignen. Wir werden aber bald erfahren, dass die Mikroben in unserem Darm sehr viel mehr tun, als nur ein paar Vitamine zu erzeugen.
Zu Beginn des Humangenomprojekts untersuchte man nur die Mikrobiome gesunder Menschen. Als dieser Standard etabliert war, konnte man die Frage angehen, inwiefern sich die Mikrobiome von Kranken unterscheiden. Könnten unsere modernen Krankheiten auf diese Unterschiede zurückzuführen sein, und wenn ja, was genau verursachte die Schäden? Könnten Hautkrankheiten wie Akne, Schuppenflechte und Dermatitis eine Störung des mikrobiellen Gleichgewichts der Haut anzeigen? Sind entzündliche Darmerkrankungen, Krebserkrankungen des Verdauungssystems, ja vielleicht sogar Fettleibigkeit auf eine veränderte Zusammensetzung der Mikroben im Darm zurückzuführen? Und wäre es möglich, dass sogar Erkrankungen, die sich fern der Schwerpunkte der Besiedlung mit Mikroben auswirken wie Allergien, Autoimmunerkrankungen und sogar psychische Probleme, von einem gestörten Mikrobiom herrühren?
Lee Rowens Tipp bei der Wette in Cold Spring Harbor deutete auf eine sehr viel bedeutendere Erkenntnis hin: Wir sind nicht allein, und unsere mikrobiellen Passagiere haben für unsere Existenz als Mensch eine ungleich größere Rolle gespielt als angenommen. Professor Jeffrey Gordon sagt dazu:
Die Entdeckung des von Mikroben bestimmten Teils von uns lässt unsere Individualität in einem ganz neuen Licht erscheinen. Erst jetzt werden wir uns der Verbindung mit der Welt der Mikroben wirklich bewusst. Und wir beginnen, das Vermächtnis unseres Austauschs mit Familie und Umwelt in unserer Jugend besser zu verstehen. All dies lässt uns innehalten und darüber nachdenken, ob wir bei der Evolution des Menschen nicht eine ganze zusätzliche Dimension beachten müssen.
Wir sind von unseren Mikroben abhängig; ohne sie wären wir nur ein Bruchteil unserer selbst. Was bedeutet es also, nur zu zehn Prozent Mensch zu sein?
Quellen
Die wissenschaftliche Literatur über den Einfluss von Mikroben auf die geistige wie körperliche menschliche Gesundheit wächst exponentiell an. Es ist ein neues Forschungsfeld, das erst seit etwa einem Jahrzehnt größeres Interesse erregt. Neben vielen persönlichen Gesprächen, Telefonaten und Unterhaltungen per E-Mail mit führenden Vertretern der Mikrobenforschung stammen viele in diesem Buch geschilderte Erkenntnisse aus Hunderten von wissenschaftlichen Fachaufsätzen. Ich bitte um Verständnis, dass ich von diesen nur eine Handvoll zu den wichtigsten und eindrücklichsten Phänomenen anführen kann (jeweils am Ende eines Kapitels) und dazu einige allgemeine Texte zu diesem sich rasch entwickelnden Thema.
International Human Genome Sequencing Consortium, »Finishing the euchromatic sequence of the human genome«, in: Nature 431 (2004), S. 931-945.
Nyholm, S. V. und McFall-Ngai, M. J., »The winnowing: Establishing the squid-Vibrio symbiosis«, in: Nature Reviews Microbiology
2 (2004), S. 632-642.
Bollinger, R. R., u. a., »Biofilms in the large bowel suggest an apparent function of the human vermiform appendix«, in: Journal of Theoretical Biology 249 (2007), S. 826-831.
Short, A. R., »The causation of appendicitis«, in: British Journal of Surgery 53 (1947), S. 221-223.
Barker, D. J. P., »Acute appendicitis and dietary fibre: an alternative hypothesis«, in: British Medical Journal 290 (1985), S. 1125-1127.
Barker, D. J. P., u. a., »Acute appendicitis and bathrooms in three samples of British children«, in: British Medical Journal 296 (1988), S. 956-958.
Janszky, I., u. a., »Childhood appendectomy, tonsillectomy, and risk for premature acute myocardial infarction – a nationwide population-based cohort study«, in: European Heart Journal 32 (2011), S. 2290-2296.
Sanders, N. L., u. a., »Appendectomy and Clostridium difficile colitis: Relationships revealed by clinical observations and immunology«, in; World Journal of Gastroenterology 19 (2003), S. 5607-5614.
Bry, L., u. a., »A model of host-microbial interactions in an open mammalian ecosystem«, in: Science 273 (1996), S. 1380-1383.
The Human Microbiome Project Consortium, »Structure, function and diversity of the healthy human microbiome«, in: Nature 486 (2012), S. 207-214.
1
Krankheiten des 21. Jahrhunderts
Janet Parker starb im Jahr 1978 als letzter Mensch der Welt an Pocken. Nur etwas mehr als 100 Kilometer von dem Ort entfernt, wo Edward Jenner 180 Jahre zuvor zum ersten Mal einen kleinen Jungen mit dem Kuhpockeneiter einer Milchmagd gegen die Krankheit geimpft hatte, gab das Virus in Parkers Körper sein letztes Stelldichein im menschlichen Körper. Ihre Tätigkeit als Medizinfotografin an der Universität von Birmingham hätte an sich keine direkte Gefahr dargestellt, hätte ihre Dunkelkammer nicht so nahe am Labor darunter gelegen. Als sie eines Nachmittags im August am Telefon saß und Fotoartikel bestellte, wanderten durch die Luftschächte Pockenviren aus dem »Pockenraum« der medizinischen Fakultät zu ihr herauf und verursachten die tödliche Infektion.
Ein Jahrzehnt lang führte die Weltgesundheitsorganisation WHO auf der ganzen Welt Pockenimpfungen durch, und in diesem Sommer stand man kurz davor, die endgültige Ausrottung der Krankheit zu verkünden. Der letzte Krankheitsfall lag fast ein Jahr zurück – der junge Krankenhauskoch, der sich im letzten Seuchenherd in Somalia mit einer milden Form des Virus angesteckt hatte, war inzwischen genesen. Einen vergleichbaren Sieg über eine Krankheit hatte es bis dahin nicht gegeben. Das Virus war durch die Impfungen in eine Ecke gedrängt worden, wo es keine anfälligen Menschen mehr befallen konnte und aus der es nicht mehr entkam.
Ein winziges Rückzugsgebiet war dem Erreger jedoch geblieben: die mit menschlichen Zellen gefüllten Petrischalen, in denen Wissenschaftler die Krankheitserreger heranzüchteten und untersuchten. Die medizinische Fakultät der Universität von Birmingham war ein solches Viren-Reservat, wo Professor Henry Bedson und sein Team hofften, Methoden für die rasche Bestimmung anderer Pockenerreger zu ermitteln, die von Tieren auf den Menschen übergehen könnten, jetzt wo die Menschen pockenfrei waren. Das war eine respektable Aufgabe, die den Segen der WHO hatte, obwohl Sicherheitsbeauftragte immer wieder Bedenken wegen der Sicherheitsvorkehrungen im »Pockenraum« äußerten. Da das Labor ohnehin bald geschlossen werden sollte, führten die Einwände der Inspektoren weder zur Schließung noch zu einer kostspieligen Überholung der Einrichtung.
Janet Parkers Erkrankung wurde zunächst als leichte Erkältung abgetan und erregte erst zwei Wochen nach ihrem Ausbruch die Aufmerksamkeit der Ärzte für Infektionskrankheiten. Sie war inzwischen von Pusteln bedeckt, sodass auch die Pocken in Betracht gezogen wurden. Sie wurde auf eine Isolierstation verlegt und Proben ihrer Körperflüssigkeiten entnommen. Auch Professor Bedson entging nicht die Ironie der Tatsache, dass er und seine Mannschaft aufgrund ihrer Erfahrung mit der Bestätigung der Diagnose betraut wurden. Bedsons Befürchtungen wurden bestätigt und Janet Parker in eine spezielle Isolationsklinik in der Nähe verlegt. Dort lag sie noch immer in kritischem Zustand, als Bedson zwei Wochen später, am 6. September, von seiner Frau zu Hause tot aufgefunden wurde. Er hatte sich selbst die Kehle aufgeschlitzt. Am 11. September 1978 erlag Janet Parker ihrer Krankheit.
Damit teilte sie das Schicksal vieler hundert Millionen Menschen vor ihr. Sie hatte sich mit einem Virenstamm namens »Abid« infiziert, benannt nach einem dreijährigen pakistanischen Jungen, der acht Jahre zuvor an der Krankheit gestorben war, kurz nachdem die WHO ihr Impfprogramm in Pakistan auf den Weg gebracht hatte. Seit dem 16. Jahrhundert waren die Pocken infolge der Erforschung und Kolonisierung ferner Regionen durch die Europäer in fast allen Weltregionen zu einer bedeutenden Todesursache geworden. Als die Bevölkerung im 18. Jahrhundert noch stärker anwuchs und zunehmend mobiler wurde, breiteten sich die Pocken weiter aus und zählten bald weltweit zu den bedeutendsten Todesursachen. In Europa fielen den Pocken Jahr für Jahr 400.000 Menschen zum Opfer, etwa ein Zehntel davon Kleinkinder. Durch die Einführung der Variolation – einem riskanten Vorläufer der Schutzimpfung, bei dem Gesunde zur Vorbeugung mit Pockenflüssigkeit von Kranken infiziert wurden, konnte die Todesrate schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts reduziert werden. Weitere Erleichterung brachte Jenners Entdeckung der Impfung mit Kuhpocken im Jahr 1796. Bis zu den 1950er-Jahren konnten die Pocken in den Industrienationen so gut wie besiegt werden, während weltweit jährlich bei 50 Millionen Krankheitsfällen noch immer zwei Millionen Todesfälle zu beklagen waren.
Die industrialisierte Welt hatte sich zwar aus dem Griff der Pocken befreien können, aber die Schreckensherrschaft vieler anderer Mikroben dauerte bis in die erste Dekade des 20. Jahrhunderts an. Infektionen waren bei Weitem die häufigsten Krankheiten, nicht zuletzt dank der menschlichen Neigung, Kontakte zu knüpfen und Neues auszuprobieren. Das exponentielle Bevölkerungswachstum und die damit einhergehende Zunahme der Bevölkerungsdichte erleichterte den Mikroben den für die Vollendung ihres Lebenszyklus notwendigen Sprung von einem Menschen zum nächsten. In den USA waren die häufigsten Todesursachen um 1900 nicht Herzkrankheiten, Krebs und Schlaganfälle wie heute, sondern ansteckende, von Mikroben verursachte Infektionskrankheiten. Lungenentzündungen, Tuberkulose und entzündliche Durchfallerkrankungen hatten gemeinsam ein volles Drittel der Menschen auf dem Gewissen.
Eine Lungenentzündung, die einst als »the captain of the men of death« galt, also etwa »der Anführer der Sensenmänner«, beginnt mit einem Husten. Sie wandert abwärts in die Lunge, erschwert das Atmen und löst Fieber aus. Die Lungenentzündung verdankt ihre Existenz dem ganzen Spektrum der Mikroben, angefangen von winzigen Viren zu Bakterien und Pilzen und auch parasitischen Protozoen (»erste Tiere«). Auch für infektiöse Durchfallerkrankungen können vielerlei verschiedene Mikroben verantwortlich sein. Zu diesen zählen der von einem Bakterium verursachte »blaue Tod« – Cholera, die Ruhr (»bloody flux«) –, häufig hervorgerufen durch parasitische Amöben, und das ebenfalls einem Parasiten zuzuschreibende »Biberfieber« – Giardiasis. Die dritte bedeutende Todesursache, Tuberkulose, befällt ebenfalls die Lunge, hat aber einen ganz spezifischen Auslöser: eine kleine Gruppe von Bakterien aus der Gattung Myobacterium.
Eine ganze Reihe anderer Infektionskrankheiten haben in unserer Spezies ebenfalls ihre Spuren hinterlassen – wörtlich wie im übertragenen Sinn: Kinderlähmung, Typhus, Masern, Syphilis, Diphtherie, Scharlach, Keuchhusten und, neben vielen anderen, die verschiedenen Ausprägungen der Grippe. Polio wird ausgelöst durch einen Virus, der das zentrale Nervensystem befallen kann und dabei Nerven zerstört, die unsere Bewegungen steuern. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden so in den Industrieländern Jahr für Jahr Hunderttausende von Kindern gelähmt. Syphilis – eine von Bakterien hervorgerufene Geschlechtskrankheit – soll in Europa bis zu 15 Prozent der Bevölkerung befallen haben. Den Masern fielen jährlich etwa eine Million Menschen zum Opfer. Die Diphtherie – wer erinnert sich noch an diese Geißel der Menschheit? – kostete allein in den Vereinigten Staaten Jahr für Jahr 15.000 Kindern das Leben. Und in den ersten beiden Jahren nach dem Ersten Weltkrieg tötete die Grippe zwischen fünf und zehn Mal so viele Menschen, wie dem Krieg zum Opfer gefallen waren.
Natürlich schlugen sich diese Plagen deutlich in der Lebenserwartung nieder. Damals, um 1900, betrug sie im weltweiten Durchschnitt nur 31 Jahre. Wenn man in einer Industrienation lebte, waren die Aussichten etwas besser, betrugen aber dennoch nicht einmal 50 Jahre. Während des größten Teils unserer Entwicklungsgeschichte wurden wir Menschen nur zwischen 20 und 30 Jahre alt, die durchschnittliche Lebensdauer lag allerdings noch sehr viel niedriger. Doch dann stieg in nur einem einzigen Jahrhundert, nicht zuletzt durch den in einem einzigen Jahrzehnt erzielten Fortschritt – die Revolution durch die Antibiotika in den 1940er-Jahren –, unsere Zeit auf Erden auf das Doppelte. Im Jahr 2005 durfte man als Mensch im Durchschnitt auf ein Leben von 65 Jahren hoffen, in den reichsten Ländern sogar auf ein ehrwürdiges Alter von 80 Jahren.
Diese Zahlen hängen in hohem Maße von der Säuglingssterblichkeit ab. Um 1900 lag die durchschnittliche Lebenserwartung auch deshalb so niedrig, weil bis zu drei von zehn Kindern noch vor Erreichen des fünften Lebensjahres starben. Wäre die Säuglingssterblichkeit bis zur nächsten Jahrhundertwende auf diesem Stand geblieben, dann wären in den Vereinigten Staaten jedes Jahr mehr als eine halbe Million Kinder vor ihrem ersten Geburtstag gestorben. Stattdessen waren es nur 28.000. Wenn die Mehrzahl der Kinder die ersten fünf Lebensjahre überstehen, dann erreichen die meisten von ihnen auch ein vergleichsweise hohes Alter, was die durchschnittliche Lebenserwartung hebt.
In vielen Entwicklungsländern wirkt sich das bislang nur in eingeschränktem Maß aus, doch haben wir als Art inzwischen viel im Kampf gegen unseren ältesten und größten Feind, den Krankheitserreger, erreicht. Diese krankheitsauslösenden Mikroben fühlen sich überall dort wohl, wo viele Menschen unter unhygienischen Bedingungen zusammenleben. Je mehr Menschen sich auf unserem Planeten drängen, desto leichter finden Krankheitserreger ihr Auskommen. Unsere Mobilität verschafft ihnen Zugang zu immer mehr Menschen und gibt ihnen damit mehr Gelegenheit, sich zu vermehren, zu produzieren und sich weiterzuentwickeln. Viele Infektionskrankheiten, mit denen wir uns in den vergangenen Jahrhunderten auseinandersetzen mussten, entstanden, nachdem frühe Menschen Afrika verlassen hatten und sich im Rest der Welt ausbreiteten. Die Weltherrschaft der Pathogene ist nur das Spiegelbild unserer eigenen Verbreitung, und nur wenige Arten besitzen eine derart treue krankheitserregende Gefolgschaft wie wir selbst.
Für viele bei uns in der Ersten Welt gehören die Schrecken der Infektionskrankheiten der Vergangenheit an. Vom tödlichen Kampf gegen die Mikroben ist kaum mehr geblieben als ein kurzer Pikser bei den Impfungen in unserer Kindheit, gefolgt von einem mit Polio-Impfstoff beträufelten Zuckerwürfel »zur Belohnung« – deutlicher vielleicht die Erinnerung an die langen Schlangen von Teenagern vor der Schulaula, als wir und unsere Freunde die Auffrischungsimpfungen erhielten. Für heutige Kinder und Jugendliche ist die Last der Geschichte noch leichter geworden, da viele Krankheiten zurückgedrängt werden konnten und ehemalige Routineimpfungen wie die gefürchtete »BCG« gegen Tuberkulose gar nicht mehr nötig sind.
Der medizinische Fortschritt einerseits sowie größtenteils zwischen dem ausgehenden 19. und dem Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführte öffentliche Gesundheitsmaßnahmen andererseits haben das menschliche Leben grundlegend verändert. Unsere Entwicklung von einer Zwei-Generationen-Gesellschaft zu einer Vier- oder gar Fünf-Generationen-Gesellschaft lässt sich auf vier verschiedene Faktoren zurückführen: Der erste – auch zeitlich gesehen – ist natürlich die Schutzimpfung, die wir Edward Jenner und einer Kuh namens Blossom verdanken. Jenner hatte beobachtet, dass Milchmägde vor den Pocken geschützt waren, da sie mit den sehr viel milder verlaufenden Kuhpocken infiziert waren. Er vermutete, dass sich dieser Schutz auf andere Personen übertragen ließ, wenn man ihnen etwas Eiter aus den Pusteln einer Milchmagd injizierte. Sein erstes Versuchskaninchen war ein achtjähriger Junge namens James Phipps – der Sohn von Jenners Gärtner. Nach dieser Impfung versuchte Jenner zweimal, den tapferen Jungen durch Injektionen mit echten Pockenerregern zu infizieren. Das Kind war tatsächlich immun.
Die Pockenimpfung von 1796 war nur der Anfang; im 19. Jahrhundert wurden Impfungen gegen Tollwut, Typhus, Cholera und die Pest entwickelt, seit 1900 gegen Dutzende andere Infektionskrankheiten. Impfungen haben Millionen vor Leid und Tod bewahrt und manche Krankheiten länder- oder gar weltweit ausgerottet. So sind wir beim Schutz gegen Krankheitserreger nicht mehr allein auf die im Zuge einer gefährlichen Erkrankung erworbene Erfahrung unseres Immunsystems angewiesen. Die riskante Methode, uns die Abwehrkräfte auf natürlichem Weg zu beschaffen, umgehen wir klug und geben unserem Immunsystem stattdessen eine Vorwarnung auf das, was kommen könnte.
Ohne vorherige Impfung führt der Kontakt mit einem neuen Erreger zum Ausbruch einer Krankheit, vielleicht zum Tod. Das Immunsystem geht in diesem Fall nicht nur gegen die eindringenden Mikroben vor, es produziert auch Moleküle, die Antikörper genannt werden. Wenn der Patient überlebt, dann patrouillieren diese Antikörper wie ein Team von Spezialisten im ganzen Körper und halten nach dieser speziellen Mikrobe Ausschau. Das tun sie noch lange, nachdem die Krankheit überwunden ist, um das Immunsystem im Fall einer erneuten Infektion sofort zu alarmieren. Beim zweiten Mal ist das Immunsystem vorbereitet und kann verhindern, dass sich die Krankheit festsetzt.
Die Impfung täuscht diesen natürlichen Vorgang vor und schult das Immunsystem, einen bestimmten Krankheitserreger zu erkennen. Anstatt zum Erlangen der Immunität die komplette Krankheit zu durchleiden, brauchen wir nur noch die Injektion oder orale Einnahme einer getöteten, abgeschwächten oder nicht vollständigen Version des Krankheitserregers zu erdulden. Obwohl uns die Krankheit erspart wird, reagiert unser Immunsystem auf den Impfstoff und produziert die Antikörper, die dem Körper bei einer tatsächlichen Infektion helfen, die Krankheit zu bekämpfen.