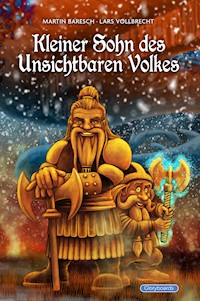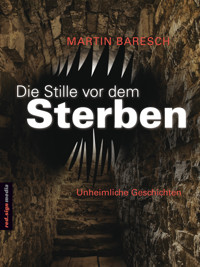
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: red.sign Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Let there be blood: Sechs unheimliche Geschichten von MARTIN BARESCH (CAMELON, TATORT: BLUTHUNDE) exklusiv als eOnly bei red.sign-media: - Der unheimliche Geist der Weihnacht. In der Stille vor dem Sterben heraufbeschworen aus purer Kinderangst in einem uralten Bunkerkeller! - Das Weihnachts-Tattoo. Stille Nacht, eisige Nacht - wenn einer einen Rachedämon direkt über dem Herzen trägt - und nichts mehr ist, wie es scheint! - Schmerzensgöttin. Du bist ganz allein im Grauen Zimmer, ringsum nur Tod und Verwesung. und die Gewissheit: Die Uhr tickt, die Schmerzensgöttin wird kommen! - Sturmstreichler. Die unheilige Zeit der Verseuchung der Welt - und ein ganz besonderes Mädchen verwandelt sich in etwas Unbeschreibliches! - Beute. Sie erwacht nachts in einem unheimlichen, völlig leeren Zug, blutige Klauenabdrücke an der Decke über ihr. Und die Schritte des Verfolgers nähern sich. - Im Korridor. entscheidet sich auf aberwitzige Art und Weise das Schicksal Deutschlands und der Welt! Ob eiskalte Psychoschocker-Geschichte, rasanter, hammerharter Actioner, bestialischer Horror oder visionärer Albtraum - die unheimlichen Geschichten von Martin Baresch werden auch Sie packen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.“ (Mark Twain)
So gesehen, begegnen uns der Wahnsinn und selbst Teufel (in Menschengestalt) in unserer Realität auf der Straße, in Arztpraxen, eigentlich überall, während wir unser Leben leben - Tag für Tag, oft hinter harmlosesten Biedermanngesichtern getarnt.
Umso wichtiger erscheint mir deshalb der ausdrückliche Hinweis darauf, dass sämtliche Personen, Orte und Handlungen in den Geschichten dieser Sammlung nicht real, sondern frei erfunden sind. Ähnlichkeiten also rein zufällig wären und völlig unbeabsichtigt.
Für Doris
... auf der Reise durch das Nachtland an meiner Seite.
„Die Vergangenheit ist ein Gespenst, das unser gegenwärtiges Leben ständig heimsucht.“
Stephen King in „Danse Macabre“
„Lasst mich raus! Bitte, bitte, lasst mich raus!“
Weihnachten … das war für ihn auch nach all diesen Jahrzehnten noch die Vergangenheit, diese jämmerliche, viel zu laut flehende Kinderstimme und das Grauen, in den Schatten am Fuß der steilen Treppe jene Familie sehen zu können, schemenhaft, die sich im Dezember 1951, an Heiligabend, dort unten gegenseitig zerfleischt hatte. An dem Tag, an dem er geboren worden war.
Weihnachten, das war er selbst, als Kind, 1959.
Das war eine Kindheit voller Gerüchte und vager Geschichten über die Toten dort unten, war die Zeit des Eingesperrtwerdens. Seine Zeit im Keller, zusammengekauert auf der obersten Stufe der morschen, hölzernen Treppe, das Gesicht nass vor Tränen und Rotz und doch wie im Fieber so heiß gegen die Kellertür gepresst. Ringsumher - nichts als Dunkelheit und hauchzarte, klebrige Spinnweben und die Ahnung grausiger Einflüsterungen und Erinnerungen - und daraus hervor wuchernder eigener, noch viel schrecklicherer Gedankenbilder.
Wie er darauf hoffte, einen Lichtschimmer von draußen durch die Risse der alten Lattentür wahrnehmen zu können, oder einen Laut zu hören.
Überhaupt irgendetwas zu hören.
Hastige Schritte auf den Steinfliesen im Korridor draußen, vielleicht; ferne Stimmen aus der Küche der Großeltern im Erdgeschoss, dort, wo die Mutter, die Tante und Großmutter das Weihnachtsessen vorbereiteten; den Hauch eines Lachens; das tröstende Wispern seiner jüngeren Schwester Romy – oder, wenigstens, das unterdrückte Schluchzen seiner Mutter, das ihren Schmerz darüber verriet, dass man ihn am Heiligen Abend bestrafen musste.
Doch außerhalb seines Kopfes war nichts … Nur eisige Stille.
Selbst die fernen Geräusche jenseits der unmittelbaren Stille schien es nicht mehr zu geben: das phantomhafte Rauschen des Schneepflugs, der in regelmäßigen Abständen die Fabrikstraße räumte; die silberhellen Stimmen der Nachbarskinder, die am Straßenrand einen Schneemann bauten und sich dabei stritten; nicht einmal mehr das Stundengeläut der Kirchenglocken gab es.
Und innerhalb seines Kopfes sah er sie alle jenseits der Kellertür versammelt: seine Großeltern Gottfried und Anna, seine Tante Hildegard, die Onkel Kurt und Anselm, seine Eltern Eberhard und Katharina, seinen fettleibigen Bruder Konstantin und die zierliche Romy, seine kleine Schwester; sah sie wie eine Teufelshorde vor der Kellertür stehen – lauernd und nickend und sich flüsternd gegenseitig in dem bestärkend, was die Großmutter vorhin gesagt hatte:
„… Angst hat noch keinem geschadet, im Gegenteil. Die wird ihn Respekt lehren und, im rechten Moment folgsam zu sein. Sie wird ihn disziplinieren und abhärten und zu einem starken Mann machen. Weil, schließlich – gehört nicht den Starken die Welt? Alles wird gut sein, und danach wird er seine Lektion gelernt haben, ein für allemal.“
In Wirklichkeit hatte er seine Lektion niemals gelernt, bis heute nicht, und niemals war alles so richtig gut gewesen in seinem Leben, und stark war nur eines geworden … diese viehische, allgegenwärtige, unbestimmbare Angst in ihm.
****
Wenn manche Erinnerungen gut sind, weil sie längst Vergangenem und längst Verstorbenen eine Art ewiges Leben und Bedeutung verleihen, so gibt es andere, ganz spezielle, die manchen Ereignissen definitiv zu viel Bedeutung verleihen - eine schleichend lebensvergiftende Bedeutung. Schemenhafte Erinnerungen, die man vergessen will; die man verdrängt, und die sich schließlich verdrängen lassen, mit jedem vergehenden Jahr ein wenig mehr.
Erinnerungen, wie diejenige an den Tod des winzigen, behinderten Bruders, den man als Achtjähriger nur ein einziges Mal im Arm gehalten hatte, unter dubiosen Umständen; Erinnerungen an die vielen, vor den Eltern geheim gehaltenen Besuche an seinem Kindergrab; Erinnerungen daran, wie bald die Eltern schon nicht mehr über ihn hatten sprechen können und in ihrem Schmerz noch weiter abgerückt waren von ihren lebenden Kindern.
Solche Erinnerungen, redete er sich ein. Doch natürlich waren es viel mehr noch die anderen Erinnerungen, die er loswerden wollte … Erinnerungen an lähmende Dunkelheit, an dieses Gefühl absoluten Ausgeliefertseins, Erinnerungen an reglose, zerschundene Körper, die Nikolauskappen trugen, keck in die Stirn gezupft. Und aus denen sich … etwas erhoben hatte, mit rasiermesserscharfen Klingen und Klauen und Raubtierfängen.
Aber auch diese speziellen Erinnerungen hatten sich verdrängen lassen, waren unter tausend Selbstzweifeln, Beteuerungen und schließlich logischen Erklärungen zu einem unguten Gefühl geworden, einem Gefühl des Belauertwerdens, einer Ahnung ständiger ungewisser Bedrohung … und irgendwann scheinbar ebenfalls verschwunden. Sie waren zu etwas geworden, das er nur scheinbar tapfer und selbstironisch als den Fluchtreflex bezeichnete, wenn sie sich tief unten in ihm regten. Trotz der eisigen Angst, die ihn dabei jedes Mal wie ein Blitz aus purer Schwärze durchfuhr. Trotz der Flüsterstimme, die er dabei zu hören glaubte.
Von der Flüsterstimme hatte er seiner Freundin niemals etwas erzählt. Auch nicht von seiner Zeit im Keller. Überhaupt niemandem hatte er davon erzählt.
Der Fluchtreflex, er kehrte jedes Jahr wieder; pünktlich Ende November schien er mit den ersten träge vom Himmel herab schwebenden Schneeflocken zu kommen, mit den dickbäuchigen Novemberwolken, den herausgeputzten, blinkenden, blitzenden Schaufenstern, den ewig gleichen Weihnachtsliedern in den Kaufhäusern, den Spendenaufrufen der Hilfsorganisationen, den langen, in graue Abgaswolken gehüllten Autoschlangen in nebligen Straßen. Mit dem Schnee, der sich am Straßenrand schnell rußig-schwarz färbte und zu einem pockennarbigen Krebspanzer wurde. Mit der Hektik, die Jahr für Jahr bizarrer Höhepunkt vor dem Fest des Friedens war.
Diese Stimmung, sie trieb ihn hinaus, in die Stadt, hinein in die dicht gedrängt hastenden Menschen mit ihren geröteten Gesichtern, den triefenden Nasen; ihrem Schwitzen unter den Pelzmänteln, Anoraks, Parkas.
Als könnte er auch nur einen von ihnen beschützen; oder gar retten.
An den Ampeln, unter den quer über die Straßen aufgehängten Neonsternen und dem Goldlametta und den überall ausgestellten Weihnachtsbäumen der weihnachtsdekorierten Stadt hörte er sie ungeduldig murren und über Zeit reden, die viel zu knapp bemessene Freizeit, in der man nun die Geschenke einkaufen musste; Geschenke für alle, vor allem aber für die Kinder, die doch gar nichts mehr zu schätzen wussten, außer den verrücktesten Klamotten, Videorekordern und Computern und möglichst bündelweise Geld; und dass gewisse Wünsche auf ihren Wunschlisten sogar nachdrücklich pinkrot unterstrichen waren.
In den grippedampfenden Kaufhäusern hörte er Kinder schreien und quengeln und weinen; sah sie an den Händen ungeduldiger, überforderter Mütter und unerbittlich strenger Väter mitgeschleift werden, hin zum nächsten Geschenk, zum nächsten dringend benötigten Weihnachtsgeschenk.
Er beobachtete, wie sie in die Parkhäuser zurücktrotteten, wie sie Weihnachtsmärkten einen hastigen Besuch abstatteten, blindlings, hektisch, schließlich hastig betrunken, beladen und behängt mit Plastiktüten, mit großen und kleinen Geschenkkartons, mit bereits verpackten Überraschungen. Die Gesichter kaum friedlicher jetzt, nicht verklärt – Gott sei Dank, eine Verpflichtung, ein Stress, ein Punkt auf meiner To-do-Liste weniger. Denn Liebe und Weihnachten trugen in dieser Zeit ganz andere Namen: nämlich Geld und Hektik und Einkaufenmüssen und Druck.
Er folgte unglücklichen Männern, Frauen, Kindern auf ihrem Weg durch den Schneematsch nach Hause und ging noch lange vor den hellen Fenstern auf und ab, in Gedanken bei den Kellern, den vielen Kellern, die es gab; ein einsamer Spaziergänger in einer unwirklichen, traumhaften Dunkelheit, die keine richtige Finsternis mehr werden konnte, weil überall künstliche Sterne und Schaufenster strahlten - die pervertierten Sterne von Bethlehem, so kalt wie die Herzen der Menschen, die auf ihre Kinder einbrüllten beim Einkaufen der Weihnachtsgeschenke, sie hierhin und dorthin zerrten und schlugen und schlimmer als Hunde behandelten; so kalt wie der Tod … und eine ferne Flüsterstimme. Eine Flüsterstimme, in einem tiefen, kalten Keller, in dem bereits Menschen gestorben waren.
An diesem Abend floh er halb besinnungslos aus dem Kaufhaus, eilte die Rolltreppe hinab, ließ sich tränenblind von den Menschenmassen davonstrudeln … hinaus, in das Schneegestöber, das eingesetzt hatte, vorbei an den dicht vor hell erleuchteten Schaufenstern am Boden kauernden Bettlern mit ihren kleinen „Ich habe Hunger!“-Pappschildern.
Irgendwann fand er seinen in einer dunkleren Seitenstraße abgestellten Wagen und warf sich hinein, ohne zu wissen, wie er ihn hatte erreichen können mit seiner Kraftlosigkeit; warf sich hinein in eine stählerne Kälte, die sich darin ausgebreitet hatte und an der er selbst dann noch festzukleben drohte, als er längst viel zu schnell unterwegs war.
Nein, gar nichts war gut in seinem Leben, und niemals an Weihnachten, denn Weihnachten, das war die Zeit dort unten, im Keller, an dieser Tür. In dieser unermesslichen Stille; denn tatsächlich, so hatte er es sich später eingeredet, hatte er niemals wirklich auch nur den geringsten Laut gehört jenseits der Kellertür, ob seine Eltern, Großeltern, die Tante und seine Geschwister nun tatsächlich lauernd und lauschend und tuschelnd dort draußen beieinander gestanden waren oder nicht.
****
Dieser tief ins lehmige Erdreich getriebene und mit einem alten Bunker voller Schatten und uralter Geheimnisse verbundene Gewölbekeller unter dem großen, alten Haus verschlang seit jeher jedes Geräusch wie ein ungeheuerliches Wesen.
Das zumindest wusste er, denn es war ihm eingehämmert worden, seit ihn die Hebamme in dieser verfluchten Mordnacht aus seiner Mutter heraus und in diese Welt gezerrt hatte. Unmöglich, die Geschichten seiner Großmutter zu vergessen.
„Alle drei, Vater, Mutter und die kleine Tochter, wollten dort unten wohnen, unbedingt. Angeblich hatten sie Schlimmes erlebt und gesehen, und dort, bei den dicken Grundmauern unseres Hauses, fühlten sie sich in Sicherheit, endlich in Sicherheit – und nur dort. Und es gab ja auch, durch den alten Bunker, einen eigenen Ausgang in den Garten. Diese armen Leute, sie wollten für sich sein und waren zufrieden, wenn man ihnen genügend Wasser und Lebensmittel vor die Kellertür gestellt hat. Das haben wir gemacht, immer. Das war uns ein Herzensanliegen. Und wie haben sie`s uns gedankt?“
Selbst heute, als Erwachsener, konnte er, ob er wollte oder nicht, ihre monotone Stimme noch hören, und wie sie von dieser armenFlüchtlingsfamilie plapperte, die nach dem Weltkrieg im Haus ihres Mannes Gottfried, seines über alles geliebten Großvaters, zwangseinquartiert worden war, weil es viel zu wenig Wohnraum gab im zerbombten Nachkriegsdeutschland. Die Geschichte selbst kam ihm noch unwirklicher vor als früher, abgerutscht an den unteren Rand seines Unterbewusstseins; aber sie war da, sie lauerte allgegenwärtig. Und mit ihr dieses Entsetzen in der Stimme der Großmutter, wenn sie in einem Satz zusammengefasst hatte, wie diese Familie dort unten gehaust hatte, nämlich: „Wie die Tiere!“
Mit diesem Satz, der ihm noch jedes Mal wie ein schleimiger Auswurf vorgekommen war, hatte sie ihre Erzählungen, die letzten Endes doch kaum mehr als Andeutungen waren, immer beschlossen und beschloss sie auch heute noch, hochbetagt, dement – jedoch nicht, was die arme Flüchtlingsfamilie anbelangte; mitgenommen von einem langen Leben voller Erinnerungen an diese Nacht, totenblass und vorwurfsvoll zugleich: „Und nichts hat man oben von der Tragödie gehört, gar nichts. So sehr wir auch die Luft angehalten und gehorcht haben, wenn uns das möglich gemacht wurde von deiner Mutter, die es in dieser Nacht auch nicht leicht hatte … deinetwegen.“
Er hatte oft an das kleine Mädchen denken müssen, früher; und natürlich hatte er nach ihr gefragt: ob sie wohl auch unbedingt dort unten hatte hausen wollen, im Dunkeln, oder ob sie nicht lieber mit den anderen Kindern aus dem Viertel in der Sonne gespielt und gelacht und wieder Kind gewesen und alles Schlimme aus der Vergangenheit vergessen hätte. - Doch mehr war nie in Erfahrung zu bringen gewesen, über die bedauernswerte Flüchtlingsfamilie.
Stille und Schweigen waren schon damals nicht nur im Keller zuhause gewesen, sondern auch oben im Haus, zwischen den Mitgliedern seiner Familie, und so hatte er sich im Lauf seiner Kindheit an das Immergleiche gewöhnt. Düstere Geschichten, Andeutungen, vage Vorwürfe, Halbheiten. Niemals Antworten, von der Großmutter nicht, vom Großvater nicht und auch nicht von seinen Eltern und der Tante - vor allem nicht auf die Fragen, die ihn von klein auf am drängendsten beschäftigten: „Was glaubt ihr - warum waren die irgendwann nicht mehr zufrieden, eure armen Flüchtlinge? Warum sind Mutter, Vater, Kind dort unten ausgerechnet an Heiligabend wie in einer Raserei übereinander hergefallen und haben sich gegenseitig … weh getan – obwohl es durch den Bunker doch einen Fluchtweg gegeben hätte? Warum sind die nicht einfach abgehauen?“
Stattdessen neues Grauen, Jahre später, als er vom Nachbarn Lohr weitere Einzelheiten erzählt bekam: wie der Gottfried in dieser Heiligabendnacht 1951 schließlich unruhig geworden war, weil die Lebensmittel nicht abgeholt wurden, und da unten nach dem Rechten geschaut … und das Kind gefunden hatte.
„Zuerst das Kind“, wie Lohr mehrfach betonte, der sich ansonsten damit zufrieden gab, sonntags mit Hingabe Akkordeon zu spielen, Lili Marleen und andere Soldatenlieder, wie sein Großvater das verächtlich nannte. „Kaum sieben Jahre alt war die Kleine damals, und da lag sie nun, mit dieser dreckigen, mottenzerfressenen Weihnachtsmannkappe keck in die Stirn gezupft. Am Fuß der Kellertreppe. Mit den Darmschlingen des Vaters erdrosselt, und das halbe Gesicht weggebissen.“
Und dass der arme Wurm gekreischt und um sein Leben gebettelt haben musste, erzählte Lohr, geschrien und gebettelt haben musste bis zuletzt.
Doch im Haus oben hatte man nichts gehört.
Gar nichts.
****
Befand man sich erst einmal hier unten, im kalten Keller, im Dunkeln, noch dazu als Kind, hörte man auch nichts mehr von oben, nicht einmal, wenn man das Gesicht panisch gegen die Tür presste, als könne man so das rissige Holz wie Luftmoleküle durchdringen.
Auch das wusste er, immer noch.
Diese Lektion zumindest hatte er gelernt.
Er hatte seine Erinnerungen, verwaschen, halb verdrängt, seltsam flackernd; hatte sie damals schon gehabt, reale oder eingebildete oder erfundene, was machte das schon für einen Unterschied?
Kinderseelen sind zerbrechlich und aus flüchtigem Stoff.
Wenn er daran denken musste, in der Weihnachtszeit, verwandelten sich seine Seele, sein Körper, sein ganzes Leben in einen Knoten, und er befand sich von Neuem dort unten. Im Dunkel. In dieser Stille, diesem Geruch. Wieder acht Jahre alt, zitternd, das Gesicht voller Tränen und Rotz gegen die Kellertür gedrückt, schluchzend, bettelnd. An seinem Geburtstag, der zugleich ein Tag war, an dem unerklärliche Morde verübt worden waren; an diesem ganz besonderen Weihnachtstag, der für ihn für alle Zeit Weihnachten sein würde.
Über ihm war es, als stehe die Zeit still, schlagartig zu purem Eis erstarrt, war es, als seien mit dem Beginn seiner Bestrafung außerhalb des Kellers alle Vorbereitungen für diesen Heiligen Abend, für das gemeinsame Singen, Beten, Essen und Geschenkeüberreichen abrupt beendet. Als werde es nie wieder einen Laut geben – im Haus über ihm nicht, und hier unten, im Keller erst Recht nicht, am Fuß der steilen Treppe. Und auch keine Weihnachtslieder. Eine Stille herrschte, wie vor dem Sterben, solange er selbst aus dem Leben seiner Familie entfernt war.
Es waren Kartoffeln eingelagert im Keller, und Äpfel aus dem großen Garten hinter dem Haus, in großen, selbstgezimmerten Lattenkisten. Doch es roch nicht nach Äpfeln hier unten, sondern nach feuchtem Lehm und Stroh, jenem Gemisch, mit dem man früher die Mauern hochgezogen hatte. Aus den Kartoffeln ragten bald schon bleiche, wurmartige Triebe, obwohl das unmöglich war, solange kein Sonnenstrahl sie fand. Es roch nach Kalk. Und dicht darunter erahnte man den Blutgeruch, den Verwesungsgeruch trotzdem, immer noch, obwohl die sterblichen Überreste und die Matratzenlager der armen Flüchtlinge gleich nach Entdeckung der Tat entfernt worden waren.
In dieser Unerträglichkeit aus dumpfer Stille und Finsternis, Angst, Selbstmitleid, Hass, Neid auf Romy und Tris, kam es ihm schließlich so vor, als habe das Haus über ihm wie ein Sterbender einen letzten langen, schon nach Verfall stinkenden Atemhauch ausgestoßen - und damit Bewohner und Weihnachtsgäste gebannt: „Psst! Der kleine Satansbraten lauscht, er hört alles, und er wird sich nicht mehr so sehr fürchten, wenn er irgendetwas hört. Das dürfen wir nicht riskieren. Denn so ist es keine Strafe mehr. Also: psst, pssst.“
Jahre später erst, als es zu spät war, begriff er, dass in genau dieser Unerträglichkeit die Kreatur geboren, nein: wiedergeboren worden sein musste. Der personifizierte unheilige Geist der Weihnacht.
****
Mit vor Anspannung geballten Fäusten hatte er, da er von draußen, von jenseits der Kellertür also, nichts hören konnte, wenigstens festzustellen versucht, wie spät es war – und schließlich aufgegeben. Wie lange mochte er schon hier unten kauern und schreiend weinen und betteln?
„Lasst mich raus … Bitte, bitte, lasst mich raus.“
Und … saß er noch allein hier im Dunkel? Vibrierte die Treppe nicht, wie unter schleichenden Schritten?
Noch war es nur ein unbehagliches Ahnen; etwas wie ein geträumtes flüchtiges Atemholen.
Vor Angst leckte er sich über die Lippen, und da schmeckte er nur Rotz und noch mehr Angst. Also versuchte er, um sich abzulenken, sich daran zu klammern, dass der Bunker-Ausgang in den Garten schon vor Jahren zugemauert worden war. Es konnte niemand da sein, außer ihm. Dort unten, am Fuß der Treppe. Oder im Bunkerkeller. Am Anfang glaubte er das tatsächlich noch und konzentrierte sich auf die Weihnachtsdüfte, die sich behutsam zu ihm in die Finsternis herab schlichen.
Er war immer glücklich gewesen in der Weihnachtszeit, obwohl Heiligabend und sein Geburtstag ein und derselbe Tag … und gleichzeitig ein fürchterlicher Mord-Erinnerungstag waren.
Es war trotzdem so schön, früher, zusammen mit ihnen allen Weihnachten zu feiern; mit ihnen zu essen, den leisen Unterhaltungen der Erwachsenen zuzuhören; manchmal sogar ohne die Worte oder deren Bedeutung verstehen zu können – wenn sich die Unterhaltung kurz um die Morde drehte -, sondern nur deren Klang nachzuspüren; den Zigarrenrauch einzuatmen, den Onkel Anselm beim Reden ausatmete, als sei er der leibhaftige Satan. Die wachsende Ungeduld seines älteren Bruders Tristan und der kleinen Romy zu spüren. Das Sehnen, nein, das Schmachten, bis es soweit war, bis der gute heilige Geist die Geschenke in den verschlossenen Raum nebenan gebracht und liebevoll unter dem Christbaum abgelegt hatte.
So musste sich das anfühlen … Geborgenheit. Und ein Teil seiner Weihnachtsglückseligkeit waren die Weihnachtsdüfte gewesen. Zimt. Honig. Anis. Mandeln. Der Geruch von Lebkuchen und frischem Gebäck, das er mit seiner Mutter aus dem Herd gezogen hatte. Der Duft der Wärme aus dem alten Backofen in der ansonsten kalten und karg eingerichteten Küche der Großeltern im Erdgeschoss des Hauses; von brennenden Kerzendochten, schmelzendem Wachs, von Tannenzweigen.
Dann, ganz abrupt, war er erneut abgelenkt, dort unten im Keller; spürte er, dass sie sich in den ersten Stock des Hauses zurückgezogen hatten und dort, um den Christbaum im großen Wohnzimmer versammelt, beteten, wahrscheinlich auch für seine unsterbliche Seele. Denn natürlich waren sie gute, um seine unsterbliche Seele besorgte Menschen und keine sabbernde Teufelshorde. Sie waren: seine Familie, die eine gerechte Strafe vollstreckte, nein, vollstrecken musste.
Weil er, wie seine Tante Hildegard behauptete, den Teufel im Leib hatte.
Weil er seinen neugeborenen, behinderten Bruder aus dem Kinderbett gehoben hatte, das davor sein Kinderbett gewesen war. Das er wiederhaben … nein: das er nicht kampflos hergeben wollte. Sie hätten mich fragen können!, dachte er – wütend. Obwohl er mit acht Jahren längst viel zu alt, zu groß, zu schwer war für dieses lächerliche Bettchen auf wackeligen Rädern, das Romy, sooft die Mutter es ins große Wohnzimmer stellte, so rührend liebevoll und sanft schaukelte, um das winzige, gequälte Neugeborene zu beruhigen.
Ihn hatte man nie beruhigt, und so summte er nun selbst vor sich hin und versuchte, sich wieder fort zu träumen.
Fort aus dem Zwiespalt aus schlechtem Gewissen und Trotz, fort von den Gedanken an den winzig-kleinen, noch ungetauften Bruder mit der zerschlitzten Oberlippe und dem klaffenden Spalt im Gaumen, den man immer dann sehen konnte, wenn er, da seine Luft- und Speiseröhre miteinander verwachsen waren, nach Atem rang, oder vor Hunger oder Schmerzen oder wegen beidem schrie wie eine Furie, bis sein Gesicht sich blau färbte. Und fort auch aus der schwarzen erstickenden Enge des Gewölbekellers … und seiner Bestrafung.
Er wollte, dass es nicht mehr wichtig war, was er getan hatte; er wollte bei ihnen sein, oben, im ersten Stock des Hauses. Im Warmen, im Hellen.
„Mama … Papa … Er kann mein Kinderbett haben“, flüsterte er gegen die Tür. „Er kann es haben.“ Er wird sowieso nicht lange leben, weil er so krank ist.
Irgendwann schrie er es wie von Sinnen so laut und wütend er nur konnte und schmierte mit zittrigen Fingern seinen Rotz über das raue Holz, schrieb damit: Es tut mir leid! Und, schließlich: ICH HASSE EUCH!
Er sah, wie es letztes Jahr war; sah seine Mutter die Kerzen am geschmückten Baum anzünden, er hörte die Weihnachtslieder, die vor diesem Baum gesungen wurden. Hörte das Knistern und Reißen von Geschenkpapier, die Freudenjauchzer von seinen Geschwistern und von sich selber, die halblauten Ermahnungen der hochbetagten Großeltern: „Nach dem Krieg waren wir froh, wenn es einen Apfel zu Weihnachten gab, oder Nüsse! Oder Socken und lange Unterhosen. Das könnt ihr Jungen euch heute gar nicht mehr vorstellen.“
Und nachts – der stille und ehrfürchtige Spaziergang durch knirschenden Schnee und eine merkwürdig nach Schwefel riechende, klirrend kalte Luft, vorbei an den dampfenden Misthaufen vor den alten, dick eingeschneiten Bauernhäusern bei dem großen, hoch ummauerten Pfarrgarten, hin zur unbeheizten Kirche, in die Mitternachtsmesse. Schnee, immer noch mehr Schnee, der in großen, zarten Flocken aus dem schwarzen Nichts herab schwebte, unablässig. Und seinerseits wiederum Erinnerungen mit sich trug, an halsbrecherische Schlittenfahrten in den letzten Tagen vor Weihnachten – auf dem Bauch liegend, Kopf voraus, die Höllenschanze an den Weinbergen hinab. Sich Überschlagen im hochstiebenden Weiß, durchnässt, halb erfroren, aber sprachlos glücklich. Dann, zu Hause angekommen, die Wärme im halbdunklen, behaglichen Wohnzimmer der Großeltern, das tief empfundene Gefühl einer großen Festlichkeit, die Wohlgerüche von Bratäpfeln auf dem glühend heißen altertümlichen Kohleofen.
Aber natürlich gelang es ihm niemals wirklich, sich aus dem Keller fort zu träumen.
Und aus dem dumpfen Lehmgeruch des Keller- und Bunkerbodens und den weichen, weiß gekalkten Lehm-/Strohwänden war stattdessen die Kreatur hervorgequollen.
Aus der schwarzen Kälte tief unten, am Fuß der steilen Holztreppe, wo sein Großvater zuerst das kleine Mädchen der armen Flüchtlingsfamilie gefunden hatte, erdrosselt, die eine Gesichtshälfte weggefetzt, hatte sie sich erhoben, geisterhaft, dunkler noch als das Dunkel im Keller und im Bunker. Nur zu erahnen, nichts weiter als Fantasie, ein Albtraumgebilde, körperlich gewordene Kinderangst mit vielen, vielen Reißzähnen und Klauen und sichelartigen Messerklingen.
„Du hast mich gerufen? Ins Leben, in eure Welt geholt, wie damals das kleine, arme Flüchtlingsmädchen?“
Er wusste, dass die Kreatur nicht wirklich da war, dass sie nicht wirklich zu ihm sprach.
Er redete es sich murmelnd ein; mit speichelsprühenden Lippenbewegungen, immer und immer wieder, bis er es selbst tatsächlich glauben konnte: „Da ist nichts. Niemand ist da. Überhaupt niemand. Bitte … lieber Gott, lass niemand da sein!“
Aber es ist eine Sache, sich einzureden, dass da niemand und nichts war; eine völlig andere ist es, eine Anwesenheit und ein Kichern zu spüren in der Finsternis.
Ein Näherkommen.
Die Schwärze, die jenseits seiner Schuhe begann, war plötzlich die Finsternis des Weltraums, und tief unten, die stets feuchten, roh zusammengezimmerten Holzregale, in denen der Großvater seine Weinflaschen lagerte, wurden zu Gestalten, die mit den verkrüppelten Silhouetten der zahllosen im Keller abgestellten alten Dinge längst verstorbener Bewohner des Hauses zum Leben erwachten und einen Zeitlupenreigen aufführten.
Aus dem Erahnen winzigster Tierbewegungen winzigster Würmer, Käfer, Raupen erwuchs etwas Großes, Allumfassendes … etwas, das sich tastend, versuchsweise, auf die unterste Treppenstufe schob, und auf die nächste und wieder nächste. Etwas in seiner Gesamtheit Schleimiges mühte sich kriechend, schnaufend, stöhnend zu ihm herauf. Bleiche Auswüchse wie von Kartoffeltrieben, Zähne, Klauen, Klingen scharrten über das Holz der abgewetzten Stufen.
Das Ding brachte den Geruch des Kellers aus dem Dunkel mit sich, und … kitschige, nach Mottenkugeln stinkende Nikolauskappen.
Als er dies sieht, zerbirst seine innere Welt in einem Strudel weißglühend kreisender Gedankenfetzen. Er fährt herum, kratzt und reißt am Holz der Kellertür, bis seine Fingernägel splitternd aus den Nagelbetten gerissen werden, hämmert mit beiden Fäusten und schreiend auf die Kellertür ein; empfindet kurz hochblitzend eine jähe Hoffnung darauf, den Schlüssel zu hören, der sich im Schloss der Kellertür dreht; meint Arme zu spüren, die ihn umfangen und Schutz, Wärme, Geborgenheit spenden. Eine Stimme zu hören, die ihm sagt, dass er keine Angst mehr zu haben braucht. Dass er sich alles nur eingebildet hat, dass es vorbei ist. Dass man ihm verzeiht, dass er kein böser Junge ist, kein schlimmes Kind, das an einem Mordtag geboren wurde und deshalb den Teufel im Leib hat, nur ein wildes Kind, das seinen Eltern und überhaupt allen ständig nur Kummer und Sorgen bereitet.
Aber da ist kein Laut. Nicht wirklich.