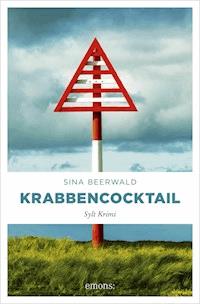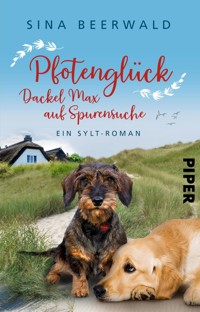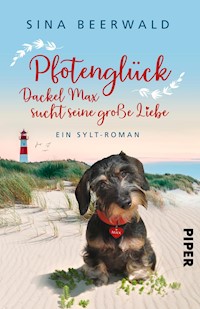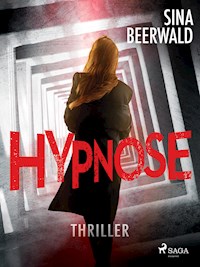4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große historische Roman um das Geheimnis der Zeitmessung Im Hamburg des Jahres 1757 wartet die junge Merit voll banger Vorahnung auf die Heimkehr ihres geliebten Mannes, der als Matrose dem Ruf des Geldes gefolgt ist. Doch die Seefahrt ist nicht nur ein einträglicher, sondern vor allem ein gefährlicher Beruf. Denn ohne die Möglichkeit zur genauen Positionsbestimmung auf See ist die sichere Heimkehr eines Schiffes ebenso sehr vom Glück wie von Mut und Können der Steuermänner abhängig. Deshalb lobt das britische Königshaus ein unvorstellbar hohes Preisgeld für denjenigen aus, der dem Sternenhimmel das Geheimnis der exakten Navigation zu entlocken vermag. Merit, deren Schwager als Uhrmacher arbeitet, hat schließlich eine Idee, die ebenso genial wie unerhört ist. Mit einer Erfindung, die einer Frau nicht zusteht, macht sie sich auf den Weg von Hamburg nach London … »Aus den Fäden von Fakten und Fiktion knüpft die Autorin das schillernde Gewebe eines historischen Romans, der sich aus dem Gros des Genres durch eine glückliche Verbindung von lebensnah gezeichneten Charakteren und solider wissenschaftlicher Recherche abhebt.« Der Teckbote Neben dem historisch verbürgten Wettrennen um das Geheimnis von Zeitmessung und Navigation auf See sind von Sina Beerwald bei Knaur auch die folgenden historischen Romane erhältlich: »Das Mädchen und der Leibarzt« »Das blutrote Parfüm« »Die Goldschmiedin«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sina Beerwald
Die Herrin der Zeit
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der große historische Roman um das Geheimnis der Zeitmessung
Im Hamburg des Jahres 1757 wartet die junge Merit voll banger Vorahnung auf die Heimkehr ihres geliebten Mannes, der als Matrose dem Ruf des Geldes gefolgt ist. Doch die Seefahrt ist nicht nur ein einträglicher, sondern vor allem ein gefährlicher Beruf. Denn ohne die Möglichkeit zur genauen Positionsbestimmung auf See ist die sichere Heimkehr eines Schiffes ebenso sehr vom Glück wie vom Mut und Können der Steuermänner abhängig.
Deshalb lobt das britische Königshaus ein unvorstellbar hohes Preisgeld für denjenigen aus, der dem Sternenhimmel das Geheimnis der exakten Navigation zu entlocken vermag. Merit, deren Schwager als Uhrmacher arbeitet, hat schließlich eine Idee, die ebenso genial wie unerhört ist. Mit einer Erfindung, die einer Frau nicht zusteht, macht sie sich auf den Weg von Hamburg nach London …
Inhaltsübersicht
Prolog
Erstes Buch
Zweites Buch
Drittes Buch
Viertes Buch
Fünftes Buch
Sechstes Buch
Siebtes Buch
Achtes Buch
Epilog
Nachwort
Glossar
Danksagung
Prolog
Ein Schatten schlich an dem Gemälde vorbei. Mit vorsichtigen Schritten tastete sich die Gestalt über den knarrenden Holzfußboden zu den drei großen, messingglänzenden Uhren. Die Zeitgeber tickten unter Panzerglaswürfeln von der Außenwelt unberührt inmitten des hellblau gestrichenen Museumsraumes. Die Töne eines jeden Meisterwerks, charakteristische Klangfärbungen, waren zu einer auf der ganzen Welt einmaligen Melodie vereint, die über Lautsprecher den Raum erfüllte. Zarte, helle Töne, übermütig tippelnd, begleitet vom unbestechlichen Rhythmus sonorer Mollschläge, dazwischen eine leise, singende Uhrenstimme. Uhren konnten singen. Niemals hätte sie das für möglich gehalten.
Im altehrwürdigen Königlichen Observatorium von Greenwich lauschte Maryann White dem Klang der Zeit in der Stille der einsamen Nacht. Niemand würde sie für eine Einbrecherin halten. Keine schwarze Maske verdeckte ihr Gesicht, und sie trug auch keine Handschuhe, die ihr eindeutiges anatomisches Erkennungsmerkmal, den verräterischen Schwimmhautlappen zwischen linkem Ringfinger und kleinem Finger, hätten verdecken können. Wozu auch? Gestern hatte sie die Diagnose bekommen. Ihr Leben war fast vorbei. Falls ihr die Polizei nach der Tat auf die Schliche käme, würde sie ihre Strafe nicht mehr absitzen müssen. Der Arzt gab ihr noch drei Monate.
Der Lichtschein ihrer Taschenlampe fiel auf die erste Uhr von John Harrison, kurz H1 genannt, an der der geniale Mann fünf Jahre lang bis 1735 gearbeitet hatte. Das vom Erfinder selbst gebrauchte Wort »Maschine« war wohl der treffendste Ausdruck für dieses pyramidenförmige Wunderwerk. Selbst für einen Mann mit ausgebreiteten Armen war es kaum zu fassen und mit einem Gewicht von zweiunddreißig Kilogramm nur schwer zu tragen. Das mechanische Skelett bestand aus einem blank polierten Gewirr metallischer Teile, die Räder waren aus Holz geschnitzt. Es erzeugte einen dunklen Ton, satt und regelmäßig. Dem ahnungslos vorbeischlendernden Museumsbesucher offenbarten erst die vier zweckmäßig gestalteten Zifferblätter, an denen sich Stunde, Minute, Sekunde und das Tagesdatum ablesen ließen, dass es sich um eine Uhr handeln müsse. Mit der Genauigkeit dieses Zeitmessers hätte John Harrison fast das vom englischen Parlament ausgelobte, millionenschwere Preisgeld gewonnen. Fast.
Mit acht schnellen Schritten konnte der eilige Besucher an den Nachfolgeuhren H2 und H3 vorbeigehen und damit am gesamten Leben von John Harrison, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, das Rätsel um die Zeit zu lösen. Neunzehn lange Jahre, bis ins hohe Alter, widmete sich der gelernte Tischler und autodidaktische Uhrmacher vergeblich seinem dritten Zeitmesser.
Maryann leuchtete mit der Taschenlampe voraus und näherte sich der vierten und letzten Glasvitrine in der Reihe. Jeder ihrer kurzen Schritte verursachte ein zähes Knirschen des spröden Holzbodens.
Der Lichtkegel erhellte ein silbern glänzendes Taschenuhrgehäuse. Mit zwölf Zentimetern Durchmesser wirkte dieser elegante Zeitmesser im Gegensatz zu seinen Vorgängern verloren in dem überdimensionalen Schaukasten. Als Museumswärterin hatte sie tagein, tagaus mit wachsamem Blick und gebührendem Abstand dieses wertvolle Kleinod beschützt. Heute, an ihrem letzten Arbeitstag und nahe an ihrem ärztlich prophezeiten Lebensende, fühlte sie sich, als müsse sie sich nicht von einem Gegenstand, sondern von ihrem eigenen Kind verabschieden.
Das weiße Emailzifferblatt der von zarter Hand gefertigten Uhr aus dem Jahr 1759 glänzte, als hätte es nicht schon Jahrhunderte überdauert. Die Bemalung mit schwarzen, filigranen Blütenranken zeugte von einer Liebe zum Detail, von einer Leidenschaft und Hingabe, die Maryann noch heute spüren konnte.
Im Inneren, für den Besucher nur auf Fotografien zu sehen, schützte eine golden glänzende, überreich verzierte, ziselierte Platine mit gitterartig durchbrochenen Blätterranken das Uhrwerk und präsentierte in geschwungenen Lettern den Namen des Erfinders: John Harrison & Son A. D. 1759. Wie war das möglich? Ein Mann, der sich auf die Prinzipien des Großuhrenbaus verstand und jahrzehntelang wie ein Besessener seine grob mechanischen Ideen verfolgt hatte, präsentierte der Menschheit plötzlich eine handliche Taschenuhr!
Sie richtete ihre Lampe auf das gegenüberhängende Gemälde, das den alternden John Harrison lebensgroß in braunem Justaucorps und mit weißer Lockenperücke in aufrechter Haltung zeigte, stolz eine kleine Uhr zur Schau stellend. Ein überlegener Zug umspielte seine Mundwinkel, doch die Furche zwischen seinen Augenbrauen verlieh ihm einen eher nachdenklichen Ausdruck, fand sie. Der freundliche Blick aus seinen wässrigen, blauen Augen war im Wissen um sein Geheimnis direkt auf ihre Person gerichtet. Wie gerne hätte sie ihn gefragt, was in jener Zeit wirklich geschehen war.
Die schlichten, blau schimmernden Zeiger der Taschenuhr in der Vitrine standen still. Sie zeigten auf die Sekunde genau zehn Minuten vor zwei Uhr an. Im Gegensatz zu den drei metallisch funkelnden Ungetümen, die regelmäßig vom weiß behandschuhten Kurator aufgezogen wurden, durfte die Taschenuhr nicht ticken, damit sie der Nachwelt unbeschadet erhalten blieb und Zeugnis von jenen Tagen ablegen konnte, als dem Schöpfer das jahrtausendealte Geheimnis entlockt wurde, wie man die Sterne vom Himmel pflückt und die präzise Zeit in ein Uhrgehäuse sperrt.
Maryann spürte ihr Herz schneller schlagen, je näher sie ihrem Ziel kam. Nur einmal den Klang dieser Uhr hören, das Ticken fühlen, spüren, wie die Taschenuhr zu leben begann, und beobachten, wie sich die Zeiger über das Zifferblatt bewegten. Diesen letzten Wunsch wollte sie sich heute Nacht erfüllen.
Kurz vor Feierabend, beim Hineinlegen der Spendeneinnahmen, hatte sie den Schlüssel aus dem Safe an sich genommen. Ihre Hand zitterte nun. Mit einem in ihren Ohren viel zu lauten Klacken schloss sie die große Vitrine auf. Auf der dunklen Präsentationsfläche lag dekorativ rechts neben der Taschenuhr der kleine weiße Aufzugschlüssel. Maryann streckte ihre Finger danach aus. Sie wusste, was gleich passieren würde.
Der Alarm jagte ihr trotzdem das Adrenalin in die Glieder. Sie zuckte unwillkürlich zurück. Der schrille, jaulende Ton trieb sie zur Flucht an, doch sie blieb stehen. Zuerst reglos, dann näherte sich ihre linke Hand wieder der Uhr. Es war wie ein Zwang, dem sie folgen musste.
»Gebt mir noch ein wenig Zeit, nur einen Augenblick, bitte. Ich will sie spüren, ihr Geheimnis erfühlen …«
Erstes Buch
Geschehen zu Hamburg, London
und auf den stürmischen Weiten des Ozeans
im Monat Mai A. D. 1757
Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen als Zeichen für Festzeiten, für Tage und Jahre dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, um über die Erde hin zu leuchten. Und so geschah es.
1. Mose 1,14–15
Es geschah am Mittag des siebenundfünfzigsten Tages. Der eisige Nebel lichtete sich gegen Mittag. Die schwankenden Schiffsplanken erzitterten unter dem Getrampel der unzähligen aufgeregten Schritte. Wie Gefangene, die unverhofft aus einem Verlies freikamen, stürzten die Matrosen an die Reling, hielten Ausschau nach Land. Vergebens. Sie sahen nur das Meer. Bis zum Horizont ein schwarzblaues Tuch, leicht gewellt, als läge es über unzähligen Toten.
Stille breitete sich aus, einzig unterbrochen vom Züngeln und Lecken des Wassers am hölzernen Rumpf und von dem tönenden Stechschritt des Kapitäns. Mit einem gezielten Hammerschlag nagelte er einen Goldgulden an den Fockmast.
Die Matrosen drehten sich in ihren steif gefrorenen Segeltuchhemden nach dem Geräusch um, nur der begehrliche Blick zeugte noch von Leben in ihren kraftlosen Körpern. Wenige hoben den Kopf. Sie verbargen die Lücken der ausgefallenen Zähne hinter den vor Anstrengung zusammengepressten Lippen, bei vielen blutete das Zahnfleisch. Die blauen Flecke im Gesicht und an den Händen waren die ersten Fingerabdrücke des Todes. Siebzehn leblose Körper hatten sie bereits über Bord geworfen. Die mit Steinen beschwerten Säcke waren schnell gesunken.
Der Gestank der Skorbutkranken war allgegenwärtig, er umschlich die Gesunden und mahnte sie, die Reise zu beenden. Doch sie befanden sich rund zehntausend Seemeilen von der Heimat entfernt. Unter Lebensgefahr hatten sie die tosende See um Kap Hoorn bezwungen, sintflutartigem Eisregen getrotzt, unermüdlich den Schnee von Deck gefegt und die spiegelglatten Bretter mit Asche bestreut. An gefrorenen Tauen waren sie dem peitschenden Wind entgegengeklettert, und irgendwo zwischen Himmel und Meer hatten sie die steifen Segel eingeholt, bis die Haut an den Fingern aufriss und ihnen das Blut die Hände wärmte. Seit siebenundfünfzig Tagen irrten sie auf See, der Sturm war ihr Steuermann.
»Einen Goldgulden für den Matrosen, der zuerst Land entdeckt!« Die Adern am Hals des Kapitäns schwollen an, während er die Worte über Deck schrie. Er war ein Mann von gedrungener Gestalt und sein Blick eisern wie der einer Galionsfigur. Seit sechzehn Jahren fuhr er als Kapitän zur See. Jede Fahrt ein weiterer Kampf ums Überleben, eine Fahrt ins Ungewisse, bei der die Verantwortung für die wertvolle Ladung der aus vier Schiffen bestehenden Flotte und damit auch für über eintausend Seemänner auf seinen Schultern lastete. Damit er nicht eines Tages unter diesem Druck zusammenbrach, reagierte er selbst mit Härte und immer häufiger mit willkürlicher Gewalt.
Die kantigen Gesichtszüge des Kapitäns verzerrten sich zu einem schiefen Grinsen, als er sich nach achtern zu seinem Steuermann begab. Die Matrosen wichen zur Seite. Land zu entdecken war keine Offerte gewesen. Es gab nur Befehle an Bord. Und wer dem Nächsten nach Gott nicht gehorchte, wurde bestraft. Gnadenlos.
Wie gelähmt beobachtete Geert Ole Paulsen das Tun des Kapitäns. Bereits das sechste Mal in Folge war er von Hamburg nach Amsterdam aufgebrochen, um sich von dem Kapitän als Erster Steuermann anheuern zu lassen. Nunmehr im fünfundfünfzigsten Lebensjahr war er eigentlich schon zu alt für solch eine Fahrt, aber der Kapitän schätzte ihn als zuverlässigen Mann, und es gab einen guten Lohn. Auch sein Sohn Geertjan war in diesem Jahr dem Ruf des Geldes gefolgt und stand ihm als Matrose hilfreich zur Seite.
Im Haus der Paulsens war seine Schwiegertochter Merit allein mit seiner Frau Pauline und dem knapp sechsjährigen Ruben zurückgeblieben. Der Junge wusste noch nichts von der Gefahr, in die sich sein Vater und Großvater begeben hatten, um das Haus zu bezahlen und die kleine Familie zu ernähren. Merit hatte nur zögernd eingewilligt, sie beide gehen zu lassen. Geertjan vermisste seinen Jungen und seine Frau, das war ihm anzusehen. Auch jetzt hatte er wieder die kostbare Taschenuhr hervorgeholt, die sein Zwillingsbruder Manulf eigens für ihn als Hochzeitsgabe gefertigt hatte.
Es war die erste Liebesheirat in der Familie gewesen. Geertjan und Merit hatten vereinbart, jeden Mittag, wenn die Sonne am höchsten stand, aneinander zu denken. Damit Geertjan wusste, wann es in Hamburg zwölf Uhr war, hatte er mittels seiner Taschenuhr die Uhrzeit des Heimathafens mit auf das Schiff gebracht.
Er hatte nicht glauben wollen, dass dies ein erfolgloses Unterfangen sein würde. Schon bald nach der Abreise zeigte selbst dieses kostbare Stück zu den unmöglichsten Zeiten Mittag, weil die Schwankungen des Schiffes dem empfindlichen Uhrwerk zusetzten. Auf See galt nur die prächtige Himmelsuhr Gottes, nichts anderes hatte vor seiner gewaltigen Schöpfung Bestand. Einzig mit ungenauen Sanduhren konnten sie sich behelfen.
Gedankenverloren drehte Geertjan die Taschenuhr zwischen den Fingern. Geert Ole ahnte, was in seinem Sohn vorging. Seit dem Nebel um Kap Hoorn waren die Zeiger endgültig stehen geblieben.
Geert Ole selbst dürstete es weniger nach Liebe als nach reinem Wasser. Sein Mund war trocken, die Zunge klebte am Gaumen. Er schluckte nur selten den mühsam gesammelten Speichel die ausgedörrte Kehle hinunter. Seine Lippen waren aufgesprungen und mit eitrigen Blasen übersät. Im Gegensatz zu den übrigen Seemännern erging es ihm aber trotz seines Alters noch regelrecht gut. Sein langer und sehniger Körper war einiges gewohnt. Zudem konnte er von Glück reden, in der Gunst des Kapitäns zu stehen. Dadurch ließ sich vieles besser aushalten. Außerdem hatte er dieses Mal Geertjan bei sich, und vor seinem Sohn wollte und durfte er keine Schwäche zeigen. Der Gedanke an seinen Enkel im fernen Hamburg tat sein Übriges, die Qualen erträglich scheinen zu lassen. An sein kratzbürstiges Eheweib Pauline dachte er besser nicht, umgekehrt tat sie dies mit Sicherheit auch nicht.
Geert Ole Paulsen hob die Sanduhr hoch. Noch ein Glas, dann war es schätzungsweise Mittag, bis dahin sollte die Sonne ihren höchsten Stand erreicht haben. Nach endlosen Tagen der Irrfahrt durch den Nebel bot sich ihm endlich wieder die Gelegenheit, mithilfe des Winkels zwischen Sonne und Horizont den Breitengrad zu bestimmen. Das Besteck würde er hoffentlich noch gissen können, bevor der Kapitän das Wort an ihn richtete. Er kam recht gut klar mit dem jähzornigen Alten, wie der Kapitän hinter vorgehaltener Hand genannt wurde. Hier an Bord konnte er sich als Steuermann beweisen. Anders als zu Hause. Dort führte sein Eheweib seit Jahr und Tag das Regiment. Dagegen genoss er auf dem Schiff hohes Ansehen und das Vertrauen des Kapitäns, der große Stücke auf die Navigationskünste seines Ersten Steuermanns hielt.
Doch dieses Mal war alles anders. Unzählige Tage lang waren sie wie Blinde durch den Nebel gesegelt, hatten versucht, sich vage zu orientieren, in der Hoffnung, endlich und wie durch ein Wunder Land vor sich zu sehen.
Der Wasservorrat war aufgebraucht. Oder besser gesagt: der Trinkwasservorrat. Denn es gab noch Wasser an Bord, fässerweise sogar. Doch dieses war längst grün geworden, mit Schleim überzogen und von unzähligen kleinen Würmern belebt. Der Nächste, der in einer schlaflosen Nacht zu den Fässern schleichen und seinem fiebrigen Durst nachgeben sollte, würde sich bald unter Krämpfen winden und sterben. Wenn sie nicht innerhalb der nächsten Tage Land anlaufen würden, dann … Geert Ole wollte nicht weiter darüber nachdenken. Probleme schob man am besten aus der Welt, indem man sie ignorierte.
Das Bild der unzähligen Matrosen aber, die mit vornübergebeugten Körpern und zitternden Muskeln ihre Arbeit an Deck verrichteten, ließ sich nicht beiseiteschieben. In breiter Reihe knieten sie nebeneinander und schrubbten das Wetterdeck im vorgegebenen Takt mit ihren Gebetbüchern. Dieser holländische Ziegelstein eignete sich bestens dazu, das mit Seewasser begossene und mit Sand bestreute Fichtenholz zu scheuern, bis es wieder hell schimmerte. Der Kapitän war der Meinung, die harte Arbeit würde die Männer von ihren Schmerzen ablenken.
In der hinteren Reihe brach einer der von Skorbut gezeichneten Männer zusammen. Keiner der anderen wandte auch nur den Kopf nach ihm. Sie wussten, dass es zu spät war. Man würde den Leichnam später über Bord werfen.
»Wann werden wir Land erreichen, Steuermann?« Kapitän Werson war an ihn herangetreten. Der Alte sprach laut, aber in ruhigem Tonfall. Trotzdem missfiel Geert Ole irgendetwas in dessen Stimme. Er schauderte unmerklich, als sich der Herr des Schiffes dicht vor ihn stellte und abermals das Wort an ihn richtete: »Wo liegen die Juan-Fernández-Inseln, die wir anlaufen wollten?«
»Verzeihung«, sagte Geert Ole und rang um seine gewohnte Sicherheit, »ich konnte das Besteck noch nicht gissen.«
Der Kapitän warf einen Blick auf die Sanduhr. Das obere Glas war leer.
Geert Ole wurde es siedend heiß. Wie immer, wenn er unter Druck geriet, konnte er kaum mehr klar denken. Seine Gliedmaßen fühlten sich taub an, wie in Blei gegossen. Er musste handeln, aber es gelang ihm nicht. Stattdessen betrachtete er den Kapitän, als käme dieser aus einer fernen Welt.
»Was hältst du Maulaffen feil, Steuermann? Beweg dich!«
Der Befehl des Kapitäns löste die Fesseln der Erstarrung. Eilig drehte er die Sanduhr um, läutete die Glocke mit vier Doppelschlägen und rief in monotonem Singsang: »Quartier ist aus!« Das Kommando zum Wachwechsel musste auch noch in der Back zu hören sein, wo sich ein Teil der Kameraden in den letzten vier Stunden auf engstem Raum, umgeben vom Gestank menschlicher Ausdünstungen, schlaflos hin- und hergewälzt hatte.
»Sollte ich da eben eine Nachlässigkeit meines Steuermanns bemerkt haben?« Kapitän Werson blieb erstaunlich ruhig. Geert Ole wäre es lieber gewesen, der Alte hätte einen Tobsuchtsanfall erlitten. Doch nichts dergleichen geschah. Auch riss er ihm nicht, wie erwartet, Oktant, Logge und Kompass aus der Hand, um die Messungen selbst vorzunehmen.
»Einmal gehe ich nun um das Schiff herum«, verkündete der Kapitän stattdessen. »Und sobald ich zurück bin, will ich unsere Position wissen. Die genaue Position.«
Die genaue Position. Geert Ole traten die Schweißperlen auf die Stirn. Der Kapitän war anders als sonst. Wie sollte er in dieser kurzen Zeit zu einem Ergebnis kommen? Den Längengrad, auf dem sie sich befanden, konnte er ohnehin nur schätzen.
Um seine innere Ruhe wiederzufinden, beschloss er, zunächst den Breitengrad zu ermitteln, was besonders unter den momentanen Bedingungen gut gelingen dürfte.
Er drehte der Sonne den Rücken zu. Mit einem tiefen Atemzug sammelte er all seine Konzentration, ehe er den Oktanten zur Beobachtung ansetzte. Ein hölzerner Winkelmesser, ähnlich einem Zirkel, dessen beide Enden eine leicht gebogene Messingskala verband. Der Oktant lag ruhig in seiner Hand. Die sanften Wellen ließen das Schiff ohne größere Schwankungen über die See gleiten. Er peilte den Horizont an und verstellte den Zeigerarm, bis er in dem daran angebrachten Spiegel die Sonne sah. Er dankte dem Herrgott für dieses Instrument und gedachte seiner Vorfahren, die die gleißende Lichtkugel direkt anvisieren und um ihr Augenlicht fürchten mussten.
Die Skala zeigte 15 Grad an. Die folgende Rechnung führte er mithilfe seines Heftes aus, das er immer griffbereit liegen hatte. Daraus ergab sich der 55. Breitengrad.
Stur wandte er die Zahlen und Formeln an, wie er es gelernt hatte. Geertjan wollte dagegen ständig wissen, welcher Sinn sich dahinter verbarg. Immer wieder erzählte ihm sein Sohn etwas von der Schräglage der Erde, von Jahreszeiten und Sonnenständen. Wozu? Wozu die Dinge begreifen, wenn doch das Ergebnis stimmte?
All seine freie Zeit verbrachte Geertjan mit unsteten Gedanken, die auch darum kreisten, wie man den Längengrad berechnen könnte. Wie vom Teufel geritten, suchte er nach einer Lösung, obwohl schon Isaac Newton, der ehrenwerte und gelehrte Sir Isaac, an dieser Frage gescheitert war. Das Geheimnis um den Längengrad war dem Herrgott nicht zu entlocken, auch auf See war Er der Herrscher über Leben und Tod. Den Längengrad ungefähr bestimmen zu können, war schon ein großes Geschenk.
»Nun, wie lautet unsere Position?« Geert Ole musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, wer bereits wieder hinter ihm stand.
»Wir befinden uns Kurs West auf dem 55. Breiten…«
»Davon gehe ich aus«, unterbrach ihn Kapitän Werson scharf. »Ich will wissen, wie weit wir schon nach Westen gesegelt sind!«
»Das ist schwer zu sagen.«
»Das weiß ich, Himmelherrgottsakrament! Mein Steuermann muss mir keine Vorträge über das Längengradproblem halten! Dann muss eben geschätzt werden! Wie immer!«
»Aber diesmal … Ich kann nicht einmal mehr schätzen. Der Sturm, die Strömung, der Nebel … Ich habe kaum …«
Kapitän Werson beugte sich vor und kam nahe an sein Ohr. »Ich will eine Position. Sofort«, zischte er. »Das ist ein Befehl!« Der Alte wandte sich ab und schrie über Deck: »Gisst das Besteck!« Fluchend machte er sich auf den Weg zu seiner Kajüte.
Geert Ole Paulsen rannte zur Handlogge. An der Reling traf er mit seinem Sohn zusammen, der die kleine Sanduhr geholt hatte. Ihre Blicke trafen sich. Es waren die gleichen grünblauen Augen. Sein eigen Fleisch und Blut. Es bedurfte keiner Worte.
Geertjan schaute wehmütig auf See hinaus und sagte: »Ich bin froh, wenn wir diese Reise überleben und wieder zu Hause sind. Ich vermisse Merit und mein Kind. Ich werde bald wahnsinnig vor Sehnsucht.«
»Ich freue mich auch sehr auf Hamburg, das kannst du mir glauben.« Der Heimathafen und das kleine rote Haus in der Niedernstraße tauchten vor seinem inneren Auge auf, während er die Handlogge hochhob. Es kostete ihn Kraft, die Holzspindel mit dem aufgerollten Seil über seinen Kopf zu halten, obwohl das Gewicht eigentlich nicht der Rede wert war. Ein weiterer Matrose trat herbei und warf das am Seilende befestigte Holzstück über Bord. Der skorbutgeschwächte Mann konnte sich kaum auf den Beinen halten. Er sprach undeutlich, durch die Krankheit waren ihm fast alle Zähne ausgefallen.
Geertjan drückte ihm die umgedrehte Sanduhr in die Hand, führte selbst das Seil über Bord und zählte die Knoten der auslaufenden Leine, bis das Glas leer war.
»Vier Knoten!«, rief er.
»Vier Seemeilen in der Stunde«, murmelte Geert Ole, als er sich in Begleitung seines Sohnes zur Kapitänskajüte begab und anklopfte. »Bei der Geschwindigkeit könnten wir auch nach Hause laufen.«
Geertjan lachte. »Ich wusste nicht, dass Sie übers Wasser gehen können, Vater.« Im selben Moment wurde er ernst. »Wir sollten uns unsere Kräfte gut einteilen.« Mehr sagte er nicht.
Geert Ole nickte, trat an seinem Sohn vorbei und ging nach harscher Aufforderung des Kapitäns hinein.
Die Kajüte war ungewöhnlich groß, aber nur mit dem Notwendigsten eingerichtet. Eine verglaste Kerzenlampe pendelte über einem dunklen Holztisch. Dieser war mit einem Tau an den Deckplanken befestigt, damit er trotz der Schiffsbewegungen an Ort und Stelle blieb. Daneben hing eine kastenförmige Uhr an einer gelenkartigen Vorrichtung, deren Gehäuse mit rot schimmerndem Schildplatt furniert war. Die Uhr war schön anzusehen. Einen anderen Zweck erfüllte sie nicht. Der Herr des Schiffes wäre vermutlich auch gerne der Herr über die Zeit gewesen, dachte Geert Ole, allerdings ging eine Pendeluhr an Land zwar durchaus sehr genau, auf See aber war sie völlig unbrauchbar. Selbst mit dieser neuartigen Kajütenuhr, in der das Pendel durch eine Unruh ersetzt worden war, hatte der Kapitän kein Glück. Sie zeigte eher die Zahl der verlorenen Matrosen denn die Zeit an. Es war zum Verzweifeln …
Der matte Lichtschein fiel auf das unbewegte Gesicht des Kapitäns. Er saß vor dem Logbuch, steif und starr, die Feder in der Hand.
»Und?«, fragte der Alte, ohne aufzusehen.
Geert Ole nannte mit dünner Stimme Windrichtung, Kurs, Geschwindigkeit, den Breitengrad und die Dauer der Fahrt seit dem letzten Kurswechsel.
Die Feder kratzte über das Papier. Die Spalte für den heutigen Tag füllte sich. Sobald der Kapitän damit fertig war, übertrug er die Strecke in die Seekarte. Hinter dem Schreibtisch wirkte der Alte durch die vornübergebeugten Schultern nahezu schmächtig und schwach, aber sein Gesichtsausdruck verriet etwas anderes. Seine Stirn legte sich in Falten, Zornwülste bildeten sich zwischen den Brauen, und seine Augen verengten sich.
»Ich habe es satt. Ich habe es einfach satt!«, spie er hervor. »Einzig sicher ist unsere Nord-Süd-Position, weil wir nun wissen, auf welchem Breitengrad die Flotte liegt, nachdem sich der Nebel gelichtet hat. Aber der Längengrad fehlt uns, Himmelherrgottsakrament! Wir wissen nicht, ob Feuerland vor oder hinter uns liegt! Davon hängt es aber ab, wann wir nach Norden steuern können, um bewohntes Land, um diese verdammten Fernández-Inseln zu erreichen! Die Männer sterben mir wie die Fliegen! Allein heute Nacht waren es sieben und heute Morgen noch mal einer. Verflucht! Wir müssen nach Norden! Wir brauchen frisches Wasser und Nahrung! Nur, wann sollen wir neuen Kurs nehmen? Wann laufen wir dabei nicht mehr Gefahr, an der unwirtlichen Küste von Feuerland zu zerschellen? Oder sind wir längst an dieser kargen Steinwüste vorbei und könnten seit Tagen die paradiesischen Fernández-Inseln anlaufen, stattdessen aber fahren wir wie die Entdecker seelenruhig weiter nach Westen? Wenn weiterhin so viele Männer sterben, habe ich bald keine Besatzung mehr! Ein verlassenes Schiff! Leblos! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Was sagt mein Steuermann dazu? Rede!«
Geert Ole besann sich und beugte sich in gebührlichem Abstand vom Kapitän über die Karte. Ein Gewirr von kantigen Linien, als hätte ein Kind die Feder geführt. Doch als Seemann erkannte er darin die Handschrift Gottes, den mühseligen Kampf gegen Wind und Wellen. Das ewige Ringen mit einem Gegner, der zugleich Freund und Feind war.
»Ich weiß nicht.« Geert Ole räusperte sich. »Rasmus hält uns schon die gesamte Fahrt über zum Narren. Bis hin zum 23. Breitengrad begleitete uns der irr gewordene Passat … Aus allen Richtungen kam er, nur nicht aus Südost. Später die grobe See, dabei aber flauer Wind. Ich konnte das Schiff kaum steuern, musste es treiben lassen. Seit Kap Hoorn der nächste Sturm aus der anderen Richtung, die Kreuzsee hätte beinahe das Schiff verschlungen, und jetzt noch der Nebel …«
»Ich will eine Zahl hören«, fuhr ihm der Kapitän über den Mund, »kein Gejammer! Wie viele Seemeilen liegt Feuerland hinter uns?«
»Nun also … Wir sind etliche Tage in Richtung Westen gesegelt, aber wir mussten wegen des vorlichen Windes ständig kreuzen. Tatsächlich sind wir also nicht so weit gekommen, wie man es anhand der vielen Seemeilen vermuten würde.«
»Ich will eine Zahl!«, schrie Kapitän Werson. Er schlug mit der Faust auf den Tisch, sodass die Feder in seiner Hand mit einem widerlichen Knirschen zerbrach.
»Ja, also dann … alsdann würde ich sagen …« Der lauernde Blick des Kapitäns lastete auf ihm. »300 Seemeilen westlich von Kap Hoorn!«, stieß er hervor.
»300 Meilen? Schwachsinn, völliger Schwachsinn! Wir sind mit dem Besteck zurück! Das Schiff ist viel weiter gelaufen. Ich sage, wir befinden uns 400 Seemeilen westlich von Kap Hoorn!«
»Aber der starke Wind … die Strömung …«
Kapitän Werson brachte ihn mit hochgezogener Augenbraue zum Schweigen. »Habe ich gerade ein Aber von meinem Steuermann vernommen?« Der Alte erhob sich. »Am Fockmast ist noch ein hübsches Plätzchen frei. Die Vögel freuen sich immer über gut abgehangenes Fleisch. Habe ich mich verhört, oder wollte mein Steuermann tatsächlich seinem Kapitän widersprechen?«
Geert Ole zögerte. Seine Eingeweide verkrampften sich, wie immer, wenn er etwas gegen seine Überzeugung tat. Aber wusste er es denn wirklich besser? So sicher, dass er sich mit dem Kapitän anlegen wollte? Er atmete langsam aus und hoffte inständig, dass der Kapitän mit seiner Schätzung recht behalten würde. »Nein, ich habe nichts gesagt.«
»Sehr schön.« Mit einem Lächeln schritt der Alte an ihm vorbei und riss die Kajütentür auf. Er trat halb hinaus und schrie: »Überall! Der Steuermann sagt und ich befehle: nördlicher Kurs bis zum 35. Breitengrad!«
Der Steuermann sagt … Geschockt von der Hinterhältigkeit des Kapitäns verließ Geert Ole die Kajüte, wo er auf seinen wartenden Sohn traf. Erst nach einigen Schritten fand Geert Ole seine Sprache wieder.
»400 Seemeilen. Bist du auch der Meinung des Kapitäns, Geertjan?«
»Nein, meiner Einschätzung nach war das ein Kombüsenbesteck, was der Alte gemacht hat.«
»Aber wenn meine Vermutung stimmt, zerschellt unsere Flotte bei Kurs Nord noch heute Nacht an den Klippen von Feuerland! Das muss dir doch klar sein! Ich hätte dem Kapitän widersprechen müssen!«, sagte Geert Ole entmutigt.
»Nein. Es war gut so, weil auch du nicht recht hattest. Meines Erachtens haben wir uns höchstens 250 Meilen in westliche Richtung bewegt, auch wenn das in Anbetracht der vergangenen Tage viel zu wenig erscheint. Ich weiß nicht sicher, ob ich mich auf meine astronomischen Berechnungen verlassen kann, aber ich weiß, dass ich Sie nicht am Fockmast hängen sehen will. Wenn meine Vermutung stimmt, werden wir bis heute Nachmittag Feuerland sichten. Sollte dem nicht so sein, dann können Sie sich immer noch überlegen, ob Sie den Kapitän von Ihren Berechnungen überzeugen wollen. 400 Seemeilen halte ich jedenfalls für vollkommen abwegig.«
»Land in Sicht! Land in Sicht!« Der Aufschrei ertönte ebenso plötzlich vom Ausguck herunter, wie das Kap Noir vor ihnen aufgetaucht war.
»Überall!«, brüllte der Zweite Steuermann geistesgegenwärtig. »Bereit zum Wenden!«
Jeder, der noch konnte, packte mit an. Das Manöver gelang. Als die Flotte wieder Südwesten anliegen hatte, kehrte Ruhe ein. Eine Ruhe der Verzweiflung.
Der Kapitän trat aus seiner Kajüte. Bleich wie eine Wasserleiche und nicht mehr in der Lage, zu fluchen oder zu schreien. Kap Noir. Wie konnte das sein? Waren sie all die Tage rückwärtsgefahren?
Geertjan sprach flüsternd aus, was alle anderen dachten: »Damit rückt das rettende Land in noch weitere Ferne, als wir angenommen haben. Es bedeutet ein paar endlose Tage mehr auf dieser vermaledeiten See. Der Kapitän hat sich um mehr als 200 Seemeilen verschätzt.«
Geert Ole gab seinem Sohn keine Antwort. Er versank in Gedanken, bis kurz darauf die Fressglocke geläutet wurde. »Wo du gerade vom Kombüsenbesteck gesprochen hast …«, meinte er und verzog die Mundwinkel. »Mir ist zwar überhaupt nicht nach Essen zumute, aber unsere Backschaft stürmt schon los. Es gibt nicht mehr viel, und von dem wenigen müssen wir überleben. Lass uns nachsehen, ob sie etwas übrig gelassen haben.«
Geert Ole betrat mit seinem Sohn die Messe, wo der Rest der ranghöheren Mannschaft bereits an den Tischen saß. Geertjan durfte mit ihm zusammen essen, ein Privileg, das ihm der Kapitän auf seine Bitte hin in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste als Erster Steuermann zugestanden hatte. Ihre beiden Teller waren noch unberührt, ebenso natürlich das Gedeck für den Klabautermann. Der Schiffskobold leistete ihnen wie immer unsichtbare Gesellschaft und erhielt etwas von den Speisen, damit ihnen das Glück auf der Fahrt hold blieb. Doch selbst die Beschwörung dieses guten Geistes half diesmal nichts, irgendetwas schien ihn erzürnt zu haben. So sehr, dass neben dem Trinkwasser bald auch alle Nahrungsmittel vergammelt waren.
Geert Ole setzte sich mit seinem Sohn an den Tisch, griff nach dem Löffel und hielt unvermittelt inne. Es gab eine zähe Masse aus grauen Bohnen, dazu gesalzenes Fleisch. Am Tellerrand lehnte ein grobes Stück Zwieback. Auf dieser Reise nützte auch der Rangunterschied zu den einfachen Matrosen nichts mehr. Mit dem Löffel in der Hand starrte Geert Ole auf den Teller, mit der anderen nahm er den Zwieback und klopfte ihn gewohnheitsmäßig auf die Tischplatte. Kleine Käfer und verschiedenes Getier fielen prompt heraus und flohen aufgeschreckt auf der Suche nach einem Versteck über das Holz.
»Sie sehen sehr müde aus, Vater. Versuchen Sie, später wenigstens ein bisschen zu schlafen.«
Geert Ole schaute zu seinem Sohn hinüber, der mit angewiderter Miene auf dem Bohnenbrei herumkaute. Er sah sich selbst dort sitzen. Die Ähnlichkeit war verblüffend, auch wenn zwanzig Jahre sie trennten. Nicht nur die schmalen, grünblauen Augen, die auch der sechsjährige Ruben geerbt hatte, auch der schlanke Körperbau, das markante Gesicht und die tiefen Grübchen in den Wangen waren gleich, nur mit dem Unterschied, dass die Haut des Sohnes noch nicht von Falten durchzogen und von Sonne und Meerwasser gegerbt war. So gern er seinen Sohn bei sich hatte, er hoffte, dass Geertjan im nächsten Jahr wieder genügend Aufträge bekäme, um als Uhrmacher sein Geld verdienen zu können. Nie hatte er gewollt, dass einer seiner Söhne eines Tages ebenfalls zur See fahren müsste, ein Beruf, bei dem man tagtäglich sein Leben riskierte.
»Es geht schon. Danke, mein Junge. Ich fühle mich nur etwas schwach auf den Beinen, und eigentlich habe ich überhaupt keinen Hunger. Aber sonst geht es mir gut.« Er biss in den Zwieback, um seine letzten Worte zu unterstreichen. Das Kauen schmerzte, als wäre sein Kiefer wund. Er ignorierte es und aß weiter, bis er Blut schmeckte.
Die gleißende Himmelsuhr erhob sich über dem glitzernden Wasser der Elbe, breitete ihre wärmenden Strahlen über den Dächern Hamburgs aus und vertrieb die nachtschwarzen Schatten aus den Gassen. Merit blinzelte in das helle Licht, das ihr durch das schmale Fenster ins Gesicht fiel. Mit einem Gähnen befreite sie sich aus der zerwühlten Bettdecke. Auch in dieser unruhigen Nacht hatte sie von Geertjans Heimkehr geträumt. Sie vermisste ihren Ehemann mit jeder Faser ihres Körpers.
Eine gebrochene männliche Stimme drang aus dem oberen Stockwerk zu ihr ins Zimmer, betont durch ein Klopfen gegen das Dielenholz.
»Wo bleibst du denn? Es wird höchste Zeit!«
Merit setzte sich kerzengerade auf. Ihr Vater hatte gerufen, und sie wusste nicht, in welchem Zustand sie ihn diesmal vorfinden würde. Begleitet von einem leichten Schwindelgefühl registrierte sie das leere Kinderbett an der gegenüberliegenden Wand. Offenbar war Ruben bereits aufgestanden und frönte der Abenteuerlust eines Sechsjährigen.
Nach einer kurzen Morgentoilette stieg sie die Treppen zur Dachkammer hinauf. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, predigte sie sich selbst, während sie sich zu jedem Schritt zwingen musste. Aber ihr Pflichtgefühl trieb sie voran.
Merit atmete tief durch, während sie die Türklinke hinunterdrückte und das Zimmer betrat, das in Größe und Deckenhöhe einer kleinen Höhle glich. Helle Kerzenlichtschatten tanzten an den dunklen Wänden. Nur wenige Lichtstrahlen zwängten sich von draußen zu der Fensterluke herein, sie krochen über den sandbestreuten Boden, erreichten aber nicht das Bett an der Wand gegenüber.
Dort saß ihr Vater Abel, mit einer Hand an das hölzerne Bettgestell gefesselt. Die Leine mit dem Seemannsknoten erlaubte ihm eine gewisse Bewegungsfreiheit, reichte aber nicht bis zur Tür. Äußerlich war ihr Vater ein Mensch ohne besondere Merkmale. Es gab nichts, woran sich das Auge festhalten konnte. Seine runde Gesichtsform, die konturlosen Züge um Mund und Nase blieben niemandem in Erinnerung. Einzig die Stelle, wo seine Schädeldecke leicht deformiert war und keine blonden Haare mehr wuchsen, hätte jemandem auffallen können – wenn er nicht in seinem Zimmer eingesperrt wäre.
Er lächelte ihr entgegen und hieß sie mit einem Kopfnicken willkommen, wie er es bei jedem Menschen tat.
»Sie haben mich gerufen, Vater?«, fragte sie.
»Ich?« Er schüttelte verwundert den Kopf. »Nein. Ich habe niemanden gerufen. Wer sind Sie überhaupt?«
Ein Stich fuhr ihr in die Brust. Sie versuchte ebenfalls zu lächeln und trat näher.
Ein Zeichen des Erkennens spiegelte sich in seinen Knopfaugen. »Ach, du bist es, mein herzensgutes Eheweib! Du hast auf den ersten Blick so anders ausgesehen.«
»Ich bin nicht Ihre Frau. Ich bin Merit, Ihre Tochter.« Sie sagte es leise, aber mit eindringlicher Stimme.
»Tochter?« Er stutzte. Nach kurzer Überlegung brach er in schallendes Gelächter aus. »Das ist gut! Jetzt hast du mich aber ordentlich aufs Glatteis geführt! Noch eine Tochter! Mein Weib ist heute mal wieder zu Scherzen aufgelegt, das gefällt mir! Du wünschst dir nach unserem Mathis und unserer Tochter Barbara wohl noch eine Tochter.« Ein spitzbübisches Lächeln schlich sich in seine Mundwinkel.
Merit spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Sie wandte sich von ihm ab und trat an das Lukenfenster, unter dem ein kleiner Tisch stand. Darauf lagen etliche Ausgaben des Hamburgischen Correspondenten. Über den Zeitungsstapeln und auf dem Boden verteilte sich handbeschriebenes Papier, als sei ein Sturm durch das Zimmer gefegt. Es war die Lieblingsbeschäftigung des Vaters geworden, die Zeitung Wort für Wort abzuschreiben. Nichts und niemand durften ihn bei dieser Tätigkeit stören, mit der er versuchte, sich die Welt zu erklären. Meist kam er über die Titelseite nicht hinaus.
Ihr Vater hatte seinen Ankerplatz im Meer der Zeit verloren. Nachdem er vor vier Jahren bei Ausbesserungsarbeiten am Dach seines Hauses von der Leiter gefallen und am Kopf verletzt worden war, lebte er bei ihnen. Oder besser gesagt: Seit seinem Erwachen lebte er in einer Welt ohne Vergangenheit und Zukunft. In seinem Gedächtnis gab es kein Gestern und kein Morgen, nicht einmal mehr ein Heute, nur noch den Augenblick. Sein Gedächtnis glich einem Buch, aus dem man bis auf die Anfangskapitel alle Seiten herausgerissen hatte. Nur das, was er in jungen Jahren gelernt und erlebt hatte, war noch fest in seinem Gedächtnis verankert. Allerdings kam kein neuer Text hinzu. Die Inhaltsangabe seines derzeitigen Lebens las er alle paar Minuten aufs Neue, keiner der Protagonisten wurde ihm je vertraut. Die meiste Zeit vegetierte er mit einem Seil angebunden im Bett dahin.
Merit räumte die sauber beschriebenen Blätter von der Sitzfläche des Stuhls zurück auf den Tisch, ehe sie sich niederließ. »Haben Sie wieder geschrieben?«, versuchte sie ein Gespräch zu beginnen.
»Ich? Nein. Wie kommst du darauf?«
Sie mühte sich um Fassung. »Die Schreibfeder und das offene Tintenfass befinden sich auf Ihrem Tisch.«
»Das sehe ich. Aber ich habe nichts geschrieben.«
Sie hielt ihm eine der Seiten entgegen. Ihre Finger krallten sich an dem Papier fest. »Aber das ist Ihre Handschrift!«
Ihr Vater schien für einen Moment irritiert. »Du hast recht. Das muss ich wohl früher einmal geschrieben haben.«
»Das Blatt trägt das gestrige Datum, von der Zeitung abgeschrieben.«
»Zeig her!« Er überprüfte ihre Aussage und lachte. »Da habe ich mich verschrieben. Das muss 1727 heißen, nicht 1757. Aber warum liegen diese Blätter hier herum?«
»Weil Sie diese erst vorhin beschrieben haben! Sie können sich nur nicht mehr daran erinnern.«
»Mit meinem Gedächtnis ist alles in Ordnung. Ich repariere Uhren. Wahrscheinlich sind das meine alten Aufzeichnungen und Skizzen.« Er hielt inne. »Du glaubst mir nicht. Ich sehe an deinem Blick, dass du zweifelst. Warum bist du überhaupt hier? Ich möchte jetzt ungestört zu Abend essen und mich dann zur Ruhe begeben.« Er zupfte an seinem Schlafgewand, als läge darin die Bestätigung seiner Worte.
»Es ist nicht an der Zeit, ins Bett zu gehen.«
»Nicht?« Er runzelte die Stirn und warf einen prüfenden Blick auf die Wanduhr neben dem Schreibtisch. »Neun Uhr. Aber tatsächlich, draußen scheint es noch recht hell zu sein.«
»Wir haben es früh am Morgen.« Ihre Stimme zitterte. Sie mühte sich um Sachlichkeit. »Sie haben mich wahrscheinlich gerufen, damit ich Ihnen beim Ankleiden helfe.« Sie deutete auf die Truhe gegenüber dem Bett, wo auch ein kostbarer, aber verhüllter Spiegel hing.
»Das kann ich selbst. Ich bin noch jung und gesund. Ich bin kein alter Mann!«
»Ach nein?« Das Gespräch kostete sie mittlerweile sichtliche Mühe. »Wann sind Sie geboren?«
»Du kannst vielleicht Fragen stellen! Hast du das vergessen? Oder willst du mich auf die Probe stellen? Mit meinem Gedächtnis ist alles in Ordnung. Ich bin am 7.4.1697 geboren.«
»Demnach sind Sie sechzig Jahre alt?«
»Sechzig? Ich bitte dich! Dein Humor ist schon etwas seltsam. Ich bin dreißig Jahre alt.«
»Ach ja?« Sie erhob sich mit einem Ruck und trat vor den verhüllten Spiegel. »Sieht so ein dreißigjähriger Vater aus, an der Seite seiner genauso alten Tochter? Merkwürdig, oder?«, herrschte sie ihn an und riss das Tuch herunter.
Sein Gesichtsausdruck machte ihr ihren Fehler schmerzhaft bewusst. »Verzeihung«, flüsterte sie, während ihr Vater von Panik erfüllt sein Spiegelbild betrachtete.
»Bin ich das?« Er fasste sich ins Gesicht. »Was ist mit mir passiert? Warum sehe ich so aus? Was geschieht mit mir?«
Merit wollte ihren Vater trösten, ihn beruhigen. Doch die eigene Angst durchzuckte ihren Körper. Sie war nicht mehr Herrin der Lage. Das Spiegelbild zeigte eine hochgewachsene, angespannte Gestalt in einem dunkelroten Kleid. Ihr Gesicht, von rotblonden, hochgesteckten Locken umrahmt, war schreckensbleich, die mandelförmigen blauen Augen blickten angsterfüllt. Sie warf das Tuch wieder über die Glasfläche, murmelte noch einmal eine Entschuldigung und floh aus dem Raum.
Dann rannte sie die Treppe hinunter bis in die Küche, wo sie keuchend innehielt. Vom ersten Tag an vor vier Jahren hatte sie seine Pflege übernommen. Im Spinnhaus wäre er in einem Käfig gelandet, man hätte ihn mehrmals täglich mit eiskaltem Wasser übergossen und ihm wie einem tollwütigen Tier harte Brotkanten durch den Schlitz zugeworfen. Liebe, Dankbarkeit, aber auch ihr Pflichtbewusstsein hatten sie zu der Entscheidung geführt, ihn zu Hause zu versorgen. Damit stieß sie allerdings an den Rand ihrer Kräfte, weshalb sie Pauline zunehmend um Hilfe ersuchen musste.
Als sie die Schwiegermutter nirgendwo im Haus fand, zog sie sich in die verlassene Uhrenwerkstatt zurück. Sie hockte sich auf den Schemel, stützte den Kopf in die Hände, starrte auf den Fußboden und schämte sich für die Tränen, die ihr über die Wangen liefen. Warum besaß sie nicht mehr Stärke? Ihr Vater war jetzt das Kind, das man trösten und beschützen musste. Warum konnte sie sich nicht damit abfinden? Er würde nie wieder gesund werden, nie wieder so sein wie früher.
Die nächsten Stunden verbrachte sie damit, die Uhrenwerkstatt zu putzen und den Boden zu säubern, in der Hoffnung, durch die Arbeit Ablenkung zu finden. Der eng bemessene Raum besaß an einer Seite zwei große Fenster, von denen sie mit Hingabe die Spinnweben entfernte und dem Dreck mit Wasser zu Leibe rückte. Sie war lange damit beschäftigt, die an den Wänden aufgehängten Werkzeuge vom Staub zu befreien, und achtete peinlich genau darauf, die kleinen Sägen, Zirkel, Zangen und Feilen der Größe nach wieder an die Befestigung zu klemmen.
Beim Umhergehen in der Werkstatt befiel sie wieder die Sehnsucht nach ihrem Mann. Bald war es Mittag, der Zeitpunkt, an dem Geertjan vom anderen Ende der Welt an sie denken würde. Sie liebte diesen Moment, der ihr Kraft für den restlichen Tag gab.
Als Matrose verdiente Geertjan gutes Geld, und dazu gehörte eben, dass er lange Zeit nicht bei seiner Familie sein konnte. Sie hatte gewusst, worauf sie sich einließ, aber sie hatte nicht geahnt, wie schwer es sein würde, ein Kind ohne Vater großziehen zu müssen. Aber sie gab ihr Bestes, und Geertjan würde stolz auf sie sein können, wenn er erst wieder bei ihnen war.
Manulf hatte es im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Geertjan vorgezogen, in seinem warmen Nest auf bessere Tage zu warten. Wie ein Vogel, der mit geöffnetem Schnabel die nächste Fütterung herbeisehnt. Er wohnte in der Nähe des Nikolaifleets und ließ sich kaum mehr im Haus der Paulsens blicken – und in der Werkstatt schon gar nicht.
Seit die Gerüchte um den Tod von Manulfs Frau kursierten, schien es in Hamburg keine reparaturbedürftigen Uhren mehr zu geben. Da die Leute diesen Zeitmessern ohnehin skeptisch gegenüberstanden und die Aufträge aus den Adelshäusern dünn gesät waren, konnten die Zwillingsbrüder kaum mehr etwas mit der gemeinsamen Uhrenwerkstatt verdienen. Nachdem sie den Männern nicht mehr zur Hand gehen konnte, hatte Merit sich Arbeit in der Zuckersiederei gesucht. Doch als das Geld noch knapper wurde, hatte sich ihr geliebter Mann Geertjan im letzten Jahr notgedrungen entschlossen, seinem Vater aufs Schiff zu folgen.
Behutsam wischte sie die beiden Werktische, die sich vor einem der Fenster gegenüberstanden, und stellte die kniehohen Schemel an ihren vorgesehenen Platz zurück. Wie oft hatte sie hier gesessen und gearbeitet, wenn einer der Brüder bei einem Kunden war, der sich gerne stundenlang in seinem Stadtpalais beraten ließ, welche Uhr denn nun am besten zu den Tapeten und Möbeln auf den Kaminsims passe. Und während jener Zeit, als Geertjan wegen einer langwierigen Sehnenentzündung im rechten Arm nicht arbeiten konnte, hatte sie über mehrere Monate hinweg den Kleinuhrenbau übernommen.
Wehmütige Erinnerungen überkamen sie. Sie beendete ihre Putzarbeit und überwand sich dazu, an diesem Vormittag ein zweites Mal zu ihrem Vater zu gehen, um ihr Verhalten von vorhin zu entschuldigen. Während sie die Treppen hinaufstieg, malte sie sich die schlimmsten Szenen aus.
Er empfing sie jedoch mit einem freundlichen Lächeln und nickte ihr zu. »Guten Abend. Schön, dass ich mal wieder Besuch bekomme. Hier ist es ruhig wie im Beichtstuhl. Niemand schaut vorbei. Mein Name ist Abel Klaasen. Wie ist Ihr werter Name?«
Mit zugeschnürter Kehle beantwortete sie ihm mehrmals diese Frage, während sie ihren Vater wusch, ihm seine altmodische Kleidung anzog, ihm zu trinken und zu essen gab und das Zimmer aufräumte. Dabei achtete sie auch hier peinlich genau darauf, die Ordnung in der Kleidertruhe beizubehalten und in ihrem eigenen Interesse niemals zu tief zu graben, weil sich zuunterst das Lieblingskleid und das Kopfkissen ihrer seligen Mutter als Andenken befanden und sie nicht daran rühren wollte.
Durch ihr Tun hielt ihr Vater sie zunächst für eine Dienstmagd, dann für seine Tochter Barbara, später für seine Frau – aber niemals erkannte er seine Tochter Merit in ihr.
Während sie den Vater wieder ans Bett band, ging die Tür auf, und Ruben schaute herein.
»Ich bin gleich bei dir, mein Junge!«, rief sie ihm über die Schulter zu. »Geh wieder in deine Kammer.« Sie wollte ihrem kleinen Sohn den Anblick des Großvaters ersparen, der ihr selbst so sehr in der Seele schmerzte. Ein harmloser Mensch, gefangen gehalten wie eine gefährliche Bestie. Wie musste das auf ein Kind wirken?
»Da ist ja mein Junge!« Abel stand auf, um auf Ruben zuzugehen, wurde aber von dem Seil an seiner Hand auf halbem Weg ruckartig gestoppt.
»Ich bin nicht dein Junge, Opapa. Ich bin ein kleiner Bär, und Mutter und Vater sind meine Hüter«, erklärte Ruben mit kindlichem Eifer und zeigte dabei keine Spur von Angst oder Ungeduld. Stets glaubte Abel seinen kleinen Sohn Mathis vor sich zu haben, obwohl Merit ihren Bruder als jungen Erwachsenen ebenso wie die Mutter durch ein heimtückisches Fieber verloren hatte. Aber auch daran konnte sich der Vater natürlich nicht mehr erinnern.
Ruben hielt ihr die Taschenuhr entgegen. »Muma, du musst auf die Uhr schauen, wann es zwölf ist, damit wir rechtzeitig an Vater denken!«, verlangte er eindringlich.
»Keine Sorge, es ist noch nicht so spät. Ich bin gleich bei dir. Warte noch einen Moment.«
Ruben bewegte sich nicht aus dem Zimmer. »Ist in der Taschenuhr wirklich die Zeit gefangen?«, fragte er stattdessen.
»Ja«, sagte sie knapp. Sie befand sich jetzt nicht in redseliger Stimmung.
»Ist die Zeit denn so klein, dass sie da hineinpasst?«, insistierte er.
Merit kannte ihren Jungen. Er würde nicht eher Ruhe geben, bis er eine Antwort erhalten und für seine Begriffe alles verstanden hatte. Sie seufzte. »Du darfst dir die Zeit nicht als Lebewesen vorstellen. Man kann sie nicht sehen.«
»Warum? Ist sie tot? Oder lebt sie weit weg?«
»Nein, so meine ich das nicht.«
»Wie dann? Was ist die Zeit?«
Was ist die Zeit? Er hatte mit der Leichtigkeit eines Kindes gefragt, das eine einfache Erklärung für den Lauf der Welt erwartete. Ruben verlangte eine schlichte Antwort von seiner Mutter, die in seinen Augen alles Wissen in sich vereinte. In seiner behüteten Welt hatte er noch nicht erfahren, dass auch Erwachsene vor dem einen oder anderen Rätsel standen und im Leben manchmal nicht weiterwussten.
»Komm her, mein Junge«, mischte sich Abel ein. »Setz dich mal zu mir, dann erkläre ich dir, wie die Zeit in die Uhr hineinkommt.«
Ruben ging freudestrahlend auf seinen Großvater zu und kletterte ihm auf den Schoß. Abel umarmte ihn, und Ruben lehnte sich gegen den schützenden Oberkörper seines Großvaters. Beide schauten sie auf die Taschenuhr, als gäbe es nichts anderes mehr auf der Welt.
»Stell dir einen kleinen Jungen vor, der wie ein König in dem Uhrwerk im Kreis schreitet. Hörst du es? Ticktack, ticktack. Ein Schritt nach dem anderen. Aber warum läuft die Uhr? In einer Standuhr sind es die Gewichte, die an Ketten angehängt nach unten wandern und die Uhr in Gang halten. In diesem kleinen Gehäuse gibt es dafür eine metallische Feder, die man durch das Aufziehen spannt. So wie du deine Muskeln anspannst, bevor du losrennst. Damit dir dabei nichts passiert, muss man dich an die Hand nehmen. Dasselbe macht die Spindelhemmung, denn die Feder darf nicht alle Energie beim Startschuss verlieren, sonst würden die Zeiger im Kreis über das Zifferblatt sausen, und danach stünde die Uhr wieder still.«
Abel sprach so schnell wie schon lange nicht mehr, als könne er den Anschluss an das letzte Wort verpassen. Merit hörte ihrem Vater ebenso gespannt zu wie Ruben – weniger wegen der Uhrendetails, vielmehr wegen seiner verblüffenden Fähigkeit, in der Vergangenheit erlernte Dinge wiederzugeben, als hätte sein Gedächtnis nie einen Schaden erlitten. Sie liebte diese Erzählungen, weil sie in solchen Momenten wieder ihren Vater vor sich sah und nicht nur ein menschliches Wrack.
»Hörst du das Ticken?«, fragte Abel und hielt Ruben die Uhr ans Ohr. »Es teilt die Zeit in Abschnitte ein, wie das Pendel einer Standuhr. In diese kleine Uhr passt natürlich kein Pendel, aber eine Unruh mit ihrer Spirale. Das ist eine aufgerollte Metallfeder aus dünnem Draht, die an der Unruhachse befestigt ist. Dieser kleine Ring schwingt, von der Feder angetrieben, hin und her.«
Ruben zog seine Stirn in krause Falten und wandte den Blick nicht von dem Gehäuse. »Wie meinst du das?«
»Ganz einfach«, mischte sich Merit ein. »Denk mal an deinen kleinen Eimer, mit dem du uns beim Wasserholen hilfst. Warum schimpfe ich da oftmals mit dir?«
»Weil ich beim Gehen den Henkel in der Hand hin- und herdrehe, immer schneller, bis das Wasser überschwappt!«
»Und nun stell dir den Eimer als Ring vor, und dein Arm ist die Feder, der die Unruh antreibt. Der Unruhreif bewegt sich in eine Richtung, bis die Feder aufgerollt ist und unter Spannung steht. Dann wird die Bewegung des Rings gebremst, angehalten, und während sich die Feder entrollt, dreht sich der Ring in die Gegenrichtung. Allerdings geht das nicht ewig so weiter.«
»Warum?«, fragte Ruben ungeduldig.
»Weil eine Unruh wie ein Pendel arbeitet. Du kannst auch nur schaukeln, solange der Schwung reicht. Irgendwann muss dich wieder jemand anschubsen. In einem Uhrwerk macht das die Hemmung.«
»Das soll mir Opapa erklären!«, sagte Ruben, und zur Bekräftigung klopfte er seinem Großvater mit dem Zeigefinger auf die eingefallene Brust.
»Was soll ich erklären?«
Merit verfluchte sich dafür, ihren Vater unterbrochen zu haben. »Sie wollten Ruben sagen, wie eine Hemmung arbeitet.«
»Ruben? Wer ist Ruben?« Er schaute sich suchend um.
»Ich bin Ruben! Ich bin es! Der kleine Bär!«
Abel lachte. »Mein kleiner Mathis wird eines Tages noch ein großer Geschichtenerzähler werden! Die Fantasie hat er von dir, mein liebes Weib. Von mir kann er das nicht haben. Für mich besteht die Welt seit jeher nur aus wahrhaftigen Tatsachen.«
Sie schluckte. »Gewiss.«
»Du schaust mich so merkwürdig an. Stimmt etwas nicht?«
»Nein, nein, keine Sorge. Es ist alles in Ordnung.« Die Worte hinterließen ein schmerzhaftes Brennen in ihrer Kehle.
Ruben zupfte am Rüschenkragen des Großvaters. »Sag mir jetzt, was eine Hemmung ist!«
»Ach, das trifft sich ja gut, dass ich diesen kleinen Zeitmesser gerade in der Hand halte. Diese Hemmung besteht aus einem kleinen Metallteil, das einer Spindel ähnlich sieht, und einem Rädchen, das mit seinen Zacken an eine Krone erinnert. Die Hemmung sorgt dafür, dass das Räderwerk abwechselnd angehalten und freigegeben wird, und gleichzeitig gibt sie der Unruh den notwendigen Antrieb, damit die Uhr gleichmäßig läuft. Die Spindel hakt sich mit ihren beiden kleinen Beinen abwechselnd in das Hemmungsrad ein. Diese Schritte kann man als Ticken sehr gut hören. Es ist also die Hemmung, die das bekannte Geräusch einer Uhr verursacht und in der Folge die Bewegung des Räderwerks beherrscht.«
Ruben staunte. »Und deshalb drehen sich die Zeiger?«, fragte er folgerichtig.
»Ja. Es gibt ein kleines Rad, das sich einmal in der Stunde dreht, das trägt den Minutenzeiger. Das größere benötigt für eine Umdrehung zwölf Stunden, das zeigt …«
»Und wie spät ist es jetzt?«, fiel Ruben ihm ins Wort.
Merit hob ihren Jungen vom Schoß seines Großvaters. »Höchste Zeit fürs Mittagsmahl.«
»Ich habe aber keinen Hunger!«, protestierte er.
»Ruben … du hast gehört, was ich gesagt habe. Es gibt jetzt Essen. Wir gehen nachher wieder zu Großvater.«
Er wehrte ihre Hand ab. »Ich will jetzt aber viel lieber bei Großvater bleiben.«
Merit mühte sich um Konsequenz, während ihre innere Verzweiflung wuchs, weil sie spürte, auf welches Spiel diese Situation hinauslaufen würde. Aber für derartige Machtkämpfe hatte sie bald keine Kraft mehr. Während sie noch nach den richtigen Worten suchte, breitete sich Bestürzung auf Rubens Gesichtszügen aus.
»Wenn es Essen gibt, dann ist jetzt schon zwölf Uhr vorbei! Muma! Wir haben vergessen, an Vater zu denken! Jetzt ist er uns böse, und deshalb kommt er bestimmt nie mehr wieder heim!«
»Ach Unsinn«, sagte sie beschwichtigend und nahm ihren Jungen in den Arm.
Zu spät, denn ihm liefen bereits die Tränen über die Wangen. Egal, mit welchen Worten sie versuchte, ihn zu trösten, er wies alles von sich und steigerte sich in Panik.
Bald wusste sie sich nicht mehr anders zu helfen, als das lauthals schreiende Kind aus dem Zimmer zu bringen. In der Küche traf sie auf die Schwiegermutter, die einen missbilligenden Blick auf die Szene warf.
Klein und stämmig, im aschgrauen Leinengewand, stand Pauline leicht vornübergebeugt wie ein verwitterter Grabstein vor ihr. Ihre trockene, aber nahezu faltenfreie Haut war von zahlreichen Altersflecken durchsetzt, dunkle Lebensnarben, die nach sechzig Jahren mühevollen Daseins an die Oberfläche drängten.
»Du bist spät dran. Eil dich, falls du noch rechtzeitig in der Zuckermanufaktur erscheinen willst. Es ist jetzt schon …« Beim Blick auf die Standuhr verstummte Pauline. Das Geschenk ihres zweiten Sohnes Geertjan, eine seiner glanzvollsten Arbeiten im letzten Jahr, war stehen geblieben. Pauline starrte das Uhrwerk an, als sei ihr der Leibhaftige erschienen. »Du weißt, was das heißt …«, flüsterte sie bedeutungsschwanger.
»Ja. Die Kette ist abgelaufen, und das Werk muss wieder aufgezogen werden. Das haben Pendeluhren so an sich«, sagte Merit und seufzte.
»Nein. Die beiden Gewichte hängen noch oben, das heißt, die Uhr ist einfach so stehen geblieben.« Pauline beugte sich in fluchtbereiter Haltung zu dem weinroten Holzgehäuse vor, um nach dem Pendel zu sehen. Ein Rostpendel, wie Geertjan erklärt hatte. Von einem einfachen Mann namens Harrison vor nicht allzu langer Zeit erfunden und deshalb genial, weil die längs angeordneten Stäbe aus verschiedenen Metallen die temperaturbedingten Längenausdehnungen ausgleichen konnten und somit, im Gegensatz zu üblichen Uhrenpendeln, für eine verblüffende Ganggenauigkeit sorgten. Doch das schmale, einem Gitterrost ähnlich sehende Pendel stand still.
Pauline wich zurück. »Siehst du? Das Leben ist aus der Uhr gewichen. Das bedeutet …« Ihre Stimme schwankte. »Es ist jemand aus unserer Familie verstorben.«
»Unsinn!« Merit lachte zornig auf. »Hör auf, uns alle mit deinem Aberglauben zu traktieren. Manulf soll die Uhr reparieren, dann läuft sie wieder. In letzter Zeit habe ich ihn nicht mehr in der Werkstatt gesehen, aber ich kann mich dunkel daran erinnern, dass er Uhrmacher von Profession ist, genau wie sein Zwillingsbruder. Genügend Zeit hat Manulf mit Sicherheit. Schließlich macht er seine Finger nur krumm, um in die Taschen anderer zu greifen. Darin hat er Übung: reichlich Geld unters Volk zu bringen, das er nicht verdient hat.«
»Wie sprichst du denn über meinen Sohn Manulf – über deinen Schwager?« Eine Zornesfalte bildete sich auf Paulines Stirn.
Merit gab vor, nicht weiter auf die Schwiegermutter zu achten, und schöpfte stattdessen von dem Sauerkrauteintopf in ihre Holzschüssel. Die Schwiegermutter ließ keinen Zweifel daran, welchen ihrer Söhne sie mehr liebte. Geertjan war der Zweitgeborene der Zwillingsbrüder, mit ihm hatte die Gebärende nicht gerechnet, er hatte ihre Schmerzen verlängert und ihr beinahe das Leben geraubt. Die zarten Triebe der Mutterliebe waren abgestorben wie die Frühlingsknospen durch einen unerwarteten Frost. Äußerlich glichen sich Geertjan und Manulf bis aufs Haar, nur der übergroße Hautlappen an Manulfs linker Hand, der sich zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger wie eine Schwimmhaut spannte, half einem Außenstehenden, die beiden bei näherem Hinsehen auseinanderzuhalten. Sogar ihre Stimmen waren fast gleich. Doch ihr Wesen unterschied sich wie Tag und Nacht. Wohl aus diesem Grund hatten ihre zwei Jahre ältere Schwester Barbara und sie sich in die beiden Brüder verliebt.
Barbara suchte das Geheimnisvolle, das Unstete, alles, was Abwechslung in ihrem eintönigen Leben versprach. Sicherheit war für sie gleichbedeutend mit einem Gefängnis. Merit empfand Manulfs Lebenswandel gegenüber nichts als Abscheu und brachte kein Verständnis für den Heiratswunsch ihrer Schwester auf. So war der Graben zwischen ihnen mit dem Auszug aus dem Elternhaus immer tiefer geworden. Jede ging ihrer Wege, weil keine die Welt der anderen verstand. Dennoch blieb die Geschwisterliebe wie eine Brücke zwischen ihnen bestehen, und wenn es darauf ankam, waren sie füreinander da. So wie an jenem Tag, als Barbara in den Wehen lag, einige Wochen nachdem Merit ihren Sonnenschein Ruben auf die Welt gebracht hatte. Das Schicksal stellte Barbara auf eine harte Probe, denn die Geburt verlief unerwartet schwer.
Merit war nicht von ihrer Seite gewichen und hatte der Gebärenden die Hand gehalten. Es waren dramatische Stunden, bis das Kind endlich in seinem Blut auf dem Laken lag und blau im Gesicht nach Luft rang. Als es die Hebamme zum Waschen in den Nebenraum trug, hatten sie den schmächtigen Jungen noch schreien gehört, doch Herz und Lungen waren zu schwach gewesen. Anstelle ihres Kindes hatte Barbara die leeren Hände der Hebamme zu Gesicht bekommen. Trotzdem hatte ihre Schwester nicht ihren Glauben verloren, und sie blieb eine weitgehend fröhliche und zuversichtliche Frau.
Manulf hingegen hatte sich seit jeher gegenüber anderen Menschen verschlossen und wurde endgültig zum Sonderling, seit seine Frau vor gut fünf Jahren unter mysteriösen Umständen ertrunken war. Ihn hatte man an jenem Morgen im Branntweinrausch am Nikolaifleet, unweit seines Hauses, aufgefunden. Man munkelte, er habe Barbara erschlagen. Doch die Leute redeten gern und viel. Beweise gab es keine. Merit jedenfalls vermisste ihre Schwester sehr, gerade jetzt in der Sorge um ihren Vater.
Pauline kam näher und blieb vor ihr stehen. Die Tischkante reichte der kleinen Frau bis an den Bauchnabel. Wortlos beäugte sie das Tun ihrer Schwiegertochter, unübersehbar und aufdringlich wie ein Pilz am Wegrand. Essbar oder giftig – das war die Frage, die Merit sich jeden Tag aufs Neue stellen musste.
Der Duft nach Wacholderbeeren und gerösteten Speckstückchen hingegen war verführerisch. Pauline konnte kochen, zwar stets einfache Gerichte, aber sehr gut in der Zubereitung. Im Laufe ihres Lebens hatte sie gelernt, aus fast nichts etwas zu zaubern. Das musste Merit neidlos anerkennen. Trotzdem verspürte sie heute keinen Hunger. Sie aß zwei Löffel und schob die Schüssel von sich.
Dies hatte einen tadelnden Blick der Schwiegermutter zur Folge. »Du bist nicht gerade ein Beispiel für Ruben, wenn du nie richtig isst.«
»Er wird schon kommen, wenn er Hunger hat. Wo ist mein Junge überhaupt hin? Eben war er doch noch hier. Hattest du ihm vor dem Essen noch eine Besorgung aufgetragen?«
»Ich? Wie käme ich dazu?«
Merit wurde unwohl. »Er wird sich doch nicht schon wieder davongestohlen haben?«
»Das darf ja wohl nicht wahr sein! Kannst du nicht besser auf dein Kind aufpassen?« Pauline baute sich vor ihr auf. »Aus Ruben wird eines Tages noch ein zwielichtiges Subjekt werden, ein verlotterter Gauner, einer vom fahrenden Volk, wenn du die Zügel weiter so schleifen lässt!«
»Er ist nicht dein Kind!«, gab Merit ruhig, aber bestimmt zurück, während sie gedanklich die Strichliste erweiterte, wie oft sie diesen Satz bereits zu ihrer Schwiegermutter gesagt hatte. Merit schaute sich um. Ihr Gefühl sagte ihr, dass Ruben noch in der Nähe war.
»Schade, dass Ruben nicht da ist«, sagte sie vernehmlich.
»Sodann müssen wir die Orangen alleine essen, die ich gestern für uns erstanden habe«, ergänzte Pauline.
Die Schwiegermutter ging zum Vorratsregal, um die Früchte zu holen, als Ruben ihr entgegensprang. Er hatte sich neben dem Herd zwischen den mit Holz gefüllten Körben versteckt gehabt. Seine hellblonden Haare waren zerzaust, seine Hände, die Nase und die Stirn mit Ruß befleckt. Rotz klebte ihm um die Nasenlöcher, und der unschuldige Blick aus seinen verweinten blauen Kinderaugen entlockte Merit ein Lächeln.
Sie nahm ihn in die Arme. »Da bist du ja, mein kleiner Bär! War es schön warm in deiner Höhle?«
Ruben nickte, seine Wangen glühten. »Ja, aber da gibt es keine Orangen. Muma, bekomme ich eine Orange von dir?« Er wischte sich mit dem Hemdsärmel über die Nase.
»Da musst du deine Großmutter fragen. Sie hat die guten Früchte gekauft.« An Pauline gerichtet fügte sie hinzu: »Musste das denn sein? Gleich so viele? Wir müssen sparen, sonst reicht uns das Geld nicht mehr lange. Dein Manulf verkauft oder repariert keine Uhren, und wir wissen nicht, wann Geertjan und Geert Ole zurückkehren.«
Pauline hatte die Heiratstradition in ihrer Uhrmacherfamilie unterbrochen und ihren Mann Geert Ole in der Hoffnung geheiratet, dass sie einst als wohlhabende Kapitänsfrau über den Jungfernstieg flanieren könnte. So weit war es nicht gekommen. Er hatte nie an oberster Stelle stehen wollen, stattdessen in der Position des Steuermanns seine Erfüllung gefunden, dafür kein eigenes Haus bauen können, und sie war als Pauline Paulsen zum Gespött jener Frauen geworden, die eine bessere Partie gemacht hatten. Zeit ihres Lebens wohnte die Familie zur Miete, das Geld reichte lediglich bis zur nächsten Heimkehr – und das Warten auf den neuen Lohn begann erneut.
Paulines Lippen verdünnten sich zu einem Strich, ehe sie sich zu einer Erwiderung entschied. »Du behauptest doch immer, dass die See unsere Ehemänner bald wieder in den Hafen spuckt. Außerdem schrieb der Hamburgische Correspondent in einer seiner letzten Ausgaben, dass diese edlen Früchte um diese Jahreszeit der Gesundheit förderlich seien, besonders Kinder sollen davon reichlich bekommen.« Pauline legte ihr die ungelesene Zeitung auf den Tisch. »Anstatt nächtelang in den Himmel zu starren, solltest du öfter mal dieses Blatt hier lesen …«
»Du kaufst den Correspondenten doch nur um des guten Eindrucks willen, möglichst bei einem Verkäufer an der Börse, wo dich viele Leute sehen. Das Geld ist wahrlich zum Fenster hinausgeworfen.«
»Wie du meinst.« Paulines Blick verriet, dass sie keinesfalls einer Meinung mit ihrer Schwiegertochter war. »Alsdann hältst du wohl auch die gelehrten Artikel für überflüssig. Es gibt allerlei Erquickliches über Kindererziehung und sittliches Familienleben darin zu lesen. Zum Beispiel, ob eine Dame, wenn sie verheiratet ist, mit guter Raison einige Briefe von vormaligen Freiern bei sich behalten und verwahren dürfe. Die Lektüre dieser moralischen Schriften könnte dir jedenfalls nicht schaden. Wenn es nach dir ginge, sollte ich wohl den aufrührerischen Reichs-Post-Reuter drüben im dänischen Altona kaufen. Aber dieses preußenfeindliche Querulantenblatt kommt mir nicht ins Haus!«
»Du sollst gar keine dieser sündhaft teuren Blätter mehr kaufen, solange wir nicht wissen, wovon wir nächsten Monat leben werden!«
»Muma, gibst du mir jetzt eine Orange?«