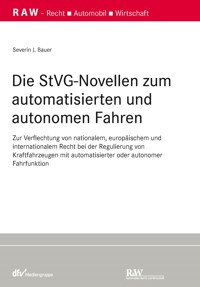
74,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fachmedien Recht und Wirtschaft
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: RAW Schriftenreihe Recht - Automobil - Wirtschaft
- Sprache: Deutsch
Für Hersteller und Mobilitätsanbieter ist neben der Genehmigung von Kraftfahrzeugen mit automatisierter bzw. autonomer Fahrfunktion vor allem deren rechtssicherer Betrieb von entscheidender Bedeutung. Vor diesem Hintergrund untersucht der Autor die StVG-Novellen zum automatisierten und autonomen Fahren und ordnet die Regelungssystematik in den rechtlichen Kontext auf europäischer sowie völkerrechtlicher Ebene ein. Ein Schwerpunkt wird zunächst auf die trennscharfe Bestimmung des Anwendungsbereichs des mit der jeweiligen StVG-Novelle implementierten Regelungsregimes gelegt. Hierfür zeichnet der Autor den Weg von technischen Klassifizierungen hin zu den gesetzlichen Definitionen nach und vervollständigt seine Erwägungen durch einen Rechtsvergleich mit dem US-amerikanischen Recht der Bundesstaaten Kalifornien, Arizona sowie Florida. Bei der Darstellung des national ausgestalteten Verhaltensrechts einerseits und des europäisch harmonisierten Typgenehmigungsrechts andererseits, wird die enge Verflechtung von nationalem, europäischem und internationalem Recht aufgezeigt. In einem nächsten Schritt identifiziert der Autor die mit der voranschreitenden Automatisierung einhergehende Verflechtung von Verhaltens- und Zulassungsrecht als besondere Herausforderung für die Regulierung von automatisierten Kraftfahrzeugen. Bei der Klärung von Lösungsoptionen für einen rechtssicheren Rechtsrahmen zieht der Autor auch Schlüsse für die Ausgestaltung von Normen auf nationaler Ebene der Mitgliedstaaten, um eine Rechtszersplitterung auf europäischer Ebene zu vermeiden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Die StVG-Novellen zum automatisierten und autonomen Fahren
Zur Verflechtung von nationalem, europäischem und internationalem Recht bei der Regulierung von Kraftfahrzeugen mit automatisierter oder autonomer Fahrfunktion
Timon Mertens
Fachmedien Recht und Wirtschaft | dfv Mediengruppe | Frankfurt am Main
Als Dissertation von dem Fachbereich Rechtswissenschaften
angenommen am:
26. Juni 2024
Berichterstatter:
Professor Dr. Dr. h.c. mult. Gilbert Gornig
Mitberichterstatter:
Professor Dr. Michael Kling
Tag der mündlichen Prüfung:
11. Juli 2024
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
ISBN 978–3–8005–1958–3
© 2025 Deutscher Fachverlag GmbH, Fachmedien Recht und Wirtschaft, Mainzer Landstr. 251, 60326 Frankfurt am Main, [email protected]
www.ruw.de
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Druck: Beltz Grafische Betriebe GmbH, 99947 Bad Langensalza
Die StVG-Novellen zum automatisierten und autonomen Fahren
Zur Verflechtung von nationalem, europäischem und internationalem Recht bei der Regulierung von Kraftfahrzeugen mit automatisierter oder autonomer Fahrfunktion
Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der juristischen Doktorwürde
dem
Fachbereich Rechtswissenschaften der Philipps-Universität zu Marburg
vorgelegt von
Severin Johannes Bauer
Rechtsanwalt aus Deggendorf
Marburg
2024
Druck von Deutscher Fachverlag GmbH in Frankfurt am Main
Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Oktober 2023 beim Fachbereich Rechtswissenschaften der Philipps-Universität Marburg eingereicht und berücksichtigt die zu diesem Zeitpunkt geltende Rechtslage.
Auch wenn neue Mobilitätskonzepte die Zukunft prägen werden, gehe ich fest davon aus, dass der Individualverkehr im eigenen Fahrzeug noch lange Zeit ein wesentlicher Bestandteil unseres Straßenverkehrs sein wird. Von meiner persönlichen Warte aus kann dies auf langen Fahrten oder im Berufsverkehr gerne mit der großartigen Option verbunden sein, vom eigenen Fahrzeug chauffiert zu werden. Ich würde mich aber auch freuen, weiterhin die Möglichkeit zu haben, das Steuer selbst in die Hand zu nehmen – sei es bei einem vollelektrischen Fahrzeug oder doch mit großem Hubraum und Kompressor- oder Turboaufladung. Kraftfahrzeuge und deren Technik sind meine Leidenschaft, so dass das Promotionsvorhaben zu rechtlichen Aspekten der voranschreitenden Fahrzeugautomatisierung nicht zuletzt aus persönlichen Gründen eine spannende Angelegenheit gewesen ist.
Besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang meinem Doktorvater Herrn Professor Dr. Dr. h.c. mult. Gilbert Gornig, der mich in jeder Phase des Promotionsvorhabens umfassend unterstützt und auf jedes Anliegen schnell reagiert hat. Es ist schön, einen so weit gereisten Menschen seinen Doktorvater nennen zu können. Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Professor Dr. Michael Kling für die schnelle und gewissenhafte Erstellung des Zweitgutachtens. Dank gilt zudem Herrn Professor Dr. Dr. h.c. dupl. Freund für die Leitung meiner Disputation als Vorsitzender der Prüfungskommission.
An dem Gelingen der Doktorarbeit haben viele wichtige Menschen aus meinem Leben mitgewirkt. Besonders herausheben und herzlich danken möchte ich meinem Vater, Harry Bauer, sowie Lisa, Nadja und Raphael für ihre fortwährende Unterstützung, die guten Worte, den interessanten Austausch und die damit verbundene viele Zeit, die sie mir auf dem Weg von der Annahme als Doktorand bis zur Disputation geschenkt haben. Ohne ihren jeweils ganz individuellen Beitrag wäre die Erstellung dieser Arbeit nicht möglich gewesen.
Ich denke, meine leider viel zu früh verstorbene Mutter, Ilse Bauer, hätte sich sehr mit mir über den erfolgreichen Abschluss der Doktorarbeit zu einem so aktuellen Thema gefreut. Ihr ist diese Arbeit gewidmet.
Frankfurt am Main, im Oktober 2024
Severin J. Bauer
Inhaltsübersicht
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Teil 1: Der technische Fortschritt als rechtliche Herausforderung
A. Recht im Kontext automatisierter und autonomer Kraftfahrzeuge
B. Technische Grundlagen automatisierter Fahrsysteme
C. Schlussfolgerung
Teil 2: Von der technischen Klassifizierung zur gesetzlichen Definition
A. Entwicklung in Deutschland
B. Rechtsvergleichende Betrachtung: Vereinigte Staaten von Amerika
C. Zusammenfassung
Teil 3: Zulässigkeit und Genehmigung als Kernpunkte der Regulierung
A. Nationales Verhaltensrecht im Kontext automatisierter und autonomer Fahrfunktionen
B. Zulassung und Genehmigung von Kraftfahrzeugen mit automatisierter oder autonomer Fahrfunktion
C. Ergebnis
Teil 4: Die Verflechtung von Verhaltens- und Zulassungsrecht als Herausforderung der Regulierung
A. Problemstellung
B. Lösung durch verhaltensrechtliche Anforderungen im Rahmen der technischen Vorschriften
C. Ergebnis
Teil 5: Zusammenführung der Ergebnisse
Literaturverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Inhaltsübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Teil 1: Der technische Fortschritt als rechtliche Herausforderung
A. Recht im Kontext automatisierter und autonomer Kraftfahrzeuge
I. Rechtlicher Rahmen
II. Die StVG-Novellen als Reaktion auf den technischen Fortschritt
III. Gegenstand und Gang der Untersuchung
B. Technische Grundlagen automatisierter Fahrsysteme
I. Sensorik
1. Umgebungswahrnehmung
a) Frontview-Kamera
b) Radar
c) Lidar
d) Ultraschall
2. Lokalisierung
a) Global Positioning System
b) Odometrie
c) Drehratensensor
3. Zusammenfassung
II. Datenzusammenführung
1. Sensordatenfusion
2. Vernetzung mit dem Backend
3. Zusammenfassung
III. Aktorik
IV. Human Machine Interface
1. Anforderungen bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion
2. Anforderungen bei Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion
3. Zusammenfassung
C. Schlussfolgerung
Teil 2: Von der technischen Klassifizierung zur gesetzlichen Definition
A. Entwicklung in Deutschland
I. Klassifizierung im nationalen Diskurs
1. Die Entwicklung einer Klassifizierung in Deutschland
a) Projektgruppe der Bundesanstalt für Straßenwesen
b) „Runder Tisch Automatisiertes Fahren“
c) Juristischer Diskurs und Veröffentlichungen von Interessenverbänden
2. Hauptkriterien zur Differenzierung der Automatisierungsstufen
a) Übernommene Fahraufgabe
b) Pflicht zur Überwachung
3. Angabe des Automatisierungsgrades
4. Erläuterung der Stufen auf Grundlage der BASt-Klassifikation
a) Stufe 0: Driver Only
b) Stufe 1: Assistiert
c) Stufe 2: Teilautomatisiert
d) Stufe 3: Hochautomatisiert
e) Stufe 4: Vollautomatisiert
f) Stufe 5: Autonom
5. Tabellarischer Überblick
6. Differenzierung zwischen den Begriffen „automatisiert“ und „autonom“
7. Zur Einordung von sogenannten „Assistenzsystemen“
a) Warnungen und Informationen
b) Regeleingriffe durch ABS, ESP und ASR
c) Notbremsassistent
8. Zusammenfassung
II. Gesetzliche Definition der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion
1. Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion
a) Fahrzeugsteuerung
b) Beachtung der Verkehrsvorschriften
c) Übersteuerbarkeit
d) Übergabesituation
e) Zuwiderlaufende Verwendung
f) Zusammenfassung
2. Bewertung vor dem Hintergrund der technischen Klassifizierung
a) Konzentration auf höhere Automatisierungsstufen
aa) Anwendungsbereich der Neuregelung
(1) Systeme bis Stufe 2 nicht erfasst
(2) Automatisierte Systeme der BASt-Stufen 3 und4
bb) Rechtsnormcharakter
b) Keine Differenzierung zwischen Hoch- und Vollautomatisierung
aa) Praxistauglichkeit der Definition
(1) Übernommene Fahraufgabe
(2) Pflicht zur Überwachung
bb) Trennung von Tatbestands- und Rechtsfolgenseite
3. Zwischenergebnis
III. Gesetzliche Definition der autonomen Fahrfunktion
1. Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen
a) Selbstständige Erfüllung der Fahraufgabe gemäß § 1d Abs. 1 Nr. 1 StVG
b) Technische Ausrüstung gemäß § 1e Abs. 2 StVG
aa) Selbstständige Fahrzeugführung
bb) Unfallvermeidung und Risikominimierung
cc) Kommunikation mit Technischer Aufsicht
2. Weitere Begriffsbestimmungen
a) Festgelegter Betriebsbereich
b) Technische Aufsicht
c) Risikominimaler Zustand
3. Einordnung der gesetzlichen Definition
B. Rechtsvergleichende Betrachtung: Vereinigte Staaten von Amerika
I. Klassifizierungen aus dem US-amerikanischen Raum
1. Klassifizierung der NHTSA
a) Einordnung der NHTSA
b) Erläuterung der einzelnen Stufen
aa) Level 0 – No-Automation
bb) Level 1 – Function-specific Automation
cc) Level 2 – Combined Function Automation
dd) Level 3 – Limited Self-Driving Automation
ee) Level 4 – Full Self-Driving Automation
c) Vergleich mit der deutschen Einteilung
2. Klassifizierung der SAE International
a) Einordnung der SAE International
b) SAE Standard J3016
aa) Level 0: No Driving Automation
bb) Level 1: Driver Assistance
cc) Level 2: Partial Driving Automation
dd) Level 3: Conditional Driving Automation
ee) Level 4: High Driving Automation
ff) Level 5: Full Automation
c) Vergleich mit der deutschen Einteilung
3. Entscheidung für den SAE Standard J3016
4. Zusammenfassung
II. Gesetzliche Definitionen
1. Bundesstaat Kalifornien
a) California Vehicle Code
aa) Definition
bb) Vergleich mit der deutschen Definition
(1) Adressierte Systeme
(2) Negative Abgrenzung
(3) Zweck der Regelung
(4) Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr
(a) Weitere Anforderungen außerhalb der Definition
(b) Trennung von Tatbestands- und Rechtsfolgenseite
cc) Zusammenfassung
b) California Code of Regulations
aa) Einordnung in den regulatorischen Kontext
bb) Definitionen
(1) Article 3.7 (Testing)
(2) Article 3.8 (Deployment)
cc) Vergleich mit der deutschen Definition
(1) Anwendungsbereich
(2) Adressierte Systeme
(3) Negative Abgrenzung
(4) Verweis auf den SAE Standard J3016
(5) Weitergehende Begriffsbestimmungen
c) Zusammenfassung
2. Bundesstaat Arizona
a) Grundlagen zur Executive Order
aa) Präsidiale Executive Orders
bb) Executive Orders der Gouverneure
b) Executive Order vom 25. August 2015
aa) Einordnung in den regulatorischen Kontext
bb) Fehlende Definition
c) Executive Order vom 1. März 2018
aa) Einordnung in den regulatorischen Kontext
bb) Definition
cc) Vergleich mit den deutschen Definitionen
(1) Anwendungsbereich
(2) Erfasste Systeme
(3) Verweis auf den SAE Standard J3016
(4) Trennung von System und Fahrzeug
(5) Weitergehende Begriffsbestimmungen
d) Ergänzung der Arizona Revised Statutes im März 2021
aa) Übernahme der zentralen Definitionen
bb) Autonomous vehicle
cc) Ergänzende Definitionen
dd) Vergleich mit der deutschen Definition
e) Zusammenfassung
3. Bundesstaat Florida
a) Einordnung in den regulatorischen Kontext
b) Definition
c) Vergleich mit den deutschen Definitionen
aa) Umfasste Systeme
bb) Anwendungsbereich
cc) Trennung von System und Fahrzeug
dd) Systematischer Unterschied
d) Zusammenfassung
III. Die Definition des automatisierten Fahrzeugs – eine Herausforderung
1. Entwicklung
a) Vorreiter Deutschland
b) Stringente Entwicklung zur Definition
2. Gesetzliche Definition
a) Herausforderung
b) Gemeinsamkeiten
c) Unterschiede und Annährung mit StVG Novelle 2021
3. Bewertung
C. Zusammenfassung
Teil 3: Zulässigkeit und Genehmigung als Kernpunkte der Regulierung
A. Nationales Verhaltensrecht im Kontext automatisierter und autonomer Fahrfunktionen
I. Nutzung hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktionen
1. Systematik
2. Zulässigkeitsvoraussetzungen
a) Bestimmungsgemäße Verwendung
aa) Meinungsstand
bb) Stellungnahme
(1) Eignung des Herstellers
(2) Ausgestaltung der Systembeschreibung
(3) Rechtsfolge einer bestimmungswidrigen Verwendung
cc) Ergebnis
b) Erfüllung der Definitionsvorgaben als zwingende Voraussetzung
aa) Wortlaut
bb) Systematik
cc) Folgeproblematik
c) An die Fahrzeugführung gerichtete Verkehrsvorschriften
aa) Streitstand
bb) Bewertung und Auslegung der Norm
(1) Wortlaut
(2) Systematik
(3) Sinn und Zweck
(4) Gesetzesentwicklung
cc) Ergebnis
d) Vorgegebener Anwendungsbereich
aa) Generelle Anwendbarkeit der Vorschriften der StVO auf automatisierte Fahrsysteme
bb) Vermeidung von Unfällen
cc) Geschwindigkeit und Abstand
dd) Besondere Verkehrslagen
ee) Weisungen der Polizei und Signale von Einsatzfahrzeugen
3. Zwischenergebnis
4. Die Abwendungsbefugnis des Fahrers als zentraler Aspekt
a) Haftungsrechtliche Implikationen
b) Fahrzeugführereigenschaft
c) Haftungsmaßstab
d) Übernahmeverpflichtung
aa) Aufforderung durch das System
bb) Offensichtliche Umstände
e) Umfang der Wahrnehmungsbereitschaft
5. Zusammenfassung
II. Betrieb autonomer Kraftfahrzeuge in festgelegten Betriebsbereichen
1. Systematik
2. Zulässigkeitsvoraussetzungen
a) Erfüllung der Definitionsvorgaben
b) Verhaltensrechtliche Anforderungen an die technische Ausrüstung
aa) An die Fahrzeugführung gerichtete Verkehrsvorschriften
bb) System der Unfallvermeidung
cc) Überführen in den risikominimalen Zustand
c) Ausschließlicher Einsatz im festgelegten Betriebsbereich
d) Betriebserlaubnis und Zulassung
3. Besondere Pflichten der Beteiligten
a) Haftungsrechtliche Implikationen
b) Besondere Sorgfaltspflichten des Halters
aa) Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Funktionsbereitschaft
bb) Vorkehrungen zur Einhaltung sonstiger Verkehrsvorschriften
cc) Verantwortung für die Technische Aufsicht
c) Vorgaben zur Technischen Aufsicht
aa) Verbindliche Wahrnehmung der Aufgaben der Technischen Aufsicht
bb) Anforderungen an die Technische Aufsicht nach § 14 AFGBV
d) Herstellerpflichten
aa) Angebot von Schulungen
bb) Herstellererklärung
cc) Nachweis der Verkehrs- und Cybersicherheit
III. Zusammenfassung
B. Zulassung und Genehmigung von Kraftfahrzeugen mit automatisierter oder autonomer Fahrfunktion
I. Einführung in das Zulassungsrecht
II. Nationaler Rechtsrahmen für die Zulassung
1. Systematik
2. Grundsatz der Verkehrsfreiheit
3. Zulassungspflicht für Kraftfahrzeuge
4. Genehmigungen nach der StVZO
a) Allgemeine Betriebserlaubnis
b) Einzelbetriebserlaubnis
c) Betriebserlaubnis für Fahrzeugteile
5. Zusammenfassung
III. Harmonisierung auf europäischer Ebene
1. Rechtlicher Rahmen bei Umsetzung der StVG-Novelle 2017
a) Richtlinie 2007/46/EG
aa) Überblick
bb) EU-Fahrzeugklassen
cc) Genehmigungsarten und Verfahren
dd) Technische Anforderungen
b) EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung
aa) Systematik
bb) Anwendungsbereich
cc) Zuständige Behörde und benannte Technische Dienste
dd) Genehmigungen nach der EG-FGV
(1) EG-Typgenehmigung
(a) Erfüllung der technischen Vorgaben
(b) Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ
(c) Genehmigungsobjekte
(2) Kleinserien-Typgenehmigung
(3) Einzelgenehmigung
c) Möglichkeit der Ausnahmegenehmigung
aa) Verweis in § 1a Abs. 3 Nr. 2 StVG
bb) Fehlende technische Vorgaben
d) Zusammenfassung
2. Rahmenbedingungen bei Erarbeitung der StVG-Novelle 2021
a) Verordnung (EU) 2018/858
aa) Überblick
bb) Geltungsbereich und Fahrzeugklassen
cc) EU-Typgenehmigung
(1) Genehmigungsobjekte
(2) Beteiligte im Genehmigungsverfahren
(3) Grundzüge des Verfahrens nach der Rahmenverordnung
(a) Überprüfung der Einhaltung der technischen Anforderungen
(b) Übereinstimmung der Produktion
(c) Marktüberwachung und Online-Datenaustausch
(4) Technische Anforderungen
dd) Kleinserienfahrzeuge
b) Begriffliche Einordnung der Genehmigungsarten
c) Übergang von der Rahmenrichtlinie auf die Rahmenverordnung
3. Zusammenfassung
IV. Genehmigung von Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion
1. Anzuwendender Rechtsrahmen
a) Relevante Fahrzeugart und Fahrzeugklasse
b) Anwendungsbereich der Verordnung 2018/858
aa) Serienfahrzeuge
bb) Fahrzeuge mit spezieller Zweckbestimmung
cc) Erprobungsfahrzeuge
dd) Zwischenergebnis
c) Relevante Genehmigungsart
d) Getrennte Genehmigung von Fahrzeug und System
e) Ergebnis
2. Kein Einfluss der StVG-Novelle 2017 auf die Genehmigung von Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion
a) Meinungsstand
b) Bewertung
aa) Harmonisierung und Maßgeblichkeit supranationalen Rechts
bb) Wortlaut des § 1a Abs. 3 StVG
cc) Auswertung der Gesetzesmaterialien
c) Ergebnis
3. Das Völkerrecht als Quelle der Regulierung und Harmonisierung im Straßenverkehr
a) Völkerrechtliche Grundlagen
b) Überblick über die relevanten völkerrechtlichen Vertragswerke
aa) Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr
(1) Ausgangsdokument
(2) Überarbeitung des Vertragstextes als Reaktion auf den technischen Fortschritt
bb) Fahrzeugteileübereinkommen
(1) Zielsetzung
(2) Revisionen
(3) Technische Vorschriften
c) Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen
aa) Einordnung der UNECE innerhalb der Vereinten Nationen
bb) Aufbau und relevante Gremien der UNECE
(1) Ausschuss für Transport
(2) Arbeitsgruppen
cc) Zusammenfassung
4. UN-Regelungen als maßgebliche technische Vorschriften
a) Bezugnahme auf UN-Regelungen im europäischen Genehmigungsverfahren
b) UN-Regelung Nr. 13H
c) UN-Regelung Nr. 79
aa) Fahrerassistenz-Lenkanlage
(1) Automatische Lenkfunktionen der Kategorien A, B1 und C
(2) Automatische Lenkfunktionen der Kategorien B2, D und E
bb) Keine Grundlage für Genehmigung von hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktionen
(1) Gegenauffassung
(2) Kritische Bewertung
(3) Ergebnis
d) UN-Regelung Nr. 157
aa) Notwendigkeit einer speziellen UN-Regelung
bb) Entwicklung der UN-Regelung Nr. 157
cc) Erfasste Fahrzeugklassen
dd) Definition der ALKS
ee) Anwendungsbereich und Funktionalität der ALKS
(1) Straßentyp
(2) Obere Geschwindigkeitsgrenze 60 km/h
(3) Obere Geschwindigkeitsgrenze 130 km/h
(4) Lane Change Procedure
(5) MRM lane change
ff) Genehmigungsfähige Systeme
e) Zusammenfassung
5. Verordnung 2019/2144 zur allgemeinen Sicherheit
a) Anwendungsbereich
b) Besondere Anforderungen für automatisierte Fahrzeuge
c) Einordung der Verordnung 2019/2144
6. Zusammenfassung
V. Genehmigung von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion
1. Systematik
a) Betriebserlaubnis
b) Genehmigung des festgelegten Betriebsbereichs
c) Zulassung
2. Nationale Betriebserlaubnis auf Grundlage der AFGBV
a) Antrag des Herstellers
b) Technische Anforderungen der AFGBV
aa) Funktionale Anforderungen
(1) Erfüllung der Fahraufgabe
(2) Fahrzeugsteuerung und besondere Situationen
(3) Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten
(4) Kollisionsvermeidung
bb) Test- und Validierungsmethoden
(1) Nachweis im Rahmen einer Testphase
(2) Bezugnahme auf UN-Regelungen
(3) Einbindung des Herstellers
c) Herstellererklärung
d) Auffangtatbestand
e) Zusammenfassung
3. EU-Typgenehmigung für Kleinserienfahrzeuge
a) Entwicklung und Systematik
aa) Verordnung 2019/2144
bb) Durchführungsverordnung 2022/1426
cc) Delegierte Verordnung 2022/2236
b) Regelungen der ADS-Verordnung
aa) Differenzierung nach Use Cases
bb) Bezugnahme auf UN-Regelungen
cc) Bediener für den Ferneingriff
c) Gleichstellung mit nationaler Betriebserlaubnis
4. Genehmigung des festgelegten Betriebsbereichs
a) Systematische Einordnung
b) Antrag durch den Halter
c) Voraussetzungen für Genehmigungserteilung
5. Vereinbarkeit mit dem Wiener Übereinkommen
a) Fahrzeugführererfordernis
b) Überarbeitung des Vertragstextes
6. Zusammenfassung
C. Ergebnis
Teil 4: Die Verflechtung von Verhaltens- und Zulassungsrecht als Herausforderung der Regulierung
A. Problemstellung
B. Lösung durch verhaltensrechtliche Anforderungen im Rahmen der technischen Vorschriften
I. Entwicklung der Diskussion
1. Trennungs- und Einheitstheorie
a) Trennungstheorie
b) Einheitstheorie
c) Bewertung
2. Verlagerung der Diskussion auf die technischen Vorschriften
3. Nationales Verhaltensrecht ohne genehmigungsrechtliche Relevanz
II. Verhaltensrechtliche Anforderungen in der UN-Regelung Nr. 157
1. Verhaltensrecht im Rahmen der UN-Regelung Nr. 157
a) Allgemeine Anforderungen
b) Bezugnahme auf das nationale Straßenverkehrsrecht
c) Bezugnahme auf die „common practise“
d) Hauptverantwortung für die Fahrzeugsteuerung
2. Überprüfung im Genehmigungsverfahren
a) Entwicklung innerhalb der UNECE
b) Prüfverfahren im Rahmen der UN-Regelung Nr. 157
c) Herstellererklärung zur Einhaltung der Verkehrsvorschriften
3. Abwendungsbefugnis
a) Entscheidung über Abwendungsbefugnis verbleibt bei nationalem Gesetzgeber
b) Vermeidung einer Rechtszersplitterung
c) Lösung in Deutschland für hoch- oder vollautomatisiertes Fahren
aa) Verknüpfung mit nationalen Verkehrsregeln
bb) Verknüpfung mit internationalen Vorschriften
d) Zusammenfassung
III. Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion
C. Ergebnis
Teil 5: Zusammenführung der Ergebnisse
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a.A.
andere Ansicht
Abl.
Amtsblatt
a.a.O.
am angegebenen Ort
ABE
Allgemeine Betriebserlaubnis
ABS
Antiblockiersystem
Abs.
Absatz
ACSF
Working Party on Automatically Commanded Steering Function
ADAS
Advanced Driver Assistance System
ADS
Automated Driving System
a.E.
am Ende
AEBS
Advanced Emergency Braking System
a.F.
alte Fassung
AFGBV
Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung
al.
alii
ALKS
Automated Lane Keeping System
Alt.
Alternative
Anm.
Anmerkung
ASR
Antriebsschlupfregulierung
BASt
Bundesanstalt für Straßenwesen
BeckOGK
Beck-online Großkommentar
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BMDV
Bundesministerium für Digitales und Verkehr
BMVI
Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur
BR-Drs.
Bundesratsdrucksache
BT-Drs.
Bundestagsdrucksache
BVerwG
Bundesverwaltungsgericht
bzw.
beziehungsweise
CCR
California Code of Regulations
CR
Computer und Recht
DAR
Deutsches Autorecht
DDT
Dynamic Driving Task
ders.
derselbe
dies.
dieselbe(n)
DOT
U. S. Department of Transportation
Ebd.
Ebenda
EBE
Einzelbetriebserlaubnis
EG
Europäische Gemeinschaft
EG-FGV
EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung
ESP
Elektronisches Stabilitätsprogramm
EU
Europäische Union
EuZW
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
f./ff.
folgende
FMVSS
Federal Motor Vehicle Safety Standards
Fn.
Fußnote
FTÜ
Fahrzeugteileübereinkommen
FZV
Fahrzeugzulassungsverordnung
GG
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
GPS
Global Positioning System
HMI
Human Machine Interface
Hrsg.
Herausgeber
HS
Halbsatz
InTeR
Zeitschrift zum Innovations- und Technikrecht
ITC
Inland Transport Committee
i.V.m.
in Verbindung mit
JA
Juristischen Arbeitsblätter
jurisPK
Juris Praxiskommentar
JZ
JuristenZeitung
Kap.
Kapitel
KBA
Kraftfahrt-Bundesamt
Kfz
Kraftfahrzeug
km/h
Kilometer pro Stunde
KriPoZ
Kriminalpolitische Zeitschrift
LCP
Lane Change Procedure
Lidar
Light Detection and Ranging
lit.
Buchstabe
LKW
Lastkraftwagen
MDR
Monatsschrift für deutsches Recht
MMR
Multimedia und Recht
MRM
Minimum Risk Manoeuvre
MüKo
Münchener Kommentar
m.w.N.
mit weiteren Nachweisen
NHTSA
National Highway Traffic Safety Administration
NJOZ
Neue Juristische Online Zeitschrift
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
No.
number
Nr.
Nummer
NVwZ
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZV
Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
ODD
Operational Design Domain
OEDR
Object and Event Detection and Response
p.
page
PflichtVG
Pflichtversicherungsgesetz
PHi
Haftpflicht International
PKW
Personenkraftwagen
Radar
Radio Detection and Ranging
RAW
Recht Automobil Wirtschaft
RDi
Recht Digital
RdTW
Recht der Transportwirtschaft
RL
Richtlinie
S.
Seite
SAE
Society of Automobile Engineers
StVG
Straßenverkehrsgesetz
StVO
Straßenverkehrsordnung
StVZO
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SVR
Straßenverkehrsrecht
t
Tonne
TÜV
Technischer Überwachungsverein
UN
United Nations
UNECE
United Nations Economic Commission for Europe
US
United States
USA
Vereinigte Staaten von Amerika
VDA
Verband der Automobilindustrie
VEH
California Vehicle Code
VersR
Versicherungsrecht
Vgl.
Vergleiche
VkBl.
Verkehrsblatt
VO
Verordnung
WP
Working Party
WÜ
Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr
WVK
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge
ZD
Zeitschrift für Datenschutz
ZdiW
Zeitschrift für das Recht der digitalen Wirtschaft
ZfPC
Zeitschrift für Product Compliance
ZRP
Zeitschrift für Rechtspolitik
Teil 1: Der technische Fortschritt als rechtliche Herausforderung
Die fortschreitenden technischen Möglichkeiten auf dem Automobilsektor sollen neben einer Komfortverbesserung für die Nutzer auch zur Minimierung der Fehlerquelle Mensch beitragen, diese bestenfalls ausschalten1. Es ist dabei sehr wahrscheinlich, dass der beschrittene Weg hin zur Automatisierung des Straßenverkehrs tatsächlich einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg zur „Vision Zero“2 leisten kann.
„Automatisiertes Fahren ist keine Science-Fiction. In wenigen Jahren werden automatisierte Fahrzeuge im Straßenverkehr unterwegs sein. […] Langfristig lautet das Ziel die komplett vernetzte Straße. Staus und Umweltbelastungen werden reduziert, die Verkehrssicherheit erhöht und die Infrastruktur optimal ausgelastet.“3
So umschrieb Alexander Dobrindt bereits im April 2015 die automobile Zukunft in Deutschland. Tatsächlich steht die Mobilität von heute vor einer Revolution. Kraftfahrzeuge sollen das Steuer übernehmen – der Mensch tritt in den Hintergrund. Unabhängig davon, ob man von einer Revolution im Straßenverkehr sprechen möchte oder nicht, eines dürfte klar sein: Die Automatisierung von Kraftfahrzeugen führt zu einem der größten Umbrüche auf öffentlichen Straßen und stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen dabei vor Herausforderungen erheblichen Ausmaßes.
A. Recht im Kontext automatisierter und autonomer Kraftfahrzeuge
I. Rechtlicher Rahmen
Der im Zusammenhang mit dem automatisierten Fahren berührte rechtliche Rahmen ist umfangreich. Das für Kraftfahrzeuge zu beachtende Zulassungs- und Genehmigungsrecht ist einem steten Harmonisierungsprozess unterworfen, so dass europarechtliche Vorgaben insofern bestimmend sind. Der rechtliche Rahmen weist zudem starke internationale Bezüge auf. Internationale Vorschriften, die ihre Grundlage in völkerrechtlichen Verträgen finden und von der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen entwickelt werden, haben erheblichen Einfluss auf die Möglichkeit der Genehmigung von Kraftfahrzeugen. Für den zulässigen Einsatz von Kraftfahrzeugen mit automatisierter oder autonomer Fahrfunktion ist aber auch der nationale Gesetzgeber gefordert. In Deutschland gibt das Straßenverkehrsgesetz4 die Rahmenbedingen für den zulässigen Einsatz von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr vor.
II. Die StVG-Novellen als Reaktion auf den technischen Fortschritt
Auf die Herausforderungen des automatisierten Fahrens wurde mit der StVG-Novelle aus dem Jahr 20175 schon frühzeitig reagiert. Es soll hierdurch der nationale Rechtsrahmen für Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion auf nationaler Ebene festgelegt werden. Die Kernpunkte der StVG-Novelle 2017 stellen die §§ 1a, 1b StVG dar, die neben einer umfangreichen Definition von Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion insbesondere auch verhaltensrechtliche Vorgaben enthalten. Die Hoffnungen der Hersteller auf einen zeitnahen Großserieneinsatz von automatisierten Kraftfahrzeugen in Deutschland erfüllten sich jedoch nicht und die mit der Novelle 2017 eingeführten Regelungen führten nicht zu einem zeitnahen Einsatz von Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion. Der Grund hierfür ist in der besonderen Verflechtung von nationalem und internationalem Recht auf den Ebenen der Zulassung und Genehmigung von Kraftfahrzeugen zu sehen. Diese rechtliche Verflechtung wird auch in Zukunft das entscheidende Kriterium für den erfolgreichen und rechtssicheren Einsatz von automatisierten Kraftfahrzeugen sein.
Mit der StVG-Novelle 20216 wird vom deutschen Gesetzgeber ein neuer Ansatz verfolgt, der zunächst losgelöst von internationalen Vorgaben und dem europäischen Genehmigungsverfahren den Einsatz von fahrerlosen Fahrzeugen in festgelegten Betriebsbereichen ermöglichen soll. Im Zentrum der Novelle 2021 stehen daher die §§ 1d bis 1f StVG, die neben grundlegenden Definitionen auch die Rahmenbedingungen für den zulässigen Einsatz von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in Deutschland vorgeben. Es handelt sich hierbei um einen nationalen Alleingang, der daher nur im Zusammenhang mit der Festlegung von technischen Anforderungen auf nationaler Verordnungsebene gelingen kann. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMDV) von seiner Verordnungsermächtigung gemäß § 1j StVG Gebrauch gemacht und mit der Verordnung zur Genehmigung und zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen7 im Juni 2022 flankierende Regelungen zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion erlassen.
III. Gegenstand und Gang der Untersuchung
Die vorliegende Arbeit beleuchtet die StVG-Novellen aus dem Jahr 2017 und dem Jahr 2021 aus regulatorischer Sicht. Der Fokus liegt hierbei auf dem rechtlichen Rahmen für den Regelbetrieb von Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion sowie von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in Deutschland. Vor diesem Hintergrund bildet das Zulassungs- und Genehmigungsrecht den Schwerpunkt der Untersuchung, wobei die Arbeit sowohl von europa- als auch von völkerrechtlichen Bezügen geprägt ist. Ein besonderes Augenmerk ist zudem auf das national ausgestaltete Verhaltensrecht im Straßenverkehr zu legen. Datenschutzrechtliche Erwägungen sind dagegen nicht Gegenstand der Untersuchung.
Die Arbeit untergliedert sich in fünf Teile. Nachdem bereits oben in Kapitel A der rechtliche Rahmen im Kontext der voranschreitenden Fahrzeugautomatisierung abgesteckt wurde, werden im Folgenden in Kapitel B die technischen Grundlagen erläutert. Teil 1 schließt mit Kapitel C, in dem vor dem Hintergrund von praktischen Erwägungen die berührten Regulierungsbereiche identifiziert und die Weichen für die darauf folgende Untersuchung gestellt werden.
Im Zentrum beider StVG-Novellen stehen die ihren jeweiligen Anwendungsbereich festlegenden Definitionen. Bei der Entwicklung der Definitionen hat sich der Gesetzgeber von technischen Klassifikationen aus Deutschland und dem US-amerikanischen Raum leiten lassen. In Teil 2 wird daher die Entwicklung der Definitionen in § 1a Abs. 2 StVG sowie in § 1e StVG nachgezeichnet. Vor diesem Hintergrund erfolgt auch der Brückenschlag in das US-amerikanische Recht, indem die Definitionen und Rahmenbedingungen von drei US-Bundesstaaten der Entwicklung in Deutschland gegenübergestellt werden. Im Rahmen der rechtsvergleichenden Betrachtung werden die deutschen Definitionen sodann einer Bewertung zugeführt.
Der gesetzlichen Systematik folgend werden in Teil 3 Kapitel A das national geprägte Verhaltensrecht und die Zulässigkeit des Betriebs von Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter bzw. autonomer Fahrfunktion untersucht. Der Schwerpunkt liegt hierbei zunächst auf den vom Gesetz vorgegebenen Voraussetzungen für die Zulässigkeit. Die gesetzlichen Regelungen spiegeln eine voranschreitende Entlassung des Fahrers aus der Fahrzeugführung wider, die bis hin zum fahrerlosen Einsatz in festgelegten Betriebsbereichen reicht. Mit der entsprechenden Zulässigkeit dieser Systeme gehen allerdings auch besondere Pflichten für den Fahrer bzw. die Beteiligten beim Betrieb des Kraftfahrzeugs einher, die insofern in einen haftungsrechtlichen Kontext zu setzen sind.
Von der Frage der Zulässigkeit der Nutzung von automatisierten oder autonomen Fahrfunktionen ist die Zulassung des jeweiligen Kraftfahrzeugs zum Straßenverkehr zu unterscheiden. Automatisierte und autonome Fahrzeuge bedürfen einer Zulassung und müssen im Vorfeld ein Genehmigungsverfahren durchlaufen. In Teil 3 Kapitel B wird daher aufgezeigt, dass das deutsche Zulassungsrecht in besonderem Maße europarechtlich überformt ist, wobei die im Genehmigungsverfahren zu beachtenden technischen Vorschriften völkerrechtlicher Natur sind. Hierzu wird zunächst das deutsche Zulassungsrecht erläutert, bevor die Harmonisierung des Genehmigungsverfahrens auf europäischer Ebene dargestellt wird. Den Schwerpunkt bilden sodann das Völkerrecht als Quelle der Regulierung von Kraftfahrzeugen und die Darstellung der Besonderheiten bei der Genehmigung von automatisierten und autonomen Fahrzeugen.
Während das Zulassungs- und Genehmigungsverfahren europäisch harmonisiert ist und internationalen Vorschriften folgt, ist das Verhaltensrecht der nationalen Ebene zuzuordnen. In Teil 4 werden daher die Ergebnisse aus Teil 3 unter dem Aspekt der Verflechtung von Zulassungs- und Verhaltensrecht zusammengeführt und dabei das Verhältnis zwischen nationalem, europäischem und internationalem Recht vertieft untersucht. Der Fokus liegt hierbei auf der Lösung des im Bereich der weit entwickelten Fahrzeugautomatisierung bestehenden Spannungsverhältnisses zwischen der europäischen Überformung und internationalen Ausrichtung des Zulassungs- und Genehmigungsverfahrens einerseits und dem auf nationaler Ebene kodifizierten Zulässigkeits- und Verhaltensrechts andererseits.
Die Arbeit schließt in Teil 5 mit der Zusammenführung der Ergebnisse der untersuchten Teilbereiche und spannt so den Bogen zwischen nationalem, europäischem und internationalem Recht bei der Regulierung von automatisierten und autonomen Kraftfahrzeugen in Deutschland.
B. Technische Grundlagen automatisierter Fahrsysteme
Kraftfahrzeuge mit automatisierter oder autonomer Fahrfunktion müssen das Verkehrsgeschehen und das Umfeld wahrnehmen und interpretieren können. Schließlich muss auf Grundlage dieser Daten eine automatisierte Steuerung des Fahrzeugs erfolgen können. Für die Klärung von rechtlichen Fragen in Bezug auf die voranschreitende Automatisierung von Kraftfahrzeugen ist ein grundlegendes Verständnis der technischen Grundlagen notwendig. Im Folgenden sollen daher – in der gebotenen Kürze – die technischen Grundlagen der automatisierten Steuerung umrissen werden. Zunächst werden die wichtigsten zum Einsatz kommenden Sensortypen vorgestellt, gefolgt von Anmerkungen zur Sensordatenverarbeitung. Auch die Umsetzung in eine tatsächliche Fahrtrichtungsänderung wird erläutert. Schließlich wird die Schnittstelle zwischen Mensch und Fahrzeug dargestellt.
I. Sensorik
Mit der im Fahrzeug verbauten Sensorik soll zum einen eine detaillierte Erfassung der Umgebung ermöglicht und zum anderen eine möglichst genaue Lokalisierung gewährleistet werden.
1. Umgebungswahrnehmung
Für die Wahrnehmung des Umfelds8 müssen sich automatisierte Fahrzeuge einer Vielzahl von Sensoren bedienen.9 Die jeweils verwendeten Sensortypen unterscheiden sich dabei in Reichweite, Genauigkeit und Störanfälligkeit für Umwelteinflüsse. Durch die Kombination verschiedener Sensorarten sollen einzelne Defizite ausgeglichen werden und eine möglichst genaue Erfassung der Umgebung erreicht werden.
a) Frontview-Kamera
Zum einen kommen optische Sensoren in Form von Frontview-Kameras zum Einsatz. Die Verwendung von Kamerasystemen ist schon seit einigen Jahren keine Besonderheit mehr im Rahmen der Unterstützung des Autofahrers. Man denke an Assistenzsysteme wie Verkehrszeichenerkennung, Spurhalteassistent oder Fußgängererkennung10, die alle auf eine kameragestützte optische Wahrnehmung des voraus liegenden Straßenraums angewiesen sind. Wichtig wird bei den verwendeten Kameras sein, dass diese eine räumliche Wahrnehmung erlauben.11 Es werden also Stereokameras12 verbaut werden, um den vor dem Fahrzeug befindlichen Verkehrsraum optisch zu erfassen.
Kamerasysteme haben sich bei Assistenzsystemen bereits bewährt. Sie weisen jedoch Defizite auf, wenn sich die Lichtverhältnisse verändern. Starkes Gegenlicht und reflektierende Oberflächen führen zu Störungen in der Bilderfassung und bringen Kamerasysteme dabei an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.13
b) Radar
Ein überaus wichtiges Element der Umfeld-Erfassung ist die radargestützte Abtastung der Umgebung und Messung des Abstandes der zu erfassenden Objekte. Das im gewöhnlichen Sprachgebrauch verwendete Wort „Radar“ bedeutet „Radio Detection and Ranging“. Es basiert auf der Aussendung von elektromagnetischen Wellen (im Automotive-Bereich im Millimeterbereich) und der Registrierung der Reflektionen.14 Die Zeit zwischen Aussendung des Radarsignals und Auftreffen des zurückgeworfenen Signals auf dem Sensor wird gemessen und der Abstand zum reflektierenden Objekt berechnet.15 Darüber hinaus kann auch die Geschwindigkeit dieses Objekts selbst, zum Beispiel ein vorausfahrendes Fahrzeug, ermittelt werden.16 Der Radar eignet sich gut zur Erfassung des weit vor dem Fahrzeug liegenden Verkehrsraums mittels Long-range Radar.17 Aber auch das nähere Umfeld des Fahrzeugs kann durch den Einsatz von Mid-Range and Short-Range Radarsystemen überwacht werden. Der große Vorteil beim Einsatz von Radartechnik ist, dass die Messwerte durch widrige Umwelteinflüsse nicht sonderlich beeinträchtigt werden.18 So funktionieren diese Systeme gerade bei Nebel oder schwierigen Lichtverhältnissen im Gegensatz zu optischen Systemen nahezu ohne Beeinträchtigung.19
c) Lidar
Schließlich findet sogenannte Lidar-Sensorik Anwendung. Lidar steht dabei für „Light Detection and Ranging“ und ist ein optisches Messverfahren zur Bestimmung von Entfernungen.20 Es wird ein Laserlicht ausgesandt und mit Hilfe des zurückgeworfenen Signals der Abstand zum reflektierenden Objekt berechnet.21 Da das ausgesandte Licht aber auch an winzigen Partikeln reflektiert wird, kann dieser Sensortyp durch Nebel, Regen oder Staub beeinträchtigt werden.22 Moderne Sensoren können allerdings ihre Empfindlichkeit anpassen und trotz widriger Umwelteinflüsse verwertbare Messergebnisse erzielen.23 Die Funktionsweise des Lidars ähnelt der eines Radar-Systems. Trotzdem ist die Einsatz-Reichweite des Lidars im Vergleich zu Radar-Sensoren deutlich geringer.24 Dafür sind die Ergebnisse der Messung mittels Lidar im Vergleich zur Radarmessung genauer und ermöglichen eine detailliertere Interpretation der Umgebung.25
d) Ultraschall
Das unmittelbare Fahrzeugumfeld kann mittels Ultraschallsensoren überwacht werden. Diese Technik ist im Rahmen von Einparksystemen bereits bekannt und weit verbreitet. Aktuelle Anwendungsfälle sind bereits im Einsatz befindliche Tote-Winkel-Assistenten und automatische Einparkfunktionen.26 Die durch Ultraschallsensoren mögliche Entfernungsmessung beschränkt sich jedoch auf wenige Meter und erreicht kein hohes Maß an Genauigkeit.27 Die Nahfeldüberwachung an den Flanken und dem Heck des Fahrzeugs lässt sich mit dieser Technik jedoch gut realisieren, da die Messtoleranz für diesen Anwendungsfall ausreichend ist.28
2. Lokalisierung
Wie einleitend dargestellt, wird das automatisierte Fahrzeug auf eine ganze Reihe unterschiedlicher Sensoren zurückgreifen, um eine Wahrnehmung sowohl des nahen Umfeldes als auch des weit vor dem Fahrzeug liegenden Verkehrsraums zu realisieren. Neben der Wahrnehmung muss das automatisierte Fahrzeug zudem auch exakt bestimmen können, wo es sich im Moment der Sensor-Datenerfassung befindet. Dies ist zum einen schon zur Routenfindung notwendig. Zum anderen ergibt sich aus dem Standort auch eine Vielzahl an relevanten Informationen, wie erlaubte Höchstgeschwindigkeit und mögliche Fahrstreifenwahl. Darüber hinaus ermöglicht die Information zum Straßentyp auch die Beachtung der jeweils für den Straßentyp zu beachtenden Verkehrsvorschriften, wie beispielsweise das Rechtsfahrgebot auf Autobahnen.
Kraftfahrzeuge mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion müssen zudem ihre Grenzen selbstständig erkennen. So muss beispielsweise ein Fahrzeug, welches lediglich über einen Autobahn-Chauffeur verfügt, erkennen, dass es sich tatsächlich auf einer Autobahn befindet. Eine sichere Lokalisierung ist auch für Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion von entscheidender Bedeutung, da die Verwendung der autonomen Fahrfunktion nur im festgelegten Betriebsbereich zulässig ist und es sich hierbei nach § 1d Abs. 2 StVG um einen örtlich und räumlich konkret bestimmten öffentlichen Straßenraum handelt. Es gibt im Wesentlichen drei Systeme, die regelmäßig zur Positionsbestimmung genutzt werden können.
a) Global Positioning System
Das Global Positioning System, kurz GPS, dient schon seit jeher den im Automobilbereich zum Einsatz kommenden Navigationssystemen zur Standortbestimmung. Mit Hilfe von Satelliten wird die aktuelle Position bestimmt.29 Die Lokalisierung mittels GPS funktioniert zuverlässig; jedoch beeinträchtigt die Umgebung, wie Berge oder Häuserfassaden, die Positionsbestimmung.30 Damit ist ein spurgenaues Fahren in der Stadt für ein automatisiertes Fahrzeug nur mithilfe von GPS nicht möglich.31 Das Fahrzeug muss auf die fahrzeugeigene Sensorik, beispielsweise zur Erkennung von Fahrstreifen, zurückgreifen. Ist die Sicht auf die GPS-Satelliten – zum Beispiel bei einer Fahrt durch einen Tunnel – gänzlich verdeckt, so ist eine Bestimmung in dieser Zeit überhaupt nicht möglich.32
b) Odometrie
Odometrie kann vereinfacht als die Berechnung der zurückgelegten Strecke anhand der Radumdrehungen definiert werden.33 So kann das Fahrzeug beispielsweise bei einer Tunnelfahrt die Zeit ohne GPS-Empfang überbrücken und anhand der berechneten zurückgelegten Strecke die Position im Tunnel bestimmen. Es kommt bei der Bestimmung der Radumdrehungen allerdings aufgrund einer Vielzahl von Faktoren zu Messfehlern, welche zu einer über die Zeit immer ungenaueren Positionsbestimmung führen.34
c) Drehratensensor
Die Bewegung des Fahrzeugs kann das System schließlich mittels Drehratensensor nachvollziehen.35 Anhand von Beschleunigungswerten berechnet die Messeinheit Geschwindigkeit und Position des Fahrzeugs.36 Im Gegensatz zu den anderen Verfahren zur Bestimmung der Position ist diese Variante unabhängig von der Umgebung und damit durchweg verfügbar.37
3. Zusammenfassung
Die hier vorgestellten Sensorsysteme stellen die wichtigsten Stützen für die Umfeldwahrnehmung und Lokalisierung des Fahrzeugs dar. Gerade die zur Umgebungswahrnehmung verwendeten Sensoren kommen bereits heute in leistungsfähigen Fahrerassistenzsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, kurz ADAS)38 teilweise zur Anwendung. Dies verwundert nicht, denn höhere Automatisierungsfunktionen bauen grundsätzlich auf der Sensorik der vorangehenden Automatisierungsstufen auf.39 Für das automatisierte Fahren ist die Kombination unterschiedlicher Sensortypen unverzichtbar.40 Die unterschiedlichen Sensoren haben jeder für sich Vor- wie auch Nachteile. Dies zeigt sich bei Wahrnehmungssensoren vor allem mit Blick auf Messreichweite und die unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber Umwelteinflüssen wie Witterung und Lichtverhältnisse.
II. Datenzusammenführung
Die einzelnen Sensoren sind jedoch nicht separat für sich zu betrachten. Erst das Zusammenspiel der unterschiedlichen Sensorik ermöglicht eine Erfassung des Umfelds, wie sie beim Einsatz von automatisierten und autonomen Fahrfunktionen nötig ist.
1. Sensordatenfusion
Die von den Sensoren zur Verfügung gestellten Daten werden im Fahrzeug verarbeitet und ermöglichen so die Wahrnehmung der Umgebung.41 Durch die Verwendung verschiedener Sensordaten können die Defizite eines Sensors durch die Vorteile eines anderen Sensortyps kompensiert werden. Dieses Zusammenspiel der Sensoren kann unter dem Begriff der Sensordatenfusion gefasst werden.42 Die Informationen einzelner Sensoren werden kombiniert, wodurch Fehler möglichst reduziert und die Genauigkeit der Ergebnisse verbessert werden sollen.43
Als Teilaspekte der Sensordatenfusion sei auch auf die Redundanz und Komplementarität der Sensorik hingewiesen.44 Durch die redundante Auslegung des Systems kann der Ausfall einzelner Sensoren kompensiert werden. Komplementäre Sensorik trägt ebenfalls zur Sicherheit des gesamten Sensorsystems bei. So verringern unterschiedliche Sensortypen die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hindernis nicht erfasst wird.45
2. Vernetzung mit dem Backend
Trotz der Vielfalt der einsetzbaren Sensoren und der Möglichkeiten der Fusion von fahrzeugeigenen Sensordaten unterliegt sensorgestützte Wahrnehmung gewissen Grenzen. So können Leistungsgrenzen wie die maximale Reichweite nicht beliebig verschoben werden oder aber auch Behinderungen durch Umwelteinflüsse nicht gänzlich kompensiert werden. Der Sensorik kann in bestimmten Situationen aufgrund von physikalischen Grenzen gewissermaßen der nötige „Weitblick“ fehlen.46 So wird beispielsweise ein automatisiertes Fahrsystem ein Stauende zwar grundsätzlich sicher erkennen und durch eine entsprechende Bremsung ein Auffahren verhindern können.47 Allerdings kann diese Bremsung aufgrund eines kurzen Bremsweges sehr hart ausfallen48 und für die Insassen als unangenehm empfunden werden. Zudem birgt jede starke Bremsung auch das Risiko, dass der nachfolgende Verkehr nicht mehr rechtzeitig reagiert und auf das eigene Fahrzeug auffährt. Derartige Situationen können mithilfe von Backendsystemen entschärft oder ganz vermieden werden. Hierbei findet ein stetiger Informationsaustausch zwischen Fahrzeugen und Servern (das Backend) über eine Mobilfunkverbindung statt.49 Alle mit dem Backend in Verbindung stehenden Fahrzeuge übermitteln ihrerseits Daten. Sie erhalten von den Servern stets aufbereitete Informationen unter anderem über die Verkehrslage und Gefahrstellen.50
Dabei greifen die Serversysteme nicht nur auf die Datenflut der einzelnen Fahrzeuge zu, sondern lassen auch Informationen aus anderen Quellen, wie Verkehrsleitzentralen, einfließen.51 Jedes Fahrzeug verfügt im Ergebnis über einen „elektrischen Horizont“.52 Durch immer genauere Information über den Ort von Gefahrstellen und besseren Überblick über Verkehrslagen können Backendsysteme zu einem stetigen Komfort- und vor allem Sicherheitsgewinn beitragen. Gerade in Verbindung mit automatisierten Fahrfunktionen können kritische Situationen vermieden und ein sicheres und komfortables Fahren auch im automatisierten Modus gewährleistet werden.53
3. Zusammenfassung
Es zeigt sich, dass in der Zusammenführung von Daten große Potentiale zur Steigerung der Verkehrssicherheit gesehen werden. Gerade mit Blick auf automatisierte und autonome Fahrsysteme müssen diese Potentiale ausgeschöpft werden, um die erhoffte Steigerung der Verkehrssicherheit in möglichst hohem Maße zu erreichen. Dies gilt zum einen bei der Fusion der einzelnen fahrzeugeigenen Sensordaten. Das sichere Erkennen von Hindernissen und die Erfassung der Fahrzeugumgebung ist bereits Grundvoraussetzung für automatisiertes Fahren im öffentlichen Straßenverkehr. Aber auch mit Blick auf den Datenaustausch zwischen vielen Fahrzeugen mit einem zentralen System, welches die Daten verwertet und in Informationen aufbereitet, erhofft man sich die Verringerung von Risiken und einen effizienteren Verkehrsfluss. Automatisierte Fahrzeuge mit einem zusätzlichen Weitblick werden effizienter und komfortabler, aber vor allem auch sicherer unterwegs sein.
III. Aktorik
Ein Kraftfahrzeug mit automatisierter oder autonomer Fahrfunktion muss schließlich in der Lage sein, seiner berechneten Route selbstständig zu folgen und zu erkannten Hindernissen ausreichend Abstand zu halten oder auszuweichen. Es muss also in erster Linie von selbst lenken und bremsen können. Dies ist durch die Implementierung von Drive-by-Wire-Systemen möglich, welche die auf die Fahrzeugsteuerung bezogenen elektrischen Signale mit Hilfe von Elektromotoren oder hydraulischen Systemen umsetzen.54 Die damit erfolgende mechanische Einwirkung auf die Lenkung und/oder die fahrzeugeigene Bremse resultiert in einer Änderung der Fahrtrichtung bzw. Anpassung der Geschwindigkeit. Derartige Drive-by-Wire Systeme kommen bereits im Rahmen von leistungsfähigen Assistenzsystemen zum Einsatz und haben sich bewährt.55 Sie sind unverzichtbarer Bestandteil des automatisierten Fahrens.
IV. Human Machine Interface
Zuletzt muss es eine Schnittstelle geben, die eine Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und seinem Fahrer oder – bei Verwendung einer autonomen Fahrfunktion – seinem Nutzer ermöglicht. Dieses Bindeglied zwischen Mensch und Fahrzeug wird als „Human Machine Interface“, kurz HMI, bezeichnet.56 Die Darstellung von Informationen wie Geschwindigkeit, Fahrzeugzustand und Navigation erfolgt über gewöhnliche Kombiinstrumente oder im Cockpit integrierte Bildschirme.
1. Anforderungen bei Kraftfahrzeugen mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion
Mit den steigenden Funktionsmöglichkeiten des automatisierten Fahrens wird der Umfang der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und seinem Fahrer stetig steigen.57 Darüber hinaus wird die Bedienung der immer intelligenteren Systeme auch komplexer und stellt höhere Anforderungen an das Verständnis des Fahrers.58 Es muss für den Fahrer indes klar und eindeutig sein, ob die automatisierte Fahrfunktion des Fahrzeugs gerade aktiviert ist und einwandfrei funktioniert.59 Dies gilt insbesondere bei der Nutzung einer hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion, bei der sich der Fahrer gemäß § 1b Abs. 1 StVG vom Fahrgeschehen abwenden darf. Hierbei wird die Situation, in der das Fahrzeug die Steuerung an den Fahrer zurückgibt, als besonders kritisch gesehen.60 Die Übergabesituation ist komplex, da neben der Information auch ein unmittelbares Handeln des Fahrers erforderlich ist. Da es hierbei um die Fahrzeugführung selbst geht, ist ein besonders sicherheitsrelevanter Bereich betroffen. Das HMI muss dazu beitragen, dass diese Übergabesituation beherrschbar bleibt und möglichst reibungslos funktioniert. Die vom HMI ausgegebene Übergabeaufforderung muss vom Fahrer möglichst schnell bemerkt und auch als solche aufgefasst werden können.
Das HMI kann in zwei grundlegende Teile aufgespalten werden. So besteht es zum einen aus Bedienelementen und zum anderen aus Anzeigen.61 Für die kritische Übergabesituation kommt es in erster Linie auf die Anzeige an, denn für die Übernahme selbst wird die Aufnahme der Steuerung allein genügen und nicht etwa erst über ein Bedienelement durch den Fahrer zurückgeholt werden müssen. Die Übernahmeaufforderung kann dem Fahrer grundsätzlich optisch, akustisch oder auch taktil angezeigt werden.62 Da der Fahrer möglichst schnell auf die von ihm verlangte Übernahme aufmerksam werden soll, ist ein deutliches akustisches Hinweissignal zu verwenden. Gerade für Warnungen werden Warntöne in Fahrzeugen bereits verwendet.63
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, die vestibuläre Wahrnehmung des Fahrers anzusprechen, also mittels Beschleunigung oder Abbremsen des Fahrzeugs auf den Fahrer einzuwirken.64 Dies wäre als Eskalationsstufe denkbar, wenn der Fahrer auf die übrigen Reize nicht reagiert. Fraglich wäre dann allerdings, ob für eine Eskalation im Falle einer nicht vorhergesehenen Übergabesituation Zeit ist. Auch ein unvermitteltes Abbremsen ist für den rückwärtigen Verkehr nicht unbedenklich.
2. Anforderungen bei Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion
Kraftfahrzeuge mit autonomer Fahrfunktion sollen in festgelegten Betriebsbereichen führerlos verkehren können. Daher entfällt die soeben dargestellte traditionelle Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Fahrer. Dennoch werden den Passagieren Informationen zum Status des Fahrzeugs und der Fahrt weiterhin angezeigt werden müssen. So wird den Nutzern eines Kraftfahrzeugs mit autonomer Fahrfunktion mitgeteilt werden, ob die Fahrt wie geplant verläuft oder ob sich das Fahrzeug in einen risikominimalen Zustand versetzt hat. Bei Störungen muss es für die Fahrzeuginsassen die Möglichkeit geben, mit der Technischen Aufsicht in Verbindung zu treten. Schließlich muss sichergestellt werden, dass für die Passagiere die Möglichkeit besteht, die autonome Fahrfunktion gemäß § 1e Abs. 2 Nr. 8 StVG zu deaktivieren und das Fahrzeug so durch Überführung in den risikominimalen Zustand anzuhalten. Es zeigt sich, dass Hersteller von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion neue Bedienkonzepte für die Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Mensch entwickeln müssen.
3. Zusammenfassung
Das HMI liegt als Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Fahrer schon seit jeher im Fokus der Hersteller, wenn es um die Gestaltung des Fahrzeuginnenraums geht. Die stetige Weiterentwicklung der Fahrerassistenzsysteme bis hin zum automatisierten Fahren stellt dabei immer höhere Anforderungen an die Gestaltung des HMI und die Auffassung durch den Fahrer. Für den Fahrer muss klar sein, ob die hoch- oder vollautomatisierte Fahrfunktion aktiviert ist und einwandfrei funktioniert. Für besonders kritische Momente, wie eine Übergabe der Steuerung zurück an den Fahrer, wird das HMI darüber hinaus als die Schlüsselstelle gesehen. Ohne eine ausgereifte Konzeption des HMI ist der Erfolg von automatisierten Fahrsystemen gefährdet. Unklarheiten können zu Missinterpretationen und damit zu kritischen Situationen führen.
C. Schlussfolgerung
Es zeigt sich, dass die voranschreitende Automatisierung von Kraftfahrzeugen mit einer umfangreichen Sensorik und einer komplexen Technik einhergeht. Ziel der Automatisierung ist es dabei, den Fahrer immer weiter aus der Fahrzeugführung zu entlassen. Aus dieser Zielsetzung einerseits und der technischen Komplexität andererseits ergeben sich zwei wesentliche Regulierungsbereiche bezüglich der Automatisierung im Straßenverkehr:
Zunächst muss der nationale Gesetzgeber die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, unter denen eine Entbindung des Fahrers aus der Steuerungsverantwortung erlaubt ist.65
Zum anderen müssen die technisch komplexen Anforderungen an die Fahrzeugsteuerung im Rahmen von entsprechend ausgestalteten technischen Vorschriften im Genehmigungsverfahren geprüft und validiert werden.66
Der Übergang der Fahrzeugführung vom Mensch hin zum Fahrzeug ist Gegenstand von technisch geprägten Beschreibungen. Mit Blick auf die Schaffung von nationalen Rahmenbedingungen für den Einsatz von automatisierten und autonomen Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr stand der deutsche Gesetzgeber daher zunächst vor der Herausforderung, Merkmale und Beschreibungen der technischen Klassifizierungen in Gesetzesform zu gießen.67
1 Vgl. BMVI, Strategie automatisiertes und vernetztes Fahren, September 2015, S. 9; siehe auch Schulz, NZV 2017, 548 (548); Horner/Kaulartz, CR 2016, 7 (13); Jourdan/Matschi, NZV 2015, 26 (26).
2 Vgl. Jänich/Schrader/Reck, NZV 2015, 313 (313); in diese Richtung auch Jourdan/Matschi, NZV 2015, 26 (26); einschränkend dann aber Schrader, DAR 2016, 242 (242), der die Vision Zero als „Illusion“ und grundsätzlich als unerreichbar ansieht.
3 So der damalige Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt im Rahmen einer Testfahrt mit einem autonomen Audi A7 auf der A9, http://www.golem.de/news/realbedingungen-audi-a7-faehrt-autonom-auf-der-a9-1504-113441.html (zuletzt abgerufen am 31.08.2023).
4 Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2003 (BGBl. I S. 310), zuletzt geändert durch Art. 16 Gesetz zur Anpassung von Gesetzen und Verordnungen an die neue Behördenbezeichnung des Bundesamtes für Güterverkehr vom 02.03.2023 (BGBl. I Nr. 56); im Folgenden „StVG“.
5 Achtes Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes vom 16.06.2017 (BGBl. I S. 1648).
6 Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes – Gesetz zum autonomen Fahren vom 12.07.2021 (BGBl. I S. 3108).
7 Verordnung zur Genehmigung und zum Betrieb von Kraftfahrzeugen mit autonomer Fahrfunktion in festgelegten Betriebsbereichen (Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung – AFGBV) vom 24.06.2022 (BGBl. I S. 986), zuletzt geändert durch Art. 10 Verordnung zum Neuerlass der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften vom 20.07.2023 (BGBl. I Nr. 199); im Folgenden „AFGBV“.
8 Siehe weiterführend Matthaei/Reschka/Rieken et al., in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 1145ff.
9 Vgl. dazu Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26.
10 Siehe weiterführend Punke/Menzel/Werthessen et al., in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 351.
11 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26; Franke/Gehring, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 396.
12 Siehe weiterführend Franke/Gehring, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 396ff.
13 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26; zu den Stärken und Schwächen von Kamerasystemen im Automotive-Bereich siehe zusammenfassend auch Bengler/Dietmayer/Eckstein et al., in: Pischinger/Seiffert, Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, Kapitel 8.3.3.1, S. 1030f.
14 Siehe weiterführend Winner, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 260ff.; Bengler/Dietmayer/Eckstein et al., in: Pischinger/Seiffert, Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, Kapitel 8.3.1.1, S. 1021f.
15 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26.
16 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26.
17 Vgl. Winner, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 299.
18 Zu Stärken und Schwächen der Radar-Technik siehe weiterführend auch Bengler/Dietmayer/Eckstein et al., in: Pischinger/Seiffert, Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, Kapitel 8.3.1.4, S. 1026f.
19 Siehe auch Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26, wonach die entsprechenden Messwerte durch Wettereinflüsse kaum verfälscht werden.
20 Siehe Gotzig/Geduld, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 318; Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26.
21 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26; weiterführend Gotzig/Geduld, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 318ff.
22 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26.
23 Vgl. Gotzig/Geduld, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 319.
24 Siehe Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26.
25 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26 (und zur Veranschaulichung Abbildung 3 auf S. 24 unter Rn. 27); siehe weiterführend zu Stärken und Schwächen der Lidar-Technik auch Bengler/Dietmayer/Eckstein et al., in: Pischinger/Seiffert, Handbuch Kraftfahrzeugtechnik, Kapitel 8.3.2.2, S. 1028f.
26 Vgl. Noll/Rapps, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 257.
27 Siehe Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26; Noll/Rapps, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 252.
28 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26, mit Hinweis auf den Anwendungsfall „Parkassistent“.
29 Siehe weiterführend zur Standortbestimmung mittels GPS Steinhardt/Leinen, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 484f.
30 Siehe Steinhardt/Leinen, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 485; Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26.
31 Siehe Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26.
32 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26; Steinhardt/Leinen, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 485.
33 Siehe Steinhardt/Leinen, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 484.
34 Vgl. Steinhardt/Leinen, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 484.
35 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 26, unter dem Oberbegriff „Inertialsensoren“.
36 Siehe Steinhardt/Leinen, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 484.
37 Vgl. Steinhardt/Leinen, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 484.
38 Vgl. Jourdan/Matschi, NZV 2015, 26 (26).
39 Vgl. Gasser et al., Rechtsfolgen zunehmender Fahrzeugautomatisierung, S. 12.
40 In diese Richtung auch Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 28; Darms, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 450.
41 Siehe weiterführend zur Sensordatenverarbeitung Darms, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 442ff., und grundlegend Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 27ff.
42 Siehe auch Darms, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 441.
43 Vgl. Darms, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 440; Oppermann, in: ders./Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 3.2, Rn. 17; in diese Richtung auch Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 28.
44 Vgl. Darms, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 441.
45 Vgl. Darms, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 441.
46 Siehe Jourdan/Matschi, NZV 2015, 26 (29).
47 Vgl. Klanner/Ruhhammer, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 549.
48 Siehe Klanner/Ruhhammer, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 549.
49 Vgl. Klanner/Ruhhammer, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 542; siehe weiterführend zur Verkehrstelematik Kleine-Besten/Kersken/Pöchmüller et al. in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 1066ff.
50 Vgl. Klanner/Ruhhammer, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 542.
51 Siehe Klanner/Ruhhammer, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 542.
52 Siehe Jourdan/Matschi, NZV 2015, 26 (27).
53 In diese Richtung auch Jourdan/Matschi, NZV 2015, 26 (29).
54 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 24.
55 Siehe Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 24.
56 Siehe Jourdan/Matschi, NZV 2015, 26 (28); König, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 622.
57 Vgl. Kleinschmidt/Wagner, in: Oppermann/Stender-Vorwachs, Autonomes Fahren, Kap. 1.1, Rn. 31.
58 Vgl. König, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 625f.
59 Vgl. auch Jourdan/Matschi, NZV 2015, 26 (28).
60 Vgl. Jourdan/Matschi, NZV 2015, 26 (28).
61 Vgl. Bruder/Didier, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 635.
62 Vgl. Bruder/Didier, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 637.
63 Vgl. Bruder/Didier, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 637.
64 Vgl. Bruder/Didier, in: Winner/Hakuli/Lotz/Singer, Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S. 637.
65 Siehe hierzu Teil 3 Kapitel A.
66 Siehe hierzu Teil 3 Kapitel B.
67 Siehe hierzu sogleich Teil 2.
Teil 2: Von der technischen Klassifizierung zur gesetzlichen Definition
Beim automatisierten Fahren wird zwischen verschiedenen Stufen der Automatisierung unterschieden, welche von bloßen Assistenzsystemen über automatisierte Fahrfunktionen bis hin zum autonomen Fahren reichen. Die Unterteilung der Automatisierungsgrade ist für die rechtliche Auseinandersetzung von erheblicher Bedeutung. Mit steigendem Automatisierungsgrad nimmt die Einwirkung des Fahrers auf die Steuerung ab. Der Umfang der Automatisierung ist für die Beantwortung der Frage nach der Zulässigkeit der Benutzung von automatisierten Systemen und im Rahmen deren Zulassung für den Straßenverkehr von entscheidender Bedeutung. Auch mit Blick auf die zivilrechtliche Haftung, welche überwiegend auf Verantwortungsbereiche und Verschulden abstellt, ist die Unterscheidung von Automatisierungsstufen relevant.
Die trennscharfe Klassifizierung und eine einheitliche Benennung ist nicht zuletzt auch für den wissenschaftlichen Diskurs unerlässlich.68 Die Ergebnisse in wissenschaftlichen Veröffentlichungen müssen von einer einheitlichen Basis ausgehen. Dies lässt sich nur durch eine klare Nomenklatur und ein übereinstimmendes Verständnis von den technischen Systemen, welche Gegenstand der jeweiligen Untersuchung sein sollen, erreichen. Der Fokus in diesem Kapitel liegt dabei nicht nur auf der Einteilung von Automatisierungsgraden, wie sie sich in der deutschen Diskussion herausgebildet hat. Es soll darüber hinaus auch die parallele Entwicklung im US-amerikanischen Raum dargestellt werden.
Die wegbereitenden Klassifikationen haben schließlich auch gesetzliche Definitionen zum automatisierten Fahren sowohl in Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten entscheidend beeinflusst. Die gesetzliche Definition der hoch- oder vollautomatisierten Fahrfunktion sowie der autonomen Fahrfunktion stellen Kernaspekte der StVG-Novellen dar und sollen vor dem Hintergrund ihrer zugrunde liegenden technischen Klassifikation bewertet werden. Für die Vereinigten Staaten werden Definitionen der Bundesstaaten Kalifornien, Arizona und Florida erläutert. Dabei soll die deutsche Definition auch mit Blick auf die ausgewählten US-amerikanischen Definitionen auf den Prüfstand gestellt werden.
68 So auch May, in: 53. Deutscher Verkehrsgerichtstag, S. 82; vgl. auch Hartmann, PHi 2016, 114 (114); Gasser, DAR 2015, 6 (7); Wolfers, RAW 2017, 2 (3); in diese Richtung auch Hilgendorf, JA 2018, 801 (801).
A. Entwicklung in Deutschland
In Deutschland wurden das Potential und die enorme Relevanz von automatisierten Fahrsystemen im Bereich der Automobilbranche früh erkannt. Expertengremien, ausgestattet mit Fachkompetenz aus Wirtschaft und Verwaltung, haben sich bereits vor über zehn Jahren mit der Automatisierung im Straßenverkehr auseinandergesetzt und eine Klassifizierung der Automatisierung entwickelt.69 Der durch die Klassifizierung von Automatisierungsstufen bereitete Weg mündete schließlich in einer gesetzlichen Definition. Durch § 1a Abs. 2 StVG wurde vom Gesetzgeber verbindlich festgelegt, was unter einem Kraftfahrzeug mit hoch- oder vollautomatisierter Fahrfunktion zu verstehen ist.70 Dem technischen Fortschritt Rechnung tragend, wurde mit der StVG-Novelle 2021 zuletzt auch das Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion im Sinne von § 1d Abs. 1 StVG definiert.71
69 Siehe dazu sogleich unter Punkt I.
70 Siehe dazu unten unter Punkt II.
71 Siehe dazu unten unter Punkt III.
I. Klassifizierung im nationalen Diskurs
Zunächst soll der in Deutschland zurückgelegte Weg zu einer einheitlichen Klassifizierung nachvollzogen und die dabei herausgebildeten Hauptmerkmale zur Unterscheidung der Automatisierungsgrade aufgezeigt werden. Sodann werden die einzelnen Stufen erläutert, wobei auf die zwingend zu beachtende begriffliche Differenzierung zwischen „automatisiert“ und „autonom“ hingewiesen wird.
1. Die Entwicklung einer Klassifizierung in Deutschland
Deutsche Expertengremien nahmen weltweit eine Vorreiterrolle bei der Klassifizierung der Automatisierungsstufen ein. Es wurde hierbei der Ansatz verfolgt, den Grad der Automatisierung zunächst zu identifizieren, zu beschreiben und letztlich in Stufen einzuteilen. Die Mitglieder der Gremien befassten sich von Beginn an mit der Einteilung einer voranschreitenden und sich entwickelnden Automatisierung von Fahrzeugen. Erst durch diese Grundlagenarbeit wurde eine (rechts)wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem komplexen Themenfeld der Automatisierung im Straßenverkehr ermöglicht.
a) Projektgruppe der Bundesanstalt für Straßenwesen
Bereits im Jahr 201072 hat sich eine Projektgruppe der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) mit Rechtsproblemen zunehmender Fahrzeugautomatisierung befasst und in diesem Zusammenhang erstmals im Rahmen einer rechtlichen Auseinandersetzung automatisierte Fahrfunktionen klassifiziert.73 Die Ergebnisse wurden im Schlussbericht zu den „Rechtsfolgen zunehmender Fahrzeugautomatisierung“ in der Reihe „Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen“ im Jahr 2012 veröffentlicht.
Die Fachgruppe identifizierte verschiedene Stufen, welche eine steigende Automatisierung abbilden. Die nicht abschließende Benennung reichte vom nicht assistierten Fahren „Driver Only“ über die Stufen „Assistiert“, „Teilautomatisiert“, „Hochautomatisiert“ bis hin zu „Vollautomatisiert“ als höchste Form der Automatisierung.74 Die Entwicklungsstufe „Autonom“ wurde von der Einteilung nicht erfasst. Neben der Benennung der einzelnen Stufen erarbeiteten die Experten der BASt-Gruppe auch eine Beschreibung der vom Fahrzeug entsprechend des Automatisierungsgrades übernommenen Fahraufgabe und der vom Fahrer erwarteten Überwachung des Systems.75 Diese Beschreibung wurde schließlich durch beispielhafte Anwendungen praxisnah veranschaulicht.76 Abgerundet wurden die Ergebnisse der BASt-Gruppe durch eine Tabelle, welche die wesentlichen Aspekte der jeweiligen Automatisierungsstufe übersichtlich zusammenfasst.77
b) „Runder Tisch Automatisiertes Fahren“
Im November 2013 wurde vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) der „Runde Tisch Automatisiertes Fahren“ ins Leben gerufen.78 Der „Runde Tisch“ soll Vertretern aus Wirtschaft und Verwaltung sowie anderen Interessenvertretern eine Plattform zum fachlichen Austausch bieten und dem BMVI zu Fragen des automatisierten Fahrens beratend zur Seite stehen.79
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Forschung“ des „Runden Tischs“ setzten sich detailliert mit relevanten Themen rund um das automatisierte Fahren auseinander und veröffentlichten im Jahr 2015 ihre Ergebnisse im Rahmen des Berichts zum Forschungsbedarf80. Dabei wurde die Einteilung der BASt-Gruppe ausdrücklich aufgegriffen und den Beratungen zugrunde gelegt.81 Die Benennung der einzelnen Automatisierungsstufen wurde vom „Runden Tisch“ dabei unverändert übernommen.82 Auch die von der BASt-Gruppe entwickelte tabellarische Übersicht zur Veranschaulichung der Automatisierungsgrade wurde vom „Runden Tisch“ fast unverändert der eigenen Arbeit als Anlage beigefügt.83 Insgesamt wurden also die Ergebnisse der BASt-Gruppe bezüglich der von ihr erarbeiteten Nomenklatur und der Beschreibung der einzelnen Stufen durch den „Runden Tisch Automatisiertes Fahren“ bestätigt und fortgeführt.
c) Juristischer Diskurs und Veröffentlichungen von Interessenverbänden
Im nationalen rechtswissenschaftlichen Diskurs hatten sich infolgedessen bereits früh eine gefestigte Nomenklatur und eine Abstufung der Automatisierungsgrade etabliert. Es wurde überwiegend auf die von der BASt-Projektgruppe erarbeitete und vom „Runden Tisch“ fortgeführte Klassifizierung abgestellt.84 Soweit in juristischen Abhandlungen diese Abstufung zugrunde gelegt wird, wird die Klassifizierung unverändert übernommen und nicht etwa modifiziert. Teilweise werden allerdings weitere Anwendungsfälle einzelner Automatisierungsstufen beispielhaft genannt und so die theoretische Beschreibung der jeweiligen Stufe praxisnah veranschaulicht.
Eine zukunftsträchtige und gesellschaftspolitisch wichtige Thematik wie die Automatisierung im Straßenverkehr ruft auch Interessenvertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft auf den Plan. In Stellungnahmen und Positionspapieren setzten sich diese Institutionen mit dem automatisierten Fahren auseinander. Sofern in den Veröffentlichungen die Automatisierungsstufen erläutert werden, lässt sich durchweg die von der BASt und dem „Runden Tisch“ entwickelte Abstufung erkennen. Beispielhaft sei auf die vom Verband der Automobilindustrie (VDA) dargestellte Entwicklung der Automatisierung „Von Fahrerassistenzsystemen zum automatisierten Fahren“ verwiesen.85 Für Veröffentlichungen von Interessenverbänden gilt also das Gleiche wie für die juristische Literatur: Es wurde keine neue Einteilung entwickelt. Vielmehr werden im Rahmen der Automatisierungsstufen die Ergebnisse der Projektgruppe der BASt und des „Runden Tischs“ zugrunde gelegt und zum Teil mit zusätzlichen praxisnahen Anwendungsfällen und Grafiken veranschaulicht.
Abschließend kann festgehalten werden, dass die Veröffentlichungen im wissenschaftlichen Diskurs und die Dokumente der Interessenverbände durch die Übernahme der Klassifizierung entscheidend zu einer gefestigten Nomenklatur und Einteilung der Automatisierungsstufen beigetragen haben.
2. Hauptkriterien zur Differenzierung der Automatisierungsstufen
Setzt man sich detailliert mit Veröffentlichungen zum automatisierten Fahren auseinander, so offenbaren sich durchwegs die gleichen Kriterien, welche zur Differenzierung der Stufen der Automatisierung herangezogen werden. Dies gilt insbesondere für die wegbereitenden Veröffentlichungen der Expertengremien. So lassen sich aus den Dokumenten der BASt-Gruppe und des „Runden Tischs“ zwei Hauptkriterien herauslösen, welche zur Identifizierung und Einstufung des jeweiligen Automatisierungsgrades herangezogen werden.86
a) Übernommene Fahraufgabe
Zum einen kann vom Umfang der durch das System übernommenen Fahraufgabe auf den Grad der Automatisierung geschlossen werden.87 Die Fahraufgabe lässt sich dabei in die Längsführung und die Querführung des Fahrzeugs aufteilen. Unter der Längsführung ist das Beschleunigen und Abbremsen des Fahrzeugs zu verstehen. Auf die Querführung wird durch das Lenken des Fahrzeugs eingewirkt.
Je umfangreicher das System die Fahraufgabe übernehmen kann, desto höher ist der anzunehmende Automatisierungsgrad des Fahrzeugs. Das heißt, dass ein System, welches sowohl die Längs- als auch die Querführung gleichzeitig ausführen kann, weiter entwickelt ist als ein System, das lediglich nur den einen Teil der Fahraufgabe ausführen kann. Außerdem scheint man auch mit Blick auf die mögliche Dauer der Ausführung der Fahraufgabe durch das System auf den Automatisierungsgrad schließen zu können.88
b) Pflicht zur Überwachung
Zum anderen wird der Automatisierungsgrad mit Blick auf die Pflicht des Fahrers zur Überwachung des Systems und seine Verpflichtung zur Übernahme der Fahraufgabe beschrieben. Umso mehr sich der Fahrer auf das System verlassen darf und dementsprechend weniger überwachen muss, desto höher wird regelmäßig der Grad der Automatisierung sein.89
3. Angabe des Automatisierungsgrades
Um den Grad der Automatisierung anzugeben, haben sich zwei Varianten herausgebildet, welche parallel nebeneinander verwendet werden können. Zum einen kann der Automatisierungsgrad eines Systems anhand seiner Bezeichnung, wie beispielsweise „teilautomatisiert“, wiedergegeben werden. Zum anderen bietet sich parallel dazu eine entsprechende aufsteigende numerische Staffelung der Automatisierungsstufen an. Ob in Bezug auf diese numerische Staffelung dann von „Stufe 2“, „Level 2“ oder „Ebene 2“ die Rede ist, macht keinen Unterschied. Solange die Zählung mit der Bezeichnung der Automatisierung korrespondiert, folgen hieraus keine Unterscheidungsschwierigkeiten oder Unschärfen.
Hartmann erachtet die numerische Einteilung anhand von Level im juristischen Diskurs dagegen nur bedingt für sinnvoll.90 Diese Ansicht lässt sich allerdings nicht klar nachvollziehen. Zwar betont Hartmann zu Recht, dass gerade der juristische Diskurs von einer begrifflichen Klarheit getragen wird und unterschiedliche Bezeichnungsvarianten dieser abträglich sein können.91 In Bezug auf die Automatisierungsstufen hat sich allerdings neben einer einheitlichen Nomenklatur auch eine numerische Staffelung gefestigt. Mit Blick auf die mittlerweile zahlreich erschienenen Veröffentlichungen, welche sich unter anderem mit den Stufen der Automatisierung auseinandersetzen92, kann festgestellt werden, dass eine numerische Staffelung als allgemein anerkannt gilt. Zudem wurde selbst in der Begründung des Regierungsentwurfs zum StVG-Ä 2017 parallel auf die numerische Zählung der Automatisierungsstufen verwiesen. Die numerische Wiedergabe der Automatisierungsstufe wird dort zur Erläuterung sogar in den Vordergrund gestellt. So wird auf die „technischen Entwicklungsstufen 3 (hochautomatisiert) und 4 (vollautomatisiert)“93 abgestellt und auf die Ergebnisse des „Runden Tischs“ verwiesen.
Da sich parallel zur Nomenklatur eine übereinstimmende numerische Zählung der Stufen entwickelt hat, besteht keine Gefahr für eine Verwässerung von Begrifflichkeiten und damit für Unklarheiten. Der Verweis von Hartmann darauf, dass die numerische Zählung eher dem technischen Bereich zuträglich sei, geht letztlich in dem Umstand auf, dass gerade die Thematik des automatisierten Fahrens besonders von der interdisziplinären Ausrichtung des Themas und dessen Überschneidung mit technischen Aspekten durchdrungen ist.
4. Erläuterung der Stufen auf Grundlage der BASt-Klassifikation
Nach dem Überblick über die Entwicklungsgeschichte und den vorbereitenden Ausführungen sollen im Folgenden die einzelnen Automatisierungsstufen näher erläutert werden. Durch die verschiedenen Stufen wird ein stetig steigender Automatisierungsgrad abgebildet.
a) Stufe 0: Driver Only
Wenn die Expertengruppe der BASt ein „herkömmliches manuelles Fahren“ beschreibt und diese Kategorie als „Driver Only“ bezeichnet94, wird deutlich, dass auf dieser Stufe noch nicht von einer Automatisierung die Rede sein kann. Die Umschreibung als „herkömmliches Fahren“ trifft den Kern der Sache sehr gut. Der Fahrer fährt eben noch selbst. Er entscheidet, in welche Richtung sich das Fahrzeug bewegen soll und lenkt und bremst selbstständig. Weder das Lenken noch das Bremsen wird ihm abgenommen.95 Da auf der Stufe „Driver Only“ also gerade keine Automatisierung der Fahraufgabe zu verzeichnen ist und der Fahrer die komplette Fahraufgabe selbst bewältigen muss, bietet sich als Bezeichnung die „Stufe 0“ an. Sie ist als Ausgangspunkt zu sehen und bildet die Basis für die folgenden Automatisierungsgrade.
Dagegen bezeichnen Fleck/Thomas mit Verweis auf die BASt-Nomenklatur die Driver-Only-Kategorie ausdrücklich als „erste Stufe“96. Gerade die Tabelle des BASt97 verleitet zu dieser Aussage, da an erster Stelle der Tabelle den automatisierten Fahrfunktionen die Driver-Only-Kategorie vorangestellt wird.
Mit Blick auf die Nummerierung nach dem „Runden Tisch“ und der Gesetzesbegründung, wonach die Stufe „Hochautomatisiert“ jedoch als Automatisierungsstufe 3 zu werten ist, ist mit der Kategorie „Driver Only“ lediglich die Stufe 0 vereinbar. Es ist davon auszugehen, dass mit dem Bezug auf die „erste Stufe“ bei Fleck/Thomas keine verbindliche Aussage über die Nummerierung der Automatisierungsstufen gemacht werden sollte. Weitere Bezüge zu einer etwaigen numerischen Staffelung der Stufen finden sich in diesem Aufsatz jedenfalls nicht. Damit steht im Ergebnis der Bezeichnung „Driver Only“ als „Stufe 0“ keine gegenteilige Auffassung in der Literatur entgegen.98





























