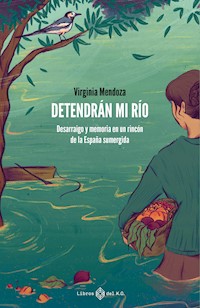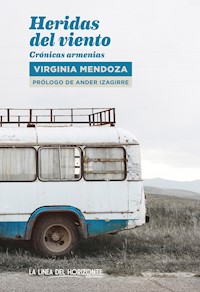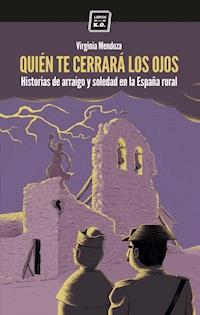21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Suche nach Wasser erzählt die Geschichte der Menschheit als getrieben von Durst. Virginia Mendoza kombiniert darin persönliche Erfahrungen am trockensten Ort Europas mit einer ansteckenden Neugier für die Ergebnisse anthropologischen Forschens. So entsteht eine packende, einmalige Zivilisationsgeschichte, die den Blick auf das Wasser und sein Ausbleiben grundlegend verändert.
Ihre ersten Erinnerungen handeln von der Trockenheit. Denn Virginia Mendoza wächst in La Mancha, Spanien, auf, in der trockensten Region Europas. Vater, Mutter, Großeltern, dazu fast jedes Wort, Werkzeug oder Tradition ihrer Heimat vermitteln eine Überzeugung: Ohne Wasser kein Leben, ohne Wasser keine Zivilisation. Als Virginia Mendoza schließlich fort geht und Anthropologie studiert, wird diese über Generationen tradierte Einsicht zum Leitgedanken ihres wissenschaftlichen Arbeitens. Intensiv befragt sie fortan die Geschichte der Menschheit nach den Auswirkungen von Dürre, Durst und Wasserknappheit. Und entwickelt eine Perspektive, aus der jede unserer Wegmarken – seien es Migrationsströme, Ackerbau, der Blick in die Sterne, das Brot, die ersten Städte, Schriften, Wissenschaften – als eine Etappe auf der Suche nach Wasser erscheint.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Virginia Mendoza
Die Suche nach Wasser
Eine Menschheitsgeschichte
Aus dem Spanischen von Maria Meinel
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel La sed. Una historia antropológica (y personal) de la vida en tierras de lluvia escasa bei Debate, Madrid.Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Förderung ihrer Arbeit mit einem Stipendium.
eBook Insel Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2025.
© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2025© Virginia Mendoza, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Anzinger und Rasp, München
Umschlagabbildung: Ashlee Jenna Gillespie, Smith River
eISBN 978-3-458-78298-8
www.insel-verlag.de
Widmung
Für Dani,
der mich wieder zum Schreiben brachte
Für eine Großmutter Francisca,
die hier in der Vergangenheit und in der Gegenwart erscheint und die letzte Frage
unbeantwortet ließ
Für meine Eltern und meinen Bruder,
mit denen ich den Durst teilte
Im Gedenken an Fati und Marie, Mutter und Tochter,
die in der libyschen Wüste verdursteten,
als ich dieses Buch vollendete
Motto
Von welcher Urwüste bist du Erinnerung
dass du dürstest und in Wasser dich verzehrst
und deinen toten Leib gen Weltenall erhebst
als fiele dein Wasser vom Himmel?
Alfonsina Storni
Die Männer befeuchteten sich die Lippen,
sie wussten um ihren Durst.
Alle befiel ein leichtes Grauen.
John Steinbeck
»Mein Wort, lieber Herr, das Gras kann nur bedeuten,
dass nahebei ein Bach sein muss oder eine Quelle,
die das Gras bewässert. Lasst uns ein Stück weiterziehen,
dann kommen wir bestimmt an eine Stelle,
wo wir den Durst stillen können, der uns so schrecklich plagt,
denn der quält zweifellos noch mehr als jeder Hunger.«
Sancho Panza
Natürlich gibt es Gott.
Er ist weiblich
und heißt Regenwolke.
Gustavo Duch
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Inhalt
Prolog
I Die Reise des Dursts
1Himmelsspeck
2
Homo sitibundus
: Die große Reise
3Wasser erfahren (und erfassen)
4Auf den Regen warten
5Unter trockener Erde
II Den Regen kontrollieren
6Die Hörner des Himmels
7Und Gott stieg herab zur Erde
8Der Regenmacher
9Durst, Aufruhr, Sakrileg
10Füße auf dem Boden, Blick nach oben
Epilog – Exodus der Durstigen
Bibliographie
Danksagungen
Informationen zum Buch
Prolog
Noch war nicht genügend Zeit vergangen, da merkte ich, dass ich durstig war, aber kein Wasser dabei hatte. Ich wollte eine Weile warten, bevor ich auf die Suche ging, doch dann erinnerte ich mich, dass es Dinge wie Durst, Tod oder Liebe gibt, denen man nicht entrinnen kann; früher oder später würde ich gehen müssen.
Núria Bendicho Giró,
Tierras muertas
Weder möchte, noch kann ich jenen Ort in La Mancha vergessen, an dem ich den Durst kennenlernte. Im Hof meiner Großeltern mütterlicherseits wartete eine von Töpfen und Schöpfkellen umringte alte Wanne auf den Regen. Die Wasser des nahen Flusses Villanueva wurden knapp und erreichten nicht mehr die Gärten und Felder von Villanueva de la Fuente (Provinz Ciudad Real). Manche Bauern verloren die Ernte, eine Frau musste gar ihre Kühe verkaufen. Auch die Trinkwasserversorgung war in Mitleidenschaft gezogen. Der Grundwasserleiter 24 (der vom Campo de Montiel), der den Fluss speiste, lag praktisch trocken. Obwohl den Bauern gesagt wurde, dass der ausbleibende Regen daran schuld sei, ahnten sie seit geraumer Zeit, dass da noch anderes im Spiel war. Inmitten der Trockenheit, während die eigenen Feldfrüchte verdorrten, wuchsen auf den fast eintausend Hektar Land eines Herzogs dank einer modernen Bewässerungsanlage prächtige Maiskolben heran. Im August 1987 organisierten die Einwohner von Villanueva de la Fuente und anderer Dörfer wie Albaladejo, Villahermosa und Montiel eine Protestaktion. Sie zogen mit umgedrehten Wasserkrügen und Transparenten mit Aufschriften, auf denen »Wir haben Durst« und »Wir wollen unser Wasser« stand, zum Landgut des Herzogs. Es änderte sich nichts.
Längst überzeugt, dass ihr Durst wenig mit dem ausbleibenden Regen zu tun hatte, kippten die Bewohner von Villanueva am 15. August, einem Samstag, vier der Masten um, die Strom zum Herrengut führten. Am Sonntagmorgen, als sie sahen, dass die Arbeiter der Stromunion im Begriff waren, die Masten zu reparieren, stürzten sie die vier Masten abermals um, und neunzehn andere auch. »Wer war das?« »Wir waren es alle, Herr«, sagten sie. Etwa dreitausendfünfhundert Menschen lebten das ganze Jahr im Dorf, Mitte August waren es sehr viele mehr, doppelt so viele. Sie inszenierten ihr eigenes, unblutiges Fuenteovejuna: »Es gibt hier keinen Anführer, wenn es das ist, was Sie wissen wollen; wir sind das ganze Dorf, und wenn sich erwartungsgemäß herumsprechen sollte, dass Sie die Strommasten wieder aufstellen, werden wir alle wie eine Lawine anrollen und das verhindern, aber wir werden mit bloßen Händen kommen, ohne Waffen, wir wollen ja keine Gewalt, wir fordern nur das, was uns gehört: das Wasser«, sagte einer der Befragten auf dem Dorfplatz zu Luis Otero. Der Journalist war gekommen, um sich nach der Frau zu erkundigen, die ihre Kühe verkauft hatte. Eigentlich hieß sie Julia, aber in jenen Tagen fingen ihre Nachbarn an, sie Agustina de Aragón zu nennen. Sie war eine widerständige Alte, die andere mit ihren selbstgeschriebenen Liedchen ansteckte und sich damit zur Wortführerin und auch zur Chronistin des Dorfaufstandes machte.
Was ein Bewohner von Villanueva de la Fuente gegenüber El País sagte, fasst das Geschehen im Dorf zusammen: »Seit Gottes Zeiten gehörte das Wasser uns, bis dieser Mann die Bewässerung für seinen Mais baute«. Sie gaben dem Sohn des Herzogs die Schuld für ihren Durst, weil er ein paar Brunnen von fast hundertfünfzig Metern geschlagen hatte, die an ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem angeschlossen waren und allen das Wasser raubten. Auch den Viehzüchter vom Hof daneben hatten sie im Visier. »Wir sagten: Klar gibt es Dürre, aber es sind die Landgüter, die den Quellen und den Seen von Ruidera Schäden zufügen«, erzählte Bürgermeister Juan Ángel Amador, der sich gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit dem Wasserkrieg herumärgern musste. Sogar die Bereitschaftspolizei sei angerückt, es heißt, mit zweihundert Mann. Die protestierenden Anwohner konterten so gut, dass man den Wächtern applaudierte, als der Bürgermeister die Reparatur der Masten schließlich stoppte. Und dann führte der Fluss wieder Wasser. Und die Justiz gab ihnen Recht: Zwei Jahre später wurde bestätigt, dass am Grundwasserleiter Raubbau getrieben worden war.
In jenem Sommer trat die Bereitschaftspolizei noch in einem weiteren Dorf ins Rampenlicht. Während man sich in Villanueva dagegen gewehrt hatte, die Stromleitungen reparieren zu lassen, kletterten die Einwohner von Riaño (Provinz León) auf die Dächer ihrer Häuser und weigerten sich herabzusteigen. Es war der verzweifelte Kampf gegen eine Vertreibung, die sie nicht aufhalten konnten und die in der Überflutung ihres Dorfes und acht weiterer Dörfer der Gemeinde mit den Wassermassen des Stausees gipfelte, welcher der Bewässerung und der Stromerzeugung dienen sollte.
Die Pressebilder aus jenem Sommer illustrieren, dass die Dürstenden und die Ertrinkenden nicht selten eine gemeinsame Geschichte haben, sie sind zwei Seiten einer Medaille. In Villanueva stieg ein Kind aus Protest in ein ausgetrocknetes Flussbett hinab, im anderen Dorf stieg eines aufs Hausdach, um die Überflutung seines Dorfes zu stoppen. Beide wurden porträtiert.
Der Durst aber blieb, er kommt niemals nur auf Stippvisite; bald kehrte er mit einer neuen Dürre zurück. In Spanien und anderen Mittelmeerländern gibt es in jedem Jahrzehnt zyklische Dürreperioden, die meist drei oder vier Jahre andauern. Im Sommer 1992, als ganz Spanien entweder Siesta hielt oder hoffte, dass Miguel Induráin zum zweiten Mal die Tour de France gewann, dachten wir in meinem Dorf Terrinches noch immer nur an Wasser, und an fast nichts sonst. An das ausbleibende Wasser, an das Wasser, das uns vertreiben könnte, wenn es noch knapper würde. Die Erwachsenen lebten damals am Rande der Verzweiflung, und da lernte ich Wasser so zu schätzen, wie man nur Dinge schätzt, die verloren gehen. Es wurde zu einem Wunder, das eine Zeit lang nur mit Hilfe von Tankwagen und den Händen meines Großvaters Norberto geschah. Noch heute stehen Tanks auf den Terrassen des Dorfes, falls sich das wiederholt.
Da mir die Abwesenheit von Durst heute normal erscheint, hüte ich die Erinnerungssplitter von damals, solche, die den eigentlichen Erinnerungen, in denen Wasser vorkam, vorausgingen. Es sind Szenen, die ihre Spuren hinterließen, weil Wasser normalerweise fehlte: Mein Großvater, in eine Höhle gezwängt, auf der Suche nach Wassertropfen, die er dann in eine Zisterne leitete, um den Gemüsegarten zu bewässern. Mein Großvater auf dem Weg vom Gemüsegarten zum Hof, um sich mit einer Schöpfkelle zu waschen. Das Wannenwasser, in das die ganze Familie stieg, weil man es mehrfach und bis zum letzten Tropfen nutzen musste. Fehlte nur noch, die Luft herauszupressen. Alles diente dazu, Wasser aufzufangen, das kaum vom Himmel fiel und das später manchmal als Schatz aufbewahrt wurde, auch wenn es zu fast nichts mehr zu gebrauchen war. Vielleicht habe ich deshalb ein so klares Bild von den Kaulquappen, die in einem Benzinkanister zur Welt kamen und sich dort vermehrten. Jene Dürre, die bis 1995 anhielt, ließ das Wasser in spanischen Stauseen auf bloße 15% schrumpfen und den gemauerten Brunnen, aus dem das Dorf seit Jahrhunderten getrunken hatte, versiegen. Während meine Nachbarn in ein anderes Dorf gingen und die Heiligen um Regen baten, erwogen andere, einen Eisberg mit Schleppschiffen zum Guadalquivir zu bringen, zu dessen Wassereinzugsgebiet Terrinches gehört, um die Wassermenge des Flusses zu erhöhen. Entweder das – oder ein Umzug in die nahe Provinz Sevilla. Die Idee, einen Eisberg zu verschleppen, war nicht neu, das plante man inmitten einer Dürre fast zwei Jahrzehnte vorher schon in Benidorm.
Im Roman Mondwind erzählt Antonio Muñoz Molina von einem Jungen, der von der Landung des Menschen auf dem Mond fasziniert ist und in einem Dorf in Jaén lebt, so trocken wie meins und unweit entfernt. Pedro, der Onkel des Protagonisten, hat die absurde Idee, auf dem Hof eine Dusche zu installieren. »Bei uns kann man sich nur in einer abgeplatzten Emailleschüssel waschen, in die wir einen Eimer eiskaltes Wasser aus dem Brunnen gießen. Fließendes Wasser ist für uns ein ebenso ferner Traum wie regelmäßig und reichlich strömender Regen auf unserem trockenen Land«, heißt es dort. In Terrinches gab es einen Seher, der behauptete, eine Dusche auf dem Hof zu haben, obwohl niemand fließend Wasser im Hause hatte. Fast alles, was Muñoz Molina über diese abgeplatzte Schüssel auf dem Hof und den anderen Kram vom Durst erzählt, erinnere ich, als wäre ich selbst in jenem Hause aufgewachsen. Auch wenn die Geschichte dreißig Jahre früher und an einem anderen Ort spielt, ist es doch die Geschichte der Wannen und Kochtöpfe, die des Regens harrten und im Hof meiner Großeltern die Hühner ersetzten. Ich habe sogar Fotos von meinen ersten Alleine-Bädern, nicht etwa, weil das einen Meilenstein der kindlichen Entwicklung bedeutete, sondern weil es ein Luxus war, der verewigt werden musste wie Ereignisse, von denen niemand weiß, ob und wann sie sich wiederholen.
Mein Großvater war der Wasserverantwortliche des Dorfes. Er fegte nicht nur die Straßen, pflanzte Bäume, vermeldete Verstorbene und brach den Rosenkranz, der ihre Füße bis zur Bestattung zusammenhielt, sondern kümmerte sich auch um den Durst der Lebenden. Er stieg am frühen Abend eine Metallleiter hinab in die Unterwelt, drehte am Hahn einer Zisterne und stellte das Wasser im Dorf ab – und das war etwas Neues. Meistens begleitete ich ihn. Es dauerte, bis fließend Wasser in die Häuser von Terrinches kam. Nur die Figurinen von Don Quijote und der Jungfrau von Luciana wurden in diesem Ort so verehrt wie der tönerne Trinkkrug, der Botijo, mit dem sie noch immer eine Dreifaltigkeit bildeten. An seinem altarähnlichen Platz wirkte der Krug imposant. Um keinen Tropfen seines Quellwassers zu verlieren, auch nicht an die Fliegen, stellte ihn meine Großmutter auf einen Teller und versah ihn mit einer maßgefertigten Häkelkappe an einem Band. Unsere Geschichte ist durch unsere Beziehung zum Wasser geprägt. In unserer Bindung daran aber lauert immer auch die Angst, dass es uns wieder verlässt.
Im Sommer 1992, trocken wie Dörrfisch, soll mein Großvater das Wasser im Dorf an manchen Tagen nur für eine halbe Stunde aufgedreht haben. Da musste man sofort duschen, Geschirr abwaschen, trinken. Manchmal blieb nicht einmal Zeit fürs Schnellprogramm der Waschmaschine. Und es waren meine Mutter und meine Tanten, die das Wasser an- und abstellten, während ihr Vater durchs Dorf lief und allen Bescheid gab. Ob es an der Eile jener Tage lag oder nicht: Ein halber kleiner Großvaterfinger blieb in der Tür des Speicherraums hängen, und jedes Mal, wenn Großvater mit seinem Taschenmesser Brot schnitt oder den Botijo zum Mund hob, sah ich seinen kleinen Fingerstumpen irgendwo dorthin zeigen, wo normalerweise das Dach oder ich waren. Wir witzelten über meine Großmutter, die sich nicht traute, die Waschmaschine zu benutzen, sie mit einer Häkelhaube abdeckte, um die Wäsche weiterhin von Hand zu waschen – mit ihrer eigenen Seife aus Öl und Natron. Heute weiß ich, dass der Kult um die Waschmaschine nicht nur auf der Angst beruhte, dass sie bei Benutzung explodieren oder kaputt gehen könnte.
Damals waren Privatvideos Mode, und im feuchten Teil Spaniens, jenem mit ausgeprägtem Kontinentalklima, filmte der bestürzt dreinschauende Paco Villalonga, wie sein Dorf Aceredo von Stauwasser geflutet wurde – mehr konnte er nicht mehr tun. Die Einwohner hatten sich im Rathaus verbarrikadiert und in Galicisch auf ihre Transparente geschrieben: »Wir sind im Hungerstreik; wir haben die Würde, die der spanischen Regierung fehlt« und »Salto des Alto-Lindoso. Tod und Zerstörung von 200 Familien. Rechtsverletzung. Menschenrechte, erhört uns!«. Aber erhört wurden sie nicht. Als ich fünf war, wusste ich nichts von alledem, später erzählte mir Paco, dass er jedes Mal, wenn der Pegel des Stausees sank, zu den Ruinen seines Hauses lief, ein Sandwich aß und zusah, wie Wasser aus einem kleinen Brunnen sprudelte, den nicht einmal der Stausee, diese große Grabplatte aus stehendem Wasser, hatte stoppen können.
Auf meine Nachfragen, wie es unserem Dorf damals ergangen sei, erfahre ich, dass uns schließlich ein Viehzüchter (derselbe, den man in Villanueva beschuldigt hatte) Zugang zu einem seiner Brunnen gewährte, und dass das Dorf seit 1995 – und dank finanzieller Zuschüsse des staatlichen Straßenbauamts zu den nötigen Kanalisations- und Versorgungsarbeiten, damit das Wasser zwanzig Kilometer überbrücken und ankommen konnte – zum großen Teil von diesem Wasser lebt. Die Geschichte wird mit Dankbarkeit erzählt. Doch der Ende August jenes Jahres unterzeichnete Überlassungsvertrag schließt mit den Worten: »Die Genehmigung kann aus jedem beliebigen, nicht zu rechtfertigenden Grund aufgehoben werden, wann immer es für angebracht gehalten wird, es genügt die bloße Ankündigung gegenüber der begünstigten Gemeinde zwei Monate im Voraus, wobei die Gemeinde kein Recht auf Einspruch oder irgendeine Form von Entschädigung hat.« Der Durst eines Dorfes hängt demnach fast ausschließlich vom Willen eines einzigen Mannes ab, oder besser gesagt von etwas, was nicht existiert: dem Willen einer Aktiengesellschaft.
Unser Durst ist der historische – der Durst der Dörfer des trockenen Spaniens, das drei Viertel der Halbinsel einnimmt, auf der ich lebe und auf der ein mediterranes Klima vorherrscht, in manchen Gegenden ist es sogar das der Steppen und Wüsten – und jener unserer entferntesten Ahnen. Hier, in dieser Region von Kastilien-La Mancha, kommen wir nicht einmal auf die vierhundert Liter pro Quadratmeter im Jahr, die dem Durchschnitt der gesamten autonomen Provinz entsprechen. Weggehen, weil es kein Wasser gibt; weggehen, weil Wasser kommt. Es ist ein Land der Durstigen und der vor Durst Ertränkten. Das ist die Geschichte, die in unseren Genen gespeichert ist und die wir vergessen, wenn wir den Wasserhahn aufdrehen. Aber sie kommt von früher, von weit her, und betrifft alle menschlichen Bewohner unserer Erde. Unsere Familie, unsere Gattung und unsere Art entstanden, als die Welt, als Ostafrika extreme Dürreperioden durchlief. Die ältesten Fossilien unserer Vorfahren wurden im Mittel- und Unterlauf eines afrikanischen Flusses, des Awash, gefunden; demnach entstanden auch die frühesten, von Trockenheit umgebenen Zivilisationen entlang von Flüssen. Durst führte im Laufe unserer Entwicklung zu bemerkenswerten Anpassungen des Stoffwechsels und der Anatomie, zu Innovationen, Revolutionen und Zusammenbrüchen. Auf den folgenden Seiten werden wir sehen, dass sich fast alles, was unsere Spezies ausmacht, während klimatischer, durch wechselnde Phasen von Feuchtigkeit und Trockenheit bestimmter Veränderungen herausbildete. Die x-te Klimakrise sollte uns also nicht verwundern: Wir sind deren Kinder. Vielleicht aber liegt in unserer Verwunderung eine gewisse Schuld.
Unsere Geschichte spielt im Känozoikum, einem Erdzeitalter, in dem sowohl unsere Vorfahren als auch fast alles, was uns bis heute ernährt, entstanden sind; sie beginnt zwar mit Lucy im Neogen, spielt aber hauptsächlich im Quartär, in dem wir uns noch heute befinden. Dieser Zeitraum umfasst zwei durch einen Klimawandel voneinander getrennte Epochen: das Pleistozän und das noch andauernde Holozän. In all dieser Zeit, über viele Millionen Jahre, gab es etliche trockene Kalt- und nasse Warmzeiten. Klimatische Zyklen gleichen Matrjoschkas. So kommt es, dass wir uns zwar in einer Phase der Erderwärmung befinden, die Erde aber seit etwa fünfzig Millionen Jahren kühler und trockener wird – ein Paradoxon, das die Leugnung des Klimawandels fraglos anheizt. Es folgten Schwankungen, die zu wiederholten Störungen innerhalb dieser globalen Entwicklung führten. Vor 2,6 Millionen Jahren geriet die Welt in einen konstanten Rhythmus von Kaltzeiten und Warmzeiten, und in dieser Zeit entstand der Mensch. Seit elftausendsiebenhundert Jahren befinden wir uns im Holozän, in einer Warmzeit, die wiederum auch kalte Phasen hat. Kurz: Die Erde erwärmt sich und kühlt sich gleichzeitig ab, so seltsam das auch scheinen mag. Das liegt zum großen Teil daran, dass wir in die natürliche Dynamik, der unser Planet seit dem Neolithikum folgt, eingegriffen haben – besonders in den letzten dreihundert Jahren.
Einige der wichtigsten klimatischen Veränderungen, die in diesem Buch beschrieben werden, wurden zwar extraterrestrischen Ursachen wie der Explosion von Kometen oder der Abnahme der Sonnenflecken zugeschrieben, aber wir werden auch sehen, dass sie vor allem astronomische Ursachen haben, die mit der Position der Erde, ihrer Stellung zur Sonne, der Form ihrer Umlaufbahn und der Neigung der Erdachse zusammenhängen. Viele klimatische Veränderungen dieser Zeit hatten aber auch geologische Gründe, wie die Plattentektonik, Erdbeben, Vulkanausbrüche und Änderungen der Meeresströmungen. Einige dieser Ursachen wirken wechselseitig, denn unser Klimasystem hängt von etlichen Faktoren ab: von der Atmosphäre, die uns nicht nur atmen lässt, sondern mittels ihrer Treibhausgase eine Durchschnittstemperatur von fünfzehn Grad Celsius aufrechterhält; vom Treibhauseffekt, der – in seiner natürlichen Form – die von der Erde aufgenommene und die von ihr abgegebene Strahlungsenergie ausgleicht, den wir aber künstlich verstärkt und damit die Erderwärmung beschleunigt haben; von den Meeresströmungen, die durch ihre Wechselwirkung mit der Atmosphäre ihrerseits zu diesem Gleichgewicht beitragen; und schließlich von der Sonneneinstrahlung. Zu all diesen Faktoren müssen wir einen neuen Auslöser hinzufügen: uns und unser Handeln.
Das Klima hätte uns fast ausgerottet: Wir sind Nachkommen der nur etwa 1300 Menschen, die die Kälte und Trockenheit vor weniger als zweihunderttausend Jahren überlebt hatten. Auch bei der letzten Eiszeit kamen wir nicht gut weg, obgleich wir Sapiens als einzige verschont blieben. Dennoch sollte es bis 1988 dauern, ehe der Klimawandel von der Politik aufgegriffen wurde. In jenem Sommer herrschten in den Vereinigten Staaten sengende Hitze und Trockenheit. Brände breiteten sich aus. Die Verzweiflung im US-Senat angesichts der unerträglichen Hitze brachte das Thema der globalen Erwärmung schließlich an die Öffentlichkeit. In Ländern wie Spanien dagegen war es noch lange verpönt, übers Wetter zu sprechen; es gilt noch immer als Smalltalk-Thema, etwa um die unangenehme Zeit mit Fremden in einem Aufzug zu überbrücken. Das Wetter aber, das uns so unbedeutend schien, war einer der Gründe, warum einige unserer Vorfahren an jenen Ort kamen, an dem wir geboren wurden, und deren Vorfahren – lange vorher – Afrika verlassen mussten.
Wir können das Klima ignorieren und seine Schwankungen leugnen, das wäre etwa so, als würden wir den gemeinsamen Urvorfahr LUCA (Last Universal Common Ancestor) leugnen, weil wir nicht von einem Bakterium abstammen wollen, als würden wir nicht akzeptieren, dass wir selbst Teil einer veränderlichen Natur sind. Klimawechsel begleiten uns seit jeher und waren uns Antrieb für Entwicklung, Migration, Neuerungen und Vermischung unserer Gene. Sie sind ein Teil von uns und wir sind ein Teil von ihnen. Die kognitive Wende legte den Grundstein für unsere heutige Freiheit. Aber Freiheit bedeutet auch Verantwortung. Die Kultur versprach uns – mit dem Segen der Natur – eine Unabhängigkeit, die grenzenlos schien. Aber das war sie nicht. Das Wetter spielt nicht verrückt; ziehen wir uns aus der Verantwortung, werden wir uns von der Freiheit nur weiter entfernen und uns noch verwundbarer machen. Das kann sogar zu einem Genozid führen, für den wir künftig werden Rechenschaft ablegen müssen, wie David Lizoain in seinem Buch Crimen climático warnt. Auch Pessimismus nützt nichts, denn ein Pessimist ist ein Mensch, der beschlossen hat, nichts zu tun, um die Dinge zu ändern, weil sie sich – seiner Logik nach – ohnehin nicht ändern werden. Nur ein rationaler Optimismus, nicht der von Sprüchetassen, kann uns motivieren, mit unserem Willen – nicht mittels göttlicher Vorsehung – das zu reparieren, was wir zerstört haben. Es gibt kein Handeln ohne Hoffnung. Aber wir müssen so handeln, wie es bei den gut ausgegangenen Ereignissen in unserer Geschichte immer gemacht worden ist: gemeinsam. Dazu müssen wir zu unserem Artenbewusstsein zurückfinden, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, dass wir mit der Natur eine Einheit bilden und dass wir nicht alle die Möglichkeit haben, denselben Fußabdruck zu hinterlassen bzw. ihn zu reduzieren.
Einem Bericht von CEDEX (Zentrum für Hydrographische Studien) zufolge deutet alles darauf hin, dass der humide Teil Spaniens, der einige der regenreichsten Gebiete Europas einschließt, auch dann feucht bleiben wird, wenn die Niederschläge zurückgehen, und dass der aride Teil Spaniens mit seinen trockensten Gebieten des Kontinents immer arider werden wird. Den Prognosen der Europäischen Umweltagentur nach wird die Iberische Halbinsel in den kommenden Jahren der trockenste Ort Europas sein. Unkontrollierte Bewässerung, Übernutzung der Grundwasserleiter, Bodendegradation und Landflucht in Verbindung mit einem Klimawandel, der zu immer massiveren und längeren Dürren führen wird, erhöhen das Risiko der fortschreitenden Wüstenbildung auf 75% der Halbinsel. Ich gehöre zu einer Generation, der langsam bewusst wird, dass sie möglicherweise bald wegziehen muss, wenn das trockene Spanien – und darauf deutet alles hin – im Laufe des Jahrhunderts zur Wüste wird. Für die dort Aufgewachsenen ist das eigentlich nichts Neues; meine gesamte Kindheit über träumte ich von einer Zukunft im grünen Norden, bevor ich ihn überhaupt kannte. Erst als ich dann hinzog, begriff ich, dass ich etwas idealisiert hatte, was nicht zu mir passte, und dass Trockenheit möglicherweise auch unsere Beziehung zum Erdboden beeinflusst. Ein galicischer Freund hört sich Aufnahmen von Regen an, wenn er in der Ferne ist und Heimweh hat. Ich dagegen habe eine leere Wasserflasche mit Saharasand gefüllt, die ich immer noch aufbewahre, um nie zu vergessen, was ich in der Wüste empfand, und ich glaube, ich habe meinen Platz nun in einem Dorf gefunden, dessen Geschichte von einem Bittgebet für Regen geprägt ist. Was, wenn auch Durst das konditioniert, was wir als Heimat empfinden? »Wir sind diese Erde, diese rote Erde; und wir sind die Jahre der Flut und die des Staubs und die der Trockenheit. Wir können nicht von vorn anfangen«, sagten die Joads in John Steinbecks Früchte des Zorns.
Etwas Ähnliches geschieht vermutlich mit der Sprache. Die Galicier haben siebzig bis einhundert Wörter für Regen, heißt es. So viele haben wir im trockenen Spanien nicht, weil wir sie nicht brauchen, aber ich habe nachgezählt, wie viele es für Süßholz gibt, und wenn ich den wissenschaftlichen Namen (Glycyrrhiza glabra) und den von Großvater geprägten »Totennabel« dazuzähle, komme ich auf neununddreißig. Ich, die ich mit leckeren, bunten Süßigkeiten vom Marktstand aufgewachsen war, hatte nie verstanden, warum mein Großvater immer so ein hässliches, düsteres Ding im Mund hatte. Aber an dieser Süßwurzel zu lutschen, war seine Art, den Durst zu stillen. Glycyrrhiza glabra wuchert nicht nur auf Friedhöfen, sondern auch in der Nähe von Flüssen. Süßholz, mancherorts als »maurische Schokolade« bezeichnet, scheint ursprünglich aus Nordafrika und Südasien zu stammen. In der Antike wurde es gekaut, um Atembeschwerden zu lindern, Muskeln und Knochen zu stärken und den Teint zu glätten. Griechen und Römer verwendeten die Wurzel bereits für einen weiteren Zweck, der von etlichen antiken Autoren dokumentiert wurde: gegen den Durst.
Wenn Hegel glaubte, dass Leute letztlich ihrer Landschaft und ihrem Klima ähneln, wäre zu prüfen, was zuerst da war, denn um zu bleiben, mussten die Bewohner von La Mancha ihrer Landschaft und ihrer Gastronomie die Gestalt ihres Wasserbedarfs verleihen – in einer Region, deren Toponym »Land ohne Wasser« bedeutet. Ich komme aus einem Ort, einer Landschaft, einer Kultur, eine Kultur, die Wasserknappheit erkannt und benannt hat. Dort bildet das Getreide geometrische Figuren, vom Himmel gesehen ein Patchwork. Ich komme aus einem Ort, an dem meine Vorfahren vor tausenden Jahren mit einer der schlimmsten Dürreperioden der Geschichte konfrontiert waren und sie überlebten.
Vor sehr viel kürzerer Zeit sahen deren Nachkommen wiederum zu, wie ein Bachbett mit Beton verfüllt wurde, und hörten auf, eine uralte Geschichte weiterzugeben: Einmal, als der Bach noch in Sichtweite war, hatte jemand in dessen Wassern einen Klumpen erspäht, am oberen Ende des Dorfs, wo sich die Frauendomäne befand, der Waschplatz. Bei so viel vernehmbarer Überraschung konnte man denken, ein Wal sei aufgetaucht. Er kam so langsam den Bach herunter, dass sich inzwischen das Gerücht verbreiten konnte, der Wal nähere sich dem Dorfplatz. Dort warteten mehrere Männer und schossen, als er endlich in die Reichweite ihrer Gewehre kam. Aber es war kein Wal. Dort trieb, wie ein Krokodil auf der Pisuerga, der Packsattel eines Esels. So erzählte man sich im Dorf, aber die Geschichte ging vor so langer Zeit verloren, dass niemand mehr sagen kann, ob es sich um eine Legende, einen Scherz oder eine Halluzination handelte. Der Wal des Baches von Terrinches war der Wal des Sequillo und der Wal des Manzanares, und das ist der Grund, warum die Madrider Einwohner schließlich »ballenatos« (»große Wale«) genannt wurden. Ähnliche Versionen dieser Geschichte gibt es auch in Dörfern des trockenen Spanien, durch die ein Fluss oder ein Bach fließt. Von meinem Schreibtisch aus sehe ich den Fluss Guadalope. Hier, mehr als fünfhundert Kilometer von Terrinches entfernt, wird auch eine dorfeigene Geschichte des Wals erzählt, der in Wirklichkeit ein prall gefüllter Packsattel war. Er querte sogar eines Tages einen Ozean, obwohl man nicht genau weiß, in welche Richtung, denn in einer Erzählung der Yamaná (in Chile) beschließen auch die dortigen Protagonisten, ihm nachzusetzen.
•
Einem UN-Bericht zufolge hat die Dürre in den letzten fünfzig Jahren 650000 Menschen das Leben gekostet. 2023 wurden 700 Millionen Menschen von Dürre vertrieben, wird geschätzt. Von Dürre? Ich sage, vom Durst, denn wenn wir über die Dürre in der Welt sprechen, lassen wir manchmal den Missbrauch, den Raubbau und den verantwortungslosen Umgang mit Ressourcen außer Acht. Wir sprechen wenig über die verheerende Hungersnot am Horn von Afrika, von welchem unsere Vorfahren – von Durst oder Hunger getrieben – aller Wahrscheinlichkeit nach aufgebrochen waren. Die regenarmen letzten vier Jahre und das monatelange Ausbleiben von Niederschlägen haben die Ernten verdorren und das Vieh sterben lassen, das Leben von Millionen von Menschen gefährdet und sie gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Über die Ursachen wird noch weniger gesprochen, und wenn, dann von Dürre oder Hungersnot. In einem Text mit dem Titel Dürre ist nicht gleich Hungersnot schreiben die Medicos del Mundo (»Ärzte der Welt«):
Ein direkter Zusammenhang zwischen lang anhaltender Dürre und Hungersnot besteht zweifellos. Gleichwohl aber müssen weitere Faktoren zusammenwirken, damit Letztere auftreten kann. […] entscheidend ist, auch auf Ursachen wie Kriege, die tyrannische Machtausübung vieler Regierungen gegenüber ihren Bürgern, die Misswirtschaft mit Ressourcen, die wirtschaftliche Ungleichheit aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftsordnung oder die massive Abholzung der Regenwälder hinzuweisen, um Umstände zu erklären, die a priori allein der meteorologischen Vorsehung oder der nachteiligen geografischen Lage eines Landes zugeschrieben werden könnten.
Durst kommt selten allein. Aber in diesem Buch spielt er die Hauptrolle. Wenn ich Durst sage, spreche ich nicht nur von einem physiologischen Bedürfnis, das uns lange vor allen anderen umbringt, sondern von der Abwesenheit von Wasser, vom Bedürfnis, den Durst zu beherrschen und zurückzuhalten, von einer Suche, die uns dahin gebracht hat, wo wir heute sind, und von der Sehnsucht heimzukehren, denn das Wasser sind wir selbst, und mit seinem Fehlen fehlt der Mensch.
Durst ist eine treibende Kraft der Menschheit. Jüngste Studien fanden ihn im Abzug der Römer, im Untergang der Westgoten und der Ankunft der Mauren in jener Gegend, in der ich schreibe. Nachdem er uns umhertrieb, an Land band, zu den Flüssen schickte und glauben ließ, wir könnten die Natur folgenlos verändern, erschien er im ersten dokumentierten »Wasserkrieg« höchstpersönlich. Auch bei der kognitiven, der landwirtschaftlichen, der wissenschaftlichen, der französischen und der industriellen Revolution spielte er eine mehr oder weniger relevante Rolle – und beim Aufkommen der künstlichen Intelligenz, mit der wir möglicherweise um eine immer knapper werdende Ressource konkurrieren werden. Es fällt uns noch nicht einmal auf, dass ein Chatbot Wasser verbraucht, dabei trinkt er für zehn beantwortete Fragen etwa einen Liter davon. Schätzungen nach wird sich dieser Verbrauch mit zunehmender KI-Verbreitung bis zu verfünffachen.
All die großen Revolutionen, die dazu führten, dass Flüsse gestoppt und Grundwasserleiter trockengelegt wurden, um Wasser, Nahrung und Strom zu gewinnen, hatten bereits Einfluss darauf, dass wir Regen bekommen und nicht an Kälte oder Hitze sterben. Unser Durst vermag die Bewegung der Erde zu verändern, das haben die Brunnen und der Drei-Schluchten-Staudamm in China mit seinem größten Wasserkraftwerk der Welt bereits getan. Fachleute sagen, dass wir davon nicht betroffen sein werden, dass diese enorme Menge Stauwasser unsere Tage um nur 0,06 Mikrosekunden verlängert und dass die massive Entnahme von Wasser aus den Grundwasserleitern die Erdachse in einem Jahrzehnt lediglich um achtzig Zentimeter verschoben hat. Sie verändert sich zwar ständig, aber wenn der langfristige Klimawandel in hohem Maße von solchen Schwankungen abhängt, wie können wir dann sicher sein, dass unser Durst nicht das Klima einer Zukunft beeinflusst, die wir nie erleben werden?
Ich sage Durst und nicht Dürre, vor allem auch, um der Wasserknappheit den ihr gebührenden Platz in der Geschichte einzuräumen – ohne die Auswüchse des Geodeterminismus, der den Menschen zu einer Marionette des Klimas werden ließ. Seit der landwirtschaftlichen Revolution machten sich unsere Vorfahren dem Regen Untertan und mehr und mehr abhängig vom Klima; und von diesem Moment an hinterließ ein Großteil von uns seine Spuren so deutlich wie nie zuvor. Doch die Dürre war nur eine weitere Ursache für das, was hier beschrieben wird. Dürre selbst löst keine Revolutionen aus, aber sie führte zu Hungersnöten und Epidemien, die dann auf Despotismus trafen.
Dieses Buch ist weder Memoire noch Essay, es ist eine Mischung. Ausgehend von Kindheitserinnerungen an die Trockenheit wollte ich verstehen, warum Wein, Brot, Öl und Speck in La Mancha allgegenwärtig sind. Woher wir kamen und warum wir gingen. Warum wir stehenblieben und die Götter um Regen baten. Warum so vielen Hungerrevolten Dürrejahre vorausgegangen waren. Warum in meinem Dorf ein Bauer so präsent ist, der vor neunhundert Jahren in Madrid lebte. Warum wir mit traditionellen und wissenschaftlichen Methoden so vehement versuchen, den Regen zu beherrschen und das Wasser zu bewahren.
Im ersten Teil werde ich anhand einiger Familiengeschichten die Reise der Menschheit nachzeichnen, und zwar von Afrika bis zur Iberischen Halbinsel. Der Durst war eine zu Völkerwanderungen treibende Kraft, die stärker war als die Liebe und die uns zu ständiger Bewegung veranlasste, bis wir sesshafter wurden und begannen, Land zu bewirtschaften und auf Regen hoffend zum Himmel zu schauen. Bevor wir aber die prähistorische La Mancha erreichen, möglicherweise die Wiege der ersten hydraulischen Gesellschaft Europas, werden wir im Fruchtbaren Halbmond verweilen, einem der Gebiete, wo die Menschen den Ackerbau entdeckten und auf den Regen warteten, bis sie lernten, das Land zu bewässern. Wir werden sehen, dass es in den ersten Jahren des Holozäns mehrere Abkühlungen gab, die mit Trockenheit einhergingen und etliche Ethnien flüchten und an den Ufern der wenigen Fließgewässer jener Zeit siedeln ließen. Wir werden auch sehen, wie Durst diese Klimaflüchtlinge dazu brachte, Zivilisationen zu gründen, denen es gelang, eine Sprache zu bewahren, ein bis dahin äußerst flüchtiges Phänomen. Städte und Königreiche – selbst das erste Imperium – in so weit entfernten Gebieten wie Mesopotamien, dem Indus-Tal und dem heutigen Peru gingen unter, hauptsächlich aufgrund einer der schwersten und langanhaltendsten Dürreperioden. Die prähistorischen La-Mancha-Bewohner, unter denen sich bereits die Jamnaja befanden, entwickelten sich derweil durch die Gewinnung von Grundwasser weiter, bis die Fluten kamen.
Der zweite Teil beginnt mit den vielleicht frühesten Deutungen der Sternbilder, die den späteren Regengottheiten vorausgingen: erst Tiere, dann anthropomorphe Götter und schließlich Menschen. Nicht nur Glaube und Gebet, auch die Bestrafung derjenigen, die den Regen beherrschten oder zu beherrschen vorgaben, ob Gottkönig, Schamane, Hexe, Heiliger oder Meteorologe, war zuweilen die Antwort auf Durst. Die letzten Kapitel befassen sich mit traditionellen Techniken zur Beherrschung des Regens, mit den Wissenschaften, die an ihre Stelle getreten sind, und mit denjenigen, die begannen, den Himmel zu beobachten, um Wolken zu benennen, Stürme vorherzusagen, die Niederschlagsstärke und die Tropfengröße zu messen.
Und schließlich forschte ich im Familiengedächtnis nach und in den Kirchenbüchern, um einen Stammbaum zu erstellen, in welchem ich abermals auf Durst und eine »hartnäckige Dürre« stieß, die vielleicht aber gar nicht so hartnäckig oder schlimm war, dass sie eine Hungersnot ausgelöst hätte. Ich besuchte auch das neue Riaño, um herauszufinden, welches Spielzeug der Dachkletterjunge damals mitgenommen hatte, bevor sein Haus geflutet wurde, denn die Ertränkten und die Durstigen teilen Schicksal und Schmerz. Wie werden wir sie von nun an nennen, wo sie (wir) doch immer zahlreicher werden?
Ich habe mich darum bemüht, dass diese Geschichte über die weißen Europäer hinausgeht, die sich über andere erheben; dass sie sich nicht nur auf Menschen beschränkt, denn auch das Kamel, die Oryxantilope oder das Flughuhn haben den Durst zu bekämpfen gelernt; dass sie über die Wissenschaftselite und die Städte hinausweist, denn die Volksweisheit der Landfrauen und -männer ist keineswegs unvereinbar mit der Wissenschaft, sondern kann sogar ihr Ausgangspunkt sein, da es auch Sprichwörter gibt, deren Lehren sich wissenschaftlich belegen lassen.
Die Reise führte mich zu alten wie zu aktuellen Debatten in der Anthropologie, der Paläontologie, der Klimatologie, der Genetik und vor allem der Archäologie. Und sie hat mich, bildlich gesprochen, in weitere durstige Gegenden der Welt geführt, die einen Teil des Ganzen zu erhellen vermögen und mit dem Ausgangspunkt verbunden sind. Als studierte Journalistin und Sozial- und Kulturanthropologin habe ich mich sehr darum bemüht, Theorien und Begriffe, die ich zu Beginn des Schreibens und der Weiterbildung als Paläoanthropologin nicht kannte, zu verstehen und auf zugängliche Weise zu vermitteln. Aus diesem Grund – und um die Lektüre für diejenigen zu erleichtern, die mit manchen Disziplinen nicht vertraut sind – habe ich einige Namen, Angaben und Daten weggelassen. Ein Großteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Forscherinnen und Forscher, ohne die ich diese Seiten nicht hätte schreiben können, wird im Literaturverzeichnis am Ende des Buches und in einigen Fällen auch in der Danksagung erwähnt, weil sie mir halfen, Fragen zu klären. Etwaige Fehler sind allein mir zuzuschreiben; ich habe wenig mehr gemacht, als mein Erstaunen darüber zu teilen, dass ich auf der Suche nach Antworten wieder und wieder auf Durst stieß, an den entlegensten Orten und in den für die Menschheit wichtigsten Momenten. Oft musste ich meinen Enthusiasmus zügeln; wo ich auch hinsah, lauerte Durst. Aber Durst ist für die Menschen wie die Nacht für den Tag.
I
Die Reise des Dursts
1Himmelsspeck
Keine Spur von Feuchtigkeit, keine Erinnerung an das Wasser stellte sich ein, um uns vor dem Spiel der durstigen Spiegelungen zu erretten.
ELENA GARRO,
Erinnerungen an die Zukunft
Das Haus, in dem ich den Durst kennenlernte, ist eine Zeitkapsel. Darin ein Tank, der Botijo, die Kerzen, die uns Licht spendeten, wenn der Strom ausfiel, und ein Hirtenkrug, den mein Urgroßvater Pedro aus einem Flaschenkürbis gefertigt hatte. Er hatte ein Loch in den Kürbis gebohrt, ihn entkernt und ausgehöhlt, getrocknet und das Loch dann mit einem Korken verschlossen. Aus dieser archaischen Feldflasche, die er an einer Schnur hängend bei sich trug, trank er an seinen langen Feldtagen Wasser. Das Wort »Kalebasse« kommt von »cal-«, was so viel wie Unterschlupf, Haus, Gehäuse bedeutet.
Flaschenkürbisse mögen die Trockenheit nicht sonderlich, dennoch wurden die Kalebassen immer schon zum Durstlöschen verwendet; nicht nur in La Mancha, auch in Yucatán, als dort eine erstickende Dürre herrschte, kurz vor dem Zusammenbruch des Maya-Reiches. Pranke des Jaguar, die Hauptfigur in Mel Gibsons Film Apocalypto, trägt einen dieser Kürbisse, in Mexiko »guajes« genannt, bei sich. Lagenaria siceraria wurde dort schon vor fast zehntausend Jahren zur Herstellung der guajes angebaut. Sie war eine der ersten vom Menschen domestizierten Pflanzen und wird in den Mythen der Navajo als erste Kulturpflanze erwähnt. Textur, Geschmack und Härte der Früchte machten sie unappetitlich, aber da sie sich gut als Wasserbehälter eigneten, wurden Flaschenkürbisse weiterhin angepflanzt und die Früchte zu Gefäßen verarbeitet. Die Kürbisse können bis zu zwei Jahre lang im Meer schwimmen, ohne dass ihre Samen verderben, daher glaubt man, dass sie den Weg von Amerika aus alleine zurücklegten. Sie wurden so bedeutsam, dass man sie vor tausenden von Jahren – und an so weit voneinander entfernten Orten wie Peru und Ägypten – Toten als Grabbeigabe mitgab.
In meinem Dorf gab es einen Mann, der sie anders zu verwenden wusste und in Kunst verwandelte: der Müller Juan. Ich traf ihn eines Tages auf der Straße. Er hatte ein Messer in der Hand und schnitt gerade einen getrockneten Kürbis auf. Obwohl Flaschenkürbisse in La Mancha nur wachsen, um zu Feldflaschen zu werden, machte Großmutters Nachbar eine Lampe daraus. Und das war nicht die erste. Sein Haus war ein ungewöhnliches Museum, vollgestopft mit Kürbissen, aus denen etwas Neues geworden war. Juan erzählte mir, dass er als Statist im Film Spartacus mitgewirkt hatte, wie viele Männer aus dem Dorf. Sie spielten die Sklaven, die für Spartacus (Kirk Douglas) kämpften, den Thraker, der sich gegen die Römische Republik erhob und dabei Massen von Menschen mitzog, und den eine spätere Serie zu einem »Rainmaker« machte – und viel Geld einbrachte. In der bekanntesten Filmszene sind tausende Menschen zu sehen; ein Großteil davon waren Angehörige der spanischen Armee, auch Juan. Regisseur Stanley Kubrick hatte diese Szene nur drehen können, weil er die von Franco gestellte Bedingung akzeptierte: Die Soldaten durften mitwirken, wenn sie im Film nicht tot zu sehen waren. Und so geschah es; sie spielten mit – im Tausch gegen ein belegtes Brot und eine Handvoll Peseten.
Juan redete nicht nur von lichtspendenden Kürbissen und Blockbuster-Filmen. Er erzählte auch eine Anekdote, über die ich schallend lachen musste; für ihn aber war sie eine Frage von Leben oder Tod: Er prahlte damit, dass er immer kerngesund gewesen und nur ein einziges Mal im Krankenhaus gewesen sei. Dort brachten ihm die Krankenschwestern eines Tages einen Joghurt, und Juan platzte heraus: »Und wo ist da der Knochen?« Es war natürlich nicht der Knochen, den er vermisste. Nachdem er lange überlegt hatte und schon fast am Verzweifeln war, beschloss er, eine quijoteske Heldentat zu wagen und fortzulaufen. Die Krankenschwestern folgten ihm den Flur hinunter, konnten ihn aber nicht einholen, und so entwischte er und lief vom Krankenhaus zurück ins Dorf, um zu Hause in eine ordentliche Scheibe Speck zu beißen.
Neben Juans Anekdote kam mir in jenen Tagen zu Ohren, dass eine meiner Nachbarinnen mit einer außergewöhnlichen Begabung fürs Kochen gesegnet war. Ich hörte sie erzählen, wie sie ihrem Sohn jeden Nachmittag ein »vegetarisches Baguette« mache: sie belege es mit Käse und Speck, vergesse aber nie, auch Salat und Tomate daraufzulegen. Wer kennt ihn nicht, diesen iberischen Zauber von »vegetarischen« Thunfischsalaten, die vegetarisch genannt werden, weil sie ein bisschen grünen Salat und Tomate enthalten. Schnell begriff ich, dass die Speckbesessenheit meiner Familie mehr war als nur eine Frage des persönlichen Geschmacks, und dass das Baguette, für das die Leute aus Terrinches bei den Dreharbeiten von Spartacus gearbeitet hatten, eines mit Fleisch gewesen sein dürfte und alles andere als mager.
Meine Großmutter Araceli verehrte eine Ecke in ihrem Hause derart, dass sie sie mir verbot. Es war eine nach ranzigem Speck riechende Speisekammer. Als Kind, das kann ich ohne Scham erzählen, sperrte ich sie eines Tages darin ein, lief hinaus auf die Straße und war mächtig stolz darauf, sie mit dieser so eifersüchtig bewachten Liebe allein gelassen zu haben. Meine Erinnerung daran duftet nach Orangen, vielleicht hatte ich in aller Seelenruhe auf der Stufe vorm Haus gesessen und genüsslich eine Orange verspeist, während sie mich von drinnen anflehte, die Kammertür zu öffnen. Was meine Großmutter Francisca betrifft, so darf es ihr an allem fehlen, bloß nicht an einem Stück Speck auf dem Abendbrot, einem Taschenmesser und einem Stapel bereitliegender Leichentücher. Für alle Vegetarier- oder Zöliakie-Enkelinnen ist sie das Leiden in Person. Ich gehöre zu Letzteren. Einmal konnte sie in der Dorfbäckerei keine glutenfreien Backwaren auftreiben und bot mir stattdessen Chorizo an, die ich in meine Milch tunken sollte. Ich lehnte ab, aber sie ließ nicht locker und versuchte es mit Schinken. Ständig empfiehlt sie, weniger Gemüse zu essen, das sei nur was für Maultiere und Ochsen. Über bestimmte Lebensmittel macht sie manchmal abfällige Bemerkungen, die jeden Ernährungswissenschaftler entsetzen würden und die den Sprüchen ihres Nachbarn ähneln, etwa: »so was klebt nicht an der Niere«. Ich weiß nicht, ob es in La Mancha einen Haushalt gibt, der im Kühlschrank nicht die übliche Dose mit Wurst stehen hat, die hungrig gebliebenen Essern als Nachtisch serviert werden kann. Auch wenn dort nie jemand hungrig bleibt. Marvin Harris erzählt in Good to eat, dass die von den Anthropologen untersuchten Dörfer und Gruppen eine sich wiederholende Besessenheit von Fleisch zeigten, weil es Bindungen stärken hilft.
Ob die duelos y quebrantos (Rührei mit Speck und Paprikawurst), die Don Quijote samstags aß, tatsächlich ein Gericht aus La Mancha waren oder eine Erfindung von Miguel de Cervantes, tut nichts zur Sache, denn mit der Königszutat war es authentisch. Abgesehen von den Linsen am Freitag und dem Täubchen am Sonntag enthielten die meisten Don-Quijote-Gerichte Speck. An den üblichen Tagen gab es bei ihm Eintopf, und sein salpicón war nicht der in anderen Landesteilen übliche Meeresfrüchtesalat, sondern der eingedickte Rest vom Eintopf an gebratenem Speck und Zwiebeln. Mit anderen Worten: Fett mit Fett, in einem Land, in dem auch migas de pan (in Öl angebratene Weißbrotwürfel) nicht verachtet werden. Dann gab es oft empedrado (Rührei »gepflastert« mit Schafsfleisch) und torreznos (kross gebratene Schweineschwarte). Und ein morteruelo (warme Wildfleisch-Leber-Pastete) mit gutem Speck. Don Quijotes Eintopf, der dem morteruelo ähnelt, wird ebenfalls mit der Königszutat gekrönt. Ob im Don Quijote bereits Speckstreifen auf migas und gachas (Platterbsensuppe) verteilt wurden, ist nicht belegt, aber heute dürfen sie in La Mancha keinesfalls fehlen. Die gachas, mit denen sich unsere Großeltern in den Hungerjahren den Bauch vollschlugen, sind an den seltenen Regentagen heute das Lieblingsgericht ihrer Enkel. Cervantes schrieb den Don Quijote mitten in der Kleinen Eiszeit. Etwa fünfhundert Jahre lang herrschten Kälte und Dürre in weiten Teilen der Welt. Vielleicht aus diesem Grund (und weil der Roman im Epizentrum des trockenen Spaniens spielt) regnet es nur ganze zwei Mal im Buch, und zwei der besten Kapitel beginnen mit dem Durst der Protagonisten und einem Bittgebet pro pluviam. Auch wenn wir später noch einmal auf die Quijote-Zeit zurückkommen werden, sei an dieser Stelle schon angemerkt, dass das Schwein damals entweder puerco oder cochino genannt wurde (beide Wörter bezeichnen sowohl das Schwein als auch das sprichwörtliche Dreckschwein) und dass Spanien in porcophile und porcophobe Menschen geteilt war, was meistens davon abhing, ob sie alte oder neue Christen waren. Es waren die Mitzwiebelisten und die Ohnezwiebelisten des Goldenen Zeitalters, die sich zu entschuldigen pflegten, wenn sie den Namen des so verehrten wie verhassten Tieres aussprachen.
Erhellend ist die Geschichte eines Erfinders, der es kürzlich wagte, seine eigene Pizza mit der »La-Mancha-Ananas«, der Melone, zu kreieren: mit fuet de melón (einer Hartwurst aus Melonenkernöl). Damit wollte er zwar den Speckkonsum reduzieren, um die Gefäße zu schonen, und nicht meine Großmutter provozieren, aber die Erfindung brachte ihm harsche Kritik ein: »Das ist ja zum Leute vergiften. Ein Graus! Kauf das nicht, bevor das nicht geklärt ist.« Wir reden hier von einer ausgesprochen schweineliebenden Gegend, in der man zwar Melonen mag, besonders die aus Tomelloso, nicht aber Gaukeleien, denen der Speck zum Opfer fällt. Menschen wie meine Großmutter haben ihre Gründe, warum sie essen, was sie essen, am liebsten nämlich, was »an der Niere klebt«. Die Nachkriegszeit trug unbestreitbar dazu bei, die wahren Gründe aber liegen weit zurück.
Im 12. Jahrhundert, als La Mancha aufhörte, eine demografische Wüste zu sein, machten die neuen Siedler das Olivenöl zum Herzstück und zur Grundlage ihrer Gastronomie. Die Gegend eignete sich gut für Olivenhaine. Denn der oleaster, der wilde Ölbaum, fand sich schon vor ca. 150000Jahren in den mediterranen Wäldern, sogar unter noch trockeneren Bedingungen als heute. Doch die Bevölkerung wuchs, das Öl wurde knapp, und für einige Zeit musste man es aus Andalusien heranschaffen. Land für die extrem dürreresistenten Olivenbäume gab es genügend, und ab dem 18. Jahrhundert wurden sie angebaut. Von nun an enthielt fast jedes Gericht die heilige Dreifaltigkeit der Gegend: Brot, Öl und Speck. Auf dieser Grundlage entfaltete sich die Küche von La Mancha. Weinstock, Olivenbaum, Schwein und Getreide. Alle sind dort – in unterschiedlichem Maße – gediehen, weil sie gemeinsam widerstehen und die Landschaft von La Mancha neu prägen konnten.
Kartoffeln wurden in La Mancha zwar schon damals angebaut, rangierten in Teilen Spaniens und Europas aber jahrhundertelang unter ferner liefen, weil ein Spanier offenbar auf die Idee gekommen war, sie samt Schale und Erde roh zu kosten, und dann das Gerücht verbreitete, dass es niemanden gäbe, der dieses Zeug esse. Meine Vorfahren hatten jahrhundertelang keinen Fisch auf dem Tisch, weil das Meer so weit weg war, und so stürzten sie sich aufs Fleisch – mit einem Genuss, den meine Großmütter erbten. Aber dann wurde die Eisenbahn erfunden, und mit ihr kamen die gesegneten Basken, die die neue La-Mancha-Kost um den eingeführten getrockneten Kabeljau bereicherten.
•
Die Rolle, die der Anthropologe Marvin Harris indirekt dem Durst zuschreibt, wenn er über Nahrungsmitteltabus und deren Beweggründe spricht, ist erstaunlich. Das Schwein, das im Nahen Osten schon domestiziert wurde, als so manch ausgedehnter Wald noch nicht durch Grasland ersetzt worden war, ein Tier, das reichlich Schatten und Wasser braucht und weder Milch noch Felle gibt, wurde für den Menschen zu einer harten Konkurrenz – besonders in Dürrezeiten, in zunehmend entwaldetem Land. Auch Harris spricht davon, wenn er erklärt, warum die Bibel und der Koran Schweinefleisch verurteilten, und wenn er Verbindungen zu den ganz ähnlichen Beweggründen der Inder sucht, die die Kühe bis heute als heilig erachten; deutlich wird: Wir nehmen bestimmte Lebensmittel in unsere Kost auf oder enthalten uns in Abhängigkeit davon, was uns die Trockenheit erlaubt. Sowohl die Israeliten als auch die ersten Anhänger Mohammeds lebten in Wüstengebieten, da fragt man sich unweigerlich, ob ein Hindu-Bauer die Kuh, die ihm weitere Ochsen schenken kann, nicht essen würde, wenn er nicht auf sie angewiesen wäre, um sein von zyklischen Dürreperioden heimgesuchtes Land zu pflügen, oder ob ein Muslim Schweinefleisch essen würde, wenn seine Vorfahren mit diesem Tier nicht um die spärlichen Ressourcen der Halbwüsten oder der nicht ausreichend zu bewirtschaftenden regenarmen, praktisch nicht zu bewässernden Gebiete hätten konkurrieren müssen. Doch auch ein Paradox ist möglich: Menschen in einem trockenen Land können Schweinefleisch mögen, das ihnen die Religion nur zu bestimmten Zeiten untersagt; andersrum ist das Schweinefleisch aus Gründen der Identität auch für jene Juden und Muslime tabu, die nicht mehr im Nahen Osten leben.
Ist es dann sinnvoll, dass Schweinefleisch einen prominenten Platz in einer Esskultur einnimmt, die auf trockener Erde beheimatet ist? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Obgleich es auf den ersten Blick eine wenig bis gar nicht angepasste Wahl scheint, erfüllte es doch die soziale Funktion, die wir bereits aus Don Quijotes Zeiten kennen, und ist außerdem eine der erschwinglichsten Quellen für tierisches Eiweiß. Darüber hinaus liegt die Bedeutung des Schweins auch darin, dass ein einziges, »bis zur Haxe genutztes« Tier eine ganze Familie ein Jahr lang ernähren kann. Zum anderen koexistieren Schweine weithin mit Ziegen, Schafen und Pflanzen, die bis zu einem gewissen Grade Trockenheit vertragen. Möglicherweise gibt es aber auch noch eine andere Erklärung, die nicht so offensichtlich ist. Normalerweise verbinde ich eine fettreiche Ernährung mit kalten Klimazonen, weil ich den Durst manchmal vergesse, aber vielleicht hängt die Begeisterung der La-Mancha-Bewohner für Speck auch damit zusammen, dass Kamele in ihren Höckern Fett speichern. Die Vorfahren der Kamele waren während der Eiszeiten von Amerika nach Eurasien und Afrika gewandert. In ihrer Urheimat starben sie aus, in der neuen Heimat passten sie sich an die Extrembedingungen an. Sowohl diese Urtiere als auch unsere Vorfahren, die Australopithecinen, entwickelten in Afrika die beeindruckende Fähigkeit, fürs Überleben in einer feindlichen und äußerst trockenen Umgebung Fett zu speichern. Im Gegensatz zu anderen Makronährstoffen benötigt Fett kein Wasser, um sich im Körper anzusammeln. Und damit nicht genug: Es wird bei seiner Verstoffwechselung nicht nur in Energie, sondern vor allem in Wasser umgewandelt. Dass Kamele Wasser in den Höckern tragen, ist ein Mythos, aber nicht ganz. Diese Tiere haben nicht nur drei Augenlider und können ihre Nasenlöcher schließen, wenn ein Sandsturm aufzieht, sie speichern auch noch Fett in ihren Höckern, das in einem dürstenden Körper Wasser gleicht. Es ist metabolisches Wasser und entsteht bei der Oxidation von Lipiden. Zusammen mit dem riesigen internen Wasservorrat (Kamele können in wenigen Minuten bis zu einhundertvierzig Liter Wasser aufnehmen) und der Fähigkeit, trockenen Stuhlgang auszuscheiden, können diese Tiere in der Wüste Tage, Wochen und Monate ohne Nahrung und Wasser überleben.
Auch unter den Tieren und Pflanzen gibt es welche, deren Verhalten nicht nur für die Evolution, sondern auch für das Lernen spricht. Während Wasserreservoirfrösche und einige Wüstenschildkrötenarten überall in ihrem Körper Wasser speichern und bis zu fünf Jahre ohne dieses auskommen können, trinkt der Koala gar keins und begnügt sich mit dem in Eukalyptusblättern enthaltenen Wasser; der namibische Nebeltrinker-Käfer gewinnt es aus Nebel, was der Mensch scheinbar erst nach zwei Millionen Jahren für sich entdeckte. Der Messerfuß ist in dieser Hinsicht ein faszinierendes Lebewesen: diese Kröte zieht sich zusammen und vergräbt sich monatelang, um in Dürrezeiten das Wasser zu speichern, und taucht erst wieder auf, wenn sie heraufziehenden Regen spürt. Der Westafrikanische Lungenfisch seinerseits kann ohne Wasser überleben, obwohl er ein Wassertier ist. Er lebt in kleinen Sümpfen, und wenn diese austrocknen, gräbt er sich Gänge in den Sand und umhüllt sich mit einem Kokon aus Schleim, um die Feuchtigkeit zu speichern. Dort legt er sich schlafen, bis ihn die Regenzeit weckt.
Manche Pflanzen nahmen auch Anpassungen vor, um der Wüste zu trotzen, und sind in der Lage, den selten fallenden Regen zu speichern. Der Saxaul-Baum bindet Salz in seinen Blättern, um die Wasseraufnahme zu verbessern und in der Gobi zu überleben. Er hat es darüber hinaus sogar geschafft, Energie mit seinen Zweigen zu erzeugen, um das Wasser zurückzuhalten, das er in Rinde und Wurzeln speichert. In manchen Jahren – und mit steigender Häufigkeit – kommt der Dsud, ein für das Verbreitungsgebiet des Saxaul spezifisches Klimaphänomen, das nach sehr trockenen Sommern noch schlimmere Folgen hat, Millionen von Nutztieren tötet und die Menschen nach Ulaanbaatar, in die mongolische Hauptstadt treibt. Der Saxaul aber ist so widerstandsfähig wie Algen in den Wüstengebieten der Vereinigten Staaten, die mit nur einem Tropfen Wasser auskommen.
Im Gegensatz zu anderen Lebewesen passen wir Menschen uns kulturell an, wir haben uns mithilfe der schneller agierenden Kultur von der Umwelt unabhängig gemacht. Nach Juan Luis Arsuaga würde der Biologe Ernst Mayr etwa sagen: »Wir brauchen unsere inneren Organe nicht zu verändern, um uns an irgendein Ökosystem anzupassen, dafür haben wir die von uns hergestellten Werkzeuge, die man gut auch als künstliche Organe betrachten könnte, als Prothesen, egal ob Grabstock oder Feldflasche.« Mein Urgroßvater brauchte also gar kein Wasserdepot in seinem Körper, weil man vor tausenden Jahren in Mesoamerika Kürbisse kultiviert hatte und er sie als Behälter zur Aufbewahrung der Flüssigkeit zu nutzen wusste. Auch meine Großmutter und ihre Nachbarin brauchten es nicht, weil sie in einer Gegend lebten, deren Gastronomie vom Durst regiert wird. Wenn ihnen aber eine der Zutaten, nämlich der Speck, das Leben in diesem trockenen Landstrich erleichterte, dann deshalb, weil ihre Vorfahren sich physisch an eine trockene Umgebung angepasst und dies an die Nachkommen vererbt hatten. Nur weil wir weitere anatomische und stoffwechselspezifische Anpassungen heute nicht mehr so nötig haben wie andere Lebewesen, heißt das nicht, dass wir uns nicht anpassen. Menschen in Bolivien und in Tibet haben nachweislich ein größeres Lungenvolumen entwickelt, um in Höhenlagen mit weniger Sauerstoff zu leben; andere auf den südostasiatischen Inseln können länger tauchen und unter Wasser besser sehen. Es gibt auch Belege dafür, dass Viehzuchtkulturen laktosetoleranter waren. Außerdem haben einige Europäer größere Nasen, ein Erbe der Neandertaler, was ihnen das Leben an kalten, trockenen Orten erleichtern könnte, wie wir später sehen werden.
Manchmal machen sich die Menschen Anpassungen von Tieren und Pflanzen zunutze, nicht ganz ohne Missbrauch. Die San im südlichen Afrika etwa wissen, dass durstige Affen inmitten der Wüste Wasser aufspüren können, also fangen sie Paviane, lassen sie dürsten, geben sie frei und laufen ihnen nach. Vielleicht haben wir durch die Fähigkeit, uns durch kulturellen Erfindungsgeist anzupassen, bis heute überleben können – selbst in Gegenden wie der Kalahari, La Mancha und der kältesten Region Norwegens. Kamele haben Höcker, und auch meine Großmutter kann nicht ohne Speck auskommen, aus ähnlichen Gründen, auch wenn es verschiedene Wege zum gleichen Ziel waren. Oder auch nicht so verschieden, wie wir sehen werden, wenn wir eine andere Großmutter treffen, die unser aller Großmutter ist, und die uns eine Anpassung vererbte, die den Speck in trockenen Gebieten zu einem Vorteil macht. Zunächst aber durchlaufen wir kurz und – zugegeben – sehr vereinfacht den Weg vom ersten Auftreten von Durst in der Welt bis zur Zeit von Lucy, der Großmutter der Menschheit.
•