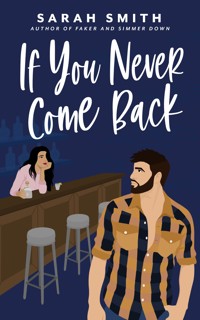5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Knight-Saga
- Sprache: Deutsch
Zwischen Schuld und Vergebung: Der düster-atmosphärische Roman »Die Sünde eines Sohnes« von Sarah Smith jetzt als eBook bei dotbooks. 1911 braut sich über Europa ein dunkler Sturm zusammen – und dennoch wagen der junge Wissenschaftler Alexander von Reisden und seine Frau Perdita die Reise nach Flandern, um dem Hilferuf eines Freundes zu folgen. Graf André du Monde, ebenso brillant wie exzentrisch, ist überzeugt, dass die Dreharbeiten seines Films im Schloss von Montfort verflucht sind. Aber ist er wirklich dem Wahn verfallen, wie seine Frau und sein kaltherziger Vater es alle glauben machen wollen? Als die rätselhaften Ereignisse in einem grausigen Todesfall gipfeln, ahnt Alexander, das ihm nur kurze Zeit bleiben wird, diesen Fall zu lösen, bevor weiteres Unheil droht. Immer tiefer tauchen er und Perdita in die aufgewühlte Familiengeschichte der du Mondes ein – und drohen schon bald, sich selbst darin zu verlieren … »Ein dunkler, träumerischer Roman über Väter, Söhne und einen Familienfluch: Sarah Smith ist eine mitreißende Erzählerin.« New York Times Book Review Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Sünde eines Sohnes« von Sarah Smith ist der dritte Band ihrer fesselnden Saga um die Familie Knight und die glanzvolle Zeit der Jahrhundertwende. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
1911 braut sich über Europa ein dunkler Sturm zusammen – und dennoch wagen der junge Wissenschaftler Alexander von Reisden und seine Frau Perdita die Reise nach Flandern, um dem Hilferuf eines Freundes zu folgen. Graf André du Monde, ebenso brillant wie exzentrisch, ist überzeugt, dass die Dreharbeiten seines Films im Schloss von Montfort verflucht sind. Aber ist er wirklich dem Wahn verfallen, wie seine Frau und sein kaltherziger Vater es alle glauben machen wollen? Als die rätselhaften Ereignisse in einem grausigen Todesfall gipfeln, ahnt Alexander, das ihm nur kurze Zeit bleiben wird, diesen Fall zu lösen, bevor weiteres Unheil droht. Immer tiefer tauchen er und Perdita in die aufgewühlte Familiengeschichte der du Mondes ein – und drohen schon bald, sich selbst darin zu verlieren …
»Ein dunkler, träumerischer Roman über Väter, Söhne und einen Familienfluch: Sarah Smith ist eine mitreißende Erzählerin.« New York Times Book Review
Über die Autorin:
Sarah Smith promovierte an der Harvard University und war Dozentin für Filmwissenschaft und Literatur des 18. Jahrhunderts, bevor sie sich dem Schreiben widmete. Ihre Romane über die Familie Knight wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und erlangten Bestsellerstatus. Für ihre weiteren Bücher erhielt sie u. a. den »Agatha Christie Award«. Sie lebte längere Zeit in Paris, Japan und London und wohnt heute mit ihrer Familie in Boston.
Die Website der Autorin: www.sarahsmith.com/
Bei dotbooks veröffentlichte Sarah Smith ihre große »Knight Saga« mit den Romanen »Der Fall des Erben«, »Die Schatten einer Familie« und »Die Sünde eines Sohnes«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2000 unter dem Originaltitel »A Citizen of the Country« bei Ballantine Books, Random House Inc., New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Das Geheimnis von Montford« bei dtv.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1996 Sarah Smith
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-567-5
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Sünde eines Sohnes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sarah Smith
Die Sünde eines Sohnes
Die Knights-Saga
Aus dem Amerikanischen von Susanne Kundmüller-Bianchini
dotbooks.
Für Kate Ross,eine gute Freundin,die zu früh gegangen ist
omnia mei dona Dei
Kapitel 1
Wie sagt man seinem Sohn, daß man einen Mord begangen hat?
Alexander Reisden machte der Mord nicht länger zu schaffen. Er hatte seine Schuldgefühle überwunden (überwunden, dachte er, so wie man eine schwere Erkältung überwindet); es ging ihm gut, zumindest einigermaßen. Aber so ein Mord hatte Auswirkungen auf die Familie. Er war wie eine Krankheit, die ein Opfer nach dem anderen forderte. Und Toby war noch so klein, seine Fingerchen umklammerten so vertrauensvoll den Daumen seines Vaters. Reisden vergötterte den Kleinen. Aber eines Tages, eines schrecklichen Tages, würde Toby alles erfahren.
Vielleicht verzieh Toby ihm, vielleicht hatte er großmütiges Verständnis. Aber wie würde er das Ganze verkraften?
Reisden hatte den Mord mit acht Jahren begangen. Es hatte seine Gründe gehabt, es war notwendig gewesen. Aber niemand weiß so etwas, wenn er acht Jahre alt ist. Toby würde die Wahrheit erfahren, aber Reisden hoffte inständig, ihn so lange davor beschützen zu können, bis er wesentlich älter war als acht.
Seine Sorge war wirklich krankhaft. Toby war erst siebeneinhalb Monate alt. Er hätte ihn hochnehmen und ihm ins Gesicht sagen können: »Dein Papa hat seinen Großvater umgebracht«, und er hätte lediglich gurgelnd gelacht und versucht, nach seiner Nase zu fassen.
Im Grunde wollte Reisden Toby überhaupt nie etwas davon erzählen, und er wollte auch nicht zulassen, daß es jemand anders tat. Toby sollte nie von dem verrückten William Knight erfahren, von Richard Knight oder all den Schrecken, die Kindern widerfahren konnten. Seinem Sohn sollten diese Dinge erspart bleiben.
Es gibt ein Märchen, in dem es ähnlich zugeht, es handelt von liebenden Eltern, einem Fluch und den ganzen Spindeln eines Königreichs, aber Reisden kannte das Märchen nicht. Er wußte nur, daß ein Vater seinen Sohn beschützen mußte.
Genau wie die Mutter, überlegte Reisden, aber Perdita schützte Toby nicht.
Das erste, was sie nach Tobys Geburt gesagt hatte, war, wie froh Gilbert sein würde. Sie schrieb Gilbert jede Woche. Sie schickte ihm Geschichten über Toby, Photographien von Toby, eine Locke von Toby, um die sie ein Bändchen gewickelt hatte. Bitte nicht, dachte Reisden im stillen, um Gottes willen, strafe Toby nicht mit Gilbert Knight.
Gilbert war diskret genug, sich fernzuhalten, aber Perdita bestand darauf, ihm weiter zu schreiben.
Reisden schalt sie statt dessen wegen ihrer Augen, was nicht fair war. Perdita wollte unbedingt hinaus auf die Straßen von Paris, nur mit Toby und ihrem weißen Stock. »Laß das Kindermädchen mit ihm spazierengehen.«
»Aber ich bin gern draußen«, entgegnete sie sanft, »und außerdem muß ich lernen, mich auf den Straßen zurechtzufinden.«
»Nicht mit ihm.«
»Glaubst du, daß ich nicht vorsichtig bin, Alexander?«
Er hatte seine Zweifel. Sie war leichtsinnig. Sie konnte nur noch Farben und schemenhafte Umrisse erkennen; sie würde möglicherweise Tobys Kinderwagen auf die Straße schieben, ohne den Bus oder das Pferd zu sehen. Ihm war, als spürte er den Zusammenprall am eigenen Körper. Er machte sich schreckliche Sorgen um seinen Sohn; irgendwann, irgendwie würde ihm etwas Schlimmes zustoßen.
Sie war unvorsichtig, was Gilbert betraf.
Sie ist waghalsig, hatte er einmal von der intelligenten, widerspenstigen, schönen jungen Frau gedacht, in die er sich verliebt hatte, lange bevor sie die Mutter seines Sohnes geworden war. Der Gedanke machte ihn traurig. Er liebte sie.
Auch das war krankhaft, dachte er; auch das vielleicht eine Art Mord, das langsame Sterben, das eine solche Tat in der Familie auslöste.
»Seid ihr besorgt um eure Kinder?« fragte er andere Väter. Ja, antworteten sie, natürlich waren sie das.
Konkreter konnte Reisden nicht werden, wenn es darum ging, was mit seiner Familie nicht in Ordnung war.
Finanzielle Sicherheit, wenigstens hierfür ließ sich sorgen.
General Lucien Pétiot sah aus wie der Weihnachtsmann in seiner himmelblauen Uniform; er hatte einen weißen Rauschebart, blitzende blaue Augen und war bei der französischen Armee für die Beschaffung (Abteilung Medizin) zuständig. General Pétiot kaufte tonnenweise Verbandsmaterial, Fässer voller Merkurochrom, Berge von Hustenpastillen – und Tests für die französische Armee. Intelligenztests, psychologische Tests; jeder Mann in Frankreich diente drei Jahre beim Militär; die Streitkräfte mußten wissen, wo potentielle Offiziere zu finden waren, aber auch, wo sich potentielle Probleme verbargen.
Reisdens Firma, die Jouvet-Klinik, Medizinische Analysen, erstellte psychologische Gutachten für Gerichte und entwickelte spezielle neurologische Tests für Krankenhäuser in ganz Europa. Jouvet war in der Lage, Berthets Intelligenztest auf große Gruppen auszudehnen. Kurz nach Tobys Geburt im September 1910 wandte sich Reisden das erste Mal an Pétiot: »Wir möchten die Streitkräfte mit medizinischen Tests und neurologischen Erkenntnissen auf Vordermann bringen.«
»Sie sind ein ehrgeiziger Mann.«
»Ich habe einen Sohn.«
Während der nächsten sechs Monate trafen sich Reisden und Pétiot regelmäßig zum Abendessen, fachsimpelten ganze Nachmittage lang über den Stand der Medizin in Frankreich, tauschten Ansichten aus, kritisierten die Regierung, tasteten sich gegenseitig ab. Pétiot besichtigte das halb fertige Klinikgebäude, das sich nach den großen Überschwemmungen von Paris im Wiederaufbau befand. »Sie wollen das Geld«, sagte Pétiot, während er das teure neue Labor bewunderte. »Ich will den Auftrag«, erwiderte Reisden. »Lassen Sie mich mit Ihren Mitarbeitern sprechen«, sagte Pétiot. Im Verlauf des Winters gehörte Pétiot bald ebenso selbstverständlich zum Inventar der Klinik wie die Katze der Concierge; ständig tauchte er bei Mitarbeiterbesprechungen auf, stöberte an der Werkbank eines Technikers herum oder lauerte vor den verschlossenen Türen des berühmten Archivs der Klinik.
An einem kalten Aprilmorgen des Jahres 1911 kam Pétiot in Reisdens Büro und ließ die Bombe platzen.
»Mit dem Angebot gibt es nur ein Problem, Reisden. Und dieses Problem sind Sie. Ihr Hintergrund.«
Sie saßen auf nicht ausgepackten Bücherkisten, inmitten von Chaos. Die Wände waren erst zur Hälfte tapeziert, der Lack der Holzvertäfelung war noch frisch, die Luft roch nach feuchtem Putz.
»Politisch ist dies ein ungünstiger Moment«, meinte Pétiot. »Deutschland hat sich mit Spanien und Österreich-Ungarn verbündet und bedroht uns; das französische Heer ist zahlenmäßig klein und schlecht ausgerüstet; und genau in diesem Augenblick beschließt der Intelligenteste der Von-Loewenstein-Waisen, daß er mit uns kooperieren will. Da fragt man sich, was Sie eigentlich im Schilde führen. Hat sich Leo von Loewenstein nicht auch immer so ausgedrückt?«
»Die Geschichte von den Waisen ist ein Märchen.«
»Ein Märchen, natürlich, ja«, sagte Pétiot. »Aber Tatsache ist, daß einer der sagenumwobenen Waisen eine französische Klinik besitzt, die medizinische Analysen vornimmt – Analysen von der Sorte, die peinliche Enthüllungen über Militärs und Regierungsbeamte zu Tage fördern könnten.« Pétiot runzelte die Stirn. »Einige Leute sind ziemlich beunruhigt.«
»Ich bin mir der schwierigen Situation bewußt.«
»Das dachte ich mir.«
Pétiot hatte eine schmale Ledermappe mitgebracht, die er nun auf eine der Bücherkisten legte und öffnete. »Alexander von Reisden«, las er laut vor, »1879 in Südafrika geboren, einziger Sohn des Baron Franz von Reisden, ja, ja, 1889 adoptiert von Graf Leo von Loewenstein, einem Diplomaten.« Pétiot sprach das Wort Diplomat gedehnt aus und zog dabei seine weißen Augenbrauen in die Höhe. »1898 machten Sie die Schwester eines radikalen Russen zu Ihrer Geliebten. Loewenstein wollte Näheres über die Radikalen wissen. 1900 heirateten Sie Ihre Geliebte, aber sie verstarb noch im gleichen Jahr – sehr traurig. Im Oktober 1906 zogen Sie nach Paris, erwarben Anfang 1907 die Klinik. Und im Januar 1910 haben Sie Perdita Halley geheiratet, die Erbin des amerikanischen Millionärs Gilbert Knight.«
»Tasy wußte nichts von Michails Machenschaften, und Perdita ist nicht Gilberts Erbin.«
»Erzählen Sie mir von Gilbert Knight«, verlangte Pétiot.
Reisden drückte auf ein geschnitztes Laubblatt an einem der Regale, worauf ein Teil der Vertäfelung zurückschwang. Dahinter kam eine frisch gestrichene Treppe zum Vorschein, die hinauf zu Reisdens Apartment führte. Entlang der Treppe hingen Photographien von Toby, Perdita und ihren Freunden: Roy Daugherty, Suzanne Mallais, Reisdens Neffe Tiggy und dessen Hund. In der hintersten Ecke zwischen den Fenstern hing ein kleines, unscheinbares Bild. Reisden holte es hervor und reichte es Pétiot. »Gilbert Knight«, sagte er.
Pétiot betrachtete die Photographie, schaute dann auf zu Reisden. »Eine verblüffende Ähnlichkeit. Wirklich bemerkenswert.«
»Seine Anwälte fürchteten, ich könnte ein bislang unbekannter Verwandter sein«, sagte Reisden. »Möglicherweise sein Neffe Richard, der als verschollen gilt. Aber dem ist nicht so.« Eine überflüssige Bemerkung, dachte er.
»Eine amerikanische Herkunft hätte sich für Sie nicht schlecht gemacht. Besser zumindest als die Verbindung zu Loewenstein.«
»Wer genau hat denn etwas gegen mich einzuwenden?«
Pétiot fuhr sich nachdenklich durch seinen Bart. Reisden hob fragend die Brauen.
»Maurice Cyron«, sagte Pétiot schließlich.
»Cyron?« Reisden legte Gilberts Bild auf einer der Bücherkisten ab.
»Wieso mag Cyron Sie nicht?«
»Ich habe einmal etwas getan, das ihm nicht gefallen hat.«
»Könnten Sie es rückgängig machen?«
»Das wollte ich gar nicht.« Er dachte an Toby, daran, daß er ihn schützen mußte. »Was sagt er über mich?«
Pétiot zuckte mit den Schultern. »Ich habe in einem Club Ihren Namen erwähnt, er war zufällig in der Nähe. Den Ausbruch hätten Sie erleben sollen. Er sagte, Sie hätten seinen Stiefsohn ruiniert, Sie wären selbst neurotisch und würden Andrés Wahn fördern; dann behauptete er noch, Sie wären ein Spion und so weiter und so fort.«
Reisden stand auf. »Cyron ist stets darauf aus, André zu bevormunden. André hatte mich gebeten, bei einem seiner Stücke mitzuwirken. Damals war er noch Kavallerieoffizier. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie fehl am Platz André in der Kavallerie war, einmal hat er sogar sein Pferd verloren. Er war völlig verzweifelt, ertrug es nicht, das Theater vernachlässigen zu müssen. Er hatte ein Gebäude gefunden, das er sich leisten konnte, war Jules begegnet, der die Rollen, die er schrieb, perfekt spielte ... Aber er konnte es Cyron nicht erklären. Er konnte mit ihm nicht über die Art Theater sprechen, die er machen wollte. Er bat mich, ihn zu begleiten, um mit Cyron zu sprechen, ihm zu erklären, weshalb André, Graf von Montfort, nicht länger das Leben führen konnte, das Cyron für ihn geplant hatte.«
»Warum ist er gerade auf Sie verfallen?«
»Heute wünschte ich natürlich, ich hätte mich nicht darauf eingelassen.« Gilberts Bild lag immer noch auf der Bücherkiste. Reisden drehte es um. »Aber nein, das ist nicht wahr. Ich habe einmal einen Verrückten erlebt, der ein Kind fast zu Tode geprügelt hätte. Ich kenne mich mit Verrückten aus, das bringt die Arbeit in der Klinik mit sich. Ich bemühe mich um diese Leute, versuche, sie in die Normalität zurückzuholen. Sie haben mich gefragt, warum ich diesen Auftrag haben will. Cyron war schon immer ein Tyrann. Er hat André für verrückt erklärt, nur weil der sich einer etwas eigenwilligen Art von Theater verschrieben hat. André ist ein merkwürdiger, trauriger Kerl – aber verrückt ist er nicht.«
»Haben Sie André im vergangenen Jahr gesehen?«
Reisden schüttelte den Kopf. »Außer meiner Familie und den Bauarbeitern habe ich so gut wie niemanden gesehen.«
»Wußten Sie, daß er verheiratet ist?«
»André?«
»Mit einem jungen Mädchen vom Lande.« Pétiot schüttelte den Kopf. »Maurice macht sich große Sorgen um sie.«
Kapitel 2
Maurice Cyron blickte aus dem Fenster seines Automobils. Die ganze Straße war von Kutschen und Wagen verstopft. Die Menschenmenge vor der Jouvet-Klinik hatte sich bis in die Rue de l’Université aufgestaut. Blitzlichter flammten auf, beleuchteten Männer in Zylindern und Frauen mit Diademen. Cyron preßte die Lippen zusammen. »Fahren Sie mich zum Hintereingang«, wies er seinen Chauffeur an.
Aber selbst hier hielten Wagen und Taxen, um weitere Gäste aussteigen zu lassen. An der Tür hatte sich eine Schlange gebildet. »Ich bin nicht hier, verstanden«, schnitt Cyron dem Portier das Wort ab, bevor dieser etwas sagen konnte. »Ich will mir nur das Stück meines Stiefsohns ansehen, das ist alles.«
»Ich sage Dr. Reisden Bescheid, Monsieur ...«
»Nein.« Man würde ihn für einen Patienten halten – oder für einen Bewunderer der Klinik.
Ein Betrieb ist nichts anderes als ein Theater: im Vordergrund strahlt alles und glänzt, hinter den Kulissen jedoch zeigen sich die wahren Zustände. Die Gesellschaft wurde im vorderen Teil des Hauses gegeben. Cyron ging zuerst nach unten, in den wiederhergestellten Keller. Verschlossene Türen. Stabile, ordentliche Regale. Alkohol, Desinfektionsmittel, Medikamente. Gurte, Stützen, Zwangsjacken. Eine Gummizelle. Schlösser und Riegel. Ein Gefängnis, in dem Geheimnisse weggeschlossen werden konnten. Reisden hatte solide gebaut. Vermutlich war er nun bis über beide Ohren verschuldet.
Oben drängten sich die Leute dicht an dicht. Auf den Fluren hingen Urkunden und Danksagungen. Von den Mitarbeitern der Kaiserlichen Nervenheilanstalten in Berlin, Potsdam und Wien. Die Deutschen. Von der Salpêtrière-Klinik in Paris, dem Invalidenhaus, der Universität zu Nancy, einer englischen Veteranenvereinigung, überall Anerkennungen für die verdienstvolle Arbeit an geisteskranken Patienten. Cyron verzog das Gesicht. Von Krankenhäusern und Ärzten aus allen Teilen Europas. In der Erforschung der Geisteskrankheiten, las Cyron, ist die Jouvet-Klinik wegweisend.
Schwer atmend stieg Cyron die Treppe hoch in den zweiten Stock, auf der Suche nach Dingen, die er hassen konnte. Ein großes Labor, neue Mikroskope auf den Arbeitsbänken, alles weiß und steril. Die Fenster hier waren ebenfalls vergittert. Notbeleuchtung auf dem Flur sorgte auch nachts für eine ausreichende Sicht. Alle Schubladen waren sorgsam verschlossen. Im dritten Stock schaute er durch eine vergitterte Tür in einen großen Raum, in dem mehrere Aktenschränke standen. Die Tür war jedoch verriegelt, und auch die Schränke waren mit zusätzlichen Schlössern versehen. Am anderen Ende dieses mehrfach gesicherten Raums versperrte eine undurchsichtige Glastür den Weg in einen weiteren Raum.
Ein Ort wie geschaffen für Geheimnisse. Reisden hatte eine Vorliebe für Geheimnisse, hatte sie immer gesucht, auch schon als kleiner Junge.
Am Büro des Klinikleiters prangte Reisdens Name. Seltsamerweise waren alle Türgriffe aus rotem Porzellan – das Rot hell und durchscheinend, fast wie Blut. Hinter Vitrinentüren blitzten goldene Buchstaben auf roten Buchrücken auf. Klinische Pathologie, las Cyron. Erkrankungen des Nervensystems. Die Fenster standen offen. Vom Hof drang lebhaftes Stimmengewirr zu ihm herauf.
Siebzehn Jahre war Reisden alt gewesen, als André ihn zum ersten Mal mit nach Montfort gebracht hatte. Ein hübscher, dünner, nervöser Junge, das schwarze Haar mit Pomade geglättet, so wie es damals unter den jungen Leuten Mode war, die Haut so blaß, daß sie durchsichtig wirkte. Er hatte permanent geraucht, eine blasierte Miene aufgesetzt und ihn und André angestarrt, als wären sie Tiere im Zoo.
Sie können gut mit Ihrem Stiefsohn umgehen, hatte Reisden gesagt. Es ist manchmal sicher nicht ganz einfach mit ihm. Reisden interessierte sich wie besessen für Nervenleiden, Geisteskrankheiten. Der ungünstigste Einfluß für André, den man sich vorstellen konnte.
Und heute gehörte Reisden die Jouvet-Klinik. Cyron ließ sich am Schreibtisch des Eigentümers nieder – einem großen, schweren Tisch mit Schubladen. Englisch, so wie er es selbst bevorzugte. Die Schubladen waren abgeschlossen.
Wie alt mochte Reisden jetzt sein? Einunddreißig. Ein skrupelloser Mensch auf dem Höhepunkt seiner Macht.
Unten im Hof hörte er Jubel und Applaus. Cyron erhob sich und trat ans Fenster.
In der porte cochère war eine riesige schwarze Kutsche aufgetaucht. Die Gäste lachten und machten zurückweichend Platz. Zwei Rappen bäumten sich effektvoll auf, während der Kutscher, der wie ein Messingskelett auf dem Bock saß, seinen Arm hob und die Peitsche über ihnen schwang. Die Kutschentür ging auf und zum Vorschein kam eine Gestalt, hager wie ein Gerippe, den Kopf als Totenschädel geschminkt:
André.
»Ich, Necrosar, König des Horrors am Grand Necropolitain Théâtre du Monde, präsentiere Ihnen Monsieur Jules Fauchard, den am häufigsten ermordeten Mann von Paris! Zusammen mit der Truppe des Grand Necropolitain Théâtre!« »Necrosars« Stimme hinter der Totenmaske klang hohl und übertrieben präzise, jedes T war so deutlich zu hören wie das Ticken einer Todesuhr. Er bewegte sich mit der lauernden Schnelligkeit einer Spinne, gleichzeitig hölzern, abgehackt, als sei er eine Marionette. Cyron konnte die Muskeln, die Statur des Kavallerieoffiziers sehen, der André einmal gewesen war, immer noch hätte sein sollen. Er hätte Frankreich gegen die Deutschen verteidigen sollen, anstatt sich hier zum Hampelmann zu machen.
André stieg die Stufen zum Klinikeingang hinauf und blieb auf dem obersten Treppenabsatz stehen. »Anläßlich der Wiedereröffnung der Jouvet-Klinik erleben Sie heute abend exklusiv das neue, originelle Stück: Es ist genug – oder Das Ende einer häuslichen Krise!«
Jules und eine Frau liefen die Stufen hinauf und plazierten sich vor den französischen Türen. Zwei weitere Frauen und Männer stellten sich auf den unteren Treppenabsatz. André und Jules sahen sich lächelnd an. Cyrons Herz zog sich kummervoll zusammen.
»Mesdames! Messieurs! Verehrte Irre! Hinter den Mauern von Jouvet haben sich schon viele traurige Geschichten abgespielt – dies ist eine davon.« Necrosar wies mit der Hand auf Jules, und das Stück begann.
»Was für ein Tag am Theater, meine liebe Frau!« setzte Jules mit erhobener Stimme ein. »Dieser strenge Arbeitgeber André du Monde hat mich heute fünf Tode sterben lassen! Ich wurde zerquetscht, aufgespießt, guillotiniert ... das hält man im Kopf nicht aus!« Jules faßte sich an die Stirn.
»Ah, mon pauvre ami!« erwiderte die Ehefrau. »Wie kann man dir nur helfen?« (Aus irgendeinem Grund Gelächter.)
»Meine Liebe – ich bedaure es wirklich sehr – aber ich muß das Dienstmädchen töten.«
Die Ehefrau klingelte. »Sylvie? Monsieur Jules verlangt nach dir.« Die Schauspieler bewegten sich an eine Stelle, wo Cyron sie nicht mehr sehen konnte. Dann ertönte ein heiserer Schrei, gefolgt von weiterem Gelächter, so mechanisch, als käme es von einer Schallplatte.
Dumme, hirnrissige Stücke. Mit dummen, hirnrissigen Geschichten. Heute abend saß Andrés liebreizende junge Frau zu Hause in Montfort, verzehrte sich vor Sehnsucht und wartete, daß ihr Ehemann ihr ein wenig Aufmerksamkeit schenkte – und was tat André? Er produzierte schlechte Stücke für Leute, die ihn nicht wollten und ihn noch nicht einmal dafür bezahlten.
Theater ist ein Werkzeug, mein Junge, dachte Cyron. Es ist kein Rauschmittel.
»Ich fühle mich etwas besser«, sprach Jules Fauchard unten im Hof, »aber noch nicht gut genug. Es tut mir leid, aber der Chauffeur – er muß ebenfalls dran glauben.«
»Wie unerquicklich, mein lieber Gatte. Wer wird dann unseren Wagen fahren?«
Die Frau strapazierte ihre Stimme. In einigen Jahren würde sie nur noch ein heiseres Krächzen von sich geben können. Jules Fauchard besaß keinerlei Ausstrahlung. Er sah aus wie ein Klempner, wie ein Mann, der an Sonntagen Fußball spielte: gewöhnlich, muskulös, vulgär, ein Niemand mit einem Schnurrbart. Unten knallte eine Requisitenpistole, als Jules den Chauffeur erschoß. Als nächstes wurde die Köchin gerufen, die einmal kurz kreischte, bevor sie starb. Das Publikum schmunzelte nachsichtig.
»Mein lieber Gatte, fühlst du dich jetzt endlich besser?«
»Leider nein. Es ist ...«
»Nicht genug!« rief das Publikum.
»Aber mein lieber Gatte, wir haben jetzt keine Diener mehr. Wie ärgerlich!«
»Du hast recht! Dienstboten kann man ersetzen«, sagte Jules, »eine liebende Gattin wie dich hingegen ...«
In Reisdens dunklem Büro tat sich eine Öffnung in der Wandvertäfelung auf, eine Geheimtür, aus der ein heller Lichtstrahl fiel. Zum Vorschein kam eine schlanke, dunkelhaarige Frau im Abendkleid, die mit einem Arm ein schläfriges Kind auf ihrer Hüfte trug, den anderen Arm dabei ausstreckte und sich langsam vortastete.
Sie war jung, sehr hübsch und offensichtlich die Mutter des Babys; niemand sonst hätte das Kind so liebevoll und stolz halten können. Sie strahlte eine Ruhe und Sicherheit aus, die für sie und ihr Kind völlig selbstverständlich zu sein schienen. Sie nahm das kleine Bündel in beide Arme, hob es hoch und legte seinen Kopf auf ihre Schulter. Vom Licht geblendet, starrte sie an Cyron vorbei. »Oh«, rief sie, »ist hier jemand?«
Hinter ihr traten Lucien Pétiot und Reisden in den Raum. »Ich wußte nicht, daß André mit der ganzen Necro-Truppe hier auftauchen würde«, beschwerte sich Reisden und hielt dann inne. »Cyron«, sagte er.
Sie veränderten sich. Die Jungen wurden erwachsen. Cyron starrte ihn an. »Cyron«, sagte Reisden, »darf ich Ihnen meine Frau und meinen Sohn vorstellen.«
Er hatte seinen Akzent verloren. Er war immer noch auffällig groß und schlank, wirkte aber stabiler, kräftiger. In seinem Blick, der früher so gehetzt gewirkt hatte, lag nun ein gewisser Stolz. Ein Mann. Ein Vater mit seinem Sohn.
Reisden war verheiratet. Reisden hatte ein Kind. Reisden nahm seinen Sohn auf den Arm. Das Kind begann an der weißen Krawatte seines Vaters zu zerren.
»Das ist kein Spielzeug, mein kleiner Schatz«, sagte Reisden und kitzelte das Baby sanft an der Nase. »Cyron, dies ist Jean-Sebastien Louis Victor Reisden, besser bekannt als Toby Bäuerchen.«
Reisdens Sohn schaute Cyron über die Schulter seines Vaters hinweg an und lächelte, das glückliche, zahnlose Lächeln eines Babys, das immer nur geliebt worden war. Sein schwarzes Haar stand ihm zu Berge. Er sah Reisden ähnlich.
Womit hast du einen Sohn verdient? Weißt du noch, was du zu meinem Sohn gesagt hast?
Jules Stimme drang von unten zu ihnen herauf. »Es ist eine endlose Krise. Erneut müssen treue Diener ersetzt werden. Erneut wurde eine liebevolle Ehefrau erschlagen. Und warum? Warum? Ich frage mich, warum?«
Immer geht es um Familien und Tod, dachte Cyron. André schreibt von nichts anderem als vom Tod. Und ich kann ihn nicht ändern. Wenn überhaupt, dann hätte ich gedacht, daß Sabine es schafft, aber nicht einmal sie kann ihn ändern, ihm ist nur dieses Schmierentheater wichtig, diese morbiden Phantasien über Familien und Morde. Das Ganze geht zu weit, manchmal wünschte ich wirklich, er wäre tot. Wenn André ihr wenigstens ein Kind schenken würde ...
»Sehen Sie nur!« rief Pétiot, der am Fenster stand. »Cyron, Reisden, kommen Sie, das ist lustig.«
Cyron schaute aus dem Fenster. Jules verfolgte André gerade mit einem riesigen Gummimesser. »Ein Mann allein ist schuld an meinem Unglück! Wenn ich durchdrehe, ist er immer in der Nähe! Stirb, Necrosar, stirb!« Jules stach André mit der wabbelnden Klinge nieder. »Endlich!« rief er, und das Publikum stimmte im Chor ein: »Endlich ist es genug!«
Es ist zuviel, dachte Cyron.
»Schauen Sie«, meinte Pétiot, »Sie kommen auch in dem Stück vor, Reisden. Sollen das da vorne nicht Sie sein?«
Der angeblich tote Necrosar hatte eine Gummiaxt hervorgeholt und robbte auf Jules zu. Krach! Jules taumelte und fiel gegen die Balustrade. Während der tödliche Dolch immer noch wabbelnd unter Necrosars Achsel hervorschaute, rieb sich Necrosar die Hände und grinste. Ohne daß er etwas merkte, richtete sich Jules auf, stützte sich auf einen Ellbogen – mit einer Hand hielt er dabei die Axt fest – und zog eine Pistole hervor; letzteres reichlich ungeschickt. Jules zielte, krümmte den Finger ...
»Wo?« fragte Reisden.
»Das dort sind Sie.«
Ein großer Mann in einem eleganten schwarzen Anzug löste sich aus den Zuschauerreihen. »Oh, mein guter Mann, wir müssen ernsthaft miteinander reden. Dieser hier ist tot – und dieser auch ... Jules, wie exzessiv.«
»Es ist wahr«, sagte Jules, während er mit der Pistole herumfuchtelte und reuig auf die Leichen starrte. »Mord zerstört die Harmonie des Familienlebens.«
»Es ist wahr«, murmelten die Leichen, die zusammengekrümmt auf den Treppenstufen lagen.
»Aber was sollen wir dagegen tun?« zischte Necrosar und holte ein rundes Objekt hervor, das mit der Aufschrift BOMBE versehen war.
Cyron beobachtete, wie Reisden auf Andrés Interpretation seiner Person reagierte. Ein amüsiertes Gesicht, ein wenig skeptisch, menschlich, das Gesicht eines Vaters mit einem Sohn. Pétiot neben ihm lachte, die junge Frau lachte ebenfalls, und das Baby lächelte ...
»Sie lachen, ja?« explodierte Cyron. »Darüber können Sie lachen? Und hier ein Fest feiern? André war früher selbst einmal in der Klinik, und es hat ihm, verdammt noch mal, nichts gebracht. Ich war derjenige, der ihm geholfen hat, ich. Als ich ihn adoptierte, hat er noch nicht einmal gesprochen. Ich habe ihm geholfen, ich allein, niemand hat mich dabei unterstützt. Und was passiert, nachdem ich ihn durchs College gebracht, nachdem ich ihn in ein Regiment eingekauft habe, damit er Offizier werden konnte, so wie sein Vater, sein Großvater und jeder andere de Montfort vor ihm auch? Nachdem ich es ihm beinahe ausgeredet hatte, seine Zeit mit dieser Schauspielerei zu verschwenden?«
Sein Ton erschreckte das Baby. Es verzog das Gesicht und fing an zu weinen. »Hören Sie auf«, sagte Reisden, »Sie machen meinem Sohn angst.« Die junge Frau nahm das Kind und wiegte es beruhigend in den Armen. Der Kleine starrte über ihre Schulter, die Augen weit aufgerissen, mit zitternden Pausbäckchen, der Blick bestürzt, empört.
»Ich sage Ihnen, was er getan hat, Pétiot, ich sage es Ihnen. Sehen Sie selbst, was für eine feine Bekanntschaft André gemacht hat. Die beiden kommen eines Tages zusammen nach Montfort. André ist völlig begeistert von seinem neuen Freund, weil er angeblich ›schauspielern‹ kann, was aber gar nicht zutrifft, er ist einfach nur ein guter Amateur. Es stellt sich heraus, daß André ihn mitgebracht hat, weil er mich überreden soll, daß André die Kavallerie verlassen darf. Er, dieser siebzehnjährige kleine ... Windhund, dieser schmierige Kerl mit seinem pomadisierten Haar ... und er glaubt, es besser zu wissen als ich. ›Nur zu‹, sagt er zu André, ›schreib deine Stücke, bring sie auf die Bühne, du hast Talent.‹ Und zu mir sagt er ... Wissen Sie, was er zu mir gesagt hat? ›Warum lassen Sie ihn nicht?‹ sagt er. ›Dafür ist er geeignet.‹ Mit anderen Worten, das ist alles, wofür er taugt. Genau das hat er zu mir gesagt.«
Wie konnte er es wagen. Ein Siebzehnjähriger. Wie konnte er sich erdreisten, André beurteilen zu wollen, mit siebzehn.
»Cyron ...«, sagte Pétiot, »immerhin ...«
»›Es wird ihn unglücklich machen, wenn er keine Stücke schreiben kann‹, so lauteten Ihre Worte«, wandte sich Cyron an Reisden. »Sie erinnern sich doch?«
Reisden nickte. »Perdita, Liebes«, sagte er, »bring Toby nach oben.«
»Und jetzt ist er glücklich, ja? Gott bewahre jede Familie davor, so glücklich zu sein, wie wir es sind. Es hat ihm nicht gutgetan, all diese Phantasien herauszulassen. Metzeleien in Familien. Er ist verheiratet, aber seine Frau fürchtet sich vor ihm. Mit gutem Grund! Das Theater hat ihn für die Ehe ruiniert – hat ihn selbst zerstört.«
Unten im Hof hatten sich die Leichen erhoben und stimmten gemeinsam ein Lied an.
Wenn du anfängst durchzudrehen,
statt zu morden, geh zu Jouvet ...
»So soll die Heilung eines kranken Mannes aussehen? Sie haben ihn in seiner Schwäche bestärkt, Reisden«, wütete Cyron. »Sie werden für das Leid bezahlen, das Sie uns angetan haben.«
Pétiot hob beschwichtigend die Hand.
Cyron schüttelte den Kopf. »Ich werde Sie ruinieren«, stieß er hervor. »Die Jouvet-Klinik hat nichts für André getan, und das werde ich an die Öffentlichkeit bringen. Ich werde über die Klinik reden. Und über Ihren Vormund von Loewenstein ebenfalls, diesen Spion. Ich habe Sie in der Hand.« Er hob seinen Arm und ballte die Finger zur Faust.
Die junge Frau hatte sich nicht von der Stelle gerührt. Sie sah blaß und zu Tode erschrocken aus. Das Baby weinte in ihren Armen. Pétiot hatte den Mund geöffnet, als wolle er protestieren, sagte aber nichts. Wenn Maurice Cyron das Wort ergriff, verstummten alle anderen.
»Nein«, widersprach Reisden.
»Wie?«
»Sie haben nicht mich, sondern André in der Hand. Die Klinik berät in Fragen mentaler Störungen und Krankheiten. Wir haben den besten Ruf in ganz Europa. Sie machen sich Sorgen um André, aber Sie bringen ihn nicht zu uns.«
»Ich soll ihn nicht gebracht haben? Natürlich habe ich das getan«, erwiderte Cyron.
»Als Sie ihn adoptiert haben. Das ist jetzt dreißig Jahre her, eine halbe Ewigkeit, wenn es um medizinische Forschung geht. Wollen Sie, daß wir ihm zu helfen versuchen, oder ziehen Sie es vor, uns weiter zu attackieren und damit seine Heilungschancen zu verringern?«
»Sie können ihm nicht helfen«, sagte Cyron. Unten im Hof hatte eine dreiköpfige Musikkapelle zu spielen begonnen. Necrosar stand mit seinem grünschillernden dunklen Anzug und dem leichenblaß geschminkten Gesicht daneben, hielt Jules’ Hand und sang lauthals mit. War dies André de Montfort, Erbe einer der ältesten Familien Frankreichs?
Jou-Jou-Jouvet,
mach dich noch heute auf den Weg ...
Jou-Jou-Jouvet. »Sie können ihn nicht heilen«, sagte Cyron. »Ich habe es dreißig Jahre lang versucht. Und was mir nicht gelang, werden Sie erst recht nicht schaffen.«
Nicht, daß sich von Reisden überhaupt Mühe geben würde. Den Herrschaften von Loewenstein und von Reisden kam es doch nur allzu gelegen, daß sich der Graf de Montfort in aller Öffentlichkeit lächerlich machte. Sie lachten, jubelten, feuerten ihn an. O ja, Cyron wußte, wie es war, bewundert zu werden.
»Unterstützen Sie uns«, sagte Reisden. »Ich werde alles in meiner Macht Stehende versuchen.«
Der beste Schlußsatz war manchmal Schweigen. Cyron machte auf dem Absatz kehrt und verließ den Raum.
Kapitel 3
Milly Xico, Journalistin und enge Freundin der Reisdens, hatte eine Flasche Wodka mitgebracht, um sie alle betrunken zu machen, eine Bernsteinkette für Perdita und natürlich ihren Mops Nick-Nack, damit sie einen Bewunderer hatte. »Ich sehe Cyron vor mir, den alten Schwätzer. Er gestikuliert wild herum und stolziert wie ein Gockel davon, diese Kartoffel mit Nase. Seine Frisur ist ganz durcheinander, das Haar fällt ihm auf eine Seite, so daß jeder seine kahlen Stellen sehen kann. Und dazu ruft er: ›Verrräterrr! Verrräterrr!‹« Sie brachte ihre Freunde wider Willen zum Lachen. Sie saßen auf dem Hof in der Sonne. Milly kniete sich auf den Boden und rief ihren Mops. »Lauf, Nicky! Lauf dort drüben hin!« Sie streckte den Arm aus. »Pinkel in seine Fußstapfen. Guter Junge!«
Im letzten Jahr hatte Milly Xico angefangen, für den Film zu schreiben und darin aufzutreten. Sie war sehr photogen, doch die Kamera konnte ihre Erscheinung nie ganz einfangen: das flammendrote Haar; den typischen Milly-Geruch nach Parfum, billigen Zigaretten und Hund; die zynischen blauen Augen, die alles von Paris gesehen hatten.
»Ein bißchen kann man ihn schon verstehen«, meinte Reisden. »Zum einen ist er Andrés Stiefvater, zum anderen ist André wirklich nicht ganz normal.«
»Ihn jetzt auch noch in Schutz zu nehmen, wie langweilig. Zahl es ihm lieber heim. Bist du wirklich ein Spion?« erkundigte sich Milly. »Das behauptet der alte Schwätzer nämlich in sämtlichen Salons. Und bist du tatsächlich bankrott?«
»Nein«, erwiderte Reisden trocken. »Weder das eine noch das andere.«
»Du solltest für die Russen spionieren, die zahlen am besten. Prrropaganda«, rollte Milly genüßlich. »Bestechung nenne ich das. Schaut euch an, was die Russen für die Damen unter uns ›Meinungsbildnern‹ übrig haben!« Milly streckte kokett einen Arm aus, um ihre neueste Errungenschaft zu präsentieren – eine Schaffelljacke mit rotem Stickereibesatz, der modisch ihre Haarfarbe wieder aufnahm. »Meine Berufskollegen werden zu Festen eingeladen, bekommen Wodka, Kaviar serviert.« Millys saphirblaue Augen funkelten spöttisch. »Die Frauen ... wir Damen bekommen hübsche Spielzeuge. Bernstein ... ich kann die Ohrringe und Ketten schon gar nicht mehr zählen, die mir Botschafter Izvolsky geschenkt hat ...« Sie ließ ihre lange Kette aus Silber und russischem Bernstein durch die Finger gleiten. »Ist sie nicht schön? Als ob wir nie von Pogromen gehört hätten.«
Perdita strich nachdenklich über ihre eigene Kette.
»Sag einfach ›Danke, Izvolsky‹, und mach, was du willst. So handhabe ich es«, meinte Milly. »Sie werfen mit so viel Geld um sich, daß niemand die paar ehrlichen Leute bemerken wird. Such dir einen aus und halte die Hand auf.«
»Laß diese Scherze, Milly«, sagte Reisden. »Was ist mit André los?«
»Wer ist Maurice Cyron?« fragte Perdita.
Reisden und Milly schauten sie überrascht an; jedes kleine Kind kannte Maurice Cyron. »Ein Schauspieler«, sagte Milly.
»Ein Held«, erklärte Reisden. »Unser französischer Held.«
Sie hatten Brot und Käse nach draußen gebracht. Milly schnitt sich ein Stück Brie ab und verteilte es auf ihrem Bâtard. »Ein ehemaliger Kriegsheld, der heute Theater macht. Er hat sein eigenes Theater und inszeniert lauter Kriegsdramen.« Sie biß in ihr Brot und sprach mit vollem Mund weiter. »Es gibt stets eine große Kampfszene, stets ein Mädchen, das um ihn weint, das Publikum vergießt Tränen, wenn er verliert, und jubelt, wenn er gewinnt. Aber jetzt hat er keine Freunde mehr in der Regierung, er ist alt und nicht mehr so einflußreich wie früher, nicht wie bei der Dreyfus-Affäre. Er sehnt sich nach Unste-e-erblichkeit.« Milly zog das Wort spöttisch in die Länge. »Deshalb soll André – der noch nicht einmal sein richtiger Sohn ist – Kinder mit diesem Wagny-Mädchen in die Welt setzen!«
»Ist das das Problem mit André?« fragte Reisden.
»Dreyfus? Wer ist Dreyfus?« wollte Perdita wissen.
Die beiden starrten sie an. Sie errötete.
»Macht ihr zwei eigentlich nichts anderes, als euch miteinander zu amüsieren? Unterhält er sich nie mit dir?« wollte Milly wissen. »Männer! Du hast ihr nie von Dreyfus erzählt, liebster Sacha? Nicky, der Mann sagt seiner Frau kein Sterbenswörtchen.«
Nick-Nack, der den Boden nach Krumen absuchte, schaute bewundernd zu ihr auf. Milly bestrich ein Stück Brot mit Brie und ließ es für ihn fallen.
»Alfred Dreyfus«, sagte sie dann nachdenklich. »Vor fünfzehn Jahren wurde er verurteilt, weil er als französischer Hauptmann militärisches Geheimmaterial verkauft haben soll – das Vergehen, dessen Cyron nun unseren lieben Sacha beschuldigt. Aber ...«, Milly legte eine dramatische Pause ein, »... Dreyfus war es gar nicht. Der eigentliche Bösewicht war ein anderer Armeeoffizier, ein Mann namens Esterhazy, gebürtiger Österreicher, genau wie unser Liebling Sacha.« Milly lächelte Reisden schmeichlerisch an. »Dreyfus hingegen war Jude und der Anhängerschaft von Cyron noch suspekter als die Österreicher. Die Offiziere leiteten also einen weiteren kleinen Prozeß ein, und was glaubt ihr, wie ihre Entscheidung ausfiel? Haben sie Esterhazy verurteilt und Dreyfus von der Teufelsinsel zurückgeholt?«
Nick-Nack, der das ganze Stück Brot auf einmal verschluckt hatte, begann zu keuchen und zu würgen. Reisden reichte Toby an Perdita weiter, hob den Mops hoch und klopfte ihm auf den Rücken. Ein schleimiger Klumpen schoß aus seinem Maul heraus und landete auf den Pflastersteinen. Toby kreischte entzückt auf. Nick-Nack blinzelte aus feuchten Augen, zappelte, damit er heruntergelassen wurde, und lief dann zu dem Klumpen, um ihn erneut zu verschlingen.
»Nein, sie haben Esterhazy freigesprochen. Obwohl ihnen ein Brief in seiner Handschrift vorlag. Sie liebten ihren Esterhazy, so wie ein Hund Erbrochenes liebt«, sagte Milly, beeindruckt von ihrem anschaulichen Vergleich. »Nicht wahr, Nikky? Du magst dein Erbrochenes, weil es von dir ist.«
Toby machte blubbernde Geräusche und versuchte, genau wie Nicky zu spucken. »O nein, mach ihm das nicht nach, Liebling«, murmelte Reisden. »Du bist so ein gescheites Kind, aber guck dir das bitte nicht ab.«
»Ihr zwei wollt eine Einbürgerung beantragen, schön, bien. Aber seid ihr wirklich französisch? Tragt ihr russischen Bernsteinschmuck, um unsere edlen Verbündeten zu ehren? Besucht ihr Cyrons Theater, applaudiert und ruft Bravo, damit er all seine großen Reden noch einmal hält? Es reicht nicht, einfach nur Staatsbürger zu sein. Man muß jemandes Hund sein.«
»Cyrons Hund?« erwiderte Reisden.
»Halt dir die Ohren zu, Perdita«, sagte Milly. »Hast du das Wagny-Mädchen gesehen? Achtzehn Jahre alt und verrückt nach Sex. Von André bekommt sie so viel Befriedigung, daß sie sich die Finger genausogut selbst küssen kann. Das ist es, was mit Andrés Ehe nicht stimmt. Die Frau ist jung. Sie ist reich. Du könntest ihr Liebhaber werden; sie könnte dir Geld geben.«
»Milly!« rief Perdita.
»André schläft also nicht mit ihr?« meinte Reisden.
»Und sie hat Cyron um den kleinen Finger gewickelt. Stell dich gut mit Sabine Wagny. Werde Sabines Hund, und halte die Hand auf nach dem Armeeauftrag.«
Kapitel 4
Reisden machte sich auf die Suche nach Andrés Patientenakte. In der Jouvet-Klinik gab es zwei Arten von Karteien, dritter Stock und vierter Stock, die offenen und die geschlossenen. Offene Karteien konnten für die Forschung genutzt werden: allgemeine Untersuchungen, Medikamentenprotokolle. Die geschlossenen Karteien durften nur im jeweiligen Krankheitsfall eingesehen werden. Das System war um 1850 eingeführt worden, nachdem ein Angestellter der Klinik ertappt worden war, der Patienten erpreßte. Aber im vergangenen Jahr, nach der Überschwemmung, waren viele weitere Akten im vierten Stock gelandet.
Dafür waren die Loewensteins verantwortlich.
Direkt nach der Überflutung war Leos Sohn Sigi zu Besuch gekommen, um seine Hilfe anzubieten. Die Keller standen damals noch hüfthoch unter Wasser, und im Hof stapelte sich Geröll, das abtransportiert werden mußte. Sigi von Loewenstein, im eleganten Savile-Row-Anzug, hatte alles inspiziert, die von Balken gestützten Wände, das zerbrochene Mobiliar und die kaputten Instrumente, das Durcheinander von Kisten mit den geretteten Krankenkarteien, den feuchten Papierbrei, der alles überdeckte, und hatte Reisden eine hohe Summe angeboten.
»Mach dir keine Sorgen wegen des Geldes. Du leistest gute Arbeit. Mach dir keine unnötigen Gedanken.«
Spiel für jemanden den Hund ... Reisden dachte an Leos zahlreiche verlockende Angebote, Angebote, die man nur schwer ablehnen konnte. Nach Sigis Besuch hatte er angefangen, sich die Klinikkarteien mit Leos Augen anzusehen.
Der Quartiermeister der Armee, der einen türkischen Geliebten hatte. Der Fahrplanersteller der Eisenbahn mit seiner kleptomanischen Frau. Der Gemüsehändler, dessen Sohn ... Jede Person mit einem Familiengeheimnis ließ sich als Waffe im Krieg zwischen Frankreich und Deutschland einsetzen.
Konnte man Cyron mit André unter Druck setzen?
Der Krieg zog sich nun schon ein ganzes Jahrhundert hin; 1870, vor vierzig Jahren, hatten die Deutschen geglaubt, ihn bereits gewonnen zu haben. Die preußischen Armeen waren in Frankreich eingefallen und hatten gesiegt. Dreißigtausend Soldaten waren durch Paris marschiert (worauf die Pariser hinterher jede Straße, jeden Pflasterstein mit Desinfektionsmittel reinigten). Die Deutschen rissen sich die reichen Provinzen Elsaß und Lothringen unter den Nagel und verhängten drastische Reparationen, die, wie sie glaubten, Frankreich drei Jahrzehnte lang wirtschaftlich lähmen würden.
Frankreich jedoch beglich die Zahlungen innerhalb von drei Jahren.
Und seitdem hatte sich das Land überraschend stark entwikkelt. Es war Bündnisse mit England, seinem traditionellen Feind, sowie mit Rußland, Deutschlands Nachbarn im Osten, eingegangen. Deutschland befand sich nun in der mißlichen Lage, von zwei starken Feinden umzingelt zu sein. Sollten Frankreich und Rußland gemeinsam angreifen, müßte Deutschland einen Zweifrontenkrieg führen – und würde verlieren.
Deutschlands einzige Chance bestand darin, in die Offensive zu gehen.
Angenommen, Deutschland griffe Frankreich zuerst an, ohne Vorwarnung. Die russische Armee, die über riesige Gebiete verstreut war, bräuchte sechs Wochen, um die deutsche Grenze zu erreichen. Wenn es Deutschland gelänge, Frankreich innerhalb dieser sechs Wochen zu besiegen, würde sich Rußland nicht mehr einmischen.
Der Schlüssel zu Europa lag in Frankreich, und der Schlüssel zu Frankreich lag in diesem Zeitraum von sechs Wochen.
Ein Tag Verzögerung war den Deutschen ein ganzes Regiment wert. Ein Quartiermeister der Armee konnte erpreßt werden, so daß er Stiefel oder Munition vergaß. Einen Eisenbahnfahrplan-Direktor konnte man in einen Nervenzusammenbruch treiben. Ein paar Stunden Verzögerung hier, ein paar dort. Ein paar Stunden oder Tage zuviel, und die Deutschen standen vor Paris.
Reisden hatte die Quartiermeisterakte und alle ähnlichen Fälle hinauf in den vierten Stock verlagert. André war eine bekannte Persönlichkeit und außerdem Cyrons Stiefsohn; damit qualifizierte er sich ebenfalls für den vierten Stock. In einem gut geführten Betrieb mußte sich Andrés Akte nun zwischen MONTFI und MONTJ befinden.
Sie war nicht dort.
Sie befand sich auch nicht im dritten Stock, und falsch einsortiert hatte man sie auch nicht. Vielleicht war sie noch bei den Akten im Lager. Sie mochte sonstwo sein. Vielleicht war sie sogar während der Überschwemmung verlorengegangen.
Jedenfalls konnte sie ihm nicht sagen, wo Andrés Problem lag. Dies würde André selbst tun müssen.
Kapitel 5
Alexander und Perdita verbrachten möglichst viel Zeit miteinander, denn – was ihn immer ein wenig bedrückte und unglücklich machte – sie würde bald nach Amerika gehen.
Perditas New Yorker Agent, der sie nach ihrer Hochzeit zunächst nicht mehr vermitteln wollte, hatte ihr geschrieben. Wie es ihr ginge, womit sie ihre Zeit verbrächte. Der Agent hatte offenbar mit jemandem gesprochen, der sie auf einer Pariser Gesellschaft hatte spielen hören. Und nun bot er ihr eine Reihe kleiner Konzerte an, nichts Außergewöhnliches, die Bezahlung sei nicht der Rede wert, es lohne sich kaum, aber wenn sie doch interessiert sei und jetzt gerade frei wäre ...
Bitte, hatte sie gesagt. Ich weiß, daß wir uns das eigentlich nicht leisten können, Alexander. Aber trotzdem, bitte.
Sie fuhr also nach Amerika, und da sie Toby noch stillte, nahm sie ihn mit; deshalb waren er und Perdita jetzt gemeinsam unterwegs, gingen Arm in Arm, während sie Toby im Kinderwagen vor sich herschoben, um André einen Besuch abzustatten. In einem Park unweit des Necro bat er sie, hier auf ihn zu warten. André sollte keine Gelegenheit erhalten, sie oder Toby zu erschrecken.
Das Théâtre du Monde, wie das Necro offiziell hieß, lag im finstersten Viertel, das André hatte finden können, nur einen Sprung von der Place Blanche entfernt, dem Zentrum des Pariser Hurenmilieus. Es war ein windiger früher Junitag; um die Mittagszeit lag die Straße völlig ausgestorben da, nackt, ohne die gewohnten Schatten, die dunklen Gestalten. André stand vor dem Haus und sah zu, wie der Fries neu gestrichen wurde.
Necrosar bei Tageslicht: Zuerst fiel sein starrer Blick auf. Er schaute die Menschen bohrend an, so als wolle er sie durchleuchten, als versuche er herauszufinden, wozu sie fähig waren. Der Blick eines Besessenen. Im wirklichen Leben sah André nicht wie ein Gerippe aus, sondern wirkte groß und kräftig. Er lief barfuß, mit offenem Hemdkragen und schäbiger Kleidung. Er trug einen Segelpullover, der ihm nicht paßte und für die Jahreszeit zu warm war. Seine Hose war an den Knien ausgebeult. Er sah hungrig und ungepflegt aus. Seine Mähne benötigte dringend einen Haarschnitt. Sie stand ihm wirr vom Kopf ab, umgab ihn wie ein Kranz.
»Komm und sieh dir meine ägyptische Mumie an.« André führte ihn zum Eingang des Hauses.
Das Grand Necro war das kleinste Theater in Paris – und warf entsprechend wenig Profit ab. Doch nun war das elegante, in Grün und Gold gehaltene Foyer neu gestaltet worden. André zeigte auf einen großen Glaskasten. Reisden schaute hinein. Ein braunes, ledernes Gesicht starrte ihn an. Es schien zu grinsen, genau wie Necrosar.
»Gruselig?« fragte André.
»Nein, André.« Reisden hatte vergessen, wie nervtötend André manchmal sein konnte; er benahm sich wie ein kleines Kind, das den Leuten unbedingt seine Zaubertricks vorführen wollte.
»Ich werde dich schon noch das Fürchten lehren.«
André öffnete die Tür zum eigentlichen Theater. »Du hast dich neu eingerichtet«, stellte Reisden fest. Als junger Offizier hatte André mit seinen adeligen Freunden Stücke inszeniert, die in den Speisesälen ehrwürdiger Schlösser aufgeführt wurden. Das neue Necro war in einem ähnlichen Ambiente gehalten: luxuriöse Louis-Seize-Sessel, moosgrüne Polster, grüne Vorhänge. Genau so hatte ein Schloßtheater auszusehen – bis auf die kleinen geschnitzten Totenköpfe natürlich, die grinsend unter den Sessellehnen hervorlugten. André hatte nicht an Geld gespart – dem Geld seiner Frau, verstand sich.
André drehte die Beleuchtung herunter und ließ nur die Notausgangslampen an. Dann fingen auch diese Lampen an zu flackern, tauchten den Raum in tanzende blaugrüne Schatten und erloschen schließlich ganz. Reisden schloß die Augen und atmete tief durch.
»Die Dunkelheit«, flüsterte Necrosar in seiner übertrieben deutlichen Aussprache, »die Dunkelheit ... Alle fürchten sich vor ihr. Warum? Die Dunkelheit sollte dich beschützen, so wie eine Mutter. Sie sollte all die furchtbaren Dinge von dir fernhalten, die auf dich lauern. Aber sie tut es nicht.«
Es ertönte ein Geräusch, ein Poltern. Irgend etwas kam die flachen Stufen des Theaters heruntergerollt und blieb in der Nähe von Reisdens Füßen liegen. Großer Gott, dachte Reisden. Was hat er sich jetzt wieder einfallen lassen? Dann flammte das Licht auf, plötzlich und grell.
Aus dem Kopf des Mannes quoll immer noch Blut. Er lag auf dem Teppich, furchtbar zugerichtet, der Hals war ihnen zugewandt, so daß man die Luftröhre sehen konnte, die wie ein nach Luft schnappender Mund aus dem rohem Fleisch hervorklaffte. Der restliche Körper war über einen der Sessel drapiert. Reisden wich zurück, stolperte, konnte sich aber gerade noch halten. Er richtete sich auf und atmete ein zweites Mal tief durch, bevor er wieder in der Lage war zu sprechen.
»Sehr beeindruckend, André.«
»Du bist so verkrampft, Reisden«, erwiderte André.
Reisden ging auf die Gestalt zu und untersuchte sie vorsichtig. Wachshände, eine mit Körnern gefüllte Baumwollbrust.
»Um zur Sache zu kommen«, sagte er. »Dein Stiefvater hält mich für einen Spion; vor allem aber wirft er mir vor, dich zu diesen Necro-Stücken ermutigt zu haben.« André verschränkte abwehrend die Arme. »Und dies scheint irgendwie ein Problem zwischen dir und deiner Frau zu sein.«
Reisden konnte sich die Szenen ausmalen, die André womöglich für seine Hochzeitsnacht arrangiert hatte.
»Gibt es ein Problem? Ich will nicht aufdringlich erscheinen; das Ganze hatte überhaupt nichts mit mir zu tun, bis es dein Stiefvater zu meiner Angelegenheit machte. Aber ich liebe meine Familie und hoffe, daß du mit deiner glücklich bist.«
Für einen Augenblick verlor André seinen starren Blick und war nicht länger Necrosar, der König des Horrors, sondern André de Montfort, der letzte verarmte Vertreter eines alten Geschlechts, der im vergangenen Frühjahr geheiratet hatte. Einen Augenblick lang stellte sich André seinen eigenen Schwierigkeiten und wurde dabei menschlich.
»Familie? Meine Familie? Oh, es geht ihnen gut, sie sind tot.«
»Ich spreche von deiner Frau.«
»Meine Frau ist aufs Land gefahren«, sagte André, wie auswendig gelernt. »Ja. Ihr gefällt es auf dem Land.« Er lachte verkrampft. »Dort ist sie zu Hause.«
»Nicht bei dir?«
»Oh, nein, nein, nein ...«, erwiderte André. »Hast du Angst vor deiner Familie?«
»Hast du?«
»Eine Familie zieht Angst und Schrecken geradezu an. Deine Frau ist blind«, stellte André fest, wobei seine Augen wieder den starren Ausdruck annahmen. »Deine Frau ist blind, und doch sieht sie nach deinem Sohn. Und du sorgst dich nicht gern, Reisden! Du hast nicht gern Angst!«
André hatte von Anfang an gespürt, daß Reisden die Dunkelheit haßte, und setzte sie daher jedesmal ein. Und er wußte, daß Reisden sich um Perditas Sehvermögen sorgte. (Wieso? Hatte er gesehen, wie Reisden sie über die Straße führte?) André war eigenartig, aber nicht dumm. »Bedrückt dich irgend etwas?« fragte Reisden.
André lächelte, das zähnefletschende, furchterregende Lächeln des Horrorkönigs Necrosar, und sein Gesicht nahm erneut jenen starren, bedrohlichen Ausdruck an, den Reisden von der Bühne her kannte.
»Was könnte mich schon bedrücken?« zischte Necrosar.
Er schien zu ahnen, worauf Reisden anspielte, wollte aber offensichtlich nicht über seine Frau sprechen. Reisden plauderte ein wenig über seine eigene Familie, in der Hoffnung, André auf diese Weise etwas zugänglicher zu machen, doch André äußerte lediglich den Wunsch, Perdita zu sehen, vermutlich weil er spürte, daß sie Reisden Angst einflößte.
Perdita und Toby standen draußen und unterhielten sich mit einem Straßenmädchen. Toby schien sich eine Erkältung eingefangen zu haben. Reisden putzte ihm die laufende Nase. Toby griff nach dem Taschentuch und versuchte es sich in den Mund zu stecken.
André stand neben Reisden und starrte auf das Baby. Die Hosenbeine schlackerten um seine nackten Knöchel. André hatte immer sehr jugendlich gewirkt, doch jetzt im Sonnenlicht sah man die weißen Strähnen in seinem blonden Haar, die ungesunde Blässe seiner Haut.
»Familien«, murmelte André, streckte einen Finger aus und strich damit über Tobys gerötete Wange. Toby musterte sein Gegenüber skeptisch, unsicher, ob dieser Erwachsene wirklich freundlich war. »Es gibt kein Glück. Keine Sicherheit. Armes, armes Kind.«
Und dann fing er an zu lachen, das höhnische, kreischende Lachen Necrosars, bei dem Toby augenblicklich in Tränen ausbrach, genau wie bei der Begegnung mit Cyron.
»Laß meinen Sohn in Ruhe«, sagte Reisden scharf. Andrés Miene erschlaffte, er sah plötzlich kindisch aus, das Gesicht eines Jungen, den die Erwachsenen nicht mögen.
»André?« meinte Reisden etwas sanfter.
»Ich kann nichts dafür, Reisden«, sagte André, wandte sich ab und ging davon.
Kapitel 6
»Was gefällt dir bloss an ihm?« fragte Perdita. »Und was ist mit ihm los?«
»Was mit ihm los ist, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wofür er nichts kann.«
»Er hat vor irgend etwas Angst.«
Reisdens Ankleidezimmer war der einzige Raum in der Wohnung, der nicht mit Kisten und Koffern vollgestellt war. Deshalb hielten sie sich hier auf, er, seine Frau und das Baby. Von draußen strömte die laue Pariser Juniluft zu ihnen herein, und sie hörten das Rattern der letzten Kutsche, die zum Boulevard St.-Germain hinauffuhr. Aline, ihr behäbiges, unbezahlbares Mädchen, war im Zimmer nebenan mit Packen beschäftigt, damit, elegante Satinkleider in feines Seidenpapier einzuschlagen. Die Anzahl der Kleider rechtfertigte sich nicht aus der Anzahl der Konzerte, die Perdita voraussichtlich geben würde. Nur ganz wenige, hatte sie gesagt. Aber der New Yorker Agent mochte sie, mochte sie offenbar so sehr, daß er ihr als verheirateter Frau eine zweite Chance gab.
In Paris hatte sie keinen Agenten. Diesbezügliche Bemühungen waren erfolglos geblieben.
Toby zog sich am Sofa hoch und hielt sich an Reisdens Knie fest, schwankte dabei hin und her und gähnte. An gewöhnlichen Tagen hätten sie ihn in sein Bettchen gelegt oder ihn zwischen sich einschlafen lassen.
»Komm, Liebling«, sagte Perdita, »komm zu Mama und mach die Augen zu.« Sie knöpfte ihr Kleid auf, damit der Kleine an ihrer Brust trinken konnte. Mit einer Hand stützte sie seinen Kopf, wiegte ihn sacht hin und her. Einer von Perditas Fächern lag auf dem Boden. Reisden hob ihn auf, klappte ihn auseinander und fächelte ihr Luft zu, fast ein wenig neidisch auf die intime Vertrautheit zwischen Mutter und Kind.
Der Fächer war feminin, weiß, bogenförmig und mit grünen Buchstaben verziert. Je désire voter, las Reisden. Ich will wählen.
»Ich war Andrés erster Hamlet«, sagte er. »Bevor er ins professionelle Lager wechselte und sich richtige Schauspieler leisten konnte. Cyron hat recht, ich habe André ermutigt, Theater zu machen. Die Bühne ist der einzige Ort, wo er glücklich ist.«
»Was wirst du tun, wenn ich weg bin?« fragte Perdita. »Meinst du, du kannst ihm helfen?«
»Das hoffe ich.«
»Andrés Frau wird sich noch wundern«, murmelte Perdita.
Reisden lachte leise und streichelte sanft über ihre Brust.
»Wenn Monsieur Cyron schlecht über dich redet, könnte die Klinik dann bankrott gehen?«
»Ich hoffe nicht. Wir werden es schon schaffen«, fügte er hinzu. Perdita hatte bisher nichts davon gesagt, daß Gilbert ihnen Geld leihen würde; Reisden fragte sich jedoch leicht pikiert, ob sie nicht gerade versucht hatte, darauf anzuspielen.
»Ich wünschte, du kämst mit uns nach Amerika«, sagte Perdita. »Gilbert würde sich so freuen, dich zu sehen.«
»Wir sollten Gilbert keine falschen Hoffnungen machen. Triff dich nicht mit ihm. Und wenn, dann nimm wenigstens Toby nicht mit.«
Perdita seufzte und lehnte den Kopf an seine Schulter, eine zärtliche und zugleich resignierte Geste. »Das kann ich dir nicht versprechen, du weißt, daß ich das nicht kann.«
Du könntest schon, dachte er. Und eigentlich müßtest du auch.
Er spürte, wie sie sich leicht hin und her wiegte, wie sie sich an ihn drückte und sich dann wieder ein wenig von ihm entfernte. Toby war inzwischen sehr schläfrig, sein kleiner, vor Müdigkeit ganz roter Kopf kippte immer wieder weg, doch von dem Ruck wurde er gleich wieder wach und suchte erneut Perditas Brust. Perdita nahm ihn hoch, klopfte ihm auf den Rücken und legte ihn dann an ihre andere Brust. Reisden betrachtete seinen Sohn und wurde von einer Welle der Zärtlichkeit erfaßt, die ihm die Kehle zuzuschnüren drohte.
»Hat André nichts für Frauen übrig?« erkundigte sich Perdita. »Ich meine, so wie sich Milly nicht für Männer interessiert?« Milly lebte mit einer französischen Baronin zusammen.
»Ich weiß es nicht.«
»Du kennst ihn, seit du siebzehn bist, und weißt es nicht?«
»Nicht jeder ist so offen und direkt wie Milly.« Womit sich André außerhalb des Theaters auch beschäftigen mochte – man konnte nur hoffen, daß es etwas Lebendiges war.
»Erzähl mir von diesem Theater, das ich nicht besuchen soll.«
»Im Grand Necropolitain fangen die Vorstellungen immer erst Punkt Mitternacht an«, erklärte Reisden mit düsterer Stimme. »André kommt im Abendanzug hinter dem Vorhang hervor und beginnt als Necrosar Geschichten zu erzählen. Der Vorhang öffnet sich und sein Ensemble spielt die Geschichten nach. Es vergehen keine fünf Minuten, bis die erste Figur verstümmelt oder in Stücke zerteilt ist. André zeigt alles, bis ins kleinste Detail. Er setzt spezielle Effekte, phantastische Tricks ein, alles unglaublich überzeugend. Du hättest seinen Hamlet erleben sollen. Aber sein Theater ist wirklich nur etwas für die Augen. Dich würde es wahrscheinlich langweilen.«
»Warum will er den Leuten angst machen?«
»Keine Ahnung.« Schon wieder. »Für ihn ist dies vermutlich ein Ausdruck von Nähe.«
»Seine arme Frau.«
»Ich denke, für André ist das Theater ein Zufluchtsort, an dem er sich vor einer Außenwelt schützen kann, die er als feindlich empfindet.«
Perdita nahm seine Hand und verschränkte für einen Augenblick ihre Finger mit seinen. Jahrelang hatte er ebenfalls Theater gespielt, aus genau dem gleichen Grund. Toby war eingeschlafen. Perdita hob ihn vorsichtig hoch, legte ihn an ihre Schulter und klopfte ihm auf den Rücken. Toby gab ein lautes Bäuerchen von sich und öffnete erstaunt die Augen. »Oh, mein liebes Lämmchen, bitte wach nicht auf«, flüsterte Perdita, wobei sie ihm den Rücken streichelte. »Du warst doch schon fast eingeschlafen.«
»Gib ihn mir. Komm her, mein Schatz«, sagte Reisden. Er legte sich das Spucktuch über die Schulter und nahm seinen Sohn entgegen. Toby blinzelte, fast schon wieder hellwach, sah sich im Zimmer um und lächelte seinen Papa an.
Reisden legte Toby auf die alte amerikanische Steppdecke vor dem Kamin, dort wo seine Spielsachen waren, setzte sich dann zu ihm und betrachtete ihn voll Wehmut. Toby versuchte nach seinem roten Ball zu greifen, kam aber nicht an ihn heran, beugte sich deshalb vor und fing an zu krabbeln.
»Ba-ba-ba«, stieß er angestrengt hervor.
»Ball?« fragte Reisden, hielt das Spielzeug hoch und wurde mit einem wunderbaren Babylächeln belohnt. Du verstehst mich! Sein Sohn grinste, streckte die Hand aus und schubste den Ball weg. Reisden holte ihn zurück und ließ ihn seinem Sohn entgegenrollen. Ob er dieses Spiel noch spielen mag, wenn er zurückkommt? Was werde ich bis dahin alles verpaßt haben?
Reisden hatte seit Tobys Geburt zwei oder drei Dienstreisen unternommen. Er war durch Genua und London geirrt und hatte es nicht erwarten können, den Zug zu besteigen, der ihn zu seinem Sohn zurückbringen würde. Nachts saß er neben Tobys Bettchen, nur um seinem Atem lauschen zu können.
Geh nicht, Perdita. Geh nicht. Laß meinen Sohn hier. Gilbert soll nicht einmal einen Blick auf unseren Jungen werfen. Wie kannst du Gilbert mit einer Familie quälen, die er niemals haben kann. Reisden sprach nicht aus, was er dachte, preßte die Lippen zusammen, gekränkt, das Herz voll der falschen Gefühle.
Sie ging nach Amerika, weil sie sich immer noch als Amerikanerin fühlte, ging nach Massachusetts, wo sie die Sprache sprach, ohne nachdenken zu müssen, ging, um Gilbert zu besuchen ... fuhr in das Land, das sie als ihre Heimat betrachtete, obwohl ihr eigentliches Zuhause in Paris sein sollte.
Aber konnte er es ihr verdenken? Was konnte er ihr schon bieten, wie sollte er einem Vergleich mit den Knights standhalten? Richard Knight hätte Millionen zur Verfügung gehabt. Richard Knight hätte in Gilberts Haus auf der Commonwealth Avenue gelebt, wo Perdita fast so etwas wie Gilberts Tochter gewesen war.
Richard Knight hätte Geldsorgen nie gekannt.
Reisden fuhr mit Perdita nach Le Havre. Es war ungemütlich kalt an diesem Morgen. Nachdem das Gepäck in die Kabine gebracht worden war, ging er mit seiner Frau und seinem Sohn an Deck. Er trug Toby unter seinem Mantel, um ihn vor der Kälte zu schützen. Das Baby schmiegte sich schläfrig an ihn, ein warmes, zufriedenes Bündel, das kaum etwas wog.
»Paß gut auf unseren Sohn auf«, sagte er, »und ich kümmere mich unterdessen um André.«
»Paß du auf dich auf«, erwiderte Perdita und drückte seine Hand.
»Alles wird gut. Bis du zurückkommst, wird sich alles geregelt haben.« So hoffte er zumindest.
»André hat schließlich nicht nur Schwierigkeiten mit Frauen«, meinte Perdita. »Ich glaube, daß er mit Familie an sich nichts anfangen kann.«
»Er fürchtet sich vor seinem Stiefvater«, entgegnete Reisden.
»Wie auch immer, vor irgend etwas hat er jedenfalls Angst.«
Perdita und er unterhielten sich bis zum letzten Moment, leise und gedämpft, damit sie ihren Sohn nicht weckten. Er würde nicht am Pier warten, bis das Schiff auslief. Sie würde ihn ohnehin nicht sehen können. Aber dann blieb er doch, entdeckte sofort Perditas rote Jacke, die sie extra angezogen hatte, damit er sie bemerkte – falls er es sich anders überlegte. Sie hatte Toby auf dem Arm und winkte zögernd. Er nahm seinen Hut und schwenkte ihn im weiten Bogen herum, kam sich dabei aber etwas lächerlich vor, zumal er überzeugt war, daß sie ihn weder sehen noch erkennen konnte – von seinem kleinen Jungen ganz zu schweigen.
Er blickte dem Schiff hinterher, bis es nur noch ein winziger Punkt am Horizont war.
Kapitel 7
Es war ein amerikanisches Schiff. Perdita stand oben an der Reling, während Aline Toby in die Kabine brachte, damit er sein Mittagsschläfchen halten konnte. Hier sprachen die Leute Englisch. Hier würde endlich einmal sie für Aline übersetzen. Sie konnte sich nach Baseball-Ergebnissen erkundigen; hier gab es richtiges Eis. Sie atmete tief durch, tastete dann mit ihrem weißen Stock nach der Tür zum Salon, schlüpfte hinein und roch Amerika. Es war wunderbar, die Mutter eines Kindes zu sein, aber jetzt genoß sie es, auch einmal allein zu sein.
»Entschuldigen Sie, Miss, kann ich Ihnen behilflich sein? Möchten Sie, daß ich Sie irgendwohin führe?«
Armes blindes Mädchen. Von allen bemitleidet, die ihm über den Weg liefen. »Ja. Gibt es im Salon ein Klavier?«
Der Raum war menschenleer. Sie würde niemanden stören. Sie teilte dem Steward mit, daß man ihr Übungszeiten an dem Instrument zugesagt hätte, zog anschließend ihre Jacke aus, nahm den Hut ab, klappte den Klavierdeckel hoch und begann mit ihren Fingerübungen. Der Wind drang durch die offene Tür zu ihr herein. Der Wind kam aus Amerika.
Im Frühjahr vor ihrer Abreise aus New York waren Freunde mit ihr zu dem Konzert eines Musikers gegangen, den sie in Uptown entdeckt hatten. Der Name des Künstlers lautete Blind Willie Williams. Sie schlug mit der linken Hand einen einfachen Walking-Bass an, improvisierte dazu mit der rechten, bis sie eine geeignete Melodie fand.