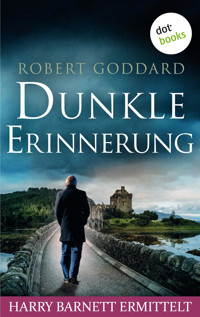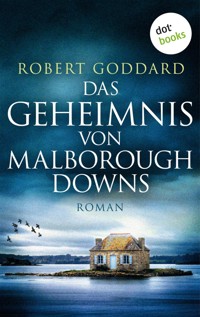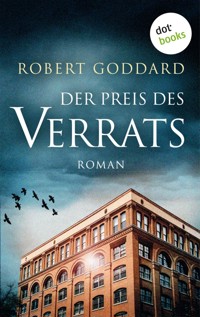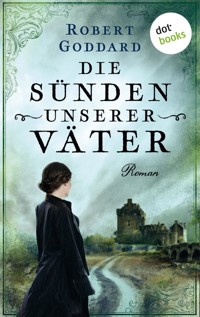
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Familienehre, Verrat und Mord – verwoben zu einem mitreißenden Drama: »Die Sünden unserer Väter« von Robert Goddard jetzt als eBook bei dotbooks. Ein malerisches französisches Dorf an der Somme birgt ein erschütterndes Geheimnis … Gemeinsam mit ihrer Mutter Leonora besucht die junge Penelope Galloway die Gedenkstätte Thiepval. Hier wird an die britischen Gefallenen erinnert, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben gaben – so wie Leonoras Vater, den sie nie kennengelernt hat. Doch als Penelopes Blick auf das Todesdatum ihres Großvaters fällt, ist sie erschüttert: Er fiel ein ganzes Jahr vor Leonoras Geburt … Und dies ist nur Penelopes erster Schritt auf einer Reise in die geheimnisvolle Vergangenheit ihrer Familie, bei der sie auf eine Geschichte stößt, die von Verlust, Täuschung, Liebe und Hass erzählt – und von einem Mord auf dem Anwesen ihrer vorgeblichen Großeltern, der nie aufgeklärt wurde … »Der beste Roman, den ich seit langer Zeit gelesen habe!« Philippa Carr »Eine 600-seitige Bombe!« Daily Mirror Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Kriminalroman »Die Sünden unserer Väter« von Robert Goddard. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 622
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein malerisches französisches Dorf an der Somme birgt ein erschütterndes Geheimnis … Gemeinsam mit ihrer Mutter Leonora besucht die junge Penelope Galloway die Gedenkstätte Thiepval. Hier wird an die britischen Gefallenen erinnert, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben gaben – so wie Leonoras Vater, den sie nie kennengelernt hat. Doch als Penelopes Blick auf das Todesdatum ihres Großvaters fällt, ist sie erschüttert: Er fiel ein ganzes Jahr vor Leonoras Geburt … Und dies ist nur Penelopes erster Schritt auf einer Reise in die geheimnisvolle Vergangenheit ihrer Familie, bei der sie auf eine Geschichte stößt, die von Verlust, Täuschung, Liebe und Hass erzählt – und von einem Mord auf dem Anwesen ihrer vorgeblichen Großeltern, der nie aufgeklärt wurde …
»Der beste Roman, den ich seit langer Zeit gelesen habe!« Philippa Carr
»Eine 600-seitige Bombe!« Daily Mirror
Über den Autor:
Robert William Goddard, geboren 1954 in Fareham, ist ein vielfach preisgekrönter britischer Schriftsteller. Nach einem Geschichtsstudium in Cambridge begann Goddard zunächst als Journalist zu arbeiten, bevor er sich ausschließlich dem Schreiben von Spannungsromanen widmete. Robert Goddard wurde 2019 für sein Lebenswerk mit dem renommierten Preis der Crime Writer's Association geehrt. Er lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks auch die Kriminalromane »Im Netz der Lügen«, »Der Preis des Verrats«, »Eine tödliche Sünde«, »Die Frau im roten Mantel«, »Denn ewig währt die Schuld«, »Das Geheimnis von Trennor Manor«, »Und Friede den Toten«, »Das Geheimnis der Lady Paxton« und »Das Haus der dunklen Träume«.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks weiterhin die historischen Kriminalromane »Die Schatten der Toten«, »Jäger und Gejagte«, »Die Klage der Toten« und »Der Kartograf von London«.
Robert Goddard veröffentlichte außerdem bei dotbooks seine drei Kriminalromane mit dem Ermittler Harry Barnett »Dunkles Blut«, »Dunkles Sonne« und »Dunkle Erinnerung«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2019
Dieses Buch erschien bereits Jahr 1991 unter dem Titel »Die Krallen der Katze« bei Schweizer Verlagshaus, Zürich
Copyright © der englischen Originalausgabe 1988 Goddard & Goddard Ltd.
Die englische Originalausgabe erschien 1988 unter dem Titel »In Pale Battalions« bei Corgi.
Copyright © der deutschen Ausgabe 1991 Schweizer Verlagshaus, Zürich
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Yulia_Bogomolova, Nejron Pluto, Faestock, Malivan Iuliia
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-918-3
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Goddard« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Goddard
Die Sünden unserer Väter
Roman
Aus dem Englischen von Werner Waldhoff
dotbooks.
IN MEMORIAM
Frederick John Goddard, Erstes Bataillon, Hampshire-Regiment, geboren 18. August 1885 in Kimpton, Hampshire, vermißt, wahrscheinlich gefallen in Ypern, Belgien, 27. April 1915
SEIN NAME LEBT AUF EWIG
PROLOG
Wenn durch deine Träume Millionen sprachloser Toter In bleichen Bataillonen ziehn, Sprich keine Worte voller Mitleid Wie andere Männer es getan haben, Denn es ist nicht nötig.
Dies ist der Tag und dies ist der Ort, wo ein Traum eine plötzliche Wendung nimmt und ein altes Geheimnis gelüftet wird. Dies ist Thiepval, wo der beklemmende Nebel eines Herbstmorgens das Mahnmal unseres kollektiven Gewissens, ein mächtiges, geschwungenes Gebilde aus Backstein, kaum mehr verbergen kann: das Soldatendenkmal der Schlacht an der Somme. Und dies ist der Ort, wohin Leonora Galloway ihre Tochter gebracht hat, um ihr das zu erzählen, was sie ein Leben lang beschäftigt hat.
Für Monsieur Lefebvre, Taxifahrer aus Amiens, ist es lediglich eine weitere Fahrt, wenn auch eine einträglichere als die meisten anderen. Mutter und Tochter, beide elegant gekleidet, die ihre Eisenbahnfahrt von Calais nach Paris unterbrachen und ihn in stockendem Französisch mit englischem Akzent baten, sie die achtundzwanzig Kilometer in nordöstlicher Richtung über die schnurgerade Straße nach Albert zu fahren und dann weiter in die Hügel über dem Ancretal zum »Memorial Britannique de Thiepval«. Natürlich lehnte er nicht ab, obwohl für ihn die Erinnerung an einen derart lang zurückliegenden Krieg keinerlei Reiz hat. Für Monsieur Lefebvre existiert die Vergangenheit so gut wie nicht, und er fühlt sich so auch wohl. Gehorsam ist er zu dem Ort gefahren – der Nebel hat sein Tempo nicht im geringsten beeinflußt –, und nun sitzt er im Taxi, raucht eine Zigarette und beobachtet, wie die Uhr seines Taxameters tickt. Gelegentlich schnippt er Asche zu den Platanen, die den Parkplatz säumen, und sinniert der müßigen Frage nach, wie lange seine Fahrgäste wohl an diesem gottverlassenen Fleckchen Erde verweilen wollen.
Sie sind schon vor einiger Zeit aufgebrochen und den Kiesweg zum Mahnmal hinaufgegangen, das vom Nebel verhüllt und von Tannen umrahmt wird. Oben ragt es aus seinem Leichentuch: riesig, unproportioniert, merkwürdig fremd in der schweigenden Demut der Landschaft. Die beiden Besucherinnen breiten Anoraks auf die lange geschweifte Steinbank dem Mahnmal gegenüber und setzen sich. Sie schauen zu, wie es allmählich aus dem Nebel auftaucht, der von der Sonne weggebrannt wird.
Leonora Galloway ist eine siebzigjährige Dame von feiner Herkunft, groß, schlank und grauhaarig. Ihre Tochter Penelope, fünfunddreißig Jahre jünger, sieht ihr verblüffend ähnlich: die gleiche Größe, das gleiche offene Gesicht mit den hohen Backenknochen, strohblonde, bis auf die Schultern fallende Haare, die eines Tages genauso grau und kurz geschnitten sein werden wie die ihrer Mutter. Vielleicht ist sie nicht so entschlossen, nicht so energisch, möglicherweise aber geduldiger, sanfter, vielleicht auch zuverlässiger. Ein Teil von Penelopes Charme liegt darin, daß sie frühzeitig die Tugenden älterer Menschen angenommen hat, Leonoras Charme beruht hingegen darauf, daß sie sich ihnen widersetzt.
Leonoras Ehemann war zu Beginn des Jahres völlig überraschend in ihrem Cottage in Somerset gestorben. Sie trug es mit der Kraft und Fassung, die man von ihr erwartete. Sechs Monate später ist sie nun zu einem Urlaub nach Paris aufgebrochen, der ihr helfen soll, sich an das einsame Leben zu gewöhnen. Von ihren beiden Kindern wählte sie Penelope als Begleitung, da diese schon lange an ein ebenso einsames Leben gewöhnt ist und im Gegensatz zu ihrem verheirateten und gutsituierten Bruder eine Eigenschaft besitzt, auf die Leonora großen Wert legt: die Fähigkeit zu denken.
Aus Penelopes Sicht sprach ebenfalls nichts gegen dieses Abenteuer. Während der dreißig Jahre, an die sie sich recht gut erinnern kann, hat sie ihre Mutter nie durchschaut. Über ihre eigene Vergangenheit hat sie sich stets merkwürdig zurückhaltend und ausweichend geäußert. Neugierde nagt an Penelope, was diese seltsam distanzierte Frau anbelangt, die ihre Mutter ist – eine Neugierde, die jetzt vielleicht endlich gestillt wird, zumindest sagt ihr das ihr Instinkt. Und ihre Erwartungen scheinen sich zu erfüllen. Die Unterbrechung der Reise in Amiens war nicht geplant, die Taxifahrt nach Thiepval kam überraschend. Hier, da ist sie sich sicher, kann sie mit Erklärungen rechnen.
»Ich vermute, du wunderst dich, weshalb wir hierhergefahren sind«, bemerkte Leonora, den Gedankengang ihrer Tochter unterbrechend.
»Natürlich. Aber ich bin überzeugt, du wirst es mir erzählen, wenn du dazu bereit bist.« Sie erinnert sich an die Worte ihres Vaters, eines geduldigen, bescheidenen Mannes, der ihr vor langer Zeit den guten Rat gegeben hat: »Deine Mutter vertraut sich dir an, wenn sie es will, nicht, wenn du es willst.«
Der Nebel hat sich gelichtet, das steinerne Mahnmal offizieller Trauer wird deutlicher, als der Hintergrund sich allmählich von verwaschenem Grau zu einem dunstigen Blau wandelt. Die beiden Betrachterinnen wirken winzig vor diesem Bauwerk, das sie mit seiner massiven Präsenz einschüchtert.
»Die Sonne wird bald herauskommen«, sagte Leonora. »Sollen wir seinen Namen suchen gehen?«
»Wessen Namen?«
»Den Namen meines Vaters. Deshalb sind wir hier, verstehst du.«
Sie erhebt sich von der Bank, überquert die Kieszufahrt und geht über die große Rasenfläche vor dem Denkmal. Ihre Füße hinterlassen dunkle Spuren in dem feuchten Gras. Geduldig wie immer folgt ihr Penelope. Für sie ist die Somme-Schlacht eine unter vielen sinnlosen Schlachten des Ersten Weltkriegs. Sie weiß, daß hier Tausende gestorben sind, weil sie davon gelesen hat – unter ihnen auch ihr Großvater. Als sie sich jetzt dem Mahnmal nähert, sieht sie, daß in die Backsteinsäulen, die den zentralen Bogengang tragen, sorgfältig Namen eingraviert sind. Penelope starrt zu den endlosen Listen hinauf, die höher reichen als ihr Blick. Sie ist entsetzt. Natürlich hat sie davon gelesen, doch niemand hat sie auf 73 412 Männer ohne Grab vorbereitet.
Leonora ist vorausgegangen, über die Fliesenschwelle unter den Säulen, und überfliegt mit ihren Blicken schnell die Wände auf der Suche nach dem einen Namen. Am Fuße einer kranzgeschmückten Namenskolonne hält sie inne. Penelope erreicht sie und folgt mit ihren Augen der Blickrichtung ihrer Mutter. Nahe der Säulenspitze sind die Namen der Hampshire Light Infantry in der Reihenfolge der Dienstgrade verzeichnet. Ganz oben stehen die Captains Arnell, Bailey, Bland, Cade, Carrington, Cromie ... und Hallows, Leonoras Mädchenname. Das ist er also. Plötzlich überkommt Penelope das Gefühl, daß sie einen sehr weiten Weg zurückgelegt haben, bloß um das zu sehen.
»Warum bist du nicht schon früher hierhergekommen, Mutter? Für Verwandte muß es doch Besuchsfahrten gegeben haben. Wir hätten alle zusammen fahren können.«
»Das glaube ich kaum.«
»Und warum um alles in der Welt nicht?«
»Weil wir hier etwas gefunden hätten.«
»Wie meinst du das?«
»Komm und sieh selbst.«
Die beiden Frauen gehen zu den Stufen zurück, die sie vorhin zum Denkmal hochgestiegen sind. Am Fuße von jeder der beiden gigantischen Säulen, die die Stufen flankieren, ist eine Metalltür in die Wand eingelassen. Leonora öffnet die linke Tür. Im Inneren gibt es mehrere mit Eselsohren versehene Bände, das Denkmalregister. Sie blättert einen Band durch, bis sie die richtige Stelle gefunden hat, und hält ihn dann. Penelope entgegen, damit sie mitlesen kann.
»HALLOWS. Captain the Hon. John, Sohn von Edward, Lord Powerstock, von Meongate, Droxford, Hampshire. Vermißt, wahrscheinlich im Kampf gefallen, Mametz, 3o. April 1916, im Alter von 29 Jahren.«
Die entfernte Verbindung der Familie mit der Aristokratie ist für Penelope nicht neu. Der Powerstock-Titel endete, wie sie weiß, mit diesem Tod an der Somme. Leonoras Mutter starb nur wenige Tage nach der Niederkunft; Leonora wurde von ihren Großeltern aufgezogen. Nach deren Tod wurde der Meongate-Besitz aufgelöst. Leonora erhielt weder Geld noch Titel, noch hatte sie irgendwelche Erinnerungen an eine aristokratische Kindheit an Penelope weitergegeben.
»Was soll da nicht stimmen?« fragt sie, nachdem sie verständnislos die Eintragung angestarrt hat.
»Komm schon, Penny. Mein Vater wurde am 3o. April 1916 getötet, aber ich wurde erst am 14. März 1917 geboren. Verstehst du jetzt?«
»Ah.« Penelope lächelt. »Das ist es also. Nun, derartige Dinge passieren doch recht häufig in Kriegszeiten, oder?«
»O ja, recht häufig, möchte ich sagen.« Leonora legt das Buch wieder hin und schließt die Tür. »Aber darum geht es gar nicht. Ich habe immer gewußt, daß mein Vater ... nun ja, nicht mein Vater war. Lady Powerstock sorgte schon dafür, daß ich es wußte; sie sorgte auch dafür, daß Tony es wußte.«
»Dann ..., wo ist dann das Problem?«
»Es gäbe keins, wenn es so einfach wäre.«
Leonora dreht sich um und geht durch den Bogengang zurück, vorbei an der Säule mit dem Namen ihres Vaters und weiter zu den Stufen hinter dem Denkmal. Diese führen zu dem Friedhof der unbekannten Soldaten. Links liegen die Gräber der Franzosen, mit einem Kreuz markiert, rechts die Briten, mit schlichten Steinplatten gekennzeichnet. Die Steine leuchten weiß und schmerzhaft grell in dem immer stärker werdenden Sonnenschein. Hinter den Tannen, die den Friedhof zu drei Seiten begrenzen, sieht man die sanften Täler der Ancre und der Somme, wo einst heftige Kämpfe tobten und wo so viele den Tod fanden. Die beiden Frauen stehen auf der obersten Stufe und blicken auf die friedliche Landschaft hinab.
Penelope bricht das Schweigen. »Ich weiß, daß ich mir nicht vorstellen kann, wie es ist, wenn man keinerlei Erinnerung an seine Eltern besitzt, aber ich würde es gern versuchen. Du hast mir nie diese Chance gegeben, du hast, selbst wenn man dich drängte, nie über deine Kindheit gesprochen.«
»Ich wollte, daß du und Ronald die Sicherheit und Beständigkeit hattet, die ich immer vermißt habe. Ich wollte einfach nicht, daß die Schatten meiner Kindheit eure Kindheit verdunkelten. Ich dachte, ich könnte so tun, als wäre es nie geschehen, wenn ich euch nichts davon erzählte.«
»War es wirklich so schlimm? Ich meine, zu wissen, daß du ein illegitimes Kind warst.
»Die Unehelichkeit spielte in diesem Fall nur eine kleine Rolle, Penny. Heutzutage hat sie fast gar keine Bedeutung mehr. Lady Powerstock tat natürlich ihr Bestes, um mich damit zu quälen, aber sie besaß weitaus wirksamere Waffen gegen mich.«
Sie gehen zurück. Penelope weiß, daß sie ihre Mutter jetzt besser nicht drängt. Sie selbst kann sich an Lady Powerstock nicht erinnern. Wann immer Leonora von ihr sprach – was selten genug der Fall war –, geschah es stets mit der gleichen verhaltenen Bitterkeit. Jetzt jedoch scheint sie bereit zu sein, mehr zu sagen. Und als sie das Denkmal hinter sich gelassen haben, nimmt sie den Faden auch wieder auf.
»Seit mehr als fünfzig Jahren wollte ich diesen Ort besuchen. Seit mein Großvater mir davon erzählt hat.«
»Und was hat dich daran gehindert? Lag es daran, daß du herausgefunden hattest, daß er nicht dein richtiger Vater war?«
»Man könnte sagen, das sei der Grund gewesen.«
»Du mußt es mir nicht erzählen, wenn du nicht willst. Aber hast du je entdeckt, wer dein wirklicher Vater war?«
»O ja.«
Die Schritte der beiden Frauen knirschen auf dem Kies. Langsam entfernen sie sich von dem Mahnmal, gehen auf den Eingang zu. Diesmal kann sich Penelope nicht zurückhalten.
»Wer also war mein Großvater?«
»Das gehört auch zu dem, was ich dir in diesem Urlaub erzählen wollte. Aber ich möchte dich warnen; es ist eine lange Geschichte.«
»Keine Sorge. Ich habe lange darauf gewartet, sie zu hören.«
»Und sie handelt ebenso von mir wie von meinem Vater.«
»Auch darauf habe ich lange gewartet.«
Sie erreichen das Taxi und steigen hinten ein. Monsieur Lefebvre fährt zurück nach Amiens. Er erkundigt sich nicht, ob sie den Besuch genossen haben, auch macht er sich nicht die Mühe, der älteren seiner beiden Fahrgäste zuzuhören, die in ausdruckslosem, gedämpftem Englisch zu sprechen beginnt.
»Wir hatten nie viel Zeit füreinander, nicht wahr, Penny? Manchmal bekümmert es mich, daß ich nicht die Mutter war, die eine gute Tochter verdient hätte.«
»Es hat mir nie etwas gefehlt.«
»Bis auf die Wärme, die ich dir nicht geben konnte, weil ich selber nicht wußte, wer ich bin. Tonys Tod war natürlich ein Schock für mich, aber er hat noch etwas anderes ausgelöst: Er zerstörte die langjährige Illusion, daß ich vor unserer Hochzeit gar nicht existiert hätte. Ich redete mir ein, du und Ronald, ihr wäret glücklicher, wenn ihr all das nicht wüßtet, was es über mich zu wissen gibt – und in Ronalds Fall bin ich überzeugt davon, daß es richtig war. Aber im Grunde war natürlich ich diejenige, die vergessen wollte. Jetzt, so glaube ich, ist die Zeit gekommen, mich zu erinnern.«
Eine halbe Stunde später, als Monsieur Lefebvre im Vorstadtverkehr von Amiens das Tempo verringern muß, hat Leonora ihren Bericht noch nicht beendet. Vage wird ihm bewußt, daß sie immer noch redet, während die andere Dame seit der Abfahrt in Thiepval nichts gesagt hat; doch er beachtet ihre Worte genausowenig wie die unter der Straßenbrücke träge dahinströmende, breite Somme. Er fährt weiter, immun gegen die Vergangenheit, während Penelope weiterhin aufmerksam lauscht. Denn Leonora ist noch nicht am Ende. Um die Wahrheit zu sagen, sie hat gerade erst begonnen.
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Kindheitserinnerungen haben ihr eigenes, kompliziertes Muster. Sie widersetzen sich dagegen, daß wir ihnen unsere heutige Sicht der Vergangenheit aufzwingen wollen. So könnte ich sagen, daß ich als Waise gar nicht dankbar genug sein konnte für das Zuhause, das Lord und Lady Powerstock mir in Meongate gaben, daß ein silberner Löffel problemlos das Lächeln meiner Mutter ersetzte. Ich könnte das sagen – doch jede Erinnerung an meine frühen Jahre würde diese Worte Lügen strafen.
Meongate muß einst das vor Leben überschäumende Haus einer fröhlichen Familie gewesen sein, so wie die Hallows einst eine solche Familie gewesen sein müssen. Die Natur war sehr verschwenderisch gewesen hier, wo das Hügelland von Hampshire auf die Weiden des Meontales trifft; die Menschen hatten ihr in nichts nachgestanden, als sie Haus und Park gestalteten. All das diente als Heim für ein kleines Kind.
Und doch war es nicht genug. Als ich zu Beginn der zwanziger Jahre in Meongate aufwuchs, war ein Großteil der Pracht längst verschwunden. Viele der Räume standen leer oder waren abgeschlossen, der Park war bis auf einen kleinen Rest in Ackerland verwandelt worden. Und all die lachenden, glücklichen Menschen, die in meiner Phantasie die leeren Räume mit Leben füllten und die vernachlässigten Rasenflächen pflegten, waren in einer Vergangenheit jenseits meiner Reichweite entschwunden.
Ich wuchs mit dem Wissen auf, daß meine Eltern beide tot waren. Mein Vater war an der Somme gefallen, meine Mutter war wenige Tage nach meiner Geburt an einer Lungenentzündung gestorben. Man hielt das vor mir nicht geheim, sondern erinnerte mich dauernd daran. Ich wurde mit Andeutungen konfrontiert, daß ich in irgendeiner Weise die Schuld trug an dem Schatten dieses Kummers oder noch etwas Schlimmerem, was ihre Erinnerungen verdüsterte. Dieser Schatten, verursacht durch das Unbekannte, lastete schwer auf mir, und in meinem Herzen wuchs die Gewißheit heran: Ich war in Meongate nicht erwünscht, man hieß mich hier weder willkommen, noch liebte man mich.
Vielleicht hätte es anders ausgesehen, wenn mein Großvater nicht der ernste, in sich gekehrte, ewig melancholische Mann gewesen wäre, der er nun mal war. Da ich ihn nicht als jungen Mann erlebt hatte, konnte ich ihn mir nur als an den Rollstuhl gefesselten Bewohner der Erdgeschoßräume vorstellen, den seine Krankheit und ein Schlaganfall aller menschlichen Wärme beraubt hatten. Wenn Nanny Hiles mich wie üblich zum Gutenachtkuß zu ihm brachte, dann wünschte ich mir nichts weiter, als der kalten, flüchtigen Berührung seiner Haut entfliehen zu können. Wenn ich auf dem Rasen spielte und merkte, wie er mich von seinem Fenster aus beobachtete, dann wäre ich am liebsten vor der fragenden Trauer in seinen Augen fortgerannt. Später dann spürte ich, daß er wartete, bis ich alt genug war, um ihn zu verstehen, daß er in der Hoffnung wartete, diesen Tag noch zu erleben.
Lady Powerstock, zwanzig Jahre jünger als er, war nicht meine wirkliche Großmutter. Diese lag auf dem Dorffriedhof begraben, ein weiteres Gespenst, das ich nicht kannte und das mir nicht helfen konnte. Ich stellte sie mir als das genaue Gegenteil ihrer Nachfolgerin vor – freundlich, liebevoll und großzügig –, aber das nützte mir auch nichts. Olivia, die Frau, die ich an ihrer Stelle mit Großmama anreden sollte, war einst wunderschön gewesen. Selbst jetzt, mit fünfzig, sah sie immer noch gut aus, ihre Figur war makellos, und sie besaß einen erlesenen Geschmack, was ihre Kleidung anbelangte. Daß wir keine Blutsverwandten waren, stellte für mich keine befriedigende Erklärung dar, weshalb sie mich nicht liebte. Ich konnte nicht begreifen, warum sie mich haßte – und das tat sie zweifellos. Sie gab sich nicht einmal die Mühe, diese Tatsache zu verbergen. Unausgesprochen hing ihr Haß wie eine Drohung über mir, sie ließ ihn wachsen wie eine lautlose Bestätigung, daß auch sie nur wartete, auf den Tod ihres Mannes wartete, damit sie jegliche Zurückhaltung mir gegenüber aufgeben konnte. Eine Aura von Lasterhaftigkeit umgab sie, die den Männern alle Lebenskraft auszusaugen schien, eine Aura wollüstigen Vergnügens über ihre eigene Verderbtheit, die ihren Haß auf mich fast als Instinkt erscheinen ließ. Und doch steckte noch mehr dahinter. Was für eine Rolle sie in der Vergangenheit dieses Hauses auch immer gespielt haben mochte, sie hatte daraus ihr Gift gesogen und es für mich reserviert.
Mein einziger Freund in dieser Zeit, mein einziger Führer durch Meongates verborgene Gefahren, war Fergus, der wortkarge, zurückhaltende Majordomus, den Olivia als »verschlagen« bezeichnete. Ganz sicher war er nicht so ehrerbietig, wie er es hätte sein sollen, aber er war mein einziger Vertrauter. Sally, das mürrische Hausmädchen, und das humorlose Kindermädchen Hiles erstarrten beide in Ehrfurcht vor Olivia, doch Fergus begegnete ihr mit einer Selbstsicherheit, die an Respektlosigkeit grenzte, was ihn zu meinem Verbündeten machte. Er war ein vorsichtiger, pessimistischer Junggeselle, der wenig vom Leben erwartet und sich somit eine Menge Enttäuschungen erspart hatte; vielleicht hatte er Mitleid mit einem einsamen Kind, dessen Zwangslage er besser verstand als es selbst. Er nahm mich mit auf heimliche Geländeexpeditionen oder hinunter zu den baumbestandenen Ufern des Meon, wo er einen ruhigen Nachmittag mit Angeln verbrachte, oder er fuhr mit mir nach Droxford, wo er mir eine Brause kaufte und mich draußen auf der Mauer vor Wilsmers Sattlerei warten ließ, während er drinnen um neues Zaumzeug für das Pony feilschte. Ich schlug mit meinen Absätzen gegen Mr. Wilsmers Mauer und trank meine Brause im Sonnenschein; in diesen Momenten war ich einfach nur glücklich, doch sie dauerten nie lange.
Es war Fergus, der mir als erster den Namen meines Vaters zeigte, zusammen mit anderen Toten des Dorfes auf einer Tafel an der Kirche eingraviert. Ihr Name lebe auf ewig, hieß es in der Inschrift, doch es war allein sein Name– Captain the Honourable John Hallows –, der für mich lebte. Ich starrte ihn stundenlang an und versuchte dabei den lebenden, atmenden Vater, der er mir nie gewesen war, heraufzubeschwören, aber ich sah immer nur diese steifen, ausdruckslosen, uniformierten Gestalten, wie sie auf Fotos in alten Exemplaren der Illustrated London News abgebildet waren. Von seiner wahren Person jenseits der akkuraten Buchstaben seines Namens bekam ich nichts zu sehen.
Was meine Mutter anbelangte, so gab es von ihr weder irgendwelche Aufzeichnungen noch ein Grab, noch Erinnerungsstücke. Als ich Fergus danach fragte, machte er Ausflüchte. Das Grab meiner Mutter, falls sie eins hatte, war weit entfernt – und er wußte nicht, wo. Auch für ihn, so gab er mir zu verstehen, existierten Grenzen dessen, was er mir erzählen konnte. Ich weiß nicht mehr, ob er den Vorschlag machte, jedenfalls beschloß ich aus irgendeinem Grund, Olivia zu fragen. Ich erinnere mich nicht mehr, wie alt ich zu dem Zeitpunkt war. Ich folgte ihr in die Bibliothek, die sie oft aufsuchte, um ein dort hängendes Gemälde zu betrachten.
»Wo ist das Grab meiner Mutter?« fragte ich ganz direkt. Die Frage war zumindest teilweise auch als Herausforderung gedacht. Jeder Haß wird mit der Zeit erwidert, und ich haßte Olivia ebenso, wie sie mich haßte. Mir war damals noch nicht klar, was für ein gefährlicher Feind sie sein konnte.
Ihre Antwort erfolgte nicht verbal. Sie wandte sich von dem gewaltigen, hohen, dunklen Gemälde ab und versetzte mir einen derart heftigen Schlag ins Gesicht, daß ich beinahe zu Boden gestürzt wäre. Ich stand da, eine Hand auf die sich rötende, mißhandelte Wange gepreßt, vom Schock des Schmerzes zu sehr gelähmt, um weinen zu können, und sie beugte sich mit funkelnden Augen über mich. »Wenn du mir je wieder diese Frage stellst«, sagte sie, »wenn du je wieder deine Mutter erwähnst, dann wirst du es mir büßen.«
Und so wurde das Geheimnis um meine Mutter zur fixen Idee meiner Kindheit, eine geheime, allgewaltige Besessenheit. Der Tod meines Vaters hatte trotz allem eine tröstliche Schlichtheit an sich. Jedes Jahr im November veranstaltete unser Dorf eine Parade zum Tag des Waffenstillstands, zum Gedenken an das Opfer von Captain the Honourable John Hallows und vieler anderer. Ich durfte mich zwar nicht der Pfadfindergruppe anschließen, die an der Parade teilnahm, bekam aber die Erlaubnis, zuzusehen. Ich stellte mir vor, wie ich zusammen mit all den anderen kleinen Mädchen marschierte, die ebenfalls ihren Vater verloren hatten. Doch am Ende der Parade gingen sie heim zu ihren Müttern; ich konnte mich nicht einmal an meine Mutter erinnern.
Manchmal jedoch glaubte ich mich an sie erinnern zu können. Natürlich war das unmöglich, wenn das, was man mir von ihr erzählt hatte, der Wahrheit entsprach, doch Olivia hatte es geschafft, daß ich allem und jedem mißtraute, was ich nicht selbst erlebt hatte. Es existierte eine vage Erinnerung, die bis zur Morgendämmerung meines Gedächtnisses zurückzureichen schien und das stützte, was ich glauben wollte.
Ich stand am Bahnsteig des Bahnhofs von Droxford. Es war ein heißer Sommertag. Ich spürte die Hitze des Kieses, die durch meine Schuhe drang. Der Zug vor mir stieß große Dampfwolken aus. Der neben mir stehende Mann, der meine Hand gehalten hatte, hob mich hoch und nahm mich auf den Arm, damit ich dem Zug nachschauen konnte. Er hatte weiße Haare und war von kräftiger Statur. Ich erinnere mich an seine tiefe, dröhnende Stimme und an den Rand seines Strohhuts, der meinen Kopf berührte, als er mit seiner freien Hand winkte. Auch ich winkte – ich winkte einer Frau im Zug, die das Fenster heruntergekurbelt hatte und die ebenfalls winkte und lächelte und gleichzeitig weinte. Sie trug etwas Blaues und hielt ein weißes Taschentuch in der Hand. Und der Zug trug sie fort. Und dann weinte ich auch, und der kräftige, alte Mann umarmte mich, wobei sich die Messingknöpfe seines Mantels kalt gegen mein Gesicht preßten.
Eines Tages erwähnte ich Fergus gegenüber diese Erinnerung, als wir vom Pilzesuchen heimkehrten. Dann fragte ich ihn, ob er eine Ahnung hätte, wer der alte Mann gewesen sein könnte.
»Hört sich nach Mr. Gladwin an«, erwiderte er. »Der Vater der ersten Lady Powerstock. Er lebte hier ... bis sie ihn fortgeschickt hat.« Mit sie meinte Fergus stets Olivia.
»Warum hat sie das getan?«
»Sie wird zweifellos ihre Gründe gehabt haben.«
»Wann ist er gegangen?«
»Im Sommer des Jahres 1920. Da warst du drei. Zurück nach Yorkshire, heißt es. Ein ordentlicher Kerl, dieser Mr. Gladwin.«
»Wer war die schöne Dame, Fergus?«
»Das weiß ich nicht.«
»War sie ... meine Mutter?«
Er blieb stehen und schaute stirnrunzelnd auf mich herab. »Das war sie nicht«, sagte er langsam und sehr entschieden. »Deine Mutter starb wenige Tage nach deiner Geburt. Das weißt du. Ganz egal, wie sehr du es dir wünschst, du wirst dich nicht an sie erinnern können.«
»Aber ... wer war dann die schöne Lady?«
Sein Stirnrunzeln wurde unfreundlich. »Ich sagte es dir schon: Ich weiß es nicht! Dieser Mr. Gladwin – er war ein verschlossener Bursche. Und jetzt paß auf dein Tuch auf, sonst wirfst du noch dein Essen in den Dreck – und meins dazu.«
Wenn die schöne Lady nicht meine Mutter war, wer war sie dann? In was für einer Beziehung stand sie zu Mr: Gladwin, meinem Urgroßvater? Ich konnte keine Antworten darauf finden. Mir blieb nur die geheime Hoffnung, daß meine Mutter vielleicht gar nicht wirklich tot war, sondern ... nur fortgeschickt worden war wie der alte Mr. Gladwin.
Auch ich sollte bald fortgeschickt werden, und zwar in die Vorschule in North Wales. Ich kam in den Juniorflügel von Howell's. Einige der Mädchen fanden, daß es hier recht streng zuging, doch ich fühlte mich vom ersten Augenblick an heimisch. Über der Schule hingen keine drohenden Schatten, und keine unausgesprochenen Geheimnisse aus der Vergangenheit bedrängten mich. Es waren die Ferien, die ich zu fürchten begann, die Zeiten, in denen ich nach Meongate zurück mußte, wo Olivia mit ihrem bösartigen Lächeln auf mich wartete. Mein Großvater wirkte jedesmal noch ein bißchen zerbrechlicher, noch schweigsamer, und Fergus wahrte immer mehr Distanz zu der eingebildeten jungen Dame, zu der ich mich seiner Ansicht nach entwickelte.
Da ich mit acht Jahren in eine Internatsschule geschickt wurde, kannte ich praktisch niemanden in Droxford weder Gleichaltrige noch andere Personen. Vermutlich erfuhr ich deswegen erst so spät von dem Mord in Meongate, von diesem Teil unseres Familiengeheimnisses.
Ich glaube, es war der Junge der Cribbins, der es mir zuerst erzählte. Er pflegte während der Sommerferien im Garten zu helfen und gehörte zu den wenigen Dorfkindern, mit denen ich etwas zu tun hatte. An einem warmen, wolkenverhangenen Nachmittag wurde ich mit einem Glas Limonade in den Obstgarten geschickt, wo er die Brombeerhecken beschnitt. Wir unterhielten uns ein bißchen, während er trank. Er fragte mich, wie das Haus innen aussehe.
»Warst du nie drin?« entgegnete ich mit einem Schuß Hochmut. Howell's Erziehung trug Früchte.
»Würd' ich nicht reingehen«, sagte er zwischen zwei Schlucken. »Mein Dad hat's mir erzählt.«
»Was erzählt?«
»Von dem Mord.«
»Was für ein Mord?«
»Wissen Sie das nicht, Miss? Vor Jahren ist in Meongate ein Mord geschehen. Mein Dad hat's mir erzählt.«
»Oh, das?« erwiderte ich. »Natürlich weiß ich darüber Bescheid.« Ich konnte ihn unmöglich merken lassen, daß ich nichts davon wußte.
Es war naheliegend, Fergus danach zu fragen. Ich fand ihn in der Küche, wo er das Silber putzte.
»Mord, sagst du? Nun, vielleicht gab's einen, vielleicht auch nicht. Was weiß Cribbins schon?«
»Hör auf, dich über mich lustig zu machen, Fergus.«
Er legte die Messer beiseite und brachte seinen Mund dicht an mein Ohr. »Ich mache keine Witze«, flüsterte er. »Sie würde mir die Haut bei lebendigem Leib abziehen, wenn sie hörte, daß ich darüber spreche. An das Thema rührt man besser nicht.«
Natürlich wußte er, daß ich mich damit nicht zufriedengeben würde. Am nächsten Nachmittag folgte ich ihm hinunter zum Fluß, zu seinem Lieblingsplatz, wo ich sicher sein konnte, daß man uns nicht belauschte.
»Nun? Hier kannst du es mir erzählen.«
»Was erzählen?«
»Von dem Mord.«
Er grunzte und warf die Leine aus. »Sie beißen heute nicht.«
»Fergus!«
»Ich seh' schon, ich kriege keinen Frieden, bevor ich's dir nicht gesagt hab'. Es passierte während des Krieges. Einer der Gäste Seiner Lordschaft. In seinem Schlafzimmer erschossen.«
»In welchem Schlafzimmer?«
»Keine Angst. Deins war's nicht. Es war eines der Zimmer, die jetzt geschlossen sind.«
»Wer war er?«
»Ich sagte dir doch schon: ein Gast. Seinen Namen hab' ich vergessen.«
»Wer hat ihn getötet?«
»Das hat man nie erfahren.«
»Meine Güte. Du meinst, der Mord ist nie aufgeklärt worden?«
»Bis zum heutigen Tag nicht.«
»Wie aufregend!«
»Ich würde es nicht gerade aufregend nennen.«
»Du würdest nichts aufregend nennen.«
Er lächelte. »Nun ja, merk dir jedenfalls eins: Erwähne es ihr gegenüber nicht. Sie würde es dir nicht danken.«
»Der Ermordete war also ein Freund von ihr, ja?«
Fergus kicherte. »Sie hat keine Freunde. Das solltest du wissen. Und jetzt verschwinde, bevor du mir alle Fische im Fluß verschreckst.«
Ich sprach Fergus noch ein paarmal auf die Sache an, erfuhr aber nichts mehr. Jemand anders wagte ich nicht zu fragen. Die Bediensteten waren anscheinend extra deswegen ausgewählt worden, weil sie für Klatsch gar nichts übrig hatten. Vielleicht machte das in Olivias Augen ihre anderen Mängel wieder wett. Sie würden mir nicht helfen, da war ich mir sicher. Außerdem war ich nur Fergus gegenüber bereit, zuzugeben, wie wenig ich über die Geschichte meiner Familie wußte. Andeutungen und vage Erinnerungsfetzen waren alles, was mir zur Verfügung stand.
Ich muß Fergus mit meinen endlosen, unbeantworteten Fragen furchtbar auf die Nerven gegangen sein. In welchem Zimmer war der Mord geschehen? Welches Zimmer hatte meinen Eltern gehört? Warum gab es keine Fotos von ihnen? Wo lag meine Mutter begraben? Wie hatte sie ausgesehen? Warum war Mr. Gladwin fortgeschickt worden? Wer war die schöne Lady? Fergus zupfte lediglich an der Nase, meinte, er könne sich nicht erinnern oder dürfe es mir nicht sagen, und lenkte mich dann durch eines seiner Rätselspielchen mit Schnur und Streichhölzern ab.
Selbst die wenigen Dinge, die er mir verriet, hätten höchstwahrscheinlich für seine fristlose Entlassung ausgereicht, wenn Olivia davon erfahren hätte. Kehrte sie von einem ihrer Ausflüge nach London zurück, die im Laufe der Jahre immer häufiger wurden, so ignorierte sie mich zuerst und unterzog mich dann einem vernichtenden Verhör. Was hatte ich getan? Mit wem hatte ich gesprochen? Was für Bücher hatte ich gelesen? Als ich älter wurde, fragte sie mich gelegentlich nach meiner Meinung über ein Kleid, das sie gerade gekauft hatte, oder über irgendwelche funkelnde Bereicherungen ihrer Schmuckschatulle. Manchmal machte ich den Fehler, den Gegenstand zu bewundern.
»Es sieht gut aus, weil ich es zu tragen verstehe«, pflegte sie dann zu sagen. »An dir wäre es ... Verschwendung.«
Mir fiel nie auf, daß sich Olivia für Kunst interessierte, mit Ausnahme des Gemäldes in der Bibliothek. Sie hielt sich oft in diesem Raum auf, und da sie nie etwas anderes als Modezeitschriften las, konnte es nur des Bildes wegen sein. Es war ein düsteres, scheußliches Bild, auf dem ein Mann im Kettenpanzer zu sehen war, der das Schlafgemach eines Schlosses betrat, in dem ihn eine nackte auf dem Bett liegende Frau erwartete. Ich bekam eine Gänsehaut, wenn ich es ansah.
Ich verstand meine Abneigung gegen das Bild selbst nicht, bis zu dem Tag; an dem Olivia fort war und Sally ihren freien Nachmittag hatte. Ich schlich mich heimlich in ihr Schlafzimmer, aus dem bloßen Vergnügen heraus, ihr zu trotzen, indem ich etwas Verbotenes tat.
Ich erinnere mich noch, daß die blauen Samtvorhänge zum Schutz vor der Sonne zugezogen waren. Sie bewegten sich leicht in der sanften Brise, die durch das halbgeöffnete Fenster drang. Es fielen schräge Sonnenstrahlen auf das breite Bett und den Toilettentisch, der mit Parfümfläschchen und Cremetöpfen, schildpattbesetzten Bürsten und Spiegeln mit silbernen Rahmen übersät war, all den Utensilien für Olivias gepflegtes, gut konserviertes Erscheinungsbild. In diesem Moment wünschte ich mir nur, im Schlafzimmer meiner Mutter zu stehen und die Gewißheit zu haben, daß sie bald zurückkehren werde. Aber das konnte nicht sein. Olivia war die einzige Herrin, die Meongate kannte, und ich war ihre Feindin. Ich betrachtete die Schicht aus Staub und Puder, die Sally auf dem Spiegel übersehen hatte – und lächelte grimmig.
Als ich mich von dem Toilettentisch abwandte, fiel mein Blick auf ein Gemälde an der gegenüberliegenden Wand. Ich hielt den Atem an. Es handelte sich bestimmt um eine Kopie des Bildes in der Bibliothek. Doch nein. Als ich es näher betrachtete, stellte ich fest, daß zwar Szene und Figuren identisch waren, jedoch in anderer Anordnung. Der Mann lag nun ebenfalls auf dem Bett, liebkoste die Frau, küßte eine ihrer Brüste, während er die andere streichelte. Die Frau hatte den Kopf leicht seitlich gewandt und ihr Gesicht – das Gesicht der Frau war Olivias Gesicht, als sie noch jünger gewesen, als ihre Schönheit noch nicht auf all die Hilfsmittel angewiesen war. Auf dem Gemälde war sie nackt, wie ich sie noch nie gesehen hatte, doch ihr Gesichtsausdruck war mir nur zu vertraut. Er zeigte die nur ihr eigene Mischung aus Langeweile und Haß.
Wie gelähmt starrte ich minutenlang das Bild an, versuchte die Bedeutung dessen zu erfassen, was ich da vor mir sah. Ich fühlte mich abgestoßen und angezogen zugleich von dem, was mir da so überdeutlich entgegensprang – die sich windenden, verschlungenen Glieder, der Mund des Mannes, der sich auf die sich ihm willig darbietende Brust der Frau preßte, und über allem die höhnische Gleichgültigkeit auf diesem Gesicht, das ich kannte.
Noch Tage danach spukte mir das gemalte Bild von Olivia im Kopf herum. Wenn sie mir beim Essen gegenübersaß und zwischen den einzelnen Happen unaufrichtige Bemerkungen zu Lord Powerstock machte, dann sah ich nichts weiter als ihre nackte Gestalt. Wenn ich in ein Zimmer kam, in dem sie sich befand, und sie meine Gegenwart mit einem kühlen, mißbilligenden Blick zur Kenntnis nahm, dann spürte ich nur den abgewandten, zynischen Blick, den sie auf dem Gemälde zeigte. Und als ich erneut das Bild in der Bibliothek betrachtete, sah ich es in einem ganz neuen Licht.
Wer war der Künstler, so fragte ich mich, und warum hatte er Olivia als Modell gewählt? Danach konnte ich nicht einmal Fergus fragen. Ich konnte es nur der Liste der unbeantworteten Fragen hinzufügen, die ich in meinem Kopf herumschleppte.
Außerdem fand meine Neugierde bald ein anderes Ziel. Ich hatte mich nie für den sechseckigen Aussichtsturm interessiert, der sich über dem Flügel des Hauses erhob – die Tür, die man über eine Wendeltreppe erreichte, war stets verschlossen gewesen –, bis Fergus eines Tages die Bemerkung herausrutschte, daß mein Vater ihn als Observatorium benutzt habe und sein Fernrohr, soweit er wüßte, sich noch oben befinde. Sofort faßte ich den Entschluß, das Fernrohr in Augenschein zu nehmen. Ich quälte Fergus so lange, mir den Schlüssel zu geben, bis er ihn mir schließlich unter strengster Verpflichtung zum Schweigen überließ. Ich stimmte zu. Es würde unser Geheimnis bleiben.
Das Observatorium selbst erwies sich als Enttäuschung. Es standen nur einige verstaubte Möbelstücke und ein auf einem Gestell befestigtes Messingfernrohr herum. Doch das Teleskop selbst bot mir die Möglichkeit zur Flucht von Meongate. Nachdem ich gelernt hatte, damit umzugehen, konnte ich beobachten, wie die Eichhörnchen auf den Bäumen im Park herumkletterten oder wie die Kaninchen über die Koppel hoppelten. Ich konnte einen Schäfer studieren, der seine Herde die Wiese hinabtrieb, und ich konnte nach Einbruch der Dunkelheit unentwegt den funkelnden Sternenhimmel anstarren. Ich konnte hier in diesem sicheren Versteck sitzen und mir vorstellen, wie mein Vater sich Notizen über die Anordnung ferner Sterne machte, und mich dabei fragen, ob er derjenige gewesen war, der die halbleere Streichholzschachtel auf dem Sims hatte liegenlassen. Manchmal weinte ich leise vor mich hin, wenn mich Zweifel und Trauer niederdrückten, und ich wünschte mir nichts mehr, als durch das Teleskop zu schauen und ihn Hand in Hand mit meiner Mutter über den Rasen unseres Heimes schlendern zu sehen.
Nur mit meinen Wünschen und Träumen konnte ich sie zurückholen. Meinen Schulfreundinnen gegenüber behauptete ich, daß mein Vater noch nach seinem Tode den DSO verliehen bekommen habe und daß meine Mutter an gebrochenem Herzen gestorben sei. Ich beschrieb sie als die schönste Frau, die ich je gesehen hätte. Soweit ich das beurteilen kann, glaubten sie mir. Manchmal glaubte ich es beinahe selber. Solange ich in Howell's war, konnte ich erzählen, was ich wollte. Erst wenn ich wieder nach Meongate zurück mußte, hatte das ein Ende.
Kapitel 2
Den Tag, an dem ich das erstemal von Thiepval hörte, werde ich nie vergessen. Es war ein Samstag im August des Jahres 1932, ein schwüler, drückend heißer Tag. In der Ferne grollte der Donner, ohne sich zu nähern, und im Verlaufe des Tages lud sich die feuchte Luft um Meongate mit einer immer stärker werdenden Bedrohlichkeit auf. Olivia gab an diesem Abend eine Party. Früher war das äußerst selten vorgekommen, doch in diesem Sommer hatte es bereits einige Anlässe gegeben. Der Ehrengast und Olivias hauptsächlicher Tanzpartner war jedesmal Sidney Payne gewesen, der reiche Bauunternehmer aus Portsmouth.
Ich war damals fünfzehn und besaß genügend falschen Hochmut, um auf diese plötzliche Einführung großer Fröhlichkeit verächtlich herabzusehen. An dem Tag, an dem ich von Howell's zurückgekehrt war, um die Sommerferien hier zu verbringen, war ich Mr. Payne vorgestellt worden, einem häßlichen, dunklen Mann mit aufgedunsenem Gesicht, angeklatschtem Haar und dünnem Schnurrbart. Ich haßte ihn vom ersten Blick an nicht nur wegen seiner schwitzenden Vulgarität und seinen gierigen, kleinen Schweinsäuglein, sondern weil ich spürte, daß Olivia ihn sich ausgesucht hatte als den Mann, der nicht zu wählerisch war und genügend Geld besaß, um sie im Alter unterstützen zu können. Diese Partys, diese Invasion grobschlächtiger Fremder, erfolgten nicht seinetwegen, obwohl er das bestimmt annahm, sondern zu ihrem Nutzen. Olivia sorgte für die Zukunft vor.
An diesem Samstagnachmittag besuchte ich meinen Großvater. Normalerweise hätte ich das nicht getan, doch die Vorbereitungen für die Party waren in vollem Gange. Lord Powerstocks abgeschiedene Räume boten mir eine Zufluchtsstätte. Ich trat unter dem Vorwand bei ihm ein, daß ich ihn seit meiner Rückkehr von Howell's kaum gesehen hatte. Er schien direkt erfreut über meinen Anblick. Er saß am Fenster in seinem Rollstuhl, eine Decke über dem Schoß, das Gesicht grau trotz der Hitze, den verschwommenen Blick auf die Seiten des Magazins gerichtet und sie mit der einen Hand umblätternd, die er noch benutzen konnte.
»Hallo, Großpapa«, sagte ich. »Was liest du da?«
Er hielt das Magazin hoch, damit ich den Titel sehen konnte: Illustrated London News. Als ich neben ihm niederkniete, sah ich, daß er die erste Seite aufgeschlagen hatte. Der Prinz von Wales in Militäruniform inspizierte in Begleitung eines ausländisch aussehenden Gentleman im Frack eine Ehrengarde.
»Wer ist der Mann neben dem Prinzen von Wales?« fragte ich.
»Der französische Präsident. Sie inspizieren französische Truppen in Thiepval. Weißt du, wo Thiepval liegt, Leonora?«
»Irgendwo in Frankreich?«
»Nicht nur das. Es liegt im Zentrum des Schlachtfeldes an der Somme. Der Prinz von Wales war dort, um das neue Denkmal für die Vermißten zu enthüllen.«
Mein Blick heftete sich auf zwei Fotos auf der Umschlagseite. Das obere Bild war eine Luftaufnahme und zeigte ein weitläufiges Backsteinmonument aus Bögen, Säulen und erhöhten Blöcken, die über nackten Feldern aufragten; der Platz davor war mit Zuschauern und parkenden Autos gefüllt. Das zweite Foto war aus der Menge heraus geschossen worden. Man sah den hohen, schlanken Mittelbogen des Monuments, auf dem die britische und die französische Flagge wehten. Davor hatten eine Reihe Soldaten Haltung angenommen. Im Vordergrund befand sich die Menge der Zuschauer, von denen sich einige mit Kameras eine günstige Position zu erkämpfen suchten, während sich andere unter Regenschirmen versteckten.
»Was bedeutet das, Großpapa – ein Denkmal für die Vermißten?«
»Es dient zur Erinnerung an die Männer, die in der Schlacht an der Somme gefallen sind und die kein bekanntes Grab haben. All ihre Namen sind da festgehalten.«
»Aber, warum ist es so groß?«
»Weil es so viele Namen gibt. Siehst du, da steht, wie viele es sind.«
Ich las den Text unter den Fotos. Da stand die Zahl: 73 412 Männer, deren letzte Ruhestätte unbekannt war.
»Dein Vater ist einer dieser Männer, Leonora. Sein Name wird dort verzeichnet stehen. Eines Tages werde ich vielleicht mit dir hinfahren, damit du es selbst sehen kannst.«
Angesichts seines Gesundheitszustandes war es ein absurder Vorschlag, doch für mich war es Ermutigung genug, da er nur selten meinen Vater erwähnte. Ich nahm meinen Mut zusammen und stellte weitere Fragen.
»Heißt das, mein Vater hat kein Grab?«
Er runzelte die Stirn und schob das Kinn vor. »Ja, ich fürchte, das heißt es.«
»Was ist mit meiner Mutter? Hat sie ein Grab?«
Sein Gesichtsausdruck wurde weicher. »O ja. Natürlich hat sie ein Grab. Wie kommst du zu dieser Frage?«
»Dann ..., wo ist es?«
Er wandte das Gesicht ab und blickte mit zusammengekniffenen Augen zum Fenster hinaus. »Es ist ... weit weg.«
»Willst du mir nicht sagen, wo es ist?«
»Vielleicht ..., wenn du älter bist.«
»Wieviel älter?«
Er sah mich an. »Wenn ich denke, daß du bereit bist.«
Wir sprachen nicht mehr nur vom Grab meiner Mutter. Ich glaube, wir wußten beide, daß er mir eben die Antwort auf all meine Fragen versprochen hatte.
»Ich bin jetzt müde, Leonora. Geh und laß mich schlafen.«
Ich durfte die Illustrated London News mitnehmen. Ich ging hoch auf mein Zimmer, legte mich aufs Bett und verschlang jedes Wort des Artikels, studierte jede Gestalt auf dem Foto. Du hast das Denkmal jetzt gesehen, genauso wie ich. Damals konnte ich mir nur ausmalen, wie es sein würde, konnte mir nur vormachen, daß mein Großvater eines Tages sein Versprechen halten würde. Immer wieder las ich die Zitate aus der Ansprache des Prinzen von Wales, bis sie in mein Gedächtnis eingebrannt waren. Bis zum heutigen Tag erinnere ich mich an seine Worte.
»Diese Myriaden von Namen dürfen nicht nur ein Buch der Toten sein. Sie müssen das Eröffnungskapitel eines neuen Buchs des Lebens darstellen – die Grundlage und der Führer für eine bessere Zivilisation, in der es keine Kriege mehr gibt.«
Nette Worte für 73 412 Männer ohne Grab. Und mein Vater war einer von ihnen.
Als es dunkel wurde, füllte sich das Haus mit Menschen. Man hörte Gelächter, Stimmengewirr und Jazzmusik aus dem Grammophon. Wagentüren knallten, als weitere Gäste ankamen. Von irgendwo hörte ich Paynes laute, brutale, vom Alkohol schon undeutliche Stimme. Es war zuviel. Kaum war das letzte Licht vom Himmel verschwunden, da suchte ich im Observatorium Zuflucht. Hier konnte ich dem Lärm entfliehen, hier konnte mich niemand finden.
Wahrscheinlich hätte ich mich damit zufriedengegeben, die Sterne zu beobachten und auf das Ende der Party zu warten, wären nicht in einem der hinteren Schlafzimmer des Haupthauses die Lichter angegangen. Überrascht sah ich Olivia an einem offenen Fenster auftauchen, denn es war nicht ihr Schlafzimmer, und die Party war immer noch in vollem Gange. Voller Neugierde und insgeheim erfreut, sie zumindest auf diese Weise in der Hand zu haben, richtete ich das Fernrohr auf sie.
Sie hob den Kopf und rieb sich über die Kehle, atmete dabei ein paarmal tief durch. Sie trug ein enganliegendes, pinkfarbenes, mit Spitze besetztes Seidenkleid, das ihre Figur sehr vorteilhaft zur Geltung brachte.
Sie wandte sich vom Fenster ab. In dem Moment kam ein Mann in mein Blickfeld. Es war Sidney Payne. Er durchquerte das Zimmer, packte sie an der Taille und küßte sie voll auf den Mund, dann auf den Nacken. Ihr Kopf schwang zurück, und sie lachte. Er ließ seine rechte Hand über ihre Hüfte und ihren Schenkel gleiten, dann küßte er die Ansätze ihrer Brüste über dem tiefen Ausschnitt ihres Kleides. Sein Gesicht wurde rot und häßlich vor Begierde, doch auf Olivias Gesicht war jetzt, da Payne es nicht mehr sehen konnte, etwas viel Schlimmeres wahrzunehmen: der gleiche Ausdruck, den ich auf dem Gemälde gesehen hatte, dieser unverwechselbare Abscheu. Dann bewegten sie sich, immer noch aneinandergeklammert, mit ungeschickten, taumelnden Schritten durch das Zimmer, auf das Bett zu, vermutete ich, in jedem Fall aber aus meinem Blickfeld hinaus.
Ich selber hätte den Blick nicht abwenden können, aber plötzlich war ich dankbar, daß sie aus meiner Sicht verschwunden waren. Allein im Observatorium, begann ich zu weinen – nicht weil mich der Anblick der Szene so entsetzt hatte. Olivia hatte mir einen kurzen Einblick in meine Zukunft gegeben, einen Vorgeschmack darauf, wie das Leben auf Meongate für mich aussehen würde, sobald sie hier die Alleinherrscherin war. Ich hätte mir ohnehin denken können, wie es sein würde. Jetzt wußte ich es.
Ich fand meine Befürchtungen früher als erwartet bestätigt. An einem Nachmittag im November dieses Jahres wurde ich in Howell's vom Hockeyplatz in das Büro der Direktorin geholt. Für gewöhnlich war sie streng und herrisch, deshalb war ich sofort auf der Hut, als sie sich bei dieser Gelegenheit sanft und milde gab. Mein Großvater hatte einen tödlichen Schlaganfall erlitten, und ich sollte auf der Stelle heimkehren.
Gleich am nächsten Morgen wurde ich von meiner Hausaufseherin nach Wrexham zum Schnellzug nach London gefahren. Ich glaube, meine vollkommen gefaßte Haltung verwirrte sie, aber ich konnte es nicht ändern. Mein Großvater hatte sich mir gegenüber nie so weit geöffnet, daß ich jetzt echte Trauer um ihn empfinden konnte. Und doch war meine gefaßte Haltung zum Teil nur Mittel zum Zweck. Ich wollte mich gegen all die Veränderungen stählen, die nun kommen würden, ich wollte Olivia nicht die Befriedigung gönnen, zu wissen, daß ich um meine Zukunft fürchtete, in der ich ihr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert wäre.
Es war gut, daß ich mich vorbereitet hatte, denn in Meongate herrschte bereits Sidney Payne. Fergus war überzeugt davon, daß Paynes ständige Anwesenheit den Tod seines Herrn beschleunigt hatte. Wir waren solidarisch in unserem Haß auf diesen Eindringling, der uns beide bedrohte, doch wir waren hilflos. Der Powerstock-Titel war zusammen mit meinem Großvater gestorben, und Adel und Würde verließen Meongate im wahrsten Sinne des Wortes mit seinem Leichenzug.
Nach der Beerdigung begleitete uns Mayhew, der Familienanwalt, zurück zum Haus zur Testamentseröffnung. Mayhew war ein hagerer Mann, der nur wenige Worte machte. Nachdem er einen Sherry abgelehnt hatte, verlas er mit schneller, ausdrucksloser Stimme das Dokument. Sein Publikum bestand aus Olivia und mir, obwohl Olivia kaum zuzuhören schien, während sie hinter ihm auf und ab ging. Im Gegensatz dazu lauschte ich angespannt, um zu erfahren, was mein Großvater mir vermacht hatte. Ich hatte bereits erfahren, daß mein Erbe, was immer es auch sein mochte, treuhänderisch verwaltet würde, bis ich volljährig war. Es würde also sechs Jahre dauern, bis ich von Olivia unabhängig war. Eine unerfreuliche Zeit, das war mir klar, aber nicht unerträglich.
Mayhew kam zum Ende der Einleitung. Olivia schob sich langsam hinter seinen Stuhl. »Ich vermache all meinen Besitz und mein gesamtes persönliches Vermögen nach Bezahlung meiner anerkannten Schulden und der Begräbnis- und Testamentskosten meiner Frau Olivia und ernenne sie hiermit zur alleinigen Vollstreckerin dieses meines Testaments.«
Das war alles. Ich wurde überhaupt nicht erwähnt, für sein einziges Enkelkind hatte er nichts übriggelassen.
»Und damit erkläre ich alle vorangegangenen Testamente, die ich bis zum heutigen Tag, dem i. Mai 1917, unterschrieben habe, für ungültig. Unterzeichnet: Powerstock.«
Ich war sprachlos. Wie konnte er seine Enkelin so vollkommen ignorieren? Er hatte das Testament verfaßt, als ich zwei Monate alt gewesen war. Mayhew begann seine Papiere einzusammeln. Endlich fand ich die Sprache wieder. »Ich verstehe nicht.«
Mayhew blickte mich an. »Was verstehen Sie nicht, junge Dame?«
»Sie haben meinen Namen nicht erwähnt.«
»Da gab es nichts zu erwähnen.«
»Aber ... ich bin seine Enkelin.«
Olivia blieb abrupt stehen und schaute mich an. Sie stand nun am Fenster und hatte das Licht hinter sich, so daß ich ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen konnte. »Edward hat dein Wohlergehen in meine Hände gelegt, Leonora.«
In ihrer Gegenwart gab es dazu nichts mehr zu sagen. Ich schritt auf dem Rasen auf und ab und versuchte einen klaren Gedanken zu fassen. Ich war Lord Powerstocks einzige Blutsverwandte, das einzige noch lebende Mitglied seiner Familie, und doch – nichts! Meongate, mein Zuhause, das Heim meiner Familie, gehörte mir, gehörte uns nicht mehr. Ich schaute zu dem Fenster, von dem aus er mich so oft beobachtet hatte. Hätte er mir das eines Tages erzählt, wenn er lange genug gelebt hätte? Ich würde es nie erfahren.
Als ich mich wieder dem Haus zuwandte, steig Mayhew gerade in seinen Wagen. Ich rannte auf ihn zu, hielt eine Hand hoch, um seine Aufmerksamkeit zu erregen.
»Mr. Mayhew!«
»Ja, junge Dame?« Sein Gesichtsausdruck stimmte mich nicht gerade zuversichtlich.
»Können Sie mir sagen ... weshalb mein Großvater mich in seinem Testament ignoriert hat?«
»Das kann ich nicht.«
»Aber ... es ist nicht richtig.«
»Ich habe das Dokument selbst als Zeuge unterschrieben. Lord Powerstocks Absichten waren unmißverständlich.«
»Bin ich denn zu gar nichts berechtigt?«
Er überlegte einen Moment. »Sie sind berechtigt, das Testament anzufechten. Als Minderjährige benötigen Sie dazu jedoch die Einwilligung Ihres Vormunds – Lady Powerstock.«
So war das also. Mayhew fuhr los und ließ mich allein zurück, Olivia ausgeliefert. Die Rechte, die mir zustanden, konnte sie mit einer Handbewegung vom Tisch fegen. Lord Powerstock hatte ihr die Zukunft überschrieben und mir nichts.
Was diese Zukunft mir bringen würde, wurde bald schon deutlich. Als ich für die Weihnachtsferien nach Meongate zurückkehrte, war eine Party im Gange. In der Kälte eines Dezembernachmittags marschierte ich allein vom Bahnhof zum Haus. Alle Fenster waren hell erleuchtet. Musikfetzen und Gelächter wehten in die Dunkelheit heraus. Fergus begrüßte mich mit der Warnung, mich auf das Schlimmste vorzubereiten. Olivia hatte Anweisung gegeben, daß ich mich sofort nach meiner Ankunft der Party zugesellen sollte.
Ungefähr ein Dutzend Gäste hatte sich im Salon versammelt. Holzscheite prasselten im Kamin, Jazzmusik plärrte aus dem Grammophon, Ginwolken und Zigarettenqualm hingen in der Luft. Sidney Payne stand mit rotem Gesicht da und lachte über einen Witz, den er gerade erzählt hatte. Einige der Leute kannte ich; es waren Geschäftsfreunde von Payne, die zuvor schon in Meongate gewesen waren. Männer mit rauhen Stimmen, die Unmengen von Alkohol tranken und kichernde, um zwanzig Jahre jüngere Frauen am Arm hatten. Ich glaube nicht, daß einer von ihnen mein Eintreten bemerkte.
Mit Ausnahme von Olivia. Sie ruhte, in karmesinrotem Seidenkleid und eine Zigarette in einer Spitze rauchend, auf einer Chaiselongue und erhob sich nun, um mich mit wachsamem Lächeln zu begrüßen. »Willkommen daheim, Leonora«, sagte sie, laut genug, um die Gespräche in ihrer unmittelbaren Umgebung zum Schweigen zu bringen. »Du kommst gerade rechtzeitig für einen Toast. Sidney, ein kleines Glas Champagner für Leonora.«
Payne trat vor und reichte mir ein Glas, wobei er mir Zigarrenrauch ins Gesicht blies. Ich schaute ihn nicht an. Mein Blick blieb auf Olivias Gesicht geheftet, auf dem sich hämischer Triumph abzeichnete.
»Sidney und ich haben unsere Verlobung bekanntgegeben«, sagte sie. »Ich möchte, daß du auf unser Glück trinkst.«
»Ich gehöre jetzt zur Familie«, sagte Payne, was ich irgendwo am Rande meines Bewußtseins mitbekam.
Ich trank – oder besser gesagt, ich nippte – und fragte, ob ich wieder gehen dürfe, doch Olivia bestand auf meiner Anwesenheit. Also setzte ich mich, immer noch in meiner Schuluniform, auf einen harten Stuhl, umklammerte mein Glas Champagner, ohne davon zu trinken, und beobachtete den Fortgang der Party.
Ein Paar begann in der Mitte des Raumes Charleston zu tanzen, ein anderes küßte sich auf einem Sofa in der Ecke. Die Stimmen wurden lauter, die Gesichter röter, das Gelächter hysterischer. Getränke wurden verschüttet, brennende Zigaretten in den Teppich getreten. Meine Augen begannen zu tränen, in meinen Ohren dröhnte es. Und während all der Zeit blieb Olivia auf ihrem Platz sitzen, trank wenig und lachte noch weniger, beobachtete mich, wie ich die grelle Schamlosigkeit ihres seltsam freudlosen Sieges ertrug. Denn das alles hier war mehr als nur eine Party, mehr als nur die Verkündigung ihrer Verlobung. Es war eine Absichtserklärung.
Gegen Ende zu war Payne sehr betrunken. Ich bemerkte, wie er eines der Mädchen in eine Ecke quetschte und ihr etwas ins Ohr flüsterte, was sie zum Lachen brachte. Er hob den Saum ihres Kleides und schob ihr eine Fünf-Pfund-Note oben in den Strumpf. Wieder lachte sie laut auf.
Dann schaute ich zu Olivia und bemerkte, daß auch sie ihn beobachtet hatte. Als ihr Blick sich wieder auf mich richtete, trug ihr Gesicht ganz deutlich den Ausdruck der Frau auf dem Gemälde, an den ich mich so genau erinnerte. Sie erhob sich von der Couch, kam auf mich zu und nahm mir das Glas aus der Hand.
»Du kannst jetzt gehen«, sagte sie.
Zu Ostern waren sie verheiratet. Paynes Sohn aus erster Ehe machte den Trauzeugen. Von mir wurde nicht verlangt, daß ich zu der Zeremonie heimkehrte, die in einem Standesamt in Portsmouth stattfand. Wie Fergus mir erzählte, folgte darauf eine sich über das ganze Wochenende erstreckende Party in Meongate.
Egozentrisch, wie ich damals war – und wer ist mit sechzehn schon nicht egozentrisch? –, hatte ich mir eingeredet, daß Olivia diese lieblose, abstoßende Ehe nur aus Haß auf mich eingegangen war. Im Rückblick bezweifle ich das allerdings. Ihr extravaganter Geschmack und Lord Powerstocks unzureichende Verwaltung seiner Finanzen hatten wahrscheinlich eine einträgliche Verbindung notwendig gemacht, falls sie weiter im gewohnten Stil leben wollte. Denn Payne hatte, neben all seinen offensichtlichen Mängeln, im Bauboom der Nachkriegszeit genügend Geld verdient, um ihr dieses Leben zu ermöglichen. Zumindest muß sie sich das so ausgerechnet haben.
Doch die wahren Konsequenzen ihrer Eheschließung übertrafen sämtliche Vermutungen bei weitem. Payne, sein widerlicher Sohn und deren ganzer Bekanntenkreis machten mich zu einer Fremden in meinem eigenen Haus. Zumindest hatte ich in Fergus einen Verbündeten und in Schulzeiten eine Zufluchtsstätte. Als mir dann eines Tages Angela Bowden, eine Schulfreundin, deren Vater eine Kette von Immobilienbüros entlang der Südküste besaß, erzählte, Payne sei in einen Bauskandal verwickelt, dachte ich mir kaum etwas dabei. Als sie mir einen Zeitungsartikel zeigte, in dem vom Absinken des Bodens unter einigen Häusern die Rede war, die er in Portsdown Hill errichtet hatte, erheiterte mich das anfangs lediglich. Was die Anschuldigungen bezüglich bestochener Beamter der Baubehörde und korrupter Stadträte bedeuteten, verstand ich nicht wirklich. Alles, was Payne schaden konnte, war mir höchst willkommen.
Die wahre Bedeutung dieser Ereignisse dämmerte mir erst, als ich Weihnachten 1933 nach Meongate zurückkehrte. Genau ein Jahr war seit Olivias Verlobungsparty vergangen, genau ein Jahr, seit sie, wie sie dachte, sich ihren Wohlstand bis zum Ende ihrer Tage gesichert hatte. Während ich vom Bahnhof heimging, fragte ich mich, was ich dort vorfinden würde. Jede nur vorstellbare Aussicht erschreckte mich, doch ich erriet nicht einmal annähernd, was mich tatsächlich erwartete.
Diesmal war keine Party im Gange. Keine Kerzenleuchter funkelten, kein Kaminfeuer prasselte. Nicht einmal Fergus war zu meiner Begrüßung erschienen. Ich ging in den Salon, in dem ein einziges Licht brannte, und traf auf Payne, der laut schnarchend und nach Whisky stinkend in einem Sessel schlief. Ich ließ meine Tasche krachend zu Boden fallen, aber er wachte nicht auf.
Verwirrt läutete ich die Glocke. Nach einigen Minuten tauchte Sally auf. Ihr Gesicht war noch mürrischer und verkniffener als sonst.
»Wo ist Fergus?« wollte ich wissen.
»Er hat uns verlassen, Miss. Hat's Ihnen die Herrin nicht erzählt?«
»Nein. Wo ist sie?«
»Wahrscheinlich im Arbeitszimmer.«
Dort fand ich sie, am Schreibtisch meines Großvaters sitzend. Sie sah müde und viel älter aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Ihre ganze Begrüßung bestand aus einem eisigen Blick.
»Sally erzählte mir, Fergus sei gegangen«, sagte ich.
»Fergus wurde entlassen.«
»Warum?«
»Er hat einmal zu oft hinter mir her geschnüffelt.«
»Aber er ist bei der Familie seit ...«
»Zu lange. Viel zu lange. Hier wird sich einiges ändern, Leonora. Fergus ist nur ein Beispiel dafür.« Sie erhob sich und ging zum Fenster hinüber. Zum erstenmal bemerkte ich, daß ihre ungeheure Selbstbeherrschung sie im Stich ließ. Sie war zornig, wenn auch ausnahmsweise nicht auf mich. »Mein Mann hat seinen Bankrott erklärt.«
»Bankrott?«
»Ich dachte, du habest davon gehört.«
»Du meinst diese Häuser in Portsdown?«
»Du hast davon gehört. Ja. Diese Häuser in Portsdown. Anscheinend besaß das Vermögen meines Mannes ein ebenso schlechtes Fundament wie sie. Er ist ruiniert und wird angeklagt werden. Aber das ist das kleinste Problem. Meine Hauptsorge ist, zu vermeiden, daß ich mit ihm zusammen ruiniert werde.« Sie drehte sich so schnell um, daß ihr meine unmittelbare Reaktion nicht entging. »Und glaube bloß nicht, du seist in die Sache nicht verwickelt.«
»Ich habe nichts damit zu tun.«
»O doch. Nach Weihnachten wirst du nicht mehr nach Howell's zurückkehren. Ich kann mir das Schulgeld nicht leisten. Ich habe gerade eben deiner Direktorin geschrieben.«
»Nicht ... zurückkehren? Das kannst du nicht ...«
»Und ob ich das kann, Leonora.« Sie kam näher. »Als dein Vormund kann ich genau das tun, was ich will. Deine Ausbildung ist nun eine unnötige Extravaganz.«
»Aber was ... was soll ich tun?«
»Jetzt, wo Fergus nicht mehr da ist, wird es sehr viel für dich zu tun geben. Du kannst Sally helfen.«
Ich war also in meinem eigenen Haus nichts Besseres mehr als eine Dienerin. Das waren ihre Pläne für mich. Ich rannte aus dem Haus hinunter zum Fluß, wo Fergus so oft geangelt hatte. Die herabhängenden Äste waren nackt und kahl, der Frost fraß sich allmählich in das Gras. Ich legte meinen Regenmantel über einen umgestürzten Baumstamm und schluchzte über all das Elend, das Olivias wegen über mich gekommen war. Kein Fergus mehr, dem ich mich anvertrauen konnte, keine Schulfreundinnen, keine Hoffnung auf Besserung. Schließlich trocknete ich mir die Tränen und beschloß, Olivia gegenüber keine Anzeichen von Schwäche zu zeigen, ihr keinen Hinweis zu liefern, daß sie mich untergekriegt hatte. Ich würde meine Zeit abwarten – und ihr dann entrinnen.
In den folgenden Monaten hingen finanzielle Ungewißheit und unausgesprochene Feindseligkeit wie eine dunkle Wolke über Meongate. Payne verbrachte seine Tage im Trunk und wartete auf seinen Gerichtsbeschluß, der seinen anderen Übeltaten vielleicht noch Bestechung und Korruption hinzufügte. Olivia hatte so viele Besprechungen mit Mayhew, daß sie sich kaum um mich kümmern konnte. Unser einziger Besucher war Paynes Sohn Walter, ein dreißigjähriger Mann ohne jeden Charme, der nur noch etwas mehr Selbstvertrauen benötigte, um ein Ebenbild seines Vaters zu werden. Ich ging allen aus dem Wege und hing meinen eigenen Gedanken nach. Wann immer es mir möglich war, begab ich mich nach Droxford. Dort hörte ich aus verschiedenen Gesprächen heraus, daß Fergus als Fahrstuhlführer in einem Kaufhaus in Portsmouth arbeitete (die Posthalterin hatte ihn dort gesehen) und daß Paynes Fall im April vor Gericht kommen würde (seine Verurteilung wurde als sicher angesehen).