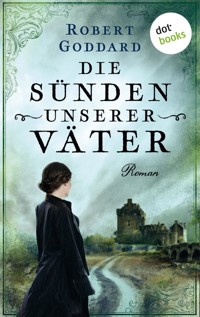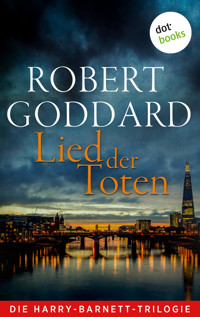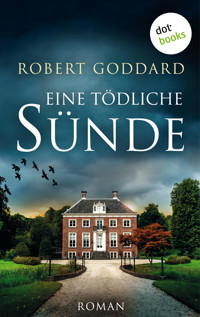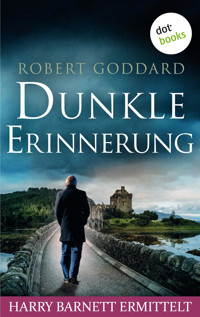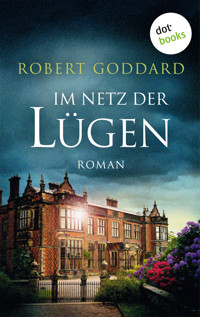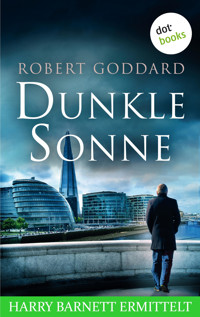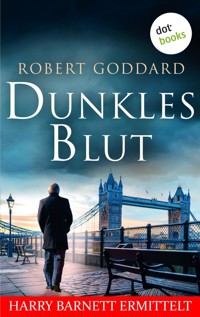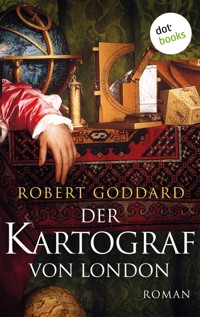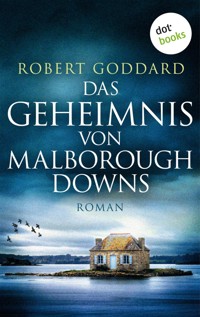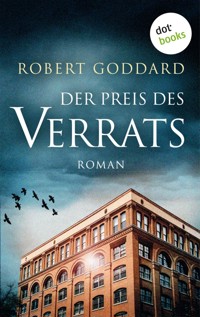Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein klassischer englischer Kriminalroman vor der morbiden Kulisse des alten Seebads Brighton: »Denn ewig währt die Schuld« von Robert Goddard als eBook bei dotbooks. Toby Flood steht vor dem Nichts: Seine Karriere als Schauspieler geht auf Provinzbühnen dem Ende entgegen, mit seiner Frau ist er nur noch auf dem Papier verheiratet. Doch nun bittet Jenny ihn um Hilfe: Er soll einen Mann zur Rede stellen, der sie seit Wochen verfolgt und beobachtet. Hat der unheimliche Schattenmann etwas mit dem reichen Unternehmer Roger Colburn zu tun, Jennys neuem Freund? Toby wittert eine Chance, seine Frau zurückzugewinnen. Doch dann beginnt er, die falschen Fragen zu stellen, und taumelt in einen Abgrund aus Neid, Hass und dunklen Familiengeheimnissen. Als ein mysteriöser Mord geschieht, wird Tony klar: Er soll das nächste Opfer sein … »Robert Goddard ist der absolute Meister des Spannungsromans!« Daily Mirror Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der abgründige Kriminalroman »Denn ewig währt die Schuld« von Robert Goddard. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 519
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Toby Flood steht vor dem Nichts: Seine Karriere als Schauspieler geht auf Provinzbühnen dem Ende entgegen, mit seiner Frau ist er nur noch auf dem Papier verheiratet. Doch nun bittet Jenny ihn um Hilfe: Er soll einen Mann zur Rede stellen, der sie seit Wochen verfolgt und beobachtet. Hat der unheimliche Schattenmann etwas mit dem reichen Unternehmer Roger Colburn zu tun, Jennys neuem Freund? Toby wittert eine Chance, seine Frau zurückzugewinnen. Doch dann beginnt er, die falschen Fragen zu stellen, und taumelt in einen Abgrund aus Neid, Hass und dunklen Familiengeheimnissen. Als ein mysteriöser Mord geschieht, wird Tony klar: Er soll das nächste Opfer sein …
Über den Autor:
Robert William Goddard, geboren 1954 in Fareham, ist ein vielfach preisgekrönter britischer Schriftsteller. Nach einem Geschichtsstudium in Cambridge begann Goddard zunächst als Journalist zu arbeiten, bevor er sich ausschließlich dem Schreiben von Spannungsromanen widmete. Robert Goddard wurde 2019 für sein Lebenswerk mit dem renommierten Preis der Crime Writer's Association geehrt. Er lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks auch die folgenden Kriminalromane: »Im Netz der Lügen«, »Der Preis des Verrats«, »Eine tödliche Sünde«, »Ein dunkler Schatten«, »Denn ewig währt die Schuld«, »Das Geheimnis von Trennor Manor«, »Und Friede den Toten«, »Das Geheimnis der Lady Paxton« und »Das Haus der dunklen Träume«.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks weiterhin die historischen Kriminalromane: »Die Sünden unserer Väter«, »Die Schatten der Toten«, »Jäger und Gejagte«, »Die Klage der Toten« und »Der Kartograf von London«.
Robert Goddard veröffentlichte außerdem bei dotbooks seine drei Kriminalromane mit dem Ermittler Harry Barnett: »Dunkles Blut«, »Dunkles Sonne« und »Dunkle Erinnerung«.
***
eBook-Neuausgabe Januar 2020
Copyright © der englischen Originalausgabe 2004 Robert Goddard
Die englische Originalausgabe erschien 2004 unter dem Titel »Play to the End« bei Bantam Press, London.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Adobe Stock/Veneratio
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96655-097-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Robert Goddard« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Goddard
Denn ewig währt die Schuld
Roman
Aus dem Englischen von Peter Pfaffinger
dotbooks.
Für Marcus Palliser,1949-2002,Seemann, Autor, Debattierer, Desillusionistund schmerzlich vermisster Freund.
Eine Transkription von Aufnahmen,die in der ersten Dezemberwoche 2002auf Band gesprochen wurden.
SONNTAG
Was ich empfand, als ich heute Nachmittag aus dem Zug stieg, traf mich völlig unvorbereitet. Dabei war schon die Fahrt so entsetzlich öde gewesen, wie es an einem Dezembersonntag wohl nicht zu vermeiden ist.
Von den anderen haben es fast alle vorgezogen, über London anzureisen, und werden erst morgen hier eintreffen. Ich hätte mich ihnen anschließen können, entschied mich aber stattdessen für den Regionalzug der South-Central-Gesellschaft die Küste entlang. So bekam ich reichlich Gelegenheit, mein Innenleben zu analysieren, während eine endlose Reihe von tristen Hintergärten an dem verschmierten Fenster vorbeizog. Natürlich war mir längst klar, warum ich London mied. Ich wusste genau, warum grelle Lichter und lärmende Gesellschaft nicht zu den Dingen gehörten, die der Arzt mir verschrieben hat. Die Wahrheit ist, dass ich es vielleicht gar nicht nach Brighton geschafft hätte, wenn ich in die große Stadt geflohen wäre. Womöglich hätte ich mich sogar eine Woche vor Schluss aus dieser von Tag zu Tag hoffnungsloseren Tournee ausgeklinkt und es Gauntlett überlassen, mich zu verklagen, sofern er sich dazu hätte aufraffen können. Aus diesem Grund habe ich das einzige Verkehrsmittel gewählt, bei dem ich sicher sein konnte, dass es mich hierher bringen würde. Und das hat es getan. Jetzt bin ich da. Verspätet, durchgefroren und deprimiert. Aber da. Und dann, als ich den Fuß auf den Bahnsteig setzte ...
Meine Gefühle bei der Ankunft sind der Grund, warum ich jetzt in dieses Gerät spreche. Ich kann sie nicht richtig benennen. Nervosität war es streng genommen nicht. Lampenfieber ebenso wenig. Nicht einmal eine Vorahnung. Wohl eher ein wenig von allem. Ein Kitzel, ein Prickeln, ein kalter Schauer den Nacken hinunter, eine Gänsehaut. Dass in Brighton etwas anderes als eine ausgedehnte große Enttäuschung meiner harrte, war wirklich nicht zu erwarten. Doch schon jetzt, noch bevor ich das Drehkreuz zur Bahnhofshalle passiert hatte, spürte ich mit einer an Gewissheit grenzenden Intensität, dass sich ein Empfang zusammenbraute, der noch mehr als all das für mich bereithielt. Dieses Mehr konnte ein gutes oder schlechtes Vorzeichen sein, war aber in jedem Fall allem anderen vorzuziehen.
Meinen Gefühlen traute ich natürlich nicht. Wie auch? Jetzt sehe ich das allerdings anders. Denn es hat bereits angefangen. Vielleicht hätte ich früher begreifen sollen, dass diese Tournee eine Reise ist. Und das eigentliche Ziel der Reise das ist, was ich jetzt mache.
Das mit dem Tonband war die Idee meiner Agentin. Na ja, eigentlich schwebte ihr eher ein Tagebuch vor – damals, in jenen herrlichen Sommertagen, als dieser Ackergaul von Theaterstück noch wie ein Vollbluthengst aussah, der endlos laufen würde, und die bloße Aussicht auf eine Chronik der Ereignisse einen Lunch im River Café wert war. Moira dachte an so etwas wie die Aufzeichnung eines Prozesses, bei dem die Schauspieler an ihrer Rolle feilen und die tieferen Schichten des Textes entdecken, ehe sie damit in London im West End auftreten. Wie sie das sah, war eine Fortsetzungsgeschichte in einer Zeitung denkbar, sozusagen als Dreingabe zu den zweitausend pro Woche, die mir Gauntlett mittlerweile mit wachsendem Widerwillen zahlt. Der Vorschlag klang gut (wie so vieles von dem, was Moira sagt). Davon motiviert, kaufte ich mir dieses kleine Aufnahmegerät zu einer Zeit, als mir noch die schönsten Luftschlösser durch den Kopf spukten. Und darüber bin ich jetzt froh.
Allerdings ist es mehr oder weniger das erste Mal, dass ich die Sache so sehe. Eigentlich hatte ich das Tagebuchprojekt aufgegeben, bevor ich überhaupt daran arbeitete. In Guildford, wo unsere stolze Produktion im Yvonne Artaud Theatre ihre Weltpremiere erlebte, hätte es damit losgehen sollen. Ist das erst neun Wochen her? Es kommt mir eher vor wie neun Monate, die Zeitspanne einer schwierigen Schwangerschaft – in unserem Fall eine, bei der eine Totgeburt von Anfang an beschlossene Sache war, nachdem wir von Gauntlett erfahren hatten, dass sich das Gastspiel im West End wohl zerschlagen würde. Jetzt danke ich Gott für die Weihnachtssaison mit den alten Pantomime-Stücken auf praktisch jeder Bühne, denn sonst wäre er vielleicht noch versucht gewesen, uns in der Hoffnung auf irgendein Wunder weiter durch das Land tingeln zu lassen. Wie die Dinge stehen, fällt nächsten Sonntag der Vorhang, und zwar wahrscheinlich für immer.
Dabei hätte es gar nicht so kommen müssen. Als letztes Jahr bekannt wurde, dass ein bis dahin unbekanntes Stück des früh verstorbenen und allseits geschätzten Joe Orton entdeckt worden war, galt es weithin schon deshalb als Meisterwerk, weil es ihm zugeschrieben wurde. Brauchte man da noch triftigere Beweise? Das war schließlich der Mann, dem wir Seid nett zu Mr. Sloane, Beute und Was der Butler gesehen hat verdanken. Zugleich war das auch der Mann, der sich mit seinem vorzeitigen Tod einen Ruf als anarchisches Genie sicherte, als ihn sein Liebhaber Kenneth Halliwell im August 1967 in ihrer gemeinsamen Wohnung im Londoner Stadtteil Islington umbrachte. Dank seiner Biografie und seiner gesammelten Tagebücher, die ich überallhin mitschleppe, habe ich die wichtigen Fakten über sein außergewöhnliches Leben immer parat. Ich dachte, das würde mich inspirieren. Ich dachte alles Mögliche. So richtig geklappt hat nichts davon.
Das Manuskript des Stücks Das Mietverhältnis wurde von einem Klempner im Flur von Ortons und Halliwells Wohnung unter den Bodendielen entdeckt. Ich stelle mir vor, dass Orton sich über die Umstände dieses Fundes königlich amüsiert hätte. Vielleicht hat er es dort sogar als Spaß platziert. Oder aber – das ist die Theorie, zu der ich neige – Halliwell verbarg es in der letzten Phase seines geistigen Verfalls, nicht lange, bevor er Orton mit einem Hammer den Kopf zertrümmerte und sich selbst mit einer Überdosis Nembutal das Leben nahm. Orton-Experten datieren das Stück auf den Winter 1965/66. Ihrer Einschätzung nach verwarf er es, als das Stück Beute nach einer verheerenden ersten Laufzeit wiederbelebt wurde. Wenn ich es recht bedenke, ähnelte diese Tournee auf gespenstische Weise meinen Erfahrungen mit dem Ensemble, in dem ich seit Herbstbeginn die Hauptrolle spiele. Im zweiten Anlauf schaffte Beute allerdings den Durchbruch, weil Orton quicklebendig war, mitarbeitete und bereit war, es zu modifizieren. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass er jetzt nicht greifbar ist, um das Stück Das Mietverhältnis zu retten, das er in den Orkus (oder unter die Bodendielen) beförderte, um sich wieder Beute widmen zu können. Wir sind auf uns selbst gestellt. Und das merkt man der Produktion auch an.
Jetzt ist aber genug über das Stück geredet worden. Seine Möglichkeiten und seine Probleme haben wir im Ensemble bis zum Erbrechen analysiert. Es hätte meine Karriere wieder auf die Erfolgsspur führen oder zumindest vom Abstellgleis herunterholen sollen, auf das ich vor ein paar Jahren auf mir unerklärliche Weise abgeschoben wurde. Ich bin der Mann, der gute Aussichten hatte, der neue James Bond zu werden, als Roger Moore aufhörte. Selbst mir fällt es heute schwer, das zu glauben, obwohl ich genau weiß, dass es stimmt. Genauso wahr ist: Man merkt erst dann, dass es nicht mehr nach oben geht, wenn der Abstieg bereits begonnen hat.
Natürlich gibt es jede Menge von Anzeichen, vorausgesetzt, man ist klug genug, sie zu bemerken, oder bereit, sich darauf einzulassen. Mein Name steht auf dem Plakat ganz oben und wird darum auch mit dem Flop verbunden. Martin Donahue dagegen, der die Rolle meines jüngeren Bruders spielt, hat es irgendwie geschafft, trotz der katastrophalen Saison so viele Lorbeeren einzuheimsen, dass beim nächsten Mal er, nicht ich, die Hauptrolle bekommen würde, sollten wir jemals wieder zusammen auftreten – wogegen ich mich allerdings mit Händen und Füßen wehren würde. Es gab mal eine Zeit, als Mandy Pringle, unsere ehrgeizige zweite Inspizientin, immer erst mich und nicht Donahue ins Auge fasste. Diese Zeit ist vorbei. Noch nicht lange, aber trotzdem vorbei. Vielleicht freuen die anderen sich auf eine Woche in Brighton. Keiner von ihnen wird sich vorstellen können, dass ich mich nach unserer Woche in Sussex-by-the-Sea sehne. Erstaunlich, aber es ist wirklich so. Im Augenblick zumindest.
In Poole hat es gestern die ganze Nacht geregnet. Und als ich heute Morgen in den Zug stieg, goss es immer noch. Brighton muss die Sintflut ebenfalls abbekommen haben, aber als ich den Bahnhof verließ, war es trocken. So trottete ich in einem milden grauen Dämmerlicht die Queen's Road zum Meer hinunter, das wie eine dunkelgraue Schieferplatte dalag. Ich hatte meine düstere Vorahnung längst verdrängt und mich damit abgefunden, dass mir sechs harte, freudlose Tage bevorstehen. Der Gedanke, sie in welcher Form auch immer zu protokollieren, lag zu diesem Zeitpunkt in weiter Ferne.
Ich bog in die Church Street ein, die zwar nicht die kürzeste Strecke zu meinem Ziel darstellte, mir aber einen kleinen Umweg zur New Road, vorbei am Theatre Royal mit seiner vertrauten historischen Fassade gestattete. Auf dessen alten Brettern soll ich nun mein viertes Engagement erfüllen, und nur zu gerne würde ich die kommenden acht Aufführungen von Das Mietverhältnis gegen jeden x-beliebigen meiner früheren Auftritte tauschen.
Ich blieb vor dem Plakat stehen und musterte es eingehend. Ich wollte wissen, ob ich in den drei Monaten, seit dieses Foto von mir aufgenommen worden war, sichtbar gealtert bin. Das war allerdings schwer zu beurteilen, nicht zuletzt deshalb, weil ich mich in letzter Zeit nie lange im Spiegel betrachtet habe. Doch das Plakat zeigte eindeutig mich. Und zum Beweis stand mein Name darunter, zusammen mit denen der anderen. Leo S. Gauntlett präsentiert DAS MIETVERHÄLTNIS von JOE ORTON. Besetzung: Toby Flood, Jocasta Haysman, Martin Donahue, Elsa Houghton und Frederick Durrance. Abendvorstellungen Montag, der 2., bis Samstag, der 7. Dezember: 19 Uhr 45. Matineen: Donnerstag und Samstag 14 Uhr 30. Ein Teil meiner selbst wünschte sich nichts sehnlicher, als ABGESAGT quer über dem Plakat prangen zu sehen. Aber das stand nicht da, und es wird auch nicht dort auftauchen. Unser Stück wird gespielt. Ich muss da durch. Bis zum Wochenende.
Ich hielt mich nicht lange auf. Vorbei am Royal Pavilion ging ich weiter, erst die Old Steine entlang, dann weiter zur St. James's Street in Richtung Osten. Das Sea Air Hotel in der Madeira Place, einer von mehreren Brightoner Straßen, in denen sich bis zur Marine Parade hinunter ein Gästehaus an das andere reiht, ist weder die eleganteste noch die billigste Pension, aber eine schauspielerfreundlichere Wirtin als Eunice lässt sich kaum denken, zumal sie bereit ist, das Haus mir zuliebe später als geplant für den Winter zu schließen. Weil es mit unserer Tournee immer rasanter bergab geht und die Aussichten für die unmittelbare Zukunft trüb sind, spare ich schon mal an der Unterkunft. Wenn kein Ruhm zu ernten ist, soll wenigstens noch ein bisschen von dem Lohn für meine Mühen übrig bleiben. Aber wahrscheinlich hätte ich mich auch so für Eunice entschieden, bietet das Sea Air doch neben dem Preis eine ganze Reihe entscheidender Vorteile. Der im Augenblick wichtigste ist der Umstand, dass dort außer mir keiner von den anderen absteigen wird. Darauf hat mir Eunice ihr Wort gegeben. »Eine Reisegruppe würde mich total überfordern, Toby. Das ständige Kommen und Gehen. Und pausenlos läuft Badewasser. Mit dir allein bin ich vollauf zufrieden.«
Bisher bin ich immer nur außerhalb der Saison hier gewesen und habe das Speisezimmer mit den Geistern der Sommerurlauber geteilt. Dank Eunices gelassenem Naturell und ihrer Abneigung gegen Lärm jeder Art geht es in ihrem Haus stets friedlich zu. Selbst Binky, ihre Katze, hat gelernt, nicht allzu laut zu schnurren.
Komplett mit Hochzeits- und Verlobungsringen ist Eunice eigentlich Mrs. Rowlandson, aber Mr. Rowlandson ist ein Thema, das nie angeschnitten wird. Dass er einmal existiert hat, darf vermutet werden, über sein Schicksal ist jedoch nichts bekannt. Mit einiger Berechtigung ließe sich feststellen, dass Eunice ihre Ringe selbst dann nicht abstreifen könnte, wenn sie wollte. Sie ist keine dünne Frau. Und momentan noch weniger dünn als je zuvor.
Aus Eunices im Souterrain gelegenen Privatwohnung wehte der Geruch von frisch Gebackenem herauf, als sie mich durch den mit Wollfasertapete geschmückten Flur und weiter die mit Axminster-Teppich ausgelegte Treppe hinauf in den ersten Stock zum besten Gästezimmer bugsierte. Mein Stammzimmer, wenn man so will. Seine Einrichtung erinnert an ein Jugendstilmuseum, und das Erkerfenster bietet einen Blick auf seinen armseligen Zwilling gegenüber.
Eunice sah mir von der Tür aus zu, wie ich meine Reisetasche abstellte und so das lautlose Willkommen des Zimmers erwiderte. »Möchtest du Tee?«
»Das wäre toll«, antwortete ich.
»Und Kuchen dazu? Du siehst aus, als müsstest du dringend zu Kräften kommen.«
Damit hatte sie Recht. »Kuchen wäre auch großartig. Ach, hast du vielleicht noch den Argus von gestern, Eunice?«
»Griffbereit sogar. Aber du wirst nicht viel finden, das dich interessieren könnte.«
»Mir geht es ja nur um das Kinoprogramm. Irgendein guter Film wird heute Abend schon für mich laufen.«
»Hm.« Sie machte ein zweifelndes Gesicht.
»Stimmt was nicht?«
»An deiner Stelle würde ich mir nichts vornehmen.«
»Warum nicht?«
»Heute hat jemand angerufen und wollte dich sprechen.«
Das verwirrte mich. Diejenigen, die wissen, wo ich abgestiegen bin, hätten doch bestimmt meine Handynummer gewählt. »Wer?«, fragte ich.
»Deine Frau.«
»Meine Frau?«
Das wurde ja immer rätselhafter. Technisch gesehen sind Jenny und ich tatsächlich noch verheiratet, aber nur deshalb, weil unsere Scheidung erst in einem Monat amtlich wird, sofern einer von uns dies beim Gericht beantragt. Da der Landsitz – danach klingt »Wickhurst Manor« nun mal in meinen Ohren – von Jennys Zukünftigem nur wenige Meilen nördlich von Brighton liegt, habe ich mich während der Zugfahrt mehrmals bei dem Gedanken ertappt, ob Jenny vielleicht eine unserer Vorstellungen besuchen wird, mir dann aber gesagt, dass sie wohl Distanz wahren wird. Bestimmt wird sie meine Anwesenheit in Brighton aus ihrem Bewusstsein verdrängen, habe ich mir gedacht. Anscheinend ist das nun doch nicht der Fall.
»Jenny hat hier angerufen?«
»Ja.« Eunice nickte. »Sie will dich sehen, Toby«
Es ist Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. Es ist Zeit zu erklären, was ich seit langem weiß. Ich liebe meine Frau. Meine baldige Ex, heißt das. Ich habe sie immer geliebt. Nur habe ich das nicht immer richtig anerkannt oder mich entsprechend verhalten. Die Ehen von Schauspielern sind – wie wohl auch die Mimen selbst – berüchtigt für ihre Unbeständigkeit. Wir vergessen bisweilen, wo die Rolle aufhört und das eigene Ich anfängt. Wenn uns keine Rolle vorgegeben ist, erschaffen wir manchmal eine. Weil wir es gewohnt sind, zu interpretieren und nicht neu zu gestalten, ist es eine Figur aus dem gängigen Bestand: zum Beispiel der Frauenheld, der viel trinkt, schnell fährt und ewig einem Rausch, egal welcher Art, nachjagt. Es ist leichter, auch im echten Leben eine Maske zu tragen, weil man sich vor dem fürchtet, was darunter zum Vorschein kommen könnte.
Darin liegt nur eines der Probleme zwischen Jenny und mir. Die Ironie des Schicksals hat es gewollt, dass dieses Problem zu denjenigen gehört, die sich im Laufe der letzten Jahre von selbst erledigt, um nicht zu sagen, erübrigt haben. Inzwischen kenne ich mich vielleicht sogar zu gut. Aber meine Selbstfindung ist etwas zu spät gekommen. Man sollte eben mit der Selbstfindung nicht warten, bis man kurz vor der Vollendung eines halben Jahrhunderts steht. Na gut, besser spät als nie, denke ich, auch wenn manche das vielleicht anders sehen.
Wir hätten es noch schaffen können, denke ich – trotz aller Seitensprünge und Streitereien, trotz der verlorenen Wochenenden und gebrochenen Versprechen –, wäre nicht etwas geschehen, womit keiner von uns rechnen konnte: einen Sohn zu bekommen – und ihn zu verlieren. So. Jetzt habe ich auch das verraten. Er hieß Peter. Er lebte viereinhalb Jahre lang. Dann war er tot. Ertrunken in einem übergroßen Swimmingpool, passend zu einem übergroßen Haus, das zu dem Lebensstil gehörte, den wir glaubten, pflegen zu müssen.
Wir gaben uns gegenseitig die Schuld. Völlig zu Recht. Aber wir hätten die Schuld teilen und nicht darum streiten sollen. Man kann die Vergangenheit nicht ändern. Vielleicht kann man die Zukunft genauso wenig ändern. Aber die Gegenwart kaputtmachen, das kann man. Oh ja. Die kann man gründlich zugrunde richten.
Als Jenny mich verließ, sagte ich mir, so sei es am besten. Plattitüden wie »Höchste Zeit, die Vergangenheit hinter uns zu lassen« kamen regelmäßig über meine Lippen. Möglicherweise habe ich sogar daran geglaubt. Eine Zeit lang zumindest.
Jetzt aber nicht mehr. Ich hätte sie nicht gehen lassen dürfen. Ich hätte mich anders verhalten sollen. Völlig anders. Im Nachhinein weiß man alles besser. Da sieht man die Wahrheit.
Und die traurige Wahrheit ist, dass ich nichts tun kann, um den Schaden, den ich angerichtet habe, wieder gutzumachen. Es gibt kein Zurück. So habe ich es jedenfalls immer gesehen. Bis heute Abend.
Jenny hatte Eunice eine Handynummer gegeben. Als ich anrief, ging sie sofort dran. Statt eines Grußes brachte ich nur »Ich bin's« hervor.
»Es hat dich bestimmt überrascht, von mir zu hören«, erwiderte sie nach einer langen Pause.
»Das kann man wohl sagen.«
»Können wir uns treffen?«
»Wann habe ich je Einwände gegen einen solchen Vorschlag gehabt?«
Ich hörte sie seufzen. »Können wir?«
»Ja. Natürlich.«
»Heute Abend?«
»Von mir aus.«
»Du hast Zeit?«
»Was glaubst du?«
Ein neuerlicher Seufzer. »Geht das schon wieder los! Es hat keinen Sinn, wenn du ...«
»Ich werde mich ganz nach dir richten, Jenny. Okay?« Ich hätte sie fragen können – oder vielleicht sollen –, warum sie mich treffen wollte. Aber dazu hatte ich nicht den Mut. »Wo und wann?«
Um sechs Uhr war der Palace Pier so ruhig wie normalerweise nie. Die meisten Bars und Buden waren geschlossen. Eine der wenigen Ausnahmen war der Palace of Fun, wo jeder willkommen war, der entschlossen war, Geld in dessen einarmige Banditen zu stecken. Das Meer leckte träge am Strand, auf einer Bank kuschelten sich zwei Verliebte aneinander, die sich eine Tüte Pommes frites teilten und einander Worte zuflüsterten, die sich anhörten wie Ungarisch. Mich wunderte, dass Jenny mich ausgerechnet hier treffen wollte, war das doch so ziemlich in allem das glatte Gegenteil von ihrer natürlichen Umgebung.
Dann, als ich das andere Ende des Piers erreichte, von wo aus die Jahrmarktbuden und Karussells aussahen wie eingehüllt in einen winterlichen Umhang, streifte mich ein anderer Gedanke. Konnte es sein, dass Jenny diesen Ort nur deshalb gewählt hatte, weil es hier kaum Zeugen gab, vor allem keine, die sie womöglich erkannt hätten? Sie wollte nicht zusammen mit mir gesehen werden. Darum ging es ihr. Der Pier war ein Ort, wo sie unbesorgt ein streng vertrauliches Gespräch führen konnte.
Schließlich entdeckte ich sie auf der anderen Seite. Sie lehnte an dem Geländer und schaute mit leerem Blick zum Strand hinunter. Bekleidet war sie mit einem langen dunklen Mantel und schwarzen Stiefeln. Ihr Gesicht war zur Hälfte von einem mit Pelz besetzten, breitkrempigen Hut verdeckt. Hätte ich sie nicht gesucht, wäre sie mir vielleicht gar nicht aufgefallen. Allerdings hätte vermutlich sie mich bemerkt.
»Toller Abend für einen Spaziergang.« Eine dümmere Begrüßung hätte mir kaum einfallen können. »Wollen wir nachher irgendwo grillen?«
»Hallo, Toby.« Sie drehte sich um und sah mich an. Um ihre Lippen zuckte die Andeutung eines Lächelns. »Danke, dass du gekommen bist.«
»Du siehst gut aus.« (Das war stark untertrieben. Die Trennung von mir ist ihr offensichtlich gut bekommen. Entweder das, oder sie hat in Brighton eine gute Schönheitsberaterin gefunden. Ich möchte lieber Letzteres glauben.)
»Wollen wir uns setzen?«, fragte sie.
»Wenn wir eine Sitzgelegenheit finden.« Das entlockte ihr nicht einmal die Andeutung eines Lächelns.
Die nächste überdachte Bank war von Regentropfen bedeckt, die im Laternenlicht schimmerten. Während ich das Wasser, so gut ich konnte, wegwischte, wehten von der gegenüberliegenden Seite ein paar Wortfetzen herüber, ungarisch, wie ich glaubte. Wir ließen uns nieder.
»Die Frittenbude hat offen.« Ich deutete auf den Kiosk, an dem ich vorbeigekommen war. »Hast du Lust, dir eine Kleinigkeit mit mir zu teilen?«
»Nein, danke.«
»Wann, meinst du, war das letzte Mal, dass wir zusammen eine Tüte Pommes frites auf einer zugigen Mole gegessen haben?«
»Haben wir das je getan?«
Das ließ sich nicht gut an. Jenny schien sich nicht im Entferntesten über das Wiedersehen zu freuen.
»Wie läuft das Stück?«, fragte sie unvermittelt.
»Willst du das wirklich wissen?«
»Ich habe das über Jimmy Maidment gelesen.«
Nun, das war keine Überraschung. Der mutmaßliche Selbstmord eines gefeierten Komödiendarstellers ist Unmengen von Schlagzeilen wert, auch wenn sein Ruhm längst verblasst ist. Die Tatsache, dass Jimmy sich einen Tag vor der Premiere von Das Mietverhältnis vor eine U-Bahn geworfen hat, ließe sich durchaus als Fingerzeig werten, mit dem er der übrigen Besetzung in der für ihn typischen eindeutigen Art seine Zweifel daran signalisieren wollte, dass das Stück seine oder irgendeine andere Karriere wiederbeleben könnte. Oder aber er war einfach nur betrunken und ist gestolpert. Der Coroner wird beizeiten seinen Kommentar dazu abgeben. Wie auch immer, ein gutes Omen ist das nicht für uns. Ich vermisse Jimmy. Und dem Stück fehlt er nicht minder.
»Das muss ein entsetzlicher Schock gewesen sein«, meinte Jenny. »Hatte er Depressionen?«
»Permanent, denke ich.«
»Die Kritiker glauben anscheinend ...«
»... dass wir ohne ihn aufgeschmissen sind, ich weiß. Und das stimmt ja auch. Fred Durrance kann Jimmy nicht das Wasser reichen. Und das ist nicht das einzige Problem. Aber du hast dich bestimmt nicht mit mir treffen wollen, um zu analysieren, was wo schief gelaufen ist, und ...«
»Es tut mir Leid ...« Ihr Ton war weicher geworden.
Kurzes Schweigen trat ein. Unter dem Pier rauschte beruhigend das Meer. »Mir auch«, murmelte ich.
»Kommt das Stück auch nach London?«, fragte sie
»Keine Chance.«
»Dann ist nach dieser Woche Schluss?«
»Anscheinend.«
»Das tut mir wirklich sehr Leid für euch.«
»So sehr, dass du mich wieder nimmst?« Ich lächelte sie im Laternenlicht matt an. »War nur ein Scherz.«
»Ich bin mit Roger vollkommen glücklich«, erklärte sie. Offenbar nahm sie an, dass ich genau das bezweifelte – und sie hatte Recht. »Wir haben auch schon den Termin für unsere Hochzeit.«
»Zu dumm, dass ich meinen Terminkalender im Sea Air gelassen habe.«
Jenny stieß einen Seufzer aus. Ich strapazierte ihre Geduld, eine Kunst, die ich schon seit langem unbeabsichtigt vervollkommnet hatte. »Lass uns gehen«, sagte sie und erhob sich. Einen Moment später lief sie mit klappernden Absätzen über die Holzplanken und auf den Strand zu.
Ich folgte ihr. »Wohin gehen wir?«
»Nirgendwohin. Wir laufen einfach.«
»Hör zu, Jenny ... Ich will bloß sagen: Ich bin froh, dass du glücklich bist. So komisch es klingen mag, aber ich habe immer gehofft, dass du das wieder sein kannst. Wenn ich irgendwas für dich tun kann ...«
»Das kannst du.« Ihr Ton war fest, aber alles andere als feindselig. In diesem Moment begriff ich, warum sie so angespannt war. Sie war gekommen, um mich um einen Gefallen zu bitten. Wie immer man es dreht und wendet, das ist eine delikate Situation, denn als sie mich zuletzt um etwas gebeten hat, wollte sie, dass ich aus ihrem Leben verschwand, und zwar für immer. »Würdest du mir einen Gefallen tun, Toby?«
»Gern.«
»Du hast ja noch gar nicht gehört, worum es geht.«
»Du würdest mich nicht darum bitten, wenn es unmöglich wäre.«
Sah ich da ein Lächeln auf ihrem Gesicht? Sicher war ich mir nicht. »Ich habe ein Problem.«
»Sprich weiter.«
Das tat sie erst, als wir den Pier verlassen hatten und westwärts auf die Strandpromenade abgebogen waren, zu unserer Linken den Strand und rechts von uns die mäßig befahrene Straße. Wir müssen eine ganze Minute schweigend nebeneinander hergelaufen sein, ehe sie mit einer Erklärung herausrückte, die sie mit einer verblüffenden Frage einleitete: »Habe ich dir schon mal vom Brimmers erzählt?«
»Nein.« Eine zutreffende Antwort, die zur Abwechslung keinen Widerspruch erregte. Ich spürte, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt war, sie darauf hinzuweisen, dass sie mir schon eine ganze Weile nichts erzählt hatte.
»Das ist ein Hutladen im Lanes-Viertel. Er gehört mir, und es macht mir großen Spaß, ihn zu führen. Er läuft sogar ziemlich gut.«
»Du wolltest ja schon immer ein eigenes Geschäft.«
»Ja. Und jetzt habe ich es.«
»Das ist ja toll.«
»Roger ist auch einverstanden.«
»Schön. In was für einer Branche ist Roger eigentlich tätig?«
»Kapitalanlagen.«
Ich rätselte noch, was das genau heißen sollte, als sie abrupt fortfuhr: »Hör zu, das hier hat nichts mit Roger zu tun. Die Sache ist die ... Vor meinem Laden treibt sich immer so ein merkwürdiger Kerl herum. Gegenüber ist ein Café, und dort sitzt er am Fenster, schlürft unaufhörlich Tee und starrt die ganze Zeit zu meinem Laden herüber. Und wenn ich aufmache oder schließe, steht er oft direkt davor. Ich habe ihn auch schon vor unserem Haus gesehen. Ein Fußweg führt nahe an Wickhurst Manor vorbei. Ich kann dort nicht mehr laufen, ohne ihm zu begegnen.«
»Wer ist das?«
»Das weiß ich nicht.«
»Hast du ihn nicht gefragt?«
»Ich habe ihn mehrmals angesprochen, aber er antwortet einfach nicht. Wenn ich ihn frage: ›Kann ich Ihnen helfen?‹, sagt er nur: ›Nein‹, starrt mich noch aufdringlicher an und schlendert weiter. So allmählich geht er mir auf die Nerven. Ich denke, er ist harmlos, aber er gibt einfach keine Ruhe.«
»Hast du schon mit der Polizei geredet?«
»Wegen was denn? Ein Mann, der regelmäßig ein Café besucht und einen öffentlichen Fußweg benutzt? Die würden denken, ich stelle ihm nach!«
»Stellt er dir denn nach?«
»So kommt es mir vor.«
»Bist du sicher, dass du ihn nicht kennst?«
»Absolut.«
»Was für ein Typ ist er?«
»Schmierig.«
»Du kannst ihn doch sicher besser beschreiben.«
»Also gut. Er ist ... mittelalt, würde ich sagen, aber zugleich wirkt er etwas kindlich. Er hat etwas von einem Schuljungen an sich: so eine Art Streber, der überall der Außenseiter ist. Trägt einen Dufflecoat mit allen möglichen ... Abzeichen daran.«
»Also offenbar doch gefährlich.«
»Wenn du das nicht ernst nimmst ...« Sie warf den Kopf auf eine Art zurück, die ich gut in Erinnerung hatte.
»Was sagt Roger dazu?«
»Ich habe es ihm nicht erzählt.« Es fiel ihr offenbar schwer, das zuzugeben, obwohl ihr klar sein muss, dass sie um ein
Gespräch mit Roger nicht herumkommen wird.
»Wirklich?«
»Ja. Wirklich.«
Jetzt kann ich ja zugeben, dass es mir eine diebische Freude bereitete, dass Jenny vor ihrem reichen und zweifellos gut aussehenden Verlobten ein Geheimnis hatte – und es mit mir teilte. Rätselhaft war die Sache trotzdem, nur lenkte mich meine Genugtuung fürs Erste von Nachfragen ab. Warum hatte sie es Roger nicht erzählt? Nun, die Antwort erfuhr ich umgehend.
»Roger ist geschäftlich viel unterwegs. Ich will nicht, dass er sich um mich sorgt oder meinetwegen daheim bleibt.«
In meinen Ohren klang das ziemlich hohl. Jenny hätte sich eigentlich denken können, dass sie mich nicht mit einer Ausrede abspeisen kann. Dafür kenne ich sie immer noch zu gut. Ich hatte Roger zu diesem Zeitpunkt längst als den beschützenden, um nicht zu sagen Besitz ergreifenden Typ eingeschätzt. In Wahrheit fürchtet Jenny nur um ihre Unabhängigkeit, die sie verlieren könnte, wenn sie den neuen Mann in ihrem Leben bitten würde, sie vor dem eigenartigen Verfolger zu retten. Und ihre Unabhängigkeit schätzt Jenny hoch ein. Sehr hoch.
»Außerdem«, fügte sie hinzu, »was könnte er schon tun?«
Spontan fielen mir mehrere Möglichkeiten ein, aber die ausgefalleneren darunter behielt ich lieber für mich. Abgesehen davon, was konnte ich denn schon tun? So griff ich nur eine heraus: »Er könnte den Typen erkennen.«
»Er kennt ihn nicht.«
»Woher weißt du das?«
»Wir waren mal zusammen, als der Kerl – ich nenne ihn übrigens Schleimer – an uns vorbeigegangen ist. Das war auf dem Fußweg, den ich vorhin erwähnt habe. Ich habe Roger gefragt, ob er ihn kennt, und er hat Nein gesagt. Eindeutig Nein.«
»Aber du hast ihm nicht den Hintergrund deiner Frage er
klärt.«
»Natürlich nicht. Außerdem ...«
»Außerdem was?«
»Ich kann mir denken, aus welchem Grund der Schleimer auf mich gekommen ist. Und der hat nichts mit Roger zu tun.«
»Was ist es also?«
»Du meinst: Wer.«
»Also gut, wer?«
»Du, Toby.«
»Was?«
Wir blieben beide abrupt stehen und sahen einander unverwandt an. Weil Jennys Miene zum Teil im Schatten der Hutkrempe lag, konnte ich nicht viel erkennen. Sie dagegen, nehme ich an, konnte in der meinen lesen wie in einem Buch. Und was sie las, war bestimmt ungläubiges Staunen.
»Ich?«
»Richtig.«
»Aber das kann doch nicht sein. Ich meine ... das ergibt doch keinen Sinn.«
»Trotzdem ...«
»Wie kannst du dir da so sicher sein?«
»Ich bin es einfach.«
»Na gut«, lenkte ich ein. »Wie bist du darauf gekommen?«
Jenny spähte über die Schulter. Bevor ich etwas gemerkt hatte, war ihr eine Gruppe Halbwüchsiger aufgefallen, die sich uns näherten. Sie fasste mich am Arm und bugsierte mich zum Rand der Promenade. Ihre Vorsichtsmaßnahme erwies sich als unnötig, weil die Jugendlichen plötzlich über die Straße zum Odeon Cinema jagten. Dennoch senkte sie die Stimme. »Sophie, meine Verkäuferin im Brimmers, geht oft in das Café, in dem der Schleimer herumsitzt. Ihr ist er auch schon aufgefallen. Letzte Woche hat sie ein Video auf seinem Tisch liegen sehen, das er am selben Tag gekauft haben muss. Er hatte es aus der Tasche genommen, um einen Blick darauf zu werfen. Rat mal, was es war.«
Ich überlegte einen Moment lang, während meine Augen unwillkürlich über den von einem Feuer zerstörten West Pier wanderten, ein schwarzer Stummel unter dem blauschwarzen Himmel. »Asche und Tod«, murmelte ich.
»Woher weißt du das?«
Jennys Erstaunen klang echt. Nun, Asche und Tod war vor gut elf Jahren der letzte meiner allzu wenigen Hollywood-Filme, der nach vernichtenden Kritiken kaum Leute in die Kinosäle lockte. Es ist ein Möchtegern-Thriller nach der Art von Hitchcock, in dem ich einen englischen Privatdetektiv spiele, der eine aufregend schöne Auftragsmörderin verfolgt, und ein wirklich erbärmliches Machwerk. Der andere Star darin, Nina Bronsky, ist danach trotzdem groß rausgekommen, was laut Moira der Grund ist, warum jetzt plötzlich auch einige ihrer früheren Filme in den Videoläden landen. Vielleicht wird in achtzehn Monaten ein Scheck mit einer Tantiemennachzahlung meinen Groll besänftigen. Vielleicht aber auch nicht.
»Es gibt ja nicht allzu viele Videos, mit denen mein Name verbunden ist«, brummte ich mit einem schiefen Grinsen. »Da bleibt kaum was übrig außer Asche und Tod. Aber das muss nicht unbedingt was bedeuten. Vielleicht ist der Schleimer ein Fan von Nina Bronsky. So wie du ihn schilderst, dürfte er eher auf sie stehen.«
»Sei doch ernst, Toby. Bitte. Dieser Mann macht mir Angst.«
»Na ja, wenn er ein Fan von mir ist« – ich zuckte mit den Schultern –, »dann bin ich wohl in gewisser Hinsicht für ihn verantwortlich.«
»Lieber Himmel, ich mache dir doch keinen Vorwurf! Ich will nur meine Ruhe vor diesem Spinner haben.«
»Wie kann ich das für dich bewerkstelligen?«
»Geh morgen früh in das Café. Halte die Augen offen. Du wirst ja sehen, ob du ihn erkennst. Oder ob er dich erkennt.«
»Ich habe mich in den letzten elf Jahren nicht großartig verändert. Also sollte er mich eigentlich erkennen.«
»Dann sprich ihn an. Bring in Erfahrung, wer er ist, was er will. Tu dein Bestes, um ...«
»Um ihn zu vertreiben?«
»Ich will nur, dass er mich in Frieden lässt, Toby.«
»Und außerdem soll er mir verraten, warum er hinter dir her ist. Falls er hinter dir her ist.«
»Es hat mit dir zu tun. Anders kann es nicht sein. Das Video ist der Beweis. Er hat herausgefunden, dass wir mal verheiratet waren, und ...«
»Das sind wir übrigens immer noch. Verheiratet, meine ich.«
Jenny verdrehte stumm die Augen und schaute aufs Meer hinaus. Nach einer Pause sagte sie: »Bist du dazu bereit?«
»Natürlich.« Ich lächelte. »Für dich immer, Jenny.«
Ich meinte es wirklich so. Und das ist auch jetzt noch der Fall. Aber hinter meiner Hilfsbereitschaft steckt mehr, und ich vermute, dass Jenny das erkannt hat. Das Video allein beweist überhaupt nichts. Wenn sich unser Freund im Dufflecoat für mich interessiert, könnte er genauso gut auch hinter Roger her sein. Jenny will aber angeblich Roger nicht beunruhigen. Vielleicht traut sie Roger einfach nicht ganz. Vielleicht will sie zu ihren eigenen Bedingungen herausfinden, was hier gespielt wird – wenn es tatsächlich um mehr geht als um die Alltagsgewohnheiten eines Hutfetischisten. Und vielleicht verlässt sie sich einfach darauf, dass ich die Wahrheit ausgrabe, weil ich sie immer noch liebe und die Hoffnung nicht aufgegeben habe, dass ich sie dazu bringen kann, ihre Liebe zu mir neu zu entdecken. Sie treibt ein gefährliches Spiel, meine ehemalige und zukünftige Jenny.
»Um welche Uhrzeit soll ich dort sein?«, fragte ich.
»Er wird bis zehn Uhr kommen. Unweigerlich.«
»Dann gehe ich wohl besser früh ins Bett.«
»Komm nicht in den Laden. Er soll nicht glauben, dass ich dich geschickt habe.«
»Ich werde mein Bestes geben. Improvisieren war schon immer meine Stärke.«
»Danke, Toby.« Ihrer Stimme war echte Erleichterung und vielleicht auch Zärtlichkeit anzuhören. Allerdings muss ich zugeben, dass ich mir da vielleicht etwas eingeredet habe. »Ich bin dir dankbarer, als ich sagen kann.«
»Soll ich dich anrufen ... danach?«
»Ja, bitte.«
»Aber dir wäre es lieber, ich würde nicht vorbeikommen?«
»Es ist nicht so, dass ich ...«
»Vielleicht wäre Roger nicht so begeistert ... Wenn es ihm zu Ohren käme.«
»Das hat nichts mit Roger zu tun.« Jenny wischte sich unter der Hutkrempe eine Strähne aus der Stirn. Dabei ließ sie sich reichlich Zeit, um so meinem Blick länger ausweichen zu können. »Zufälligerweise«, fuhr sie fort, »ist Roger gegenwärtig auf Geschäftsreise.«
»Ach ja?«
»Ja«, erwiderte sie kühl.
»Dann ist das also etwas zwischen dir und mir allein.«
»Ich möchte auch, dass das so bleibt.«
»Ich verstehe.« Es war mir tatsächlich klar, und das ist es auch jetzt noch. Wir haben eine stillschweigende Vereinbarung, bei der es darauf ankommt, dass sie auch weiterhin unausgesprochen bleibt. Wirklich ehrlich ist dabei keiner von uns.
»Ich gehe jetzt besser«, erklärte Jenny mit einer plötzlichen abschließenden Kopfbewegung. »Ich treffe mich mit Freunden zum Dinner.«
Jenny hat es schon immer verstanden, Freunde zu finden. Wie gut sie das kann, habe ich erst begriffen, als sie mich verließ und die meisten mitnahm.
»Gute Nacht, Toby.«
Ich sah ihr nach, wie sie die Straße überquerte und am Kino vorbei die West Street hinunterging. Dann setzte auch ich mich in Bewegung und schlenderte die Promenade entlang zum Palace Pier und weiter in Richtung Sea Air Hotel.
Als ich zurückkam, meinte Eunice, ich würde besser aussehen als am Nachmittag. Aber bei ihrem Hang zur Romantik hätte sie das wahrscheinlich ohnehin gesagt, egal, ob es stimmt oder nicht. Sie hat eine Art Vision à la Burton und Taylor für Jenny und mich. Doch ein Blick in den Spiegel bestätigte, dass sie tatsächlich Recht hatte. Ich erkannte etwas, das ich in den langen Wochen unserer Tournee nicht ein Mal an mir bemerkt habe: ein unscheinbares optimistisches Funkeln in den Augen.
Nachdem ich Eunices Steak and Kidney Pie bewältigt hatte, waren dringend ein paar Schritte angesagt. Und weil Erkundungsgänge, wie mein alter Herr immer gern sagte, selten verlorene Zeit sind, marschierte ich rüber nach Lanes und streifte dort so lange herum, bis ich nach mehreren Fehlschlägen das Brimmers fand.
Dass Jenny einen guten Geschmack hat, lässt sich schon an der flotten Auslage und den bunten Streifenmustern im Schaufenster erkennen. Vom Inneren des Ladens bekam ich allerdings nicht viel zu sehen, und wenn ich Jennys Anweisungen gehorche, wird es auch nie so weit kommen. Aber wer weiß das schon? Ich nicht. Ich hoffe ja nur.
Das Café – es heißt Rendezvous – war wie zu erwarten ebenfalls geschlossen. Das Schild verspricht aber Frühstück mit Kaffee, leichte Mittagsmenüs und Nachmittagstee. Im hinteren Teil gibt es eine Theke, in der Mitte Tische und Stühle und vorn beim Fenster einen breiten Sims mit Barhockern davor, auf denen die Gäste es sich bequem machen und der Welt von Lanes beim Vorüberschlendern zusehen können, während sie selbst am Getränk ihrer Wahl nippen. Von dort aus kann man natürlich auch das Brimmers mühelos ausspähen, ohne dabei selbst beobachtet zu werden, was bei meinem angeblichen Fan vielleicht tatsächlich das Ziel der Übung sein könnte, aber nicht notwendigerweise sein muss. Wir werden ja sehen. Morgen, wie versprochen.
Nach erfolgter Erkundung schlenderte ich in eines von den Pubs, in denen ich während meiner Auftritte in Brighton zwangsläufig irgendwann lande, das Cricketers in der Black Lion Street – angeblich Graham Greenes Lieblingskneipe –, und kippte in nachdenklicher Stimmung ein Bier hinunter. Der Sonntag in Brighton hatte schon jetzt meine Erwartungen übertroffen, was zugegebenermaßen nicht schwer war. Aber da ahnte ich nicht, dass er noch eine Überraschung für mich bereithielt.
Ich saß an einem Ecktisch, den man von der Tür aus nicht sehen konnte, und beobachtete träge, wie ein verheirateter Mann und eine Frau, die eindeutig nicht seine Gattin war, sich langsam betranken. So ein Sonntagabend kann mehr als nur ein bisschen Tristesse erzeugen. Nachdem das gegenwärtig mein einziger freier Abend in der Woche ist, weiß ich, wovon ich spreche. Heute fühlte ich mich allerdings prächtig.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum es mir nicht die Stimmung verhagelte, als sich mir ein Mann von der Theke her näherte und sich mit der Frage »Was dagegen, wenn ich mich zu Ihnen setze?« auf den Stuhl neben mir plumpsen ließ.
Auf den ersten Blick kam er mir vor wie eine von diesen Kneipenexistenzen, die einen mit ihrem endlosen Gerede langweilen. Klein und dick, feuchte blaue Augen, rot geäderte Nasenflügel und Wangen, dünnes graues Haar, das früher braun gewesen war, und eine Zunge, die zu groß für den Mund zu sein schien. Bekleidet war er mit einem Sakko, das sich über seinem Bauch bestimmt nicht mehr zuknöpfen ließ, einem vergilbten weißen Hemd und einer befleckten Flanellhose. Mit einer Hand hielt er ein Rotweinglas, in der anderen hatte er eines unserer Flugblätter für Das Mietverhältnis.
»Wenn Sie nicht Toby Flood sind, bin ich ein Holländer«, erklärte er.
»Sie sind kein Holländer.«
»Darf ich Ihnen einen Drink besorgen?«
»Danke, aber im Moment bin ich wunschlos glücklich.«
»Ich bin ehrlich gesagt erleichtert, Sie hier zu sehen.«
»Erleichtert?«
»Ich habe eine Karte für Dienstagabend.« Er hielt das Flugblatt hoch. »Darum tut es gut, zu wissen, dass Sie es bis hierher geschafft haben. Syd Porteous. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Er streckte mir seine Wurstfinger entgegen, sodass mir nicht viel anderes übrig blieb, als ihm die Hand zu schütteln.
Ich versuchte, einen lockeren Konversationston anzuschlagen. »Gehen Sie regelmäßig ins Theater, Syd?«
»Nein, nein. Zumindest früher nicht. Aber jetzt versuche ich ... meinen Horizont zu erweitern, seit ich ... mehr Zeit zur Verfügung habe.«
»Sie sind in Rente?«
»Das nicht unbedingt. Eher ... freigestellt. In dieser Stadt – na ja, heute heißt es wohl City – muss man von der Hand in den Mund leben. Die Stadträte sind fein raus, aber nach uns normalen Bürgern, auf deren Kosten sie sich ihre Spesen genehmigen, kräht kein Hahn. Wie auch immer, ich kann nicht behaupten, dass ich dieses Jahr öfter im Theater war als die Nutten. Hey, aber vielleicht nächstes Jahr? Bald kommt ja Silvester mit den vielen guten Vorsätzen. Ich habe sowieso oft genug ein neues Leben angefangen, und deshalb ...«
So wie er loslegte, beschlich mich der Verdacht, dass er mir mit seinem Monolog bis zur Sperrstunde die Ohren verstopfen würde. Gerade wollte ich mir einen Vorwand zurechtlegen, um mich unbeschadet verabschieden zu können, als ich merkte, dass es in der Welt seiner wild durcheinander wirbelnden Gedanken einen winzigen ruhenden Pol gab, und der schien ich zu sein.
»Besteht die Möglichkeit, dass mal neue Folgen von Was nun? gedreht werden, Toby?«, fragte Syd unvermittelt. »Ich klebte damals richtig am Fernseher.«
So traurig es ist, aber damit gehörte Syd einer winzigen Minderheit an. Die Fernsehserie von 1987 mit mir als zwanghaftem Spieler, der sich nebenbei als Amateurdetektiv versucht (oder war es umgekehrt?), hat ungefähr so gute Aussichten auf eine Wiederbelebung wie das Britische Imperium. »Keine Chance, leider.«
»In letzter Zeit hat man Sie kaum noch in der Glotze gesehen.«
»Ich konzentriere mich auf das Theater. Auftritte vor Publikum sind eine größere Herausforderung.«
»Hm, ja, da ist wohl was dran. Ihre Fans bekommen Sie als Mensch aus Fleisch und Blut zu sehen.«
»Genau.«
»Dieses Stück bringt Ihnen bestimmt viel Publicity ein. Ich freue mich schon darauf.«
»Schön.«
»Ich kannte ihn übrigens.«
»Wen?«
»Orton.«
Obwohl ich hätte gewarnt sein sollen, war meine Neugierde auf einmal geweckt. »Wirklich?«
»Oh ja.« Syd senkte melodramatisch die Stimme. »Hier. In Brighton. Nur wenige Wochen vor seinem Tod. Im Sommer '67.«
Ich bin mit den Tagebuchaufzeichnungen Ortons von Dezember 1966 bis zu seinem Tod im August 1967 so gut vertraut, dass ich Syd zumindest ein oberflächliches Wissen nicht absprechen kann. Orton und Halliwell kamen Ende Juli 1967 nach Brighton, wo sie ein verlängertes Wochenende bei Oscar Lewenstein, dem Koproduzenten von Beute, verbrachten. Bei diesem Besuch langweilte sich Orton schier zu Tode. Allerdings kann ich mich an keine Stelle in seinen Tagebüchern erinnern, in der eine jüngere Version von Sydney Porteous aufgetaucht wäre. »Wie haben Sie ihn denn kennen gelernt?«, fragte ich in beiläufigem Ton. Angesichts von Ortons sexuellen Gewohnheiten fiel mir spontan eine öffentliche Toilette ein, aber Syds Antwort brachte mich etwas aus dem Konzept.
»Bin ihm in genau dieser Kneipe über den Weg gelaufen. An einem Sonntagabend, wie heute. Wir haben über nichts Besonderes geplaudert. Er hat mir nicht gesagt, wer er war, aber mit seinem Namen hätte ich sowieso nichts anfangen können. Ich war ein völlig unbeleckter Grünschnabel. Habe dann aber etwa zwei Wochen danach sein Gesicht in der Zeitung wieder erkannt. Irgendwie war das ein ganz schöner Schock. Rückblickend denke ich, dass er mich abschleppen wollte. Unheimlich, finden Sie nicht?«
»Was ist daran unheimlich?«
»Na ja, erst er und jetzt Sie, an einem Sonntagabend im Cricketers. Wie würden Sie das denn nennen?«
»Ich würde es Zufall nennen.« (Wenn es denn wirklich einer war, woran ich meine Zweifel hatte.) »Puren Zufall.«
»Trotzdem würde ich zur Vorsicht raten. Ich selbst bin nicht abergläubisch, aber ihr Schauspieler sollt ja viel auf Omen geben. Der verwunschene Macbeth, der Superman-Fluch – diese Art von Quatsch eben.«
»Ich werde versuchen, mich nicht davon beunruhigen zu lassen.«
»Hören Sie, ich bin ein Brightoner Urgewächs. Meine Mutter hatte in Brighton Rock eine kleine Rolle. Und ich selbst bin in Oh, What a Lovely War! in einer Massenszene zu sehen. Darum halte ich mich fast für ein Ehrenmitglied der Schauspielerzunft. Wenn ich also während Ihres Aufenthalts hier was für Sie tun kann, egal, was, brauchen Sie es mir nur zu sagen. Das ist meine Handynummer.« Er kritzelte eine Zahlenfolge auf einen Bierdeckel und drückte ihn mir in die Hand. »Es gibt nicht viel, was ich hier nicht in die Finger kriegen oder herausfinden kann. Sie wissen, was ich meine?« Er zwinkerte mir zu.
Ich war mir nicht sicher, ob ich das wirklich wissen wollte. So bedachte ich ihn mit einem matten Lächeln und steckte den Bierdeckel ein. »Ich werde womöglich auf Ihr Angebot zurückkommen.«
»Tun Sie das, Toby«, meinte er mit einem übertriebenen, neuerlichen Zwinkern. »Ich will mir lieber nicht ausmalen, in was für Schwierigkeiten Sie geraten könnten, nur weil Ihnen niemand mit Rat und Tat zur Seite stand.«
Syd abzuschütteln war nicht einfach. Er wollte unbedingt irgendwo anders »einen heben«. Ich musste meinen ganzen Charme aufbieten, um ihn nicht zu kränken. Andererseits glaube ich nicht, dass er schnell verletzt ist. Das könnte er sich bei seiner Wesensart gar nicht leisten.
Ich bin wieder im Sea Air und habe die Gelegenheit, Ortons Tagebucheinträge für Ende Juli 1967 nachzulesen. Die werfen jedoch mehr Fragen auf, als sie beantworten. Orton und Halliwell trafen am Donnerstag, den 27. Juli, in Brighton ein, wo sie vier frustrierende Tage in für Orton viel zu beengenden Verhältnissen in Lewensteins Haus in Shoreham verbrachten. Am 31. Juli reiste er dann wieder ab. Das einzige Mal, dass Orton für sich sein konnte, war erstaunlicherweise der Sonntagabend. Ursprünglich wollte er zusammen mit Halliwell und den Lewensteins den neuen James-Bond-Film Man lebt nur zweimal im Odeon anschauen, aber der war schon ausverkauft. Die anderen gingen dann in Derek Flint: Hart wie Feuerstein, während Orton es vorzog, allein loszuziehen und irgendjemanden für ein lockeres Abenteuer aufzureißen. Anscheinend gelang es ihm schließlich, sich in einer öffentlichen Bedürfnisanstalt einen blasen zu lassen. (Offenbar fasste Orton das Wort »Bedürfnisanstalt« in einem sehr weiten Sinne auf.) Danach trank er am Bahnhof einen Tee und ging zu Fuß nach Shoreham zurück.
Vom Cricketers ist nicht die Rede, genauso wenig von einem Grünschnabel, der der junge Sydney Porteous hätte sein können. Seinem Tagebuch und auch den Aufzeichnungen anderer Leute zufolge hielt sich Orton nicht viel in Kneipen auf. Syds Erzählung klingt darum unglaubwürdig. Und ich schließe daraus, dass der gute Mann mir einen Bären aufgebunden hat.
Oder doch nicht? Ein Orton-Kenner ist er mit Sicherheit nicht, aber wie hat er es dann geschafft, mir so viele Fakten zu nennen? Zufälligerweise war Sonntag, der 3o. Juli 1967, tatsächlich der einzige Abend, an dem er den großen und bald verstorbenen Joe Orton in einer Brightoner Kneipe kennen lernen konnte.
Außerdem kann ich nicht leugnen, dass Porteous' Geschichte einen für Abergläubische durchaus unheimlichen Hintergrund hat. Ortons Agentin, die legendäre Peggy Ramsay, hatte ein Haus in Brighton. Sie hatte sich am Samstagabend mit ihm und dem Rest der Gruppe zu einem Dinner verabredet und wurde von ihnen abgeholt. Im Restaurant ließ Orton einige seiner typischen abfälligen Bemerkungen vom Stapel, unter anderem über eine Horus-Figur, die sie ihm zeigte und erklärte, dass es eine antike Holzschnitzerei von einem Vogel sei, eine traditionelle Grabbeigabe der Ägypter, die die Seele der Verstorbenen auf dem Weg in den Himmel begleiten sollte. Peggy hielt Orton vor, mit seinem Spott würde er das Schicksal herausfordern. Nun, eines lässt sich nicht leugnen, wenn man eine Affinität zu derlei Dingen hat: Orton war binnen zwei Wochen tot.
Ich habe diesbezüglich natürlich keinerlei Affinität. Zumindest wehre ich mich dagegen. Aber vorhin hat mir Eunice den Argus gebracht, um den ich sie gebeten hatte, und was lese ich darin? Zurzeit läuft im Odeon der neueste James Bond. Genauso wie im Juli 1967. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Vielleicht wäre ich ja dazu gekommen, und sei es nur, um mich in meinem Neid auf Pierce Brosnan zu suhlen. Aber die Umstände haben das verhindert. So wie damals bei Orton.
Und jetzt führe ich selbst eine Art Tagebuch. Genauso wie Orton.
Denken, Trinken, Reden. Alle drei habe ich übertrieben. Ich sollte wirklich so früh ins Bett gehen, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber meine innere Uhr ist schon auf den Rest der Woche eingestellt, und da werde ich bis in die frühen Morgenstunden wach sein. Anscheinend kann ich mich nicht entspannen. Doch ich kann aufhören zu erzählen. Wenigstens das habe ich in der Hand. Außerdem gibt es jetzt wirklich nichts mehr zu sagen. Fürs Erste.
MONTAG
Der Wecker hat mich heute Morgen um halb neun aus dem Schlaf gerissen – für mich hora incognita, was meine Gewohnheiten in letzter Zeit betrifft. Vom Reiz des Neuen konnte allerdings nicht die Rede sein. Ich blinzelte kurz zum Fenster hinaus. Zu sehen waren ein grauer Himmel und eine vom Wind gejagte Burgerverpackung, die die Straße hinuntertaumelte. Der Mann, dessen Gesicht mir wenig später aus dem Spiegel entgegenschaute, sah nicht gerade frisch aus.
Das war er auch nach dem Frühstück und einem Spaziergang zum Strand nicht. Aber ich hatte ein Versprechen gegeben und wollte es nicht erst dann einhalten, wenn mein Biorhythmus wieder stimmte. Also marschierte ich nach Lanes.
Als ich das Café Rendezvous erreichte, war es schon mehrere Minuten nach zehn. Ich entdeckte den Schleimer, als ich mich in einem wohlgeübten schlendernden Gang der Tür näherte. Dabei beachtete ich ihn ebenso wenig, wie ich zum Brimmers hinüberschaute. Aus den Augenwinkeln eine Gestalt mit Dufflecoat am Fenster zu bemerken, war Rechtfertigung genug für das grausam frühe Ende der Nachtruhe. Ob uns die Eigentümerin des Brimmers beobachtete, wusste ich nicht, doch ich hoffte inständig, Jenny würde klug genug sein, um in Deckung zu bleiben. Das hier war eine Vorführung, die kein Publikum vertrug.
Im Rendezvous war wenig los. Noch fehlten die Arbeiter, die ihren Schuss Koffein benötigten, und die Kaufhauskunden, die ihren Füßen zwischendurch eine Pause gönnten. Mit seiner Innenausstattung – viel dunkles Massivholz und an den Wänden ausgebleichte Fotos von Paris zu Anfang des letzten Jahrhunderts – zielt das Café auf Gäste vom europäischen Festland, wird aber seinem Anspruch dank ungemein fröhlicher, freundlicher Bedienungen und seiner eindeutig nicht kontinentalen Gäste nicht ganz gerecht. Der Schleimer war der beste Beweis. Der Dufflecoat, seine Jeans und die Wüstenstiefel gehörten eher zum Aldermaston March als zu den Champs-Elysées. Von dem Platz aus, wo ich mich mit einem doppelten Espresso und dem dazugehörigen Glas Wasser niedergelassen hatte, konnte ich nicht erkennen, was für Buttons er trug, aber er hatte mindestens ein halbes Dutzend an seinem Mantel stecken. Sie spiegelten sich matt im Fenster, durch das er zum Brimmers hinüberschaute. Vor sich hatte er ein aufgeschlagenes Buch liegen, dem er allerdings nicht viel Aufmerksamkeit schenkte.
Mir übrigens auch nicht – was Zweifel an Jennys Behauptung weckte, dass ich der Schlüssel für sein Interesse sei. Zugleich warf sein Verhalten die Frage auf, wie ich mich diesem Mann am besten nähern sollte, ein Thema, auf das ich mich nicht wirklich vorbereitet hatte. Das Video von Asche und Tod hatte er nicht dabei, und als ich eingetreten war, hatte er nicht einmal in meine Richtung geblinzelt.
Mein erster Eindruck, der auf einer Ansicht von drei Vierteln seines Profils beruhte, schien Jennys Eindruck zu bestätigen: ein Muttersöhnchen mittleren Alters, wobei es keine Rolle spielte, ob die Mama noch zugegen war oder nicht. Unter seinem Mantel lugte ein handgestrickter Pullover hervor. Sein graubrauner Mopp von Haar sah aus, als hätte man vor dem Schneiden eine Puddingschüssel darüber gestülpt. Seine Brille, die ziemlich weit vorn auf der Nase saß, war seit mindestens fünfzehn Jahren aus der Mode. Wenn er aus seiner Tasse nippte, führte er sie mit beiden Händen vorsichtig an die Lippen. Hätte er gestern bei der Ankunft meines Zuges mit Notizblock und Stift in der Hand am Bahnsteig gestanden, hätte er bestimmt nicht fehl am Platz gewirkt.
Aber Menschen in Schubladen zu stecken, ist, wie jeder Schauspieler weiß, eine tückische Methode, und leidvolle Erfahrung lehrt, dass sie bisweilen in die Irre führt. Jetzt war Fingerspitzengefühl gefragt. Während ich dem Espresso ein Glas Latte folgen ließ, bastelte ich mir die am wenigsten erbärmliche Ausrede zusammen, die mir auf die Schnelle einfiel. Dann schlenderte ich auf ihn zu.
»Entschuldigen Sie«, begann ich, »sind Sie von hier?«
Langsam wandte er den Kopf mir zu. »Ja, allerdings.« Er sprach so bedächtig, wie er sich bewegte, und lispelte leicht. Die Augen blieben leer. Dass er mich erkannt hätte, verrieten sie nicht.
»Ich bin fremd hier in Brighton. Könnten Sie mir vielleicht helfen, mich zu orientieren?«
»Vielleicht, ja.«
Wie mir erst jetzt auffiel, handelte es sich bei den Buttons um Emaillebroschen mit Darstellungen von Gestalten aus Hergé-Comic-Heften: Kapitän Haddock, Professor Bienlein, die Detektive Schulze und Schultze und natürlich Tim mit seinem legendären Struppi.
»Ich suche die Bibliothek«, fügte ich hinzu. (Ziemlich lahm, ich weiß, aber was will man machen?)
»Es könnte ... schwer sein, sie zu finden«, erwiderte er mit einem matten Lächeln. »Sie ist umgezogen, wissen Sie.«
»Ach, wirklich?«
»Sie ist jetzt in der New England Street.«
»Gut. Und die ist ...« Mein Blick fiel auf seine Lektüre. Wie der Zufall es wollte, hatte sie den vergilbten Schnitt und den mit Folie bezogenen Deckel eines Bibliotheksbuchs. Und dann bemerkte ich den Titel: Joe Orton – Die Tagebücher. Ich sagte kein Wort, doch meine Augen müssen sich vor Überraschung geweitet haben.
In diesem Moment – er hätte nicht ungünstiger sein können – klingelte mein Handy. »Jemand will was von Ihnen«, kommentierte der Schleimer, während ich in meiner Jackentasche herumfummelte.
»Entschuldigung«, stotterte ich. »Das tut mir Leid.« Endlich hatte ich das Scheißding in der Hand. Ich wandte mich ab und kehrte zu meinem Tisch zurück. »Ja?«, bellte ich.
»Toby, ich bin's, Brian. Hoffentlich nicht zu früh für dich.«
Hätte mich Brian Sallis, der unermüdliche Inspizient unserer Truppe, aus einem wohlverdienten Schlummer gerissen, ich wäre nicht verärgerter gewesen als jetzt. Was, in Gottes Namen, konnte er nur wollen?
Diese stumme Frage wurde umgehend, wenn auch für meine Begriffe nicht zufrieden stellend, beantwortet.
»Ich wollte nur hören, ob du gestern eine ruhige Fahrt hattest.«
»Ich bin durchgekommen, ja.«
»Schön.«
»Hör zu, Brian ...«
»Du hast doch unsere Pressekonferenz heute Nachmittag nicht vergessen, oder?« Das war also der wahre Grund für den Anruf. Er wollte sicherstellen, dass ich mich nicht vor unserem Termin mit den Medienvertretern drückte. »Halb drei im Theater.«
»Ich werde da sein.«
»Und um vier die Durchlaufprobe.«
An jedem Montagnachmittag während der Tournee ist es dasselbe: Pressekonferenz um halb drei, Durchlaufprobe um vier, damit wir ein Gefühl für die neue Bühne bekommen. Brian hatte wohl kaum befürchtet, dass ich den Terminplan vergessen würde. Seine eigentliche Sorge galt wahrscheinlich meinem Gemütszustand, und der war tatsächlich nicht besonders gut, wenn auch aus Gründen, von denen er nichts wissen konnte. »Ich werde da sein«, wiederholte ich. »Okay?«
»Wunderbar. Ich wollte nur ...«
»Ich muss jetzt Schluss machen.«
»Dir fehlt doch nichts, Toby, oder?«
»Mir geht's prima. Bis später. Tschüs.«
Ich beendete das Gespräch, bevor Brian dazu kam, sich seinerseits zu verabschieden, und wandte mich wieder zu dem Schleimer um.
Doch der war nicht mehr da. Sein Hocker war leer, seine Kaffeetasse ausgetrunken. Der Schleimer war mitsamt Orton-Tagebüchern und Hergé-Ansteckern verschwunden.
Mit einem wüsten Fluch auf Brian schnappte ich mir meinen Mantel und stürzte hinaus. Vom Schleimer fehlte jede Spur, aber in den engen, verwinkelten Gassen von Lanes ist das kein Wunder. Die Chance, seine Richtung zu erraten, war fünfzig zu fünfzig.
In einer Mischung aus Furcht und Hoffnung schaute ich bei Brimmers zum Fenster hinein. Jenny hatte entweder nichts gesehen – dann hätte sie mir ohnehin nicht helfen können –, oder sie hatte das Fiasko verfolgt, und dann ...
Elegant in einen Hosenanzug gekleidet und ohne jede Spur eines Lächelns starrte sie mich durch einen schmalen Schlitz zwischen all den Hüten in der Auslage an, konnte sich aber in der Gegenwart einer Kundin nicht mehr als ein tiefes Stirnrunzeln als Ausdruck ihres Zorns leisten. Ich schnitt eine Grimasse, und sie neigte den Kopf nach rechts.
Ich drehte mich in die angezeigte Richtung, bog eilig um die Ecke und ließ im Gehen den Blick über die Geschäfte und Querstraßen schweifen. Kein Dufflecoat belohnte meine Bemühungen. Ich hastete weiter, und binnen weniger Minuten war ich mitten im Trubel der North Street mit ihrem tosenden Verkehr und all den hektischen Passanten.
Doch dann – ich traute meinen Augen kaum – sah ich ihn auf der anderen Straßenseite an einer Bushaltestelle ungeduldig auf und ab gehen. Er schob seine Brille mit dem Zeigefinger nach oben und blinzelte gespannt in die Richtung, aus der der Bus kommen musste. In diesem Moment griffen all die übrigen Wartenden wie auf Kommando nach ihren Taschen oder klappten ihre Einkaufswagen zusammen – ein untrügliches Zeichen für das Nahen des Busses. Ich schaute kurz nach links und sah einen Doppeldecker auf sie zufahren.
Ich rannte los. Der Bus stand noch da, als ich es endlich auf die andere Straßenseite geschafft hatte. Noch immer stiegen Leute ein. Ich spähte durchs Fenster. Der Schleimer erklomm gerade die Stufen zum oberen Deck. Ich erkannte seine Wüstenstiefel. »Wohin fährt dieser Bus?«, fragte ich eine entnervte Mutter und gab ihre Antwort an den Fahrer weiter. »Patchman, bitte.« Wie ich erfuhr, galt für alle Strecken ein Einheitstarif von einem Pfund. Ich konnte also fahren, wohin ich wollte.
Na gut, in Wirklichkeit bestimmte natürlich der Schleimer das Ziel. Ich setzte mich unten einigermaßen weit vorn hin, sodass ich sehen konnte, wann er herunterkam. Der Bus tuckerte um den Royal Pavilion herum, blieb erneut stehen und nahm weitere Passagiere auf.
Zehn Minuten im Kriechtempo brachten uns zur London Road und in die Nähe des Duke of York's Cinema. Mehrere Leute standen auf, als die Haltestelle in Sicht kam. Dann tauchten oben die Wüstenstiefel an der Biegung der Treppe auf. In den Schleimer war wieder Bewegung gekommen. Ich erhob mich unauffällig hinter einem breitschultrigen Jugendlichen und stieg als Letzter aus.
Der Schleimer strebte mittlerweile in nördlicher Richtung auf die nächste Kreuzung zu. Ich folgte ihm in, wie ich meinte, sicherem Abstand. Als er die Kreuzung erreichte und an der Ampel warten musste, verzog ich mich in einen Hauseingang und rührte mich erst wieder von der Stelle, als die Ampel auf Grün schaltete.
Er bog ostwärts in die Viaduct Road ein, wo dichter Verkehr an schäbigen viktorianischen Reihenhäusern vorbeidonnerte. Mit gesenktem Kopf trottete der Schleimer weiter. Für seine Umgebung zeigte er nicht das geringste Interesse. Auch machte er keine Anstalten, einen Blick über die Schulter zu werfen. Eigentlich, dachte ich, hätte er vorsichtiger sein müssen, wenn ich sein Misstrauen erregt und er das Rendezvous deshalb so abrupt verlassen hatte. Daraus schloss ich, dass er wahrscheinlich ohnehin vorgehabt hatte zu gehen und ich ganz einfach irrelevant für ihn war.
Ich sah ihn in der Hosentasche nach dem Schlüssel wühlen. Sekunden später blieb er vor einem Haus stehen, das noch heruntergekommener war als die meisten der anderen Häuser, und sperrte auf. Als ich es erreichte, fiel die Tür gerade ins Schloss. Im Weitergehen registrierte ich die Nummer: 77. Nach einer Weile kehrte ich um. Diesmal ließ ich mir mehr Zeit und betrachtete das Gebäude eingehend.