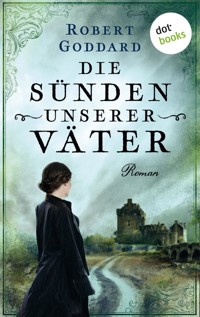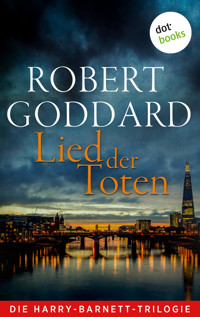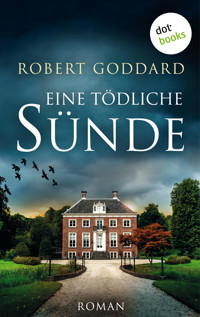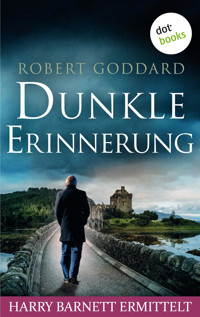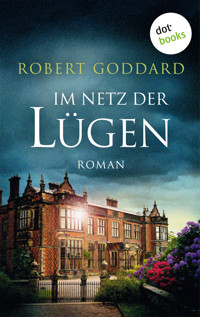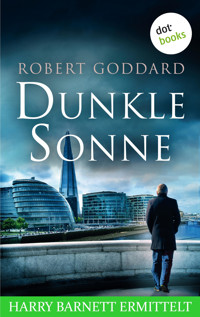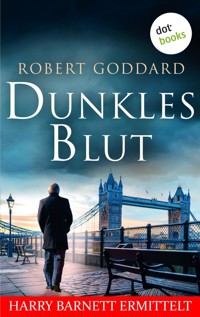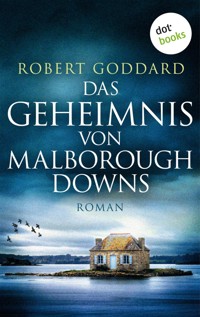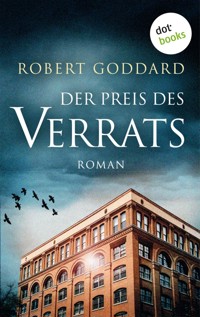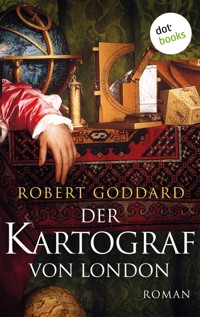
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Verschwörung, die das Ende Britanniens bedeuten könnte: Der historische Kriminalroman »Der Kartograf von London« von Robert Goddard als eBook bei dotbooks. London, Januar 1721: England wird erschüttert vom größten Finanzskandal in seiner Geschichte, dem Zusammenbruch der South Sea Company. In dieser Zeit der Unruhe bietet der ehemalige Direktor der SSC dem mittellosen Kartenzeichner William Spandrel ein Geschäft an, das dieser nicht ablehnen kann: Er soll ein geheimnisvolles Paket nach Amsterdam bringen – und alle seine Schulden sind erlassen. Doch kaum in Holland angekommen, wird Spandrel des Mordes bezichtigt. Warum wurde er in ein tödliches Komplott verwickelt? Um sich zu retten, muss Spandrel die Hintermänner der Verschwörung aufdecken, die nicht nur sein Leben bedrohen, sondern ganz England in den Abgrund stürzen könnten … »Robert Goddard ist einer der besten Erzähler unserer Zeit.« Sunday Telegraph »Robert Goddards Romane machen süchtig!« Main-Post Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der historische Kriminalroman »Der Kartograf von London« von Robert Goddard. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 602
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
London, Januar 1721: England wird erschüttert vom größten Finanzskandal in seiner Geschichte, dem Zusammenbruch der South Sea Company. In dieser Zeit der Unruhe bietet der ehemalige Direktor der SSC dem mittellosen Kartenzeichner William Spandrel ein Geschäft an, das dieser nicht ablehnen kann: Er soll ein geheimnisvolles Paket nach Amsterdam bringen – und alle seine Schulden sind erlassen. Doch kaum in Holland angekommen, wird Spandrel des Mordes bezichtigt. Warum wurde er in ein tödliches Komplott verwickelt? Um sich zu retten, muss Spandrel die Hintermänner der Verschwörung aufdecken, die nicht nur sein Leben bedrohen, sondern ganz England in den Abgrund stürzen könnten …
»Robert Goddard ist einer der besten Erzähler unserer Zeit.« Sunday Telegraph
»Robert Goddards Romane machen süchtig!« Main-Post
Über den Autor:
Robert William Goddard, geboren 1954 in Fareham, ist ein vielfach preisgekrönter britischer Schriftsteller. Nach einem Geschichtsstudium in Cambridge begann Goddard zunächst als Journalist zu arbeiten, bevor er sich ausschließlich dem Schreiben von Spannungsromanen widmete. Robert Goddard wurde 2019 für sein Lebenswerk mit dem renommierten Preis der Crime Writer's Association geehrt. Er lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks auch die folgenden Kriminalromane:»Im Netz der Lügen«»Der Preis des Verrats«»Eine tödliche Sünde«»Ein dunkler Schatten«»Denn ewig währt die Schuld«»Das Geheimnis von Trennor Manor«»Und Friede den Toten«»Das Geheimnis der Lady Paxton«»Das Haus der dunklen Träume«
Robert Goddard veröffentlichte bei dotbooks weiterhin die historischen Kriminalromane:»Die Sünden unserer Väter«»Die Schatten der Toten«»Jäger und Gejagte«»Die Klage der Toten«»Der Kartograf von London«
Robert Goddard veröffentlichte außerdem bei dotbooks seine drei Kriminalromane mit dem Ermittler Harry Barnett:»Dunkles Blut«»Dunkles Sonne«»Dunkle Erinnerung«
***
Aktualisierte eBook-Neuausgabe Februar 2020
Dieses Buch erschien bereits 2002 unter dem Titel »Die Mission des Zeichners« im Goldmann Verlag, München
Copyright © der englischen Originalausgabe 2000 Robert & Vaunda Goddard
Die englische Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »Sea Change« bei Transworld, London.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 Goldmann Verlag, München
Copyright © der aktualisierten Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung eines Bildes von Hans Holbein dem Jüngeren »Die Gesandten«
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (CG)
ISBN 978-3-96148-991-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Robert Goddard« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Robert Goddard
Der Kartograf von London
Historischer Roman
Aus dem Englischen von Peter Pfaffinger
dotbooks.
Von klugen Köpfen ist darauf hingewiesen worden, dass eine Handelsnation von den goldenen Verlockungen der Gier, den unwirklichen Hoffnungen der Pläneschmiede und den verwegenen Träumen der Spekulanten mehr zu befürchten hat als von äußeren Gefahren.
John Miller , An Authentic Account
of the South Sea Scheme (1845)
»Ich habe einen Gewinn von tausend Prozent gemacht – und bin zufrieden.«
Robert Walpole (1720)
ERSTES BUCH
Januar – März 1721
Kapitel 1Spekulanten in der Falle
Düsteres Wetter für eine düstere Zeit. Die feuchte, klamme Nacht klebte an London wie kalter Schweiß. Obwohl im Kamin ein Feuer brannte, stand Sir Theodore Janssen am entgegengesetzten Ende des Salons vor dem geöffneten Fenster. Mit einem Arm stützte er sich auf den Sims, den anderen hatte er vor die Brust gehoben, die gespreizte Hand quer über seine mit Brokat bestickte Weste gelegt. Er sah auf den Hanover Square hinaus, und in der von Sprühregen verhangenen Dunkelheit schien er den immer schwärzer werdenden Schatten seiner Zukunft zu erkennen.
Bis vor kurzem war er ein Mann von hohem Ansehen und Wohlstand gewesen. Sir Theodore, auf die »nachdrückliche Empfehlung« des Prince of Wales hin zum Baronet ernannt, Parlamentsabgeordneter, Direktor der Bank of England, Großgrundbesitzer und Finanzier mit beinahe legendärem Geschäftssinn, hätte sich eigentlich darauf freuen können, im Alter allseits geschätzt ein behagliches Leben zu führen. Vom flämischen Auswanderer, der in seiner Jugend ohne Freunde und Mittel ins Land gekommen war, hatte er es zum Pionier einer neuen Epoche des freien Handels gebracht. Doch nun stand er auf einmal am Rande des Ruins, als ein Mann, der sein Werk mit eigener Hand zerstört hatte und dem Ende seiner Tage zu nahe war, um sich noch der trügerischen Hoffnung hinzugeben, er könne einen Verlust wettmachen, der so gut wie unwiderruflich feststand.
Die South Sea Company war natürlich sein Fehler, so wie sie der Irrtum vieler Männer gewesen war. Wäre er vor zwölf Monaten von seiner Stelle als Direktor zurückgetreten oder – besser noch – hätte er sie gar nicht erst angenommen, dann wäre er jetzt frei von all dem. Natürlich nicht von sämtlichen finanziellen Verlusten. Kein Zweifel, wie jeder andere auch hätte er damit spekuliert, dass die Anteile weiter steigen würden. Aber ihren Verfall hätte er verschmerzen können. Bei der Größe seines Vermögens hätte er kaum etwas davon bemerkt. Doch das hier war von ganz anderer Art. Es war das beschämende und unvermeidliche Eingeständnis seiner Gier und Dummheit. Darüber hinaus würde es einen Preis kosten, den womöglich nicht einmal er würde bezahlen können.
Noch viel düsterer wurde die Angelegenheit dadurch, dass sich am anderen Ende des Zimmers der Mann am mit reichlich Holz geschürten Feuer die Hände wärmte, der ihn vor zwei Jahren ins Direktorium gelockt hatte: Robert Knight, oberster Kassenführer der Gesellschaft, Verwalter ihrer Konten, Hüter ihrer Geheimnisse. Auch Knight drohte der Ruin, doch er stellte sich ihm mit einem unbekümmerten Lächeln und ohne Sorgenfalten auf der Stirn. Er sah immer noch zehn Jahre jünger aus, als er tatsächlich war, und hatte sich jenes Funkeln in den Augen bewahrt, das nicht dem Kerzenlicht zu verdanken war.
Sir Theodore wandte sich nun vom Fenster zu ihm um. »Warum sind Sie hier, Mr. Knight?«, fragte er mit rauer Stimme und hüstelte, um seine Kehle frei zu bekommen.
»Weil ich übermorgen vor den Ausschuss treten muss, Sir Theodore.«
Bei dem Gremium, von dem Knight sprach, handelte es sich um den vom Unterhaus zur Aufklärung des Skandals um die South Sea Company eingesetzten, geheimen Untersuchungsausschuss. Wie eine Besatzungsmacht hatte er sich im South Sea House festgesetzt, wo er nun schon die ganze Woche tagte, nach Gutdünken jeden, den er verhören wollte, herbeizitierte und Dokumente jeglicher Art beschlagnahmte, die ihm für die Wahrheitsfindung geeignet erschienen. Freilich war die Wahrheit im Wesentlichen längst bekannt. Das Unternehmen South Sea war von Anfang an ein unmöglicher Traum gewesen, auf recht erhalten durch nicht mehr als eine weltweite wilde Entschlossenheit, daran zu glauben. Jetzt war der Winter der grausamen Enttäuschungen, eingefrorenen Kredite und der im Frost geplatzten Vermögen gekommen. Die Fahndung lief, wenn auch nicht so sehr nach der Wahrheit, sondern nach Schuldigen. Jeder war ein Opfer, doch nicht jeder konnte ein Schurke sein.
»Man wird mir wohl hart zusetzen«, fuhr Knight fort. »Sehen Sie das nicht auch so?«
Sir Theodore nickte. »Sehr hart. Daran habe ich keinen Zweifel.«
»Was soll ich ihnen sagen?«
»Sind Sie gekommen, um bei mir Rat zu suchen?«
»Ihren Rat – und Ihre Hilfe.«
Sir Theodore runzelte die Stirn. »Hilfe wobei?«
»Die Beseitigung – wenn ich es so ausdrücken darf – des Inhalts meines Köfferchens.« Knight hob eine Tasche, die er mitgebracht hatte, vom Boden hoch und trat damit zu einem Tisch in der Mitte des Raums. »Darf ich?«
Mit einem fast unmerklichen Neigen des Kopfes erteilte Sir Theodore seine Zustimmung, woraufhin Knight die Tasche öffnete und ein dickes, in Leder gebundenes Buch auf den Tisch legte. Der marmorierte Schnitt war abgegriffen und sein Deckel grün.
»Sie wirken überrascht, Sir Theodore.«
»Das bin ich auch.«
»Sie wissen, was das ist?«
»Wie sollte ich?«
»Wie sollten Sie nicht? Es sei denn …« Knight ging um den Tisch herum und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Dabei griff er mit einer Hand hinter sich, bis sie auf dem Buch zu liegen kam. »Vielleicht haben Sie ja die Absicht, sich auf Unwissenheit zu berufen. Und vielleicht proben Sie jetzt schon eine solche Verteidigung. Wenn dem so ist – bei mir können Sie sich die Mühe sparen. Sie wissen, was das ist. Und ich weiß, dass Sie es wissen. Sie können andere zum Narren halten – dabei wünsche ich Ihnen viel Glück –, aber mich können Sie nicht täuschen.«
»Nein.« Sir Theodores Gesicht umwölkte sich. »Natürlich nicht. Letzten Endes verhält es sich eher umgekehrt.«
»Ihnen waren die Risiken unserer Unternehmung bekannt, Sir Theodore. Behaupten Sie nicht das Gegenteil.«
»Habe ich das etwa? Heute frage ich mich, wie ich je an ihren Erfolg glauben konnte.«
Damit war Sir Theodore vermutlich nicht der Einzige. In ganz England stellten die Großen und die Guten, die über Nacht verarmten und die nicht mehr ganz so Reichen dieselbe Frage, wenn nicht anderen, dann sich selbst: Wie hatten sie annehmen können, dass sie damit Erfolg haben würden? Die Vorstellung, dass sich die dreißig Millionen Pfund Staatsschulden mit einem Fingerschnippen in das stetig wachsende Kapital einer Gesellschaft verwandeln ließen, deren tatsächliches Guthaben zwar nur einen Bruchteil davon ausmachte, aber deren mögliche Gewinne aus dem Südseehandel unbegrenzt schienen, hatte eine magische Anziehungskraft ausgeübt. Und der glattzüngige Mr. Knight hatte jeden Zweifler auf seine Seite gezogen, wenn nicht mit Worten, dann eben mit … eindrücklicheren Methoden. Nun aber war der Zauberer als Betrüger entlarvt. Und diejenigen, die sich an seinen Geschäften beteiligt hatten, standen vor der unerquicklichen Wahl, sich entweder als von ihm Geprellte oder als seine Komplizen zu erkennen zu geben.
»Ich hegte Hoffnungen auf mehr als persönliche Bereicherung, Mr. Knight«, fuhr Sir Theodore fort. »Ich sah das als den Beginn einer glorreichen neuen Welt für alle und glaubte, wir seien an einem philanthropischen Werk beteiligt.«
»Ich würde Ihnen nicht empfehlen, dieses Argument dem Ausschuss vorzutragen.«
»Es ist kein Argument. Es ist die Wahrheit.«
»Aber wird es Ihnen das Gefängnis ersparen? Das glaube ich eher nicht.«
»Vermag das überhaupt noch etwas?«
»Vielleicht.« Knight begann mit den Fingern auf das Buch zu trommeln. »Eine härtere Art von Wahrheit könnte uns retten.«
»Uns?«
»Sie und mich, Sir Theodore. Sie, mich, Ihre Kollegen im Direktorium und all deren Freunde in hohen Ämtern. So viele Freunde. So hoch oben. Meiner Meinung nach zu hoch, als dass man Ihren Sturz zulassen dürfte. Aber die Furcht vor dem Sturz wird Wunder bewirken. Und nichts anderes als Wunder brauchen wir.«
»Ich dachte, Sie bräuchten Hilfe.«
»Genau. Eine Kleinigkeit, die einem großen Ziel dient.« Knights Finger kamen jäh zur Ruhe. »Dieses Buch stellt unsere Rettung dar. Aber nur so lange, wie es in Sicherheit bleibt – sowohl vor unseren Freunden, die es gerne zerstören würden, als auch vor unseren Feinden, die am liebsten auf den Kirchturm klettern und seine Geheimnisse laut hinausposaunen würden.«
»Dann schlage ich vor, dass Sie es sicher verwahren, Mr. Knight.«
»Wie kann ich das? Im South Sea House gibt es keinen sicheren Ort mehr. Mr. Brodrick hat seine Schnüffler in jedes Loch geschickt.« Thomas Brodrick, ein eingeschworener Gegner der South Sea Company und all ihrer Unternehmungen, war der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, und es verstand sich von selbst, dass er seiner Aufgabe mit äußerster Hingabe und höchstem Genuss nachging. »Wenn ich bleibe, finden sie es.«
»Wenn Sie bleiben?«
»Oder wenn ich fliehe. Es wäre einerlei.«
»Beabsichtigen Sie zu fliehen?«
»Das habe ich nicht gesagt.« Knight grinste. »Oder?«
Sir Theodores Augen verengten sich. Unvermittelt knallte er das Fenster hinter sich mit völlig unnötiger Gewalt zu. Als wäre er der beiderseitigen Winkelzüge überdrüssig, sagte er dann: »Was wollen Sie von mir?«
»Ich will, dass Sie das Buch in Ihre Obhut nehmen.«
»Warum ich?«
»Weil Sie das bedeutendste Mitglied des Direktoriums sind, und auch das verlässlichste. Und meines Erachtens sind Sie derjenige, der am wenigsten zu Panik neigt. Caswall und Master haben sich heute mitten auf der Straße vor dem South Sea House geprügelt. Es war kein sehr erbauliches Spektakel.«
»Sie schmeicheln mir, Mr. Knight.«
»Ganz und gar nicht. Ich weise Sie lediglich auf die einfachen Tatsachen hin. Sie sind wirklich so, wie ich Sie beschrieben habe.«
»Angenommen, dem wäre so, warum wäre das Buch dann in meinen Händen sicherer als in Ihren?«
»Weil man nicht erwarten würde, dass ich ein solches Dokument ausgerechnet in diese Hände legen würde. Und weil Sie in ihrem Herkunftsland langjährige Freunde haben, denen man es anvertrauen könnte. In diesem Fall hätte ich keine Ahnung von seinem Verbleib, und niemand könnte mir das Wissen darum abpressen. Und niemand würde auf die Idee kommen, solches bei Ihnen zu versuchen. Solange das Buch im Ausland verbleibt, sind den Maßnahmen, die gegen uns ergriffen werden könnten, Grenzen gesetzt. Es wäre eine Versicherung für uns beide. Und für unsere Kollegen.«
»Denken Sie dabei wirklich auch an sie?«
»Nein«, grinste Knight. »Ich erwähne sie nur für den Fall, dass Sie das tun.«
»Wenn bekannt würde, dass Sie mir das Buch anvertraut haben, würde man annehmen, dass mir sein Inhalt bekannt ist.«
»Was selbstverständlich nicht der Fall ist.« Knights Grinsen wurde breiter, um dann jäh zu ersterben. »Aber das würde nicht ans Tageslicht kommen. Warum auch? Ich habe Vertrauen in Ihre Auswahl des Empfängers wie des Boten. Ich habe volles Vertrauen zu Ihnen.«
»Ich glaube, Vertrauen haben Sie so wenig zu mir wie ich zu Ihnen, Mr. Knight.«
Knight starrte ihn mit einem Ausdruck aufrichtiger Verletztheit an. »Wie können Sie das sagen?«
»Doch zwischen uns geht es ohnehin nicht mehr um Vertrauen. Wäre dem so, säßen wir noch alle fest im Sattel.«
»Worum geht es dann?«
»Verzweiflung.« Sir Theodore stieß einen tiefen Seufzer aus und schlurfte zum Tisch, wo er stehen blieb und den Blick auf das Buch mit dem grünen Umschlag richtete. »Nackte Verzweiflung.«
»Womöglich. Darüber möchte ich nicht streiten. Aber die Frage ist ganz einfach: Sind Sie dazu bereit?«
»Ich müsste wahnsinnig sein.«
»Und noch wahnsinniger, wenn Sie es nicht nähmen. Zu vieles steht auf dem Spiel. Mehr als bloß unsere persönlichen Umstände. Weit mehr. Aber zufälligerweise« – Knights Stimme nahm den klebrig süßen Ton an, den er in den vergangenen Tagen benutzt hatte, um so vielen einzureden, das Unternehmen South Sea würde, ja, könne gar nicht scheitern – »decken sich unsere Interessen und die der Nation. Unsere Rettung ist die Rettung aller.«
»Wie erfreulich.«
»Sind Sie dazu bereit?«, wiederholte Knight.
Sir Theodore sah ihm lange in die Augen. »Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten, Mr. Knight.«
»Kann ich zurücklassen, was ich mitgebracht habe?«
»Sie haben nichts mitgebracht.« Sir Theodore zog eine Augenbraue hoch. »Ich gehe davon aus, dass ich mich klar ausgedrückt habe.«
Knight nickte. »Vollkommen klar.«
»Dann erübrigt sich jedes weitere Wort.« Sir Theodore nahm das Buch und trug es zu einem Sekretär in der Ecke. Dort legte er es in eine Schublade, sperrte sie ab und ließ den Schlüssel in seine Westentasche gleiten. »Nicht wahr?«
Eine Stunde später – Knight war längst gegangen – erhob sich Sir Theodore von seinem Stuhl am Pult, in dem das Buch mit dem grünen Umschlag weggesperrt lag. Er trank sein Glas Portwein aus, dann sah er noch einmal auf den Brief hinunter, den zu schreiben er den größten Teil dieser Stunde benötigt hatte. Richtig, alles in allem erschien es ihm so, als hätte er gerade so viel und so wenig wie nötig preisgegeben. Und wenn er seinem ältesten und treuesten Freund eindringlich ans Herz gelegt hatte, äußerste Vorsicht walten zu lassen, so war dies zweifellos unerlässlich. Er versiegelte den Brief, durchquerte den Raum zum Glockenzug und betätigte ihn.
Mehrere Minuten verstrichen, in deren Verlauf Sir Theodore das ersterbende Feuer betrachtete. Zwischen Daumen und Zeigefinger der rechten Hand drehte er langsam den protzig am kleinen Finger der linken Hand steckenden Gold- und Diamantenring hin und her. Er war ein Geschenk des Prince of Wales; vor acht Jahren hatte ihm der Prinz den Ring bei der Geburtstagsfeier des Königs im Saint James’s Palace überreicht. Das war noch zu einer Zeit gewesen, als Reichtümer vom klaren Frühlingshimmel zu regnen schienen und niemand daran zweifelte – ganz einfach weil es niemand wagte –, dass Anteile an der South Sea Company in Höhe von einem Pfund morgen zehn und übermorgen hundert Pfund wert sein würden. Seine eigene Einzahlung musste sich damals auf eine Million belaufen haben. Eine Million Pfund und eine Milliarde Illusionen. Jetzt war nichts mehr davon übrig, nichts als Asche in seinem Mund.
Jemand klopfte an die Tür. Gleich darauf trat Nicodemus Jupe ein, Sir Theodores Diener und treues Faktotum. Jupe, ein hagerer Bursche von etwa vierzig Jahren mit markanter Adlernase und ernstem Gesicht, hatte das Gebaren eines Mannes, der seine Bedeutung in der Welt nie überschätzte, sie aber auch zu keinem Zeitpunkt unterschätzte. Er war bescheiden, ohne unterwürfig zu sein, scharfsinnig, jedoch nie anmaßend. Er war stets völlig verlässlich gewesen, aber im gleichen Maße war der kalte Wesenszug, dem er seine Tüchtigkeit verdankte, der Schlüssel zu dem Einverständnis zwischen ihm und seinem Herrn. Er nahm an, dass Sir Theodore sich der Schwierigkeiten, die sie beide ereilt hatten, entledigen würde. Ja, er erwartete es sogar von ihm. Und er selbst würde alles tun, um das herbeizuführen. Das beinhaltete das Ausmaß seiner Treue. Sie reichte weit, aber nicht bis zum Ende der Welt.
»Auf dem Pult liegt ein Brief«, erklärte Sir Theodore. »Er muss noch heute Nacht befördert werden.«
Jupe nahm den Umschlag an sich und warf einen Blick auf die Adresse. Sein Gesicht verriet keine Reaktion.
»Es tut mir Leid, dass ich Sie bitten muss, das Haus zu so später Stunde noch zu verlassen. Aber es ist eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit.«
»Ich verstehe, Sir. Ich mache mich sofort auf den Weg.«
»Noch etwas anderes, bevor Sie gehen.«
»Ja, Sir?«
»Der mittellose Kartenzeichner … Spandrel. Wir haben ihn fest im Visier?«
»Allerdings, Sir. Ich bezweifle nicht, dass er versuchen wird, sich zu entziehen. Und dann kriegen wir ihn. Aber fürs Erste …«
»Hält er sich an die Regeln.«
»Ja.«
»Ich möchte ihn sehen.«
Jupes Augen weiteten sich ein wenig vor Überraschung. »Und ist das auch … eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit?«
»Das ist es, Jupe. Ja.«
Kapitel 2Der nutzlose Wiegemesser
Die Morgendämmerung kroch langsam und widerwillig in das schlecht beleuchtete Zimmer, das William Spandrel mit seiner Mutter unter den Dachsparren einer Pension im Cat and Dog Yard teilte. Ihre Ankunft war Spandrel nicht willkommen. Das graue, vom Staub gefilterte Licht legte die Risse im Putz und den Zerfall des Backsteins darunter nur umso deutlicher bloß. Während er beim Rasieren mit einer stumpfen Klinge und minderwertiger Seife sein durch eine Spiegelscherbe fragmentiertes Gesicht begutachtete, fiel ihm auf, wie hohlwangig er geworden war, und er bemerkte die tiefen dunklen Schatten unter den Augen und den verhärmten Ausdruck des Scheiterns, der sich dahinter zu verbergen suchte. Wer würde sich schon über die Morgendämmerung freuen, wenn doch die Dunkelheit wenigstens eine Art von Zuflucht bot.
Er hatte den Spiegel an den Rahmen des nach Süden gehenden Fensters in seinem Mansardenzimmer genagelt, weil ihm so zumindest genügend Licht gewiss wäre, um sich die Kehle aufzuschlitzen, sollte er eines Tages dazu gezwungen sein. Dass dieser Fall irgendwann eintreten würde, erschien ihm in Anbetracht seiner düsteren Lage durchaus möglich. Wenn er einen Blick zum Fenster hinaus wagte, konnte er hinter dem durchhängenden Firstbalken der Punch Bowl Tavern die mit Pfählen bewehrte Mauer des Fleet Prison sehen, jenes Gefängnisses, in dem er im vergangenen Herbst zehn Tage lang als ein von niemandem beachtetes Opfer der plötzlichen Verschärfung der Kreditrahmen in einem wahren Fegefeuer geschmort hatte. Nach dem Ende des South Sea Bubble war das gewesen, als die Betrügereien dieser Handelsgesellschaft aufgeflogen und mit ihnen unzählige süße Träume von Reichtum jäh geplatzt waren. Sein eigener Traum war genau genommen nicht davon berührt gewesen, aber Handelskatastrophen eines solchen Ausmaßes ziehen weite Kreise und reißen auch diejenigen mit in die Tiefe, die sich dagegen gefeit wähnen.
Sein Glaube an die eigene Unverletzbarkeit war, wie Spandrel jetzt begriff, ein Trugschluss gewesen, der auf einer zu schmalen Grundlage beruht hatte: nämlich der Gewissheit, dass er selbst nicht mit Aktien der South Sea Company gespielt hatte. Er war einfach zu sehr damit beschäftigt gewesen, seinem Vater bei der mühsamen Erstellung dessen zu helfen, was ihre stolzeste Errungenschaft hätte werden sollen – »eine exakte und vollständige Karte der Stadt London und ihrer Umgebung in der Regierungszeit Seiner Britannischen Majestät König Georg des Ersten« –, um sich mit Börsenspekulationen abzugeben, selbst wenn er das dafür nötige Kapital gehabt hätte. Doch alle anderen, auch die Königin, hatten spekuliert, am Anfang erfolgreich, letztlich mit verheerenden Folgen. All die feinen Herren, die William Spandrel senior versichert hatten, dass sie ihm eine Kopie abkaufen und damit die demnächst mit Blattgold tapezierten Wände ihres Salons schmücken würden, hatten ihm eilfertig die für sein Unterfangen nötigen Mittel versprochen, aber genauso eilig hatten sie sich ihr Geld zurückgeholt, als sich vor ihren eigenen Füßen ein Abgrund aufgetan hatte. Die Karte war mittlerweile der Vollendung verlockend nahe, aber was nützte das jetzt noch? Mit einem Schlag standen sie ohne Kunden und Geldgeber da. Aus Gram darüber war William senior schwer krank geworden. Um seinem Vater zu ersparen, dass man ihn ins Gefängnis warf, was er in seinem Zustand nicht überlebt hätte, übernahm William junior die Verantwortung für seine Schulden. Prompt holten die Büttel den jungen Mann. Der Altere starb trotzdem. Spandrels Opfer hatte nichts geholfen.
Seine Lage war derart verzweifelt, dass seine Mutter ihren sonst so knauserigen Bruder erweichen konnte und tatsächlich die fünf Guineen bekam, die nötig waren, um Spandrel die Freiheit zu erkaufen, in einer eigenen Unterkunft zu leben. Zwar war er nach wie vor den Gefängnisregeln unterworfen, durfte aber immerhin dessen Mauern hinter sich lassen. So beschränkt diese Freiheit auch war, so war sie doch dem Grauen im Fleet bei weitem vorzuziehen. Aber in dem Maße, in dem die Erinnerung an die Schrecken dort verblasste, traten neue an ihre Stelle. Würde er je wieder wirklich frei sein? Sollte er die Blüte seines Lebens wie eine Fliege in einem Glas verbringen? Gab es denn gar keinen Ausweg?
Nun, an diesem trüben Januarmorgen schien sich jedenfalls keiner abzuzeichnen. In der Ecke stand, halb verdeckt von der zum Trocknen vor dem Kamin aufgehängten Wäsche, einer der Wegemesser, die er und sein Vater durch die Straßen von London geschoben hatten, um mit seiner Hilfe mit geradezu besessener Genauigkeit Entfernungen zu berechnen. Inzwischen war sein Rad von Rost überzogen. Alles verfiel, selbst die Hoffnung. Die Bögen mit ihren fertig gestellten Zeichnungen lagen beim Drucker und würden dort wahrscheinlich auch bleiben, da der Bursche für seine bisherige Arbeit noch keinen Penny erhalten hatte. Und solange Spandrel im Cat and Dog Yard eingesperrt blieb, wie es die Regeln des Fleet Prison verlangten, würde es keine weiteren Bögen geben, so viel stand fest.
Land zu vermessen war das Einzige, was er konnte. Er war immer nur der treue Lehrling seines Vaters gewesen. In dieser Zeit brauchte jedoch niemand einen Landvermesser. Der Gedanke an all das, was er verloren hatte, war schier unerträglich. Letzten Sommer hatte er Hoffnungen auf eine Hochzeit mit der schönen Maria Chesney gehegt. Und die Erarbeitung der Karte hatte sich so angelassen, als wäre sie die beste Idee, die sein Vater in seinem ganzen Leben gehabt hatte. Jetzt war ihm nichts mehr geblieben. Maria hatte er verloren. Sein Vater war tot. Seine Mutter war Wäscherin geworden, und aus ihm ein Wäscherinnenhelfer.
An der Tür hörte er ein Geräusch und drehte sich um. Das musste seine Mutter sein, auch wenn ihn wunderte, dass sie schon so schnell zurückkam. Zu seinem Erstaunen war es jedoch jemand anderes.
Ein hagerer Mann mit dunklen Kleidern und grau-schwarzer Perücke stand in der Tür. Wegen des niedrigen Rahmens musste er sich leicht bücken. Zusammen mit seiner knochigen Hakennase verliehen ihm seine stets hin und her schießenden, tief liegenden Augen das Aussehen eines fremdartigen Raubvogels auf der Suche nach Aas. Und vielleicht kam es Spandrel in den Sinn, glaubte er, jetzt eines gefunden zu haben.
»William Spandrel«, sagte der Mann. Es war keine Frage, sondern hörte sich vielmehr an wie eine Feststellung, die jedes Leugnen im Ansatz erstickte.
»Ja«, gab Spandrel misstrauisch zu.
»Mein Name ist Jupe. Ich vertrete Sir Theodore Janssen.«
»Ach? Na ja …« Spandrel legte das Rasiermesser beiseite und wischte sich den Seifenschaum vom Kinn. »Wie Sie sehen, habe ich keine Möglichkeit, etwas für Sir Theodore zu tun.«
»Sie schulden ihm einen hohen Betrag.«
Das ließ sich nicht leugnen. In vielerlei Hinsicht war Sir Theodore tatsächlich sein Hauptgläubiger. Spandrels Vater hatte in Wimbledon ein Grundstück vermessen, das Sir Theodore ein paar Jahre zuvor erworben hatte, und sich später um Unterstützung an ihn gewandt, als ihm die Idee mit der Karte von London gekommen war. Sir Theodore, der damals in Geld schwamm, hatte sich nur zu gern erkenntlich gezeigt. Als einer der Direktoren der South Sea Company musste er jetzt ein verzweifelter Mann sein. Das hatte Spandrel geborgten Zeitungen und auf der Straße aufgeschnappten Gesprächen entnommen. Trotzdem war so jemand doch bestimmt nicht derart verzweifelt, dass er sich ausgerechnet an den unglücklichsten seiner vielen Schuldner um Hilfe wenden würde.
»Sir Theodore wäre an einer Begleichung der Schuld gelegen.« Jupe trat weiter ins Zimmer und ließ den Blick über die dürftige und armselige Einrichtung schweifen.
»Mir nicht minder. Aber ich habe Besseres zu tun, als mich mit Gedanken an all das zu quälen, was ich gerne hätte.«
»Sir Theodore ebenso.«
»Warum sind Sie dann hier?«
»Um Ihnen eine Möglichkeit aufzuzeigen, Ihre Schuld bei ihm – und all Ihre anderen Verbindlichkeiten – zu begleichen, indem Sie Sir Theodore eine kleine, aber bedeutsame Gefälligkeit erweisen.«
»Soll das ein Witz sein?«
»Sehe ich aus wie einer, der Witze macht, Mr. Spandrel?« Das war ganz gewiss nicht der Fall. »Sie sollten vielmehr darüber nachdenken, ob Sie es sich leisten können, die Gelegenheit zu ignorieren, die ich Ihnen biete, sich – und Ihre Mutter – von dem Dasein zu erlösen, das Sie hier führen.« Jupe betrachtete neugierig einen aus dem Verputz herabhängenden Splitter. »Das heißt, wenn man das hier noch Leben nennen kann.«
»Verzeihung, Sir.« Spandrel zwang sich zu einem Lächeln. Vielleicht, überlegte er, hatte sich Sir Theodore zu Großzügigkeit denen gegenüber entschlossen, zu deren Bankrott seine Misswirtschaft beigetragen hatte. Es hatte schon merkwürdigere Dinge gegeben, auch wenn ihm im Augenblick keines einfallen wollte. Aber wenn Jupe die Wahrheit sagte, bot sich vielleicht wirklich ein Ausweg aus seinen Schwierigkeiten. »Es gibt selbstverständlich keinen Dienst, den ich Sir Theodore nicht mit der größten Freude für den Erlass meiner Schulden erweisen würde.«
»Selbstverständlich.« Jupe erwiderte sein Lächeln mit kaum verhohlener Überheblichkeit. »Sie sagen es.«
»Was würde er von mir verlangen?«
»Er wird es Ihnen persönlich erklären, Mr. Spandrel. Wenn Sie sich treffen.«
»Er kommt hierher?«
»Das mit Sicherheit nicht.« Jupe kräuselte sogleich die Stirn, um dem anderen zu zeigen, wie absurd eine solche Vorstellung war. »Sie suchen ihn auf.«
»Aber das kann ich nicht.«
»Sie müssen.«
»Halten Sie mich für einen Narren, Mr. Jupe?« Spandrel glaubte, die Umrisse einer primitiven, doch wirksamen Falle zu erkennen. »Sobald ich dieses Haus verlasse, werde ich auf der Stelle verhaftet.« Aber genau das war womöglich der einzige Zweck dieses Vorschlags.
»Nicht an einem Sonntag.«
Ein zutreffendes Argument. Am Sabbat konnte kein Schuldner verhaftet werden. Einmal jede Woche durfte Spandrel die Freiheit schnuppern, wenn er an diesem Tag als freier, wenn auch mittelloser Mann durch die Straßen Londons spazierte. Gelegentlich ließ er die Stadtgrenzen hinter sich und lief bis ins Land hinaus, doch nie so weit, dass er bis zum Abend nicht mehr heimkehren konnte. Um seinen Hals war eine unsichtbare Leine gebunden, und die zerrte ihn stets zurück.
»Sir Theodore wird Sie empfangen.«
»Gern.«
»Neun Uhr, Sonntagmorgen. In seinem Haus am Hanover Square.«
»Ich werde kommen.«
»Halten Sie sich daran, Mr. Spandrel. Und seien Sie pünktlich. Sir Theodore schätzt Zuverlässigkeit.«
»Gibt es irgendetwas … das ich mitbringen soll?«
»Bringen Sie sich selbst. Das ist alles, was Sir Theodore benötigt.«
»Aber … warum? Was kann ich denn schon …?«
»Keine weiteren Fragen«, unterbrach ihn Jupe in scharfem Ton, sodass seine Stimme jäh den ganzen Raum füllte. Dann sank sie wieder zu ihrer normalen Stärke ab. »Sie erhalten Ihre Antworten am Sonntag. Mögen sie Ihnen helfen.« Spandrel wusste nicht, ob er angesichts dieser Vorladung zu einem persönlichen Gespräch mit Sir Theodore Janssen sich freuen oder eher beunruhigt sein sollte. Gerade als er am wenigsten damit gerechnet hatte, tat sich ihm ein Ausweg aus all seinen Problemen auf. Andererseits könnte er ihn in noch größeres Ungemach führen. Die Sache musste einen Haken haben. Menschen vom Schlag eines Sir Theodore Janssen überschütteten seinesgleichen nicht einfach mit Wohltaten. Das lag nicht in der Natur der Dinge. Jedenfalls nicht in der Natur von Handelskönigen.
Leichtsinn und Selbstüberschätzung hatten Spandrels Vater in die Schulden gestürzt. Bei der Ausstattung für sein neues Projekt hatte er stets auf dem Teuersten und Besten bestanden: brandneue Theodoliten, Wegemesser und Maßketten, von denen ihnen nichts geblieben war – der Wegemesser vor dem Kamin war so alt, dass sogar die Gerichtsbüttel die Nase gerümpft hatten. Mögliche Kunden hatte er üppig bedient und nie an Speisen und Getränken gespart, wenn er ihnen die Erhabenheit und Genauigkeit seiner Karte erläuterte, und er hatte mit Geld um sich geworfen wie ein Bauer im Frühling mit dem Saatgut. Doch geerntet hatte er nichts außer gebrochenen Versprechen und unbezahlten Rechnungen. Und alles, was Spandrel von ihm geerbt hatte, war die Mentalität eines Kartenzeichners und ein Schuldenberg, der durch Zinsen und Zinseszinsen auf mehrere hundert Pfund angewachsen war.
Genauso gut hätte Spandrel davon träumen können, durch das Fenster zu fliegen und die Stadt vom Himmel aus zu vermessen, wie davon, durch eigene Arbeit einen solchen Betrag zu verdienen. Doch irgendeine Art von Verdienst musste das sein, was ihm Sir Theodore offenbar anbieten wollte. Warum? Und was musste er dafür tun? Was konnte er schon bieten, das so viel wert sein sollte? Das ergab einfach keinen Sinn.
Doch natürlich würde er am Sonntag zum Hanover Square gehen. Er würde sich dort einfinden, und ob ihm das, was Sir Theodore von ihm verlangte, gefiel oder nicht, er würde es annehmen. Er hatte keine Wahl. Doch das bedeutete nicht, dass er keine Bedenken hatte. Die Hoffnung war wieder erwacht, aber der Zweifel leistete ihr Gesellschaft.
Als Margaret Spandrel später am Vormittag mit Schmutzwäsche beladen zurückkehrte, starrte ihr Sohn durch das Fenster auf eine Szenerie hinaus, die ihnen beiden so vertraut geworden war, dass es eigentlich völlig müßig war, sich damit abzugeben. Und weil sie ohnehin schon müde war, ärgerte sie sich sogleich maßlos über diese scheinbare Teilnahmslosigkeit.
»Kein frischer Tee, um mich willkommen zu heißen?«, fragte sie. »Sag bloß, du hast die ganze Zeit vor dich hin geglotzt wie ein Mondkalb, während ich weg war?«
»Ich habe nachgedacht«, entgegnete Spandrel.
»Nachgedacht?« Mrs. Spandrel war eine warmherzige Frau, die ihren Mann aus Liebe geheiratet hatte. Der Lohn dafür waren fünf Kinder gewesen, von denen nur eines nicht schon in der Wiege gestorben war, ein frühes Witwendasein und bittere Armut, wie sie sie sich in ihren schlimmsten Träumen nicht hätte vors teilen können. Nachdenken war alles in allem etwas, das sie für überflüssig erachtete. »Du treibst mich noch in die Verzweiflung, Junge.«
»Bestimmt nicht, Ma.«
»Ich bin ihr schon sehr nahe, glaub’s mir. Lass uns jetzt erst mal Tee trinken, ehe wir daran gehen, diesen Haufen da zu schrubben.« Sie warf das Bündel Wäsche auf den Boden und ließ sich mit einem tiefen Seufzer in den Stuhl vor dem Kamin sinken. »Dabei kannst du mir dann erzählen, wer unser geheimnisvoller Besucher war.«
»Wir hatten keinen Besuch«, widersprach William und warf ein paar Stückchen Steinkohle in das so gut wie erloschene Feuer, um das Teewasser zu erhitzen.
»Ich habe unten Annie Welsh getroffen. Sie hat gesagt, ein
Fremder wäre zu uns gekommen. Gepflegt und vornehm soll er gewesen sein.«
»Du weißt doch, was für eine Wichtigtuerin diese Frau ist.«
»Trotzdem hat sie meistens recht.«
»Hm, diesmal aber nicht.«
»Willst du etwa behaupten, sie hätte das erfunden?«
»Nein, aber er muss wohl jemand anderen besucht haben, das ist alles.« William lächelte sie an, was in letzter Zeit selten vorkam und sie jedes Mal aufmunterte. »Was könnte ein gepflegter, vornehmer Herr schon von mir wollen?«
Kapitel 3Wege und Abwege
Es darf bezweifelt werden, dass William Spandrel erraten hätte, was für einen Dienst Sir Theodore Janssen von ihm benötigte, selbst wenn er eine Fliege an der Wand des Sitzungssaals des South Sea House gewesen wäre, als am Samstag der Geheime Untersuchungsausschuss bei Kerzenlicht und gegen die Fensterscheiben prasselndem Regen mit der Befragung Robert Knights begann. Dank seiner flinken Zunge und seines wendigen Verstands war Knight den Männern, die ihn verhörten, mehr als gewachsen, aber sogar einen wie ihn konnte man auf die Dauer zermürben. Darauf jedenfalls musste der Vorsitzende Brodrick gebaut haben. Wenn die Fragen immer präziser und die Antworten immer ausweichender wurden, würde der Kern des Skandals zwangsläufig ans Licht kommen. Die Zeit arbeitete schließlich für den Ausschuss. Doch als man die Sitzung am Abend vertagte, hatten die Männer des Ausschusses noch keine Schneise durch Knights kunstvoll geflochtenes Dickicht aus Unklarheiten geschlagen. Nun, am Montag würde ihnen das ganz sicher gelingen.
Der Sonntag brach grau und frostig an, der Regen war verbraucht, die Stadt still. Spandrel hatte seine Mutter weiterschlafen lassen; er wusste, dass sie sich nicht sorgen würde, wenn sie ihn beim Aufwachen vermisste. Mit seinen Sabbatwanderungen war sie wohlvertraut. Doch an diesem Sonntagmorgen unternahm er keine Wanderung. Heute hatte er einen bestimmten Zweck und ein Ziel im Auge. So schritt er den High Holborn mit dem Schwung eines Mannes hinunter, der wusste, dass er etwas Geschäftliches zu erledigen hatte, obwohl ihm die Natur dieser Angelegenheit überhaupt nicht klar war.
Die Karte, für die sein Vater und er so viel Zeit und Mühen aufgewendet hatten, mochte nicht mehr in seinem Besitz sein, aber das gewaltige Londoner Labyrinth hatte er immer noch im Kopf; es war ihm unauslöschlich ins Gedächtnis eingeprägt. Wenige kannten dieses Geflecht so gut wie er: die Hinterhöfe, die Gärten, die Plätze, die Gassen. Er hätte ein halbes Dutzend verschlungene Wege zum Hanover Square auswählen können und sie alle blind bewältigt. So hatte es nichts mit Vorsicht zu tun, sondern mit einem Gefühl von Dringlichkeit, wenn er den kürzesten Weg die bogenförmige Broad Street hinunter vorbei an der St.-Giles-Kirche wählte. Eine Verspätung konnte er sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten.
Bald erreichte er die Tyburn Road mit ihren modernen eleganten Häusern zu seiner Linken und offenen Feldern, unterbrochen von Baustellen, auf der rechten Seite. Hier war die äußerste Stadtgrenze, wo neues Geld bereits seine Fangarme zum Land hin ausgestreckt hatte. Doch die Katastrophe mit der South Sea Company hatte diese Fangarme abgeschnitten. Die Bauarbeiten ruhten. Die halb fertigen Häuser rechts von ihm würden vielleicht nie vollendet. Seinem Vater hatten mehrere potenzielle Kunden versichert, dass sie hier bald bis hinunter zum Hyde Park im Westen ein wahres Geflecht von Straßen zu kartographieren haben würden. Doch auf den Weiden hinter der Bond Street grasten nach wie vor Pferde und Rinder und würden dort auch bestimmt noch viele Jahre bleiben.
Der Hanover Square war sowohl der End- als auch der Glanzpunkt dieser so jäh beendeten Bauarbeiten. Hier hatten sich viele Begünstigte des neuen Monarchen eine prunkvolle Residenz gewählt, unter ihnen auch Sir Theodore Janssen. Ob ihn die Herzoge und Generäle jetzt immer noch als Nachbarn haben wollten, war allerdings fraglich. Ja, es bestand durchaus die Möglichkeit, dass er ihnen peinlich geworden war. Das wiederum tröstete Spandrel ein wenig, als er sich der Tür des großen Mannes näherte und den Klopfer gegen das Holz dröhnen ließ.
Jupe öffnete ihm, und zwar so schnell, als ob er unmittelbar hinter der Tür gewartet hätte. Zunächst sagte er kein Wort, sondern musterte Spandrel von oben bis unten, als überlegte er, ob seine Kleider wirklich das Beste waren, was er für einen Besuch bei einer derart vornehmen Persönlichkeit hatte finden können. (Tatsächlich waren sie das Beste, was er für einen Besuch, egal bei wem, hatte.) In seinem Rücken in der Vorhalle begann eine Uhr neunmal zu schlagen, und so etwas wie ein Hauch von erstaunter Anerkennung flackerte über Jupes Gesicht.
Er trat einen Schritt zurück und forderte Spandrel zum Eintreten auf. Sobald er die Tür geschlossen hatte, sagte er kurz: »Hier entlang«, und führte ihn durch die Vorhalle und die Treppe hinauf. Auf den ersten Blick offenbarten vergoldete Friese und Gemälde so groß wie Banketttische Spandrel einen Eindruck von großem Reichtum, auf dem jedoch drückende Stille lastete und das Schlagen der Uhr zu einem unheilvollen Dröhnen anschwoll.
Im ersten Stockwerk wurde eine Tür geöffnet, und sie standen in einem Salon mit hohen Fenstern, die auf den Platz hinausgingen. Auch hier gab es Gemälde und dazu Mengen an Büsten und Vasen. Im Kamin brannte ein hoch loderndes Feuer – zumindest für Spandrels Begriffe, so sehr war er von allem entwöhnt, was das Nötigste zum Leben überstieg. Davor stand ein Mann in violettfarbenem Veloursumhang und Turban und nippte an einer Tasse heißer Schokolade. Er war klein und breitschultrig und von sichtlich vorgerücktem Alter, verriet jedoch keinerlei Gebrechlichkeiten. Wenn er verzweifelt war, ließ er es sich nicht anmerken. Sir Theodore Janssen hatte nicht umsonst eine Aura stiller Autorität bis zur Perfektion kultiviert.
»Mr. Spandrel«, sagte er schlicht und reichte seine Tasse Jupe, der wortlos damit hinausging. »Ich kannte Ihren Vater.«
»Er hat oft von Ihnen gesprochen, Sir Theodore.«
»Wirklich? In welcher Form, wenn ich fragen darf? Als vornehmer Gönner oder als gnadenloser Peiniger?«
»Es behagte ihm nicht, Schulden zu haben.«
»Das behagt keinem Menschen, Mr. Spandrel. Und doch haben Sie diese Bürde auf sich genommen, um Ihrem Vater die Einkerkerung zu ersparen.«
»Ich hatte keine andere Möglichkeit.«
»Manche Söhne hätten diese Sichtweise nicht geteilt.«
»Vielleicht nicht.«
»Jupe sagt mir, dass es Ihrer gegenwärtigen Unterkunft … an den meisten Annehmlichkeiten mangelt.«
»Sie ist nicht der Hanover Square.«
»Nein. Und auch nicht das Gefängnis in der Fleet Street. Immerhin ein Trost für Sie.«
»Immerhin.«
»Aber ich habe Sie nicht geholt, um Ihnen Trost zu spenden.«
»Weshalb haben Sie mich geholt, Sir Theodore?«
»Für Geschäfte, ja? Nun gut, es geht um das Geld, das Sie mir schulden, Mr. Spandrel.«
»Ich kann es Ihnen nicht zurückzahlen.«
»Nicht mit Münzen, nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, dass Sie es sehr wohl auf eine andere Art zurückzahlen können.«
»Wie?«
»Indem Sie für mich bei einer vertraulichen Transaktion als Bote auf treten.«
»Als … Bote?«
»Ein bestimmter Gegenstand muss an einen mir gut bekannten Herrn in Amsterdam überbracht werden. Und dafür benötige ich jemanden Vertrauenswürdigen.«
»Mich?«
»Ganz recht.«
»Aber … warum?« Selbst wenn er es versucht hätte, Spandrel hätte seine Verwirrung nicht überspielen können. Die Schlichtheit dieser Aufforderung bestürzte ihn irgendwie mehr, als wenn Sir Theodore von ihm verlangt hätte, einen Konkurrenten zu ermorden. »Für diese Art von Botengängen haben Sie doch gewiss eigene Bedienstete. Warum schicken Sie nicht einfach Mr. Jupe?«
»Ich habe meine Gründe. Und Sie brauchen sie nicht zu kennen. Ja, je weniger Sie wissen, desto besser. Ich werde Ihre Schulden bei mir streichen, sobald Sie mir die schriftliche Bestätigung vorlegen, dass der Gegenstand sicher überbracht worden ist. Das ist alles, was Sie zu wissen brauchen. Nehmen Sie meine Bedingungen an?«
»Mr. Jupe hat auch meine Schulden bei anderen Parteien erwähnt.«
»Es gibt keine anderen Parteien. Ich habe all Ihre Schulden gekauft. Ich bin Ihr einziger Gläubiger, Mr. Spandrel. Lassen Sie sich nebenbei gesagt sein, dass Ihre Schulden mich außerordentlich billig kamen. Keiner hat geglaubt, dass sie ihm je zurückgezahlt würden. Aber keiner dürfte bei der Art ihrer Begleichung so flexibel wie ich sein.«
»Und um sie abzuzahlen, brauche ich nur als Ihr Bote aufzutreten?«
»Ja. Das ist alles.«
»Und nur zu diesem einen Anlass?«
»Nur zu diesem Anlass.«
»Das ist sehr großzügig von Ihnen.« Das war es allerdings, verdächtig großzügig. Wie konnte Spandrel sich sicher sein, dass nicht weitere, schwerere Dienste von ihm verlangt würden, sobald er sich bei der Bewältigung dieser so einfachen Aufgabe als nützlich erwiesen hatte? Die unausweichliche Antwort lautete, dass er nicht sicher sein konnte.
»Sie werden sich zweifellos fragen, welche Garantie Sie bekommen, dass diese Bedingungen wirklich eingehalten werden.« Es schien Sir Theodore leicht zu fallen, Spandrels Gedanken zu lesen. »Nun, Sie haben mein Wort.«
»Versetzen Sie sich in meine Lage, Sir Theodore. Würden Sie es als … ausreichend empfinden?«
»Ihre Lage, Mr. Spandrel, ist die eines Mannes, der nichts zu verlieren hat und sich kein Feilschen leisten kann. In Ihrer Lage würde ich jede Garantie als ausreichend betrachten.« Sir Theodore hob die Hand, um Einwände von vornherein abzuwehren, auch wenn Spandrel weit davon entfernt war, sich auch nur einen vorzustellen. »Ich muss Ihnen einen Gegenstand von einigem Wert anvertrauen und dazu das Geld, das Sie für die Reise nach Amsterdam benötigen. Sie Ihrerseits müssen das Vertrauen haben, dass ich Sie zur Belohnung für Ihre Mühen von Ihren Schulden entbinde. Sie könnten fliehen. Aber die Rücksicht, die Sie auf Ihren Vater genommen haben, verrät mir, dass Sie Ihre Mutter nicht leichtfertig im Stich lassen würden. Ich könnte mein Wort brechen. Aber wozu? Ich habe nichts davon, wenn man Sie ins Gefängnis wirft. Allerdings könnte ich sehr wohl von Ihrer Dankbarkeit profitieren. Die Karte Ihres Vaters betrachte ich nach wie vor als lohnenswertes Geschäft, und nur Sie können Sie vervollständigen. Ich habe keinerlei Absicht, Sie daran zu hindern. Wenn Sie das tun, wer weiß, ob wir nicht vielleicht einmal in der Lage sind … orthodoxere Geschäfte miteinander zu tätigen.« Sir Theodore lächelte. »Wir alle nehmen ein Risiko auf uns, Mr. Spandrel, an jedem Tag, an dem wir leben. Das Risiko, zu dem ich Sie auffordere, ist doch nicht zu groß, oder?«
»Wahrscheinlich nicht.«
»Willigen Sie also ein?«
»Ja, ich willige ein.« Spandrel verbiss sich gerade noch den Zusatz, dass er eigentlich keine andere Wahl hatte.
»Schön.« Sir Theodore ging an ihm vorbei zu einem Tisch in der Mitte des Raums. Spandrel sah, dass eine alte Ledertasche darauf lag. Sir Theodore stellte sie auf und öffnete den Riemen. »Das ist der Gegenstand, den Sie für mich überbringen sollen.«
Spandrel trat näher heran. In der Tasche befand sich eine Depeschenkassette aus kastanienbraunem Leder mit Messingbeschlägen, Verschlüssen und einem Schloss.
»Diese Kassette überbringen Sie Mijnheer Ysbrand de Vries persönlich in sein Haus in Amsterdam. Er lebt an der Herengracht in der Nähe des Zentrums. Es wird Ihnen nicht schwer fallen, das Haus zu finden. Mijnheer de Vries ist wohl bekannt. Er wird Sie erwarten. Sie werden von ihm eine Bestätigung erhalten und damit zu mir zurückkehren.«
»Ist das alles?«
»Ja. Die Kassette ist verschlossen, Mr. Spandrel, und der Schlüssel bleibt bei mir. Haben Sie verstanden?«
»Ja.«
»Mijnheer de Vries ist ungefähr in meinem Alter. Wir sind alte Freunde. Es darf keinen Fehler bezüglich der Person geben, der Sie die Kassette übergeben. Sie werden ihm sagen, dass Sie angewiesen wurden, ihn zu bitten, sich an das dritte Mitglied der Gruppe zu erinnern, das ebenfalls dabei war, als wir uns kennenlernten. Er wird Ihnen den Namen Jakob van Dillen nennen. Haben Sie ihn sich gemerkt?«
»Jakob van Dillen«, wiederholte Spandrel.
»Van Dillen ist längst tot. Ich möchte bezweifeln, dass außer mir und Ysbrand de Vries noch jemand lebt, der sich an ihn erinnert. Und nun natürlich auch Sie.«
»Ich werde ihm die Kassette nur geben, wenn er den Namen van Dillen weiß.«
»Sehr gut.«
»Wann soll ich abreisen?«
»Sofort.«
»Aber vorher muss ich mit meiner Mutter sprechen.«
»Das ist nicht nötig. Schreiben Sie ihr eine Nachricht. Sagen Sie, dass Sie ungefähr eine Woche lang weg sein werden, aber nennen Sie nicht den Grund. Jupe wird den Brief überbringen und ihr versichern, dass wirklich kein Grund zur Sorge besteht.«
»Bestimmt …«
»So und nicht anders wird es sein, Mr. Spandrel. Setzen Sie sich und schreiben Sie die Nachricht. Feder und Papier liegen bereit.«
Ehe Spandrel so recht wusste, wie ihm geschah, saß er am Tisch und kritzelte ein paar Worte, die ihm völlig nichts sagend vorkamen und seine Mutter, wie er wusste, vor ein unlösbares Rätsel stellen würden. Sir Theodore stand hinter ihm und wartete darauf, dass er endlich fertig wurde.
»Das genügt.« Die Unterschrift war noch nicht trocken, als ihm Sir Theodore Spandrel den Brief unter den Fingern wegzog. »Das können Sie bei mir lassen. Nun zur Reise. Sie werden in meiner Kutsche zum Kai an den Hungerford Stairs gefahren, wo meine Fähre Sie erwartet, um Sie nach Deptford zu bringen. Das Segelschiff Vixen wird mit der Nachmittagsflut nach Helvoetsluys auslaufen. Ihre Überfahrt ist bezahlt. Für Ihre weiteren Ausgaben …« Sir Theodore ging zu einem Pult, das in einer Ecke stand, und kehrte mit einem prall gefüllten Umschlag zurück. »Das dürfte genügen.«
»Danke.« Spandrel steckte den Umschlag ein, ohne den Inhalt anzusehen. Das Gewicht der Münzen verriet ihm bereits, dass das Geld, wie Sir Theodore gesagt hatte, genügen würde. »Ich … äh … hatte immer gedacht, die kürzeste Überfahrt nach Holland sei von Harwich aus.«
»Ich wusste nicht, dass Sie ein erfahrener Reisender sind, Mr. Spandrel.«
»Das … bin ich nicht.«
»Waren Sie schon einmal in Holland?«
»Nein.«
»Hand aufs Herz: Haben Sie dieses Land je verlassen?«
»Nein.«
»Dann lassen Sie die Reisevorkehrungen von jemandem treffen, der weit entfernt von diesen Gestaden geboren wurde. Sie werden im Laufe des morgigen Tages in Helvoetsluys eintreffen. Von dort dürfte die Weiterfahrt nach Amsterdam nicht länger als zwei Tage dauern. Mijnheer de Vries wird Sie am Mittwoch erwarten. Sollten unvorhergesehene Schwierigkeiten auf treten, wenden Sie sich an meinen Bankier in der Stadt – das Bankhaus heißt Pels. Aber tun Sie das nur im äußersten Notfall. Es wäre besser, viel besser, wenn Sie jeglichen Schwierigkeiten aus dem Weg gingen und bald zurückkehrten, um Ihre Belohnung zu erhalten.«
»Nichts anderes habe ich vor, Sir Theodore.« Spandrel schnallte die Tasche zu und legte die Hand darauf. »Sie können sich auf mich verlassen.«
»Hoffentlich«, erwiderte Sir Theodore, ohne zu lächeln.
Spandrel schwirrte der Kopf, als er das Haus am Hanover Square verließ. Nach Monaten des elenden Daseins, von der Hand in den Mund zu leben, hatte er jetzt auf einmal Geld in der Tasche und wurde in einer gut gefederten Kutsche von einem livrierten Lakaien durch London gefahren. Das war fast zu schön, um wahr zu sein. Dann wieder tröstete er sich damit, dass bestimmte Dinge eben schön und wahr waren. Vielleicht gehörte diese Angelegenheit hier dazu.
Mit Maria Chesney verhielt es sich gewiss ebenso. Bei seiner letzten Begegnung mit Sam Burrows, dem geschwätzigen Diener der Chesneys, in Sams Stammkneipe an den Sonntagen, hatte er erfahren, dass Maria immer noch nicht verlobt war. Das hatte Spandrel so interpretiert, dass ihr Herz nach wie vor ihm gehörte, was seine Niedergeschlagenheit freilich nur verschlimmert hatte, weil ihr Vater sich kategorisch weigerte, Marias Hand einem Schuldner zu geben. Aber jetzt war er ja bald kein Schuldner mehr. Vielleicht konnte er mit Sir Theodores großzügiger Hilfe die Karte von London vervollständigen und einen erfolgreichen Handel damit beginnen. Und vielleicht ließ sich Chesney doch noch bewegen, ihn als Schwiegersohn anzuerkennen.
Obwohl er wusste, wie unklug das war, ließ sich Spandrel solcherlei Gedanken zu Kopfe steigen. Niedergeschlagenheit hatte er wirklich im Übermaß gekostet. Da konnte er – wenigstens für heute – dem Geschmack eines süßeren Getränks nicht widerstehen.
Jupe überbrachte umgehend Spandrels Brief an dessen Mutter, wenn auch wortkarg. Bis auf die Versicherung, dass ihr Sohn sich während seiner Abwesenheit außerhalb des Gerichtsbezirks Middlesex befinden würde und darum nicht verhaftet werden könne, sagte er ihr nichts und war schon wieder verschwunden, noch ehe sie Williams wenige Zeilen gelesen hatte. Ihnen war nicht mehr zu entnehmen, als dass sie sich nicht zu sorgen brauche, was sie natürlich trotzdem tat, zumal Annie Welsh ihr versicherte, dass Jupe ganz bestimmt der Mann war, der am Freitagmorgen hier gewesen war. Folglich hatte William sein Verschwinden seit dem Tag – wenn nicht schon länger – geplant. So viel schien klar. Aber sonst überhaupt nichts. Und solange sie keine Gewissheit hatte, würde sie kaum noch etwas anderes kennen als Sorgen. Vor Annie gab sie sich aber dennoch forsch. »Allein schon um dieses Jungen willen«, verkündete sie, »möchte ich hoffen, dass er eine gute Entschuldigung dafür hat, dass er seine alte Mutter im Stich gelassen hat.«
Ob seine Mutter seine Entschuldigung für gut oder schlecht halten würde, kam Spandrel überhaupt nicht in den Sinn, als Sir Theodores Boot sich unter bleigrauem Mittagshimmel dem Kai von Deptford näherte und neben der Vixen anlegte. Bereits während der Fahrt die Themse hinunter war seine Zuversicht der Ernüchterung gewichen, weil die Seemänner kein einziges Wort mit ihm gesprochen, untereinander aber ständig unverständliche Bemerkungen und viel sagende Blicke gewechselt hatten. Er war durchgefroren und hungrig und würde bald fern der Heimat sein. Was mochte sich in der Kassette befinden? Er wusste es nicht und wollte es nicht wissen. Wenn alles gut ging, würde er es nie erfahren. Und wenn nicht alles gut ging …
Warum hatte Sir Theodore gerade ihn ausgewählt? Und warum hatte er ihn nicht über Harwich geschickt? Fragen über Fragen, doch keine Antworten. Außer einer: Er musste es hinter sich bringen; er hatte keine Wahl.
Wahrscheinlich hätte sich an Spandrels Schlussfolgerung auch dann nichts geändert, hätte er gewusst, dass am selben Tag noch jemand anderes den Ärmelkanal überqueren würde, der kürzlich ebenfalls Sir Theodore Janssen in dessen Haus aufgesucht hatte. Wie er war auch Robert Knight im Begriff, das Land zu verlassen, und ging gerade in Dover für die kurze Fahrt nach Calais an Bord eines privat angemieteten Segelschiffs. Wenn am Montagmorgen der Untersuchungsausschuss zur Fortsetzung seiner Ermittlung wieder im South Sea House zusammentrat, sollte er sich des Objekts der Überprüfung beraubt sehen.
Kapitel 4Die Mission des Kartenzeichners
Unter anderen Umständen hätte Spandrel seine Reise nach Amsterdam wahrscheinlich genossen, zumal sich bei der stürmischen Überfahrt auf der Vixen zu seiner Überraschung erwies, dass er nicht an der Seekrankheit litt. Mit seinen Sorgen verhielt es sich indes ganz anders. Erst wenn er de Vries die Kassette ausgehändigt hätte, würde er in den Betrachtungen und Aufregungen des Reisens schwelgen können. Bis dahin aber konnte er nur hoffen, dass die Meilen und Tage schnell vorüberzogen.
Er versuchte, für sich zu bleiben, doch ein geschwätziger Kachelhändler aus Sussex namens Maybrick überwand in der Passagierskajüte der Vixen seine Gegenwehr und bestand darauf, ihn von Helvoetsluys, wo sie am Montagnachmittag anlegten, bis nach Rotterdam zu begleiten. Maybrick gegenüber gab sich Spandrel als das aus, was er so gerne gewesen wäre: ein Kartenzeichner, der vorhatte, seine Fähigkeiten den großen Städten der Vereinigten Provinzen zur Verfügung zu stellen.
An und für sich hatte er keinen Grund, sich allzu sehr über Maybrick zu ärgern, denn dieser Bursche nahm ihn zu einem nicht nur gemütlichen, sondern auch billigen Gasthof mit. Außerdem erfuhr er so, wie klug es von ihm gewesen war, dass er die Überfahrt von Harwich vermieden hatte, allein schon weil einem die Wirte in Essex so viel Geld abknöpften.
Trotzdem war Spandrel darüber erleichtert, die Reise am nächsten Morgen allein mit einem der Trekschuits fortzusetzen, Barken, die von Pferden durch die Kanäle gezogen wurden, die sich durch winterkahle flache Felder wanden. Regen verschiedenster Heftigkeit zwischen Niesei und Wolkenbruch fiel von der weiten grauen Himmelskuppel herab, und der Trekschuit glitt gemächlich voran. In der Eiseskälte des frühen Abends setzte er schließlich neun Stunden später seine Passagiere in Haarlem ab, alle todmüde und wie Spandrel völlig benebelt, nachdem er in diesen neun Stunden bis auf wenige Minuten in der Enge der Kabine unablässig den Pfeifenrauch anderer hatte einatmen müssen.
Doch von Haarlem nach Amsterdam waren es nur noch drei Stunden. Ausgeschlafen und frisch gewaschen, spürte Spandrel am nächsten Morgen, wie seine zerbrechliche Zuversicht zurückkehrte. Noch vor dem Ende des Tages hätte er erledigt, worum ihn Sir Theodore gebeten hatte. Nichts würde ihn aufhalten. Und nichts würde schief gehen.
Es regnete unablässig weiter. Der Trekschuit von Haarlem nach Amsterdam schien zugiger und klammer als der gestrige zu sein. Oder lag das vielleicht nur daran, dass Spandrel langsam die Geduld verlor? Die riesigen Wasserflächen, zwischen denen der Kanal durch eine mickrige Landzunge kroch, erzeugten in Spandrel die Empfindung, dass sie hinaus zu einer Insel irgendwo in der Zuider Zee reisten, obwohl er dank der Kartensammlung seines Vaters wusste, wo Amsterdam lag.
Dann endlich erreichten sie ihr Ziel, als der Kanal in den Graben, der rund um die Stadtmauer führte, mündete. Über ihnen hockten, Wachtposten gleich, mitten auf der Mauer Windmühlen mit ihren sich langsam im nasskalten Wind drehenden Flügeln. Es war früher Nachmittag, und Spandrel brannte darauf, seinen Auftrag zu erfüllen. Mit einer Großzügigkeit, an die er, wie er meinte, sich leicht gewöhnen könnte, leistete er sich am Stadttor eine Kutsche zu de Vries’ Haus. »Ik heb hast«, sagte er dem Fahrer, ein Satz, den er von Maybrick auf geschnappt hatte. »Ich habe es eilig.« Es war die reine Wahrheit. Die eleganten Häuser an der Herengracht waren alle im gleichen Stil gebaut, und wie sie so mit ihren hohen, schmalen Fassaden in einer Reihe den Kanal säumten, stellten sie einen Wohlstand zur Schau, der Spandrel restlos davon überzeugte, mitten in das Herz der Handelsgemeinde dieser Stadt getreten zu sein. Die de-Vries-Residenz, die der Kutscher anscheinend gut kannte, ähnelte zum größten Teil den benachbarten Häusern: Eine breite Treppe führte zu einem auf Höhe des Hochparterre liegenden Eingangsportal mit prächtigem Torbogen. Als er von der Straße unten hinaufstarrte, bemerkte Spandrel die aus den Speicherfenstern ragenden Balken für die Flaschenzüge. Jedes Haus hier hatte eine solche Vorrichtung. Sein Blick folgte ihnen bis um die Kanalbiegung. Plötzlich und höchst unwillkommen befiel ihn die Vorstellung, dass sie wie eine Reihe Fleischerhaken am Smithfield-Markt aussahen, die auf neue Kadaver warteten. Eilig verwarf er diesen Gedanken und erklomm die Treppe.
Ein älterer Lakai öffnete die Tür. Mit verkniffener Miene musterte er ihn von oben herab, als spürte er schon, dass Spandrel nicht bedeutend genug war, um eine respektvolle Behandlung zu verdienen. Da er offenbar kein Englisch konnte, behalf sich der Kerl mit Grimassen und Gesten. Er ließ Spandrel nicht weiter als in die mit Marmor geflieste Vorhalle herein, wo er ihm bedeutete, auf einem niedrigen Stuhl Platz zu nehmen, der von einer riesigen orientalischen Vase auf einem Gestell buchstäblich überschattet wurde.
Fünf Minuten verstrichen, exakt von einer Standuhr mit massivem Gehäuse abgemessen, der Spandrel gegenüber saß. Dann erschien ein großer dunkeläugiger Mann, ungefähr in Spandrels Alter. Er hatte einen aufmerksamen, besorgten Gesichtsausdruck und war tadellos, wenn auch schlicht gekleidet. Zugleich hatte er aber auch etwas Gelangweiltes an sich, ein seinem Rang nicht gebührendes, überhebliches Gebaren. Und in diesen tief liegenden Augen war noch etwas anderes, das Spandrel beunruhigte. Er konnte es nicht benennen, und gerade das war es, was ihn erschreckte.
»Mr. Spandrel«, begann der Mann in perfektem, wenn auch mit leichtem Akzent behaftetem Englisch, »mein Name ist Zuyler. Ich bin Mijnheer de Vries’ Sekretär.«
»Ist Mijnheer de Vries zu Hause?«
»Zu meinem Bedauern – nein.«
»Ich muss ihn sprechen. Es geht um eine Angelegenheit von äußerster Wichtigkeit.«
»Ich verstehe.« Zuyler warf einen flüchtigen Blick auf die Tasche. »Sie werden erwartet. Nur war ihre Ankunftszeit niemandem bekannt. Und Mijnheer de Vries ist ein viel beschäftigter Mann.«
»Das glaube ich gern.«
»Ich habe die Anweisung, Sie zu bitten, hier zu warten, bis ich ihn geholt habe. Er ist im Oost Indisch Huys. Das ist nicht weit von hier. Aber ich kann nicht sagen, wie … wie sehr er bei meinem Eintreffen in … Geschäfte vertieft sein wird. Trotzdem …«
»Ich warte.«
»Gut. Hier entlang bitte.«
Zuyler führte Spandrel in einen weit hinten gelegenen Raum, der eindeutig de Vries’ Bibliothek sein musste. Von oben bis unten mit schweren Bänden gefüllte Regale säumten die Wände, und die Fenster waren gegen »Schäden durch grelles Sonnenlicht« verhängt, was Spandrel angesichts des grauen Wetters als eine völlig unnötige Vorsichtsmaßnahme erschien. Da kam doch sicher mehr Licht von dem Feuer im Kamin als von der Welt hinter den Fenstern.
»Ich komme so bald wie möglich zurück«, versprach Zuyler. Im nächsten Moment war er wie vom Erdboden verschluckt. Lautlos und beängstigend schnell war er hinausgeschlüpft.
Spandrel sah sich um. Auf den oberen Regalen der Bücherschränke waren die Büsten historischer Gestalten aus der Antike aufgereiht. Prächtig eingerahmte Ölgemälde von weniger alten Persönlichkeiten – größtenteils holländische Bürger – nahmen die Fläche zwischen ihnen und der Stuckdecke ein. Über dem Spiegel in der Nähe des Kamins hing ein Gemälde von ganz anderer Art. Es zeigte ein Schloss in einer tropischen Landschaft mit von einem imaginären Wind gebeugten Palmen. Der Kamin wurde von einem Sofa und einem Sessel flankiert. Vor einem der Fenster sah man einen Schreibtisch. Ein weiterer Tisch neben einem Teil des Bücherregals bestand aus vielen Schubladen für Landkarten. Spandrel war versucht, sie herauszuziehen und sich genauer anzusehen, was sie enthalten mochten, widerstand jedoch. Er hatte nicht vor, in diesem Haus für Komplikationen zu sorgen. Im Gegenteil, er wollte so wenig wie möglich über seinen Eigentümer erfahren; und dieser Eigentümer wiederum sollte so wenig wie möglich über ihn erfahren.
Aber das war leichter gedacht als getan. Auch hier begleitete das Ticken einer Standuhr die bleiernen Minuten. Spandrel setzte sich vor das Feuer, stand wieder auf und betrachtete die Gemälde, setzte sich wieder, erhob sich erneut. Und ständig hielt er die Tasche fest in der Hand.
Zwanzig Minuten krochen dahin. Spandrel hatte kaum noch Hoffnung, dass de Vries sich auch nur für kurze Zeit von seinen Geschäften losmachen könne. Verdrießlich stand er in der Mitte des Raumes und begutachtete seine Reflexion im Spiegel. Ein so scharfes, deutliches Abbild seiner selbst hatte er seit Monaten nicht mehr gesehen. Die schweren Zeiten hatten unbestreitbar ihre Spuren hinterlassen. Er sah älter aus, seine Schultern hingen mittlerweile schlaff herunter, und wenn er seine Haltung nicht korrigierte, würde er bald dauerhaft gebückt gehen. Sogleich richtete er sich auf – mit ermutigendem Effekt. Freilich war das auch schon alles: ein Effekt. Nichts, was von Dauer sein konnte. Als hätte er sich das schon längst selbst eingestanden, ließ er die Schultern wieder sinken.
Im selben Moment ging die Tür auf, und eine dunkelhaarige junge Frau in blauem Kleid trat ein. »Entschuldigen Sie«, sagte sie mit englisch klingendem Akzent, »ich wusste nicht, dass …«
»Verzeihung, Madam.« Spandrel drehte sich zu ihr um und brachte eine Verbeugung zustande. »Ich bin aufgefordert worden, hier auf Mijnheer de Vries zu warten.«
»Dann müssen Sie vielleicht noch lange warten. Mein Mann ist im Ostindien-Haus. Ich erwarte ihn nicht vor sechs Uhr zurück.«
Verwirrt nahm Spandrel zur Kenntnis, dass diese Frau de Vries’ Gattin war. Sie konnte nicht viel älter als fünfundzwanzig sein, doch Sir Theodore hatte de Vries als einen Mann von ungefähr seinem Alter beschrieben, sodass Mrs. de Vries mindestens dreißig Jahre jünger sein musste als er. Und was das Ganze noch schlimmer machte, sie war ausgesprochen attraktiv. Zugegeben, eine klassische Schönheit war sie nicht – dafür war ihre Nase etwas zu lang und die Stirn zu breit. Aber ihre Anmut und ihr frischer Gesichtsausdruck ließen solche Überlegungen schnell in Vergessenheit geraten. Das blaue Kleid brachte ihr Haar und ihre Augen vorzüglich zur Geltung. Um ihre Lippen spielte der Ansatz eines Lächelns. Die Augenbrauen waren leicht gewölbt. Um den Hals trug sie eine einfache Perlenkette, und die Brust zierte eine Schleife aus weißem Samt. Nachdem er so lange an die weibliche Gesellschaft des Cat and Dog Yard gekettet gewesen war, hatte Spandrel ganz vergessen, wie bezaubernd die Anwesenheit einer gut gekleideten und kultivierten Frau sein konnte. Und selbst Maria Chesney hatte etwas gefehlt, das Mrs. de Vries ganz offensichtlich besaß: Vertrauen in die eigene Weiblichkeit, das ihre Ehe mit diesem griesgrämigen alten Geizhals, der de Vries, wie Spandrel urplötzlich schloss, ganz gewiss war, nicht so sehr zu einer Travestie, sondern zu einer Tragödie geraten ließ.
»Sind Sie von weit gekommen, um meinen Mann zu sprechen, Mr …?«
»Spandrel, Madam. William Spandrel.«
»Aus England vielleicht?«
»Genau.«