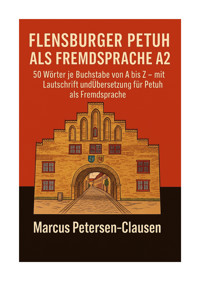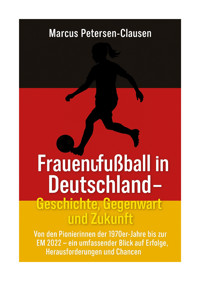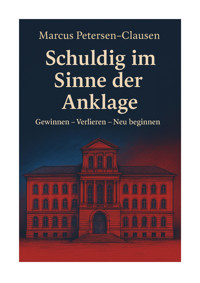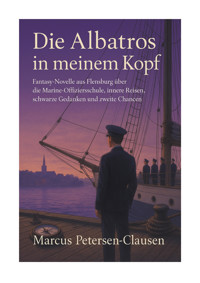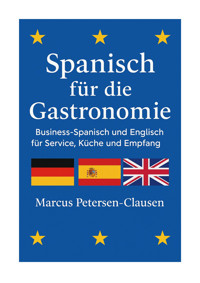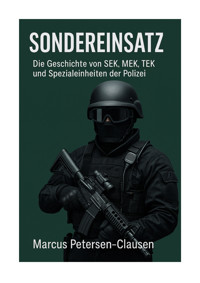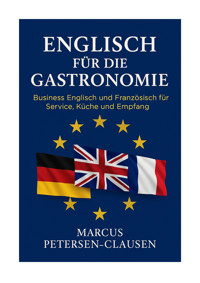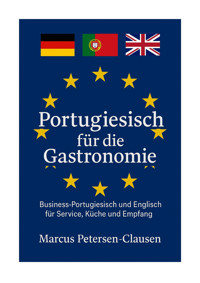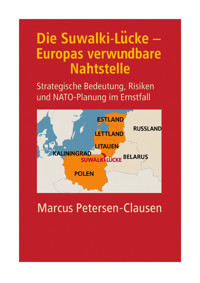
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erklärt die strategische Bedeutung der Suwałki-Lücke – einem schmalen Landstreifen zwischen Polen und Litauen – für die Sicherheit Europas. Es zeigt, warum diese Region als eine der verwundbarsten Stellen der NATO gilt, welche Bedrohungsszenarien existieren und wie die NATO ihre Verteidigung plant. Das Buch liefert fundierte Hintergründe in leicht verständlicher Sprache und macht komplexe sicherheitspolitische Themen zugänglich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Die Suwałki-Lücke – Europas verwundbare Nahtstelle
Untertitel:
Strategische Bedeutung, Risiken und NATO-Planung im Ernstfall
Vorwort:
Die Suwałki-Lücke ist ein schmaler Landstreifen zwischen Polen und Litauen, der im Falle einer Krise über die Sicherheit von ganz Osteuropa entscheiden kann. Sie verbindet die baltischen Staaten mit dem Rest der NATO. Gleichzeitig ist sie von der russischen Exklave Kaliningrad und dem mit Russland verbündeten Belarus eingekreist. Dieses Buch erklärt in klarer, gut verständlicher Sprache, was diese Lücke ist, warum sie so wichtig ist und was im Ernstfall passieren könnte. Das Buch richtet sich an alle, die verstehen möchten, warum diese Region in den Nachrichten so oft erwähnt wird und warum sie als eine der verwundbarsten Stellen Europas gilt. Sie erfahren, wie die NATO ihre Verteidigung plant, welche Herausforderungen ein möglicher Konflikt mit sich bringen würde und welche politischen und militärischen Folgen das hätte. Das Ziel dieses Buches ist es, Hintergründe verständlich zu machen und damit zur Aufklärung beizutragen.
Freundliche Grüße,
Marcus Petersen-Clausen
https://www.Köche-Nord.de
Haftungsausschluss:
Dieses Buch dient ausschließlich der allgemeinen Information. Es ersetzt keine sicherheitspolitische Beratung, keine militärische Analyse und keine offizielle Einschätzung von Regierungen oder internationalen Organisationen. Alle Inhalte basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, Recherchen und Auswertungen. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die beschriebenen Szenarien sind hypothetisch und dienen nur zur Veranschaulichung.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch wurde mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt. Marcus Petersen-Clausen verwendet in seiner Arbeit häufig KI-basierte Textgenerierung, um Inhalte zu strukturieren, verständlich aufzubereiten und in klarer Sprache zugänglich zu machen.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 – Die Suwałki-Lücke: Eine Einführung
Kapitel 2 – Geographie und Natur der Suwałki-Region
Kapitel 3 – Politische und historische Hintergründe der Suwałki-Lücke
Kapitel 4 – Kaliningrad und Belarus: Die Nachbarn der Lücke
Kapitel 5 – Infrastruktur und Nachschubrouten durch die Lücke
Kapitel 6 – Militärische Bedrohungsszenarien
Kapitel 7 – NATO-Strategien und Verteidigungspläne
Kapitel 8 – Übungen und Manöver in der Region
Kapitel 9 – Risiken und Herausforderungen für die Verteidigung
Kapitel 10 – Politische Bedeutung der Suwałki-Lücke für Europa und die Welt
Kapitel 11 – Wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen einer Krise
Kapitel 12 – Die Rolle der baltischen Staaten
Kapitel 13 – Polens Verantwortung als Schlüsselstaat
Kapitel 14 – Kaliningrad als militärische Herausforderung
Kapitel 15 – Belarus als zweiter Schauplatz
Kapitel 16 – Hybride Bedrohungen und Cyberkrieg
Kapitel 17 – Die Bedeutung der Zeit: Geschwindigkeit als Schlüsselfaktor
Kapitel 18 – Logistik und Versorgung im Ernstfall
Kapitel 19 – Luftüberlegenheit und Luftraumsicherung
Kapitel 20 – Seewege und maritime Sicherung
Kapitel 21 – Diplomatie und Abschreckung
Kapitel 22 – Die Rolle der USA und Kanadas
Kapitel 23 – Deutschlands Rolle und Verantwortung
Kapitel 24 – Kooperation mit den nordischen Staaten
Kapitel 25 – Die Rolle der Europäischen Union
Kapitel 26 – Geheimdienste und Aufklärung
Kapitel 27 – Zivile Resilienz und Bevölkerungsschutz
Kapitel 28 – Wirtschaftliche Stabilität und Versorgungssicherheit
Kapitel 29 – Psychologische Kriegsführung und Informationshoheit
Kapitel 30 – Die Bedeutung der Medien und internationaler Öffentlichkeit
Kapitel 31 – Internationale Partner und ihre Rolle
Kapitel 32 – Szenarien eines möglichen Konfliktverlaufs
Kapitel 33 – Die Rolle von Technologie und Innovation
Kapitel 34 – Historische Lehren aus vergangenen Konflikten
Kapitel 35 – Politische Entscheidungsprozesse und NATO-Bündnisfall
Kapitel 36 – Rolle der Bevölkerung und zivilgesellschaftlicher Unterstützung
Kapitel 37 – Wirtschaftliche und soziale Folgen eines langen Konflikts
Kapitel 38 – Der Einfluss globaler Mächte wie China und Indien
Kapitel 39 – Humanitäre Aspekte und internationale Hilfsorganisationen
Kapitel 40 – Der Faktor Zeit nach einem Konflikt: Wiederaufbau und Rückkehr zur Normalität
Kapitel 41 – Diplomatische Wege zur Konfliktvermeidung
Kapitel 42 – Rüstungskontrolle und Abrüstungsperspektiven
Kapitel 43 – Die Rolle internationaler Organisationen wie UNO und OSZE
Kapitel 44 – Informationskrieg und digitale Souveränität
Kapitel 45 – Resilienz durch Bildung und gesellschaftliche Aufklärung
Kapitel 46 – Die Rolle der Wirtschaft und der Industrie
Kapitel 47 – Internationale Finanzmärkte und Sanktionen
Kapitel 48 – Szenarien für eine diplomatische Lösung nach einer Eskalation
Kapitel 49 – Die Lehren für die Zukunft der NATO und Europas Sicherheit
Kapitel 50 – Schlussbetrachtung und Ausblick
Nachwort
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Was ist die Suwałki-Lücke?
Kapitel 1 – Die Suwałki-Lücke: Eine Einführung
Die Suwałki-Lücke ist eine der am meisten diskutierten Regionen Europas, wenn es um Sicherheitspolitik und strategische Verteidigungsfragen geht. Sie ist ein relativ schmaler Landstreifen zwischen Polen und Litauen. Diese Region ist etwa 65 Kilometer breit, wenn man die Luftlinie misst, und sie verbindet das NATO-Gebiet Mittel- und Westeuropas mit den baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland. Der Begriff „Lücke“ ist dabei nicht zufällig gewählt: Er betont, dass es sich um eine Engstelle handelt, die im Krisenfall eine Schwachstelle sein kann.
Geographisch liegt die Suwałki-Lücke in einem Gebiet, das stark von Wäldern, Seen und sanften Hügeln geprägt ist. Es gibt dort viele Naturschutzgebiete, kleine Flüsse und Feuchtgebiete. Die Region ist dünn besiedelt, was bedeutet, dass es nur wenige größere Städte gibt und die Infrastruktur begrenzt ist. Die Straßen- und Eisenbahnverbindungen sind vorhanden, aber nicht in großer Zahl. Genau das macht die Region strategisch so interessant: Wer diese wenigen Verbindungen kontrolliert, kann den Landweg in die baltischen Staaten offenhalten – oder blockieren.
Die Bedeutung der Suwałki-Lücke ergibt sich aus ihrer Lage zwischen zwei geopolitischen Polen. Im Westen liegt Polen, ein wichtiges Mitglied der NATO, das sich stark für die Sicherheit des Bündnisses engagiert. Im Osten liegt Litauen, das ebenfalls Teil der NATO ist, aber gemeinsam mit Lettland und Estland eine besonders exponierte Lage hat. Diese drei Staaten sind nämlich nur über diese Landverbindung direkt mit den anderen NATO-Ländern verbunden. Alles, was ihre Anbindung gefährdet, wird von der NATO deshalb sehr genau beobachtet.
Besonders brisant ist die Nachbarschaft zu zwei Regionen, die mit Russland verbunden sind. Zum einen gibt es die russische Exklave Kaliningrad, die zwischen Polen und Litauen liegt. Sie ist hoch militarisiert und dient Russland als wichtiger Stützpunkt an der Ostsee. Zum anderen liegt südöstlich der Lücke Belarus, das eng mit Russland kooperiert und in vielen Bereichen militärisch und politisch abgestimmt handelt. Damit ist die Suwałki-Lücke von zwei Seiten potenziell unter Druck: von Norden und Westen durch Kaliningrad und von Süden und Osten durch Belarus.
In sicherheitspolitischen Kreisen wird die Suwałki-Lücke deshalb oft als „Achillesferse der NATO“ bezeichnet. Damit ist gemeint, dass dieser schmale Landstreifen im Falle einer militärischen Auseinandersetzung besonders verwundbar wäre. Wenn Russland und Belarus in einem Konflikt versuchen würden, diese Region zu erobern oder zu blockieren, wären die baltischen Staaten vom restlichen NATO-Gebiet abgeschnitten. Das würde es erheblich erschweren, Truppen, Nachschub und Ausrüstung zu transportieren.
Die Suwałki-Lücke ist also weit mehr als nur eine geographische Besonderheit. Sie ist ein Symbol für die Verwundbarkeit der NATO-Ostflanke und gleichzeitig ein Schlüssel für deren Verteidigung. In diesem Buch werden wir uns mit allen Aspekten dieser Region beschäftigen: von ihrer genauen Lage über die militärischen und logistischen Herausforderungen bis hin zu den politischen Überlegungen, die mit ihr verbunden sind. Kapitel für Kapitel werden wir uns der Frage nähern, was diese Lücke für Europa bedeutet, warum sie so oft in den Schlagzeilen erscheint und welche Pläne es gibt, sie im Ernstfall zu schützen.
Kapitel 2 – Geographie und Natur der Suwałki-Region
Die Suwałki-Region gehört zu den landschaftlich reizvollsten Gegenden Polens und Litauens, auch wenn sie in der Öffentlichkeit vor allem wegen ihrer strategischen Bedeutung bekannt ist. Wer diese Region besucht, bemerkt sofort die große Weite, die von Wäldern, Feldern und Seen geprägt ist. Die Landschaft ist abwechslungsreich: sanfte Hügel wechseln sich mit flachen Niederungen ab, und zahlreiche kleine Gewässer glitzern in der Sonne. Besonders charakteristisch sind die vielen Seen der Suwałki-Seenplatte, die in der letzten Eiszeit entstanden sind. Sie machen die Gegend zu einem beliebten Ziel für Wanderer, Radfahrer und Naturfreunde – in Friedenszeiten wohlgemerkt.
Das Klima in der Suwałki-Region ist eher kühl. Sie liegt im sogenannten Kontinentalklima, was bedeutet, dass die Sommer warm, aber nicht sehr heiß sind und die Winter lang und frostig sein können. Die Temperaturen können in der kalten Jahreszeit weit unter null Grad fallen. Für das Militär ist das nicht unwichtig, denn die Jahreszeiten beeinflussen die Beweglichkeit von Fahrzeugen und Truppen. Im Sommer sind die Wege und Straßen meist gut passierbar, während im Frühjahr und Herbst Regen die Erde aufweichen und ganze Straßenabschnitte in Schlamm verwandeln kann. Im Winter wiederum kann Schnee den Transport erschweren, aber gleichzeitig bietet die gefrorene Erde auch Vorteile für schwere Panzerfahrzeuge.
Die Vegetation besteht aus Mischwäldern, in denen Kiefern, Fichten, Birken und Laubbäume wachsen. Zwischen den Wäldern finden sich weite Felder, die von kleinen Dörfern unterbrochen werden. Landwirtschaft ist ein wichtiger Teil des Lebens in dieser Region. Kleine Höfe und Felder prägen das Bild, und die Menschen hier leben in engem Kontakt mit der Natur. In den vielen Seen und Flüssen gibt es eine reiche Tierwelt, darunter Fische, Vögel und auch größere Säugetiere wie Elche und Wildschweine.
Ein wichtiger Punkt für die militärische Bedeutung ist die Infrastruktur. In der Suwałki-Region gibt es nur wenige größere Straßen, die für den Transport von schweren Militärfahrzeugen geeignet sind. Die bekannteste Verkehrsachse ist die Via Baltica, eine wichtige Straße, die von Warschau über Białystok nach Kaunas in Litauen führt. Sie ist eine der Hauptrouten, über die im Krisenfall Truppen verlegt werden könnten. Daneben gibt es Eisenbahnlinien, die jedoch nicht überall modernisiert sind. Brücken, Straßen und Gleise sind deshalb potenzielle Schwachstellen – wenn sie zerstört oder blockiert werden, kann der Nachschub ins Stocken geraten.
Hinzu kommt die Topographie: Viele Wälder und Seen können eine schnelle Bewegung großer Truppenverbände erschweren. Das kann aber auch ein Vorteil sein, wenn es um Verteidigung geht, denn das Gelände bietet viele Möglichkeiten, Bewegungen des Gegners zu beobachten, Hinterhalte zu legen und den Vormarsch zu verlangsamen.
Die dünne Besiedlung der Region bedeutet, dass es relativ wenige große Städte gibt, die geschützt werden müssten. Das kann die Verteidigung vereinfachen, bedeutet aber auch, dass es wenig Infrastruktur für die Versorgung von Soldaten gibt. In einem Konflikt müssten deshalb viele Versorgungsdepots und Feldlager aufgebaut werden, um Truppen in der Region langfristig stationieren zu können.
Die Geographie der Suwałki-Region ist also ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist sie ideal für Verteidiger, die das schwierige Gelände ausnutzen können, um Angreifer zu verlangsamen. Andererseits macht die dünne Infrastruktur es auch schwierig, schnell große Mengen an Nachschub und Truppen heranzubringen. Wer diese Region kontrolliert, hat daher einen strategischen Vorteil – und genau deshalb ist sie für die NATO wie auch für Russland von so großem Interesse.
Kapitel 3 – Politische und historische Hintergründe der Suwałki-Lücke
Um die Bedeutung der Suwałki-Lücke wirklich zu verstehen, ist es wichtig, einen Blick in die Geschichte zu werfen. Grenzen entstehen nicht zufällig, sie sind das Ergebnis von Kriegen, Verträgen und politischen Entscheidungen. Die Region, die wir heute als Suwałki-Lücke kennen, war in den letzten Jahrhunderten immer wieder Schauplatz von Grenzverschiebungen und Konflikten.
Im 19. Jahrhundert gehörte das Gebiet zu Russland, genauer gesagt zum russischen Zarenreich. Die Menschen in dieser Region waren ethnisch und kulturell gemischt: Polen, Litauer, Russen, Juden und andere Minderheiten lebten hier. Nach dem Ersten Weltkrieg änderte sich die politische Landkarte Europas grundlegend. Das russische Zarenreich zerbrach, und neue Staaten entstanden. Polen wurde wieder unabhängig, ebenso Litauen. Zwischen beiden Ländern gab es jedoch Streit um den genauen Grenzverlauf, insbesondere um die Stadt Vilnius, die damals von großer Bedeutung war.
1920 wurde das sogenannte Suwałki-Abkommen geschlossen. In diesem Vertrag einigten sich Polen und Litauen auf eine Demarkationslinie. Sie legte die Grenze fest, die in weiten Teilen noch heute gilt. Doch der Frieden war brüchig. Nur kurze Zeit später, 1939, marschierten die Sowjetunion und Deutschland in Polen ein, und die gesamte Region wurde erneut aufgeteilt – diesmal unter den Besatzungsmächten. Während des Zweiten Weltkriegs erlebten die Menschen dort schwere Kämpfe, Umsiedlungen und Verfolgungen.
Nach 1945 wurde die Landkarte Osteuropas erneut neu gezeichnet. Die Sowjetunion behielt das nördliche Ostpreußen und machte daraus die Kaliningrader Oblast, eine Exklave, die bis heute zu Russland gehört. Polen rückte westwärts, während Litauen, Lettland und Estland Teil der Sowjetunion wurden. Die Grenze zwischen Polen und Litauen war nun eine innere Grenze der Sowjetunion, die militärisch streng überwacht wurde. Die Region war abgeschottet und spielte für den Westen kaum eine Rolle.
Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 änderte sich die Situation erneut. Polen wurde unabhängig, Litauen ebenso, und beide Länder orientierten sich nach Westen. Sie traten 2004 der NATO und der Europäischen Union bei. Damit wurde aus der ehemaligen sowjetischen Grenzregion plötzlich eine Nahtstelle zwischen NATO-Gebiet und Russland. Kaliningrad blieb russisch, während Belarus eng an Moskau gebunden blieb. Die Suwałki-Lücke war nun der einzige Landweg, der die baltischen Staaten direkt mit den übrigen NATO-Staaten verbindet.
Diese Entwicklung machte die Region zu einem strategischen Brennpunkt. Militärische Planer begannen, Szenarien zu entwickeln, was passieren würde, wenn Russland versuchen sollte, die baltischen Staaten zu isolieren. Plötzlich rückte ein schmaler Landstreifen, den außerhalb der Region kaum jemand kannte, in den Mittelpunkt internationaler Sicherheitspolitik.
Heute ist die Suwałki-Lücke also nicht nur ein geografischer Begriff, sondern auch ein politisches Symbol. Sie steht für die Verwundbarkeit der NATO-Ostflanke und erinnert daran, dass die Sicherheit Europas nicht selbstverständlich ist. Jede Krise zwischen Russland und dem Westen – sei es wegen der Ukraine, der Energiepolitik oder anderer Streitfragen – wirft sofort die Frage auf, wie sicher dieser Korridor ist und wie gut die NATO auf einen möglichen Angriff vorbereitet wäre.
Kapitel 4 – Kaliningrad und Belarus: Die Nachbarn der Lücke
Wer die strategische Lage der Suwałki-Lücke verstehen möchte, muss die beiden direkten Nachbarn betrachten, die diese Region von zwei Seiten einrahmen: die russische Exklave Kaliningrad im Nordwesten und die Republik Belarus im Südosten. Beide spielen eine zentrale Rolle, wenn es um Sicherheit, Abschreckung und mögliche Konflikte in Osteuropa geht.
Kaliningrad ist eine Besonderheit. Die Region gehörte bis 1945 zu Deutschland und war unter dem Namen Königsberg bekannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet von der Sowjetunion annektiert, die deutsche Bevölkerung wurde größtenteils vertrieben, und die Stadt erhielt den Namen Kaliningrad. Heute ist die Region ein wichtiger Teil der Russischen Föderation – geografisch jedoch vom restlichen Russland abgeschnitten. Sie grenzt im Süden an Polen, im Norden und Osten an Litauen und im Westen an die Ostsee.
Diese isolierte Lage macht Kaliningrad für Russland strategisch wertvoll und gleichzeitig verwundbar. Russland hat die Region deshalb stark militarisiert. Hier befinden sich Marinebasen, Luftabwehrsysteme, Raketenstellungen und andere wichtige militärische Einrichtungen. Kaliningrad ist außerdem ein Vorposten, von dem aus Russland die Ostsee überwachen und gegebenenfalls blockieren kann. Die dort stationierten Raketen können große Teile Polens, Litauens und sogar Teile Deutschlands erreichen. Aus westlicher Sicht ist Kaliningrad daher nicht nur ein logistisches Problem, sondern auch eine ständige Quelle militärischen Drucks.
Auf der anderen Seite der Suwałki-Lücke liegt Belarus. Das Land war lange Teil der Sowjetunion und ist seit seiner Unabhängigkeit eng mit Russland verbunden. Politisch, wirtschaftlich und militärisch ist Belarus stark von Moskau abhängig. Besonders seit den politischen Unruhen im Jahr 2020 und der innenpolitischen Krise unter Präsident Alexander Lukaschenko hat sich Belarus noch stärker an Russland angenähert. Russische Truppen dürfen das Land nutzen, gemeinsame Manöver werden regelmäßig durchgeführt, und auch russische Waffensysteme sind dort stationiert.
Für die NATO bedeutet das: Sollte es zu einem Konflikt mit Russland kommen, könnte Belarus sehr schnell zum Aufmarschgebiet werden. Russische Truppen könnten von dort aus in Richtung Westen vorrücken, während gleichzeitig aus Kaliningrad Druck aufgebaut würde. Auf diese Weise könnte die Suwałki-Lücke von beiden Seiten in die Zange genommen werden. Das würde die Situation für die Verteidiger deutlich schwieriger machen, denn sie müssten nicht nur eine Front, sondern gleich zwei Fronten absichern.
Die Nachbarschaft dieser beiden Regionen macht die Suwałki-Lücke zu einem der sensibelsten Punkte auf der Landkarte Europas. Sie ist wie eine Brücke, die jederzeit von beiden Enden her bedroht werden kann. Für die NATO ist das ein ständiger Ansporn, hier wachsam zu bleiben, Truppenübungen durchzuführen und die Infrastruktur zu verbessern.
Gleichzeitig birgt diese Lage auch diplomatische Herausforderungen. Jede Bewegung von NATO-Truppen in der Nähe der Lücke wird von Russland aufmerksam registriert und oft als Provokation dargestellt. Umgekehrt betrachtet die NATO jede größere Truppenverlegung in Kaliningrad oder Belarus als potenzielle Bedrohung. Es ist also nicht nur ein militärisches, sondern auch ein politisches Gleichgewicht, das hier ständig neu austariert werden muss.
Kaliningrad und Belarus sind damit mehr als nur Nachbarn der Suwałki-Lücke – sie sind die beiden Schlüsselfaktoren, die bestimmen, ob diese Region im Frieden ruhig bleibt oder im Krisenfall zu einem Brennpunkt wird. Ihre Rolle ist entscheidend für jede strategische Planung, und sie erklären, warum dieser Landstreifen so häufig in den Fokus internationaler Berichterstattung gerät.
Kapitel 5 – Infrastruktur und Nachschubrouten durch die Lücke
Die Suwałki-Lücke ist nicht nur eine geographische Engstelle, sie ist vor allem eine logistische Herausforderung. Damit Truppen, Fahrzeuge, Munition, Treibstoff und Versorgungsgüter in die baltischen Staaten gelangen können, müssen sie über diesen schmalen Landkorridor transportiert werden. Die Infrastruktur dieser Region ist deshalb von zentraler Bedeutung. Jede Straße, jede Brücke und jede Bahnlinie spielt im Krisenfall eine strategische Rolle.
Das Rückgrat der Straßeninfrastruktur bildet die Via Baltica, eine wichtige Fernstraße, die von Warschau über Białystok nach Kaunas in Litauen führt und schließlich weiter in Richtung Riga und Tallinn. Sie ist Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes und damit eine der wenigen leistungsfähigen Straßenverbindungen zwischen Polen und den baltischen Staaten. Im Normalbetrieb reicht sie für den zivilen Verkehr aus, doch im Kriegsfall wäre sie stark belastet. Militärische Transporte benötigen Platz, und Kolonnen aus Panzern oder Lastwagen würden den Verkehr dominieren.
Neben der Via Baltica gibt es eine Reihe kleinerer Straßen, die als Ausweichrouten genutzt werden könnten. Doch diese sind oft schmal, kurvig oder nicht für schwere Fahrzeuge geeignet. In Regenzeiten verwandeln sich manche Abschnitte in schlammige Wege, die für große Militärtransporter kaum passierbar sind. Das bedeutet, dass die NATO im Ernstfall sehr genau planen müsste, welche Einheiten auf welchen Routen vorrücken, damit es nicht zu Staus und Engpässen kommt.
Auch das Eisenbahnnetz ist von Bedeutung. Es gibt einige Bahnlinien, die von Polen nach Litauen führen, doch sie sind nicht überall modernisiert. Unterschiedliche Spurweiten zwischen dem westeuropäischen und dem baltischen Schienennetz können zusätzliche technische Probleme verursachen, da Lokomotiven und Waggons nicht ohne Weiteres durchfahren können. Teilweise müssen Züge an der Grenze umgeladen oder umgespurt werden, was Zeit kostet – Zeit, die in einer Krisensituation oft nicht vorhanden ist.