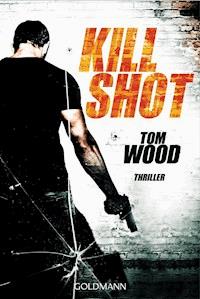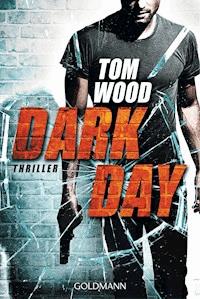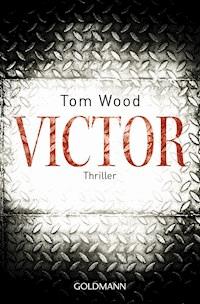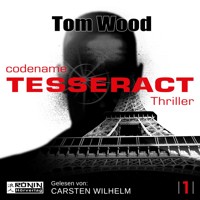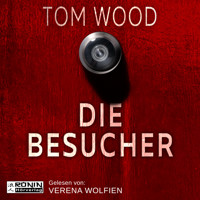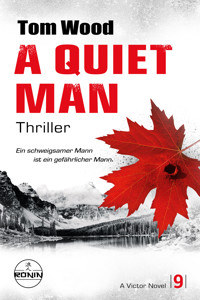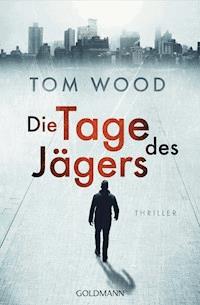
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Victor
- Sprache: Deutsch
Victor ist der perfekte Jäger. Er taucht auf, um zu töten, und verschwindet wieder, ohne Spuren zu hinterlassen. Doch jetzt wird er selbst gejagt – von einem hochrangigen Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdiensts: Antonio Alvarez ist entschlossen, den Mann zu fassen, den er für zahlreiche Morde an CIA-Agenten verantwortlich macht. Und der ihm immer entwischt ist. Als er Victor gefährlich nahe kommt, gibt es für diesen nur eine Chance: Eine brillante Auftragsmörderin, deren Leben er einst gerettet hat, soll nun seines retten. Doch dazu muss sie ihn töten …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 594
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Schon seit Jahren jagt der amerikanische Geheimagent Antonio Alvarez ein tödliches Phantom: einen Auftragskiller, den man »Victor« nennt und auf dessen Konto zahlreiche Morde gehen – auch an Kollegen von Alvarez. Alvarez’ Suche wurde von höchster Stelle stets behindert, doch er gab nie auf. Akribisch sammelte er jeden Hinweis, speicherte jede Information. Nun steht Alvarez selbst an der Spitze der CIA und hat die Macht, nach Victor zu suchen und ihn zur Strecke zu bringen. Doch Victor ist abgetaucht. In jüngster Zeit hatte er Gefühle bei der Arbeit zugelassen. Er hat Fehler gemacht. Und er weiß, dass Alvarez eine echte Gefahr für ihn ist. Victor bleibt nur eine Chance: Er muss dorthin fliehen, wohin niemand ihm folgen kann – in den Tod. Doch um seine eigene Ermordung vorzutäuschen, braucht er Hilfe. Da kommt es ihm gelegen, dass eine Kollegin – die brillante Auftragskillerin Raven – ihm noch einen Gefallen schuldet. Victor hatte ihr einst das Leben geschenkt. Jetzt soll sie sich revanchieren, indem sie ihm seines nimmt …
Weitere Informationen zu Tom Wood
sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
TOM WOOD
Die Tage des Jägers
Thriller
Aus dem Englischen
von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
»The Final Hour« bei Sphere,
an imprint of Little, Brown Book Group, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung April 2018
Copyright © der Originalausgabe 2017
by Tom Hinshelwood
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagfoto: Mark Owen / Trevillion Images
Redaktion: Gerhard Seidl
AB • Herstellung: kw
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-21307-7V002
www.goldmann-verlag.de
Kapitel 1
Der Priester war nicht besonders groß, und durch seine gebückte Haltung wirkte er noch kleiner, als er in Wirklichkeit war. Trotzdem strahlte er viel Würde aus, besonders wenn er sprach. Mit seiner tiefen Stimme erreichte er ohne Mühe auch die hinteren Sitzbänke. Er bekam oft zu hören, dass er nicht flüstern konnte. Für seine Predigten war das eine sehr hilfreiche Eigenschaft, für die Beichte jedoch weniger. Er versuchte, diesen Makel wettzumachen, indem er sich dabei die linke Hand vor den Mund hielt. So schaffte er es zumindest einigermaßen, den Mantel der Vertraulichkeit über die Sünden seiner Gemeindemitglieder zu breiten.
Der reuige Sünder saß bereits im Beichtstuhl und wartete geduldig, so regungslos und leise, dass der Priester ihn fast nicht bemerkte. Er beschloss, die Ungeduld des Büßers unerwähnt zu lassen, aber eigentlich hätte er draußen warten müssen, bis der Priester bereit war, ihm die Beichte abzunehmen. Keine große Sache, dennoch würde er versuchen, das am Schluss noch anzusprechen. Gute Manieren, das jedenfalls stand fest, rangierten auf Platz drei, nur knapp hinter Gottgefälligkeit und Reinlichkeit.
Er wusste, dass es nicht richtig war, aber ungeachtet dessen fing er unwillkürlich an zu spekulieren, wer wohl der arme Sünder sein mochte, der es so eilig hatte. Der Priester kannte eigentlich so gut wie jeden hier in der Gegend mit Namen und an der Stimme. Es waren alles anständige Leute, trotzdem sündigten sie in Gedanken und mit Taten, so wie alle anderen auch. Als junger Mann hatte er in kleinen und größeren Städten seinen Dienst versehen und dabei Geständnisse zu hören bekommen, die ihm die Schamröte ins Gesicht getrieben oder ihm vor Entsetzen den Atem geraubt hatten. Doch die Vergehen, die ihm hier normalerweise gebeichtet wurden, nannte er insgeheim nur »Babysünden«. Die Menschen hatten lüsterne Sehnsüchte, begingen allerdings keinen Ehebruch. Sie empfanden Neid, ohne aber etwas zu stehlen. Manchmal ließen sie sich vom Zorn hinreißen, gebrauchten jedoch höchstens die Fäuste. Es waren einfache Menschen, und jetzt, wo er alt war, genoss er das einfache Leben, das er sich gemeinsam mit ihnen aufgebaut hatte. Der Priester war beliebt, weil er am Whiskey ebenso großen Gefallen fand wie die Dorfbewohner auch, und weil er ihnen nicht mehr Ave-Marias aufbrummte, als sie verkraften konnten.
Die Kirche stand auf einem niedrigen Hügel mit Blick über das Dorf, und zwar an der südwestlichen Spitze Irlands, im County Cork. Es war ein kleiner, einsam gelegener Ort. Die einzige öffentliche Verkehrsverbindung war der Bus, der einmal am Tag nach Cork und wieder zurück fuhr. Nach der bescheidenen Meinung des Priesters war es ein sehr hübscher Ort, bewohnt von Menschen, die den Herrn und den Whiskey gleichermaßen liebten. Ein Ort, in dem es vier Geschäfte und vier Pubs gab. Die Kirche war Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet worden und stand immer noch groß und mächtig an Ort und Stelle, ein prachtvolles Bauwerk, auch wenn sie erheblich mehr Platz bot, als nötig gewesen wäre. Der Fußboden des Kirchenschiffs bestand aus aquamarinblauen, weißen und blassgrünen Fliesen, die Wände waren weiß und die Dachbalken von vielen dunklen Flecken überzogen. Die einfachen Kirchenbänke hätten eigentlich gründlich abgeschmirgelt und frisch lackiert werden müssen, aber wer hatte schon das Geld für solch nichtigen Tand? Gewidmet war sie Unserer Lieben Jungfrau Maria sowie dem heiligen Patrick.
Der Beichtende sagte: »Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte liegt genau ein Jahr zurück.«
Diese präzise Angabe ließ den Priester aufhorchen. Die anderen Beichtenden benutzten in der Regel etwas allgemeinere Formulierungen, um ihre Verfehlungen abzumildern. Ein paar Tage bedeuteten eine Woche. Eine Woche bedeutete zehn Tage. Ein paar Wochen waren ein Monat. Ein Jahr bedeutete achtzehn Monate. Eine lange Zeit bedeutete mehrere Jahre. Und »Ich kann mich nicht erinnern« stand für ein ganzes Leben. Der Priester betrachtete Präzision als hohes Gut, darum schätzte er jeden Mitmenschen, der es ebenso hielt.
Der Sprecher war kein Ire, und das war ungewöhnlich. Der Beichtende hatte, um genau zu sein, eigentlich überhaupt keinen Akzent, falls so etwas überhaupt möglich war.
Jedes seiner Worte war wohlartikuliert, die Aussprache perfekt, aber ohne jede Betonung, vollkommen monoton. Ein Engländer vermutlich, aber einer, der viel auf Reisen war und mehrere Sprachen sprach, der alles typisch Englische aus seiner Aussprache getilgt hatte. Der Priester gab sich gerne solchen Spekulationen hin, wenn er mit Fremden zu tun hatte. Das kam zwar heutzutage nur noch selten vor, aber früher hatte er damit viele gute Erfahrungen gemacht. Der Engländer war zweifellos hier, um das ländliche Irland kennenzulernen – das Irland der Postkarten und der Folksongs.
Die Trennwand des Beichtstuhls gewährte zwar eine gewisse Vertraulichkeit, aber keine völlige Geheimhaltung. Daher konnte der Priester den Büßer – einen dunkelhaarigen Mann in einem grauen Anzug – durch das Gitterwerk hindurch erkennen.
Dann sagte er: »Sag mir, welches deine Sünden sind, mein Sohn.«
»Ich habe viele Menschen ermordet.«
Der Priester zeigte sich unbeeindruckt. »Soll das vielleicht ein Scherz sein? Falls ja, dann ist er weder witzig noch besonders originell. Du vergeudest damit ja nicht nur meine Zeit, sondern hinderst mich und die ganze Gemeinde daran, uns um die wirklich Bedürftigen kümmern zu können.«
»Ich versichere Ihnen, es ist kein Scherz.«
»Nun denn«, sagte der Priester und machte sich gefasst auf das, was kommen sollte.
Seit er hier in der Wildnis tätig war, war ihm so etwas nicht mehr passiert, aber früher, in dichter besiedelten Gegenden, hatte er immer wieder einmal mit einem von diesen Durchgeknallten zu tun gehabt. Manch reuiger Sünder war am Rande des Wahnsinns oder schon komplett übergeschnappt gewesen. Diese Menschen hatten unvorstellbare Verbrechen gestanden, weil sie Aufmerksamkeit gesucht hatten oder tatsächlich überzeugt gewesen waren, dass sie diese Taten auch begangen hatten. Er hatte mehr als einem Hitler zugehört, der den Krieg überlebt und sich seither irgendwo versteckt hatte. Und auch der Satan hatte ihm schon öfter gegenübergesessen.
»Also gut«, sagte der Priester. »Fangen wir ganz von vorn an. Warum hast du diese Menschen ermordet?«
»Ich bin ein Auftragsmörder.«
»Ja, natürlich. Und wie viele Menschen genau hast du getötet?«
»Das weiß ich nicht genau.«
Obwohl das, was er sich da gerade anhören musste, absolut lächerlich war, dachte der Priester unwillkürlich daran, dass er früher gelegentlich auch echten Mördern die Beichte abgenommen hatte. Damals, zur Zeit der großen Unruhen. Die Dinge, die er dort erfahren hatte, verfolgten ihn bis heute.
»Wie kann es sein, dass du nicht weißt, wie viele Menschen du ermordet hast?«
»Vor Kurzem habe ich eine Frau vergiftet«, lautete die Antwort des Beichtenden. »Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie tatsächlich gestorben ist.«
»Warum hast du das getan? Hat man dich dafür bezahlt?«
»Nein«, lautete die Antwort. »Wir waren zuerst Feinde und dann Verbündete. Als das Bündnis nicht länger notwendig war, habe ich sie wieder als Feindin betrachtet.«
»Ich verstehe.« Das war gelogen. »Und warum weißt du nicht, ob sie gestorben ist?«
»Ich habe ihr verraten, wie sich die Wirkung des Gifts neutralisieren lässt. Ich habe ihr eine Chance zum Überleben geboten, vorausgesetzt, sie war stark genug, um sie zu ergreifen. Und es ist noch zu gefährlich, zu überprüfen, ob sie es geschafft hat oder nicht.«
»Und warum hast du ihr diese … Chance, wie du sagst, eröffnet?«
»Sie hat mich davon überzeugt, dass ich eines Tages vielleicht auf ihre Hilfe angewiesen sein könnte. Weil sie schon einmal bewiesen hat, dass sie dazu durchaus in der Lage ist.«
Das war reine Fantasie. Eine Wahnvorstellung. Der Mann im Beichtstuhl glaubte tatsächlich, was er da sagte. Und das war furchterregend, wenn auch anders, als der Beichtende glaubte. Der Priester konnte nur hoffen, dass ihm jemand helfen würde, wenn er wieder draußen war. Aber im Augenblick war es das Beste, den Irren einfach weiterreden zu lassen, damit er sich nicht unnötig aufregte. Der Priester wollte schließlich nicht, dass all die, die mit wirklichen Sorgen und Nöten zu ihm kamen, unnötig verschreckt wurden.
»Liegt dir etwas daran, dass diese Frau überlebt oder stirbt?«
Der englische Sünder schwieg für einen Augenblick, dann sagte er: »Wenn sie stirbt, dann habe ich eine große Gefahr eliminiert. Wenn sie überlebt, dann habe ich eine nützliche Verbündete gewonnen.«
»Dann solltest du ihr vielleicht, falls sie tatsächlich überlebt, einen Blumenstrauß schicken. Aber das war eigentlich keine Antwort auf meine Frage.«
»Eine andere habe ich nicht.«
Der Priester verdrehte die Augen. »Tut es dir leid, was du getan hast? Hast du deswegen ein schlechtes Gewissen?«
»Nein«, erwiderte der Mann.
»Und warum bist du dann hier?«
Das Schweigen auf der anderen Seite des Gitterwerks zog sich in die Länge. Der Priester drängte den Beichtenden nicht, sondern wartete geduldig ab. Er war neugierig.
»Weil ich muss. Aus Gewohnheit, obwohl … vielleicht wäre Sucht der angemessenere Begriff.«
»Das musst du mir etwas genauer erklären.«
»Das, was hier und jetzt geschieht, ist ein Überbleibsel des Menschen, der ich einst gewesen bin.«
Der neutrale Tonfall, mit dem er diese Worte aussprach, stand im starken Widerspruch zu ihrem traurigen Inhalt. Der Priester fragte sich, was das für ein Mensch sein mochte, der sich eine solch zerrüttete Wahnvorstellung schuf, und wie das Leben aussehen mochte, vor dem er flüchten wollte.
»Was erhoffst du dir von dieser Beichte?«
»Wie meinen Sie das?«, erwiderte der Beichtende.
»Du bist ja nicht hier, um die Absolution zu bekommen. Wenn du deine Sünden nicht bereust, dann ist das Ganze hier sinnlos. Wenn du Vergebung suchst, dann musst du zu deinen Sünden stehen.«
»Und Gott vergibt mir, ganz egal, was ich getan habe, wenn ich ihn nur darum bitte?«
»Ganz genau, so funktioniert das«, erwiderte der Priester, um das Gespräch zu beenden. »Du betest jetzt neun Ave-Marias und zehn Vaterunser, dann wirst du von deinen Sünden erlöst.«
»Danke, Pater.«
»Und geh öfter als nur einmal im Jahr zur Beichte.«
»Ich werde es versuchen.«
Der Priester musste schmunzeln. Es wurde eben nie langweilig. »Und bringen Sie keine anderen Menschen mehr um.«
Der Sünder erwiderte: »Das kann ich nicht versprechen.«
Kapitel 2
Sterben tat nicht weh, die Rückkehr ins Leben dafür umso mehr. Rehabilitation war pures Leiden. Das zentrale Nervensystem lässt sich nicht einfach ohne schwerwiegende Konsequenzen abschalten und neu starten, das würde man ihr sagen. Es wäre nicht nötig gewesen. Zu Beginn ihres zweiten Lebens war sie vollkommen gelähmt gewesen. Sie konnte atmen, sie konnte stöhnen, aber mehr nicht. Es dauerte lange, bis wieder erste, kleine Bewegungen möglich gewesen waren. Und die Empfindungen ließen noch länger auf sich warten. Sie konnte sich kratzen, noch bevor sie die Fingernägel auf ihrer Haut spüren konnte. Trotzdem war der Schmerz ihr ständiger Begleiter, aber unbestimmt, ohne konkreten Ausgangspunkt, ohne Ursache. Ihre Gliedmaßen zum Beispiel taten ununterbrochen weh. Ihre Rückenmuskulatur verkrampfte sich immer wieder anfallartig und ohne jede Vorwarnung. Der kleinste Lichtschimmer konnte auf ihrer Netzhaut flammende Explosionen in allen Farben erzeugen, aber manchmal hatte völlige Dunkelheit genau denselben Effekt. Und in ihrem Kopf bearbeitete ein grausamer Sadist die Innenseite ihrer Schädeldecke ununterbrochen mit einem Presslufthammer.
Daran werden Sie sich gewöhnen müssen, würde einer der Ärzte zu ihr sagen, und dann – eher symbolisch als ernsthaft mitfühlend – hinzufügen: »Fürchte ich.« Jede Menge Mediziner, Spezialisten und Fachärzte stellten ihr Fragen und studierten ihre Krankenakte. Zu Anfang hatte sie das beruhigt, aber dann war ihr schon bald klar geworden, dass sie für diese Leute nichts weiter als ein interessanter, ungewöhnlicher Fall war. Für sie als Person interessierte sich niemand.
Es hatte einen Tag gedauert, bis sie überhaupt sprechen konnte. So lange hatte kein Mensch gewusst, aus welchem Grund ihr Herz aufgehört hatte zu schlagen. Bei der Ankunft in der Notaufnahme war sie klinisch tot gewesen, dann hatten sie sie zurückgeholt, und sie hatte bewusstlos auf der Intensivstation gelegen. Irgendwann war sie dann langsam aufgewacht, immer noch stumm und bewegungsunfähig. Und darum hatte sie ihnen auch nicht sagen können, was geschehen war. Aber selbst wenn ihre Lippen und ihre Zunge funktioniert hätten, sie hätte den Namen des Gifts nicht gekannt. Es war ein Neurotoxin, so viel hatte ihr Mörder ihr verraten.
Daher waren die Ärzte gezwungen zu raten, zu vermuten, Untersuchungen durchzuführen. Und sie genossen es in vollen Zügen. Sie merkte genau, dass sie dabei – mit ihr – großen Spaß hatten. Aber sie hatte gar nichts dagegen, wenn das bedeutete, dass sie schneller wieder ganz bei Kräften sein würde. Das letzte Mal hatte sie zu College-Zeiten so viel Zeit im Bett verbracht, aber ganz bestimmt nicht, um sich auszuruhen.
»Hast du das gesehen?«, hörte sie eine körperlose Stimme sagen. »Sie hat gelächelt.«
»Ich habe nichts gesehen. Das hast du dir vermutlich eingebildet.«
»Ich lass mir doch von dir nicht sagen, was ich gesehen habe und was nicht.«
»Fängst du jetzt schon wieder mit gestern Abend an?«
Als sie wieder sprechen konnte, gab sie nichts wirklich Substanzielles preis. Nichts, womit sie etwas anfangen konnten. Sie sagte, dass sie sich nicht erinnern konnte. Dass ihr vielleicht jemand ein Glas in die Hand gedrückt hätte. Das war zumindest nicht gelogen. Vielleicht hatten sie ihr ja den Magen ausgepumpt und das Gift oder zumindest Rückstände davon in ihrem Blut gefunden.
»Sie können von Glück reden, dass Sie noch am Leben sind«, hatte ein junger Arzt zu ihr gesagt.
»Kommt mir aber nicht so vor.«
»Ihr Herz hat über zwei Minuten lang stillgestanden.«
Wenn du stark genug bist, können sie dich wiederbeleben, hatte der Mörder zu ihr gesagt.
»Danke, dass Sie mich nicht aufgegeben haben.«
»Wirklich sehr gern geschehen, aber in Wirklichkeit müssen Sie sich bei niemand anderem bedanken als bei sich selbst.«
Ich bin stark genug, hatte sie ihm erwidert.
Die Ärzte waren begeistert, dass sie wieder bei Bewusstsein und ansprechbar war, aber sie wollte mehr wissen, wollte erfahren, wann sie wieder ganz gesund sein würde, wann sie das Krankenhaus verlassen konnte. Das wollte ihr jedoch niemand verraten, oder sie wussten es selbst nicht. Da sie immer nur im Bett lag, fiel es ihr schwer, das volle Ausmaß ihrer Schwächung zu erfassen. Sie wusste nur, dass es schlimmer als schlimm war. Dass sie so schwach war, wie es schwächer nicht ging. Das wusste sie durch ihre Hände. Es fiel ihr sogar schwer, eine Hand zur Faust zu ballen. Es fühlte sich an, als müsste sie zuerst eine Eisenkugel zerquetschen, bevor sie mit den Fingerspitzen ihre Handfläche berühren konnte. Ihr Arm zitterte vor Anstrengung. Sie fing an zu schwitzen, und nachdem sie aufgegeben hatte, schnappte sie schwer atmend nach Luft, wutentbrannt und niedergeschlagen zugleich.
Die Polizei hatte sich auch schon gemeldet, was nicht anders zu erwarten gewesen war. Zwei einfache Polizeibeamte hatten ihr ein paar Fragen gestellt, aber schnell die Lust verloren, weil sie ihr nichts anderes entlocken konnten, als dass sie sich nicht erinnern konnte, sich nicht sicher war oder eine Gedächtnislücke hatte.
»Wir kommen in zwei Wochen wieder, sobald es Ihnen besser geht.«
Sie versuchte keineswegs, ihren Beinahe-Mörder zu schützen. Sie wollte sich selbst beschützen. Südlich der Grenze gab es jede Menge Leute, die das Werk, das er begonnen hatte, nur zu gerne zu Ende bringen würden. Als unbekannte Patientin in einem kanadischen Krankenhaus war ihr eine gewisse Anonymität zwar sicher, aber sie war jetzt schon viel zu lange hier. Das Überleben war einfacher, wenn man ständig unterwegs war, und falls tatsächlich irgendjemand hier auftauchen und ihr nach dem Leben trachten sollte, dann konnte sie nicht einmal weglaufen, von kämpfen ganz zu schweigen.
Es dauerte etliche Tage, bis sie in der Lage war, sich selbstständig aufzusetzen, und dann, sobald sie auch die Knie beugen konnte, dauerte es nicht mehr lange, bis sie die Bettdecke wegschieben und einen ersten Versuch unternehmen konnte, sich hinzustellen. Das Ergebnis waren zahlreiche blaue Flecken. Krankenhausfußböden waren hart.
»Sie können noch nicht gehen«, bekam sie von einem weiteren Arzt mitgeteilt.
»Ich will ins Fitnessstudio.«
Der Doktor lachte, weil er glaubte, dass das ein Scherz sein sollte.
»Sehen Sie mich doch an. Meine Muskeln atrophieren wie verrückt.«
»Aber zuerst müssen Sie vollständig genesen. Das ist ein allmählicher Prozess. Und wenn Sie so weit sind, kommt noch die Physiotherapie dazu.«
»Ich bin so weit.«
»Wir wollen Sie auf gar keinen Fall überfordern.«
»Das überfordert mich nicht. Ich bin von den Toten auferstanden, wissen Sie noch?«
Am nächsten Tag fing sie mit Liegestützen an – nur drei und auch nur auf Knien –, aber am Ende der Woche schaffte sie schon fünf ohne Hilfe. Sie machte ihre Übungen bei Nacht, wenn das Licht aus war und stundenlang niemand nach ihr sah. Dadurch hatte sie genügend Zeit, um vollkommen erschöpft auf dem Boden zu liegen, so lange, bis sie wieder genügend Kraft gesammelt hatte, um ins Bett zu klettern – ja, wahrhaftig, sie musste klettern. Dabei liefen ihr die Tränen über die Wangen, weil die durch die Strapazen verursachten Schmerzen einfach unerträglich waren. Das Kissen benützte sie, um ihre Schreie zu ersticken.
Im Bett machte sie Fingerkraftübungen, indem sie versuchte, die Edelstahlstangen zusammenzupressen, bis der Schweiß darauf deutlich sichtbare Abdrücke hinterließ. Sie zwang sich zu essen, bat jedes Mal um einen Nachschlag, eine Extramahlzeit, Naschkram, Reste, ohne ihrem inneren Widerstand nachzugeben. Sie schluckte und schluckte, ignorierte das Gefühl der Übersättigung, ignorierte die Übelkeit, wollte nur sicherstellen, dass sie genügend Kalorien zu sich nahm, um nicht noch mehr zu verfallen. Mit beiden Händen hielt sie sich Mund und Nase zu und schluckte alles, was sie emporgewürgt hatte, wieder hinunter, um nur ja keine Nährstoffe zu vergeuden.
Die Wanduhr besaß neben der Drei ein kleines Plastikfenster mit einer Datumsanzeige. Wir kommen in zwei Wochen wieder … Bis dahin durfte sie nicht mehr hier sein. Sie konnte keine zweite Begegnung mit der Polizei riskieren. Tag für Tag fühlte sie sich besser und sah auch besser aus. Beim nächsten Mal würden sie sich nicht so leicht abwimmeln lassen. Sie würden ihr richtige Fragen stellen, ihr eine richtige Aussage abverlangen. Und dann würden sie sie in ihre Datenbank einspeisen.
Davor hatte sie Angst. Das musste sie auf jeden Fall verhindern.
Diejenigen, die auf der Suche nach ihr waren, würden diesen Eintrag mit ihren eigenen Systemen aufspüren. Ihre elektronischen Tentakel waren überall. Ihren Such-Algorithmen würden die verräterischen Einzelheiten sofort auffallen. Irgendjemand würde es merken. Ein paar Nachrichten würden ausgetauscht werden. Dann würde eine schnelle Entscheidung gefällt und sofort in die Tat umgesetzt werden, weil die geheimnisvolle Frau ohne Namen und ohne Gedächtnis eine frappierende Ähnlichkeit mit einer gewissen Constance Stone alias Raven aufwies, ehemalige Geheimagentin in Staatsdiensten, fahnenflüchtige Kapitalverbrecherin, Attentäterin …
Aufspüren und töten.
Kapitel 3
Der Kunde stand am Fenster. Er hatte die Vorhänge zugezogen, starrte jedoch durch den schmalen Spalt zwischen Vorhang und Wand hinaus in die Nacht. Er war in seinen grauen Anzug geschlüpft – jedes Mal war er unheimlich schnell wieder angezogen –, ohne sich zu duschen. Er duschte nie, und sie hatte mittlerweile aufgegeben, ihn auf die Möglichkeit hinzuweisen. Es kam ihr zwar ziemlich seltsam vor, weil er ansonsten so einen sauberen Eindruck machte, aber er wollte in ihrer Gegenwart nicht länger als unbedingt nötig unbekleidet sein. Wahrscheinlich schämt er sich, wenn er nackt ist, dachte sie, obwohl er dazu nicht den geringsten Anlass hatte. Sie hatte noch nie einen durchtrainierteren Mann gesehen. Seine Muskeln waren so hart, dass es schmerzte, wenn er sich zu fest an sie drückte, und seine Haut war so straff, dass sein Körper wie eingeschweißt wirkte. Wahrscheinlich sind ihm die Narben peinlich, dachte sie. Er hatte so viele davon – viel mehr, als sie je bei einem einzelnen Menschen wahrgenommen hatte. Manche sahen ziemlich grässlich aus, aber trotzdem fand sie sie nicht hässlich. Eigentlich sogar genau das Gegenteil. Für sie erzählte jede einzelne eine neue, spannende Geschichte, war jede Narbe die Seite eines Buches, das sie nur zu gerne gelesen hätte.
Er war ein Russe, groß und dunkel. Er hatte zwar nie gesagt, woher er stammte, aber sie hatte seinen Akzent sofort erkannt, weil sie viele seiner Landsleute kannte. Sie beobachtete ihn, wie er dort am Fenster stand, während sie sich einen Bademantel nahm und ihre Kleider, die am Fuß des Betts lagen, zusammenraffte. Sie brauchte immer ein wenig länger, bis sie sich erholt hatte.
»Sie steht nicht da draußen«, sagte sie.
Der dunkelhaarige Russe sah sie nicht an. »Wer steht nicht da draußen?«
»Deine Frau.«
Er hatte ihr zwar seinen Namen genannt, aber sie ging davon aus, dass es nicht sein richtiger war – sie hatte sich schon längst daran gewöhnt, dass ihre Kunden ihr nicht die Wahrheit sagten. Trotzdem ließ sie sich nichts anmerken. Sie spielte immer die Rolle, für die sie bezahlt wurde.
»Ich bin nicht verheiratet«, erwiderte er.
»Natürlich nicht«, meinte sie. »Deswegen musst du auch immer nachsehen, ob jemand draußen steht, vorher und nachher. Du glaubst vielleicht, dass mir das nicht auffällt, aber da täuschst du dich. Du hast Angst, dass deine Frau dich erwischen könnte. Darum kannst du es auch nie voll und ganz genießen.«
»Ich versichere dir, dass ich die Zeit mit dir sehr wohl genieße.«
»Das habe ich nicht gemeint, und das weißt du auch. Wenn du keine Angst haben müsstest, dass sie dich in flagranti ertappt, dann könntest du dich besser entspannen und hättest noch mehr von unserer gemeinsamen Zeit.«
»Ich habe keine Angst«, fühlte er sich verpflichtet zu sagen.
Das war eine eigenartige Bemerkung, oder besser: es wäre eine gewesen, wenn sie von jemand anderem gekommen wäre. Doch da er selbst mehr als nur ein bisschen eigenartig war, war dieser Satz fast schon normal. Sie hatte genügend Zeit mit Männern zugebracht, um zu wissen, wie sie tickten. Sie konnte ihre Handlungen interpretieren und zwischen den Zeilen lesen. Aber dieser hier war und blieb ihr ein Rätsel. Die Sache mit dem Fenster hatte sie entschlüsselt, ja, aber das war auch nicht weiter schwierig gewesen. Männer betrogen ihre Frauen, und ihre Frauen waren nicht dumm. Ein Mann, der den Verdacht hatte, dass seine Frau ihm womöglich bis zur Wohnung seiner Geliebten gefolgt war, brauchte noch lange nicht paranoid zu sein. Andererseits war da das Bett. Es hatte mehrere Besuche gedauert, bis sie gemerkt hatte, dass er es ein kleines Stückchen von der Wand abgerückt hatte. Aufgefallen war es ihr, weil sie die Schläge des Kopfbretts nicht mehr gehört hatte. Sie wohnte in einem zweistöckigen Haus und hatte das Bett extra an eine Außenwand gestellt, damit nicht irgendwann ein wütender Nachbar an ihre Tür klopfte. Genau deswegen. Denn Männer, das wusste sie in der Zwischenzeit, hörten diese Schläge gerne. Sie fühlten sich gerne stark und mächtig. Aber dieser hier nicht.
Sie gähnte. Es wurde langsam spät, und sie war ausgelaugt. »Morgen wieder um die gleiche Zeit?«
Sie ließ die Kleider in einen Wäschekorb fallen und warf einen Blick in den Spiegel auf dem Schminktisch. Das Zimmer war einfach, aber geschmackvoll eingerichtet. Es war ihr zweites Schlafzimmer. Dort, wo sie schlief, empfing sie keine Kunden. Sie war zwar mit der Art und Weise, wie sie ihren Lebensunterhalt verdiente, durchaus im Reinen, aber so im Reinen nun auch wieder nicht. Sie brauchte ihren eigenen, privaten Raum. Berufliches und Privates sollten voneinander getrennt sein, und wenn sie jemandem privat näherkommen wollte, dann sollte das nicht im selben Zimmer geschehen, wo sie beruflich Nähe praktizierte.
Sie hatte eine gute Ausbildung genossen, besaß zwei Universitätsabschlüsse, davon einen Master, war viel gereist und hatte ehrenamtliche Arbeit geleistet, aber mit ihrer jetzigen Tätigkeit verdiente sie weit mehr, als sie sich in der wirklichen Welt jemals erträumen könnte. Ihr Vater war ein Trunkenbold, und ihre Mutter war auf dem Kindsbett gestorben. Bis auf ihr Aussehen und ihren Charme hatte das Leben ihr nichts geschenkt. Die Universität hatte sie durch harte Arbeit und den inneren Drang, sich zu verbessern, bewältigt, doch die Welt beurteilte sie nach ihrem Aussehen und nicht nach ihren geistigen Fähigkeiten. Daher war es nur logisch gewesen, dass sie irgendwann mitgespielt hatte. Wenn sie nicht der Mensch sein konnte, der sie sein wollte, dann würde sie eben das Beste aus dem Menschen machen, den die anderen in ihr sahen.
Der dunkelhaarige Mann hatte ihr noch keine Antwort gegeben, aber er sprach sowieso nicht viel. Er antwortete immer nur, wenn er angesprochen wurde. Sie fragte sich, ob er am liebsten gar nicht reden würde. Ob er zufrieden gewesen wäre, wenn jenseits des Körperlichen gar keine Kommunikation stattgefunden hätte.
»Was soll ich anziehen? Wieder das weiße Kleid? Das hat dir gefallen, stimmt’s?«
Sie musste lächeln, als sie daran dachte, wie er reagiert hatte, als sie es das erste Mal getragen hatte.
Er erwiderte: »Ich verlasse Sofia, morgen in aller Frühe.«
»Dann hättest du dir aber wirklich ein bisschen mehr Schlaf gönnen müssen, nicht wahr?« Sie zwinkerte ihm zu. »Und wann kommst du wieder zu mir?«
»Gar nicht.«
Ihr Lächeln fiel in sich zusammen. »Was soll das heißen, gar nicht?«
Er sah sie an. »Ich reise ab. Ich komme nicht wieder zurück.«
»Das redest du dir bloß ein, nicht wahr? In dieser Woche warst du doch an jedem Abend hier.«
»Und das war ein Fehler«, sagte er ohne jede erkennbare Gefühlsregung. »Normalerweise mache ich so etwas nicht. Ich weiß es besser. Ich hätte es besser wissen müssen.«
»Aber ich bin etwas Besonderes, nicht wahr?«, sagte sie und kannte die Antwort bereits. »Ich bringe dich dazu, deine Regeln zu brechen. Ich weiß, dass du mich magst. Du kommst nicht dagegen an. Genau diese Wirkung habe ich auf Männer. Sie können mir nicht widerstehen. Sie kommen immer wieder zurück.«
»Ich nicht. Nie mehr.«
»Und wieso nicht?« Es war weniger eine Frage als eine gebieterische Aufforderung.
»Weil ich mich nie länger irgendwo aufhalte. Ein paar Tage, eine Woche allerhöchstens. Und das ist meine siebte Nacht in derselben Stadt. Ich habe den Bogen sowieso schon überspannt.«
Sie konnte ihre Verwirrung genauso wenig verbergen wie ihre Verletztheit angesichts dieser schroffen Zurückweisung.
Er fuhr fort: »Falls ich dich aus irgendeinem Grund zu falschen Schlüssen verleitet haben sollte, dann gebe ich dir gerne auch das Geld für morgen, aber ich komme bestimmt nicht noch einmal hierher.«
Sie wandte sich ab. »Nein, ich will kein Geld von dir. Ich könnte schon mit dem, was du mir bisher gegeben hast, einen ganzen Monat Urlaub machen.«
»Und wo ist dann das Problem?«
»Wer sagt, dass es ein Problem gibt, wenn du ohne jede Vorwarnung einen Schlussstrich ziehst?«
»Ich wusste nicht, dass ich dich hätte vorwarnen sollen. Ich dachte eigentlich, dass wir die geschäftlichen Bedingungen eindeutig geregelt hätten.«
»Ich weiß, das haben wir auch. Aber du hast doch selbst gesagt, dass du so etwas normalerweise nicht machst.«
»Und genau deshalb kann ich es nicht noch einmal machen.«
»Aber als ich gesagt habe, dass du mich magst, da hast du mir nicht widersprochen.«
»Ich verstehe nicht, was du meinst«, sagte er, und das war nun wirklich ausgesprochen empörend. Er war so naiv, so einfach gestrickt. Nein, er war dämlich. Seine Dämlichkeit war absolut lächerlich.
»Natürlich verstehst du das nicht. Wie solltest du auch?«
»Ich habe nie gesagt, dass das etwas Langfristiges werden würde. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Falls ich dir Unannehmlichkeiten bereitet habe oder du darauf angewiesen bist, dass ich dich regelmäßig besuche, dann kann ich mich nur entschuldigen.«
Sie lachte ein hohles, spöttisches Lachen. »Willst du jetzt etwa das Arschloch spielen? Sieh mich an. Glaubst du wirklich, dass ich nicht genügend Kunden bekommen kann? Ich entscheide ganz allein, wen ich nehme und wen nicht. Ich dachte, das hätte ich unmissverständlich deutlich gemacht. Und in zehn Jahren kann ich immer noch ganz alleine entscheiden. Aber du wagst es, zu behaupten, ich sei auf dich ›angewiesen‹ …? Noch nie im Leben bin ich so beleidigt worden. Großer Gott!«
Er runzelte die Stirn. »Ich halte nicht viel von Gotteslästerung.«
»Oh, ich bitte um Verzeihung. Aber nachdem du eine Woche lang auf Teufel komm raus eine Hure gevögelt hast, hätte ich nicht gedacht, dass Gotteslästerung auf deiner Liste der moralischen Verfehlungen so weit oben steht.«
Er wartete einen Augenblick lang ab – aus reiner Höflichkeit, so hatte es den Anschein – und sagte dann: »Ich verlasse dich jetzt.«
Mit wenigen Schritten war er bei der Tür, und sie ließ ihn gehen, stinkwütend auf ihn, weil er ging, und noch viel mehr auf sich, weil sie ihn ließ. Sie drehte sich erst um, als die Tür hörbar ins Schloss gefallen war, und lauschte seinen Schritten auf dem Absatz, dann auf der Treppe, bis sie schließlich nicht mehr zu hören waren. Erst jetzt fiel ihr auf, dass er das Geld für noch eine Nacht auf die Kommode neben der Tür gelegt hatte. Sie griff nach dem Stapel mit druckfrischen Scheinen und riss sie in winzige Fetzen, ließ sich mit dem Rücken an die Schlafzimmertür sinken und langsam zu Boden gleiten. Dann saß sie mit an die Brust gezogenen Knien auf dem Teppich, sodass die Haare ihr Gesicht völlig bedeckten.
Kapitel 4
»Die Befehle Ihres Gehirns kommen nur mit Verzögerung bei Ihren Muskeln an«, erfuhr Raven von wieder einem anderen Arzt. »Die Synapsen tun, was sie können. Die Botschaften werden rechtzeitig abgeschickt, aber sie gelangen nicht dorthin, wo sie benötigt werden. Ihr fein verästeltes Nervensystem bietet sehr viele verschiedene Wege an, ähnlich wie ein Labyrinth. Und die Botschaften, die Ihr Gehirn aussendet, wissen nicht mehr, welchen Weg sie nehmen sollen. Sie kommen zwar irgendwann am Ziel an, aber unterwegs verlaufen sie sich. Entscheiden sich für die landschaftlich schönere Strecke, wenn Sie so wollen. Sie müssen sich in diesem Labyrinth erst wieder zurechtfinden, und das wird viel Zeit und Geduld erfordern.«
»Zeit und Geduld sind zwei Dinge, die ich nicht habe.«
»Es würde uns wirklich sehr helfen, wenn wir wüssten, womit man Sie vergiftet hat.«
»Sie haben keinerlei Rückstände gefunden?«
Er schüttelte den Kopf. »Sehr eigenartig, nicht wahr?«
Eigentlich nicht, sagte sie nicht. Raven hatte eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Toxinen. Sie hatte schon viele Menschen mit nicht nachweisbaren Giften getötet. Kaliumchlorid zum Beispiel war eines der Mittel, die sie besonders schätzte. In der richtigen Dosis führt es zum Herzstillstand, ist aber sehr schwer nachzuweisen, weil es nach dem Tod des Betroffenen in seine Bestandteile zerfällt, die im menschlichen Körper ohnehin vorhanden sind. Solange die Ärzte nicht wussten, wonach sie suchen sollten, konnte niemand sagen, ob das Neurotoxin, das sie gelähmt und ihr Herz zum Stillstand gebracht hatte, schon längst abgebaut oder aber immer noch in ihrem Körper präsent war.
»Ist alles in Ordnung?«
Sie lächelte trotz der Schmerzen. »Hab mich nie besser gefühlt.«
Die Schmerzen hielten Raven in der Nacht wach. Und am Tag auch. Es gab kein Entrinnen. Wann immer es möglich war, versuchte sie, sich das wahre Ausmaß ihres Leidens nicht anmerken zu lassen.
Eine britische Fachärztin versuchte sich mit ihrem eigenartigen, vornehm klingenden Akzent an einer Erklärung: »Dieser Dauerschmerz ist eine Folge der Übererregung Ihres Nervensystems. Es reagiert immer noch auf einen Reiz, der in Wirklichkeit gar nicht mehr vorhanden ist. Die Nerven melden Ihrem Gehirn fortwährend Verletzungen, die gar nicht existieren.«
»Soll das heißen, dass sich das alles nur in meinem Kopf abspielt?«
»Gewissermaßen, ja. Ihre Schmerzen sind absolut real, das versichere ich Ihnen. Aber Ihr zentrales Nervensystem ist verwirrt. Es ist gewissermaßen auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt worden, sodass die Software sich nicht auf dem aktuellen Stand befindet.«
»Jetzt bin ich genauso verwirrt wie mein Nervensystem.«
»Tut mir leid«, sagte die Fachärztin. »Ich versuche ja, mich so klar wie möglich auszudrücken, leider nur mit mäßigem Erfolg. Im Prinzip könnte man sagen, dass Ihr ZNS nicht mehr weiß, wo rechts und wo links ist.«
»Was?«
»Vergessen Sie’s«, sagte die Fachärztin. »Haben Sie einfach Geduld.«
»Das kriege ich ständig zu hören. So langsam reicht es mir.«
Raven war müde, unendlich müde. Sobald der Schmerz ein wenig nachließ, schlief sie ein, aber dann dauerte es nicht lange bis zu den ersten, grausamen Muskelkrämpfen, und sie wachte auf und musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszubrüllen. Und wenn sie doch einmal schlief, dann träumte sie, dass die Lähmung sich immer mehr ausbreitete und sie in einem Körper gefangen war, über den sie keinerlei Kontrolle mehr hatte. Es war Wahnsinn.
Die Spezialisten kamen und gingen. Ärzte und Fachärzte, Krankenschwestern und Therapeuten gaben sich die Klinke in die Hand. Jeder hatte eine andere Idee. Widersprüche waren an der Tagesordnung.
»Moment mal, wollen Sie damit sagen, dass mein zentrales Nervensystem sich wieder neu aufbauen muss?«
»Nein, keineswegs. Es muss nur alles wieder ganz neu lernen. So lässt sich dieser Prozess wohl am ehesten beschreiben.«
Prozess. Das bekam sie oft zu hören. Was für ein steriler, seelenloser Begriff für das, was sie durchzustehen hatte. Als wäre sie in den Augen der Mediziner lediglich ein Projekt oder ein Experiment – und in gewisser Weise war sie das ja auch.
Ihr Zustand besserte sich mit jedem Tag, die Schmerzen nahmen ab, und ihre Beweglichkeit nahm zu. Nach einer Woche schaffte sie es, die Krämpfe und Zuckungen vor den Ärzten zu verbergen. Sie konnte ihnen vorgaukeln, dass es ihr deutlich besser ging, als es tatsächlich der Fall war, und hoffte, dass sie dadurch den Prozess der Rehabilitation beschleunigten. Aber immer wieder bekam sie zu hören, dass man keinerlei medizinische Risiken eingehen wolle. Doch wahrscheinlich wollten sie nur auf ihre Kosten kommen. Sie wussten immer noch nicht, was die Ursache für ihren neurologischen Totalabsturz gewesen war.
»Sie wollen bloß einen Aufsatz über mich veröffentlichen«, beschied sie einem besonders schleimigen Experten, der alle paar Tage eingeflogen kam, um sich anzusehen, welche Fortschritte sie gemacht hatte, und ihr dämliche Fragen zu stellen. »Sie wollen das Geheimnis meines Leidens lüften und sich dann vor Ihresgleichen damit brüsten.«
»Ich versichere Ihnen, dass das keinesfalls meine Absicht ist.«
»Dann lassen Sie mich in Ruhe, verdammt noch mal.«
Als sie ihr schließlich glaubten, dass sie seit achtundvierzig Stunden schmerzfrei war, durfte sie zum ersten Mal ins Freie, natürlich nur unter Aufsicht. Die Nachmittagssonne auf ihrem Gesicht fühlte sich so gut an, dass sie tatsächlich fast keine Schmerzen mehr empfand – zum allerersten Mal überhaupt, soweit sie sich erinnern konnte.
Der Krankenpfleger, der sie begleitete, sagte: »Wir können doch eine Runde durch den Park drehen.«
Niedlich sah er aus mit den kleinen Grübchen und den hinter die Ohren gesteckten, blonden Haaren. Außerdem war er noch ziemlich jung, aber kräftig, und besaß ein unschuldiges Lächeln. Sie musste ihn einfach gernhaben. Typisch, dass sie ausgerechnet jetzt in einem Krankenhaus festsaß, so ein grässliches Nachthemd tragen musste und überhaupt so beschissen aussah wie nie zuvor. Aber das spielte ohnehin keine Rolle. Sie wusste nicht einmal mehr, wann sie das letzte Mal einen Kerl nach seiner Telefonnummer gefragt hatte. Ihr Beruf – ihr ehemaliger Beruf – ließ ihr nicht viel Zeit für romantische Abenteuer.
»Ich möchte gerne da rüber«, sagte sie und versuchte, ihn in die entsprechende Richtung zu lenken.
»Aber da gibt es doch gar nichts zu sehen.«
Oh, doch. Fenster und Ausgänge, Kameras und Fahrzeuge. Sie analysierte das Gelände, während der niedliche, zugewandte Krankenpfleger ihr einen Arm anbot.
»Das reicht wahrscheinlich fürs Erste«, sagte er.
»Noch eine Runde.«
Er wollte schon den Kopf schütteln.
»Bitte«, sagte sie.
Sie kannte sich in diesem Krankenhaus nicht aus. Außerdem war es viel zu groß, um es auf eigene Faust zu entdecken, selbst dann, wenn sie sie gelassen hätten. Darum tat sie eben, was sie konnte. Machte das Beste aus der Situation. So konnte sie zum Beispiel ohne großes Aufsehen zu erregen ihr Zimmer verlassen und durch die Station humpeln. Sie konnte das Kopfschütteln und die diversen Angebote, sie wieder auf ihr Zimmer zu bringen, mit einem Lächeln ignorieren. Sie konnte sehr nett lächeln, und das machte sie sich zunutze. Bei Frauen klappte das allerdings nicht. Sie kannten diese Tricks. Den Frauen gegenüber spielte sie die Tapfere und wurde mit Hochachtung bedacht. Den Männern gegenüber spielte sie die Verletzliche und wurde dafür angebetet.
Eines Nachmittags brachte ihr der niedliche Krankenpfleger einen wunderschönen Strauß Lilien aufs Zimmer. Sie hatte geschlafen und war noch ganz benommen.
»Aber Lionel, das wäre doch nicht nötig gewesen«, sagte sie zu ihm.
Er stellte den Strauß auf ihren Nachttisch. »Sind Lilien nicht eher was für Beerdigungen?«
»Das soll ein Scherz sein«, sagte Raven. »Was steht auf der Karte?«
»Uns bleibt immer Coney Island«, las er vor. »Was soll das denn heißen?«
»Das ist eine Anspielung auf Humphrey Bogart und Ingrid Bergman in Casablanca. Ist auch ein Scherz.«
Lionel kapierte gar nichts. »Von wem sind die?«
»Von einem Mann, der keine Scherze macht«, erklärte sie ihm, ohne etwas zu erklären. »Steht auf der Karte vielleicht auch die Adresse des Floristen? Ein Logo? Sonst irgendwas?«
Er sah nach. »Fast Flowers. Und die Adresse eines Blumenladens hier in der Stadt.«
»Könnten Sie die Karte vielleicht in eine meiner Schubladen legen? Ich würde sie gern aufbewahren.«
Die Uhrzeiger drehten unaufhaltsam ihre Runden. Die Datumsanzeige schritt unaufhaltsam voran. Zwei Wochen waren nicht viel Zeit, um sich vom Tod zu erholen, aber sie musste alles dafür geben, dass sie es schaffte. Sie hatte sich nicht ins Leben zurückgekämpft, nur um gleich wieder umgebracht zu werden. Das wäre einfach zu viel Pech gewesen, selbst für ihre Verhältnisse.
Der nächste Mörder würde ihr keinen Rettungsring zuwerfen. Sie würde keine Gelegenheit bekommen, um eine Galgenfrist zu feilschen.
Raven empfand kaum Groll für den Mann, der sie beinahe umgebracht hätte und jetzt quälte. Er hatte sich lediglich selbst verteidigt, wenn auch präventiv. Aber dass sie überhaupt noch am Leben war, lag daran, dass er seine Meinung geändert hatte. Sie hatte ihn davon überzeugt, dass sie eine zweite Chance verdient hatte. Nur dass diese zweite Chance sich jetzt als übermächtige Herausforderung erwies. Dieses neue Leben war keines, das sie leben wollte. Es musste unbedingt besser werden. Sie kämpfte weiter, weil sie kein Mensch war, der leicht aufgab. Falls sie auch nur den Hauch einer Chance auf Besserung hatte, dann würde sie sämtliche Qualen und Rückschläge wegstecken, so lange, bis sie am Ziel war.
»Sie setzen sich zu sehr unter Druck«, sagte Lionel, während er ihr behilflich war, sich wieder ins Bett zu legen.
»Das ist mir egal. Koste es, was es wolle.«
»Aber Ihre Schmerzen werden nur schlimmer, wenn Sie immer schon laufen wollen, bevor Sie gehen können.«
»Ich kann nicht laufen. Das ist ja das Problem.«
Die zwei Wochen waren fast um. Sobald die Polizisten sie ein zweites Mal befragt hatten, sobald ihre persönlichen Angaben in einer Datenbank auftauchten, hatte sie schätzungsweise noch einen Tag Vorsprung. Ihre Feinde würden schnell reagieren und noch schneller zuschlagen. Sie würden diese einmalige Chance auf keinen Fall verstreichen lassen. Eine bessere Gelegenheit, dieses Problem, das früher einmal Teil ihrer Organisation gewesen war, zu beseitigen, würden sie nie wieder bekommen.
Ein Tag Vorsprung. Das war nicht viel. Sie war ihren Feinden auch schon mit halb so viel Zeit entkommen, aber da war sie voll bei Kräften gewesen. In ihrem momentanen Zustand hatte sie deshalb keine Chance. Übermüdet, geschwächt, unkonzentriert durch die ständigen Schmerzen … all diese Faktoren musste sie dadurch ausgleichen, dass sie sich auf keinen Fall entdecken ließ. Darum musste sie so schnell wie möglich so weit zu Kräften kommen, dass sie unbemerkt aus dem Krankenhaus flüchten konnte – bevor ihr all diese Fragen gestellt wurden, bevor sie Teil des Systems werden konnte. Sie musste fliehen. Noch drei Tage, dann waren die zwei Wochen um.
Noch ein Tag zur Erholung und um ihre Übungen voranzutreiben. Dann noch einen zur Planung und Vorbereitung. Und am dritten Tag die Flucht.
Es würde eng werden, aber es war zu schaffen. Sie musste es schaffen.
Dann klopfte es an ihre Tür. Sie erwachte aus ihrem Nickerchen, als der niedliche Pfleger ihr Zimmer betrat und sagte: »Die Polizei ist da.«
Kapitel 5
Der Ausbilder brachte etwas mehr als fünfundachtzig Kilogramm durchtrainierter Muskelmasse auf die Waage. Schon bevor er lesen und schreiben konnte, war er ein Kämpfer gewesen. Zuerst auf dem Schulhof, dann auf der Ringermatte und schließlich in diversen Dojos und im Boxring. Er war Landesmeister im Kickboxen, besaß den dritten Dan im Shotokan-Karate, hatte professionelle Mixed-Martial-Arts-Kämpfe bestritten, beherrschte das russische Sambo, hatte sich von israelischen Meistern Krav Maga beibringen lassen und auf den Hinterhöfen von São Paulo, dort, wo es keine Regeln gab, brasilianisches Jiu-Jitsu erlernt. Er war geboren, um zu kämpfen, und lebte nur für den Kampf, doch dann hatte eine Netzhautablösung mit einem Schlag all seine Hoffnungen auf eine professionelle Karriere zerstört. Darum war er jetzt als Lehrer tätig. Er besaß drei Kampfsportschulen in Amsterdam und führte in ganz Europa und manchmal sogar in Übersee Selbstverteidigungsseminare durch. Aufgrund der immer größer werdenden Popularität der Mixed Martial Arts war auch er immer gefragter geworden. Er hatte schon eine Menge Geld damit verdient, Ultimate-Kämpfern neue Bewegungen oder eine verfeinerte Technik beizubringen und sie ganz allgemein gründlich auf Herz und Nieren zu prüfen. Auch private Kunden hatte er schon den einen oder anderen gehabt – reiche Männer und Frauen, die so richtig böse sein oder aber mit anderen Bösen fertigwerden wollten.
Aber der Neue war anders. Kein Profikämpfer, aber auch kein reicher Schnösel, der einfach nur ein bisschen angeben wollte. Die Fortgeschrittenenkurse dieses Ausbilders wurden nicht öffentlich angekündigt. Man erfuhr davon nur über Mund-zu-Ohr-Propaganda. Man musste jemanden kennen, der davon wusste. Das war ein nützlicher Filter, damit sich keine Zeitverschwender einschleichen konnten. Ein Blick auf den neuen Schüler beim Aufwärmen hatte genügt, um zu wissen, dass er alles andere als ein Zeitverschwender war. Natürlich war er schon zu alt, um noch an eine Karriere im Ring zu denken, aber so wie er sich bewegte, wie er kämpfte … der Ausbilder wusste sofort, dass dieser Mann in den vergangenen Jahren längst nicht nur Sparringskämpfe bestritten hatte. Die Boxbirne bearbeitete er wie ein Profi, allerdings wie einer, der nur halb so viel wog wie er, ein Fliegengewicht vielleicht, unglaublich schnell und präzise.
»Wie viele Kämpfe hast du bestritten?«, erkundigte sich der Ausbilder.
»Ich habe nie professionell geboxt.«
Die vorsichtige Antwort eines vorsichtigen Mannes. Er war Amerikaner, das hörte man an seiner typischen, rauen Stimme. Wahrscheinlich ein Geschäftsmann auf Transatlantikreise, dachte der Ausbilder. Dem schicken grauen Anzug nach zu urteilen vermutlich einer dieser hoch bezahlten Vorstandsvorsitzenden irgend so einer Technikschmiede, der die angestaute Energie des Sitzungszimmers bei einem schönen Käfigkampf loswerden wollte, irgendwo, wo ihn sein Job eben gerade hingetrieben hatte. Der Ausbilder konnte ziemlich gut Körpermaße und Gewicht schätzen und veranschlagte für den Neuen, der schlank und kräftig war, ungefähr achtzig Kilogramm. Er trug kein einziges überflüssiges Gramm Fett mit sich herum. In der Boxersprache war er der geborene Halbschwergewichtler, aber er hätte sich wahrscheinlich auch bis zum Mittelgewicht abkochen können, um sich die fehlende Flüssigkeit dann vor dem Kampf wieder zuzuführen.
»Meine Frage war nicht, ob du je professionell geboxt hast, aber lassen wir das«, erwiderte der Ausbilder jetzt. »Wie sieht es mit dem Körperfettanteil aus? Sieben Prozent?«
»Eher acht. Ich habe ganz gern ein bisschen Energievorrat dabei.«
»Für den Fall, dass …?«
Der Amerikaner zog eine Augenbraue nach oben. »Für … den Fall.«
Der Ausbilder ließ ihn sein Aufwärmprogramm zu Ende machen. Das Sportstudio besaß einen Boxring und Wurfmatten, zahlreiche Kleinhanteln, Bänke und Kraftsportausrüstung, dazu Langhanteln und die dazugehörigen Scheiben, aber kein einziges Trainingsgerät. Der Ausbilder hielt nicht viel von Geräten, dafür jedoch umso mehr von mehrdimensionalen Bewegungen und Stabilisationstraining. Aber noch mehr hielt er von Seilspringen und Reifenwerfen, von Liegestützen und Klimmzügen. Er war ein großer Anhänger der funktionalen Kraft. Beim Boxen hatte er immer wieder erlebt, dass Muskelzunahme keineswegs dasselbe war wie Kraftzunahme. Ein Boxer konnte einfach dadurch, dass er mehr Masse besaß, eine Gewichtsklasse aufsteigen. Aber nahm deshalb auch seine Schlagkraft zu? Oder seine Fähigkeit, Schläge einzustecken? Die Antwort lautete: Nein. Fast nie. Aber die jungen Kerle wollten das nicht glauben. Sie wollten vor allem größere Muckis und damit in den sozialen Medien angeben. Ihnen war gar nicht klar, was das bedeutete: nämlich, dass sie es mit Typen zu tun bekamen, die genauso schwer waren wie sie, allerdings von Natur aus. Sie kapierten es immer erst dann, wenn sie heulend in der Umkleidekabine hockten und der Trainer sich mühsam verkneifen musste: »Ich hab’s dir doch gleich gesagt.« Er selbst hatte zwanzig Jahre gebraucht, um zwanzig Pfund zuzulegen, und zwar zwanzig echte Pfund.
Der Neue arbeitete nur mit seinem eigenen Körpergewicht. Er machte Handstand-Push-ups, einarmige Klimmzüge, Unterarmstütze und andere Kunststücke, sodass die anderen Kursteilnehmer aus dem Staunen nicht mehr herauskamen. Sie fühlten sich provoziert. Es passte ihnen nicht, von einem Neuen, der noch dazu deutlich älter war als sie, so vorgeführt zu werden.
Das Sportstudio war nicht besonders groß, aber relativ hoch, da es direkt unter dem Bogen einer Eisenbahnbrücke lag. Es war ein heißer, schweißgetränkter Raum ohne Klimaanlage, abgesehen von den großen Ventilatoren, die aber nur an den größten Hitzetagen eingeschaltet wurden. Der Besitzer wollte, dass alle schwitzten, und zwar durchgehend. Er mochte Schweiß. Schweiß bedeutete harte Arbeit. Er wollte, dass der Körper auch in den Pausen arbeitete. Knallhart trainieren und locker kämpfen, dieser Spruch hatte durchaus seinen Sinn. An den nackten Backsteinen der hohen Gewölbedecke glitzerten den ganzen Tag und die halbe Nacht über die Schweißtropfen. Dabei bildete sich auch Schimmel, und das war ein Problem. Um dem Problem zu Leibe zu rücken, hatte er eigens ein Gemisch aus Bleichmittel und Reinigungschemikalien entwickelt. Es wurde mit einer Bürste und einer Teleskopstange auf der Decke verteilt. Diese Arbeit mussten die Nachwuchstalente machen. Es kotzte jeden an, aber das schulte den Charakter.
Dazu kam der Gestank. Das war die Kehrseite des Ganzen. Der Körpergeruch war einfach nicht aus der Luft zu kriegen. Er hatte sich so sehr an den gammeligen Mief nach altem Schweiß gewöhnt, dass ihm die abgasgeschwängerte Luft in der Innenstadt lieblich und sauber vorkam. Etliche seiner Kunden waren damit nicht klargekommen. Sie konnten weder ihre eigenen, klatschnassen Klamotten am Körper noch den Schweißgestank der anderen ertragen. Für solche Leute gab es ein Wort. Doch der Ausbilder hatte sich fest vorgenommen, keine unflätigen Worte mehr in den Mund zu nehmen. Er fand, das war ein schönes Gegengewicht zu den Tattoos und dem rasierten Schädel, den Muskeln und den Narben. Die Leute erwarteten geradezu von ihm, dass er ab und zu lauthals fluchte. Und es verunsicherte sie, wenn er es nicht tat. Das gefiel ihm. Aber noch mehr gefiel es ihm, dass er in Gedanken jederzeit so unflätig sein konnte, wie er nur wollte.
Das Seminar dauerte den ganzen Tag: Kraft und Ausdauer am Vormittag, dann Mittagessen und anschließend verschiedene Techniken. Der Abschluss waren dann Sparringskämpfe all derer, die dazu Lust hatten. Der Neue hatte Lust. Und danach gleich noch mal.
»Man hat es entweder oder man hat es nicht«, sagte der Ausbilder am Ende des Seminars, als die Sparringskämpfe beendet waren und alle noch zusammensaßen und ein wenig plauderten, zu dem Amerikaner.
»Was hat man?«
»Herz. Das kann man niemandem beibringen. Man kann es nicht trainieren.«
»Du meinst damit den Instinkt.«
»Kann sein. Ganz egal, wie du es nennen willst, aber du hast es.«
Der Neue gab keine Antwort.
»Du hast meine besten Schüler vorgeführt.«
»Ich habe jeden Kampf verloren.«
Der Amerikaner war der geborene Kämpfer, das sah der Ausbilder sofort, im Gegensatz zu seinen fortgeschrittenen Schülern. Sie hielten sich für die Größten, wenn der Neue auf die Matte klopfte und sie keuchend in der Ecke lagen, sich den Schweiß aus dem Trikot wrangen und versuchten, ihre Schmerzen vor den anderen zu verbergen. Aber der Ausbilder ließ sich nicht täuschen. Er betrachtete seine besten Schüler der Reihe nach und wusste, dass keiner von ihnen sich zur nächsten Stunde blicken lassen würde. Jeder Einzelne würde sich irgendeine dämliche Ausrede einfallen lassen und abwarten, bis die Schwellungen zurückgegangen und die blauen Flecken nicht mehr zu sehen waren. Der Ausbilder musterte den Amerikaner, der zwar müde war, aber immer noch stand, und das nach drei Sparringskämpfen hintereinander. Er rollte mit den Schultern und dehnte seine überanstrengten Muskeln, aber abgesehen davon machte er den Eindruck, als könnte er noch einmal drei Runden mit einem frischen Gegner durchstehen, und dann vielleicht noch einmal. Trotzdem hatte er jeden Kampf verloren, hatte kurz vor dem unvermeidlichen Sieg einen dummen Anfängerfehler gemacht und sich in einem Armhebel oder einem Würgegriff wiedergefunden, aus dem es kein Entrinnen gab. Dann hatte er das Klopfzeichen gegeben, seine Niederlage anerkannt und einem Gegner, der ohne fremde Hilfe nicht einmal aufstehen konnte, zum Sieg gratuliert.
Nein, so leicht ließ der Ausbilder sich nicht hinters Licht führen.
»Von deinen Sparringspartnern kommt diese Woche keiner mehr zum Training. Vielleicht fehlen sie sogar noch nächste Woche.«
Der Neue blieb stumm.
»Du hast sie glimpflich davonkommen lassen, das weiß ich genau.«
»Ich habe verloren«, wiederholte der Amerikaner jetzt. »Jedes Mal.«
»Weißt du was? Ich habe es nur auf einen einzigen Profikampf gebracht, als Boxer«, sagte der Ausbilder. »Und ich habe verloren. Mein Gegner war ein junger Mexikaner. Ein Talent aus dem Stall eines großen Veranstalters. Der wollte ihm mehr Kämpfe, mehr Erfahrung verschaffen, aber ohne Risiko. Das ist absolut üblich. So funktioniert das Geschäft. Zwanzig Kämpfe gegen irgendwelche Unbekannte, um das eigene Talent aufzubauen, ihm eine Statistik zu verschaffen. Tja, also, dieser Mexikaner hat das ganze Fallobst, das sie ihm vorgesetzt haben, so übel zugerichtet, dass niemand mehr gegen ihn kämpfen wollte, zumindest nicht für die lächerliche Gage, die sie dafür bezahlen wollten. Also habe ich zugesagt. Ich war mir sicher, dass ich ihm den dürren Arsch versohlen würde, weil ich nämlich a) auch ein dämliches Bürschchen war und b), weil ich wirklich was draufhatte. Der Veranstalter hat das auch gewusst. Darum hat er mich am Kampfabend beiseitegenommen und mir gesagt, dass er mir die doppelte Gage bezahlt, wenn ich absichtlich verliere. Das war damals für mich ein Haufen Geld, aber es hat mich wahnsinnig angekotzt, dass in dem Sport, den ich liebte, so etwas gemacht wird. Also wollte ich diesen Mexikaner mit aller Macht in den Boden rammen. Ich wollte ihm den Kopf von den Schultern schlagen. Ich war blind vor Wut, eine Kombination aus Jake LaMotta und Marvin Hagler. Und weißt du, was passiert ist? Er hat mich mit dem allerersten Schlag auf die Bretter geschickt. Ein perfekter linker Haken, genau ans Kinn. Ich bin sofort aufgesprungen, noch wütender als zuvor. Das wollte ich ihm heimzahlen, aber er hat mich vier Runden lang windelweich geprügelt, wie eine Piñata. Nur den linken Haken, den hat er kein einziges Mal mehr angebracht. Bei der Schlussglocke hatte ich zwei geplatzte Trommelfelle, vier gebrochene Rippen, mehrere innere Blutungen und eine abgelöste Netzhaut. Dann habe ich erfahren, dass sein Veranstalter ihm kurz vor Beginn des Kampfs gesteckt hatte, dass ich absichtlich k. o. gehen würde. Und das hat ihn genauso wütend gemacht wie mich. Darum hat er sehr genau darauf geachtet, mich nach dem ersten Niederschlag nicht noch einmal entscheidend zu treffen. Er wollte, dass ich leide. Er hat es mir genauso heimgezahlt, wie ich es mir für ihn vorgenommen hatte. Und ich … tja, ich wollte einfach nicht merken, wann es genug war. Wann ich geschlagen war. Ich hatte zwar Herz – viel zu viel Herz –, aber ich habe nie wieder einen Kampf bestritten.«
»Und warum erzählst du mir das alles?«
»Das weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Normalerweise spreche ich nicht darüber. Und wenn ich es tue, dann sehe ich den Leuten meistens an, was sie denken, nämlich: Ausreden, Ausreden. Aber auf die Gefahr hin, dass ich mich irre, ich vermute, dass du einer der wenigen Menschen bist, die mit dieser Geschichte etwas anfangen können.«
Er nickte.
»Hast du Lust, gegen mich zu kämpfen?«, fragte ihn der Ausbilder.
Er war noch nicht oft einem anderen geborenen Krieger begegnet, und noch nie einem, der einen sicheren Sieg einfach wegwarf. Denn was den Krieger vom Kämpfer unterschied, das war der Siegeswille: der Wille, trotz eines geplatzten Trommelfells, ein paar gebrochener Rippen und verschwommenen Blicks auch noch die zwölfte Runde zu bestreiten; der Wille, den Ring zu Fuß zu verlassen, obwohl das Gehirn bereits dabei war, komplett herunterzufahren und einen Neustart zu versuchen. So etwas konnte man nicht lernen. So etwas nannte man Herz. Er wollte wissen, wie viel Herz der Neue tatsächlich besaß.
Doch der antwortete, ohne zu zögern, ohne nachzudenken. »Nein, danke.«
»Wieso? Weil du weißt, dass ich dir in den Arsch treten würde?«
Der Amerikaner lächelte freundlich, signalisierte, dass er den Scherz verstanden hatte, sagte jedoch nichts mehr.
»Oder«, fuhr der Ausbilder fort, »weil dir klar ist, dass ich dich durchschaut habe und du mir deshalb in den Arsch treten müsstest, nur damit ich das nicht kann?«
Er sammelte seine Sachen ein. »Vielen Dank für alles, was du mir heute beigebracht hast.«
»Sehr witzig«, erwiderte der Ausbilder. »Wir wissen doch beide, dass ich dir nicht das kleinste bisschen beigebracht habe.«
Kapitel 6
Es waren dieselben beiden Beamten, die Raven schon beim ersten Mal besucht hatten. Eine Frau und ein Mann. Beide trugen die Uniform der örtlichen Polizei. Der Mann war klein und dick und hatte ein fleischiges Gesicht. Ein Schnurrbart hing wie ein dunkler, haariger Wurm über seine Oberlippe. Die Frau war größer und schwerer, mit breiten Schultern und noch breiteren Hüften. Sie hatte den Körperbau eines Rausschmeißers, aber die wachen Augen einer Denkerin. Sie machte Raven unruhig. Diese Frau würde sich nicht so einfach hinters Licht führen lassen. Sie war jünger als der Mann, schien aber seine Vorgesetzte zu sein, weil sie beim letzten Mal schon das Wort geführt hatte. Doch vielleicht lag es auch an ihrem Alter, dass sie mehr Interesse an der Frau ohne Gedächtnis hatte. Der Mann machte sich schon längst keine Gedanken mehr über die Irren, mit denen er es während seiner Arbeitszeit zu tun bekam.
Der niedliche Pfleger ließ sie allein.
»Sie sind ja früh wieder hier«, sagte Raven.
Der kleine Dicke erwiderte achselzuckend: »Zwei Wochen, zehn Tage, was ist das schon für ein Unterschied?«
»Normalerweise vier Tage.«
Er grinste. »So ungefähr.«
Die Frau sagte: »Man hat uns gesagt, dass Sie mittlerweile zu Kräften gekommen sind und mit uns sprechen können.«
»Da kann ich ja wohl schlecht das Gegenteil behaupten, was?«
Sie nickte. »Die wissen es immer noch am besten, stimmt’s? Die Ärzte wissen immer, was gut ist für uns. Sie sehen aber wirklich deutlich besser aus als beim letzten Mal. Und Sie hören sich auch viel besser an.«
»Danke.«
»Wie ein völlig neuer Mensch, beinahe. Was macht denn Ihr Gedächtnis? Wie geht es dem? Auch besser? Bestimmt, oder?«
»Kann ich nicht sagen«, erwiderte Raven.
»Das ist ja zu schade.« Sie ließ sich gegen die Stuhllehne sinken, die berechnenden Denkeraugen zu schmalen Schlitzen verengt.
Der Dicke sagte: »So was Blödes aber auch.«
»Dann sollten wir uns vielleicht am besten noch einmal vorstellen«, sagte die Frau. »Ich bin Officer Heno, und das ist Officer Willitz. Wir sind von der zuständigen Polizeidienststelle.«
»Ich weiß noch vom letzten Mal, wer Sie sind«, sagte Raven, weil sie zu sehr auf die Körpersprache und die Waffen der beiden Polizeibeamten geachtet hatte und weniger auf Henos Worte.
»Ach«, sagte Heno sofort. »Dann erholt sich Ihr Gedächtnis also doch?«
Raven ärgerte sich, dass sie in eine so offensichtliche Falle getappt war, aber sie lächelte die ganze Situation einfach weg. Schließlich war sie ja nicht richtig bei Sinnen.
»Woran können Sie sich denn noch erinnern?«, hakte Heno nach.
Willitz hatte einen Notizblock aufgeklappt. Fast genüsslich leckte er an der Spitze seines Kugelschreibers.
Raven zuckte mit den Schultern. »Das ist nicht so einfach. Ich weiß, dass ich hier aufgewacht bin, aber alles, was davor war, ist total verschwommen. Ich bekomme immer nur Bruchstücke zu fassen, Umrisse und Geräusche. Ich weiß noch, dass ich mehrere Drinks gehabt habe. Dann fragt mich jemand, ob alles in Ordnung ist … aber das ist alles.«
Heno sah Willitz an. Dieser zuckte mit den Schultern.
Dann sagte Heno: »Das haben Sie uns alles schon beim letzten Mal erzählt. Hat sich vielleicht auch etwas Neues ergeben? Irgendwelche Einzelheiten?«
»Dass ich mich an gar nichts erinnern kann, macht mir doch genauso zu schaffen wie Ihnen, Officer.«
Heno nickte, um ihr – schlecht gespieltes – Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen. »Und was ist mit Ihnen persönlich? Wissen Sie zum Beispiel wieder, wie Sie heißen?«
Raven schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Wissen Sie zufälligerweise, wie häufig eine solche vollständige retrograde Amnesie vorkommt?«
»Ich bin keine Ärztin«, erwiderte Raven und fügte schnell hinzu: »Soweit ich weiß, zumindest.«
»Nun ja, ich habe mich seit unserer letzten Begegnung ein wenig mit dem Thema beschäftigt. Es ist das erste Mal, dass ich jemandem begegne, der unter einem Gedächtnisverlust zu leiden hat, abgesehen von den Besoffenen, natürlich. Meine Büchereikarte ist mittlerweile hauchdünn, so oft ist sie gescannt worden. Ich habe versucht zu begreifen, wie es sein kann, dass ein Mensch vollkommen vergisst, wer er ist und was ihm zugestoßen ist.«
Raven meinte: »Versuchen Sie’s mal mit Sterben.«
Henos Lächeln dauerte nur einen kurzen Moment. »Komisch, dass Sie das sagen, weil nämlich die meisten Fälle einer vollständigen retrograden Amnesie dokumentiert sind. In fast allen Fällen hat die betroffene Person eine schwere Schädelverletzung oder eine andere Schädigung des Gehirns erlitten. Und wissen Sie, wie oft dieses Phänomen infolge eines Herzstillstands beobachtet wurde?«
Raven schüttelte den Kopf.
»Null mal.«
Alle beide starrten sie durchdringend an, beobachteten jede kleinste Reaktion.
Raven setzte eine verblüffte und neugierige Miene auf, die nicht einmal gespielt war, weil sie nicht nur aus beruflichen Gründen mehr über ihren Zustand und das Neurotoxin, das diesen Zustand verursacht hatte, erfahren wollte.
»Und was ist mit einem Zusammenbruch des zentralen Nervensystems, Sauerstoffmangel und Vergiftung?«
Wieder zuckte dieses kurze Lächeln über Henos Gesicht. »Was ich damit sagen möchte: Vielleicht wissen Sie ja doch mehr, als Sie mir erzählen wollen.«
»Warum kommt es mir so vor, als würden Sie sich überhaupt nicht dafür interessieren, wer mich vergiftet hat? Warum geht es Ihnen immer bloß um … mich?«
Officer Heno trat einen Schritt näher. »Wir würden wahnsinnig gerne alles über die Person erfahren, die Sie vergiftet hat. Wir würden den Täter oder die Täterin wirklich zu gerne festnehmen. Aber es gibt da ein kleines Problem: Sie können sich an gar nichts erinnern. Sie wissen nicht, wo Sie waren oder wer Sie sind und erst recht nicht, was passiert ist. Und ich fürchte, bevor wir diese Kleinigkeiten nicht geklärt haben, können wir nicht allzu viel unternehmen. Es sei denn, Sie möchten uns vielleicht doch irgendetwas mitteilen, was wir noch nicht wissen. Nun?«
»Wenn mir noch irgendetwas einfällt, dann erfahren Sie’s als Erste.«
»Bestimmt«, meinte Heno.
»Steigen Sie öfter in Hotels ab?«, wollte Willitz jetzt wissen.
»Was soll das denn heißen?«
»Vielleicht, dass eine Frau, auf die Ihre Beschreibung passt, in einer Hotelbar in der Innenstadt gesehen worden ist, und zwar an dem Abend, als Sie hier eingeliefert worden sind.«
»Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo ich an diesem Abend war.«