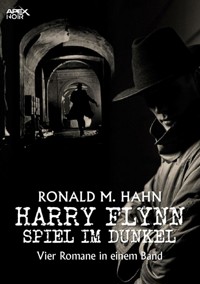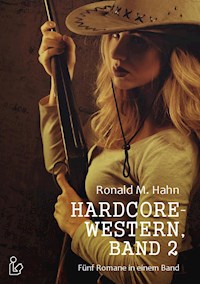2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
An Bord der Somasa hielten sich, wie eine Zählung ergeben hatte, genau achtundfünfzig Menschen auf. Fünf davon waren Frauen: Thorna, das Islahami-Mädchen Layla Chalid, die Treiberin Ragna Magnusson und zwei Mädchen, die als Matrosinnen auf Collyns Segler Sturmvogel gearbeitet hatten.
Von den zehn Menschen, denen es gelungen war, die sinkende Sturmvogel zu verlassen, waren außer Ragna Magnusson noch vier weitere mit Psi-Kräften ausgestattet, ohne sie jedoch auf dieser Welt richtig einsetzen zu können: Farrell, Collyn, Allyn Bradley und Seward Lindon. Bradley und Lindon waren zwar Treiber, aber noch keine Terranauten. Man hatte sie während einer Befreiungsaktion auf Modestan II mitgenommen und nach Rorqual gebracht. Inzwischen waren jedoch auch sie davon überzeugt, dass es keinen Sinn hatte, vor Max von Valdec und seinen Grauen Garden davonzulaufen. Sie hatten an das Komitee der Terranauten ein Aufnahmeersuchen gerichtet, über das nach der Rückkehr von ihrer Testmission entschieden werden würde. Die Suche nach David terGorden war für sie – wie auch für die fünf weiteren Männer, von denen zwei zu Collyns eingeborener Mannschaft gehört hatten – eine Möglichkeit gewesen, ihre Tauglichkeit unter Beweis zu stellen...
DIE TERRANAUTEN – konzipiert von Thomas R. P. Mielke und Rolf W. Liersch und verfasst von einem Team aus Spitzen-Autoren – erschien in den Jahren von 1979 bis 81 mit 99 Heften und von 1981 bis 87 mit 18 Taschenbüchern im Bastei Verlag.
Der Apex-Verlag veröffentlicht die legendäre Science-Fiction-Serie erstmals und exklusiv als E-Books.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
RONALD M. HAHN
DIE TERRANAUTEN, Band 52:
Die Irrfahrt der Somasa
Science-Fiction-Roman
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
DIE IRRFAHRT DER SOMASA von Ronald M. Hahn
1.
2.
3.
Das Buch
An Bord der Somasa hielten sich, wie eine Zählung ergeben hatte, genau achtundfünfzig Menschen auf. Fünf davon waren Frauen: Thorna, das Islahami-Mädchen Layla Chalid, die Treiberin Ragna Magnusson und zwei Mädchen, die als Matrosinnen auf Collyns Segler Sturmvogel gearbeitet hatten.
Von den zehn Menschen, denen es gelungen war, die sinkende Sturmvogel zu verlassen, waren außer Ragna Magnusson noch vier weitere mit Psi-Kräften ausgestattet, ohne sie jedoch auf dieser Welt richtig einsetzen zu können: Farrell, Collyn, Allyn Bradley und Seward Lindon. Bradley und Lindon waren zwar Treiber, aber noch keine Terranauten. Man hatte sie während einer Befreiungsaktion auf Modestan II mitgenommen und nach Rorqual gebracht. Inzwischen waren jedoch auch sie davon überzeugt, dass es keinen Sinn hatte, vor Max von Valdec und seinen Grauen Garden davonzulaufen. Sie hatten an das Komitee der Terranauten ein Aufnahmeersuchen gerichtet, über das nach der Rückkehr von ihrer Testmission entschieden werden würde. Die Suche nach David terGorden war für sie – wie auch für die fünf weiteren Männer, von denen zwei zu Collyns eingeborener Mannschaft gehört hatten – eine Möglichkeit gewesen, ihre Tauglichkeit unter Beweis zu stellen...
DIE TERRANAUTEN – konzipiert von Thomas R. P. Mielke und Rolf W. Liersch und verfasst von einem Team aus Spitzen-Autoren – erschien in den Jahren von 1979 bis 81 mit 99 Heften und von 1981 bis 87 mit 18 Taschenbüchern im Bastei Verlag.
Der Apex-Verlag veröffentlicht die legendäre Science-Fiction-Serie erstmals und exklusiv als E-Books.
DIE IRRFAHRT DER SOMASAvon Ronald M. Hahn
1.
Violette Wolkenbänke zogen sich am Morgenhimmel zusammen, als Maris die Festung seines Großvaters verließ und sich auf den Weg nach Süden machte. Der Tag war kalt und grau und ungemütlich. Er konnte sich nicht daran erinnern, jemals zuvor ein ähnliches Wetter erlebt zu haben. Die Landschaft, durch die ihn sein gehörntes Reittier trug, hatte sich zudem während der vergangenen Dunkelperiode erneut verändert.
Dort, wo gestern noch die hüfthohen Stachelpflanzen gewachsen waren, hatte der Boden nun die fahle Farbe des Todes angenommen. Seltsame Erdhügel bedeckten die vor der Festung liegende Ebene, und vor den Augen der neugierig und ratlos herumstehenden Dörfler wuchsen eiförmige, dunkelbraune Knollen aus diesen Hügeln, die hier und da bereits die Größe ausgewachsener Männer erreichten. Sie kamen aus dem Nichts. Nicht einmal Maris’ Großvater hatte je solche Gewächse gesehen. Eine solche Aussage aus dem Mund eines Mannes, der nicht nur diese, sondern auch zahlreiche andere Welten bereist hatte, musste die Dörfler naturgemäß noch stärker beunruhigen.
Maris’ Großvater war ein alter Mann. Er hatte ein halbes Dutzend Söhne und zwei Töchter überlebt. Fünf Enkel waren ihm verblieben, und einer davon war Maris, den er erst vor wenigen Monaten dazu auserkoren hatte, seine Dynastie weiterzuführen. Maris hatte sich dieser hohen Ehre jedoch nur sehr kurz erfreuen können. Nun verlangten die veränderten Lebensumstände, dass er seine Bestimmung für eine Weile vergaß und sich auf ein anderes Ziel konzentrierte. Während seiner Abwesenheit würde Vetter Georgo auf der Festung die Geschäfte führen. Er war trotz seiner Neigung zum Aberglauben ein verlässlicher Mann. Man konnte ihm vertrauen.
Der Grund, weshalb Maris an diesem trüben Morgen aufgebrochen war, lag darin, dass sein Großvater von einem vorbeiziehenden Händler erfahren hatte, dass auf der fernen Insel Pitcairn seltsame Menschen gelandet waren. Sie sollten angeblich über Flugmaschinen verfügen und kraft ihres Geistes in der Lage sein, miteinander zu sprechen, ohne dabei den Mund zu Hilfe zu nehmen.
Maris’ Großvater hatte sich dieser Geschichte gegenüber nicht nur stark interessiert gezeigt, sondern war von einer auffälligen Erregung erfasst worden, wie Maris sie noch nie an ihm erlebt hatte. Seinen Enkeln hatte er erklärt, dass es sich bei diesen Fremden nur um Angehörige seines Volkes handeln könne. Sie mussten Sternenfahrer sein, Menschen wie er; Leute, die mittels ihrer Geisteskraft Schiffe durch die Große Leere steuern konnten. Mit ihnen galt es Kontakt aufzunehmen. Aber Maris’ Großvater war alt und schwach, und so hatte er den vielversprechendsten seiner Enkel ausgeschickt, um zu den Fremden zu gehen. Bevor er dem Tod ins Antlitz schauen musste, wollte Maris’ Großvater noch einmal mit einem Angehörigen seines Volkes sprechen.
Sosehr sich Maris auch darüber freute, dem täglichen Einerlei auf der Festung zu entgehen, so besorgt war er darüber, dass seine Reise von Ereignissen überschattet wurde, die keinen anderen Schluss zuließen als den, dass es mit der Welt zu Ende ging. Die Felder waren unfruchtbar geworden, und die Tiere zogen fort. Sogar die Menschen hatten sich auf eine große Wanderschaft begeben. Es gab nirgendwo mehr Sicherheit, denn überall wimmelte es von marodierenden Banden und Mordbrennern. Der Hunger hatte zu viele Menschen entwurzelt, und auch auf der Festung würde man bald dazu übergehen müssen, sparsam mit den Vorräten umzugehen. Die meisten Gefolgsleute und Knechte von Maris’ Großvater hatten bereits vor Wochen ihr Bündel geschnürt und waren weitergezogen. Viele wollten nach Süden, denn natürlich hatte der fahrende Händler nicht nur Maris’ Großvater von den Fremden erzählt: Die angeblich magischen Kräfte, die der Händler ihnen angedichtet hatte, hatten in vielen die Hoffnung erweckt, dass sie möglicherweise imstande waren, die gegen die Menschen rebellierende Natur zu besänftigen.
Maris machte sich dergleichen Illusionen nicht. Er war zeit seines Lebens ein aufmerksamer Schüler seines Großvaters gewesen und wusste, dass es magische Kräfte nicht gab. Die Stärke der Fremden basierte auf den ausgebildeten Kräften ihres Geistes. Nichts daran war übernatürlich.
Während des ersten Tages seiner Reise kam Maris an zahlreichen verlassenen Dörfern vorbei. Hin und wieder sah er vereinzelt herumstreifende Plünderer, die sich von den Gefahren nicht schrecken ließen und von dem lebten, was die Flüchtlinge in der Eile zurückgelassen hatten. Es gab nicht mehr viel, wovon sie sich ernähren konnten, und manche waren bereits dazu übergegangen, Baumrinde zu kochen und zu verzehren.
Je weiter sich Maris der Südküste näherte, desto mehr fiel ihm auf, wie der Boden sich verändert hatte. Überall erblickte er tiefe Spalten und gähnende Abgründe. Um eine Strecke von zehn Kilometern hinter sich zu bringen, musste er oft die dreifache Entfernung zurücklegen. Zum Glück war sein Reittier – ein kleines, pferdeähnliches Geschöpf mit zottigem Fell und flatternder, blonder Mähne und einem Schweinerüssel – zäh genug, um nicht schon während der ersten Hälfte des Weges zu ermüden. Wenn er es so weiterritt wie bisher und keine schwierigeren Wegstrecken auf sie zukamen, würde es ihn ohne Rast geradewegs bis an die Küste tragen.
Als Maris die leichteste Etappe seiner Reise hinter sich gebracht hatte, näherte er sich einer Ortschaft, die in hellen Flammen stand. Bevor er nahe genug an sie herangekommen war, um zu erkennen, dass sie keinesfalls verlassen war, jagte plötzlich ein dunkler Punkt auf ihn zu, der rasch größer wurde. Er hielt an. Sein Reittier grunzte ungehalten.
Der dunkle Punkt teilte sich jetzt, und Maris erkannte, dass er es mit mindestens vier Reitern zu tun hatte. Ihm war nicht klar, ob es sich um Stadtbewohner oder Marodeure handelte, aber da er allen Schwierigkeiten aus dem Wege gehen wollte, gab er seinem Reittier mit einem Schenkeldruck zu verstehen, dass ihm daran gelegen war, diesen Ort so schnell wie möglich zu verlassen.
Er riss das Tier herum und jagte weiter. Als er über die Schulter einen Blick zurückwarf, musste er zu seinem Entsetzen registrieren, dass die fünf Reiter ebenfalls die Richtung geändert hatten.
Sie folgten ihm. Und das gefiel Maris gar nicht. Er beugte sich tief über den Hals seines Reittiers und gab ihm die Sporen. Das Tier reagierte sofort. Seine Kraftreserven waren riesig, aber wenn es dieses Tempo über einen längeren Zeitraum hinweg durchhielt, musste er damit rechnen, dass es unter ihm zusammenbrach.
Überraschenderweise holten die Verfolger auf, was nur bedeuten konnte, dass ihre Reittiere frisch und ausgeruht waren. Maris stieß einen Fluch aus und tastete nach der Klinge, die an seinem Gürtel baumelte. Sein Großvater hatte großes Vertrauen in ihn gesetzt. Er wollte ihn nicht enttäuschen. Andererseits...
Maris war ein guter Reiter und ein heller Kopf, aber er war nicht unbedingt ein guter Fechter. Seine Vorliebe hatte stets den schönen Künsten gegolten, und er erträumte sich nichts sehnlicher, als ein Gelehrter zu werden. Sein erstes Buch war schon im Entstehen begriffen. Er schrieb die Lebensgeschichte seines Großvaters auf, um sie der Nachwelt zu erhalten.
Als Maris einen mit Stachelpflanzen bewachsenen Abhang hinaufsprengte, stießen seine Verfolger ein lautes Geheul aus. Auf der Hügelkuppe wurden plötzlich zwei Köpfe sichtbar, und als Maris in plötzlichem Erschrecken sein Reittier herumzureißen versuchte, um den beiden ihn höhnisch musternden Banditen zu entkommen, strauchelte es und wäre beinahe gestürzt.
Im letzten Moment gelang es dem Tier, sich zu fangen. Aber sie hatten kostbare Sekunden verloren. Während die fünf Verfolger laut schreiend den Hügel in Angriff nahmen, richteten sich die beiden Gestalten auf der Kuppe auf und winkten ihnen zu. Auch die Männer vor Maris waren beritten, wie sich jetzt herausstellte. Sie schwangen sich in die Sättel ihrer Reittiere und sprengten von oben her auf ihn zu. Nur fünfzig Meter trennten sie noch.
Angriff ist die beste Verteidigung, dachte Maris und jagte entschlossen auf die beiden von oben kommenden Wegelagerer zu. Die hageren Männer mit den unrasierten Gesichtern und den flammendroten Stirnbändern hatten offensichtlich nicht damit gerechnet, dass ihr vermeintliches Opfer bereit war, alles auf eine Karte zu setzen. Ehe sie sich von dem Schreck erholten, war Maris zwischen ihnen und teilte nach rechts und links Hiebe aus. Der Marodeur zu seiner Linken schrie und fiel aus dem Sattel. Der andere duckte sich, aber sein Reittier strauchelte, verlor völlig das Gleichgewicht und rutschte, ein heulendes Geräusch ausstoßend, den Abhang hinunter.
Maris jubelte. Sein Plan war geglückt! Er sprengte über die Hügelkuppe hinweg und ließ seinem Reittier, als es wieder abwärts ging, völlig freie Hand. Seine Verfolger schienen sich derweil um die beiden Burschen zu kümmern, die er übertölpelt hatte, denn es dauerte mehrere Minuten, bis sie wieder sichtbar wurden.
Vor ihm breitete sich nur eine steinübersäte, hier und da von Tulpenwaldinseln bedeckte Ebene aus. Am Horizont wurden die zackigen Gipfel der Schwarzen Berge sichtbar. Wenn es ihm gelang, den Pass zu erreichen, bevor es dunkel wurde, hatten die Banditen das Nachsehen. Es war schwierig, wenn nicht gar unmöglich, einen einzelnen Menschen in dieser wildzerklüfteten Bergwelt zu verfolgen. Zudem wimmelte es in den Seitentälern von Halsabschneidern aller Art, und eine größere Reitergruppe musste dermaßen viel Lärm erzeugen, dass sie sofort die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog. Auch für Maris würde es nicht einfach sein, den Pass zu überqueren, aber er war ein gewitzter Bursche und besaß die Fähigkeit, unnötigen Kämpfen geschickt aus dem Weg zu gehen.
Hinter den Schwarzen Bergen setzte sich die Ebene fort. Dort entsprang auch der Fluss, der drei Tagesreisen später in das Meer mündete. Es gab zahlreiche Hafenstädte an der Südküste des Nordkontinents. Maris hoffte, dort ein Schiff zu finden, das ihn an Saryfa vorbei zum Hauptkontinent bringen würde. Er hatte ein kleines Säckchen mit wertvollen Edelsteinen bei sich; sein Großvater hatte ihn bestens ausgerüstet.
Wie sich eine Stunde später herausstellte, dachten die Marodeure nicht im Entferntesten daran, die Verfolgung aufzugeben. Maris fragte sich, ob einer der Burschen, die er aus dem Sattel geworfen hatte, vielleicht sein Gesicht kannte. Sein Großvater war ein wohlhabender und bekannter Mann; da lag die Vermutung, aus ihm würde man ein hübsches Sümmchen herausschlagen können, sicher nahe.
Als Maris den Pass erreichte, begann sein Reittier, die ersten Anzeichen von Erschöpfung zu zeigen. Der schwarzfellige Paarhufer röchelte, und das gab Maris zu denken. Er stieg kurz ab, führte das Tier mehrere hundert Meter am Zügel und saß dann wieder auf. Die Wasserhöhle, der er sich näherte, konnte nicht mehr weit sein. Mit etwas Glück konnte er dort sein Reittier tränken und dann ein Pulver in die Quelle schütten, das sie für vierundzwanzig Stunden ungenießbar machte. Vielleicht gaben die Verfolger dann auf.
Maris erreichte die Wasserhöhle ohne Schwierigkeiten. Als sein Reittier das herrliche Nass witterte, verdoppelte es seine Anstrengungen und jagte noch einmal für ein paar Minuten wie ein Pfeil dahin. Der Eingang zum Wasserloch lag rechter Hand des Weges. Maris sprang ab, kletterte eine raue Felswand hinauf, blickte auf den Pass hinunter, stellte fest, dass die Marodeure gerade erst im Begriff waren, die niedrigen Ausläufer der Schwarzen Berge zu durchqueren, und machte sich an die Arbeit.
Nachdem er sich satt getrunken und seine Feldflasche gefüllt hatte, nahm er seine Mütze, füllte sie und rutschte wieder zur Passstraße hinunter. Das Reittier trank in langen, gierigen Zügen. Es blühte sichtlich auf. Maris füllte die Mütze noch zweimal, dann setzte er sie wieder auf und erklomm die Felswand zum letzten Mal. Das Wasserloch befand sich in einer kleinen Höhle, in der ein Mann, wenn er nicht zu gewaltig gebaut war, gerade aufrecht stehen konnte. Das Wasser selbst war herrlich kalt und klar. Es war eine Schande, es ungenießbar zu machen, aber er hatte keine andere Wahl.
Rasch öffnete Maris ein kleines Fläschchen und schüttete das grüne Pulver in die Quelle. Das Wasser begann zu brodeln und zu zischen, verfärbte sich rot und begann augenblicklich übel zu riechen. Mit einem befriedigten Lächeln bestieg Maris sein Reittier und jagte weiter.
Als er den höchsten Punkt der Passstraße erreicht hatte, verdunkelte ein Schatten den Himmel und ließ sein Reittier scheuen. Maris verlor die Balance. Ein menschlicher Körper stürzte sich auf ihn herab und warf ihn aus dem Sattel. Ein stechender Schmerz fuhr durch seine Schulter, dann legten sich eisenharte Hände um seinen Hals. Er sah das Gesicht eines zerlumpten Bergbanditen, das sich über ihn beugte und dessen Blick nur zu deutlich sagte, dass Maris’ Leben nicht mehr viel wert war.
»Nicht«, gurgelte Maris. Seine Hände fuhren wild tastend in der Luft herum und bekamen schließlich die Haare seines unbekannten Gegners zu fassen. Mit aller Kraft, zu der er fähig war, begann Maris, daran zu zerren. Der Fremde schrie auf. Seine Hände lösten sich. Maris rammte ihm den Kopf gegen die Nase und rollte sich zur Seite. Ehe der Bandit wieder auf den Beinen war, stand Maris über ihm und zielte mit der Spitze seines Schwertes auf seine Kehle. Der Fremde stöhnte entsetzt auf. Sein irrer Blick klärte sich, und dann sagte er mit einem verschreckten Unterton: »Nein, nein, verschone mich!«