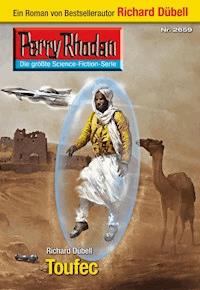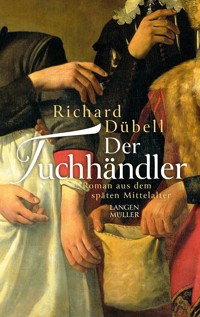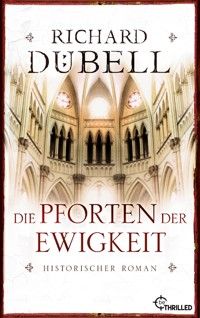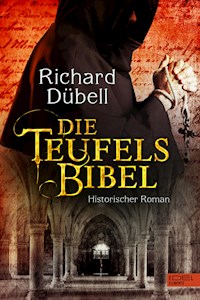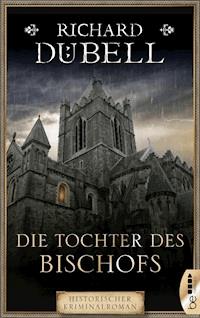
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Sänger im Dienste des Bischofs und ein verschwundener Mönch, zu dem eine blutige Fährte führt ...
Aquitanien, Frühjahr 1183. Raymond, Sänger und Geschichtenerzähler, ist auf der Suche nach einem Brotgeber. Seine letzte Hoffnung ist der Bischof von Poitiers, der ihm schließlich eine ungewöhnliche Aufgabe stellt: Raymond soll Fermin, den verschwundenen Assistenten des Bischofs, wiederfinden. Als ein Mord entdeckt wird, ahnt der Sänger, dass Fermin etwas damit zu tun hat, doch alle Indizien sprechen dafür, dass Raymond selbst der Täter ist. Ihm ist klar: Er ist in eine Sache verwickelt, die dramatischer ist als alle seine Geschichten ...
Weitere historische Romane von Bestsellerautor Richard Dübell bei beTHRILLED: Im Schatten des Klosters, Die Die Braut des Florentiners und Krimis der Tuchhändler-Reihe.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Ein Sänger im Dienste des Bischofs und ein verschwundener Mönch, zu dem eine blutige Fährte führt …
Aquitanien, Frühjahr 1183. Raymond, Sänger und Geschichtenerzähler, ist auf der Suche nach einem Brotgeber. Seine letzte Hoffnung ist der Bischof von Poitiers, der ihm schließlich eine ungewöhnliche Aufgabe stellt: Raymond soll Fermin, den verschwundenen Assistenten des Bischofs, wiederfinden. Als ein Mord entdeckt wird, ahnt der Sänger, dass Fermin etwas damit zu tun hat, doch alle Indizien sprechen dafür, dass Raymond selbst der Täter ist. Ihm ist klar: Er ist in eine Sache verwickelt, die dramatischer ist als alle seine Geschichten …
Über den Autor
Richard Dübell, geboren 1962, lebt mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen in Niederbayern und ist Träger des Kulturpreises der Stadt Landshut. Er zählt zu den beliebtesten deutschsprachigen Autoren historischer Romane. Seine Bücher standen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurden in 14 Sprachen übersetzt. Mehr Informationen über den Autor finden Sie auf seiner Homepage: www.duebell.de
Richard Dübell
DIE TOCHTER DES BISCHOFS
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2004 by Richard Dübell
Copyright 2004/2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schluck GmbH, 30827 Garbsen Umschlaggestaltung: U1berlin / Patrizia di Stefano unter Verwendung von Motiven © shutterstock: photocell | photomaster; © pixabay: darksouls1 Illustrationen im Text: Richard Dübell Lektorat: Anne Bubenzer eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-5401-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für R.C. und P.M. und für Sam, der einmal dasselbe tun musste
Die Sünde liegt nicht in der Tat, sondern in der Absicht. Um eine wirkliche Sünde zu begehen, muss der Täter sein eigenes Moralgewissen verletzen; nicht nur das der anderen. Pierre Abaelard
DRAMATIS PERSONAE
(ab initio orditi)
RAYMOND LE RAILLEUR
Vagant
Neigt dazu, den rechten Augenblick zu versäumen
ARNAUD
Anführer einer Gauklertruppe
Ist der Ansicht, dass manche Dinge einfach passieren, oder nicht?
CAROTTE
Gauklerin
Glaubt an die Bedeutung des eigenen Gewissens
GUIBERT
Kaplan
Verfügt über feste Grundsätze
JEAN BELLESMAINS
Bischof von Poitiers
(historisch)
Ein Mann auf einer langen Suche
FIRMIN
Cluniaszenser, Assistent
von Jean Bellesmains
Ist verschwunden
MEISTER HUGUE
Wirt des Zufriedenen Prälaten
Hat seine Gäste und jede Menge Gewicht verloren
FOULQUES
Knappe, Verwalter und Freund Robert Ambitiens
Besitzt einen festen Leitsatz und hat eine große Liebe
ROBERT AMBITIEN
Freier Ritter
Will sein Leben auf neue Beine stellen
JEUNEFOULQUES
Pferdeknecht
Foulques’ Bastardsohn
SUZANNE AMBITIEN
Ehefrau von Robert Ambitien
Nicht nur Gegenstand der Begierde
BALDWIN, BAVARD, THIBAUD, RAOUL, VINCENT, HIPPOLYTE
Cluniaszensermönche
Nicht mehr alle von ihnen sind noch am Leben
JEHANNE GARDER
Die Schöne, der Engel, die Königin der Herzen
Ihre wundertätigen Hände haben selbst ein Wunder nötig
BERTRAND D’AMBERAC
Ein Mann auf eigenen Füßen
Rückt Raymonds Bild des neuen Standes wieder gerade
DES WEITEREN:
Arnauds Truppe, stets auf der Suche nach dem nächsten Brotgeber
Ein Vizegraf, der einen anstößigen Umgang pflegt
Einige erschreckende Vertreter des neuen Standes in Chatellerault
Einige nicht ganz so erschreckende Vertreter des neuen Standes in Poitiers
Eine Menge Hungriger vor der Klosterpforte
Roberts Burgknechte, schweigsame Burschen allesamt
Suzannes Zofen, vom Schöpfer ungleichmäßig ausgestattet
Ein Stadtwächter mit Sinn für Tauschgeschäfte
Ritter, Mönch und Bauersleut’ und ein paar Ketzer, Ausgestoßene, Gesetzlose, Verfemte und sonstige vom Glück Vernachlässigte (die übliche mittelalterliche Fauna)
IN IHREN HISTORISCHEN ROLLEN:
ALIÉNOR POITOU
Königin von England, Herrin der Troubadoure
Eine Frau mit mehr Energie als Möglichkeiten
HENRI II PLANTAGENET
Noch König von England, Graf von Anjou, Herzog der Normandie, derzeitiger Ehemann von Aliénor Poitou
Hat in seinem Leben drei schwere Fehler gemacht: seinen ältesten Sohn voreilig gekrönt, sich Thomas Becket zum Feind gemacht und seine Frau mit der schönen Rosamonde betrogen
HENRI PLANTAGENET D.J.
gen. El Jove Rey, Freund der Troubadoure, designierter König von England
Fordert sein Recht von seinem Vater, und wenn es sein muss, mit Blut
WALTHER DE CHATILLON
Vagant
Hat rasch erkannt, wie der Hase läuft
GUILHEM IX POITOU
gen. der Troubadour, ehemaliger Herzog von Aquitanien, Großvater von Aliénor
Grandseigneur, Weiberheld, Spaßvogel und Dichter, in den Erzählungen immer noch so präsent wie zu seinen Lebzeiten
PIERRE ABAELARD
Philosoph, Kirchenlehrer
Hat in seinem Leben alles gewonnen und alles verloren
BERTRAND DE BORN, GUILHEM LE MARECHAL, PEIRE VIDAL, GAUCELM FAIDIT, BERNARD DE VENTADORN u.a.
Sänger, Troubadoure, Dichter, Herzensbrecher
… und vermutlich allesamt Ketzer!
Ein Abschiedslied
»So was passiert, oder nicht?«
Arnaud der Gaukler
1.
Raymond traf beim Unterstand ein, als Arnaud dem Neugeborenen die Augen zudrückte.
Die Mutter war zu erschöpft, um mehr zu tun, als leise zu weinen. Carotte und die anderen Frauen der Gauklertruppe, deren Namen Raymond ebenso wenig geläufig waren wie derjenigen, die das tote Kind zur Welt gebracht hatte, schluchzten umso lauter. Arnaud sah zu Raymond auf, als dieser sich durch den Ring der Pilger hindurchdrängte, die gaffend um die Szene in der Ecke des Unterstandes herumstanden. Sie nickten einander zu.
»Er ist mit offenen Augen zur Welt gekommen«, sagte Arnaud, »aber gesehen hat er sie nicht mehr.«
»Die verfluchte Kälte«, erklärte Raymond.
Arnaud zuckte mit den Schultern. Eine der Frauen breitete eine feuchte Decke über die Mutter des toten Kindes und nahm sie in den Arm. Das leise Weinen veränderte sich nicht. Es klang so dünn, wie das Greinen des Neugeborenen hätte sein sollen, aber das Neugeborene lag still und stumm in Arnauds großen braunen Händen. Raymond fühlte, wie Bedauern in ihm aufstieg um das Leben, das keine Chance gehabt hatte, und sah weg.
Arnaud band mit geübten Bewegungen die Nabelschnur ab und richtete sich auf, den kleinen Leichnam in den Händen, ein großer, fast absurd muskulöser Mann mit olivfarbener Haut und langem, gekräuseltem Haar, der selbst in der Kühle des Frühlingsregens nicht zu frieren schien. Er sah sich um und winkte den Männern seiner Truppe zu, die sich etwas abseits mit betroffenen Gesichtern zusammendrängten.
»Es ist deins, Maus«, sagte er. »Nimm Abschied.«
Einer der Gaukler trat zögernd vor. Mit jedem Schritt, den er aus dem Halbdunkel des Hintergrunds nach vorn machte, verlor er ein paar Jahre, und als er vor Arnaud und Raymond stand, war er nur noch ein höchstens achtzehnjähriger Knabe, der sich bemühte zu erfassen, was eigentlich geschehen war – ein verwirrter Junge, der deutlich hinter dem üblichen abenteuerlichen Aussehen der Gaukler hervortrat, in seinem Fall mit Kalk und Fett gefärbtes und steil nach oben gekämmtes Haar sowie einer Menge Ohrringe in einem Ohrläppchen und einem Geißbärtchen an der Unterlippe. Sein Anblick versetzte Raymond einen Stich; der Junge kam ihm vor, als sei er nur wenige Jahre von dem Kind entfernt, das ihm Arnaud übergab. Maus starrte den Leichnam an, und seine Unterlippe begann zu zittern.
Arnaud wandte sich ab; die Pilger, die um ihn und seine Leute herumstanden, schien er kaum wahrzunehmen. Er war sein halbes Leben herumgezogen, um vor Publikum aufzutreten und seine Späße zu machen; Raymond vermutete, dass Arnaud es nur natürlich fand, wenn auch etwas vor Publikum stattfand, das weniger zum Lachen war. Ganz und gar nicht zum Lachen. Raymond fand es schwer, den Blick von dem blau angelaufenen Körper zu wenden. Maus schüttelte den Kopf wie jemand, der nicht wieder damit aufhören kann. »Was soll ich denn damit machen, was soll ich denn damit machen?«, flüsterte er.
Raymond klopfte Arnaud auf die Schulter und drängelte sich wieder nach draußen ins Freie. Der Regen fiel dicht und so kalt, dass seine Hände selbst in den feinen ledernen Handschuhen froren. Zusammenhanglos überlegte er, dass sich alle seine Instrumente wieder hoffnungslos verstimmt haben würden, bis er die nächste trockene Unterkunft erreichte. Was soll’s, dachte er dann, es ist ohnehin weit und breit niemand in Sicht, für den ich spielen könnte. Jean le Maréchal hatte die Großzügigkeit von Königin Aliénor und ihrem ältesten Sohn, Henri dem Jungen König, über alle Maßen gerühmt – doch das war zehn Jahre her, nichts war mehr so, wie es einst gewesen war, und Jean le Maréchal kämpfte auf der Seite des jungen Königs in der Normandie, anstatt Lieder zu komponieren oder auf den Turnierplätzen Frankreichs zu brillieren. Bernard de Ventadorn, der sich selbst ohne Scham als den begabtesten Troubadour bezeichnet hatte (»Es ist kein Wunder, wenn sich kein Sänger mit mir vergleichen kann!« – heiliger Hilarius, der Mann hatte ein gesundes Selbstvertrauen!) und mit seiner leidenschaftlichen Verehrung für die Königin ihrem Ehemann Henri Plantagenet schon auf die Nerven gegangen war, als Henri und Aliénor einander noch in Liebe verbunden waren, hatte sich ins Kloster zurückgezogen und bemühte sich, sein Leben zu bereuen. Raymond verachtete ihn, während er ihn gleichzeitig darum beneidete, ein warmes Plätzchen gefunden zu haben, ohne wie die meisten anderen seiner Zunft die Flucht nach Flandern, in die Champagne oder über die Pyrenäen an die spanischen Höfe anzutreten.
Hauptsächlich aber dachte er an das tote Kind, während er in den grauen Himmel spähte und den Regentropfen zusah, wie sie aus ihm herunterstürzten. Er blinzelte, als sie sein Gesicht trafen. Gott hatte es entstehen und heranreifen lassen, und dann hatte er es zu sich genommen, noch bevor es eine Chance gehabt hatte, etwas mit dem Geschenk des Lebens anzufangen. Wenn das Geschenk ein Irrtum gewesen war, dann hatte Gott ihn reichlich spät bemerkt. Raymond sah sich um, die schlammbedeckte Straße, die nassen Felder, die kümmerlichen Getreidehalme, zwischen denen immer noch viel zu viel triefend feuchte Erde zu sehen war (wenn sie nicht in einer Seenlandschaft aus flachen Pfützen standen, die das Grau des Himmel widerspiegelte), das unterentwickelte Laub an den Bäumen. Der Frühling war fast vorüber, und der Süden Frankreichs ertrank in Regen und erstarrte in der Kälte, und das nun schon das dritte Jahr hintereinander, der Herr stehe uns bei. Wo war das süße Aquitanien geblieben, reich an saftigen Weiden und prächtigen Wäldern, überquellend von Früchten und vom Wein süß wie Nektar? Raymond öffnete den Mund und ließ ein paar Regentropfen auf seine Zunge fallen, ohne durstig zu sein. Süß wie Nektar, ganz bestimmt. Wenn auch das ein Irrtum Gottes war, dann blieb zu hoffen, dass er auf ihn ein wenig schneller aufmerksam wurde.
Neben ihm räusperte sich jemand. Er wandte sich um. Carotte nickte ihm müde zu und rieb sich dann Tränen und Regen über das nasse Gesicht. Dutzende von Zöpfchen, die sie in ihr rotes Haar gedreht hatte, um zu verbergen, wie kurz es nach der letzten Läuseschur noch war, hingen traurig herab.
»Hallo Raymond«, sagte sie heiser, »ich dachte, du wolltest noch eine Weile in Chatellerault bleiben?«
Die Pilger begannen leise miteinander zu tuscheln. Sie trugen die breitkrempigen Hüte und schweren Mäntel, die als Wahrzeichen der Santiago-Pilger beliebt geworden waren, in den Händen lange Stöcke – unterwegs über die Berge nach Compostela, mit Poitiers und dem Grab der heiligen Radegonde als nächstem Ziel vor Augen.
»Wie ein Tier im Stall; ist das nicht eine Schande?«, erklärte eine Stimme aus ihrer Gruppe.
»Stimmt.«
»In der Kälte und dem Regen.«
»Da hatte es keine Chance.«
»Äääh, das arme Geschöpf.«
»Der heilige Jakob erbarme sich seiner.«
»Und der heilige Martin von Tours!«
»Amen.«
»Ihr müsst es beerdigen.«
»Wir werden euch helfen.«
»Es ist noch nicht mal getauft.«
»Wo sollen wir hier einen Diakon herbekommen?«
»Aber das ist doch nicht nötig; es ist doch ein Mönch unter uns.«
Raymond und Carotte drehten sich um. Die Pilger hatten in ihrer Mitte einen Raum um einen Mann entstehen lassen, der in seiner grauen Kutte und dem langen Reisestock genauso ausgesehen hatte wie einer von ihnen. Die Kapuze verbarg sein Gesicht fast vollständig.
Arnaud trat auf ihn zu. Der Gaukler überragte den Mönch beinahe um Haupteslänge. »Ist es wahr, bist du ein heiliger Bruder?«
»Erkennst du nicht, wenn ein Diakon Gottes vor dir steht?«, fragte der Kirchenmann. Seine Stimme war hell und brüchig; er war derjenige aus der Gruppe der Pilger, der das mit der Schande gesagt hatte. Raymond musterte seinen Rücken und begann zu ahnen, dass er es anders gemeint hatte, als seine Reisegefährten es auffassten.
»Dann hast du ja die Diakonweihe; noch besser.«
»Ich bin Diakon.«
»Das reicht, um die Taufe zu spenden, oder nicht?«
Der Diakon antwortete nicht.
»Würdest du …?« Arnaud deutete mit dem Daumen über die Schulter zu Maus hinüber, der mit seinem toten Sohn in den Händen immer noch völlig verloren dastand.
Der Diakon schüttelte stumm den Kopf.
»Warum denn nicht?«
Der Diakon zögerte ein paar Momente; wie es zuerst schien, aus Verlegenheit. Als er sprach, wurde klar, dass er nur nachgedacht hatte, ob er sich so weit herablassen sollte, Arnaud seine Gründe zu erklären. »Woher sollte einer wie du auch wissen, dass es dazu heiligen Werkzeugs bedarf?«, sagte er schließlich.
»Das einzige Werkzeug, das du brauchst, sind deine Hände«, erklärte Raymond und fragte sich selbst, weshalb er sich einmischte. »Öl und Weihwasser kannst du dir sparen, der Regen würde es ohnehin schneller abwaschen, als du Amen sagen kannst.«
Die Pilger nickten; ein paar ließen den Schatten eines Grinsens auf ihren bartstoppeligen Gesichtern erkennen. Der Diakon stand stocksteif vor Arnaud.
»Sind die beiden überhaupt Mann und Frau vor dem Sakrament?«, fragte er und deutete auf Maus und die Mutter des Kindes auf dem Boden.
Arnaud kratzte sich unter seinen langen Locken und blickte zu Boden. »Als ihm klar wurde, dass sie schwanger war, ist er nicht weggelaufen. Ich finde, das zählt. Oder nicht?« Sein breiter bretonischer Akzent ließ seine Worte ungeschickt wirken, und seine verlegene Körperhaltung tat ein Übriges. Raymond fragte sich, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn er einfach gelogen hätte. Wie hätte das kleine Diakönchen den Unterschied bemerken sollen? Die Pilger spitzten die Ohren. Wenn Raymond sie richtig eingeschätzt hatte, waren sie einfache Leute, die das Problem, dass die Leidenschaft eher über die Menschen zu kommen pflegte als der Priester mit seinen Sakramenten, aus ihrer nächsten Umgebung kannten. Sie mochten die Gaukler heimlich fürchten, wenn sie durch ihr Dorf kamen, doch die Tragödie vor ihren Augen brachte ihnen die Menschen hinter ihrer bizarren Aufmachung näher.
»Ääääääh, na komm schon, Bruder Guibert«, sagte einer der Pilger, den die Stimme schon vorher als Frau verraten hatte. »Du liebe Güte!«
Der Diakon wandte sich ihr zu. »Ich habe etwas mehr Respekt verdient, erst recht von einem Weib.«
»Bitte«, sagte Maus, dessen Stimme noch jungenhafter war als sein Aussehen, »ich meine … äh … es kann doch sonst nicht zu den Engeln in den Himmel kommen.«
Die Stimme Guiberts war kalt. »Und an welche Engel glaubst du?«
Maus spähte verwirrt unter Guiberts Kapuze. Man konnte sehen, dass er tatsächlich versuchte, ein paar Namen zusammenzubekommen. Raymond, der den Hintergrund der Frage sofort verstanden hatte, biss die Zähne zusammen und schüttelte den Kopf.
Der Diakon wandte sich zu den Pilgern um, seinen bisherigen Weggefährten. Nun erkannte Raymond ein jugendlich bleiches Gesicht unter der Kapuze. Der Mann war glatt rasiert, nicht viel älter als Maus, der seinen toten Sohn mit ausgestreckten Armen hielt; jünger als Raymond, viel jünger als Arnaud, der mit etwas Mühe sein Vater hätte sein können.
»Wer weiß, wo dieses Volk herkommt«, sagte er. »Vielleicht aus dem Provenzalischen und hat die dortigen Ideen mitgebracht?« Er gab sich keinerlei Mühe, von den Gauklern nicht gehört zu werden. Sogar die weinende Mutter in der Ecke hob den Kopf und starrte ihn an. »Seid ihr so naiv, dass ihr nicht wisst, dass ein Geweihter sich nicht verunreinigen darf? Dass er über solchem Schmutz steht, wie wir ihn hier sehen? Ist euch nicht klar, dass ich durch die Weihe mehr geworden bin als ihr: ein rechter Diener des Herrn?«
»Du bist ein rechter Esel vor dem Herrn«, sagte Raymond. »Wieherst schon über die Disteln, bevor du geschaut hast, ob es nicht doch nur Blumen sind.«
Der Kopf des Diakons schnappte nach oben. Seine Augen bohrten sich in die Raymonds. »Vade retro«, zischte er.
Raymond grinste, obwohl er sich noch immer fragte, weshalb er sich einmischte. Die Gaukler, so herzlich sie in den letzten beiden Tagen mit ihm umgegangen waren, gehörten nicht zu seinen Freunden.
»Ich vade ja schon«, sagte er. »Den ganzen Tag vade ich schon im Schlamm der Straße, das brauchst du mir nicht extra zu befehlen.«
Die Pilger kicherten. Die Augen des Diakons wurden schmal vor Zorn.
»Wir sind keine Katharer«, sagte Arnaud.
»Wie willst du mir das beweisen?«
»Und wie willst du das Gegenteil beweisen? Bei der Nässe kriegst du keinen Scheiterhaufen zum Brennen.« Die Pilger kicherten erneut und nickten zu Raymonds Worten, und dieser dachte: Nun sollte ich aber wirklich endlich meinen Mund halten.
Guibert musterte Raymond schweigend. Der Blickwechsel sagte Raymond deutlich, dass der junge Mann erkannte, wer sein eigentlicher Widersacher war. Arnaud war nur ein hilfloser Bär, der Guibert mit einer Umarmung hätte zerquetschen können und dennoch vor Nervosität nicht wusste, wie er seine Worte zu wählen hatte.
»Und das Balg, ist das vielleicht nicht in Sünde gezeugt worden?«
»Bitte«, versuchte es Arnaud erneut, »die beiden sind jung und waren voller Hitze, sie werden es nachholen, oder nicht?«
»So spricht der Wurm, der sich den ganzen Tag im Dreck suhlt und sagt: Gestern war gestern, heute lebe ich, um morgen soll der Herr sich kümmern, was schert mich die Reinheit meiner Seele?«
Arnaud senkte den Kopf. Wie der mächtig gebaute Mann vor dem schmächtigen Diakon schrumpfte, ließ in Raymond die Galle aufsteigen, und er vergaß seinen Vorsatz wieder, nun endgültig nicht mehr Partei zu ergreifen. »Wir bitten nur um die Taufe für das tote Kind, sonst nichts«, murmelte Arnaud.
»Und warum nicht gleich die Letzte Ölung für die Sünderin?«
Die Frauen der Gauklertruppe schrien empört auf. Selbst die Pilger murrten. Guibert warf den Kopf zurück. »Habe ich nicht die Pflicht vor dem Herrn, meine Hände rein zu halten?«
Arnaud seufzte und wandte sich ab. Maus ließ die ausgestreckten Hände sinken. Die Pilger zuckten mit den Schultern und spähten bereits in den Regen hinaus, ob sie ihre Reise fortsetzen konnten. Auch Raymonds Pferd wieherte und scharrte mit den Hufen. Niemand mochte etwas sagen; das Plätschern des Regens, der vom Grasdach des Unterstands auf den Boden rann, war überlaut.
»Habt ihr eure Sünden bereut, damit der Herr euch vergeben kann?«, fragte der Diakon schließlich. »Es ist Zeit, daran zu denken, wie wir selbst enden werden.« Er sprach im gleichen Moment wie Raymond, der sowohl die Stille als auch den aufsteigenden schlechten Geschmack in seinem Mund nicht mehr ausgehalten hatte und hervorstieß: »Ich werde die Taufe vornehmen.«
O mein Gott, warum tue ich das?, fragte er sich.
Arnaud und Maus blickten auf und gafften ihn an. Carotte, die sich wieder zu den Frauen gesellt hatte und versuchte, die auf dem Boden Liegende durch Massagen warm zu halten, warf Raymond einen scharfen Blick zu. Er fing ihn auf und fühlte sich schuldig, als ob er das, womit er noch gar nicht angefangen hatte, bereits vermasselt hätte.
Die Pilger stießen sich an. Guibert ballte die Fäuste. Tu was, bevor dich der eigene Mut verlässt, dachte Raymond. Er streifte die Handschuhe ab und klemmte sie unter den Gürtel, trat auf Maus zu und nahm ihm das tote Kind aus den Armen. Es war erstaunlich schwer und erstaunlich kalt. Raymond bemühte sich, sich sein Grauen nicht anmerken zu lassen. Er kniete nieder und legte das leblose Ding auf den Boden.
»Wer nichts zu tun hat, kann das Grab ausheben«, sagte er, nachdem er nachgedacht hatte, ob es sich weniger endgültig ausdrücken ließ, und nichts gefunden hatte. Die Mutter des toten Kindes begann wieder zu weinen. Die Männer starrten ihn an.
»Ich mache das«, stotterte Maus, »ich mache es.«
Arnaud stand plötzlich neben Raymond. »Wir können es in ein paar Lumpen einwickeln.«
»Geh zu meinem Pferd. Auf der linken Seite hängt ein Leinenbeutel. Wir können es dort hineintun.«
Arnaud brachte den Beutel. Raymond hörte, dass Guibert mit den Pilgern sprach, doch diese waren weder zum Gehen zu bewegen noch dazu, gegen Raymond einzuschreiten. Raymond schnürte den Beutel auf und legte die Bruchstücke der Fiedel auf den Boden. Arnaud pfiff durch die Zähne.
»Das sieht so aus, als hätte die jemand als Prügel benutzt, oder nicht?«, brummte er, stockte und starrte Raymond an. Sein Mund ging auf. Die Pilger kicherten. Raymond schloss die Augen und fühlte, wie ihm die Schamesröte ins Gesicht stieg. Aufs Neue fragte er sich, warum er sich einmischte. Arnauds einfaches Gemüt war nicht das Einzige, was ihn von den Gauklern trennte, und er wünschte sich, er wäre an diesem Unterstand einfach vorbeigeritten. Arnaud räusperte sich und sagte nichts mehr, und Raymond atmete im Stillen auf; man musste Gott für die kleinen Gefälligkeiten dankbar sein.
»Wie ist der Name?«
Maus sah verwirrt auf. »Was meinst du?«
»Das Kind: Welchen Namen soll es bekommen?«
»Richtig, du musst es ja auf einen … äh … Namen taufen«, sagte Maus töricht. Sein Gesicht arbeitete. Er warf der Mutter einen Hilfe suchenden Blick zu, aber sie starrte nur leer zurück. Plötzlich hellte sich Maus’ Gesicht auf. »Raymond!«, blökte er.
Raymond schloss die Augen und schüttelte dann den Kopf.
»Nein, das geht nicht«, erklärte er, sanfter, als er gedacht hatte, dass es herauskommen würde.
»Äh … nicht?«
»Ihr solltet es Arnaud nennen.«
Der Anführer der Gaukler räusperte sich. Maus blickte von ihm zu Raymond und zurück und begann plötzlich zu lächeln. »Das ist eine gute Idee. Ja, wir nennen es Arnaud. Und sollten wir noch mal eines kriegen, dann kann es ja immer noch … äh … ich meine …« Seine Stimme verlor sich, und er schlug den Blick wieder nieder.
»Arnaud, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen«, sagte Raymond und legte eine Hand auf die kalte Stirn des Kindes. »Ruhe in Frieden, und möge deine Seele bei den Engeln freudig aufgenommen werden«, fügte er aus eigenem Antrieb hinzu. Er schlug das Kreuzzeichen über den kleinen Körper und wischte mit einer Hand voll Regenwasser über das Gesicht. Als er aufsah, wurde ihm bewusst, dass sowohl Carotte als auch Guibert ihn mit weit aufgerissenen Augen beobachteten und dass in beiden Gesichtern, begleitet von völlig unterschiedlichen Emotionen, die Erkenntnis aufblitzte, dass Raymond nicht improvisierte.
Maus hatte mit einem Stock eine flache Grube in die andere Ecke des Unterstands gescharrt; zwei von den Pilgern hatten mit ihren Stäben geholfen. Raymond winkte Maus zu sich heran, und gemeinsam zogen sie den Beutel über den Körper des Neugeborenen. Raymond trug es zu der Mutter hinüber und überredete sie, die Hand auf den kalten, kleinen Kopf zu legen und dem Leichnam den Muttersegen mit auf den Weg zu geben. Sie war beinahe blind vor Tränen, und ihr Körper zitterte vor Kälte, Erschöpfung und vom stoßweisen Schluchzen, das sie nicht unterdrücken konnte; Carotte führte ihr die Hand. Raymond erkannte, dass die Unselige noch jünger war als Maus. Sein Herz war noch schwerer als das Bündel in seinen Händen. Als der Beutel zugeschnürt war und nur noch vage Umrisse andeuteten, was sich darin befand, wurde es ihm ein wenig leichter.
Sie begruben den Beutel in der Ecke des Unterstandes. Als das Erdhäuflein darauf lag, begann Maus zu weinen, sichtlich mehr aus Verwirrung als aus Schmerz um den Tod seines Kindes; sein Schluchzen griff dennoch wie eine kalte Hand in Raymonds Inneres und drehte dort etwas erbarmungslos herum.
Alle sahen ihn an und warteten darauf, dass er etwas sagte. Sein Kopf war leer. Was wollten sie hören? Tröstet euch, das Leben findet unter der Herrschaft des Todes statt, seid froh, dass die Mutter die Geburt überlebt hat (und betet, dass sie die nächsten paar Tage auch überleben wird), der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, verflucht sei der Name des Herrn, Amen?
Wahrscheinlich war es nicht das, was sie zu hören gewünscht hätten.
Raymond drehte sich abrupt um und ging zu seinem Pferd hinüber. Guibert stellte sich ihm in den Weg und musterte ihn demonstrativ von oben bis unten. Dann spuckte er vor Raymond auf den Boden. Raymond hatte nichts anderes erwartet. Er blickte auf den Fleck hinunter. Die Pilger, die sich nicht um das kleine Grab geschart hatten, beobachteten ihn atemlos.
»Dabei ist es hier drin doch schon nass genug«, hörte sich Raymond sagen. Seine Finger zuckten, und der plötzliche Hass auf den Jüngling, der mächtig in ihm aufstieg, obwohl er über die verächtliche Geste nicht überrascht war, ließ seine Stimme gepresst klingen. Die anderen hörten nichts dergleichen; wie die Gaukler war auch Raymond daran gewöhnt, vor Publikum eine andere Sprache zu reden, als sein Herz ihm eigentlich diktierte. Er ging um den Diakon herum, widerstand der Versuchung, ihn dabei mit der Schulter zu streifen, marschierte steifbeinig zu seinem Pferd, nestelte den Ledersack auf und fischte die Laute heraus. Die Saiten waren verstimmt und klangen in seinen Ohren schrecklich, als er mit einer Hand darüber fuhr; er drehte probehalber an den Saitenwirbeln und war sich bewusst, dass er es wahrscheinlich noch schlimmer machte. Auf dem Weg zurück zum Grab räumte er die zerschmetterte Fiedel mit dem Fuß beiseite. Er hätte sie in Chatellerault lassen sollen; sie war jenseits aller Reparatur, und eigentlich wusste er nicht, wozu er die Bruchstücke wieder eingepackt hatte. (Tatsächlich wusste er es genau: Sie war das eine Instrument in seiner Sammlung gewesen, das er wirklich meisterhaft beherrschte, und es war schwer, sich von dem Stück zu trennen, das ihn wenigstens ein Stück weit über den Durchschnitt erhob.) Er war auch mit der Laute gut, aber die Fiedel … Die Fiedel hatte in den wirklich besonderen Momenten seines Spiels in seinen Händen zu leben begonnen.
Er schritt darüber hinweg. Am besten wäre gewesen, er hätte sie mit dem toten Kind begraben.
Als er das Lied spielte, das Cercamon als Klagelied für den Tod Herzog Guilhems vor über vierzig Jahren komponiert hatte, fühlte er nichts. Erst als er die Laute wieder einpackte und der Pilgergruppe nachschaute, die unter der Führung von Guibert weiterzog und im Dämmerlicht des vergehenden Regentages über die Straße ins Zwielicht glitt, dunkelfarbene Figuren in einer Welt aus Grau und Braun, traten Tränen in seine Augen. Unsinnig und völlig absurd wünschte er plötzlich, er hätte irgendetwas tun können, um das Kind zu retten. Die Pilger sahen aus, als wären sie die verhüllten Engel des Todes, die die kleine Seele mit sich nahmen, und es gab nichts Endgültigeres als diesen Anblick der vermummten Gestalten, die mit dem sterbenden Tag verschmolzen.
Arnauds Hand fiel ihm so schwer auf die Schulter, dass er zusammenzuckte.
»Danke für das Liedchen«, sagte Arnaud und starrte ihn neugierig von der Seite an. »Was ist los?«
»Nichts, nichts!«, stieß Raymond hervor und wischte sich heftig über die Wangen. Sein Gesicht brannte vor Verlegenheit. Es brannte noch mehr, als er erkannte, dass Arnaud die Stücke der Fiedel in seinen Pranken hielt; ein Stück des Halses baumelte an einer nicht gerissenen Saite herab und unterstrich die Lächerlichkeit eines Musikinstruments, das auf dem Rücken des Musikanten zerbrochen worden ist. »Es war ein blanh; ich habe ihn nicht selbst gedichtet.«
Arnaud zuckte mit den Schultern. »Es hat sich schön angehört, oder nicht?«
»Warum hast du dir von dem Pfaffen so viel gefallen lassen?«, fragte Raymond. Sein Ärger prallte an Arnaud ab. »Was geht es ihn an, ob die beiden ein Ehepaar sind oder nicht? In den kleinen Bauerndörfern warten sie auch nicht mit dem Kindermachen, bis irgendwann mal ein Klerikaler vorbeikommt und die Paare segnet.«
»Du hast ja gehört, was er uns unterstellen wollte.«
»Na und?«
»So was kann gefährlich werden.«
»Wenn es ein Bischof im Dom sagt oder ein Priester von der Kanzel brüllt, ja. Aber so ein lächerliches kleines Bürschlein, das noch die Wickelfalten am Hintern hat …«
»Du redest dich leicht.«
»Ich war ja auch der Einzige, der mit ihm geredet hat.«
Arnaud zuckte mit den Schultern. »Die Hälfte unserer Zunft hängt den Lehren von Montsegur an, da liegt es ja nahe, oder nicht? Was regst du dich darüber so auf? Die Welt ist überall voll Missgunst.«
»Ach, zum Teufel!« Raymond winkte ab und schnürte den Ledersack zu. »Genau, was rege ich mich eigentlich auf?«
Arnaud stand mit hängenden Schultern neben ihm, ein Hüne, der ein gutes Stück größer war und neben dem sogar Raymonds Pferd zierlich wirkte. »Na ja«, brummte er, »eigentlich ist es mir auch gar nicht wirklich darauf angekommen. Bei allem, was man dem fahrenden Volk unterstellt, fällt eine Verleumdung mehr oder weniger gar nicht mehr auf.«
Raymond nahm Arnaud die Stücke der Fiedel aus den Händen. Arnaud, erleichtert, begann sich am Kopf und dann zwischen den Beinen zu kratzen, während er damit kämpfte, ob er weitersprechen sollte. Raymond unterdrückte den Impuls, die Fiedel einfach über den Rücken seines Pferdes auf die Straße zu schleudern. Er hatte keine Ahnung, was er mit den Teilen anfangen sollte, außer wild fluchend darauf herumzutrampeln.
»Ich konnte ihm schlecht die Wahrheit sagen«, sagte Arnaud. »Er durfte doch nicht erfahren, dass Maus und Sibylle Bruder und Schwester sind.«
Raymond stand der Mund offen.
»Sie sind … was?«
»Na ja, so was passiert, oder nicht?«
»Nein«, sagte Raymond fassungslos, »so was passiert nicht.«
Arnaud zuckte erneut mit den Schultern. Es sagte mehr als jede Erwiderung. Raymond wandte sich ab und begegnete Carottes Blicken. Ihre großen grünen Luchsaugen brannten in ihrem blassen Gesicht. Es war nicht zu erkennen, ob sie den Wortlaut ihrer Unterhaltung gehört hatte; sie kauerte immer noch neben Sibylle und rieb deren Gelenke. Maus saß mit den anderen Männern, näher beim kleinen Grab als bei der erschöpften Mutter und den Frauen. Sie unterhielten sich halblaut und spähten hin und wieder blinzelnd durch das lecke Dach des Unterstandes. Bruder und Schwester. Sie sahen sich nicht ähnlich. Selbst wenn, Raymond wäre es vermutlich nicht aufgefallen; dazu war er zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen. Carottes Augen funkelten und sahen in ihn hinein. Er blinzelte ihr zu und versuchte ein Grinsen, doch im Inneren fühlte er sich von der Intensität ihres Blicks beklommen. Sie blinzelte zurück und lächelte. Vielleicht sah sie doch nicht so sehr in ihn hinein, wie es den Anschein hatte.
»Warum kommst du nicht mit uns?«, fragte Arnaud.
Raymond drehte sich um und starrte ihn an. Arnauds Hände nahmen ihre kratzende Tätigkeit zwischen den Beinen und am Kopf wieder auf.
»Ich meine, das in Chatellerault hat ja wohl nicht geklappt, oder doch?« Arnaud machte eine ungewisse Handbewegung die Straße hinunter. »Wir können uns doch zusammentun. Wir wären die ersten ioculatores …« Er sagt ioculatores, Akrobaten, Jongleure, dachte Raymond, als würden sie an Herzogshöfen auftreten und nicht in den zertretenen Salatköpfen eines Stadtmarktes, aber statt dass er Belustigung über Arnauds geschwollene Wortwahl empfand, regte sich Achtung vor dem widerborstigen Stolz des Gauklers. »… die mit Musik auftreten. Hei«, er stieß Raymond plötzlich in die Seite, »und Carotte tanzt dazu, oder nicht? Händeklatschen und Füßestampfen, und Carotte tut so, als ließe sie die Kerle unter ihre Röcke schauen! Die werden uns die Bühne einrennen! So was hat’s noch nie gegeben: Musik auf den Marktplätzen, und es ist kein Choral und nicht das Gröhlen der Bauern auf dem Dorffest, sondern richtige, echte Musik, von einem Könner dargeboten, wie sie sonst nur die Herren zu hören bekommen. Hei, Raymond, das wäre doch was, oder nicht?«
Immerhin, dachte Raymond, während er Arnaud sprachlos anstarrte, ist er mit seinen Leuten im selben Saal beim Vizegrafen von Chatellerault aufgetreten wie du. So weit seid ihr nicht auseinander, du und er (wenn man es mit dem Maßstab des Erfolgs beim Publikum maß – dem Publikum im Saal von Jaufre von Chatellerault –, dann war Arnauds Truppe sogar höher einzuordnen als er. Nun ja, immerhin hatte er, Raymond, ein paar schmerzhafte Sekunden lang auch für größere Belustigung gesorgt, es ließ sich nicht leugnen, beim heiligen Hilarius nicht und allen sieben Todsünden!).
Aber es gab noch eine Grenze zwischen einem wie Raymond le Railleur, dem fahrenden Sänger, dem Vaganten, dem Interpreten von Tenzonen, Pastourellen, Kanzonen und Sirventen, seinen selbstparodistischen gaps und seinen Liebesliedern, für die er die Musik meistens aus dem Stegreif erfand, mit seinen Bittgesängen in geschliffenem Latein und seinen satirischen Gedichten in melodiöser langue d’oc; und einem wie Arnaud mit seinen Leuten, Gauklern, Akrobaten, Seiltänzern, Volksbelustigern und Kindererschreckern (wohl eher Kinderbeerdiger, aber der Gedanke passte im Moment nicht in Raymonds Stimmung), seiner inzestuösen Truppe von Halbketzern und Aspiranten auf den nächsten Strick oder Scheiterhaufen.
»Du kannst es dir ja überlegen«, meinte Arnaud.
Raymond nickte. Er wurde sich bewusst, dass Carotte ihn die ganze Zeit über gemustert hatte. Er sah auf seine Hände nieder, mit denen er immer noch die verfluchte Fiedel festhielt.
Arnaud und seine Leute waren ehrlos, rechtlos, vogelfrei. Selbst der große Arnaut de Maruelh, der Troubadour, der sich Bedienstete hielt, die seine Kompositionen unter die Leute brachten (oder – sehr diskret – seine Liebesbrieflein an die Adressatinnen, die Spezialität eines seiner Bediensteten, der deshalb pistoleta genannt wurde, »Brieflein«), suchte sich sein Personal nicht unter den Gauklern. Und wenn man es recht betrachtete, war Arnauds Angebot genau andersherum. So weit war es mit Raymond gekommen.
Er hätte die Fiedel wirklich mit dem toten Kind begraben sollen. Beide – das tote Kind und das zerstörte Instrument – waren Symbole für die Hoffnung auf ein Leben, das nicht mehr stattfinden würde. Hätte er nur eher die Zeichen erkannt.
Raymond besaß Ehre und Rechtsstand. Das trennte ihn von Arnaud und seinesgleichen. Und wenn ihm im Winter auf der Straße der Arsch abfror, würde er sich vermutlich an diesem kleinen Unterschied wärmen, bis ihn der Teufel holte.
Ach, zum Henker, dachte Raymond. Ich bin noch nicht am Ende. Der Junge König wird den Plantagenet mit seinen Beamten bald zum Teufel jagen. Und bis dahin – gibt es immer noch Poitiers!
»Ich nehme an, du bleibst über Nacht bei uns, oder nicht?«, fragte Arnaud. »Dieser Unterstand ist das einzige halbwegs trockene Plätzchen zwischen hier und Poitiers, und das erreichst du heute vor dem Dunkelwerden nicht mehr.«
Er hatte Recht. Raymond fühlte Carottes Blicke. Er nickte wieder, diesmal als Zeichen der Zustimmung. Und immer noch hielt er die kaputte Fiedel in der Hand.
2.
Nachdem sie ein Feuer geschürt hatten, scharten sich die Gaukler um ihn, als wäre sein Abschiedslied etwas Besonderes gewesen. Sie klopften ihm auf die Schulter und bedankten sich und boten ihm von ihrem kalten Fleisch an, Reste von der Tafel aus Chatellerault, wie man sie ihm nicht mitgegeben hatte. Er konnte es nicht unterlassen, verstohlen Maus und die im Halbschlaf dahindämmernde Sibylle zu mustern, die Geschwister, deren Kind er begraben hatte. Wie hatte es geschehen können, dass sie nach all den Jahren, die sie aneinander geschmiegt auf einer Strohschütte in der Ecke einer Bauernkate die Nächte verbracht hatten, plötzlich feststellten, dass der nackte Schoß, an die Rundung eines nackten Hintern gepresst, hitzigere Gefühle hervorrief als das Teilen der vagen Körperwärme? Wahrscheinlich war es doch so, wie Arnaud gesagt hatte: Es war einfach passiert. Als Sänger sollte ihm die Macht, die die plötzliche Liebe besaß, eigentlich geläufig sein. O Brüderchen, o Schwesterchen; wenn ihn Arnauds Mitteilung nicht so sehr aus dem Gleichgewicht geworfen hätte, wäre ihm vielleicht noch eine spöttische Pastourelle dazu eingefallen (»Hab dich so lange gekannt, bis ich dich endlich erkannte«, oder: »Hab das Blümlein gepflückt meinem Schwesterlein, und ich meine es so, wie ich’s sage«). Er schüttelte den Kopf. Alles nicht gut, und vor allem: Wenn er an die beiden dachte, sah er den kleinen Erdhügel in der Ecke des Unterstandes vor sich und Maus, wie er den Diakon um die Taufe bat, damit die Seele seines Kindes sich zu den Engeln gesellen konnte. Es waren keine Bilder, die das Dichten eines Liedes unterstützten.
»Kein Wasser? Reicht dir der Regen? Graf Jaufres Bissen sind scharf gewürzt!«, hörte er Arnaud sagen und bemühte sich zu begreifen, was er gefragt worden war und wozu er den Kopf geschüttelt hatte.
»Das Zeug hatte schon einen Stich«, rief Carotte, »und sein Küchenmeister musste tiefer in das Gewürzschränkchen greifen als üblich.«
»Lieber eine Menge Geld ausgegeben, als das Gesicht verlieren.«
»Lieber eine Menge Geld ausgegeben, als dass den Gästen das Essen wieder aus dem Gesicht fällt!«
»Wolltet ihr mir vielleicht Flusswasser andrehen?«, fragte Raymond und lächelte.
»Ganz sicher wollten wir dich nicht bitten, dich mit offenem Mund in den Regen hinauszustellen«, erklärte Carotte. Ihre Lippen glänzten rot vom scharfen Gewürz, und auf ihren hohen Wangen waren Flecken von der Wärme des Feuers, neben dem sie kauerte. Sie lachte laut.
»Danke, dann verzichte ich. Wenn ich Flusswasser trinken soll, muss ich immer an den Bischof von Rouen denken.«
Arnaud grinste. »Was ist mit dem Mann?«
»Nur eine Antiquität, nichts weiter.« Raymond erinnerte sich daran, dass am Ende dieser Geschichte eine Hand voll Toter wartete, und das war nichts, was erzählt werden wollte, schon gar nicht heute. Antiquitäten: sinnlose Geschichtchen, die nichts vom göttlichen Heilsplan erzählten. In keiner seiner Geschichten, ob sie nun wahr oder erfunden waren, konnte Raymond viel göttliches Heil entdecken, doch heute fiel es ihm zum ersten Mal unangenehm auf. Die Gaukler sahen ihn seltsam an. Verlegenes Schweigen machte sich breit.
Raymond erhob sich, um die Situation zu retten, und ging zu seinem Pferd hinüber und brachte den Weinschlauch zurück, den er sich – wenigstens hier war er einmal vorausschauend gewesen, dem heiligen Hilarius sei Dank – in Chatellerault hatte füllen lassen, bevor die Geschichte mit dem aufgebrachten Pfeffersack und Graf Jaufre passiert war. Als er ihn im Kreis herumgehen ließ, seufzte einer der Gaukler ebenso genüsslich wie sehnsüchtig.
»Wir hätten auch als Pilger über Land ziehen sollen, da würden wir jede Nacht in einem Hospiz verbringen und fette Suppe und Wein schlürfen.« Er schmatzte und verdrehte die Augen. Die anderen lachten vorsichtig, unsicher, ob die Bemerkung angesichts des Zusammentreffens mit Guibert und seiner Pilgergruppe nicht ebenso unangebracht war wie Raymonds Weigerung, die Geschichte des Bischofs von Rouen zu erzählen. Unwillkürlich trafen Raymond einige Blicke.
»Das dachte sich Helinand d’Autun auch«, sagte Raymond.
Sie zögerten einige Sekunden. »Helinand wer?«, fragte Carotte schließlich.
»Baron Helinand d’Autun«, betonte Raymond. »Ein Seigneur, der sein Gut in der Nähe von Cluny im Herzogtum Burgund hatte und der sich an jedem Tag, an dem er ausritt, von Pilgerscharen umgeben sah, die sich noch das Fett von den Backen wischten, wenn sie von einem der Klöster in seiner Nähe aufbrachen.«
»Ist man tatsächlich so freigebig zu den Pilgern?«, staunte Maus.
»In Burgund füttern sie sogar die Heuschrecken, wenn sie nur eine graue Kutte anhaben.«
Die Gaukler lachten, Raymonds vorheriges Zögern war vergessen.
»Ihr wisst ja, wie es mit den Seigneurs ist.«
»Nein, wie ist es mit ihnen?«
»Ständig klamm«, sagte Raymond.
Die Gaukler wieherten. »So wie Graf Jaufre«, rief einer, und sie wieherten noch lauter.
»Jedenfalls kam Baron Helinand auf eine gute Idee, um seine Finanzen zu schonen. Er schleppte seine ganze Familie, in Sack und Asche gekleidet, zu den verschiedenen Hospizen und zu allen Armenspeisungen und päppelte sie mit der Klostersuppe.«
»Das gibt’s nicht«, stöhnte Carotte.
»Der Mann hielt jahrelang durch, weil er sich und die seinen in immer wieder neue Verkleidungen hüllte und sich so unerkannt in die Reihen der Bettler und Pilger schmuggeln konnte.«
Die Gaukler schüttelten voller Neid die Köpfe. »He, Arnaud, stell dir mal vor: Carotte mit einer … äh … Pilgerkutte!«, rief Maus. Carotte errötete und warf ihm einen mörderischen Blick zu; vermutlich hinderte nur Maus’ heutiger Status als einer der Hauptdarsteller in einer realen Tragödie sie daran, ihn auf der Stelle bei lebendigem Leib auszuweiden.
»Habt Geduld, Freunde«, sagte Raymond mit der Stimme eines Diakons, der von der Kanzel predigt, »zuletzt flog er doch auf.«
»Na endlich.«
»Gott ist gnädig.«
»Man muss ihm nur ein bisschen … äh … Zeit geben.«
»Schuld an seiner Entdeckung war Helinands Nachbar und Rivale, der plötzlich unabhängig von Helinand dieselbe Idee entwickelt hatte. Die Streithähne standen sich eines plötzlichen Tages am Suppenkessel Auge in Auge gegenüber. Man schritt sofort zu Beschimpfungen, in die sich die jeweiligen Familien einmischten und bei denen schließlich auch die Schlangestehenden Partei ergriffen. Von da war es nicht weit zu Tätlichkeiten. In deren Verlauf wurde viel gutes Essen verschüttet, viel Geschirr zertrümmert, und viele Gliedmaßen wurden verbogen, bevor der Abt des Klosters mit seiner Torwache eingriff und mit wahllosen Knüppelschlägen auf Köpfe und Leiber die Sache für sich entschied. Wie es heißt, dehnte er die Züchtigung auch auf etliche jüngere Mönche aus, die das Spektakel begeistert angefeuert und sich infolge ihrer unterschiedlichen Parteinahme zum Teil bereits gegenseitig an den Hälsen hatten.«
»Gib ihnen«, brummte Arnaud begeistert.
»Der zuständige Bischof war über den Fall so empört, dass er sich um die Exkommunizierung der Schuldigen bemühte; aber das göttliche Strafgericht war ausnahmsweise mal schneller. Nicht lange danach führten Helinand und sein Nachbar eine ordentliche Fehde gegeneinander – und bissen schon beim ersten Zusammentreffen beide ins Gras, übrigens die einzigen Todesfälle des ganzen Scharmützels. Ihr Besitz fiel an den Herzog von Burgund.«
»Und was hat der dazu gesagt?«, fragte Carotte.
»Ist nicht überliefert.« Raymond lächelte. »Wahrscheinlich bekam er vor Lachen keine Luft mehr.«
»Ja«, sagte Arnaud, und es wirkte so merkwürdig, dass keiner wusste, ob er lachen oder betreten sein sollte, »das Leben ist schon lustig, wenn man es lässt.«
In der Nacht schlüpfte Carotte aus dem Wagen heraus, in dem die Gaukler zusammengedrängt schliefen, und zu ihm unter die Decke. Sie kuschelte sich an ihn und drängte ihre kalten Füße zwischen seine Waden.
»Wie schaffst du es nur, bei dieser Kälte hier draußen so warm zu sein?«, stöhnte sie. »Selbst im Wagen ist es kalt und klamm.« Sie schlang die Arme um ihn und seufzte. Raymond war vor Überraschung stocksteif.
»Nanu, Herrin, sollte es Euch nach einem Minnesang dürsten?«, fragte er schließlich aufgeräumter, als er sich fühlte.
»Hör auf mit den geschwollenen Reden, Raymond.« Sie küsste ihn kurz entschlossen auf den Mund. »Hör überhaupt mit dem Reden auf für eine Weile, ja?«
Alles an ihr war fest und sehnig: die schlanken Arme, die kleinen Brüste, ihr flacher Bauch, ihr Po, ihre Oberschenkel, selbst ihre Scham mit dem dichten roten Haargekräusel war ein fester Hügel, der sich erst seinen Fingern, dann seiner Zunge und schließlich seinem steifen Geschlecht leidenschaftlich entgegendrängte. Sie gehörte nicht zu denen, die laut stöhnten oder ihrem Liebhaber ins Ohr flüsterten, sie keuchte stattdessen und zerraufte sein Haar und kratzte in seinen Rücken und seine Pobacken und empfing seine Stöße mit wilden Gegenbewegungen, bis ihre Lust ihn mitriss und er im letzten Moment an den coitus interruptus dachte und sich über ihren festen, sehnigen Körper ergoss. Dann sank er auf ihr zusammen, bemüht, einen Teil seines Gewichts mit den Armen abzustützen, und küsste sie. Die Feuchtigkeit zwischen ihren Körpern wärmte sie und verhieß schon jetzt einen weiteren Ritt auf der Woge der körperlichen Liebe. Im Moment jedoch waren beide, Carotte und Raymond, damit zufrieden, einander nah zu sein und sich in die Augen zu sehen. Sie hatte die Beine noch immer um seine Hüften geschlungen; ihre Schenkel waren heiß, aber ihre Füße so kalt wie zuvor. Er wusste, dass sie auch gekommen war, weil sie instinktiv einen Akt des Lebens dem Akt des Todes entgegensetzen wollte, den sie heute Nachmittag vollzogen hatten.
»Es gibt Kräuter, die eine Schwangerschaft verhindern«, keuchte Carotte nach einer Weile, »außerdem hilft es, wenn man herumhüpft und zu niesen versucht.«
»Du kannst nicht herumhüpfen, wenn ich dich festhalte.«
»Was du für Maus und Sibylle getan hast, war eine gute Tat.«
Raymond zuckte verlegen mit den Schultern.
»Der Diakon hat es gemerkt, nicht wahr?«
»Was gemerkt?«
»Hältst du mich für dumm?«
»Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, sagte Raymond und zauberte ein Lächeln auf sein Gesicht. Carotte starrte ihm in die Augen. Plötzlich begann sie zu schielen, als er etwas vor ihrer Nasenspitze baumeln ließ. Sie griff danach und hielt es fest.
»Meine Halskette«, sagte sie. »Der Knoten ist aufgegangen.«
»Nnnnein«, sagte Raymond.
»Hast du ihn aufgemacht? Hinter meinem Nacken, ohne dass ich es merkte?«
»Jjjjja.«
»Donnerwetter«, sagte sie beeindruckt. »Wo hast du das gelernt?«
»Derjenige, der es mir beigebracht hat, würde sicher nicht wollen, dass ich seinen Namen verrate.«
»Damit könntest du auf jedem Markt als Beutelschneider ein Vermögen verdienen.«
»Ja, und mir selbst eine Halskette erarbeiten. Eine aus Hanf, die der Mann mit der schwarzen Maske mir umlegt …«
Er nahm ihr die Kette aus der Hand und legte sie wieder um ihren Hals. Sie hob den Kopf, doch er zog die Finger schon wieder zurück. »Fertig.« Sie ruckte an der Kette; er hatte sie in Windeseile wieder zusammengeknotet.
»Du vergeudest ein Talent«, erklärte Carotte, und es war unklar, ob sie seine Fingerfertigkeit meinte oder das, worauf sie vorher angespielt hatte. Raymond lächelte sie wieder an.
»Na gut«, sagte sie. »Was willst du jetzt tun?«
»Meinst du jetzt im Moment oder jetzt gleich danach?«
Sie gab ihm einen Stoß mit einer Ferse in den Hintern. »Sei ernst«, sagte sie.
»Ich weiß nicht.«
»Du hast gehofft, eine Weile in Chatellerault bleiben zu können.«
»Natürlich. Mit viel Glück sogar über den Winter, in den dieser Frühling wahrscheinlich nahtlos übergehen wird.«
»Wir ziehen über die Berge nach Aragon.«
»Was ist in Aragon?«
Carotte lachte unlustig. »Zuerst mal: Sonne und trockenes Wetter.«
»Das sind gute Gründe.«
»Am Königshof sind Musik und Tanz willkommen. König Alfons bewundert die Dichtkunst, seit er damals mit Sancho von Navarra in Poitiers zu Gast war.«
»Damals«, sagte Raymond, »als noch Leben war in Aquitanien.«
Carotte erwiderte nichts. Sie bewegte sich unter ihm, und der plötzlichen Melancholie zum Trotz spürte Raymond, wie sich wieder die Lust in ihm regte. Carotte bewegte sich nochmals. Im Inneren des Wagens drehte sich einer von Carottes Kameraden um und furzte im Schlaf. Raymond und Carotte sahen sich an und kicherten unwillkürlich.
»Das war die untere Hälfte der Tonleiter«, erklärte Raymond.
»Ein Sänger erkennt in allem die Musik.«
Raymond prustete und drückte sie enger an sich. Das grobe Geräusch hatte plötzlich wieder die Frage in ihm geweckt, was er hier eigentlich machte unter diesen Menschen? Doch Carottes Nähe war zu angenehm, und er schob seine Bedenken von sich.
»Wir werden in Poitiers Halt machen.«
»Wegen …« Raymond nickte mit dem Kopf in Richtung der Ecke, in der Sibylle ihr totes Kind auf die Welt gebracht hatte.
»Ja. Sie ist zu geschwächt, um die Reise mitzumachen. Es würde sie umbringen.«
Es ist nicht gesagt, dass sie es überhaupt überlebt, dachte Raymond. »In Poitiers gibt es ein Hospiz. Man wird sich um Sibylle kümmern.«
»Wir haben alle zusammengelegt. Die heiligen Frauen werden bestimmt Geld verlangen.«
»Ich hoffe, Arnaud hält sich mit der Auskunft zurück, in welchem Verhältnis Sibylle und Maus zueinander stehen. Sonst hilft euch alles Geld der Welt nichts.«
Carotte musterte ihn. »Für einen, der von der Liebe singt, bist du ganz schön engstirnig, wenn sie dir in einem ungewöhnlichen Gewand begegnet.«
Raymond schnaubte. »Bruder und Schwester, na hör mal …«
»Warum kommst du nicht mit?«
»Wohin? Nach Aragon?«
»Ja.«
»Nein, das ist … nein …«
»Warum nicht? Peire Rogier ist dort, und Elie de Barjols, das sind doch keine Kleinen.«
»Was soll ich dann noch dort?«
»Was willst du hier? Herzog Richard ist in Paris und hofiert König Philippe, der Junge König und sein Bruder Geoffroy toben sich auf Turnieren an der Dordogne aus, Königin Aliénor ist gefangen in England, und die Beamten des verfluchten Plantagenet sitzen in Le Mans, Poitiers und wo du sonst noch willst …«
»Es heißt, der Junge König und Geoffroy de Bretagne rüsten sich zum entscheidenden Schlag gegen den alten Henri.«
»Ja, ja. Henri Plantagenet hält ja bloß alle Festungen und Burgen, die auch nur im Entferntesten von strategischer Bedeutung sind, und seit Jung-Henris und Geoffroys Bruder Richard sich ihm unterworfen haben, ist auch noch das strategische Geschick der Plantagenets auf einer Seite vereint. Bist du der Träumer, oder sind sie es?«
»Ich setze auf Jung-Henri. Seit der Alte ihm die Krone aufgesetzt hat, ist er der rechtmäßige König.«
»Nicht mal der alte Plantagenet akzeptiert ihn als König. Hat er die Macht etwa an ihn abgegeben? Oder warum lehnt sich der Junge gegen seinen Vater auf?«
»Henri Plantagenet ist im Unrecht.«
»Seht her, ein sturer Poiteviner!«
»Seht her, ein treuer Poiteviner!«
Carotte starrte in die Nacht außerhalb des Unterstands hinaus. Ihre Hände waren warm auf Raymonds bloßem, kaltem Rücken. Sie fuhren leicht an seinem Rückgrat auf und ab; es war ein heimeliges Gefühl. Wenn nicht die Berührung ihrer nackten Körper gewesen wäre und die warme Feuchte ihrer Lust dazwischen, wäre es wie das sanfte Streicheln eines Sommerwindes gewesen, der durch die Gräser strich, während man sich nach einem Bad in einem kühlen Bach die Wassertropfen von der Haut trocknen ließ. Carotte wandte sich Raymond zu und lächelte. »Armer Raymond«, sagte sie, »alles hat sich verändert, aber du willst es nicht wahrhaben. Du ziehst herum, aber in Wahrheit wünschst du dir, dass alles ruht. Du trittst auf der Stelle und verwechselst Stillstand mit Standhaftigkeit.«
Carotte strich ihm über die Wange. Ihre Worte waren leidenschaftlich, nicht böse, und dennoch schlug jedes von ihnen eine Saite tief in seinem Inneren an. Sie drehte seinen Kopf, bis er in die Dunkelheit der Nacht jenseits des Unterstandes hinaussah. »Da draußen, da steht auch alles still. Du bist doch nicht wie die dort, die ängstlichen Bauern, die sich heute wünschen, alles wäre so wie gestern, während sie gestern wünschten, alles wäre so wie letztes Jahr. Weißt du, warum die Leute uns hauptsächlich fürchten? Weil wir Unruhe verkörpern, weil in der Zeit, in der wir im Dorf oder in der Stadt sind, nichts ist, wie es vorher war. Sieh dir doch bloß mal die Figuren an den Kirchen an: Fortuna, die das Glücksrad hält. Sie hat so viel Angst davor, was die Bewegung des Rades bringen wird, dass sie sich die Augen verbindet. Es heißt, Veränderung bedeutet Verfall. Ich glaube, Stillstand bedeutet Verfall.« Sie drehte seinen Kopf zwischen ihren starken Fingern wieder zurück und lächelte zu ihm hoch. Schließlich küsste sie ihn. »Und weil die sturen Poiteviner geglaubt haben, es gehe ewig so weiter wie bisher mit dem glanzvollen Leben unter Königin Aliénor und ihren Söhnen, Wein, Weib und Gesang – und nebenher besiegen wir mal kurz Henri Plantagenet von England und seine brabantischen Söldnertruppen, ein Kinderspiel! –, sind sie jetzt ganz unten.«
»Jeder ist irgendwann mal unten«, sagte Raymond und zuckte mit den Schultern. Er war froh, einen halbwegs launigen Abgang aus Carottes Predigt gefunden zu haben. Ihre Worte trafen ihn mehr als die hochnäsige Verachtung Guiberts. Er hatte ein einziges Mal in seinem Leben die vorgezeichnete Bahn verlassen. Anders war es nicht mit seinem Gewissen vereinbar gewesen; und dennoch hatte es ihn so tief verletzt, dass er sich geschworen hatte, es nie wieder zu tun, und den rechten Zeitpunkt, Aquitanien zu verlassen, natürlich verpasste.
»Ja«, sagte Carotte und wand sich unter ihm hervor. Sie drückte ihn mit ihren kräftigen Armen zu Boden. Er wehrte sich nicht. »Und jetzt bist du an der Reihe.« Sie schwang sich auf ihn, die Tatsache nicht achtend, dass die Decke davonrutschte und ihre nackten Körper der nächtlichen Kühle und dem feuchten Dunst aussetzte, der in den Unterstand zog.
»Es so zu tun ist eine Sünde«, sagte Raymond.
»Pierre Abaelard hat gesagt, nur wer gegen sein eigenes Gewissen verstößt, sündigt.«
Raymond verdrehte gespielt die Augen. »Heiliger Hilarius, diese Sünderin ist belesener als die Äbtissin von Fontevrault.«
»Ich höre nur zu, das ist alles. Komm mit uns, und bring mir das Lesen bei, dann wirst du erst recht dein blaues Wunder erleben.«
»Ich habe in der letzten Stunde schon jede Menge Wunder mit dir erlebt.«
Carotte nahm seine Hände und legte sie auf ihre Brüste. Sie waren kalt, die Brustwarzen hart. Als Raymond sie vorsichtig streichelte, fühlten sie sich an wie zwei Perlen auf dem kühlen Samt eines teuren Stoffes. »Was du vorhin mit deiner Zunge getan hast, war auch eine Sünde«, sagte sie.
»Wenn man es mit Abaelard nimmt, nicht.«
Carotte grinste. »Dann hast du also kein schlechtes Gewissen deswegen?«
»Nicht im Mindesten.«
»Also war es keine Sünde.«
Raymond schaffte es, mit den Schultern zu zucken. »Wer kennt sich da noch aus?«
»Wenn es eine war, dann sehen wir uns eben in der Hölle wieder.« Nach einigen Küssen murmelte sie in sein Ohr: »Was willst du denn in Poitiers?«
»Bischof Bellesmains residiert dort. Der Mann hatte schon alle Fäden in der Hand, als Aquitanien noch von Königin Aliénor und Herzog Richard regiert wurde anstatt von den Kastellanen des Königs von England. Ich will mich in seine Dienste stellen.«
Sie küsste ihn wieder und bewegte sich verführerisch. Nach einer Weile murmelte sie wieder: »Komm doch mit uns. Komm mit mir.« Sie strich über sein Haar und dann über sein Gesicht. Ihre Hand war nass und kalt von seinem Haar, sein Haar war nass vom Regen. »Wo es warm ist.«
»Nein«, sagte er, »meine Zukunft liegt bei Bischof Bellesmains.«
»Warum willst du allein bleiben? Allein ist man nichts.« Sie musterte ihn. »Ich verstehe dich nicht.«
Er konnte ihr nicht erklären, dass mit ihnen zu ziehen genau das war, wovor er sich fürchtete: so weit zu sinken, dass ihm nichts anderes mehr übrig blieb als ihr rechtloses Leben. Beide sagten nichts mehr, aber ihr Liebesakt hatte die vorherige Leichtigkeit verloren und war eher wie das Aneinanderklammern zweier Verzweifelter.
In der Nacht hatte er einen Traum, in dem er als versoffenes Wrack den Gauklern die Begleitmusik zu ihren Darbietungen lieferte, während die Kinder mit den Fingern auf ihn zeigten und kicherten. Eines der Kinder war nackt und winzig klein, und die Nabelschnur hing wie eine obszöne Appendix von seinem blau angelaufenen Körper. Es lachte am lautesten. Durch den Suff hindurch spürte er die Verachtung der Kinder, die Verachtung der Zuschauer und am meisten die Verachtung der Gaukler. Selbst für ihre Verhältnisse war er zu tief gesunken. Die Sonne schien grell aus einem tiefblauen Himmel. Er war, wo es warm war, aber sein Herz war eiskalt vor Selbstekel.
Raymond erwachte schwitzend und dankbar, dass Carotte nicht mehr neben ihm lag. Das Tageslicht, wenn es so etwas in dieser Welt aus Gräue und Trübnis und Regen gab, war nicht mehr allzu fern. Er raffte seine Sachen zusammen und stahl sich grußlos davon wie ein Dieb. Der Eindruck des Traums verschwand nicht einmal dann vollständig von ihm, als er schon lange auf der Straße war und der Unterstand nicht mehr als eine Erinnerung, unsichtbar und weit weg im Dämmerlicht hinter ihm.
Die zerbrochene Fiedel hatte er auf den kleinen Grabhügel gelegt, wie eine Opfergabe an einen heidnischen Gott. Zu spät fiel ihm ein, dass die Gaukler es als rührende Geste missinterpretieren würden – wo es doch nur Ausdruck seiner entsetzlichen Angst vor der Zukunft war.
Poitiers, ich komme, dachte er.
Ein großer Dummkopf
»Ich glaube, du musst noch üben.«
Sire Robert Ambitien
1.
Poitiers lag im dunstigen Licht des frühen Regenvormittags wie ein geduckter Haufen flacher Schatten. Die Stadt war von einer hohen Mauer umfangen, die man an einigen abschüssigen Stellen im Norden, wo die Abhänge des Hochplateaus zum Zusammenfluss von Clain und Boivre abfielen, abgestützt hatte, weil die nasse Erde zu rutschen begann. Hinter der Mauer: nass glänzende, steile Holzdächer, Hausfassaden, die vor Feuchtigkeit schwarz waren – würde man sie anfassen, das Holz wäre weich und glitschig und würde einem unter den Fingernägeln bleiben. Dazwischen fanden sich ein paar steinerne Bauten: Notre-Dame-la-Grande, gedrungen zwischen den Häusern und doch die größte der Marienkirchen, die Westfassade förmlich überwuchert von Skulpturen, schindelgedeckte Ecktürme, vor wenigen Jahren erst fertig gestellt; der Bischofspalast gegenüber dem Westportal; das massive Kirchenschiff von Saint Jean, einem Lagerhaus ähnlicher als einem Tempel; Sainte Radegonde, eigentlich nur ein prachtvoller riesiger Stein über der Gruft der darunter begrabenen Heiligen, der Neubau noch nicht länger beendet als der von Notre-Dame-la-Grande, und die Baustelle von Saint-Hilaire-le-Grand, hundertjähriges beharrliches Wachsen und Verändern über dem ursprünglichen alten Holzbau, nicht wenige der Steine in ihren Mauern verschleppt aus den Ruinen des römischen Amphitheaters in der Nähe; verstreut überall jede Menge weitere Gerüste und hölzerne Kräne, Kirchen und Stadthäuser in allen Stadien des Umbaus, der Fortschritt der Baustellen war erstorben in den neun Jahren, die seit der Gefangennahme Königin Aliénors auf der Straße nach Chartres ins Land gegangen waren. Auch die Steinbauten waren nass und sahen darum nicht weniger gemein aus, von den Simsen zogen sich lange schwarze Bärte über die Fassaden, und in den Mörtelfugen spross Moos, das Einzige, was zurzeit wirklich zuverlässig wuchs. Zu den Steinbauten gehörte natürlich auch das Stadtschloss der Herzöge im Zentrum der Stadt, sein großer Saal war jetzt ohne das Lachen und die Musik, die Königin Aliénors Liebeshof hatte erklingen lassen; auch an den Flanken des Schlosses hingen noch die wetterzerzausten Seilgerüste, auf denen die Maurer und Steinmetze versucht hatten, Aliénors Umbaupläne zu verwirklichen. Im großen Saal zählte ein Kastellan von Henri Plantagenet die Lösegelder der Barone und Grafen, die sich zusammen mit des Plantagenets Söhnen gegen den König von England empört hatten. Im Norden erhob sich schließlich das Cluniaszenser-Kloster des heiligen Jean von Montierneuf ein kleines Stück außerhalb der Stadtmauern.
Die Stadt war nicht mehr, was sie gewesen war, und das Wetter ließ es zu, dass man es ihr ansah: Poitiers die Mächtige, Poitiers die Schöne, Poitiers die Perle von Aquitanien, sie war mit dem Überschwang der Herzöge Guilhem dem Troubadour und seinem Sohn Guilhem Poitou gewachsen, hatte die Eifersucht der jungen Königin Aliénor von Frankreich ertragen und die Reue der alternden Königin Aliénor von England genossen und starb jetzt den Liebestod, den der Krieg Weib gegen Mann und Söhne gegen Vater ihr bereitete. Wären nicht die Pilgerstraße nach Santiago de Compostela und die Haupthandelsroute von Nord nach Süd und Ost nach West durch die Stadt verlaufen – nicht einmal das nüchterne Leben, das die Kaufleute in ihre Mauern trugen, wäre ihr geblieben. Stolzes Poitiers, stolze letzte Hoffnung von Raymond le Railleur. Immer noch imposant anzusehen, erhob es sich in den stetigen Regen aus den Feldern, die von den verzweifelten Bauern längst nicht mehr mit Merkel und Kalk, sondern mit menschlichen und tierischen Fäkalien gedüngt wurden und von denen der Gestank in den Himmel stieg.
Die Torwachen an der Ponte Joubert ließen Raymond warten, obwohl sie nichts zu tun hatten; immerhin hatten sie sich herabgelassen, ihm Auskunft zu erteilen, dass der Bischof zurzeit in der Stadt war, bevor sie ihn fürs Erste vor dem halb geöffneten Tor stehen ließen. Raymond hatte Zeit, die öden Häuser der Pfahlbürger zu betrachten, die sich am hiesigen Ufer des Clain hinzogen. Eine kleine Gruppe Kinder in schmutzigen Hemden starrte ihn an, schmutzige Finger in ebenso schmutzigen Nasen, die Knie unter den kurzen Hemden blau vor Kälte, wo sie nicht von einer schützenden Schmutzschicht überzogen waren. Raymond dachte an Carotte und an ihre Bemerkungen bezüglich anderer Methoden der Empfängnisverhütung und sah sich plötzlich als Vater dieser Kinder, der hoffnungslos auf die nächste Hilfsarbeit wartete, während ihm und seiner Familie der Magen knurrte, und Carotte als magere Vettel, vorzeitig gealtert, ebenso hoffnungslos wie er, beide zutiefst bereuend, dass sie damals den Kräutern und dem Herumhüpfen und dem Niesen vertraut hatten. Das war eines seiner Probleme: Er sah sich stets in Szenarien, in denen die Hoffnung so weit entfernt war von ihm wie der Mond, und es schnürte ihm vor Angst die Kehle zu. Die Kinder waren nur eine weitere Variante des Bildes Raymond-wie-er-völlig-heruntergekommen-neben-der-Straße-stirbt und fügten zur Angst um sich selbst auch noch die Verzweiflung einer Verantwortung hinzu, die er nicht zu erfüllen vermochte.
Bischof Jean Bellesmains, dachte er. Meine letzte Chance. Wollt ihr Eure Christenpflicht an einem Hoffnungslosen erfüllen, Ehrwürden? Ich habe Spottlieder gegen die Kirche gesungen, aber der Spott ist mir vergangen, und wenn ich gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich mich ein wenig mehr zurückgehalten.
Hätte er? Man hatte ihn Raymond le Railleur genannt, Raymond den Spötter. Hätte er damals geglaubt, dass es so weit mit seiner Heimat kommen würde, dass die wenigen übrig gebliebenen Herren (Graf Jaufre, der verdammte Geizkragen) lieber mit den Pfeffersäcken paktierten als mit den schönen Künsten?