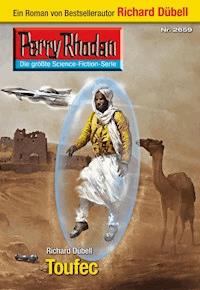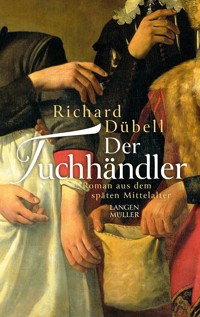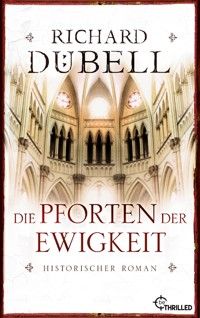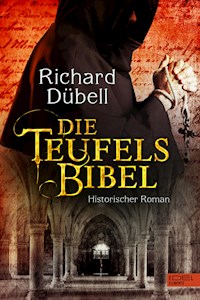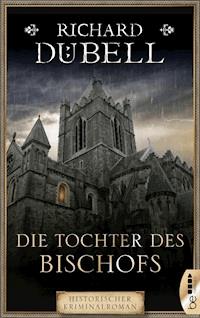6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Teufelsbibel-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Jahrzehntelang haben sie die Welt vor der Teufelsbibel behütet. Nun wendet sich die Welt gegen sie. 1648: Dreißig Jahre Krieg haben Europa an den Rand des Untergangs gebracht. Die Menschen sind verroht, Tag für Tag brennen unschuldige Männer, Frauen und Kinder als Hexen auf den Scheiterhaufen. Auch das Schicksal von Agnes Khlesl und ihrer Tochter Alexandra scheint besiegelt, als sie in Würzburg in die Fänge eines Hexenjägers geraten. Doch dann bietet dieser einen Handel an: Bringen sie ihm die Teufelsbibel, wird er die Anklage fallenlassen. Alexandra muss sich entscheiden. Lässt sie zu, dass ihre Lieben den Feuertod sterben? Oder stiehlt sie die gefährliche Handschrift aus der Obhut ihrer eigenen Familie? Diese bewacht die Teufelsbibel seit vielen Jahren - denn das mächtige Buch soll aus der Feder des Teufels stammen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1044
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Jahrzehntelang haben sie die Welt vor der Teufelsbibel behütet. Nun wendet sich die Welt gegen sie.
1648: Dreißig Jahre Krieg haben Europa an den Rand des Untergangs gebracht. Die Menschen sind verroht, Tag für Tag brennen unschuldige Männer, Frauen und Kinder als Hexen auf den Scheiterhaufen. Auch das Schicksal von Agnes Khlesl und ihrer Tochter Alexandra scheint besiegelt, als sie in Würzburg in die Fänge eines Hexenjägers geraten. Doch dann bietet dieser einen Handel an: Bringen sie ihm die Teufelsbibel, wird er die Anklage fallenlassen. Alexandra muss sich entscheiden. Lässt sie zu, dass ihre Lieben den Feuertod sterben? Oder stiehlt sie die gefährliche Handschrift aus der Obhut ihrer eigenen Familie? Diese bewacht die Teufelsbibel seit vielen Jahren - denn das mächtige Buch soll aus der Feder des Teufels stammen ...
Über den Autor:
Richard Dübell ist als Autor historischer Romane bekannt. Neben seinen schriftstellerischen Aktivitäten leitet er eine Schreibwerkstatt, die er sowohl in Abendkursen als auch als Wochenendseminare und Urlaubsreisen anbietet, und arbeitet als Cartoonist und Grafiker.
Dübells Roman „Der Tuchhändler“ wird derzeit in ein Drehbuch adaptiert, an dem der Autor selbst mitarbeitet. Sein Roman „Der Jahrtausendkaiser“ nimmt die These des Erfundenen Mittelalters auf. In „Die Teufelsbibel“ widmet er sich einem der rätselhaftesten Artefakte der mittelalterlichen Kirchengeschichte, dem Codex Gigas. Die gesamte Teufelsbibel-Trilogie, „Die Teufelsbibel“, „Die Wächter der Teufelsbibel“ und „Die Erbin der Teufelsbibel“ sind in 14 Sprachen weltweit übersetzt worden, es gibt Ideen für eine Umsetzung in ein Brettspiel und eine Verfilmung.
Weitere Titel des Autors bei Edel Elements
Die Teufelsbibel (Teufesbibel-Trilogie Band 1)Die Wächter der Teufelsbibel (Teufelsbibel-Trilogie Band 2)Der JahrtausendkaiserDer TuchhändlerEine Messe für die Medici
Richard Dübell
Die Erbin der Teufelsbibel
Historischer Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2010 by Richard Dübell
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-271-0
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Für die vier Millionen Toten des Dreißigjährigen Krieges und die neunhundert aus Würzburg
Jeder Tod beraubt uns einer einzigartigen Seele, und sie kehrt nie wieder zurück.
Wer Hoffnung besitzt, besitzt alles. ARABISCHES SPRICHWORT
DRAMATIS PERSONAE
(ein Ausschnitt)
Cyprian Khlesl
Ein alter Hund lernt vielleicht keine neuen Tricks, aber er hat seine alten auch nicht verlernt
Agnes Khlesl
Cyprians Frau erkennt, dass das Ende und der Anfang manchmal dasselbe sind
Alexandra Rytíř, geb. Khlesl
Sie hat viele Jahre lang gelernt, wie man dem Tod ein Schnippchen schlägt, aber der Tod ist zuweilen schneller
Karina Khlesl
Alexandras Schwägerin verschließt eine verzweifelte Liebe in ihrem Herzen
Andrej von Langenfels
Agnes’ Bruder hat alle Geheimnisse mit ihr geteilt, nur eines nicht
Pater Giuffrido Silvicola S.J.
Er will ein Versprechen einlösen, das er als Kind gegeben hat: die Welt zu retten
Wenzel von Langenfels
Er hat das Erbe von Kardinal Khlesl angetreten, doch der Preis dafür ist hoch
Melchior Khlesl
Cyprians und Agnes’ jüngster Sohn muss sich entscheiden, wo sein Platz ist
Andreas Khlesl
Cyprians und Agnes’ älterer Sohn ist sein Leben lang davongelaufen
Rittmeister Samuel Brahe
Ein Elitesoldat hat alles verloren, doch eines will er sich zurückholen: seine Ehre
Wachtmeister Alfred Alfredsson
Was ihn betrifft, ist sein Platz an Samuel Brahes Seite; einer muss ja den Überblick behalten
Sebastian Wilfing
Agnes’ ehemaliger Verlobter hat einen neuen Platz im Leben gefunden; einen neuen, keinen besseren!
Bruder Bonifác, Bruder Čestmír, Bruder Daniel, Bruder Robert, Bruder Tadeáš
Wer sich ihnen in den Weg stellt, sollte das Elfte Gebot kennen
Corporal Gerd Brandestein, Reiter Björn Spirger,
Reiter Magnus Karlsson
Sie haben den halben Krieg in der Hölle zugebracht; warum sollten sie nicht am Ende versuchen, den Teufel an den Hörnern zu packen?
Bruder Buh
Ein Riese, ein Mörder, ein reiner Tor – und ein Mann, an dem die Schrecken der Vergangenheit kleben wie das Blut an seinen Händen
HISTORISCHE PERSÖNLICHKEITEN
(ein Ausschnitt)
Ebba Sparre
Die junge schwedische Gräfin begibt sich in die Hölle – auf einer Mission der Liebe
General Hans Christopher Graf Königsmarck
Später wird er einen Blumennamen tragen; jetzt nennt man ihn nur den Teufel
Kristina Wasa, Königin von Schweden
Die Tochter des legendären Königs Gustav Adolf hat eine große Liebe und einen noch größeren Plan
Legat Fabio Chigi
Der päpstliche Unterhändler bei den Friedensverhandlungen versucht stets herauszufinden, wo sich der nächste Abort befindet
Pater Jiří Plachý S.J.
Der „Schwarze Pope“ verteidigt seine Heimat
General Rudolf Colloredo
Der Stadtkommandant von Prag hat mehr Tapferkeit als Verstand; in der Regel eine gute Voraussetzung für einen Soldaten, nur diesmal nicht
Erzbischof Ernst Graf von Harrach, Bürgermeister Mikuláš Turek von Rosenthal, Stadtrichter Václav Augustin Kavka, Václav Obytecký von Obitetz
Einige der Verteidiger von Prag; nicht alle von ihnen werden den Frieden erleben
Vincenzo Carafa S.J.
Der Pater Generalis der Societas Jesu hat ein Problem
Anna Morgin
Das Schicksal einer Hexe überdauert die Zeit; stellvertretend für alle anderen, die ebenso unschuldig waren wie sie
„Und ich sah ein fahles Ross, und der auf ihm saß, des Name ist der Tod, und die Unterwelt war sein Gefolge. Es wurde ihnen Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten durch Schwert, Hunger und Pest.“
Offenbarung 6,8
PROLOG
April 1632
1.
Der Tod kam im Frühling, und er glänzte wie Gold.
Der Junge, der die Schafe hütete, hörte die Reiter nicht gleich. Sie sprengten in einem unordentlichen Haufen aus dem Wald und auf die sattgrünen Weiden, aus dem blauen, lang gezogenen Schatten der Bäume hinaus in das rote Licht. Doch der Junge hatte den Blick abgewandt; er widmete sich ganz seiner Sackpfeife und der Melodie, die er aus ihr herausquälte. Er blickte erst auf, als das Donnern der Hufe seine Eingeweide zum Erzittern brachte. Die Schafe blökten und drängten sich zusammen.
Der Junge kam auf die Beine. Das Anblasrohr glitt aus seinem Mund, und als er unwillkürlich den Luftsack an sich presste, gab die Sackpfeife einen kläglichen Ton von sich. Das Hufgetrommel versetzte seinen Leib in Schwingungen und brachte seine Augen zum Tränen.
Die Reiter waren Kürassiere mit den üblichen, bis zu den Knien reichenden Trabharnischen und Sturmhauben auf den Köpfen, aber das wusste der Junge nicht. Was er sah, waren gesichtslose Wesen, die im Abendrot wie aus purem Gold gemacht schienen und deren blankgezogene Klingen Lichtreflexe schleuderten. Die Kürassiere schwärmten in einer langen, zerrissenen Reihe aus und formten einen Bogen wie eine riesige Hand, die nach der Schafherde und ihrem einsamen Hirten griff. Der Hund stürzte hinter der Herde hervor und warf sich den Reitern entgegen, das Donnern verschluckte sein Bellen, dann verschluckte ein Wirbel aus galoppierenden Beinen, hochgeschleuderten Grassoden und Dreck seinen Körper, als wäre er nie da gewesen. Die Schafe drehten sich wie auf Kommando um und flohen, eine hüfthohe Woge aus schmutzig weißem, krausem Fell, panisch glotzenden Augen und aufgerissenen Mäulern, die sich um die schmächtige, wie angewurzelt dastehende Gestalt mit der Sackpfeife im Arm teilte. Der Goldschimmer der Panzer und die tanzenden Lichtblitze waren so schön, dass es einem den Atem verschlug. Der Junge blinzelte.
Einer der Reiter schwenkte herum, lehnte sich halb aus dem Sattel, und irgendetwas im Hirn des Jungen, das von Überraschung und Staunen vollkommen überwältigt war, löste den Befehl aus, die Arme hochzuheben und dem Reiter entgegen zustrecken. Er fühlte den Anprall aus Pferdegeruch und Donnern, einen Augenblick bevor der Reiter heran war, fühlte sich emporgerissen und quer über einen Sattel geworfen, die Sackpfeife ging verloren und wurde in den Boden gestampft, er wurde durchgeschüttelt und auf- und abgeworfen, die Luft wurde aus seinen Lungen getrieben und sein Magen gequetscht, dass er sich hätte übergeben müssen, wenn er nur etwas im Bauch gehabt hätte. Er hatte das Gefühl zu fliegen. Eine gepanzerte Hand drückte ihn grob gegen einen gepanzerten Körper, doch er fühlte keinen Schmerz. Er flog! Die Pferdebeine waren ein Wirbel aus Muskeln, Sehnen und glänzendem Fell, der Dreck spritzte ihm ins Gesicht. Er renkte sich den Hals aus, um nach oben zu sehen, und starrte in ein bärtiges, schmutziges Gesicht unter dem Goldglanz der Sturmhaube. Ein Schwenk, der ihn beinahe heruntergeschleudert hätte, und die Sonne war im Rücken des Reiters, warf Reflexe um ihn herum und blendete den Jungen. Er sah, dass sich der Mund im Gesicht unter dem Helm öffnete, sah ein braunes Gebiss mit vielen Lücken. Der Mund verzog sich, und der Mann lachte laut.
Der Junge lachte mit.
Als sie den Hof erreichten, auf dem der Junge lebte, brachte der Reiter sein Pferd zum Stehen und ließ seine Beute von dessen Rücken gleiten. Die Knie waren dem Jungen so weich, dass er in sich zusammensackte, doch als er nach oben sah, lachte er erneut. Der Hof lag bereits im Schatten, das Gold verwandelte sich in Eisenglanz und den matten Schimmer der bronzierten Helme. Die Schafe wimmelten zwischen den Gebäuden herum. Der Bauer hatte nie erlaubt, dass sie frei auf dem Hof herumliefen; selbst zum Scheren waren sie in einen Pferch getrieben worden. Ihre Bocksprünge brachten den Jungen erneut zum Lachen.
Ein zweiter Reiter kam zu dem heran, auf dessen Pferd er hierhergelangt war.
„Das is’ ja ’n lustiger Vogel“, sagte der zweite Reiter. „Gehört der Flick hierher?“
„Wo soll er sonst hingehören. Gibt doch weit und breit nix außer dem Hof hier.“
Der erste Reiter musterte den Jungen, der inzwischen wieder auf die Beine gekommen war und erwartungsvoll zu den Männern nach oben blinzelte. Ein breites Grinsen lag immer noch auf seinem Gesicht.
„Das is’n Idiot, wenn ich je einen gesehen hab“, sagte der zweite Reiter.
„Das is’n Bauernbalg.“
„Wo is der Unterschied?“
Beide Reiter lachten. Der Junge hörte das Krachen, mit dem Türen, die ohnehin offen waren, von Stiefeln eingetreten wurden. Er erwartete, dass der Bauer und seine Familie im nächsten Moment herauskommen würden, doch nichts tat sich. Nicht einmal die Knechte, die sich sonst mit Sensen und Dreschflegeln im Hintergrund herumzudrücken pflegten, voller Hoffnung, jemand möge einen Streit vom Zaun brechen, waren zu sehen. Er dachte an Leupold, der mit einem gebrochenen Bein im Stall lag, doch dann nahm etwas anderes seine Aufmerksamkeit gefangen: Einer der Reiter, der abgestiegen war, zog sich den Helm vom Kopf, riss an Lederbändern, die an seinem eisernen Leib herabhingen, und wand sich aus seinem Harnisch. Darunter war er nichts weiter als ein dünner Mann mit verschwitztem Hemd, zotteligem Bart und verfilztem Haar. Der Junge starrte ihn weniger enttäuscht als erstaunt an, dass eine solche Wandlung mit dem Eisenreiter vorgegangen war. Der dünne Mann schüttelte sich, bückte sich um das Rapier, dessen Klinge er in den Boden gesteckt hatte, zog es heraus und durchbohrte mit einem langen Vorwärtsschritt das ihm am nächsten stehende Schaf.
Das Blöken des Schafs hörte sich an wie ein überraschtes Husten. Es brach vorne auf die Knie, dann versuchte es wieder aufzustehen. Die anderen Schafe drängten von ihm weg. Der Mann mit dem Rapier zog die Klinge heraus und stach erneut zu. Das Schaf zuckte und fiel auf die Seite, seine Beine begannen zu schlagen.
„Kannst du nich’ mal so’n blödes Vieh auf einen Streich totmachen?“, schrie einer der anderen Reiter. „Wie auf’m Schlachtfeld!“
„Leck mich“, sagte der Mann mit dem Rapier und sah sich nach seinen Sachen um.
„Keine Pistolen“, sagte der Reiter, der den Jungen mitgenommen hatte. „Spart euch das Pulver für morgen.“
„Das geht so nich’“, hörte sich der Junge sagen. Die Reiter starrten ihn an. Das Schaf auf dem Boden röchelte.
„Du musst ihm die Gurgel durchschneiden“, sagte der Junge.
„Na so was, ein Fachmann. Zeig’s uns, du Hosenscheißer.“
Der Junge lief zu dem auf dem Boden liegenden Schaf hinüber, kauerte sich bei ihm nieder und packte seine Schnauze mit beiden Fäusten. Dann zog er den Kopf nach hinten und entblößte die Kehle. Er schaute den Mann mit dem Rapier aufmunternd an. Dieser stach zu. Der Körper des Schafs versteifte sich, es begann zu zittern. Blut pumpte in einzelnen Stößen hervor und prasselte hörbar auf den Boden. Der Mann hob sein Rapier erneut, diesmal zeigte die Spitze auf den Leib des Jungen.
„Lass den Buben in Ruh, Vollidiot“, schnauzte der Anführer der Reiter. Er stieg ächzend vom Pferd, reckte sich und deutete dann zu den Hühnerställen und auf die Schafe. „Holt euch die Holderkäuze und ihre Eier und stecht so viele von den Schafen ab, wie wir auf die Pferde kriegen. Wenn ihr Hornböcke findet, lasst sie leben. Die nehmen wir mit – wir können die Milch brauchen. Das hier weidet aus und richtet es her; heut Abend feiern wir das Osterfest nach!“ Er blinzelte dem Jungen zu und machte eine Kopfbewegung. „Komm mal mit.“
Der Junge folgte ihm ins Haus. Mehrere Reiter waren in der Stube, und das Gepolter von oben sagte ihm, dass weitere sich in den Schlafzimmern umsahen. Er wunderte sich, dass niemand von der Familie hier war. Es sah dem Bauern gar nicht ähnlich, den Hof allein zu lassen, schon gar nicht, wenn Fremde eingetroffen waren. Die Reiter hatten Tücher, Decken und Kleidung zusammengerafft und schleuderten wahllos Kochutensilien und Werkzeug in die behelfsmäßigen Säcke. Aus dem Obergeschoss drang der Krach von zerberstender Töpferware und Federngestöber, als Zudecken und Kissen aufgeschlitzt und in Tragetaschen verwandelt wurden. Einer der Männer starrte die brennende Osterkerze im Herrgottswinkel an, als wecke sie eine verschüttete Erinnerung in ihm, von der er nicht wusste, ob er sich ihr ergeben oder sie verachten sollte; dann schlug er die Flamme mit der flachen Hand aus und steckte die teure Wachskerze in einen Sack. Aus dem Mund quollen ihm zerquetschtes Eigelb und zerbissene rote Schalen. In der Räucherkammer wurde lautes Jubelgeschrei vernehmbar – die Reiter hatten den Speck und die Würste entdeckt, die vom Osterfest vor ein paar Tagen übrig geblieben waren.
„Wer lebt hier?“, fragte der Anführer der Reiter den Jungen.
„Der Bauer und seine Leute“, antwortete dieser.
„Ist der Bauer dein Alter?“
Der Junge erinnerte sich daran, dass der Bauer ihn deutlich grober zu behandeln pflegte als seine beiden Söhne und seine Tochter, jedoch sanfter als die Knechte oder den Gänsejungen. Er war sich nicht sicher.
„Die Christel ist meine Mutter“, sagte er. Das wenigstens stand fest.
„Das is’ die Bäuerin?“
„Nö“, sagte der Junge stolz. Die Bäuerin pflegte in der Stube zu sitzen und den ganzen Tag die Hände zu ringen. Seine Mutter hingegen packte zu. „Die Magd.“
„Na, du Bastard“, grinste der Reiter. „Und wo sind sie alle hin?“
Der Junge zuckte mit den Schultern. Er sah zu, wie die Männer das Kupfer- und Zinngeschirr zerschlugen und die Bruchstücke einpackten. Andere rissen die Fenster heraus und warfen sie nach draußen und die Bänke und die Bettladen hinterher. Er roch nach Rauch; jemand vor dem Haus versuchte, ein Feuer in Gang zu bekommen.
„Wir ham Holz in der Scheune“, sagte er.
Die Reiter waren merkwürdig. Wenn sie das Schaf, das sie geschlachtet hatten, braten wollten, sollten sie lieber das gehackte Feuerholz nehmen; mit dem Hausrat würden sie nur eine hoch lodernde Flamme erzeugen, in der das Fleisch verbrannte. Er fand es erheiternd, dass diese Männer, die die Fähigkeit hatten, auf den Pferden förmlich über den Boden zu fliegen und sich in Eisen zu gewanden, zu dumm zum Feuermachen waren.
„Was is’ so lustig, du Rauling?“
„Nix“, sagte der Junge und kicherte.
„Wachtmeister!“, rief eine Stimme von draußen. „Wachtmeister, wir haben was gefunden.“
Der Anführer der Reiter packte den Jungen am Arm und zog ihn hinter sich her. Leupold, der Knecht, lag zwischen drei Reitern auf dem Boden; er stöhnte und keuchte und hielt sich das Bein. Seine Nase war blutig. Einer der Reiter trat Leupold nachlässig gegen das gebrochene Gelenk, und Leupold schrie auf.
„Is’ der Iltis allein?“
„Nee, ’ne Moß hat ihm das Händchen gehalten.“ Der Reiter machte eine Kopfbewegung zur Scheune. Gedämpfte Geräusche drangen daraus hervor, als wenn jemand zu schreien versuchte.
Der Wachtmeister beugte sich zu Leupold hinunter. Leupolds Augen wurden weit, als er den Jungen erblickte.
„Wo sind alle?“, fragte der Wachtmeister.
„Ich sag nix“, keuchte Leupold. „Ihr Teufelsbrut.“
Ein neuerlicher Tritt gegen sein verletztes Bein ließ ihn brüllen.
„Wie war das?“, fragte der Wachtmeister.
„Lasst den Bengel laufen, er hat euch nix getan.“
„Du hast uns auch nix getan, und glaubst du, wir lassen dich laufen?“
„Bei der Liebe Gottes, ich bin nur der Knecht!“, stöhnte Leupold.
„Gebt ihm was zu trinken“, sagte der Wachtmeister.
Leupold schrie und wand sich, aber sie banden ihm Hände und Füße zusammen. Einer holte etwas aus einer Satteltasche, das wie zwei handtellergroße Brettstücke aussah, mit einer Zwinge verbunden. Sie packten Leupolds Unterkiefer und zwangen ihm den Mund auf, dann rammten sie das Holz hinein und drehten an der Zwinge. Leupold ächzte und lallte. Die Bretter öffneten sich. Sie waren ein Sperrholz, wie man es auch den Schafen ins Maul rammte, wenn man ihnen etwas einflößen musste. Ein Reiter schleppte einen Kübel herbei, und unter allgemeinem Gejohle schüttete er den Inhalt des Eimers in Leupolds Mund. Der Junge verzog das Gesicht. Jauche.
Leupold bäumte sich auf und gurgelte und spuckte die Jauche und alles aus, was er sonst noch im Magen hatte. Sie drehten ihn auf die Seite und rissen ihm das Sperrholz aus dem Mund. Leupold lag in seinem Erbrochenen und krümmte sich.
„Is’ dir jetzt eingefallen, wo alle sind?“, fragte der Wachtmeister.
Leupold winselte und nickte. Der Wachtmeister kauerte sich neben ihn. „Erleichtere dich, du Sünder“, sagte er grinsend.
Der Junge blickte zum Eingang der Scheune hinüber. Mehrere Reiter standen dort dicht an dicht und betrachteten etwas, das offenbar in der Scheune vor sich ging. Sie johlten und pfiffen, dazwischen war rhythmisches Gegrunze und Klatschen zu hören. Er trat über Leupolds sich krümmenden Leib und machte sich auf den Weg zur Scheune, um ebenfalls zu schauen. Ein Reiter fing ihn ab.
„Richte das Schaf her, du Nichtsnutz“, sagte er und stieß ihn in Richtung auf den Kadaver.
Der Junge bedauerte, dass er nicht zur Scheune gelassen wurde, aber er war barsche Anweisungen gewohnt und vor allem die Folgen, wenn er nicht darauf hörte. Er machte sich an dem Schaf zu schaffen. Als bestiefelte Beine neben ihn traten, blickte er blinzelnd auf. Es war der Wachtmeister. „Wir holen die Familie zusammen.“
Der Junge zuckte mit den Schultern. Er hielt es für keine gute Idee, den Bauern zu holen. Wenn dieser die Bescherung im Haus und das tote Schaf sah, würde er zu brüllen anfangen. Der Bauer konnte sehr laut brüllen.
„Wie heißt du?“
„Bub“, sagte der Junge stolz.
Der Wachtmeister verdrehte die Augen. „Das seh ich selber. Wie ruft dein Alter dich?“
Der Junge legte den Kopf schief.
„Der Bauer“, stieß der Wachtmeister hervor. „Wie nennt der dich, in drei Teufels Namen?“
„Taugenichts. Dumme Sau. Drecksbengel.“
„Und deine Mutter? Die Magd?“
„Bub“, sagte der Junge und wusste nicht, ob er wegen der Begriffsstutzigkeit des Wachtmeisters erneut lachen sollte.
„Bist du zu blöd, um deinen Namen zu wissen?“
„Wieso, du weißt ihn ja auch nicht.“
„Scheiße, du Frosch, werd bloß nich’ frech. Was bist du, ’n Weißhulm? Kannst du den Himmelssteig aufsagen?“
Der Junge blinzelte verständnislos.
„Das Paternoster, verdammt!“
„Kann ich“, sagte der Junge.
„Sag’s mir vor.“
„Unser lieber Vater, der du bist Himmel, heiliget werde dein Nam, zu kommes dein Reich, dein Will schehe Himmel ad Erden, gib uns Schuld, als wir unsern Schuldigern geba, führ uns nicht in kein bös Versucha, sondern erlös uns von dem Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, Ama.“
„Heilige Scheiße“, staunte der Wachtmeister.
Ein anderer Reiter war herzugekommen.
„Der Bursche is’ so blöd, ich krieg nich mal aus ihm raus, wie er heißt, geschweige denn, ob seine Herrschaft Dofelmänner oder Grillen sind“, erklärte der Wachtmeister.
„Is’ doch eh egal“, erwiderte der Reiter.
„Ich würd mich wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass es Ketzer sind.“
„Ich würd mich wohler fühlen, wenn ich was zu fressen und zu saufen hätte und um die nächste Courasche Schlange stehen könnte“, sagte der Reiter und fügte hinzu: „Und wenn ich wüsste, dass der Schwed’ nich’ kommt. Wir sin’ auf deren Seite des Flusses, Wachtmeister.“
„Scheiß auf den Schwed’. Der Schwed’ schanzt irgendwo bei Rain am Lech und holt sich dort einen runter.“ Der Wachtmeister richtete sich auf. „Na schön“, seufzte er. „Mal sehen, ob die anderen die Vögel einfangen können.“
Der Junge wurde allein gelassen. Nach einigen Sekunden des Nachdenkens kümmerte er sich wieder um das Schaf. Es schien ihm, dass sie das von ihm wollten.
Das Schaf war bereits geschoren und ausgenommen, als der Bauer mit seiner Familie und den Knechten kam. Die Reiter führten sie ins Haus. Da andere Männer ihm das Schaf wegnahmen und sich bemühten, es auf einen Spieß zu stecken, folgte der Junge ins Haus. Der Bauer, seine Frau, die Tochter und die beiden Söhne saßen auf dem Boden, die Knechte wurden von den Soldaten festgehalten. Der Bauer blinzelte vor Angst.
„Zwei Fragen“, sagte der Wachtmeister und hob behandschuhte Finger. „Erstens: Protestant oder Katholik?“
Das Kinn des Bauern bebte. Niemand konnte erkennen, ob er protestantische oder katholische Truppen vor sich hatte, wenn er auf Marodeure wie diese hier stieß. Im Kampf trugen die kaiserlichen Soldaten schwarz-rote und die schwedischen weiß-blaue Tuchfetzen oder Hutfedern, um von den eigenen Truppen erkannt zu werden. Abseits des Schlachtfelds war dies nicht nötig. Abseits des Schlachtfeldes war es taktisch klüger, unerkannt zu morden. Was immer der Bauer sagte, er hatte eine gute Chance, das Falsche zu sagen. Er schluckte und schwieg.
„Zweitens“, sagte der Wachtmeister. „Wo hast du deine Wertsachen versteckt?“
Der Junge sah zu, wie das Kinn des Bauern noch stärker bebte und seine Lippen weiß wurden, so fest presste er sie zusammen. Man konnte seinen Atem in der Kehle wimmern hören.
Die Reiter zwangen einen der Knechte auf die Knie, wickelten ihm blitzschnell einen Strick um den Kopf und drehten ihn dann mit einem Holzstück zusammen. Der Knecht begann zu schreien. Blut lief ihm aus Ohren, Nase und Mund. Seine Hände rissen sich los und zerrten an den Stricken, aber sie saßen zu stramm. Seine Augen traten aus den Höhlen, groß und weiß wie Hühnereier. Der Knecht heulte. Etwas knackte. Mit einem dumpfen Keuchen sackte der Unglückliche in sich zusammen. Der Junge starrte ihn an und schluckte. Leupold die Jauche in die Kehle zu schütten war irgendwie lustig gewesen, ein grober Streich, wie ihn die Knechte sich gegenseitig immer wieder spielten – aber das viele Blut hier … und die Augen … Irgendwo in seinem Innern verkümmerte das Lachen. Er versuchte ein hilfloses Lächeln und sah zu dem Wachtmeister auf, doch dieser beachtete ihn nicht.
„Fällt’s dir noch nich’ ein?“, fragte der Wachtmeister. „Na gut, schauen wir, was die Weiber davon halten.“
Die Tochter versuchte sich an der Bäuerin und diese am Bauern festzuhalten, als die Soldaten sie davonzerrten. Sie scharten sich in einer Ecke um sie, direkt unter dem Herrgottswinkel. Der Junge versuchte erneut zu erspähen, was sie mit ihnen trieben. Der Wachtmeister wurde auf ihn aufmerksam.
„Alch dich“, sagte er. „Kümmer dich um den Braten.“
Zögernd schlenderte der Junge zur Tür, verfolgt von Anfeuerungsrufen und panischem Kreischen aus dem Herrgottswinkel, das abrupt in abgehacktes Schmerzgeheul überging. Er blickte über die Schulter zurück. Der Wachtmeister stand über den Bauern gebeugt. Reiter zogen dem Bauern die Schuhe von den Füßen. In einer Hand des Wachtmeisters war ein langes Messer, mit der anderen griff er, ohne hinzusehen, in das Salzfass. Die bloßen Füße des Bauern zuckten. Der Junge sah, dass auch den Söhnen des Bauern die Schuhe ausgezogen wurden.
„Die Weiber wissen’s nich’“, sagte der Wachtmeister. „Oder sie ham den Mund zu voll, um was sagen zu können. Wir müssen uns wohl an die Männer in der Familie halten. Wolltet ihr in der nächsten Zeit viel zu Fuß gehen?“ Ohne zu dem Jungen hinzusehen, fügte der Wachtmeister hinzu: „Bist du noch nich’ draußen, Nichtsnutz? Soll’n wir dich auch fragen?“
Der Junge stolperte hinaus. Über die Geräusche aus dem Herrgottswinkel hinweg hörte er einen der Knaben erschreckt aufschreien und den Bauern keuchen: „Also gut, ich sag’s euch!“, und den Wachtmeister sagen: „Schön, schön, aber lass uns dir zeigen, was los is’, wenn du uns Scheiß erzählst!“, und daraufhin eine gellende Knabenstimme, die schrie und schrie …
Er stürzte davon, zu der Feuerstelle hinüber, an lachenden oder gelangweilt aussehenden Soldaten vorbei, die ihm einen Tritt gaben, wenn er sie anrempelte. Zitternd griff er nach dem Spieß und versuchte, das Schaf herumzudrehen, das an der Unterseite schon schwarz wurde. Plötzlich fehlte ihm die Kraft.
Jemand langte an ihm vorbei und drehte den Spieß mit einem Ruck um. Eine Handfläche klatschte gegen seinen Hinterkopf.
„Hier, bring den Cavallen was zu saufen, wenn du zu dumm zum Bratendrehen bist.“
Der Junge schnappte sich blindlings einen Eimer, füllte ihn am Brunnen und torkelte mit seiner Last in die Scheune. Die Soldaten, die sich zuvor noch im Eingang gedrängt hatten, waren verschwunden, die Scheune eine schwarze Höhle in der Dämmerung. Auf einmal fühlte er die Kühle des Aprilabends und erkannte, dass sein Körper mit Schweiß überzogen war. Undeutlich nahm er zwei Gestalten unweit des Eingangs wahr, die auf dem Boden lagen. Eine richtete sich schwach auf. Sein Blick glitt zu der anderen. Der Eimer fiel aus seiner Hand.
„Lauf, Bub“, flüsterte eine heisere, von Schmerz zerrissene Stimme, die er kaum als die seiner Mutter erkannte. „Lauf, sonst tun sie mit dir das Gleiche!“
2.
Rittmeister Samuel Brahe von den Småländischen Reitern wartete nervös auf die Rückkehr des Spähers. Die Gegenwart des Königs, der umringt von Brahes Männern auf seinem Pferd saß und ein Gesicht zog, als wäre jeder Tag ein köstliches Abenteuer, machte ihn unruhig. Es war nicht die Person Gustav Adolfs an sich, dazu hatte er sich zu lange in der unmittelbaren Nähe seines Souveräns aufgehalten und mit ihm Essen, Trinken, Latrine und das Fieber des Kampfes geteilt. Was dem Rittmeister Sorgen machte, war, dass er nicht genau wusste, ob sie sich noch in dem Areal aufhielten, das vom schwedischen Heer kontrolliert wurde.
Heute Morgen waren sie bei Rain am Lech angekommen und hatten festgestellt, dass die andere Flussseite von den Kaiserlichen unter Tilly gehalten wurde. Es sah aus, als sei Tillys Heer zahlenmäßig unterlegen, aber sie hatten Kanonen in ausreichender Anzahl in Stellung gebracht. Während sich die schwedische Artillerie eingrub, hatte Gustav Adolf Erkundungsritte auf ihrer Seite des Lechs befohlen; die Taktik war, soweit Rittmeister Brahe es mitbekommen hatte, die Kaiserlichen mit dem morgigen Tagesbeginn mit Dauerfeuer zu belegen, als ob man hier den Flussübergang erzwingen wolle, und gleichzeitig zu versuchen, an anderer, besser geeigneter Stelle überzusetzen. Diese geeignete Stelle zu finden, waren mehrere Spähtrupps unterwegs. Der König hatte es sich nicht nehmen lassen, die Gegend persönlich in Augenschein zu nehmen.
Alles, was Brahe sicher wusste, war, dass sie immer noch auf der Westseite des Lechs waren. Er hatte keine Zeit gehabt, sich genauer zu orientieren. Der König war einfach davongeprescht, und sie hatten nichts tun können, als ihm zu folgen.
Die Stellung Tillys am Ostufer des Lechs hatte den Marsch des schwedischen Heers auf Ingolstadt aufgehalten. Samuel Brahe kannte seinen König; er hasste es, aufgehalten zu werden, besonders wenn die Chance bestand, den Feind nach den Siegen vor Nürnberg und Donauwörth vor sich herzutreiben wie eine Viehherde. Wenn Gustav Adolf über den Verlauf des Feldzuges unzufrieden war, neigte er zu Leichtsinn – nicht in seiner Taktik, sondern in Bezug auf seine eigene Person. Selbst für eine Elitetruppe wie die Småländischen Reiter, die ihren König in- und auswendig kannten, war es schwer, ihm dann auf den Fersen zu bleiben. Der beleibte Monarch war ein überraschend guter Reiter und ein Draufgänger, wie es selbst in Brahes kleiner Truppe nur wenige gab.
Der Rauchgeruch war mittlerweile nicht mehr zu leugnen. König Gustav Adolf hatte ihn zuerst wahrgenommen, wie immer. Brahe hatte daraufhin den Späher losgeschickt. Der Mann war überfällig. Brahe hielt ihren Feind, den Brabanter Johan Tserclaes Graf von Tilly, für einen fähigen Feldherrn. Er würde seinen Abschnitt der Front sichern; vielleicht waren sie auf feindliches Gebiet geraten, und der Späher lag längst mit durchschnittener Kehle neben einem Baum, während sich kaiserliche Musketiere langsam näherschlichen.
Überrascht erkannte er, dass Gustav Adolf ihm zublinzelte. Das lange Gesicht mit dem üppigen blonden Knebelbart und den feisten Backen verzog sich zu einem Grinsen. Brahe wurde klar, dass der König all seine Gedanken gelesen hatte. Er räusperte sich unwillig. Gustav Adolfs junger Page August von Leublfing und sein Leibknecht Anders Jönsson sahen zu Boden; Leublfings Wangen brannten vor unterdrücktem Eifer.
„Bereithalten, Männer“, flüsterte Brahe und lockerte die zweite Sattelpistole. Er gab das breiter werdende Lächeln des Königs mit einem stoischen Kopfnicken zurück.
Ein Hakengimpel begann in einem Gebüsch ein paar Mannslängen entfernt zu rufen. Brahe entspannte sich. Es hatte eine Weile gedauert, bis er erkannt hatte, dass es das Tier zwar in seiner Heimat, aber nicht hier im Reich zu geben schien. Sein Gesang unterschied sich nicht sehr von dem anderer Finken, aber doch genug, dass es einem Småländer auffiel. Einem Kaiserlichen wäre der Unterschied nicht klar gewesen, was den Ruf des gedrungenen roten Vogels zu einem idealen Erkennungszeichen machte. Brahe warf einen Seitenblick zu Wachtmeister Alfredsson und sah diesen lächeln. Der Wachtmeister spitzte die Lippen und antwortete auf das Zeichen. Augenblicke später kam Torsten Stenbock auf bloßen Füßen aus dem Gebüsch und baute sich vor Brahe auf.
„Meldung, Kornett“, flüsterte Brahe. Er ließ sich seine Erleichterung nicht anmerken, dass der junge Offizier wohlbehalten zurückgekehrt war. Torsten Stenbock war der Neffe von Oberst Fredrik Stenbock, dem Oberbefehlshaber des Småländischen Reiterregiments. Brahes Befehle lauteten, den Kornett nicht anders zu behandeln als alle seine Männer, doch der Rittmeister hatte in den Augen des Obersten lesen können und erkannt, welche Angst dieser um den Sohn seines Bruders hatte.
Der junge Mann schluckte.
„Kaiserliche Kürassiere“, sagte er leise. Brahe spürte, wie sich König Gustav Adolf im Sattel aufrichtete.
„Späher?“
„Marodeure. Sie haben einen Bauernhof überfallen.“
„Die Bauersleute?“
„Niemand zu sehen, aber …“ Der junge Offizier schluckte erneut.
„Aber?“
„… zu hören, Rittmeister.“
Brahe nickte. Niemand brauchte ihm zu erklären, was Stenbock gehört hatte.
„Stiefel anziehen, aufsitzen“, sagte er. Er fing einen Blick seines Wachtmeisters auf. „Gut gemacht, Kornett.“
„Vielleicht können wir den Leuten helfen?“, fragte Stenbock kläglich.
Brahe schüttelte grimmig den Kopf. „Viel zu …“
„Er hat recht, Kornett“, unterbrach ihn die Stimme des Königs. „Hat Er gezählt, wie viele Kürassiere es sind?“
„Ein Dutzend, Majestät.“
„Genau so viele wie wir.“
„Majestät …“, begann Brahe.
„Die Kerle müssen irgendwo über den Fluss gekommen sein, Rittmeister“, sagte der König. „Meint Er nicht, wir sollten sie befragen, an welcher Stelle?“
„Natürlich, Majestät, aber doch nicht mit Majestät erlauchter Person als …“
„Als Retter sind wir ins Reich gekommen, nicht als Zuschauer“, sagte Gustav Adolf. „Kornett Stenbock, reite Er voran. Rittmeister Brahe… mir nach!“
Der König sprengte aus dem Ring seiner Bewacher heraus, hinter dem Pferd Torsten Stenbocks her. Leublfing und Jönsson setzten ihm nach. Die Småländer warfen sich und ihrem Rittmeister unsichere Blicke zu. Brahe sah Wachtmeister Alfredsson den Kopf schütteln. Er selbst hätte am liebsten laut geflucht.
„Worauf wartet ihr?“, zischte er. „Angriff!“
Sie stoben über eine Weide, die jetzt, in der beginnenden Dunkelheit, wie eine graue Fläche vor ihnen lag. Über der nächsten Hügelkuppe stand eine Rauchsäule, von unten rot beleuchtet, dick und schwer. Der Geruch war beißend. Brahe schloss zu König Gustav Adolf auf, der Leublfing und Jönsson abgehängt hatte, und jagte neben ihm her. Er hütete sich, den König zu überholen; er hatte es einmal getan, um Kugeln, die auf seinen Herrn gezielt waren, mit seinem Körper abfangen zu können. Gustav Adolf hatte ihn mitten im Kampfgetümmel in die hinterste Reihe geschickt. Der König, ein Koloss in einem gelben Lederkoller, den Hut im Nacken, eine Spur ausgerissener Hutfedern durch die Dämmerung ziehend, als fiele in seinem Kielwasser bunter Schnee, grinste und nickte ihm zu. Seite an Seite galoppierten sie über die Hügelkuppe, eingehüllt vom Rauch, dem Schweißgeruch der Pferde und dem lauten Donnern der Hufe.
Brahe sah eine Anzahl von Gebäuden, zwischen denen Schafe hin- und herliefen, halb irr vor Panik wegen des Feuers. Die Flammen schlugen aus dem größten Bau, vermutlich dem Wohnhaus, und sandten die dicke Rauchsäule in den Himmel. Soldaten standen um das Feuer herum; sie drehten sich nicht um, obwohl das Getrommel der Pferdehufe überlaut war. Das Prasseln des Feuers musste den Lärm schlucken. Brahe glaubte zu sehen, dass einer der Männer eine lange Stange in der Hand hielt und etwas in das Feuer zurückstieß, etwas, das offenbar versuchte, daraus zu entkommen, etwas, das ein Mensch sein musste …
Wut schäumte in ihm hoch, und er ließ die Zügel fahren und ergriff die zweite Sattelpistole, stand im Sattel auf und sprengte vorwärts, beide Arme mit den Pistolen ausgestreckt, feuerbereit. Er erkannte aus dem Augenwinkel, wie seine Männer sich auffächerten, sah Wachtmeister Alfredsson an der anderen Seite des Königs auftauchen, seinen nägelbespickten Knüppel schwingend, mit dem er tödlicher war als mit jedem Rapier.
An einer zweiten Feuerstelle, über der ein geschlachtetes Tier gedreht wurde, fuhren Männer in die Höhe und starrten ihnen bestürzt entgegen. Die Ersten griffen zu ihren Musketen. Brahe sah die Bewegungen der kaiserlichen Soldaten, als handelten diese im Traum, langsam und träge. Er wünschte sich, bereits näher heran zu sein, damit er seine Pistolen abfeuern und Zeuge werden könnte, wie zwei der Mörder tot zu Boden geschleudert wurden. Das Pferd unter ihm war wie ein Teil seines eigenen Körpers, der über den Boden flog. Er federte die Stöße ab, ohne darüber nachzudenken; seine Hände waren so ruhig, als stünde er in einem Schießstand.
Ein Schatten kam ihnen entgegengerannt. Brahes Hände zuckten von allein herum, die Pistolenläufe senkten sich, er krümmte die Finger, während ein Teil von ihm schrie: Das ist ein Kind!, und ein anderer antworte: Schütze den König, was immer es kostet!
Der Schatten fiel zu Boden und krümmte sich dort zusammen. Brahes Pferd setzte mit einem Sprung über den kleinen Körper hinweg, der Rittmeister schwang die Pistolen wieder herum und zielte auf die Soldaten, die jetzt allesamt den Angriff gehört hatten und auf der Suche nach ihren Waffen planlos herumliefen. Nirgendwo waren Pferde zu sehen; die Narren mussten sie in der Scheune untergebracht haben. Er hatte jemanden sagen hören: Wenn ein Dragoner vom Pferd fällt, steht er als Musketier wieder auf. Doch die Kaiserlichen dort vorn in dem Schlachthaus, in das sie den friedlichen Bauernhof verwandelt hatten, waren keine Dragoner, sondern Kürassiere, mit dem Kampf auf den eigenen Beinen nicht vertraut – sie hätten dem Angriff nicht einmal dann ernsthaft etwas entgegensetzen können, wenn sie darauf vorbereitet gewesen wären.
Brahe sah einen Soldaten hektisch seine Muskete laden und nahm ihn ins Visier. Gut! Er wollte nichts so sehr als diese Männer töten. Gleich würden er und seine Reiter heran sein, gleich würde er feuern können. Die Wut war so groß, dass das Kind, auf das er im letzten Augenblick doch nicht geschossen hatte, bereits aus seinen Gedanken verdrängt war. Er brüllte laut und hörte das Kriegsgeschrei der Männer links und rechts von ihm – „Magdeburger Pardon!“ –, aber die Erinnerung an die grausame Zerstörung Magdeburgs vor elf Monaten durch die tillyschen Soldaten war nur ein Name für all die Gräuel, die sie gesehen hatten, von den zu Tode geschändeten Frauen und Mädchen links und rechts der kaiserlichen Heerstraßen bis zu den Feuern von Würzburg, in denen die Kinder gebrannt hatten. Jeder der Småländer wünschte sich den Tod der Kürassiere ebenso sehr wie ihr Anführer.
Ein Dutzend apokalyptischer Reiter, die direkt in die Hölle galoppierten, um die Teufel darin abzuschlachten.
3.
Der Junge taumelte in den Schutz des Waldsaums und fiel hinter den ersten Bäumen zu Boden. Sein Körper verkrampfte sich im Schüttelfrost. Er versuchte sich das Gesicht seiner Mutter vorzustellen, aber es gelang ihm nicht – weder das rotwangige, augenzwinkernde Lächeln aus besseren Tagen noch die blutverschmierte, zerschlagene, zur Unkenntlichkeit aufgeschwollene Fratze, die ihn aus dem Dunkel der Scheune heraus angesehen hatte. Der Anblick von Leupold schob sich davor, splitternackt, auf den Boden geworfen wie totes Schlachtvieh, die grässliche Wunde zwischen den Schenkeln, das von den Tritten und Schlägen aufgeplatzte Fleisch seines Oberkörpers, die aus den Höhlen gequollenen Augen – und das unsägliche Teil, das man ihm in den Mund gestopft hatte und woran er erstickt war. Der Junge rollte sich zusammen und wimmerte.
Aus der Richtung, in der der Bauernhof lag, drang das trockene Peitschen von Schüssen, Gebrüll, Pferdewiehern, das Donnern der galoppierenden Bestien, wütende Befehle und panisches Gewimmer. Das Feuer toste und röhrte dazwischen. Er presste sich die Hände auf die Ohren, doch es nützte nichts. Er kniff die Augen zusammen, aber der Anblick des toten Leupold ließ sich nicht vertreiben. Er begann zu schreien. Als er erst damit angefangen hatte, konnte er nicht mehr aufhören.
Schließlich verstummte er doch, wenn auch nur aus purer Erschöpfung. Es war stiller geworden hinter dem Hügel, selbst das Prasseln des Feuers schien schwächer geworden zu sein. Er hörte Rufe und ein sich ständig wiederholendes Geschrei einer einzelnen, schrillen Stimme: „Quartier! Quartier!“ Ein Schuss dröhnte, und die schrille Stimme war verstummt. Langsam richtete er sich auf und versuchte, durch das Gestrüpp hindurch nach draußen zu sehen. Von einer Seite näherte sich das grollende Donnern, das er nun kannte: heranstürmende Kavallerie. Er erstarrte vor Entsetzen. Er sah die Reiter, denen er auf der Flucht begegnet war, vollständig wieder über den Hügel kommen, ein dichter Pulk diesmal, der sich um einen dicken Mann mit gelbem Gewand scharte und ein halbes Dutzend zusätzlicher, reiterloser Pferde hinter sich herzog. Sie galoppierten an seinem Versteck vorbei. Wenn sie die Pferde an der Stelle in den Wald getrieben hätten, an der er lag, hätten sie ihn über den Haufen geritten, denn er war nicht fähig, sich zu bewegen. Etliche qualvoll trommelnde Herzschläge später galoppierte eine andere Gruppe Reiter den Hügel herauf, hielt aber vor dem Waldrand an. Die Pferde tänzelten und drehten sich um sich selbst, ihre gepanzerten Reiter fluchten und schwenkten die Waffen.
„Wenn wir da hineinreiten und der Schwed’ steckt noch drin, knallt er uns alle ab!“, schrie jemand.
„Sollen wir die Schweinerei drunten ungesühnt lassen, du Schmalkachel?“
„Sühnen wir sie auf dem Schlachtfeld, morgen! Für jeden unserer Kameraden ein toter Schwed’ und noch einer als Dreingabe!“
„Zwei als Dreingabe!“
„Und der fette Arsch von Gustav Adolf!“
Die Männer brüllten vor Lachen. Dann rissen sie die Pferde herum und stürmten den Hügel wieder hinunter.
Der Junge ließ den Atem langsam entweichen. Seine Hände hatten sich so um die Zweige gekrampft, die er vorsichtig beiseitegeschoben hatte, dass er sie nur mit Mühe lösen konnte. Er sah an sich herunter und erkannte, dass er sich vor Angst beschmutzt hatte. Ein Schluchzen stieg in seiner Kehle auf.
Dann packte ihn etwas von hinten, eine Pranke legte sich über seinen Mund, er wurde gegen etwas Raues, nach hundert Jahren Schweiß und Dreck Stinkendes gedrückt und davongeschleppt, und seine von neuerlichem Entsetzen rotierenden Sinne hörten ein Stammeln: „Teufel … Teufel … T…t…teufel …!“
4.
Am dritten Abend ergriff der Einsiedler zum ersten Mal das Wort. Bis dahin war der Junge ihm auf seiner scheinbar ziellosen Wanderung durch den Wald hinterhergestolpert, weniger aus dem Bewusstsein heraus, dass der hünenhafte Alte ihn gerettet hatte und es möglicherweise gut mit ihm meinte, sondern eher aus der Ratlosigkeit, wohin er sich sonst hätte wenden sollen.
„N… N… gnnnnn! … N…name?“, fragte der alte Mann. Sein Gesicht war wettergegerbt und von einem dichten Bart überwuchert, eine Ansammlung wuchtiger Kanten und Kliffe. Das Lachen sah eher wie Zähnefletschen aus, aber der Junge fürchtete sich nach zwei Tagen schweigsamen Zusammenseins nicht mehr genug, um davon in die Flucht geschlagen zu werden.
Er zuckte mit den Schultern.
Der Einsiedler deutete auf sich. Sein Mund arbeitete. „P… P…“
„Was?“, fragte der Junge unwillkürlich.
Der Einsiedler verdrehte die Augen und deutete erneut auf sich. „P… P…“ Plötzlich brach er ab und machte eine wegwerfende Bewegung. Er beugte sich zu dem Jungen und fasste ihn am Handgelenk. Der Junge wollte sich losreißen, doch der Einsiedler legte nur dessen Faust auf seine eigene Brust. „Petr!“, sagte er halbwegs deutlich.
„Petr? Soll das dein Name sein?“
Der Einsiedler nickte. Der Junge musste lachen. Das Geräusch schien dem Einsiedler fremd vorzukommen; er legte den Kopf schief und lauschte ihm hinterher. Dann deutete er erneut auf den Jungen. „Name?“
Der Junge seufzte und ließ den Kopf hängen. Er antwortete nicht.
Diesmal zuckte der Einsiedler mit den Schultern. Dann legte er sich wortlos auf die Seite und begann nach ein paar Augenblicken zu schnarchen. Der Junge starrte den dunklen Wald um sich herum an. Falls Tiere in der näheren Umgebung herumschlichen, wurden sie jedenfalls durch das Schnarchen vertrieben. Das Gesäge hatte etwas Tröstliches, so wie der muffige Geruch des Einsiedlers und seine Struppigkeit – es erinnerte ihn an den Hütehund, wenn sie sich in einem Regenschauer aneinandergedrängt und gegenseitig gewärmt hatten. Nach einer Weile kroch er zu dem Alten hinüber und rollte sich neben ihm zusammen.
5.
Wenn man die Gesten, die Mimik der klobigen Gesichtszüge und das Gestammel des Einsiedlers zusammennahm und sich durch nichts ablenken ließ, war fast so etwas wie eine Unterhaltung möglich. Nicht dass der Alte viel Wert darauf gelegt hätte, eine Diskussion zu führen. Wenn er sprach, dann sprach er allein. Was er zu sagen hatte, benötigte Tage, um sich im Geist des Jungen zu formen, aber dann hatte er es verstanden. Es war eine Geschichte.
„Es ist, weil wir gesündigt haben“, sagte Petr. „Das ist schon sehr lange her, aber Sünden gehen nicht einfach weg. Man muss dafür Buße tun, und solange man nicht genug Buße getan hat, bleibt die Sünde in der Welt und vergiftet alles.“
„Was für ein Gift?“
„Das, was draußen passiert. In den Städten. In den Dörfern. Der Krieg. Dass so viele Menschen erschlagen werden. Dass keiner mehr weiß, was der wahre Glaube ist, und dass die Hoffnung stirbt. Es ist unsere Sünde. Wir haben darin versagt, die Welt vor ihr zu beschützen. Wir haben … schreckliche Dinge getan!“
Dem Jungen wurde stets unheimlich zumute, wenn der Einsiedler zu weinen begann. Er hatte den Bauern nie weinen sehen, und auch die Knechte nicht. Weinen war den Weibern und den Kindern vorbehalten. Er fühlte sich schutzlos, sobald der Alte das Gesicht in seinen Pranken vergrub und schluchzte.
Die Geschichte, in mühsamen Wochen dem Geist des Alten entrungen, war diese:
Einst hatte der Teufel ein Buch geschrieben. Ein sündiger Mönch hatte ihn um seine Hilfe gebeten, damit er seine Buße vollenden konnte, und hatte dem Teufel seine Seele dafür versprochen. Das Buch hatte eine Sammlung all des Wissens sein sollen, das der Mönch im Laufe seines Lebens erworben hatte; doch der Teufel hatte sich einen Spaß daraus gemacht, stattdessen seine eigene Weisheit darin festzuhalten. Es war eine Weisheit ohne Erbarmen, eine Klugheit ohne Liebe, ein Wissen, das nicht zur Erleuchtung, sondern zum Erwerb der Macht diente, es war des Teufels stärkste Waffe in seinem Plan, die Menschen zu verderben, weil die Menschen stets nach Erkenntnissen gierten, um Gott ähnlicher zu werden. Wenn man einem Narren eine Fackel in die Hand drückte, würde er das Haus abbrennen; wenn man sie einem Gelehrten gab, würde er die ganze Welt in Flammen setzen. Niemand wusste das so gut wie der Teufel.
Sieben schwarze Mönche hatten dieses Buch bewacht. Es mussten immer sieben sein, damit der Zirkel vollkommen war. Jahrhundertelang hatte dies gegolten. Doch eines Tages war ein Unwürdiger in diesen Zirkel geraten, einer, der schwach war, einer, der statt Verstand nur Vertrauen besaß, einer, der nicht misstraute, sondern liebte … einer, der an seiner Aufgabe zerbrach.
„Ich“, schluchzte der alte Einsiedler. „Ich war dieser Mann.“
Petr – Bruder Petr, die Reste der Mönchskutte hingen immer noch an dem ausgemergelten Leib –, hatte sich auf die Jagd nach einer unschuldigen Seele hetzen lassen, hatte gemordet im Namen des Buches … und das Buch hatte ihm alles genommen, was er geliebt hatte. Die Sünde des Mönchs, der damals den Teufel um Hilfe gebeten hatte, war durch die Jahrhunderte auf Petr gekommen; der Erschaffer des Buches hatte damals auch gemordet. Petr hatte das Buch bewacht, und es hatte ihn berührt … beschmutzt.
„Es beschmutzt alles, was einmal rein war“, flüsterte er.
Durch Petrs Schuld war der Zirkel zerbrochen. Er war geflohen. Er hatte zugelassen, dass die Bosheit des Buches in die Welt dringen konnte, und das war das Ergebnis: ein Krieg, in dem sich das ganze Reich zerfleischte, in dem Christen gegen Christen standen, ein Armageddon auf Raten, ein langes, grässliches Sterben, nicht begleitet von den Posaunen des Jüngsten Gerichts, sondern vom Trommelschlag der marschierenden Heere und vom Flehen der Gemarterten um Barmherzigkeit.
„Warum hast du das Buch nicht verbrannt?“, fragte der Junge.
„Man kann nicht gegen das Vermächtnis des Teufels kämpfen“, erwiderte Petr. Er brauchte viele Anläufe dafür, es endlich herauszubringen.
„Man kann auch nicht immer wegrennen“, sagte der Junge. „Irgendwann geht dir die Luft aus, und dann holt es dich ein. Wenn du eine Maus in der Scheune findest und in eine Ecke jagst, dreht selbst sie sich um und kämpft.“
Petr schüttelte den Kopf.
„Wo ist das Buch?“
Petr schüttelte erneut den Kopf.
Der Junge betrachtete ihn eine lange Weile. Ein überraschendes Gefühl stieg in ihm auf. Es war Zuneigung. Es war der Wunsch, den riesenhaft gebauten alten Mann zu beschützen. Er, der kleine Kerl, wollte den alten Einsiedler behüten, der mehr als doppelt so groß war wie er? Aber hatte er es nicht auch immer geschafft, die Schafe zu beschützen, wenigstens bis die goldenen Reiter gekommen waren, und die waren ein paar Dutzend gewesen und er ganz allein?
„Ich finde das Buch“, hörte er sich sagen. „Ich finde es, und dann zerstöre ich es. Dann musst du dich nicht mehr ängstigen, Väterchen!“
„Niemand kann es zerstören. Es wird stattdessen ein Opfer verlangen.“
„Dann werde ich das Opfer bringen.“
„Es wird dich vernichten.“
„Wer sagt denn, dass ich das Opfer sein muss?“, fragte der Junge und lachte. „Sorg dich nicht, Väterchen. Sag mir nur, wo das Buch ist und wie es heißt.“
Der Einsiedler schüttelte den Kopf. „W… w… gnnnnh … w… wir … müssen schlafen“, krächzte er und legte sich neben dem Feuer auf den Boden.
Auch in dieser Nacht schlief der Junge schlecht, doch es waren keine Angstträume, die ihn wach hielten. Der alte Mann stöhnte und ächzte im Schlaf. Er schien an der Grenze zwischen Schlaf und Wachen dahinzutaumeln. Seine riesigen Pranken zuckten. Der Junge brachte seinen Mund ganz vorsichtig an das Ohr des Alten.
„Wie heißt das Buch?“, flüsterte er.
Er nickte, als der Name sich den zitternden Lippen entrang. Er würde den Namen nicht vergessen. Und wenn er vor dem Scheiterhaufen stand, in dessen Flammen das Buch verzehrt wurde, würde er sagen: „Siehst du, Väterchen, jetzt ist alle Angst vorbei. Ich habe die Teufelsbibel verbrannt.“
Er schlief ein, zum ersten Mal seit seiner Flucht aus dem Bauernhof mit dem Gefühl, dass die Welt sich weiterdrehte; und zum ersten Mal in seinem Leben mit der Ahnung, dass auch eine Existenz wie die seine einen Sinn hatte.
Ein paar Tage später starben seine Träume unter den Knüppeln der Soldaten.
1. BUCH
GÖTTERDÄMMERUNG
Dezember 1647
Wir müssen uns mit aller Kraft bemühen, uns selbst heilen zu können. MARCUS TULLIUS CICERO, TUSKULANISCHE GESPRÄCHE
1.
Er hatte gesündigt … oh Gott im Himmel, er hatte gesündigt. Er hatte gedacht, seine Tat diene einem guten Zweck, aber am Ende des Tages war sie doch nur eines gewesen: eine schreckliche, widerliche, ganz und gar unverzeihliche Sünde.
Confiteor Deo omnipotenti …
Vor Dir, allmächtiger Gott, bekenne ich …
Er erinnerte sich an das Feuer; an die Schreie; an das Hämmern an der verschlossenen Tür; an das Flehen um Gnade, das leiser und leiser wurde, weil es sich hinter ihm entfernte, weil er davonrannte, weil er sie ihrem Schicksal überließ: der Hölle, die sie fürchteten, der sie um jeden Preis hatten entgehen wollen … der Hölle, die sie jetzt bei lebendigem Leib verschlang.
Confiteor Deo omnipotenti,
Quia peccavi nimis …
… dass ich gesündigt habe ...
Aber das war es wert, oder nicht? Als sie vom Aufruf zu einem neuen Pilgerzug in das Heilige Land gehört hatten, zu dem der König von Frankreich und der Herr von Venedig aufgerufen hatten (es schien, als sei es erst gestern gewesen, und dabei war er damals ein Jüngling gewesen und jetzt ein Mann jenseits der Lebensmitte), hatten sie diskutiert. War es der Glaube wert, dafür zu sterben? Die Antwort war „Ja!“ gewesen, gegeben mit blitzenden Augen und glühenden Wangen. Die Narren, die sie damals gewesen waren, er ebenso wie die anderen. Nichts hatten sie gewusst, gar nichts!
Confiteor Deo omnipotenti,
Quia peccavi nimis,
Cogitatione …
… in Gedanken …
Und es war die falsche Frage. Für den Glauben zu sterben war einfach. Wer glaubte, war überzeugt, dass nach dem Leben auf Erden ein besseres Leben im Himmel auf ihn wartete – warum den Eintritt darein verzögern? Nein, die wahre Frage musste lauten: War es der Glaube wert, dafür zu töten?
Confiteor Deo omnipotenti,
Quia peccavi nimis,
Cogitatione,
Verbo et opere.
… in Worten und Werken.
Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa! Kyrie eleison! Kyrie eleison …
Er blätterte ... blätterte in seinem Hirn, weil er seit Langem die Schriftwerke nicht mehr benötigte, um das Wissen abzurufen. Das Streben des Daseins lag nicht in der Ordnung und erst recht nicht in der Seligkeit, sondern im Gleichgewicht der Dinge. Wenn man das akzeptiert hatte, verstand man das Leben; vor allem, dass jeglicher Anspruch auf Macht und Unterwerfung und alle Lieder vom weißen König auf dem weißen Ross völliger Unfug waren. Es ging nicht darum, zu siegen; es ging darum, ins Gleichgewicht zu kommen. Leben gab es nicht ohne Tod …
Die Worte hallten in seinem Kopf: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
Das war die wahre Dreifaltigkeit, und sie hatte ihre dunkle Entsprechung. Er hörte die gleiche Stimme in seinem Kopf wispern: Nun aber bleiben Misstrauen, Verzweiflung, Hass …
Gleichgewicht. Es kam nur auf das Gleichgewicht an. Das war das Herz aller Dinge.
Kyrie eleison, denn ich habe vom Baum der Erkenntnis genossen, und ich sehe die Welt, wie Du sie geschaffen hast.
Kyrie eleison, denn ich habe gesündigt.
Kyrie eleison, kyrie eleison … denn Du hast es so gewollt, weil ich ein winziger Stein in den Waagschalen von Gut und Böse bin, und Du, o Herr, hast mich in die Schale des Zorns gelegt.
Er hörte die Schreie hinter sich und das Prasseln der Flammen, roch den Rauch …
… es war ein Traum gewesen! Nur ein Traum …
Doch die Schreie blieben, und die Kampfgeräusche. Sie drangen bis hierher – Klingen, die aufeinanderprallten, das Peitschen der Schüsse, die verzweifelten Befehle, Pferdewiehern … das Flattern eines Geschosses, das in hohem Bogen über die Mauern flog, der Einschlag, das Beben des Bodens und das Krachen, mit dem eine Hauswand in sich zusammenstürzte … Hufgetrappel, wilde Flüche, lang gezogene Schmerzensschreie und dazwischen das schrille Gebet eines Menschen, der sich seiner Angst ergeben hatte: Heilige Maria Mutter Gottes, voll der Gnaden …! Heilige Maria Mutter Gottes …! Etwas prasselte, als stünde alles in Flammen, aber reines Mauerwerk konnte doch nicht brennen! Oder doch? Vielleicht brannten heute sogar Steine, vielleicht brannte die ganze Welt, vielleicht starb die Hoffnung hier und heute, nachdem der Glaube schon so lange tot war und zuletzt auch die Liebe gestorben war.
Dies war kein Traum. Oh, wollte Gott, es wäre einer gewesen!
2.
Alexandra Rytíř blieb an der Schwelle der Ägidius-Kirche stehen und holte Luft. Der Geruch, der aus dem weiten, nüchternen Kirchenschiff drang, war einladend – Kerzenwachs und Unschlitt, Reste von Weihrauch, Ölfarbe, Staub und Alter: der ewige Kirchenduft. Für sie würde er nie mehr etwas anderes bedeuten als Abschied, Schmerz und Leere. Ein schneeiger Windstoß ließ sie erschauern; wie passend, dachte sie unzusammenhängend, dass dieser nachdrückliche Beweis der angebrochenen Adventszeit ihr Gänsehaut verursachte. Advent war seit Jahren etwas, das durchlitten werden musste. Keine Kerzen, kein Gebäck mehr … keine warme, kleine Hand, die sich in die ihre schmiegte, um der Kälte zu entgehen. Sie straffte sich und trat ein.
Die Zeit nach dem Mittagsläuten war die beste Zeit, um die Kirche zu besuchen. Meistens war sie dort allein. Es war einfacher, die Fassung zu bewahren, wenn man sie nicht bewahren musste, um neugieriges Mitleid zu verhindern. Wenn man weinen und mit den Zähnen knirschen und Gott beschuldigen durfte, dass er einem das Beste weggenommen hatte, dann war es irgendwie einfacher, es nicht zu tun … dann konnte man sich still niederknien und eine Kerze anzünden, hoffen, dass die kleine Flamme die noch kleinere Seele wärmte, die für so kurze Zeit das Dasein mit einem geteilt hatte und die jetzt irgendwo war, erreichbar nur in Träumen.
Und man konnte hoffen, dass man irgendwann am Morgen aufstehen und den Schmerz nicht mehr so übermächtig empfinden würde, dass jede Stunde des Tages ein Kampf gegen die Verzweiflung war. Sie hoffte seit so vielen Jahren …
Sie holte die Kerze aus ihrem Mantel, hielt den Docht an die Flamme einer der anderen Kerzen, die in der Seitenkapelle brannten, und klebte sie auf dem Steinboden fest. Anfangs hatte sie große, wuchtige Kerzen genommen und nach ihren Besuchen stehen gelassen, doch dann hatte sie festgestellt, dass es Menschen gab, die solche teuren Kerzen stahlen, löschten und dann in einer anderen Seitenkapelle neu entzündeten, um ihre eigenen Bitten an das Emporzüngeln der Flamme zu heften. Im Gegensatz zu früher war sie nicht mehr sicher, ob Gott solche Gebete nicht genauso erhörte wie alle anderen, weil es ihm ohnehin egal war, was die Menschen taten, ob sie lebten – oder starben. Jedenfalls war sie dazu übergegangen, kleine Kerzen zu verwenden und so lange bei ihnen zu verharren, bis sie heruntergebrannt waren.
Sie blickte nach oben, in das nachgedunkelte bärtige Gesicht auf dem Gemälde.
„Behüte deinen Schützling, heiliger Mikuláš“, flüsterte sie. „Behüte ihn im Tod, wenn du ihn schon im Leben nicht schützen konntest.“
Der Heilige antwortete nicht. Die Kerzenflamme brannte stetig. Alexandra schluckte den Schmerz hinunter, der sich in ihre Kehle krallte.
„Hallo, Miku“, wisperte sie heiser. „Hier ist deine Mutter. Geht es dir gut?“
Sie konnte nicht weitersprechen. Während der Anblick der vielen Dutzend Kerzenflammen vor ihrem Gesicht verschwamm, sagte sie sich, dass sie nicht hätte kommen sollen. Immer am Namenstag ihres einzigen Kindes fand sie sich in der Kapelle vor dem Bild von Mikus Namenspatron ein und versuchte, so zu tun, als könne man mit Gott, den Heiligen und den Toten Verbindung aufnehmen. Mühsam kam sie auf die Beine und trat in das Kirchenschiff hinaus.
„Keine Mutter sollte jemals ihr Kind zu Grabe tragen müssen“, hörte sie eine Stimme sagen. Die Stimme war in ihrem Kopf, und sie gehörte Wenzel von Langenfels. Sie hatte die Bemerkung abgeschmackt empfunden und gleichzeitig gewusst, dass es ein ehrlicher Versuch von seiner Seite gewesen war, Mitgefühl auszudrücken.
Wenn du wüsstest, hatte sie damals gedacht und dachte es auch heute. Wenn du wüsstest …
Die kleine Kerze in der Kapelle brannte zügig herunter. Alexandra starrte sie an. Ihr beim Verlöschen zuzusehen war fast genauso, wie Zeuge von Mikuláš’ Verlöschen zu werden, zu beobachten, wie sein schmaler Körper immer schmaler und sein Gesicht immer blasser wurde und seine Augen begannen, an ihr vorbei und durch sie hindurch an einen Ort zu schauen, zu dem sie ihm nicht folgen konnte. Panik befiel sie, sodass sie glaubte, nicht mehr atmen zu können. Sie bückte sich nach der Kerze, doch dann zuckte sie zurück. Wenn sie sie auslöschte, wäre das nicht, als ob sie Mikus Leben …? Aber das Kind war tot, es konnte nicht mehr schlimmer werden, und einfach zu gehen und dann später darüber nachzudenken, ob jemand anderes die kleine Kerze ausblasen und für seine eigenen Zwecke stehlen würde, war fast genauso unerträglich, wie zuzusehen, wie ihr Licht erlosch. Sie löste die Kerze vom Boden, hielt sie dicht vor ihr Gesicht und blies sie aus mit einem Hauch, der wie ein Kuss war. Der Rauch des erloschenen Flämmchens stieg in die Höhe und verging mit einem letzten Flackern, und auf einmal dachte sie, dass sie dieses Flackern auch als das Winken der kleinen Seele ihre Sohns nehmen konnte, die sich bei ihr meldete.
Absurd, dachte sie. Gedanken wie diese waren der letzte Strohhalm, bevor einen der Wasserfall des Schicksals in die Tiefe riss.
Dennoch fühlte sie sich auf eine seltsame Art und Weise getröstet, als sie die Kirche verließ.
Das Licht draußen war trüb. Die Schönheit der Stadt schimmerte durch die Dämmerung und berührte das Herz, auch wenn der Winter sie in ein Mosaik aus grauen und schwarzen Flächen verwandelte, über denen die Rauchsäulen aus den Kaminen hingen und der beißende Hausbrandgeruch in die Gassen sank. Alexandra tastete nach der Kerze in ihrer Tasche. Sie bedauerte es auf einmal so sehr, sie nicht bis zu Ende brennen gelassen zu haben, dass sie fast wieder umgekehrt wäre. Dann erkannte sie die Gestalt, die allein vor der Kirche auf dem Pflaster stand.
„Mama?“
Von Weitem sah Agnes Khlesl immer noch wie eine Frau in mittleren Jahren aus. Ihr langes Haar, das sich zu einem schimmernden Grau gefärbt hatte, trug sie hochgesteckt unter einem Kopftuch; ihre schlanke, hochgewachsene Statur tat ein Übriges, um den Eindruck zu verstärken, dass sie nicht Alexandras Mutter, sondern höchstens ihre ältere Schwester war.
Bestürzt erkannte Alexandra, dass Agnes geweint hatte, und die harsche Frage, ob ihre Mutter ihr gefolgt sei, weil sie ihr noch immer nicht zutraute, allein mit ihrer Trauer fertig zu werden, starb auf ihrer Zunge, zusammen mit dem leisen Gefühl des Trostes, das ihr der Kirchenbesuch geschenkt hatte.
„Was ist passiert?“
Agnes räusperte sich. „Es geht um Lýdie“, sagte sie schließlich.
„Was ist mit der Kleinen? Andreas und seine Familie sind doch auf der Rückreise aus Münster … um Gottes Willen, ist ihnen etwas zugestoßen? Der Krieg ist doch vorbei …“
„Nein, sie sind wohlauf. Außer Lýdie.“
Alexandra starrte ihrer Mutter ins Gesicht. „Schlimm?“
„Schlimm.“ Agnes’ Augen begannen zu schwimmen.
„Wie schlimm?“
Agnes kämpfte damit, es ihr zu sagen. Eine Ahnung stieg in Alexandra hoch, und sie schnürte ihr beinahe die Stimme ab. „Nervenfieber?“
Agnes nickte und senkte den Blick.
„Sie ist die Einzige, die sich damals nicht angesteckt hat“, murmelte Alexandra. In Gedanken forderte sie ihre Mutter heraus, es zu sagen, aber Agnes schwieg, und so sprach Alexandra es aus: „So wie Miku der Einzige war, der damals daran gestorben ist.“
„Kryštof ist auch gestorben“, sagte Agnes.
Alexandra schluckte. Sie antwortete nicht. Auch heute hatte sie wieder vergessen, eine Kerze für ihren verstorbenen Ehemann zu entzünden. Sie fragte sich im Stillen, ob es wohl daran lag, dass sie ihm nicht verzeihen konnte, die Krankheit von einer Reise mit nach Hause gebracht zu haben. Es war nicht seine Schuld gewesen. Wenn einer Schuld trug, dann Gott, und selbst von ihm konnte man nicht erwarten, dass er über jedes einzelne Leben wachte. Nein, es war zu viel verlangt von Gott. Er hatte in den letzten dreißig Jahren genug damit zu tun gehabt, die Seelen derer zu wiegen, die von den Soldaten aller Lager erschossen, erstochen, erschlagen, ertränkt, erdrosselt, zu Tode gefoltert und geschändet worden waren. Wie aber sollte man Gott die Schuld geben und danach einem neuen Tag ins Auge sehen können? Es gab Situationen, da mussten Menschen die Bürde auf sich nehmen, die der Herr der Schöpfung eigentlich zu tragen hätte.
„Er hat es nicht verdient, weißt du“, sagte Agnes leise.
Natürlich hatte er es nicht verdient. Tatsächlich war Alexandra nicht nur Miku genommen worden, sondern auch Kryštof, der Mann, dessen Namen sie trug, der Mann, den sie geheiratet hatte. Kryštof Rytíř war zwei Tage vor Miku gestorben, verzweifelt darüber, dass die Krankheit, mit der er sich angesteckt hatte, nun auch seinen Sohn dahinraffen sollte, und hoffnungslos, weil er seiner Frau ansah, dass sie ihm deswegen nicht verzeihen konnte. Wahrlich, Kryštof hatte das alles nicht verdient gehabt; nicht verdient zu sterben, nicht verdient, sich selbst dafür zu verfluchen, nicht verdient, von seiner Frau verflucht und bei den Kirchenbesuchen ein ums andere Mal vergessen zu werden. Schon gar nicht hatte er verdient gehabt, mit der Lüge zu leben und mit ihr zu sterben, dass Miku sein Kind gewesen war.
„Ich kann das nicht“, sagte Alexandra.
„Ich habe nichts von dir verlangt“, sagte Agnes.
„Du wärest nicht hierhergekommen, wenn du mich nicht darum bitten wolltest, Lýdie zu retten.“