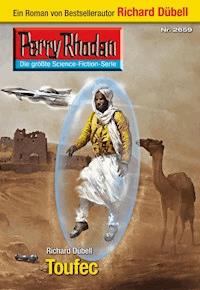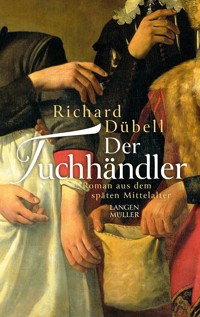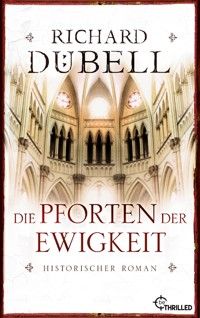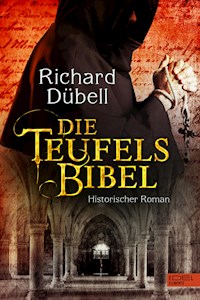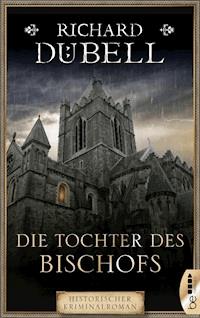6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Teufelsbibel-Trilogie
- Sprache: Deutsch
"Prag, 1612: Nach dem Tod Kaiser Rudolphs II. dringen Plünderer in die Prager Burg ein und stehlen das gefährlichste Buch seiner Zeit - die Teufelsbibel. Wenig später geschehen im Namen des Satans unheimliche Dinge im Land, und düstere Legenden um eine alte Burg in den mährischen Hügeln erwachen zum Leben. Menschen begehen barbarische Verbrechen und berichten, dass sie den Teufel lachen und tanzen gesehen haben ... Gibt es einen Zusammenhang zwischen all den Grausamkeiten und dem Verschwinden der Handschrift? Cyprian Khlesl und Andrej von Langenfels riskieren ihr Leben im Kampf gegen skrupellose Fürsten und Kleriker. Für sie steht noch mehr auf dem Spiel, denn das Böse bedroht auch das, was ihnen am meisten bedeutet: das Leben ihrer Kinder."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1117
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Prag, 1612: Nach dem Tod Kaiser Rudolphs II. dringen Plünderer in die Prager Burg ein und stehlen das gefährlichste Buch seiner Zeit - die Teufelsbibel. Wenig später geschehen im Namen des Satans unheimliche Dinge im Land, und düstere Legenden um eine alte Burg in den mährischen Hügeln erwachen zum Leben. Menschen begehen barbarische Verbrechen und berichten, dass sie den Teufel lachen und tanzen gesehen haben ... Gibt es einen Zusammenhang zwischen all den Grausamkeiten und dem Verschwinden der Handschrift? Cyprian Khlesl und Andrej von Langenfels riskieren ihr Leben im Kampf gegen skrupellose Fürsten und Kleriker. Für sie steht noch mehr auf dem Spiel, denn das Böse bedroht auch das, was ihnen am meisten bedeutet: das Leben ihrer Kinder.
Über den Autor:
Richard Dübell ist als Autor historischer Romane bekannt. Neben seinen schriftstellerischen Aktivitäten leitet er eine Schreibwerkstatt, die er sowohl in Abendkursen als auch als Wochenendseminare und Urlaubsreisen anbietet, und arbeitet als Cartoonist und Grafiker.Dübells Roman „Der Tuchhändler“ wird derzeit in ein Drehbuch adaptiert, an dem der Autor selbst mitarbeitet. Sein Roman „Der Jahrtausendkaiser“ nimmt die These des Erfundenen Mittelalters auf. In „Die Teufelsbibel“ widmet er sich einem der rätselhaftesten Artefakte der mittelalterlichen Kirchengeschichte, dem Codex Gigas. Die gesamte Teufelsbibel-Trilogie, „Die Teufelsbibel“, „Die Wächter der Teufelsbibel“ und „Die Erbin der Teufelsbibel“ sind in 14 Sprachen weltweit übersetzt worden, es gibt Ideen für eine Umsetzung in ein Brettspiel und eine Verfilmung.
Weitere Titel des Autors bei Edel Elements
Die Teufelsbibel (Teufesbibel-Trilogie Band 1)Die Erbin der Teufelsbibel (Teufelsbibel-Trilogie Band 3)Der JahrtausendkaiserDer TuchhändlerEine Messe für die Medici
Richard Dübell
Die Wächter der Teufelsbibel
Historischer Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2008 by Richard Dübell
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, Hannover
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-270-3
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
1612: Caesar mortuus est
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
1617: Der tanzende Teufel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
1618: 1. Teil – Die Sense des Schnitters
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
1618: 2. Teil – Ein tiefer Fall
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
1618: 3. Teil – Pernstein
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Epilog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Anhang
Der Weg in den Krieg 1612–1618
Nachwort
Quellen
Die Grenzen der Seele kannst du nicht finden.
Heraklit von Ephesos
Es gibt eine Legende …
Ein Mönch wurde eingemauert, als Sühne für eine schreckliche Tat.
Während er in seinem Gefängnis verschmachtete, wollte er sein Vermächtnis niederschreiben. Sein Buch sollte all die Kenntnisse enthalten, die er ein ganzes Leben lang gesammelt hatte, für die er sein Leben verwirkt hatte. Es sollte eine Bibel des Wissens werden.
Schon in seiner ersten Nacht erkannte er, dass er niemals damit fertig werden würde. In seiner Not begann er zu beten, und da Gott seine Gebete nicht erhörte, betete er zum Teufel und bot ihm seine Seele an.
Der Teufel kam und schrieb das Buch in jener einen Nacht zu Ende. Aber statt wie vereinbart die gesammelte Weisheit der Welt darin festzuhalten, ergänzte er sie um das Wissen des Teufels. Durch alle Zeiten hindurch hatte der große Verführer versucht, der Menschheit sein Wissen zuzuspielen, für das sie noch nicht reif war und mit dem sie sich selbst zerstören würde. Seinetwegen wurden Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben; seinetwegen würde sich die Menschheit nun endgültig zugrunde richten. Und da er wusste, dass die meisten Menschen vor ihm auf der Hut waren, tarnte er sein Vermächtnis als Niederschrift der Bibel. Wer es ohne Verstand las, dem würde es sich nicht erschließen; die klugen Köpfe jedoch würden es entschlüsseln. Dem Teufel war von jeher daran gelegen, stets die Glänzendsten von uns zu verderben.
Der Mönch würde erkennen, was geschehen war. Doch wenn er das Werk zu zerstören trachtete, so würde auch sein Wissen verloren gehen. Nicht nur sein Leben, auch seine Buße wäre vollkommen vergebens gewesen.
Der Teufel wusste, dass der Mönch dies niemals fertigbringen würde.
Als das Verlies des Gefangenen nach Wochen aufgebrochen wurde, fand man neben seinem Leichnam ein gigantisches Buch. Die Mönche, die es aufschlugen, zuckten entsetzt zurück – auf einer Seite grinste ihnen ein riesiges Abbild des Leibhaftigen entgegen. Alles, was der einsame Mönch hatte tun können, war, die Nachwelt mithilfe dieser Zeichnung zu warnen. Und den Schlüssel zu des Teufels Werk auf drei Seiten in dem Buch zu verstecken.
Es gibt eine Legende …
Wer den Glauben an Gott besitzt, dem gehört das Himmelreich.
Wer das Wissen des Teufels besitzt, der beherrscht die Welt.
Dramatis Personae
(ein Auszug)
Agnes Khlesl
Von ihrer sterbenden Mutter auf die Welt gebracht und in einem Haus ohne Zuneigung aufgewachsen, hat Agnes ihr Herz für immer an Cyprian verschenkt − doch der Preis ihrer Liebe ist hoch
Cyprian Khlesl
Er ist dem Bösen stets in den Weg getreten, wenn es nach den Menschen gegriffen hat, die ihm lieb und teuer sind. Wie nahe es ihm diesmal gekommen ist, ahnt er nicht
Andrej von Langenfels
Cyprians bester Freund und Partner war einmal Dieb, Helfer eines Scharlatans, Erster Kaiserlicher Geschichtenerzähler und ein Mann, dem die große Liebe seines Lebens genommen wurde.
Seither hat er die Schatten der Vergangenheit zu groß werden lassen
Alexandra Khlesl
Agnes’ und Cyprians Tochter glaubt an die Liebe und verzweifelt am Zustand der Welt
Wenzel von Langenfels
Andrejs einziger Sohn muss sich seiner Herkunft stellen
Filippo Caffarelli
Der junge Kleriker kennt die Kirche so gut, dass ihm nur noch eine einzige Frage an Gott geblieben ist
Adam Augustýn
Der Oberbuchhalter der Firma Khlesl & Langenfels hat einen Hang zu außergewöhnlichen Verstecken
Oberst Stephan Alexander Segesser
Der Kommandant der Schweizergarde ist seinem Vorgänger ein loyaler Kamerad – und vor allem ein guter Sohn
Vilém Vlach
Der einflussreiche Brünner Händler hat Verbindungen bis ganz nach oben – und eine Rechnung zu begleichen
Sebastian Wilfing junior
Er ist noch immer der Traum zumindest einer prospektiven Schwiegermutter
Heinrich von Wallenstein-Dobrowitz
Der Vetter eines bekannten Feldherrn hat die Erfahrung gemacht, dass die größte Dunkelheit immer in der eigenen Seele ist
Kassandra de Lara Hurtado de Mendoza
Sie hat den Teufel im Gesicht – und im Herzen
… und noch ein paar historische Figuren
(ebenfalls ein Auszug)
Melchior Kardinal Khlesl
Der Erzbischof von Wien vernachlässigt seine politische Vorsicht
Polyxena von Lobkowicz
Die Gattin des kaiserlichen Reichskanzlers und schönste Frau ihrer Zeit bewahrt ein Geheimnis
Zdenĕk Popel von Lobkowicz
Ein geschmeidiger Realpolitiker im höchsten Amt des Reichs
Abt Wolfgang Selender von Proschowitz
Ein Hirte, der an die Kraft Gottes glaubt, aber nicht an die eigene
Jan Lohelius
Erzbischof von Prag, Primas von Böhmen, Großmeister der Kreuzherren – und
Kriegstreiber wider Willen
Jaroslav Graf von Martinitz, Wilhelm Slavata, Philipp Fabricius
Drei Männer fallen aus dem Fenster und lösen eine Katastrophe aus
Graf Matthias von Thurn
Wortführer der protestantisch-böhmischen Stände
Karl von Žerotín, Albrecht von Sedlnitzky, Siegmund von Dietrichstein
Mährische Politiker mit unterschiedlichen Moralvorstellungen
Matthias I. von Habsburg
Kaiser des Heiligen Römischen Reichs als Nachfolger des verhassten Rudolf II.; im Übrigen keine wirklich bessere Wahl
Ferdinand II. von Habsburg
Erzherzog von Innerösterreich, König von Böhmen und künftiger Kaiser des Heiligen Römischen Reichs; Matthias’ Bruder; ein fanatischer Protestantenhasser
Papst Paul V.
Sein Geist beschäftigt sich mit Prachtbauten, sein Herz mit dem vatikanischen Geheimarchiv – für die Christenheit bleibt da leider kein Platz mehr
Da nahm ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sagte zu ihm: „Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest.“EVANGELIUM NACH MATTHÄUS
1612:
Caesar mortuus est
„Alle, die wir tot dort unten liegen, sind Gebein und Asche und sonst nichts.“ INSCHRIFT AUF EINEM RÖMISCHEN GRABSTEIN
1.
Der Kaiser war tot, und mit ihm war all das gestorben, was an ihm menschlich gewesen war. All das Bizarre, Unverständliche, Monströse, all das Phantastische, Visionäre und Irrsinnige aber, das die Welt darüber hinaus mit seiner Person verbunden hatte, würde bleiben. Es würde in der Erinnerung an ihn konserviert sein für alle Zeiten – und es war hier konserviert, in seinem Reich, seiner Drachenhöhle, seinem Hort tief in den Eingeweiden der Burg auf dem Hradschin.
Sebastiàn de Mora, ehemaliger Hofnarr des toten Kaisers Rudolf, erschauerte. Er erwartete jeden Moment, dass der Geist des Toten um eine der Säulen in der Wunderkammer kommen würde.
„Heiliger Wenzel, was ist denn das?“, flüsterte einer der vermummten Mönche. Er hatte einen Behälter ein Stück weit aus einem Regal gezogen. Glas schimmerte im Licht der Laterne, die der Mönch hielt. Sebastiàn wusste, was es war, er kannte fast alle Sammlerstücke des verstorbenen Kaisers.
Konserviert, dachte er. Genau.
Hastig warf er einen Blick zu den anderen hinüber. Er hatte sich stets gefragt, ob Kaiser Rudolf eines Tages, wenn sein Hofnarr vor ihm sterben sollte, dafür sorgen würde, dass auch dessen Leichnam konserviert werden würde.
Die anderen waren nie hier hereingekommen, aber an ihren Mienen sah er, dass sich diese Frage nun auch ihnen unwillkürlich stellte. Die Bedrohung durch die Mönche, die Rapiere und Dolche in den Händen hielten, war nur zu greifbar; doch wenn man sah, was sich in diesen Regalen befand, und sein eigenes Spiegelbild kannte, dann drängte sich die Frage in den Vordergrund.
Der Mönch wich zurück. Das Glas rutschte aus dem Regal, fiel durch den Lichtschein und zerbarst auf dem Boden. Der Inhalt schwamm heraus und kam auf den Fliesen zu liegen. Ein Gestank von Alkohol und Fäulnis wallte auf.
„Herr im Himmel!“
Der Mönch sprang beiseite. Sebastiàns Leidensgenossen wandten den Blick von der bleichen, aufgedunsenen Gestalt auf dem Boden ab. Der Hofnarr holte tief Luft, obwohl der Geruch ihm in die Nase stach. Er hätte erklären können, dass in den Dutzenden von Gläsern in diesem Regal weitaus entsetzlichere Dinge konserviert waren als ein Säugling mit zwei Köpfen, die beide mit blinden Augen aus ihren halb zerfallenen Gesichtern starrten.
„Das nisst risstige Mönken seien“, flüsterte die Stimme von Brigitta. Er warf ihr einen Seitenblick zu; im Laternenlicht war ihr Antlitz eine Ansammlung von missgestalteten Schattenflächen, die beinahe Ähnlichkeit mit den grauen Gesichtern der Scheußlichkeit auf den Fliesen aufwiesen. Sie war als eine der Letzten an Rudolfs Hof gekommen, ein Geschenk des schwedischen Königs. Sie alle, wie sie hier standen, kleinwüchsige, krummbeinige, kurzgliedrige Wesen mit knolligen oder schiefen Gesichtszügen, hatte Kaiser Rudolf auf der halben bekannten Erdkugel zusammengesammelt.
„Man sollte das alles verbrennen, all diese grässlichen … Monstrositäten!“, stieß der falsche Mönch hervor, der das Glas aus dem Regal gekippt hatte. Sein Blick fiel auf die sechs Zwerge, die sich unwillkürlich zusammendrängten.
„Weiter“, sagte der Anführer der Mönche. „Wir vertrödeln nur Zeit.“
Sebastiàn führte sie tiefer in das Kuriositätenkabinett hinein. Er hatte keine andere Wahl. Er hatte auch keine andere Wahl gehabt, als das böse Spiel der Männer mitzuspielen, als sie plötzlich in dem einsamen Flur aufgetaucht waren, in den Sebastiàn sich zurückgezogen hatte, um Kaiser Rudolfs Tod beweinen zu können. Sie waren zu zweit gewesen. Zuerst hatte er sie für wirkliche Mönche gehalten, dann hatte er das Knallen der Stiefelabsätze gehört, einen Blick in die dunklen Kapuzen geworfen – und zu fliehen versucht. Der Anführer der Männer hatte ihn erwischt und mit einer Hand hochgehoben, ihm mit der anderen den Mund zugehalten; dann hatten sie ihn in eine der vielen Kammern geschleppt, und er hatte sich den anderen Hofzwergen gegenübergesehen und zwei weiteren Mönchen, die Sebastiàns Leidensgenossen mit gezückten Klingen in Schach gehalten hatten.
„Du weißt, wo der Kaiser die Teufelsbibel versteckt hält?“, hatte der Anführer ihm ins Ohr geflüstert. Sebastiàn hatte geschwiegen. Der Anführer hatte ihn geschüttelt. Sebastiàn hatte weiterhin geschwiegen und gefühlt, wie seine Blase vor Angst nachzugeben gedroht hatte. Der Anführer hatte eine kleine Kopfbewegung gemacht, und einer seiner Männer hatte den ihm zunächst stehenden Zwerg gepackt – es war zufällig Miguel gewesen, mit dem Sebastiàn schon am spanischen Königshof zusammen gewesen war – und mit dem Rapier ausgeholt.
Sebastiàn hatte wie wild genickt, halb erstickt vom eigenen trommelnden Herzschlag.
„In einer Truhe in der Wunderkammer, verschlossen mit einer Kette? Und den Schlüssel zur Truhe trägt der Kaiser am Leib?“
Resigniert hatte er ein weiteres Mal genickt.
„Der Kaiser liegt aufgebahrt auf seinem Bett. Glaubst du, du kommst an den Schlüssel ran, Toro?“ Die Stimme des Anführers hatte erregt geklungen. Dass er Sebastiàns Spitznamen kannte, wies ihn als Mitglied von Rudolfs Hofstaat aus. Die Stimme war Sebastiàn dennoch unbekannt gewesen.
Er hatte erneut genickt. Und dann war er losgegangen, hatte seine Aufgabe erfüllt, weil niemand auf die kleine, täppisch vorwärtsstapfende Gestalt geachtet hatte, die sich zum Bett des toten Kaisers vorgearbeitet hatte, während die Würdenträger und Hofbeamten alle in einer Ecke gestanden und flüsternd beratschlagt hatten. Danach war er in die kleine Kammer zurückgekehrt, wider alle Erwartungen hoffend, dass die verkleideten Männer ihn und seine Kameraden freilassen würden.
Die Gruppe blieb erneut stehen, als sie im letzten der Räume angelangt war. Hier hatte Rudolf all die Dinge gehortet, die ihn am meisten faszinierten. Bezoare, mit Gold überzogen, in Silber gefasst oder zu Kelchen umgearbeitet, lagen und standen in Regalen. Ein präparierter Hase mit einem Kopf und zwei Körpern, einer verkrüppelter als der andere, und ein zweiköpfiges Kalb starrten ihre Besucher mit Glasaugen an. Das Laternenlicht strich hastig über die Ausstellungsstücke. Ein äußerlich unscheinbarer Stock glitt aus den Schatten; der Kaiser war überzeugt davon gewesen, dass es sich um den originalen Stock Mosis handelte, so wie er auch geglaubt hatte, dass die lange, elfenbeinerne Spindel in ihrer opulenten Gold- und Juwelenfassung das Horn eines Einhorns gewesen sei. Mechanische Spielzeuge glitzerten matt; das Gewicht der vielen Menschen in der Kammer verschob ein paar Holzbohlen, die nicht ganz abgelaufene Feder eines der Automaten reagierte, und mit lautem Schnarren setzte sich eine metallene Diana auf einem ebenso metallenen Zentauren in Bewegung und rollte ein paar Zoll weit über den Boden. Einer der falschen Mönche fluchte.
Sebastiàn deutete auf einen Ring im Boden. Die Laterne beleuchtete die feinen Umrisse einer meisterlich eingepassten Falltür. Als sie geöffnet war, drangen die scharfen Dünste von Schwefel und Salpeter, der Staubgeruch von getrockneten Pilzen, Totenmoos und anderen Flechten, die Düfte von Rosenöl, Leinöl, Terpentin und Sandelholz nach oben, schwimmend auf einer undefinierbaren, kaum wahrnehmbaren Note von Heimlichkeit, Verstohlenheit und schwarzer Magie.
Sebastiàn und die anderen wurden gezwungen, die Leiter als Erste hinunterzusteigen. Er hörte, wie einer von den Männern die Luft durch die Zähne saugte. Er wollte es nicht, aber dann drehte er sich doch um.
Kaiser Rudolf hatte ein mächtiges Pult für die Teufelsbibel anfertigen lassen. Ein Eisenkäfig war darum herum angebracht, eine kurze Treppe wendelte sich zu ihm empor; es sah aus wie die Kanzel in einer Kirche, in der nicht Gott, sondern abseitigen Experimenten gehuldigt wurde. Sebastiàn erinnerte sich an die Gelegenheiten, bei denen er die Teufelsbibel auf dem Lesepult gesehen hatte: Das weiße Leder schien von sich aus zu schimmern, die metallenen Beschläge sahen darauf aus wie schwarze Tatzenspuren, das ebenfalls metallene Ornament in der Mitte des Deckels wirkte wie ein magischer Schlüssel zu einer Welt jenseits der Realität. Er hatte nie ein ähnlich großes oder gar noch größeres Buch gesehen. Für jemanden wie ihn, der sich auf Zehenspitzen stellen musste, um über eine Tischkante zu spähen, dräute sie auf dem Lesepult wie eine mächtige, schimmernde Klippe. Sebastiàn hörte das Dröhnen in seinen Ohren, das er immer hörte, wenn er hier war; es schien von der Teufelsbibel zu kommen, aber es war tatsächlich nur das Blut, das in seinem Schädel pochte.
„Leer“, sagte der Anführer der Mönche.
Sebastiàn wies zum Fuß der unheiligen Gebetskanzel, wo eine gewaltige Truhe stand. Ein Kettenschloss hing davor. Unaufgefordert watschelte er zur Truhe und sperrte das Schloss auf. Ein langer Arm fasste an ihm vorbei und öffnete den Deckel. Etwas leuchtete matt in der Finsternis des Truheninneren, Beschläge funkelten. Sebastiàn wurde schlecht.
„Gute Arbeit“, sagte der Anführer der Mönche. „Ihr könnt gehen, Zwerge.“
Noch im Umdrehen hörte Sebastiàn das metallene Geräusch, wie eine Sense, die ein zu dickes Büschel Gras mäht. Miguel stand vor Sebastiàn, und einen gähnenden Augenblick lang fragte Sebastiàn sich verwirrt, was anders an Miguel war als sonst, dann wusste er es. Miguels Beine knickten ein, soweit seine verkrüppelten, steifen Gelenke es zuließen, dann fiel er seitlich um wie eine Holzpuppe. Aus dem Halsstumpf schoss ein langer, schwarzer Strahl Blut. Miguels Kopf kam am Fuß des Pults zur Ruhe.
Stille.
Einen Wimpernschlag lang herrschte Stille, einen Wimpernschlag lang, der sich bis in die Ewigkeit ausdehnte.
Miguels Blut prasselte auf den Steinboden nieder wie ein Regenschauer.
Dann begann Brigitta zu kreischen, und die Stille zerstob in panisch wirbelnder Bewegung.
Fünf kleine, stämmige Gestalten rannten kopflos im Labor umher. Die falschen Mönche fluchten und schwangen die Klingen, aber die Todesangst machte die kurzen Beine wieselflink, und das zum Bersten mit Tischen, Bänken und Trögen vollgestopfte Labor hinderte die großen Männer daran, ihren Vorteil auszuspielen. Ein Rapier zuckte einem Flüchtling hinterher, schlug aber in die Kante eines Tisches statt in dessen Rücken. Die Phiolen und Kolben darauf klirrten und tanzten, fielen herunter und zerplatzten, als der Besitzer des Rapiers hastig versuchte, es aus dem Holz zerren. Funken sprühten auf, als eine andere Klinge über einen Steintrog schrammte und die bunte Gestalt, die hineingekrabbelt war, verfehlte. Brigitta kreischte wie von Sinnen, während sie unter Tischen hindurchschlüpfte und mit wedelnden Ärmchen versuchte, die Leiter zu erreichen. Jemand rannte in vollem Lauf gegen das Pult mit der Teufelsbibel, prallte zurück und fiel zu Boden, und ein Rapier zuckte an der Stelle durch die Luft, wo eben noch ein fliehender Zwerg gestanden hatte.
„Macht die Missgeburten fertig!“, schrie der Anführer der Mönche, stolperte über den kopflosen Leib Miguels und fiel gegen die Truhe. Seine Kapuze rutschte zurück, und Sebastiàn, der wie erstarrt inmitten des Chaos stand, sah ein von einem schwarzen Kopf- und Halstuch verhülltes Gesicht, in dem nur die Augen nicht vermummt waren. Ebendiese Augen starrten auf das weiße Leder der Teufelsbibel, nur eine Handbreit entfernt. Sebastiàn sah Gier und Angst gleichermaßen in ihnen, dann wurden sie blind vor Zorn. Der falsche Mönch fuhr herum und trat gegen Miguels Körper, so dass dieser unter einen Labortisch rutschte. Er hob das Schwert und machte einen riesigen Schritt auf Sebastiàn zu, doch jemand – Hänschen, Sebastiàn war sicher, es war Hänschen, der so dick war, dass er bei einer Aufführung einmal in dem Drahtkorb unter der Pastete steckengeblieben war, aus der er hätte herausspringen sollen – warf sich gegen die Beine des Mannes und brachte ihn zum Wanken. Eine Stiefelsohle glitt in Miguels Blut aus, und der falsche Mönch stürzte zusammen mit einem Tisch zu Boden, eine Explosion aus Glasscherben, vielfarbigen Flüssigkeiten, Pulvern und magischen Kristallen auslösend. Hänschen taumelte in die andere Richtung und entging dadurch einem Klingenstoß, der einen Ledersack durchbohrte. Feinster Rotwein, den Rudolf zur Waschung von Erdwürmern verwendet hatte, spritzte in hohem Bogen heraus.
Sebastiàn erwachte aus seiner Erstarrung und sprang zurück. Seine Blicke hefteten sich auf das Licht der Laterne auf einem Tisch. Wenn er sie löschen könnte, wäre es stockdunkel im Labor; dann wäre die Größe und Stärke der vier Männer ihnen kein Vorteil mehr. Er sah, dass Brigitta sich auf die Leiter gerettet hatte und bereits halb nach oben geklettert war, aber ein kuttenverhüllter Arm streckte sich nach ihr aus. Er sah, dass Hänschen versucht hatte, einem der Angreifer zwischen den Beinen hindurchzuschlüpfen, und es nicht geschafft hatte und eben hervorgezerrt wurde; er sah die beiden anderen Zwerge, die sich in die entfernteste Ecke geflüchtet hatten und sich dort gegenseitig umklammert hielten, gelähmt wie in die Enge getriebene Kaninchen … Wenn es ihm gelang, die Laterne zu erreichen, konnte er seine Kameraden retten.
Er ließ sich gegen den Tisch fallen, auf dem sie stand. Sie schwankte. Seine Ärmchen waren zu kurz; er konnte sie nicht erreichen. In blinder Panik stemmte er sich gegen die Tischplatte, hob den Tisch fast hoch und knickte dann unter ihm ein, aber der Aufprall der Tischbeine auf dem Boden ließ die Laterne tanzen, sie tanzte auf Sebastiàn zu, drohte, von der Kante zu fallen, er kriegte sie zu fassen, verbrannte sich die Finger, warf sich herum, um sie zu Boden zu schmettern …
… und die Szene stand eingefroren vor seinen Augen und würde es für den Rest seines Lebens bleiben: Brigitta, die der lange Arm in der dunklen Kutte von der Leiter gefegt hatte und die gegen eine Wand flog in einem Aufprall, der alle Knochen in ihrem Leib brechen ließ. Ihr Kreischen verstummte. Hänschen, der mit Armen und Beinen zappelnd auf dem Rücken lag und den Mann anstierte, der über ihm stand und das Schwert in seinen dicken Leib trieb. Die beiden in der Ecke, einander immer noch umklammernd, aber jetzt zu Boden gesunken und still liegend, während der Anführer der Mönche sich von ihnen abwandte und das Blut von seiner Schwertklinge troff.
Die Lampe zerplatzte. Plötzliche absolute Dunkelheit, das Tropfen von Flüssigkeiten, das Geräusch von Scherben, die langsam tanzend zum Stillstand kamen, das Knarren von Holz. Ein blubberndes, lang gezogenes Ächzen, das aus Hänschens Mund gekommen sein musste. Ein gezischter Fluch. Das Stolpern von Stiefeln und ein lauterer Fluch. Jemand, der sagte: „He?“, als wäre alles ein Spiel und einer hätte versehentlich die Kerze ausgeblasen. Dann Stille. Und Sebastiàn, der an der Stelle stand, an der er die Lampe zerschmettert hatte, bewegungslos, atemlos, blutlos, keines Gedankens fähig, halb irre vor Entsetzen.
„Das hat man überall gehört“, sagte eine Stimme.
„Hauen wir ab.“
„Toro?“ Es war die Stimme des Anführers. Sebastiàn erschauerte von Kopf bis Fuß. „Nicht schlecht, Toro!“
„Lass uns abhauen, Henyk! Jeden Moment werden die Palastwachen hier sein.“
„Toro?“
Sebastiàn hielt den Atem an.
„Lass die kleine Missgeburt. Hier, ich hab die Leiter gefunden.“
Sebastiàn hörte förmlich das Zögern des Anführers.
„Na gut, na gut. Wir sehen uns wieder, Toro! Los, schnappen wir uns das Ding und verschwinden wir, solange es noch geht.“
Die nächsten Minuten – Stunden? Tage? Jahrhunderte? – waren angefüllt von Ächzen, Fluchen, Herumtappen und Sebastiàns vorsichtigem Kriechen über Glasscherben, stinkende Flüssigkeiten und durch die Finsternis, bis er unter einem der umgefallenen Tische lag, sicher vor einem versehentlichen Tritt, der seine Position verraten hätte. Er hörte die Diebe, wie sie zu viert die Truhe, die zusammen mit dem Buch so viel wiegen musste wie zwei erwachsene Männer, die Leiter hinaufwuchteten; er hörte die Schritte über sich, wie sie schnell in Richtung Ausgang verschwanden. Er wusste nicht, wie lange er noch so dagelegen hatte, als alles wieder verhältnismäßig still war und er seinen Beinen den Befehl gab aufzustehen, während sie sich weigerten. Schließlich kroch er die Leiter empor; seine Haut kribbelte bei dem Gedanken, dass sie ihn hereingelegt hatten und oben bei der Falltür auf ihn warteten, doch nichts geschah. Er torkelte durch das Kuriositätenkabinett, von seinem Instinkt durch die Finsternis gelenkt; als er dachte, er müsse bei den Regalen mit den missgestalteten Fehlgeburten angelangt sein, roch er auch schon den Alkohol und spürte die Konservierungsflüssigkeit um seine Schuhe herum aufspritzen.
Dann flog die Tür auf, Lichtschein drang herein, und ein weiterer Instinkt ließ Sebastiàn hinter das nächste Regal huschen.
„Los, mehr Licht!“
Eine Handvoll Männer drang in das erste Gewölbe. Rüstungen schimmerten. Sebastiàn kroch tiefer in das Regal hinein. Das Licht näherte sich, während die Gruppe die Gewölbe durchquerte. Auch sie hatte einen Anführer, einen Mann mit einem langen, dunklen Mantel. Die Soldaten folgten ihm.
„Mein Gott, was ist das da vorn?“
„Heilige Maria …!“
„Eine Missgeburt“, sagte die erste Stimme und hörte sich krank an. Sebastiàn kannte sie nicht – dafür wurde ihm plötzlich klar, was der knöchellange Mantel tatsächlich war: die Soutane eines Pfarrers. „Seine Majestät hat sie gesammelt. Ich glaube, hier gibt es Dutzende davon.“
„Heilige Maria …“
„Wo ist das geheime Labor?“
„Unterhalb der letzten Kammer, Ehrwürden.“
Das Licht glitt an Sebastiàns Versteck vorbei. Sein Blick fiel auf einen schmuckvoll gefassten Pokal direkt vor ihm. Ein Gesicht starrte ihn aus dem Pokal heraus teilnahmslos an, schwerlidrige Augen, eine breite Nase, wulstige Lippen, ein Kopf, der auf keinem Hals saß und oberhalb der Augen einfach abgeflacht war wie ein Brett. Das Licht verschwand im Kuriositätenkabinett. Sebastian hörte die überraschten oder angeekelten Ausrufe der Wachen und dann die plötzliche, schockierte Stille, als sie die Falltür entdeckt und mit ihren Lampen hinuntergeleuchtet hatten. Er kroch aus seinem Versteck heraus und rannte zum Ausgang des Kuriositätenkabinetts, so schnell er konnte, merkte nicht, dass ihm die Tränen über die Wangen liefen und dass sein Mund versuchte, Worte zu rufen, die seine verformte Kehle niemals würde hervorbringen können, die sich wie ein dumpfes Muhen anhörten und der andere Grund waren, der ihm seinen Spitznamen eingebracht hatte.
Er lief in den Gang hinaus, rannte an die gegenüberliegende Wand, rutschte an ihr zu Boden und schluchzte. Durch die Tränen in den Augen sah er eine Gestalt in gelb-rotem Gewand eilig herankommen, sah einen breitkrempigen Hut mit langen Federn in denselben Farben darüber wippen. Es war ihm egal, dass der Mann ihn auf dem Boden liegen und weinen sah; das Entsetzen über das, was er gesehen und mit knapper Not überlebt hatte, überdeckte alle anderen Gefühle. Er krümmte sich zusammen und wünschte sich, nicht mehr am Leben zu sein.
Plötzlich fühlte er sich hochgehoben; er starrte in ein hübsches Jungengesicht über den Flammenfarben des Gewandes, sah es lächeln.
„Leb wohl, Toro“, sagte das Gesicht, und falls das Entsetzen in Sebastiàns Seele noch größer werden konnte, dann war die Stimme daran schuld. Er kannte sie. Wenige Augenblicke vorher hatte er sie sagen hören: „Macht die Missgeburten fertig!“
Der junge Mann mit dem flammenfarbenen Gewand hielt ihn mühelos mit einer Hand in die Höhe. Sebastiàn schlug mit seinen kleinen Fäusten gegen den Arm, an dem er hing. Es war, als kämpfe ein Schmetterling mit seinem Flügelschlag gegen einen Löwen. Er hörte das Geräusch des Fensters, als sein Gegner es mit der freien Hand öffnete, fühlte die Januarkälte hereindringen. Er hörte sich ächzen …
… dann war er auf einmal schwerelos. Ein Teil seines Wesens fühlte, wie lächerlich die Erinnerung in diesem Augenblick war, die Erinnerung an einen warmen Sommertag, die erhitzten Gesichter, die auf ihn zukamen und sich von ihm wegbewegten, die Decke, die sich spannte und ihn in die Höhe schleuderte, die ihn weich in Empfang nahm, als er wieder nach unten stürzte, nur um ihn von Neuem nach oben zu katapultieren … das Lachen und Kreischen der Hofdamen, die an der Decke ruckten … die kleinen Flügel, die man ihm auf den Rücken geschnallt hatte und die sich in Federgestöber auflösten, während er auf und ab flog, so dass er in einem weichen, warmen Schneegestöber zu taumeln schien … das knielange Hemdchen, das sein einziges Kleidungsstück war und das ihm bei jedem neuen Emporschnellen bis zu den Achseln hochrutschte, zum johlenden Vergnügen der Hofdamen … ein lebender, drei Fuß großer Puttenengel mit feschem schwarzen Schnauz- und Kinnbart und einem Gehänge, das an einem normal großen Mann schon mächtig gewesen wäre und das den ersten Grund für seinen Spitznamen darstellte … das Gelächter ringsherum und die Angst, dass ihn die kreischenden Weiber danebenstürzen ließen, vermischt mit der Erregung, wieder und wieder hochgeschleudert zu werden, zu fliegen …
Er hörte Gebrüll und wunderte sich über den Lärm, bis er merkte, dass er ihn selbst verursachte. Überrascht erkannte er, dass er tatsächlich nichts so sehr wollte wie leben! Er vernahm die Stimme seiner Mutter, die sagte: „Mein kleiner, kleiner Glücksstern!“, und ihn an sich drückte, während Tränen ihre Wangen hinunterliefen und er sich wunderte, worüber sie traurig war, er war doch gesund ...
Er hörte den Wind brausen.
Ein winziger Mann, der dem Tod entgegenstürzte.
2.
Reichskanzler Zdenĕk von Lobkowicz gelangte beim Eingang zur kaiserlichen Wunderkammer an, als sich die Soldaten eben davor postierten. Er keuchte.
Wer glaubte, dass mit dem Tod eines Kaisers das Leben am Hof zu einem trauervollen Stillstand kam, war gut beraten, diese Theorie nicht ihm zu präsentieren; der kleine, harmlos aussehende Mann mit dem gesträubten Schnurrbart und dem glatt nach hinten gekämmten Haar hätte ihn vermutlich angesprungen. Zdenĕk von Lobkowicz war durch all die Jahre hindurch der höchste Beamte im Reich gewesen – Jahre, die vom Verfall Kaiser Rudolfs und von den plumpen Versuchen seines Bruders Matthias, nach der Reichskrone zu greifen, geprägt gewesen waren. Diese Erfahrung hatte ihn ein großes Maß an Verachtung gegenüber fast allen Kreaturen des Hofs gelehrt, die von Gott angeblich auserwählten Herren des Reichs absolut eingeschlossen. Er hatte versucht, dieser Verachtung mit höchster eigener Effizienz zu begegnen, um sie nicht auch noch eines Tages zu verspüren, während er gerade in den Spiegel blickte.
Nur gegenüber einem hochrangigen Mann im Dienst des Reichs hatte er sich Respekt bewahrt: Melchior Khlesl. Der alte Kardinal und Minister war zwar eigentlich als Unterstützer von Rudolfs Bruder Matthias im feindlichen Lager gewesen, doch in diesem Sumpf aus Hofschranzentum, Faulheit und Wichtigtuerei mussten die beiden einzigen kompetenten Beamten notgedrungen Achtung voreinander entwickeln, selbst wenn sie politische Gegner waren.
Der Kreuzherren-Hochmeister und Prager Weihbischof Jan Lohelius stand neben den Soldaten und trat von einem Bein auf das andere; der alte Mann hatte sich eine Soutane angezogen statt des Bischofsstaats und sah darin aus wie fetter, gichtkranker Dorfpfarrer; er war geradezu leuchtend blass. Ein junger Mann lehnte gegenüber neben einem Fenster an der Wand und wirkte so blasiert wie alle jungen Höflinge, die ihre verzweifelte Abhängigkeit von der Gunst eines einfältigen hohen Beamten oder einer ältlichen, nach junger Haut hungernden Hofdame mit Arroganz kaschierten. Ein zweiter Blick in die blauen Augen des jungen Mannes ließ ihn ahnen, dass er hier möglicherweise mit seiner Beurteilung danebenlag, aber warum sich weiter um einen Menschen Gedanken machen, der von keinerlei Wichtigkeit mehr war, wenn diese Aufgabe hier abgeschlossen war, und der mit der Auswahl seiner Kleiderfarben (gelb und rot) zu solch einer Zeit schlechten Geschmack bewies?
Er wandte sich an Lohelius. „Hat es geklappt?“, flüsterte er.
Hochmeister Lohelius nickte wie jemand, der nicht mehr damit aufhören kann.
Lobkowicz forschte in den Taschen seiner Kleidung und fand zwei kleine, metallene Kapseln, die mit abblätternder Farbe bemalt waren – rot und grün. Er starrte die grüne Kapsel an.
„Reichskanzler …“, wisperte Lohelius.
Lobkowicz zögerte, dann öffnete er die Kapsel und nahm das kleine Papierband heraus, das darin eingerollt war. Er hatte es in den letzten Stunden bestimmt ein Dutzend Mal herausgenommen, gelesen, wieder hineingesteckt und dann erneut herausgenommen und gelesen, um sicherzustellen, dass er die richtige Nachricht in die richtige Kapsel getan hatte. Er spähte auf die winzige Schrift. Arcimboldo hat das Gebäude verlassen.
„Reichskanzler …“
„Was denn, Ehrwürden?“
„Es hat geklappt, aber trotzdem … etwas ist geschehen …“
„Was?“ Lobkowicz versuchte, die Papierrolle wieder in die Kapsel zu stopfen. Er stellte fest, dass seine Finger zu stark zitterten, und verfluchte sich dafür. Irgendwo von jenseits des Fensters, das in die Gärten hinabführte, kamen gedämpfter Lärm und Geschrei. „Was ist denn da los, zum Teufel?“
„Ich … ich …“ Der Weihbischof würgte plötzlich und musste sich angestrengt räuspern. „Erzählen Sie es ihm, von Wallenstein.“
Der junge Mann stieß sich von der Mauer ab. Er glitt zu Lobkowicz heran, nahm ihm ungefragt Papier und Kapsel aus der Hand und verstaute die Botschaft mit einer flinken Bewegung. Der Reichskanzler schenkte ihm einen aufgebrachten Blick, hielt aber den Mund und nahm die geschlossene Kapsel wieder in Empfang. Der junge Mann lächelte. Er hatte Gesichtszüge, die man als Vorlage für eine Engelsstatue hätte verwenden können, doch das Lächeln ließ Lobkowicz trotz aller Ebenmäßigkeit, der blitzenden Zähne und feinen Grübchen auf den Wangen erschauern. Er fühlte sich eiskalt angeweht.
„Im geheimen Labor liegen ein paar Tote“, sagte der junge Mann.
„Sind Sie dafür verantwortlich, … äh …?“
„Heinrich von Wallenstein-Dobrowitz“, sagte der junge Mann und verneigte sich. „Nein, sie waren schon dort, als ich mit meinen Männern eintraf.“
„Der Schlüssel zur Tür hat gepasst …?“
„Es war offen“, sagte der junge Mann liebenswürdig.
Lobkowicz biss die Zähne zusammen. „Was sind das für Tote?“
„Des Kaisers Hofzwerge.“
Der Reichskanzler war fassungslos. „Wem sollte daran gelegen sein, die kleinen Missge… die kleinen Burschen umzubringen?“
„Lassen Sie uns annehmen, es war eine Art kollektiver Selbstmord“, sagte Lobkowicz’ Gesprächspartner. „Nachdem ihr Protektor Kaiser Rudolf verblichen war und so weiter …“
„Einer oder zwei waren regelrecht zerstückelt …“, brachte der Weihbischof heraus. „Selbstmord, von Wallenstein!?“
„Ich sage nicht, dass es so war, ich sage nur, dass wir das annehmen sollten. Laut und vernehmlich annehmen, meine ich.“
Lobkowicz, der in allen politischen Dingen von schneller Auffassung war, nickte. „Gut“, sagte er. „Es gibt genug Probleme, da müssen wir uns nicht noch ein paar erschlagene Zwerge ans Bein binden.“
„Auch das sind arme Seelen vor dem Herrn!“, protestierte Lohelius.
Lobkowicz musterte ihn. „Haben Sie einmal zugesehen, wie eine dieser armen Seelen Sie selbst nachgemacht hat, um den Kaiser zu belustigen, komplett mit Amtsgewand, das Seine Majestät dafür hat anfertigen lassen? Und in ein grinsendes Knollengesicht geblickt, von dem Sie ablesen konnten, dass sein Besitzer genau wusste, Sie würden ihn am liebsten in Stücke reißen, aber es nicht wagen, weil der Kaiser sonst noch einen freien Käfig im Hirschgraben für Sie gefunden hätte? Und haben Sie voller Scham festgestellt, dass Sie vor lauter Besorgnis um Ihr Amt zu dieser Komödie gelacht haben?“
Der Weihbischof stotterte.
„Nein, haben Sie nicht“, sagte Lobkowicz. „Ich schon. Lassen Sie mich also in Ruhe mit den armen Seelen. Nur weil sie klein waren, heißt das nicht, dass ihr Vergnügen an Bosheit nicht genauso ausgeprägt war wie das aller anderen.“
„Aber derjenige, der die Tür offen gelassen hat … das kann nur wenige Augenblicke vor der Ankunft von Herrn von Wallenstein gewesen sein … Wir haben sogar ein kaputtes Glas mit einer eingelegten Missgeburt gesehen …“
„Wenn nur mehr davon zerschlagen worden wären!“
„Aber, Herr Reichskanzler – es kann doch etwas aus der Wunderkammer gestohlen worden sein!“
„Was denn? Eine ausgestopfte Meerjungfrau, der jeder Trottel ansieht, dass sie eine Fälschung ist? Eine unwahrscheinlich wertvolle Nuss? Ein Automat, der so tut, als fresse er Perlen, und sie nach zehn Minuten wieder ausscheißt?“
Weihbischof Lohelius bemühte sich, Worte zu finden. Der Reichskanzler kam ihm zuvor.
„Von mir aus kann alles gestohlen werden, was da drin ist. Sobald Matthias Kaiser ist, wird er ohnehin das meiste davon verbrennen, in den Hirschgraben werfen lassen oder veräußern.“
„Ja, aber …“
„Ja, ja.“ Der Reichskanzler fühlte, wie der Zorn ihn langsam verließ. Er zuckte mit den Schultern. „Solange der König von Böhmen noch nicht Kaiser des Heiligen Römischen Reichs ist oder mir keiner etwas anderes gesagt hat, bin ich für die Bewahrung von Seiner Majestät Wunderkammer verantwortlich. Ich weiß schon. Und solange dies gilt, hänge ich jeden auf, der sich daran vergreift.“
„Meine Männer haben die Fracht ordnungsgemäß für die Übergabe vorbereitet“, sagte Heinrich von Wallenstein-Dobrowitz in die Pause hinein, die entstanden war.
„Ein Ledersack mit dem kaiserlichen Wappen darauf?“
„Eine unbezeichnete Kiste mit einem Kettenschloss.“ Heinrich von Wallenstein-Dobrowitz gestattete sich ein mitleidiges Lächeln.
„Haben Sie hineingesehen?“
„Wir hatten nur den Schlüssel zur Eingangstür.“
„War sie schwer?“
„Wie ein Sarg.“
Lobkowicz starrte den jungen Mann an. „Welch ein geschmackloser Vergleich.“
Heinrich von Wallenstein-Dobrowitz breitete die Hände aus. „Ich bitte vielmals um Entschuldigung.“
„Ich will die Kiste sehen.“ Lobkowicz drehte sich um und drückte dem Weihbischof die grüne Kapsel in die Hand. „Hier, Ehrwürden. Da Sie sich schon als einfacher Pfarrer verkleidet haben, können Sie auch die Taube auf den Weg schicken. Sie kennen ja den Weg zum Schlag.“
„Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein, Exzellenz?“, fragte Heinrich von Wallenstein-Dobrowitz.
Reichskanzler Lobkowicz schüttelte den Kopf. „Gott helfe uns allen“, sagte er. „Bringen Sie mich zu Ihren Männern, damit wir die verdammte Übergabe hinter uns bringen können.“ Irritiert blickte er zum Fenster, „Und sorge in Gottes Namen endlich jemand dafür, dass der Lärm da draußen aufhört. Man könnte ja meinen, jemand sei aus dem Fenster gefallen!“
3.
Der Pergamentfetzen hätte für jemanden, der mit dem Geheimen Archiv des Vatikans nichts zu tun hatte, keinerlei Bedeutung gehabt. Ein Mensch, der sich in den letzten Jahren allerdings mit nichts anderem beschäftigt hatte, als im Auftrag von Papst Paul V. eine komplette Umstrukturierung des Archivs vorzunehmen mit dem Ziel, es noch geheimer zu machen, erkannte sofort, was die Zahlenkolonnen bedeuteten: einen Archivierungsort.
Das handschriftliche Gekritzel hinter der Koordinate hätte jemand, der nicht den ganzen Tag von Traktaten, Erlassen und Bullen umgeben war, nicht unbedingt als eine Notiz von Papst Urban VII. erkannt, der im September 1590 überraschend nach einem extrem kurzen Pontifikat von zwölf Tagen verstorben war. Letzteres wäre nicht vollkommen ungewöhnlich gewesen, hätte es da nicht die Gerüchte und Ungereimtheiten gegeben, die sich mit dem Tod des Pontifex verbanden. Wie die Dinge standen, war das Ableben von Papst Urban immer noch ein offizielles Rätsel.
Der Text der kurzen Notiz wäre jemand anderem als Pater Filippo Caffarelli nicht ins Auge gestochen: Reverto meus fides! Du hast mir den Glauben zurückgebracht!
Was hatte Papst Urban den Glauben zurückgebracht? Oder wer?
Und die viel wichtigere Frage: Würde es in seiner Macht stehen, auch Pater Filippo den Glauben zurückzugeben?
„Du bist nicht bei der Sache“, sagte die junge Frau und gab ihm einen spielerischen Nasenstüber.
„Entschuldigung“, sagte Pater Filippo und begann wieder zu stoßen. Es ließ sich nicht leugnen, dass sein Herz nicht bei seiner Tätigkeit war. Er spürte die Hände der jungen Frau, die die seinen umklammerten, und ahnte, dass seine Bewegungen schnell wieder erstorben wären, wenn sie nicht schon nach der letzten Mahnung die Initiative ergriffen hätte. Er hörte sie keuchen und sah in ihr verschwitztes Gesicht, ohne es wirklich zu sehen.
Wer sollte nicht den Glauben verlieren in einer Zeit wie dieser, in der ein katholischer Erzherzog sich mit protestantischen Ständen verbündete, um seinem Bruder die böhmische Königskrone abzunehmen, seit Jahrhunderten das Unterpfand für die Wahl zum nächsten Kaiser? Wer sollte nicht am Kaisertum an sich verzweifeln, wenn er überlegte, wie lange Kaiser Rudolf seine Würde getragen hatte, ein von jeder Religion abgefallener Ketzer, der widernatürliche Experimente in seinen geheimen Laboren trieb und Sterndeuter, Quacksalber und alchimistische Ketzer um sich versammelt hatte? Und wer sollte nicht an seiner Kirche irrewerden, wenn ihr oberster Hirte sich nicht um die Wiedervereinigung der gespaltenen Christenheit bemühte, sondern in seinen drei Hauptprojekten vollkommen aufging: dem Geheimen Archiv, dem Neubau der Fassade des Petersdoms und der Verteilung von Kirchenpfründen an seine Familie?
„Das führt zu nichts“, sagte die junge Frau und stellte ihre rhythmischen Bewegungen ein. Sie ließ die Hände sinken; beschämt rückte Filippo von ihr ab.
„Du denkst zu viel, Brüderchen“, sagte sie, schob das Butterfass in eine andere Position, umklammerte den Stampfer und begann, alleine zu stoßen. Filippo betrachtete seine Hände und schwieg. „Und es wird immer schlimmer mit dir.“
„Ich wollte dir wirklich helfen.“
„Hilf dir selbst, und sag mir, was du auf dem Herzen hast.“
„Hast du schon mal etwas von der Teufelsbibel gehört?“
„Wovon?“
Filippo seufzte.
„Gehört nicht, aber ich glaub’s aufs Wort, dass es so was gibt. Wenn der eine da oben ein Buch über sich hat schreiben lassen, warum nicht auch der da unten?“
„Vittoria, es ist schockierend, dass jemand so spricht, in dessen Familie ein lebender Papst und ein Kardinal sind.“
„Gerade dann lernt man das.“ Vittoria Caffarelli ließ den Stampfer ruhen und betrachtete ihren jüngeren Bruder Filippo, das Nesthäkchen, unter dem Vorhang ihres aufgelösten langen Haars hindurch. „Besonders wenn man dem Kardinal den Haushalt führt. Warum fragst du ihn nicht, unseren großen Bruder?“
„Scipione?“ Filippo schüttelte den Kopf.
„Was ist so wichtig für dich an dieser Teufelsbibel? Wenn du sie findest, wird sie sich gewiss als dämliche Fälschung irgendeines minderbemittelten Mönchs vor vierhundert Jahren herausstellen und nicht mal Geld wert sein.“
„Woher weißt du das?“ Filippo kniff die Augen zusammen. „Das mit den vierhundert Jahren?“
Vittoria lachte. „Das weiß ich gar nicht. Ich hab einfach eine Zahl genannt.“
„Die Teufelsbibel ist vor vierhundert Jahren entstanden. Und Papst Urban hat danach gesucht.“
„Lange Zeit kann er damit nicht zugebracht haben.“
„Ich glaube, seine Suche hat ihn getötet.“
„Ich glaube, der Blick in die Abgründe aus Schweinerei, aus denen der Vatikan zum großen Teil besteht, hat ihn getötet.“
Filippo fragte sich, ob ihm das Los des Zweiflers im Angesicht der katholischen Kirche erspart geblieben wäre, wenn er eine weniger zynische ältere Schwester gehabt hätte. Vittoria und er waren die letzten in der Reihenfolge der Caffarelli-Geschwister. Nachdem zwei weitere Kinder vor ihnen nicht über das Säuglingsalter hinausgekommen waren, bestand eine große altersmäßige Lücke zwischen dem nächstälteren Geschwister und ihnen, und zum ältesten Kind der Familie, Erzbischof Scipione Kardinal Caffarelli, waren es zehn Jahre – eine mächtige Distanz, die sich vielleicht dennoch hätte überbrücken lassen, wenn alle Beteiligten nur intensiv genug daran gearbeitet hätten. Dies war nicht geschehen, und so hatten sich die beiden jüngsten Geschwister eng zusammengetan, bereits als Kinder ahnend, dass ihre Daseinsberechtigung einmal darin bestehen würde, auf die eine oder andere Weise all den anderen zu dienen.
Vittoria war Scipiones Haushälterin geworden, Filippo ein Pfarrer ohne Gemeinde in der Diözese seines großen Bruders, der für all die gelegentlichen Aufgaben innerhalb des Vatikans ausgeliehen wurde, mit denen Scipione Caffarelli sich lieb Kind machen konnte. Scipione, der große Schatten im Leben von Filippo, ein düsteres Monument aus Glaubensfestigkeit, Bigotterie und katholischem Eifer, in dessen klammer, kalter Dunkelheit Filippo seinen persönlichen Scheiterhaufen des Zweifels errichtet hatte und darin brannte.
„Ich habe herausgefunden, dass Papst Urban der festen Überzeugung war, mit Hilfe der Teufelsbibel die Spaltung der Kirche überwinden zu können. Es muss etwas darin stehen, das einen alle Zweifel verlieren lässt …“
„Armes Brüderchen. Der Glaube kommt nicht von außen, das müsstest du doch wissen, der du täglich mit den Lektionen des Papstes und der anderen Kirchengrößen konfrontiert wirst.“
Filippo zuckte mit den Schultern. Nicht einmal zu seiner Schwester hatte er genug Vertrauen, um ihr zu gestehen, dass in seiner Seele ein gähnendes Loch war, wo sein Glaube sich hätte befinden sollen. Dort drin war nichts außer Schwärze. Ein Loch dieser Art schrie danach, von außen gefüllt zu werden.
„Was hast du noch herausgefunden?“
„Dass die Protokolle über Papst Urbans Tod nicht ganz zusammenpassen. Aber darüber hinaus – nichts.“
„Was sagen die Protokolle der Schweizergardisten aus?“
Filippo starrte Vittoria an.
„Die Schweizergardisten“, wiederholte Vittoria. „Schon mal gesehen? Die Kerle, die aussehen wie Pfauen, mit den langen Hellebarden und einem grässlichen Akzent …“
„Vittoria!“ Filippo hasste es, wenn ihr Zynismus sich gegen ihn richtete. Sie räusperte sich und nahm den Stampfer wieder zur Hand.
„Die Kerle wissen alles“, sagte sie zum Takt des Butterstampfers. „Aber du wirst nichts aus ihnen rauskriegen. Die sagen nur was, wenn du sie unter Druck setzt.“
„Wie sollte ich die Schweizergarde unter Druck setzen?“
„Jeder hat Dreck am Stecken.“
„Die Schweizergarde nicht.“
„Dann hast du ja schon einen wunden Punkt gefunden.“
Filippo gab seiner Schwester einen Kuss auf die Stirn. „Warum arbeitest und kochst du für unseren verdammten großen Bruder?“, fragte er. „Du bist die Klügste von uns allen.“
Vittoria betrachtete ihn liebevoll. „Ich habe zu oft zugesehen, wie Scipione sein Spiel mit dir gespielt hat“, sagte sie und strich ihm über die Wange. „Das Glaubensspiel. Weißt du noch?“
„Ja“, sagte Filippo erstickt.
„Eines Tages“, sagte sie, „finde ich den Mut und mische ein Pfund Rattengift in seinen Fraß. Nur aus diesem Grund koche und arbeite ich für ihn.“
4.
Das Geräusch erinnerte Abt Wolfgang Selender an Iona. Wo er sich auch aufgehalten hatte – er hatte dem Auf- und Abschwellen des Lärms niemals entgehen können. Es hatte zum Leben auf der Insel dazugehört, so wie die Kälte, der Regen, die tief hängenden Wolken und die beständige schlechte Laune der schottischen Brüder. Das Geräusch hier klang ähnlich; es wurde lauter und leiser, hallte in den Gängen des Klosters wider, brach sich an Kanten, Mauerecken und Treppenstufen, wogte vor und zurück.
In Iona war es die Brandung gewesen, die die Mönche in der stolzen Benediktinerabtei niemals allein gelassen hatte, mit der sie in den Schlaf gesunken und wieder aufgewacht waren.
Hier, in Braunau, war allen außer Abt Wolfgang das Geräusch der Brandung unbekannt, und auch Wolfgang wusste, dass es nur das An- und Abschwellen war, das ihn an das kalte, einsame, ganz und gar in Gott und seine Schöpfung versunkene Jahr auf der schottischen Insel erinnerte.
Das Geräusch selbst hatte mit dem geduldigen Schlag der Wellen nicht das Geringste zu tun. In Wahrheit war es das rhythmische Grölen einer hasserfüllten Menge, durch die Klostermauern auf ein Rauschen reduziert.
Er hasste die Meute. Er hasste sie dafür, dass sie die Frechheit besaß, vor seiner Klosterpforte zu lärmen, er hasste sie dafür, dass sie sich frei genug fühlte, ihn – den Abt von Braunau, den Herrn der Stadt! – zu bedrohen. Er hasste sie für ihren protestantischen Irrglauben und dafür, dass sie all seinen Maßnahmen zu ihrer Einschüchterung und all seinen Lockungen zum Abfall vom Ketzertum widerstand. Am meisten hasste er sie dafür, dass sie seine Erinnerung an Iona beschmutzte.
Abt Wolfgang hörte, wie sich die Tür zu der kleinen Zelle öffnete, in der er tagsüber zu sitzen pflegte, um Anfragen der Mönche zu beantworten oder Probleme zu lösen. Er drehte sich nicht um.
„Es werden immer mehr, ehrwürdiger Vater“, sagte eine zittrige Stimme.
Er nickte. Sein Blick wich nicht von der Inschrift an der Wand. Er hatte sie dort stehen lassen, als Mahnung für sich selbst und als Hinweis darauf, was geschehen konnte, wenn man aufhörte, der Kraft Gottes zu vertrauen.
„Was sollen wir tun, ehrwürdiger Vater? Wenn sie anfangen, gegen das Tor zu rennen … Du weißt doch, dass es nicht viel aushält …“
Natürlich wusste er, dass das Tor es nicht einmal wert war, so genannt zu werden. Als er hier auf Befehl des Kaisers und auf Vermittlung eines guten Freundes in höchsten Kirchenkreisen angekommen und das durch den Tod Abt Martins, seines Vorgängers, verwaiste Amt übernommen hatte, hatte es kein Tor gegeben. Die Klosterpforte hatte ausgesehen, als sei ein Sturmangriff über sie hinweggegangen. Später, als er begriff, welch düsteren Schatz sein Kloster hütete, erfuhr er auch, dass es tatsächlich so gewesen war. Abt Martin hatte nichts mehr reparieren lassen; die Klosterdisziplin war vor die Hunde gegangen. Nicht anders als auf Iona, hatte Wolfgang gedacht. Die üppige Kulturlandschaft und das sich langsam von der letzten Pestwelle erholende Braunau waren zwar vollkommen anders als die schottische Insel in ihrer kargen, maritimen Klarheit, aber ansonsten gab es kaum einen Unterschied: Er, Wolfgang Selender von Proschowitz, war an einen Ort gerufen worden, an dem Gott und die benediktinischen Regeln eine entschlossene Hand benötigten, die wieder Ordnung schaffte. Dass er, der seit Jahrzehnten dieser Berufung folgte, von Herzen gern auf Iona geblieben wäre, wo das Meer den simplen, alles durchdringenden Rhythmus des Glaubens vorgab, durfte keine Rolle spielen. Er hatte die Aufgabe angenommen, in fester Zuversicht, sie in einem oder zwei Jahren vollendet zu haben. Nachdem er erkannt hatte, was hier in Braunau wirklich im Argen lag, hatte er sich fünf Jahre gegeben und die Gegenreformation in der Stadt in seine Zeitberechnung mit aufgenommen.
Mittlerweile waren bereits zehn Jahre vergangen, und alles, was er geschafft hatte, war, die neuen Torflügel an der Klosterpforte anbringen zu lassen. Sie jedoch so einzumauern, dass sie einem Sturmangriff trotzen würden, war ihm noch nicht möglich gewesen. Das Kloster, einst eines der Zentren der Gelehrsamkeit in Böhmen, gespeist von der reichen Tuchmacherstadt vor seinen Mauern, lag nun am Ende der Welt, und die Stadt war geschwächt von Überschwemmungen, Seuchen und einem hartnäckigen Ketzertum, das sich jeder Bekehrung verschloss.
Manchmal, in seinen einsamsten Gebeten, fragte er Gott, warum er ihn hier hatte versagen lassen. Die Antwort aber kam zuweilen aus einer anderen Quelle, die in den Gewölben tief unterhalb des Klosters atmete und ihre Verdorbenheit in seine Seele hauchte.
„Geh zurück zu den anderen. Betet weiter. Singt weiter. Die da draußen müssen euch hören können. Wenn das Tor fällt, müssen eure Körper der Widerstand sein, der die Ketzer aufhält.“
Der Mönch zögerte. Abt Wolfgang blickte ihm in die Augen. Sie waren weit aufgerissen in dem grauen Gesicht.
„Das Tor wird halten“, sagte der Abt und zwang sich zu einem Lächeln.
Der Mönch hastete wieder davon. Abt Wolfgangs Blicke wanderten zurück zu der einen Inschrift, die er bewusst hatte stehen lassen, als er den Befehl gegeben hatte, über all die anderen Putz und Farbe zu schmieren. Er hatte sich darauf vorbereitet, gegen Laxheit, Irrlehre und Orientierungslosigkeit zu kämpfen; er hatte sich – wie immer – darauf eingestellt, seinen kleinen Kreuzzug gegen das Nachlassen des Glaubens an dem Ort zu führen, für den er verantwortlich war. Niemand hatte ihm gesagt, dass er in Wahrheit gegen ein Ding anzugehen hatte, das in mehrfachen Truhen verschlossen und mit Ketten gesichert in einem Verlies in den Gewölben unterhalb des Klosters lag, ein Ding, von dem manche behaupteten, sie könnten sein Vibrieren spüren und sein Flüstern hören. Ein Ding, das sich ihm nicht offenbarte, weil er sich weigerte, an die Geschichte seiner Schöpfung zu glauben, und das dennoch manchmal auch in seinen Ohren zu flüstern schien, wenn sein Hass auf die Widerstände, die sich ihm hier entgegenstemmten, so groß wurde, dass er daran zu ersticken glaubte.
Abt Martin, der die Monate vor seinem Tod in dieser Zelle verbracht hatte, ein freiwilliger Gefangener seines Wahns, musste vor Angst gelähmt gewesen sein. Abt Wolfgang wusste nicht, was mit Martins katholischem Glauben oder seinem Vertrauen auf die Regeln des heiligen Benedikt geschehen war, aber er nahm an, dass jemand, der in seinem Glauben fest war, keinen Bannspruch benötigt hätte, um die Furcht von sich fernzuhalten. Martin hatte den Bannspruch wieder und wieder in die Wand seiner Zelle geritzt, große Buchstaben, kleine Buchstaben, leserlich wie eine Grabinschrift und unleserlich wie ein Sgraffito. Immer und immer wieder derselbe Spruch, bis die Wände von ihm bedeckt waren und der Putz an manchen Stellen bereits abplatzte. Als er zum ersten Mal hier hereingesehen hatte, hatte Wolfgangs Fleisch sich zu kräuseln begonnen vor Entsetzen. Dass ihm keiner seiner Mönche gefolgt war, wunderte ihn nicht. Wolfgang hatte einen der Sprüche übrig gelassen, direkt in Augenhöhe. Mittlerweile bereute er es; es kam ihm nun vor, als habe er dadurch eine kleine Öffnung geschaffen, durch die das Gift des verfluchten Schatzes in den Klostergewölben in seine Zelle eindringen konnte.
Über dem Pulsieren der Brandung auf Iona hatte er, wenn er sich angestrengt hatte, einzelne Geräusche ausmachen können: Möwengekreisch, das Bellen von Seehunden … Hier konnte man, wenn man wollte, ebenfalls Obertöne vernehmen, nicht viel anders als das schrille Kreischen der weißen Vögel. Es waren Schmähungen und Verwünschungen. Sein Name, Abt Wolfgangs Name, kam darin vor. Er hörte die Beschimpfungen, und die Erinnerung an die ziehenden Wolken und die segelnden Möwen davor wurde faul.
Er starrte die Wand an. Seine Zähne mahlten aufeinander, dass sie ihm wehtaten. Auf Iona hatte er sich manchmal in den peitschenden Wind gestellt, die Arme ausgebreitet, in das beständige Brausen hineingebrüllt, die Augen geschlossen und den Regen im Gesicht, und in all seiner Kleinheit gegenüber den Elementen gespürt, dass Gott ihn dort hingestellt hatte, wo er gebraucht wurde, und ihn mit seiner Kraft erfüllte. Das Brüllen war in Wahrheit ein Psalm gewesen. Hier hatte er mehr und mehr das Gefühl, die Kiefer verschließen zu müssen, weil sonst ein Gebrüll herausgekommen wäre, das von Hass erfüllt war und nicht von der Erkenntnis der göttlichen Macht. In seinen schlimmsten Momenten war er sicher, dass er etwas in seiner Seele pochen und flüstern hörte, das nichts Menschliches an sich hatte. Die Inschrift auf der Wand schien zu atmen.
Vade retro, satanas.
Es hatte ihm den Atem genommen, alle Zellenwände damit bedeckt zu sehen. Ein einziger Aufschrei, tausendmal wiederholt. Jesus Christus hatte ihn voll Zuversicht ausgesprochen. Hier kreischte die Verzweiflung aus jedem einzelnen Buchstaben. Abt Wolfgang hatte eine Woche in diesem stumm hallenden Gefängnis verbracht und sich mehr und mehr wie im Innern von Abt Martins Schädel gefühlt. Dann hatte er es nicht mehr ausgehalten und den Cellerar damit beauftragt, einen Handwerker zu finden.
Vade retro, satanas.
Wie nahe war der Verderber an Abt Martin herangekommen?
Die Tür zu seiner Zelle flog auf und krachte an die Wand. Abt Martin fuhr herum. Der Bruder Torhüter stand da, schwer atmend und kalkweiß.
„Sie brechen das Tor auf!“, rief er.
Der Halbkreis aus betenden und singenden Mönchen, den Abt Wolfgang direkt hinter dem Tor hatte Aufstellung nehmen lassen, sah ausgedünnt aus und keineswegs wie eine Wand aus Leibern, fest im Glauben, die sich der Ketzerhorde entgegenstellen würde. Ihre Psalmen hörten sich dünn an über dem Dröhnen, das die in ihren Aufhängungen schwingenden Torflügel verursachten. Die Meute schien sich dagegenzustemmen. Sie hatte keine Rammen zum Einsatz gebracht, sie wogte einfach nur dagegen. Wolfgang sah den trockenen Putz von den Stellen rieseln, an denen die Eisenbänder der Torscharniere vermauert waren. Die Torflügel schienen zu atmen, und für einen Augenblick nahm das grau gebleichte Holz die Farbe der See an, die in einem heftigen Sturm vor- und zurückwogte, der Frühlingshimmel über Iona dunkelblau, dramatisch, zerfurcht von Wolkenfetzen, die darüberjagten. Der Himmel über Braunau sah unschuldig aus, ein warmer, böhmischer Apriltag mit langsam dahinsegelnden Wolkenkissen, musikalisch untermalt von wüstem Geschrei jenseits des Tores.
„Katholische Heidenschweine!“
„Wolfgang Selender – verrecke!“
„Sankt Wenzel, erschlag sie alle!“
Abt Wolfgang spürte die Blicke der Brüder auf sich. In einem Aufwallen unsäglichen Zorns bereute er, die Urkunde nicht vor aller Augen zerrissen zu haben, die sie ihm damals, im dritten Jahr seiner Amtszeit, erstmals unter die Nase gehalten hatten. Abt Martins krakelige Handschrift und Signatur waren darauf zu sehen gewesen, unter einem länglichen, von unterdrücktem Triumph triefenden Abschnitt, in dem der Bau einer protestantischen Kirche innerhalb der Stadtmauern gefordert wurde. Als wollten sie der Frechheit noch den Hohn aufsetzen, hatten sie ihren beabsichtigten Heidentempel dem böhmischen Patron Sankt Wenzel gewidmet. Martin hatte damals „… auf dem Markt der Stadt …“ durchgestrichen und durch „… direkt beim Niedertor …“ ersetzt; in seinem Wahn, den Bau überhaupt zu erwägen, war er dennoch klarsichtig genug gewesen, ihn nur am entgegengesetzten Ende der Stadt zu sanktionieren. Martin hatte die Urkunde niemals gesiegelt – der Tod war ihm zuvorgekommen. Ohne Siegel des Klosters aber war die Erlaubnis nichtig. Wolfgang hatte den Vorgang niemals nachgeholt. Über Jahre hinweg hatten die Ketzer jeweils am Todestag ihres verfluchten Doktor Luthers vorgesprochen und das Siegel verlangt. Wolfgang hatte es jedes Mal verweigert.
Unter einem neuerlichen Ansturm gab das Tor fast nach, die Mönche wichen zurück, ihr Gesang geriet ins Stottern. Wolfgang war überzeugt, dass diese Situation schon vor Jahren entstanden wäre, wenn er die Urkunde gesiegelt hätte – sie hätten ihn dann nicht mehr gebraucht, und Urkunde war Urkunde und gab ihnen alles Recht, selbst wenn der Kaiser eine Abordnung nach Braunau geschickt hätte, um die Plünderung des Klosters und den Tod einiger Mönche (darunter zufälligerweise des Abtes) zu untersuchen. Die Torflügel ratterten und wackelten, das gequälte Holz knarrte.
„Hängt die Brüder auf!“
Einer der Mönche in der Reihe machte kehrt und rannte winselnd davon, in den Hauptbau hinein. Das Singen verstummte völlig. Wolfgang ballte die Fäuste und sprang zu der Lücke hinüber, die durch die Flucht des einen Mönchs entstanden war. Er packte die Hände der Brüder links und rechts von sich und hielt sie fest.
„Sed et si ambulavero in valle mortis non timebo malum quoniam tu mecum es virga tua et baculus tuus ipsa consolabuntur me!”, brüllte er den Text aus dem dreiundzwanzigsten Psalm. „Und wenn ich auch wandere im finsteren Todestal …“
Ein paar Stimmen schlossen sich zögernd an.
„Pones coram me mensam ex adverso hostium meorum …”
Die Tore bebten. Die Stimmen wankten, aber sie verstummten nicht.
Das ist es, dachte Abt Wolfgang. Das ist die Kraft der katholischen Kirche. Das ist die Quintessenz des Glaubens.
Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde.
Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über.
„Wolfgang Selender, du wirst in der Hölle brennen!“
Er vermeinte, aufs Neue das drängende Flüstern zu hören über all dem Geschrei, aber die Strophen des Psalms ertränkten es.
Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immerdar.
Die Mönche fanden sich langsam zu einem geschlossenen Choral zusammen. Abt Wolfgang starrte den Torhüter an, der wie vom Donner gerührt angesichts der Bedrohung dagestanden hatte, und dieser ergriff wie in Trance die Hand des nächststehenden Bruders und fiel in den Gesang mit ein. Immer mehr Mönche nahmen sich an den Händen. Der Cellerar, der Novizenmeister, der Prior … Es konnte kaum mehr einen Bruder geben, der sich nicht dem lebenden Wall hinter dem Tor angeschlossen hatte. In all seiner Wut fühlte Wolfgang eine beinahe heilige Zuversicht sich in ihm ausbreiten. So war es auf Iona gewesen, als im Herbst plötzlich die Sturmflut gekommen war und die fünf ältesten Brüder im Dormitorium ertrunken wären, wenn nicht alle anderen eine Menschenkette gebildet und sie in das Obergeschoss des Turms gezerrt hätten, die Gefahr für das eigene Leben nicht achtend.
„Ein Psalm Davids!“, brüllte Wolfgang, und die Brüder wiederholten den Psalm von vorne.
Das war der Glanz der katholischen Kirche, das war der Triumph des christlichen Glaubens – zusammenzustehen gegen jede Bedrohung von außen, auch wenn es einem das Märtyrertum abverlangte.
„Gib uns, was uns zusteht!“
„Verschwindet aus der Stadt, ihr Papsthuren!“
Eines der Torscharniere sprang plötzlich aus seiner Verankerung, Putzbrocken und Steine stoben davon. Der Torflügel wölbte sich. Der Torhüter verschluckte sich vor Angst.
Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern.
Er erquickt meine Seele; er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
Die Torflügel kamen zur Ruhe. Das Geschrei draußen verstummte plötzlich. In die Stille hallte der Choral wie die Stimmen der Engel selbst und echote von der klippenhohen Wand des Klosterbaus wider. Abt Wolfgang sang weiter. Die Stimmen folgten ihm, bis der Psalm ein zweites Mal zum Ende gekommen war. Dann senkte sich Schweigen über den Klostervorhof. Ein letzter Putzbrocken löste sich von dem aus der Mauer geplatzten Eisenband und fiel zu Boden. Die Mönche wechselten unsichere Blicke. Abt Wolfgang schritt auf fühllosen Beinen zum Tor. Er packte den Riegel mit beiden Händen. Der Torhüter gab ein Geräusch von sich. Wolfgang hob den Riegel aus der Verankerung und ließ ihn dröhnend auf den Boden fallen; die Mönche zuckten zusammen. Mit der Faust stieß er die Türflügel auf. Sie schwangen nach außen. In der Gasse, die zum Stadtplatz führte, lagen zertretenes Gemüse und Steine; die Wurfgeschosse waren niemals zum Einsatz gekommen. Die Gasse war leer, die Gassenmündung zum Marktplatz lag hell und sonnig da.
Wolfgang drehte sich um. Er empfand es als eine der schwierigsten Aufgaben seines ganzen Lebens, in dieser Situation nicht in Triumphgeheul auszubrechen.
„Amen“, sagte er ruhig.
Die Brüder bekreuzigten sich. Die ersten begannen zu lächeln.
In Wolfgangs Ohren sang es.
Dann sah er den Mönch mit der schwarzen Kutte aus dem Eingang des Hauptbaus taumeln. Blut lief ihm über das Gesicht.