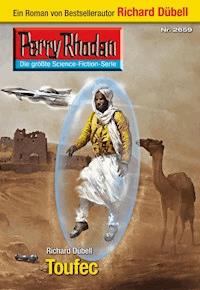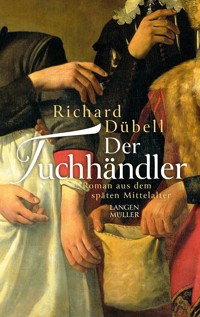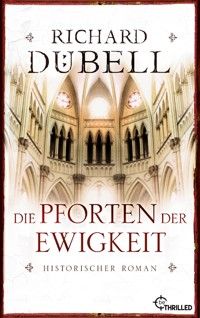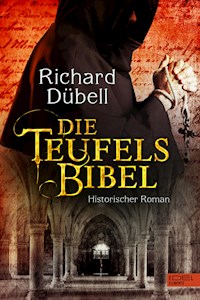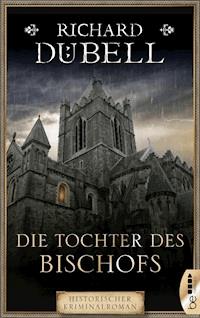9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1840: Der Jahrhundertsturm beginnt. Alvin von Briest ist ein echter Preuße. Er fühlt sich den alten Traditionen seines Heimatlandes verpflichtet, auch wenn es ihm nicht immer leicht fällt. Auf Rat seines Freundes Otto von Bismarck entscheidet er sich sogar für eine Militärlaufbahn. Ganz anders sein Freund Paul Baermann. Paul stammt aus dem Münchner Bürgertum und ist ein Mann des Fortschritts. Seine einzige Liebe gilt der Eisenbahn. Bis er in Paris Louise Ferrand kennenlernt, die ihn mit ihrer Schönheit verzaubert. Doch Louise ist schon einem anderen versprochen - seinem besten Freund. Sie heiratet Alvin von Briest, der sie vor Hunger und Tod gerettet hat. Ihr Herz aber gehört Paul. Während in Berlin Barrikaden gebaut werden, die Industrialisierung ihren Lauf nimmt und sich Deutschland schließlich unter Bismarck eint, müssen Alvin, Paul und Louise in einem Jahrhundert der Gegensätze ihren Weg finden. Berlin, Paris, München: die große historische Saga zur Bismarckzeit!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Das Buch
Gut Briest, Preußen: Am Sterbebett seines Vaters erfährt der junge Adlige Alvin von Briest, dass er vom Erbe ausgeschlossen ist. Ein Offizier aus der Nachbarschaft kennt das Schicksal des Zweitgeborenen und zeigt Verständnis: Otto von Bismarck rät Alvin, eine Militärlaufbahn einzuschlagen.
Paris: Louise Ferrand hat alles verloren. Ihren Vater, ihren Status und ihre Ehre. Einen Ausweg aus ihrer schwierigen Lage bietet ihr ausgerechnet ein junger preußischer Offizier: Die schöne Französin heiratet Alvin von Briest.
München: Paul Baermann ist ein Mann der Moderne. Seine einzige Liebe gilt der Eisenbahn und allem, was damit zu tun hat. Bis er die Frau seines besten Freundes kennenlernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt: Louise Ferrand.
Berlin: Lily Baermann hasst ihren Bruder Paul bis aufs Blut. Weil er ihre Mitgift aufs Spiel gesetzt hat, droht ihr ein Leben in Armut. Das Revoltionschaos in Berlin und Pauls Liebe zu einer verheirateten Frau bieten ihr endlich eine Gelegenheit, sich an ihm zu rächen.
Vier Menschen, die das Schicksal zusammengeführt hat, suchen in Zeiten des Umbruchs nach ihrer Bestimmung. Dabei kreuzen sie immer wieder den Weg eines Mannes, der Europa verändern wird: Otto von Bismarck.
Der Autor
Richard Dübell, geboren 1962, lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen bei Landshut. Als Autor von historischen Romanen stürmt er seit Jahren die Bestsellerlisten und legt nun mit Der Jahrhundertsturm ein großes Epos zur deutschen Geschichte im neunzehnten Jahrhundert vor. Homepage des Autors: www.duebell.de
Von Richard Dübell sind in unserem Hause bereits erschienen:
Allerheiligen ∙ Himmelfahrt
Richard Dübell
Der Jahrhundertsturm
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage Februar 2015
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Titelabbildung: © getty images/Thorsten Muehlbacher (Zug);
© FinePic®, München (Hintergrund)
Gestaltung des Vor- und Nachsatzes: Angelika Solibieda, cartomedia, Karlsruhe
ISBN 978-3-8437-1093-0
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Für all diejenigen von uns, die an unserer Zukunft bauen, ohne zu vergessen, wo unsere Herkunft liegt: in den Dingen, an die wir glauben.
Januar bis März 1840
»Nutzen Sie die Möglichkeit.«
Otto von Bismarck
1
Der alte Levin von Briest lag im Sterben.
Wie es Sitte war, hatte er die Familie um sich versammelt. Die allernächste Familie bestand aus seinen beiden Söhnen Levin, der nun bald nicht mehr »der Jüngere« gerufen werden würde, und Alvin. Die beiden jungen Männer – Levin war zweiundzwanzig Jahre alt, Alvin neunzehn – standen links und rechts des großen Betts, in dem ihr Vater lag, der inzwischen nicht mehr war als ein gelbes Gesicht und zwei schlaffe Hände inmitten von Bergen blütenweißer Laken. Es hatte noch zwei Schwestern gegeben, eine älter als Alvin, eine jünger. Alvin hatte kaum Erinnerungen an die Ältere. Wenn er an seine jüngere Schwester dachte, sah er ein rundes Gesichtchen mit großen Augen. Noch heute hatte er ihr helles Lachen im Ohr, wenn sie gekitzelt worden war. Er erinnerte sich an den ungläubigen, fassungslosen Schmerz eines Achtjährigen, der seine nur zwei Jahre alt gewordene kleine Schwester im Sarg liegen sehen musste. Mehr Kinder hatte es nicht gegeben. Alvins und Levins Mutter war bald nach dem Tod ihres jüngsten Kinds verstorben, und der Vater hatte nicht wieder geheiratet.
Die anderen Familienmitglieder standen an den Wänden des Schlafzimmers aufgereiht, in respektvollem Abstand zum Sterbebett. Der alte Briest hatte noch eine Schwester, die von ihrem Gut in Pommern angereist war und gleich bei ihrer Ankunft jedem erklärt hatte, dass sie nur aus Schwesterliebe gekommen war und nicht in der Hoffnung, auch etwas zu erben. Alvin hatte seiner Tante in die Augen geschaut und die Lüge darin gesehen. Durch die Familie von Briest lief eine geizige, gierige Ader, die auch der alte Levin besessen und die er an seinen älteren Sohn weitergegeben hatte. Weitere nahe Verwandte hatte Levin von Briest nicht. So wie das neidische Erbgut zog sich auch eine Tradition von Kinderlosigkeit und früher Sterblichkeit durch die Sippe.
Alvin und sein Bruder Levin hatten es immer wieder von ihrem Vater gepredigt bekommen: Die Vaterschaft war das Werkzeug des Mannes, um seine Lebenskraft und seine Ehre weiterzugeben. Vaterschaft war Männlichkeit! Doch wenn es danach gegangen wäre, besaßen die Pächter auf ihren Höfen und die Fabrikarbeiter in den Städten mit ihren acht, zehn, zwölf Kindern mehr Männlichkeit als der Junker, Gutsherr und Spross einer alten Dynastie Levin von Briest. Alvin wusste, dass der Vater darunter gelitten und seiner Frau insgeheim die Schuld gegeben hatte.
Zum erweiterten Familienkreis gehörten auch der Gutsverwalter, der Schultheiß des Bauerndorfs auf dem Grund von Gut Briest, der dortige Pfarrer, der Schulmeister, Levin von Briests Forstaufseher und der Aufseher über seinen Stall sowie Levins steinalter Kammerbursche, der so senil war, dass der Gutsherr, bevor er erkrankt war, den Alten angezogen hatte statt umgekehrt. Die dritte Eigenheit der Briests war von jeher eine freundliche Geduld mit den Schwächen ihrer Mitmenschen. Diese Eigenschaft hatte der alte Levin seinem Sohn Alvin vererbt.
Vor der Schlafzimmertür drängelten sich die Dienstboten. Auch sie waren auf eine unklare Art und Weise Familienmitglieder. Alvins Mutter hatte sie heimlich gehasst und gefürchtet wegen ihrer intimen Nähe zu allen Familiengeheimnissen, hatte sie ständig verdächtigt, zu spionieren und zu klatschen – und hatte sie gleichzeitig als unentbehrlich in einem Haushalt betrachtet, der so groß war wie der von Gut Briest. Draußen vor dem Herrenhaus waren die Grundpächter versammelt und warteten darauf, dass Alvins großer Bruder auf die Treppe hinaustrat und den Tod des alten Herrn verkündete, woraufhin die Frauen weinen und die Männer, wenn Levin weiterhin erklärte, dass nun er der neue Herr sei, brummig rufen würden: »Vivat!«
Beim Tod der Mutter damals war der Auflauf bedeutend geringer gewesen, dachte Alvin ärgerlich.
Der alte Mann auf dem Bett atmete rasselnd und mit geschlossenen Augen. Alvin ahnte, dass sein Vater Kraft sammelte für seine letzten Worte. Als er zu sprechen begann, blieben seine Augen geschlossen. »Levin«, murmelte er. Er war kaum zu verstehen. Im Raum wurde es still.
»Ich bin hier, Herr Vater.«
»August?«
Der Gutsverwalter trat an Levins Seite. Er streifte Alvin mit einem schnellen Blick, in dem Alvin so etwas wie Verlegenheit zu entdecken meinte. Nur worüber? Weil der sterbende Gutsherr nun gleich festlegen würde, dass Levin den besseren Teil des Besitzes vererbt bekam und Alvin den schlechteren? Alvin erwartete nichts anderes. »Ich bin hier, gnädiger Herr.«
»Hat Er alles so aufgeschrieben, wie es Ihm gesagt wurde, August?«
»Jawohl, gnädiger Herr.«
»Lies Er es vor, August.«
Der Gutsverwalter räusperte sich. Ein weiterer verlegener Blick traf Alvin. Von diesem Augenblick an wusste Alvin, dass er sein ganzes Leben lang vergeblich um die Liebe seines Vaters gekämpft hatte.
2
Eine schmale Straße führte durch ein Tor zum Gutshaus. Das Tor bestand aus einem eisernen Gatter, das zwischen zwei runden Backsteintürmchen eingehängt war. Links und rechts der Türmchen gab es weder eine Mauer noch einen Zaun. Das Tor war ein Symbol, mehr nicht. Wer hindurchwollte, musste lediglich einen Riegel öffnen und die beiden Flügel des Gatters aufschieben. Dann brauchte man nur noch der grobgepflasterten Auffahrt zu folgen, bis man vor dem Hauptportal des Guts stand.
In zwei oder drei Monaten, wenn es taute, würde die Straße für eine Weile unbefahrbar sein: eine Schlammpiste, die von Pferdehufen zerwühlt und von Wagenrädern zerfurcht worden war. Im Sommer würde sie dann steinhart sein, und der beständige Wind würde den Sand von den Füßen der Reisenden wehen. Der Herbst würde dann wieder den Schlamm bringen. Jetzt, im Winter, genauer gesagt im Januar dieses neuen Jahres 1840, war die Erde so hart wie im Sommer.
Alvin von Briest stand allein in der Tordurchfahrt und schaute die Straße entlang. Das Land hier, westlich von Berlin, war so flach, dass Alvin immer das Gefühl gehabt hatte, heute schon sehen zu können, wer morgen ankommen würde.
Die testamentarischen Regelungen, die sein Vater getroffen hatte, hatte er allerdings nicht auf sich zukommen sehen.
Vom Gutshaus her hörte er Musik an sein Ohr dringen. Wahrscheinlich hatte der Schultheiß ein paar Wandermusikanten engagiert. Von denen gab es viele. Die Zeiten waren nicht besonders gut. Fünfundzwanzig Jahre war der Krieg gegen Napoleon schon her, und Preußen hatte sich immer noch nicht davon erholt. Die meisten Musikanten beherrschten ihre Instrumente nicht; sie waren nur eine Ausrede, damit sie nicht einfach nur betteln mussten. Diese hier konnten auch nicht damit umgehen. Selbst auf die Entfernung hörten sich die Lieder zu Ehren des verstorbenen Gutsbesitzers nach Katzenjammer an.
Alvins Vater hatte alles richtig gemacht in seinem Testament. Er hatte gehandelt wie ein preußischer Junker, dessen Aufgabe es war, das Land zusammenzuhalten, das Erbe nicht zu zersplittern. Er hatte gehandelt wie der unumschränkte Familienpatriarch, der er bis zu seinem letzten Atemzug gewesen war. Alvin wusste das. Er fühlte sich trotzdem bis tief in sein Innerstes verletzt.
Der alte Briest hatte alles seinem erstgeborenen Sohn Levin vermacht. Alles. Falls ihm bei der Abfassung seines Testaments überhaupt eingefallen war, dass er noch einen Sohn hatte, hatte er diese Erkenntnis erfolgreich verdrängt.
Levin war der alleinige Herr von Gut Eichenhain bei Guben in Pommern sowie der alleinige Herr von Gut Briest hier im Jerichower Kreis. Alvin war der Herr über – nichts. Noch nicht einmal sein eigenes Leben, wenn man es genau nahm, weil man Geld brauchte, um ein eigenes Leben zu führen, und Geld hatte er keins. Kein Geld – keine Chancen. Auch nicht für den Sohn eines der ältesten und vornehmsten Geschlechter Preußens. Das Jahr 1840 hatte eben erst angefangen, doch für Alvin von Briest war es schon zu Ende. Sein ganzes Leben war zu Ende, bevor es richtig angefangen hatte. Der Anblick der Straße, die sich wie ein schwarzer Strich durch die flache winterliche Heidelandschaft zog, verschwamm vor seinen Augen.
»So geht ein großes Leben zu Ende«, ertönte eine helle, kratzige Stimme hinter ihm.
Alvin drehte sich erschrocken um. Er hatte den hochgewachsenen blonden jungen Mann nicht herankommen hören und wischte sich über das Gesicht, damit der Neuankömmling seine Zornestränen nicht sah.
Der Mann lächelte verkniffen und streckte eine Hand aus. »Darf Ihnen mein Beileid ausdrücken, Herr von Briest.«
Als Alvin die dargebotene Hand schüttelte, schlug sein Gegenüber leicht die Hacken zusammen und verbeugte sich. »Bin Ihnen gegenüber im Vorteil, Herr von Briest. Bitte um Entschuldigung. Hätte mich Ihnen gleich vorstellen sollen. Bismarck. Otto von Bismarck, zu Ihren Diensten.«
Alvin schlug ebenfalls die Hacken zusammen und erwiderte die Verbeugung. Dann musterte er sein Gegenüber. Otto von Bismarck war einen halben Kopf größer als er, schlank und in einen langen Mantel gekleidet, der wie ein Offiziersmantel wirkte, aber keiner war. Sein Haar sträubte sich widerborstig. Er hatte es mit Pomade nach vorn gekämmt, um den Umstand zu kaschieren, dass es über der Stirn bereits dünner wurde. Unter dem blonden Schopf gaben zwei große eisblaue Augen Alvins Musterung zurück. Otto von Bismarck war ein gutaussehender Mann, und seine offensichtliche Eitelkeit bewies, dass er es wusste.
»Wollten Sie zu meinem Vater?«, fragte Alvin. »Es tut mir leid, aber …« Er machte eine hilflose Handbewegung in Richtung der misstönenden Musik.
Bismarck schüttelte den Kopf. »Wollte nur allgemein meine … hmm … Aufwartung machen. Bin seit Jahren nicht mehr hier gewesen und besuche derzeit meinen … meinen … äh … ja, meinen alten Herrn auf Schönhausen. Gut Schönhausen, ja?« Er deutete vage in nördliche Richtung. »Bin dort geboren, müssen Sie wissen. Sind übrigens verwandt, Ihre Familie und ich. Über … hmmm … über tausend Ecken.«
Alvin kannte Schönhausen, und auch der Name seines Gesprächspartners war ihm nicht unbekannt. Nach dem, was er eben erfahren hatte, musste der alte Rittmeister Karl Ferdinand von Bismarck, der Gutsherr auf Schönhausen, Ottos Vater sein. Den jungen Mann kannte Alvin nicht, aber das bedeutete nichts. Schönhausen war lange Zeit von einem Verwalter bewirtschaftet worden, weil die Bismarcks auf einem ihrer Güter in Pommern gelebt hatten. Der alte Rittmeister war erst voriges Jahr wieder auf Schönhausen heimisch geworden. Da war Otto wahrscheinlich irgendwo studieren gewesen – oder hatte die Welt bereist, wie es die Söhne aus den Junkersfamilien zu tun pflegten, bevor sie sich niederließen.
Die Söhne, deren Väter sie dafür mit dem nötigen Geld ausstatten und nicht als billige Arbeitskraft bei sich zu Hause missbrauchen, dachte Alvin bitter.
Etwas spät fiel ihm ein, dass es letztes Jahr auch auf Schönhausen einen Trauerfall gegeben hatte. »Verzeihen Sie meine Unhöflichkeit«, sagte er unsicher, »doch ich habe gehört, dass es voriges Jahr einen Todesfall in Ihrer Familie gegeben hat? Oder irre ich mich? Mein Beileid.«
»Meine Mutter«, sagte Bismarck und zuckte mit den Schultern. Zu Alvins maßloser Überraschung fügte er hinzu: »Hat mich nie gemocht.«
Alvins Überraschung wurde noch größer, als er sich selbst sagen hörte: »Mein Vater mich auch nicht.«
Bismarck grinste plötzlich. »Lassen Sie mich … hmm … raten. Äh … das Testament Ihres alten Herrn ist etwas … äh … einseitig ausgefallen?«
Bismarck besaß eine anstrengende Sprechweise, fand Alvin. Er redete leise und stockend und nahm sich Zeit, nach einem Wort zu suchen, anstatt den Fluss seiner Rede am Laufen zu halten. Dennoch fühlte Alvin Sympathie für seinen Gesprächspartner.
»Sehr einseitig«, erwiderte er.
»Älterer Bruder hat geerbt, oder?«
»Alles«, sagte Alvin. »Ratzeputz alles. Den gesamten Landbesitz. Wenn ich hierbleiben will, muss ich meinen Bruder um eine Anstellung bitten – und wenn ich mir selbst etwas aufbauen möchte, um Geld.« Er fragte sich, wieso es ihm nichts ausmachte, diesem Fremden, den er eben erst kennengelernt hatte, derart sein Herz auszuschütten. Otto von Bismarck schien etwas auszustrahlen, das einen für ihn einnahm, ob man ihn kannte oder nicht.
Bismarck zögerte. »Im Vertrauen«, sagte er dann. »Bevor mein Vater seinen Besitz zwischen meinem Bruder und mir geteilt hat, ging es mir wie Ihnen. Keine … hmm … ausreichenden Mittel, wenn Sie verstehen.«
»Wir haben zwei Güter. Mein Vater hätte sie auch teilen können. Aber er gehörte zu dem Schlag Männer, für den die Teilung des Landbesitzes die Schwächung des Staats bedeutet.«
»Hatte nicht so unrecht, Ihr alter Herr, wenn man es bedenkt. Unser Stand hat Opfer zu bringen für den Staat.«
Alvin ignorierte den Einwand. »Ich hoffte, dass er es trotzdem tun würde. Briest oder Eichenhain – mir wäre es egal gewesen. Ich liebe beide Güter. Stattdessen hat er mir außer einer kleinen Apanage, mit der ich mir keinen eigenen Besitz aufbauen kann, nichts hinterlassen.«
»Eine Apanage? Kaufen Sie sich ein Offizierspatent dafür und gehen Sie zum Heer«, sagte Bismarck. Er straffte sich. »Gedient zu haben gereicht einem Mann zur Ehre und gibt ihm einen … hmm … Platz in der Welt.«
»Wo haben Sie gedient?«
Bismarck lächelte stolz. »Jägerbataillon Nummer zwei in Greifswald. Habe mich trotz alter Verletzung freiwillig gemeldet.« Er rieb sich wie unbewusst über den Arm. »Bin vor gut neun Monaten ausgeschieden.« Bismarck wirkte plötzlich unkonzentriert. Er kniff die Augen zusammen und schaute über Alvins Schulter. »Irgendwer kommt«, brummte er. »Hat es mächtig eilig.«
Der Neuankömmling war ein Reiter. Alvin kannte ihn. Er war einer der Gemeindeschreiber aus der kleinen Stadt Jerichow, zwei Stunden Fußmarsch von Gut Briest entfernt. Er hing auf dem Pferd wie ein Mehlsack. Als er heran war, zügelte er seinen Gaul mit Mühe. Das Gesicht des Mannes war rot vor Anstrengung. Er hatte nicht einmal einen Mantel über seine Jacke gezogen, aber er schien die Kälte gar nicht zu spüren. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis er etwas herausbekam.
»Aufstand!«, stieß er dann keuchend hervor. »Aufstand in Jerichow! Der Bürgermeister und seine ganze Familie sind schon erschlagen!«
3
Eine halbe Stunde später befand sich eine Gruppe berittener Junker, zu denen auch Alvin gehörte, auf dem Weg nach Jerichow. Alvins Bruder Levin hatte seine erste Amtshandlung als Gutsherr vollzogen und seinen jüngeren Bruder bewaffnet in die Stadt geschickt, um dort nach dem Rechten zu sehen und eine der Aufgaben des Junkers – für Ordnung im Land zu sorgen – zu erfüllen. Alvin hatte sich gefügt, weniger aus Gehorsam denn aus Neugier über die Lage in Jerichow; und außerdem aus Sorge, was aus der Situation werden würde. Sie roch nach beginnender Revolution. Jerichow mochte unbedeutend und das Schicksal seines Bürgermeisters, wenn auch tragisch, so doch ebenfalls nicht weniger unbedeutend sein, was die Staatspolitik betraf. Aber Revolutionen, davon war Alvin überzeugt, entstanden immer im Kleinen; aus der einen alltäglichen Ungerechtigkeit zu viel, aus dem einen unmoralischen Übergriff, der nicht mehr hätte sein dürfen … aus der Tat eines aufrührerischen, mörderischen Bauernhaufens im flachen Jerichower Land, das die Welt ansonsten so wenig interessierte wie ein Furz im Herbststurm.
Als Alvin aufgebrochen war, hatten sich ihm mehrere Trauergäste angeschlossen. Levin hatte auch ihnen Waffen mitgegeben. Auf Gut Briest gab es so viele Jagdgewehre, dass man die Wälder Preußens damit hätte leerschießen können. Zu Alvins Überraschung war auch Otto von Bismarck mitgekommen. Er war so groß, dass sein Pferd unter ihm aussah wie ein Pony, und er wirkte ungeschlacht auf dem Gaul, obwohl er kein schlechterer Reiter zu sein schien als alle anderen.
Bei einer Wegkreuzung kurz vor Jerichow stießen sie auf eine andere berittene Gruppe. Einer von Alvins Begleitern löste sich und ritt voraus, der zweiten Gruppe entgegen. Es waren Männer von seinem Gut, wie sich herausstellte: sein Verwalter, ein paar wohlhabendere Bauern, einige adlige Logiergäste. Der Gutsherr selbst und seine Frau waren bei der Trauerfeier auf Gut Briest gewesen. Die Gruppen schlossen sich zusammen, und Alvins Nachbar, nun mit einer eigenen Truppe ausgestattet, übernahm die Führung, die er bisher aus Höflichkeit Alvin als dem Stellvertreter seines Gastgebers überlassen hatte. Alvin sah keine Möglichkeit, dagegen anzugehen, und wusste auch nicht, ob er es wollte. Er blieb still und hörte mit mulmigem Gefühl den aufgebrachten Reden der mittlerweile gut zwanzigköpfigen, schwerbewaffneten Reitergruppe zu. Sie näherten sich der Stadt im lockeren Galopp. Es war noch früh am Nachmittag, aber die tiefhängenden Wolken ließen es abendlich wirken. Der Wind pfiff von Westen her. Ein feuchter Wind. Ein Tauwind. Ein Wind, der Veränderungen brachte.
Wie es schien, war die zweite Gruppe besser informiert, wie es überhaupt zu dem Aufruhr der Bauern gekommen war.
»Wollten in Geld bezahlt werden, die Kerls, statt in Lebensmitteln, Werkzeug und Schuhen!«, sagte jemand. »Kommt alles nur von den verdammten Sitten in den Städten. Die verderben die Leute.«
»Die Industrie versaut das Volk. Der Untergang jedes Staats. Für die zählt nur das Geld. Geld! Als ob man das fressen könnte! Als ob man aus einem Sack Geld auch nur eine Kartoffel ziehen könnte!«
»Wessen Gesocks ist das überhaupt? Von welchem Gut stammen die?«
Niemand schien es zu wissen. Die allgemeine Ansicht war, dass der Gutsherr, bei dem diese Aufrührer in Lohn und Brot gestanden hatten, nachlässig gewesen war. Er hätte die Hunde auf die Wortführer hetzen sollen, anstatt zuzulassen, dass sie in die Stadt zogen und dort Radau machten.
»Bei den Franzosen hatten sie einen Aufstand! Barrikaden! Soll in Rouen gewesen sein.« Der Sprecher betonte es falsch, wie »Ruhn«. Alvin verdrehte heimlich die Augen. »Wollten die Mittagspause verkürzen, die Herren Industrialisten. Doch den Arbeitern reichte dann die Zeit nicht, um nach Hause zu gehen und dort zu essen. Da haben sie Barrikaden errichtet. Verkommenes Pack! Und unsere dummen Pächter lassen sich von so was beeindrucken.«
»Das ist die Schuld der Sozialisten. Laufen überall rum und hetzen das Volk auf. Wenn ich einen auf meinem Grund erwische, lass ich ihn totprügeln!«
»Das ist die Schuld des Oktoberedikts«, hörte Alvin plötzlich die heisere, helle Stimme Otto von Bismarcks. Der junge Gutsherr, der einen Kopf über die Meute hinausragte, hatte bisher geschwiegen. Umso erstaunter war Alvin über die Heftigkeit in Bismarcks Worten. »Verdammte Reformerbande damals!«
Das Oktoberedikt war in der Zeit der französischen Besatzung entstanden, als König Friedrich Wilhelm III. wirtschaftliche Reformen zugelassen hatte, um den völligen Zusammenbruch des preußischen Staats abzuwenden. Die erste Reform war die Abschaffung der Leibeigenschaft des Bauernstands gewesen. Über Nacht hatten sich die Bauern von Gutsherrenuntertanen, die zur Zwangsarbeit verpflichtet, dem Richterspruch ihres Grundherren unterworfen und dessen Züchtigungen ausgesetzt waren, in freie Menschen verwandelt. Der Junkerstand hatte massiven Widerstand dagegen geleistet. Vergeblich.
Das war dreißig Jahre her – gute zehn Jahre vor Alvins Geburt. Er kannte es nicht anders, als dass die Bauern de jure freie Menschen waren. De facto zahlten manche von ihnen ihr Leben lang die Kredite ab, die ihre ehemaligen Grundherren ihnen gewährt hatten, damit sie Land erstehen konnten. Von Fronknechtschaft waren sie in die Schuldknechtschaft geraten. Der einzige Unterschied war, dass der Grundherr sie nicht mehr ungestraft züchtigen durfte. Nun, dann zahlte er eben die Strafe und züchtigte weiter. Alvin hatte das oft genug erlebt.
Der alte Levin von Briest war in dieser Hinsicht anders gewesen. Alvin hatte ihn nie die Peitsche gegenüber einem Bauern gebrauchen sehen. Bei den Krediten für den Landkauf hatte er die Pächter jedoch ebenso übers Ohr gehauen, wie es seine Standesgenossen getan hatten.
Alvin sah die ratlosen Gesichter. Der junge Bismarck hatte sich niemandem vorgestellt. Niemand konnte ihn zuordnen. Ein paar Männer, die von der Trauerfeier kamen und Bismarck anscheinend dort gesehen hatten, wandten sich an Alvin.
»Darf ich vorstellen: Otto von Bismarck, Gutsherr auf …«
»… Kniephof«, fiel ihm Bismarck ins Wort. »Der alte Herr sitzt auf Schönhausen. Bin zu … hmmm … Besuch hier. Ist mir eine Ehre, mit Ihnen ins Feld zu reiten, meine Herren.«
»Ins Feld?«, dehnte einer der älteren Männer irritiert.
»Übers Feld«, korrigierte sich Bismarck geschmeidig.
»Führen ja recht kesse Reden, Herr von Bismarck«, sagte der alte Herr. »Das Oktoberedikt wurde damals auf Wunsch unseres allergnädigsten Königs verfasst, um unter der Knute der verfluchten Franzmänner herauszukommen.«
»Herauszukriechen«, betonte Bismarck und hielt dem Blick seines Gesprächspartners kaltlächelnd stand.
Auf dem Platz vor dem Jerichower Rathaus drängten sich Männer, Frauen und Kinder. Fast alle waren zu Fuß, aber es standen auch drei Kutschen im Gedränge. Mit den Pferden war kein Durchkommen, daher überließen die Männer um Alvin und Bismarck die Zügel einigen Halbwüchsigen, die herbeieilten und die Hände für ein paar Münzen aufhielten. Alvins Nachbar übernahm auch hier wieder das Kommando und fragte lautstark nach der Gendarmerie. Alvin versuchte festzustellen, was los war, doch bis auf die Tatsache, dass die Menschenmenge respektvollen Abstand zum Rathaus hielt, konnte er nichts erkennen. Die Gaffer standen dicht an dicht. Er hätte sich durchdrängeln müssen, um nach vorn zu gelangen.
Der hochgewachsene Bismarck hatte kein Problem, was den Überblick betraf. »Die Rathaustür ist eingetreten«, sagte er. »Vor dem Rathaus liegt ein zerschmetterter Stuhl, bei zwei Fenstern im Erdgeschoss fehlt das Glas, und das ganze Pflaster ist voller Scherben.«
Jemand aus der Meute drehte sich zu ihnen um. »Die haben den Bürgermeister und alle Gemeindeschreiber umgebracht!«
»Den Bürgermeister und seine Familie«, berichtigte Alvin. »Einen der Gemeindeschreiber habe ich vorhin selbst noch gesehen. Er hat uns alarmiert.«
»Den Bürgermeister und alle Gemeindeschreiber«, wiederholte ihr Informant mit weit aufgerissenen Augen. »Das Blut steht knöchelhoch im Rathaus.«
Alvin wechselte einen Blick mit Bismarck. Der junge Gutsherr zuckte mit den Schultern. Ihr Informant verlor das Interesse an ihnen und wandte sich wieder ab.
Drei uniformierte Landgendarmen in grünen Jacken und mit ebenfalls grünen Tschakos auf den Köpfen näherten sich den Neuankömmlingen. Ihr Anführer war ein schwitzender Lieutenant.
»Haben Sie hier das Kommando?«, schnappte Alvins Nachbar.
Der Lieutenant salutierte, obwohl er keine Uniform vor sich hatte. Natürlich konnte ein Offizier in den zivilen Kleidern stecken. Und als Lieutenant musste man davon ausgehen, dass man in den allermeisten Fällen einen höheren Dienstgrad als den eigenen vor sich hatte.
»Aufrührer«, schnarrte er, »haben sich im Rathaus verschanzt!«
»Das weiß ich selbst. Wie konnte das geschehen?«
»Haben sich einfach hineinbegeben«, meldete der Polizeilieutenant.
»Warum hat sie niemand aufgehalten?«
»War mit meinen Männern nicht vor Ort!« Der Lieutenant versuchte angestrengt, den Eindruck zu vermitteln, dass er und seine beiden Schutzmänner die aufständischen Pächter mühelos niedergerungen hätten. »Haben Geiseln genommen und stellen Forderungen!« Nach einer kurzen Nachdenkpause fügte er hinzu: »Haben ein Blutbad angerichtet.«
Alvins Nachbar winkte ungeduldig ab. »Weiß ich alles. Wie viele Aufständische sind es?«
»Etwa ein Dutzend, schätze ich.«
»Etwa?«, wiederholte Bismarck. »Geht das auch genauer, Sie Genie?«
Der Lieutenant errötete und nahm Haltung an. »Sehr wohl!«, sagte er.
»Also?«
Der Lieutenant blinzelte verwirrt. »Also was?«, fragte er.
»Wie viele sind es?«
»Etwa ein Dutzend.«
»Ich wollte die genaue Zahl wissen!«, brüllte Bismarck.
Der Lieutenant konnte tatsächlich noch strammer stehen. »Sehr wohl!«, stieß er hervor. Alvin wurde klar, dass das »Sehr wohl!« nur das Äquivalent von »Ich weiß es nicht!« und »Ich kann nichts dafür!« war, mit einem starken Unterton von »Ich wünschte, ich hätte hier nicht das Kommando …«.
Alvin hörte Bismarck raunen: »Wer zu dumm für die Armee ist, wird Schutzmann.«
Dann hörte Alvin ihn fragen: »Zu wem gehören die Saukerle?«
Die Augen des Lieutenants rollten in Richtung einer nahe stehenden Kutsche. Alvins Nachbar ließ den Gendarmen stehen und stapfte hinüber. Ein Disput begann, von dem Alvin kein Wort verstand, weil er in wütendem Flüstern zum Fenster der Kutsche hinein geführt wurde, aber es war offensichtlich, dass Alvins Nachbar an das Verantwortungsgefühl des Gutsbesitzers appellierte, zu dessen Gut die Pächter gehörten. Es oblag ihm, mit den Männern zu sprechen und sie zum Aufgeben zu überreden. Ebenso offensichtlich hatte der Gutsbesitzer eine andere Auffassung von seinen Pflichten, weil er in der Kutsche sitzen blieb. Alvin fragte sich, wie schwer bewaffnet die aufständischen Pächter wohl sein mussten, dass niemand wagte, das Rathaus zu betreten. Nachdem er ein paar Augenblicke darüber nachgedacht hatte, stellte er dem Lieutenant diese Frage.
»Sind eben bewaffnet«, erklärte der Lieutenant, deutlich weniger unterwürfig als gegenüber dem stattlichen Bismarck.
»Ja, aber womit?« Aus dem Augenwinkel sah Alvin, dass Otto von Bismarck ihn aufmerksam musterte.
»Verstehen das ja doch nicht, der Herr«, knurrte der Lieutenant. »Keine Angelegenheit für Zivilisten.«
»Also mit Gewehren?«, fragte Alvin unbeeindruckt.
»Ja.«
Otto von Bismarck mischte sich ein und fragte: »Mit welchen?«
Der Lieutenant sah von einem zum anderen. Man konnte förmlich fühlen, dass er gegenüber den beiden jungen Männern aufbrausen wollte, aber ein längerer Blick in Bismarcks Gesicht schien ihn eines Besseren zu belehren. »Keine Ahnung«, sagte er zuletzt.
»Sie müssen doch Schüsse abgegeben haben. Wonach hat es sich angehört? Jagdgewehre? Schrotflinten? Großvaters alter Vorderlader?« Bismarck grinste herablassend.
»Habe keine Schüsse gehört«, sagte der Lieutenant widerstrebend. »Habe jetzt auch keine Zeit mehr. Guten Tag, die Herren.« Er stolzierte davon, seine beiden Untergebenen im Schlepptau. Dass er sich dabei gewaltig beeilte, raubte seinem Abgang etwas von der beabsichtigten Würde.
»Und so was trägt einen Uniformrock«, meinte Bismarck. »Armes Preußen.«
»Worauf warten die denn?«
»Darauf, dass richtige Uniformen eintreffen«, mutmaßte Bismarck. »Soldaten unter Führung eines Offiziers, der diese Ehre verdient.«
»Und dann?«, fragte Alvin.
»Dann«, sagte Bismarck, »werden so viele Schüsse zu hören sein, dass sogar dieser Hornochse von Lieutenant etwas hört.«
»Ich wette«, murmelte Alvin nach einer Pause, »dass die Aufständischen gar keine Waffen haben. Jedenfalls keine Schusswaffen.«
Bismarck erwiderte langsam: »Wollte eben das Gleiche sagen.«
»Wir müssen es ihnen mitteilen!« Alvin gestikulierte in Richtung der Kutsche.
Bismarck schüttelte den Kopf. »Nutzen Sie die Möglichkeit«, sagte er.
»Was meinen Sie?«
»Ihr Nachbar«, Bismarck deutete auf den Gutsherrn, der vor der Kutsche stand und hineingestikulierte, »hat auf dem Weg hierher das Kommando übernommen, ohne Sie zu fragen. Er hat Sie vor Ihren Gästen … hmmm … dumm dastehen lassen. Wenn Sie die Kerle im Rathaus nun ausräuchern, können Sie die Demütigung wettmachen und kommen besser weg als zuvor – weil Ihr Nachbar nämlich auch nur ein Quatschkopf ist, der andere für sich einspannen will, anstatt selbst etwas zu tun.«
»Ich soll die Kerle im Rathaus …?«
»Nicht Sie allein!«, versetzte Bismarck ungeduldig. »Nehmen Sie sich ein paar von den Gaffern und stürmen Sie das Rathaus. Sie sind ja überzeugt, dass die Aufständischen nicht schießen werden, nicht wahr?« Das Lächeln des jungen Gutsbesitzers war mitleidlos.
»Warum tun Sie es nicht?«, fragte Alvin, plötzlich wütend.
»Weil ich nichts dabei gewinnen kann. Sie aber schon.«
Alvin starrte Bismarck nachdenklich an. Ihm war, als habe sein Gesprächspartner in Alvins Hirn und Herz gesehen, die Gedanken und Gefühle dort gelesen, analysiert und ihm dann einen Rat gegeben, den Alvin sich selbst hätte geben können, wenn er nur den Wald vor lauter Bäumen gesehen hätte. Bismarck hatte ihm die Augen geöffnet.
Doch er hatte sie ihm mehr geöffnet, als er wahrscheinlich beabsichtigt hatte, stellte Alvin fest. Denn seine eigenen Gedanken bewegten sich noch einen Schritt über das hinaus, was Bismarck ihm geraten hatte. Er nickte dem jungen Gutsherrn zu und drängelte sich durch die Menge, bis er den freien Platz vor dem Rathaus erreichte. Jemand in der vordersten Reihe versuchte, ihn festzuhalten, als er in den freien Raum hinaustrat. Alvin machte sich los, ohne hinzuschauen. Er hatte den Weg zum Rathauseingang halb zurückgelegt, als er Bismarcks kratzige, helle Stimme hörte: »Was zum Henker haben Sie vor?«
»Da ich, wie Sie selbst erwähnt haben, überzeugt bin, dass die Aufständischen keine Schusswaffen haben, brauche ich sie nicht auszuräuchern und schon gar nicht mit einer halben Hundertschaft das Rathaus zu stürmen. Ich gehe jetzt hinein und rede mit ihnen.«
Mit Genugtuung erkannte er, dass Bismarck sprachlos war. Diejenigen in der Meute der Gaffer, die ihn verstanden hatten, waren weniger stumm.
»Sei’n Se nich dumm, junger Mann!«, rief eine ältere Frau in einfacher Kleidung. »Die ham schon den Bürgermeester und das halbe Rathaus abgemurkst.«
»Die machen dich auch kalt, Kleener«, brummte ein Bär von einem Mann. »Da helfen auch die schönen Klamotten nüscht, die du anhast.«
Alvin verdrehte die Augen, obwohl sein Herz heftig zu pochen begonnen hatte, seit er den Schutz der Menge verlassen hatte. Er wollte etwas Bedeutendes sagen, etwas, an dem die Meute noch kauen würde, wenn er das Rathaus längst betreten hatte, aber ihm fiel nichts ein. Er machte kehrt und rief in Richtung des Rathauses: »He! Ihr da drin! Ich komme rein! Ich bin allein! Ich will mit euch reden!« Seine Stimme hatte sich überschlagen, und er hatte alles in einem Atemzug hervorgestoßen, weil ihm sonst der Mut dazu ausgegangen wäre.
Er erhielt keine Antwort. Er räusperte sich. Von der Menge her kam halb höhnisches, halb mitleidiges Geraune. Vom Rand des Platzes hörte er die barsche Stimme des Lieutenants, der ihm zurief, er solle sich gefälligst nicht einmischen, und von dort, wo die Kutsche stand, die lautstarke Frage seines Nachbarn, was da vorn los sei.
Aus dem Rathaus kam noch immer keine Antwort. Mit den geborstenen Fensterscheiben im Erdgeschoss, dem zerbrochenen Stuhl auf dem Pflaster und den überall glitzernden Scherben wirkte es plötzlich bedrohlich. Rund um die beiden zerstörten Fenster prangten Löcher in der Rathauswand wie Pockennarben. Die spätnachmittägliche Kälte drang auf einmal durch Alvins Mantel und durch die Sohlen seiner Stiefel. Er schauderte und gab sich einen Ruck, um weiterzugehen. Seine Beine verweigerten ihm den Dienst. Unvermittelt war er überzeugt, dass er sich geirrt hatte, dass die Aufständischen doch Waffen besaßen, dass sie – was er bisher für eine maßlose Übertreibung gehalten hatte – ihre Geiseln im Rathaus tatsächlich alle ermordet hatten und dass hinter den Fensterläden hervor bereits Gewehrläufe auf ihn zielten. Was hatten die Pächter noch zu verlieren? Wenn sie ihn erschossen, konnte ihre Strafe doch nicht schlimmer werden. Alles, was sie tun konnten, war, ihre Haut teuer zu verkaufen und einem aus der verhassten Adelsschicht, der wie ein Narr in ihre Schusslinie tappte, ein Loch in den Schädel zu schießen.
Bismarck war plötzlich neben ihm. »Wenn Sie das tun wollen, was Sie vorhaben, tun Sie es gleich«, sagte er und deutete mit dem Daumen hinter sich. In der Menge war Bewegung entstanden, als ob ein paar Leute sich hindurchwühlten. »Ihr werter Nachbar mag es nicht, dass Sie die … hmmm … Initiative an sich gerissen haben. Und gleich wird er sie Ihnen wieder wegnehmen.«
»Und Sie?«
»Ich komme mit«, sagte Bismarck einfach.
»Ich dachte, für Sie gäbe es nichts zu gewinnen?«
Bismarck ballte die Hände zu Fäusten und lächelte. »Ich hatte vergessen, dass eine schöne Rauferei auch ein Gewinn sein kann.«
Alvins Nachbar arbeitete sich aus der Menge hervor. »Briest!«, rief er. »Was haben Sie vor? Bleiben Sie sofort stehen.«
Alvin und Bismarck sahen sich an. Dann gingen sie schweigend los und drangen in das dunkle, stille Rathaus ein.
4
Louise Ferrand saß auf ihrem Bett in ihrem Zimmer und hielt sich die Ohren zu. Es nützte nichts. Das Stöhnen aus dem Schlafzimmer ihrer Mutter war trotzdem zu hören.
Sie hatte schon versucht, den Kopf unter das Kissen zu stecken, aber außer dass sie fast erstickt wäre, hatte sich nichts geändert. Eigentlich sollte sie sich mittlerweile daran gewöhnt haben, sagte sie sich und seufzte im Stillen. Aber man gewöhnte sich nie an diesen unüberhörbaren Beweis von Peinlichkeit – wenn man Zeuge wurde, wie ein Elternteil wilde Leidenschaft erlebte.
Die Betonung lag auf ein Elternteil. Amélie Ferrand, Louises Mutter, war mit ihrem Liebhaber zugange. Louise wusste aus Erfahrung, dass es noch eine ganze Weile dauern würde, bis die beiden Liebenden im Nachbarzimmer endlich still wären – und bis dahin würde es noch jede Menge Stöhnen, lautes Schreien und das wuchtige Hämmern des Bettgestells gegen die Wand und gegen den Fußboden geben.
Meine Mutter ist eine Hure!, dachte Louise manchmal bei sich. Aber Amélie war keine Hure, ganz im Gegenteil. Sie war die Geliebte eines hochrangigen Beamten am Königshof in Paris; sie war ihm treu und liebte ihn mit der verzweifelten Anhänglichkeit einer Frau, die weiß, dass sie den Mann ihres Herzens nie besitzen kann und immer diejenige sein wird, die in einer einsamen Wohnung auf ihn warten muss.
Der siebzehnjährigen Louise war das Gefühlsleben ihrer Mutter nicht unbekannt. Außer ihrem Liebhaber hatte Amélie so gut wie niemanden, dem sie ihr Herz ausschütten konnte, und hatte deshalb ihre Tochter zu ihrer Vertrauten gemacht. Aus diesem Grund machte Louise sich auch keine Illusionen darüber, wie abhängig sie und ihre Mutter vom Wohlwollen des Mannes waren, dessen Stöhnen sie durch die dünne Wand hörte.
Louises Vater – Amélies Ehemann – war vor gut fünf Jahren verstorben. Um die Beerdigung bezahlen zu können, hatte Amélie alle ihre guten Kleider verkaufen müssen. Obwohl der Sarg in einem abseits gelegenen, ungepflegten Fleck des Friedhofs versenkt worden war und der Pfarrer sich nicht hatte blicken lassen, hatte er genauso viel Geld verlangt wie für ein Staatsbegräbnis. Tatsächlich hatte er dafür, dass Louises Vater überhaupt auf dem Friedhof hatte bestattet werden dürfen, deutlich mehr verlangt als für ein Staatsbegräbnis. Amélie hatte bezahlt. Die Alternative wäre gewesen, ihren toten Mann in die Seine zu rollen und vom Wasser davontragen zu lassen.
Der Auszug aus ihrem Haus war ein Jahr später erfolgt, als Amélie die Kredite nicht mehr hatte bedienen können, die sie aufgenommen hatte, um die Schulden ihres Mannes zu bezahlen. Amélie, deren Stolz zu diesem Zeitpunkt noch ungebrochen gewesen war, hatte alle eindeutigen Angebote des Bankverwalters ausgeschlagen, gegen zärtliche Dienstleistungen den Kredit zu günstigen Konditionen weiterlaufen zu lassen. Als sie und Louise inmitten ihrer restlichen Habseligkeiten auf der Straße gestanden und auf den Karren gewartet hatten, mit dem die gemieteten Lastträger die Truhen und wenigen Möbel zu ihrer neuen Bleibe bringen würden, war der Gemeindepfarrer erschienen. Louise, deren Naivität damals noch genauso groß gewesen war wie Amélies Stolz, hatte vor dem Pfarrer geknickst und erwartet, dass dieser ein paar tröstende Worte finden würde – oder einen Ausweg aus der Lage anbot, in die Mutter und Tochter Ferrand ohne eigenes Zutun geraten waren.
Der Pfarrer hatte sie jedoch keines Blickes gewürdigt, sondern war ins Haus gegangen und dort von Zimmer zu Zimmer gewandert, um es auszusegnen. Das Haus der Ferrands war das Haus eines Spielers und Selbstmörders; die Verdorbenheit musste hinausgesegnet werden, wie es die Christlichkeit gebot, bevor jemand anderer dort einzog. Er war wieder gegangen, ohne ein Wort mit Mutter und Tochter gewechselt zu haben. Louise hatte ihre Mutter trotz all der Widrigkeiten nicht oft weinen sehen seit jener Nacht, in der sie sie vor dem Arbeitszimmer ihres Vaters auf dem Boden sitzend gefunden hatte, tränenüberströmt und zitternd, ihr den Zugang zu dem Zimmer verwehrend, aus dem der schweflige Geruch von Schießpulver drang. Die wortlose Verachtung des Pfarrers ließ Amélie jedoch erneut Tränen in die Augen treten, und Louise, welche die Scham, Wut und Verzweiflung ihrer Mutter ebenso stark empfand, weinte mit.
Der Vater von Louise war vermögend gewesen. Er hatte sein Vermögen den Würfeln anvertraut. Die Würfel hatten ihn im Stich gelassen. Daraufhin hatte er versucht, in der Flasche einen Weg zu finden, die Würfel für sich zu gewinnen. Die Flasche hatte ihn auch im Stich gelassen. Am Ende hatte sich nur die Pistole in seinem Schreibtisch als zuverlässig erwiesen, als er sich den Lauf in den Mund steckte und abdrückte. Erst viel später hatte Louise von ihrer Mutter erfahren, dass diese den Abschiedsbrief nur zum Teil hatte lesen können, weil Louises Vater über dem Schreibtisch zusammengebrochen war und Blut die Nachricht fast unleserlich gemacht hatte. Es hatte keine Rolle gespielt. Amélie hatte auch so gewusst, was darin stand – eine lahme Entschuldigung für den Ruin, in den die Spiel- und Alkoholsucht des Vaters die Familie getrieben hatte, und eine noch lahmere Erklärung für die Feigheit, mit der er sich lieber eine Kugel durch den Kopf schoss, als sich der Katastrophe zu stellen.
Louise und ihre Mutter waren in einer kleinen Wohnung in einem Haus am Stadtrand untergekommen. Einige der Fenster hatten freien Blick auf die Seine. Aus den großen Fenstern ihres alten Hauses hatten sie ebenfalls auf die Seine blicken können. Es war derselbe Fluss, es war dasselbe Wasser. Aber Louise hatte gelernt, dass es am Ende nicht auf den Blick ankam, sondern auf das Viertel, in dem das Haus stand, das den Blick gewährte. Früher hatte sie aus ihrem Fenster Enten und Schwäne sehen können, die zwischen den herabhängenden Zweigen der Trauerweiden umherschwammen. Wenn sie in ihrer neuen Bleibe aus dem Fenster sah, erblickte sie Abfall und Gerümpel am Ufer, über das die Ratten huschten.
Das Viertel war kleinbürgerlich, seine Gassen rochen nach Küchendunst und – wenn der Kübelwagen des Exkrementesammlers hindurchzog – nach Latrine. Das Haus war bei weitem nicht so schlimm wie die Arbeiterquartiere, von denen man immer wieder in den Zeitungen las, meistens im Zusammenhang mit grässlichen Verbrechen oder einem Aufschrei der Empörung, dass menschliche Wesen derart vegetieren mussten. Die Wohnung hatte einem kleinen Buchhalter gehört. Louises Bett stand im Wohnzimmer, weil sie kein eigenes Zimmer hatte, die Küche war ein winziges dunkles Loch, in dem das Kochgeschirr, das Amélie hatte mitnehmen können, überall herumstand und -lag. Es gab keine Toilettenkabine – aber die Toilette auf dem Gang besaß immerhin eine Wasserspülung und nicht, wie in vielen anderen Mehrparteienhäusern, nur einen großen Tonkrug pro Etage, der alle paar Tage auf die Gosse geleert wurde. Für den Buchhalter musste die Wohnung sein privates Paradies gewesen sein. Für Louise, die zwölf Jahre ihres Lebens im Luxus gelebt hatte, war sie anfangs die Hölle gewesen; mittlerweile hatte sie sich daran gewöhnt.
Doch nicht einmal diese Bleibe hätten sie auf Dauer halten können, wäre nicht Alexandre DuPlessys auf der Bildfläche erschienen. Alexandre, der Beamte, der Teil einer Abordnung gewesen war, welche die Lebensumstände der Bevölkerung in Louises Viertel untersucht hatte und dem die schöne, sich mit verbissener Eleganz und Würde haltende Frau aufgefallen war, die mit ihrer Tochter allein lebte. Er hatte Amélie, deren Stolz nun nicht mehr die Kraft hatte wie zuvor und die von dem höflichen, raffiniert bekundeten Interesse des gutaussehenden Beamten überwältigt war, zu seiner Geliebten gemacht. Amélie war Ende dreißig, was man ihr nur im grellen Tageslicht ansah; Alexandre war Ende zwanzig und voller Energie. Amélie hatte sich Hals über Kopf in den Mann verliebt, der ihr anbot, sie und ihre Tochter auszuhalten.
Aus dem anderen Zimmer ertönten immer noch das rasante Hämmern des Bettgestells und das zweistimmige Rufen und Stöhnen. Louise hörte das langgezogene Ächzen Alexandres und das fieberhafte Keuchen ihrer Mutter. Das Hämmern verklang. Dann war es still drüben. Louise nahm die Hände von den Ohren und starrte an die Decke. Sie hörte Alexandres Stimme schläfrig etwas sagen. Er sprach lange, ohne dass Louise ein Wort verstanden hätte. Von ihrer Mutter wusste sie, dass Alexandre, wenn seine Lust gestillt war, oft zu erzählen begann – von seinen idiotischen Untergebenen, Gleichrangigen und Vorgesetzten, von den Pferden, die er auf seinem Landsitz züchtete, von dem Garten, den er dort hatte anlegen lassen, von der Gefühlskälte seiner Frau und von seinen Zukunftsplänen. Louise fühlte plötzlich Tränen in ihren Augen und hätte nicht genau sagen können, woher sie auf einmal gekommen waren; nur dass es ihr einen Stich gab, als sie sich bewusstmachte, was ihre Mutter bei solchen Gesprächen fühlen musste: Alexandre von der Zukunft reden zu hören und zu wissen, dass sie höchstens ein Teil davon war, aber sie nie mit ihm würde teilen können.
Aber war Amélie das wirklich bewusst? Alexandre war erst vorgestern hier gewesen. Danach hatte ihre Mutter Louise erzählt, dass er befördert worden sei; dass man ihm eine neue Verantwortung übertragen habe, die Planung einer Gesetzesvorlage für den Ausbau jener neuen Technik, die alle Welt so unendlich faszinierte – die Eisenbahn. Amélie hatte von Alexandres Begeisterung für das Projekt geredet und welche Karriere sich damit für ihn auftat. Sie hatte in der Wir-Form gesprochen – als ob sie vergessen hätte, dass Alexandres Frau an dessen Seite stehen würde, wenn er für seine Erfolge geehrt wurde, und nicht sie, Amélie Ferrand, die Mätresse …
Nach einiger Zeit wurde Louise bewusst, dass aus dem Schlafzimmer ihrer Mutter ein neues Geräusch kam. Es war ein Schluchzen.
5
Louise hielt den Atem an. Sie hörte Alexandre etwas sagen. Es klang, als wolle er ihre Mutter beruhigen. Das Schluchzen wurde lauter. »Bitte …«, konnte sie Amélie stammeln hören. »Bitte …« Und dann, viel lauter und voller Qual: »O Gott, Alexandre, das kannst du doch nicht tun!«
Louise sprang auf und stürzte, ohne nachzudenken, aus dem Wohnzimmer. Sie hatte schon die Hand nach der Klinke von Amélies Schlafzimmertür ausgestreckt, als sie plötzlich zögerte. Sie konnte doch nicht dort hineinplatzen! Der Gedanke, dass sie ihre Mutter und Alexandre nackt im Bett überraschen würde, erfüllte sie auf einmal mit Grausen. Dann wurde die Tür von innen geöffnet, und Alexandre DuPlessys stand vor ihr – in engen karierten Hosen, die mit einem Steg an seinen spitzen Schuhen befestigt waren, und einem weiten Hemd, das unordentlich über den Hosenbund hing. Die Schlaufen der Hosenträger baumelten links und rechts an seinen Hüften, über dem Arm trug er seine Weste und einen dicken Wollmantel. Er hatte seinen schmalen Zylinder aufgesetzt und sah damit vollkommen lächerlich aus. Er stutzte und starrte Louise überrascht an. Auf dem zerwühlten Bett kauerte Amélie, ohne ihre Nacktheit zu bedecken, und schluchzte in die vors Gesicht geschlagenen Hände. Neben ihr auf dem Bett lag ein dicker Umschlag aus gelblichem Papier.
»Oh«, sagte Alexandre und wusste offensichtlich nicht, wie er sich verhalten sollte. Selbstverständlich kannte er Louise, aber nach den ersten verkrampften Begegnungen, wenn sie ihm die Tür geöffnet oder ihm bei seiner Ankunft über den Weg gelaufen war, hatte sie es vorgezogen, ihm so wenig wie möglich zu begegnen, wenn er ihre Mutter besuchte.
»Oh«, sagte Alexandre nochmals, und dann, der Gipfel der Unbeholfenheit: »Du bist groß geworden.«
»Maman?«, fragte Louise. »Geht’s dir gut? Was ist los?«
Noch etwas wurde Louise klar. Sie wurde Zeugin einer Abschiedsszene. Alexandre DuPlessys hatte noch einmal sein Vergnügen mit ihrer Mutter gehabt und ihr dann eröffnet, dass er sie verlassen werde.
»Verschwinde, Louise!«, schluchzte Amélie. Sie hob ihr tränenüberströmtes Gesicht. »Was tust du überhaupt hier, zum Teufel?«
»Ich hab dich weinen gehört …«
»Es ist nichts …«, sagte Alexandre in einer weiteren Zurschaustellung männlicher Idiotie.
»Meine Mutter weint!«, rief Louise viel heftiger, als sie beabsichtigt hatte.
Amélie streckte die Hand in Richtung Alexandre aus. »Bitte!«, stieß sie hervor und begann aufs Neue zu weinen, »bitte, Alexandre! Du brichst mir das Herz.«
In Alexandre DuPlessys’ Gesicht zuckten ein paar Muskeln. Er schloss kurz die Augen. »Es geht nicht anders«, erwiderte er heiser und ohne sich umzudrehen.
»Bin ich dir zu alt geworden?«, fragte Amélie hilflos. »Ich weiß, ich habe nachgelassen … ich werde weniger essen …« Zu Louises Horror rappelte ihre Mutter sich auf und stand splitternackt im Raum; sie holte aus und drosch sich mit der flachen Hand auf die Oberschenkel, gegen die Hüften, auf ihren Po. Es klatschte laut. Striemen zeichneten sich auf ihrer Haut ab. Amélie schien es nicht zu spüren. »Hier … und hier … das kriege ich weg … ich esse einfach weniger … dann werde ich wieder straffer … ich esse gar nichts mehr … Du magst es doch, wenn meine Haut straff und glatt ist … ich werde mich mit Sand abreiben …« Amélie stotterte unzusammenhängend. Ihre Augen waren zwei Löcher mit verschmierten Rändern in ihrem Gesicht, über das die Tränen verwaschene Kajalstreifen gezogen hatten.
Louise fühlte eine derart lähmende Mischung aus Abscheu, Mitleid und Scham, dass sie sich nicht vom Fleck rühren konnte und kein Wort hervorbrachte.
Alexandre sagte, immer noch ohne Amélie anzusehen: »Das ist es nicht, Amélie, und das weißt du.«
Amélies Blick fiel auf Louise. Louise erschauerte, als sie die nackte, irre Not in den Augen ihrer Mutter sah. Als sie hörte, was ihre Mutter sagte, brach ihr am ganzen Körper Gänsehaut aus.
»Louise ist jung«, flüsterte Amélie. »Sie kann dich glücklich machen. Wenn du nur bleibst … und mich ab und zu ansiehst … mehr will ich gar nicht … nimm Louise, aber verlass mich nicht, Alexandre. Nimm Louise …« Sie stieß die Worte so schnell hervor, dass sie beinahe übereinanderpurzelten.
Louise starrte in Alexandres Augen. Ihr wurde noch kälter, als sie die Gefühle erkannte, die sich in seinem Gesicht spiegelten: Überraschung, Fassungslosigkeit, Abscheu … aber auch, für einen winzigen Augenblick – Lust. Sie merkte erst, dass sie zurückgewichen war, als sie mit dem Rücken an die Wand gegenüber prallte. Ihr Mund arbeitete, aber kein Wort kam heraus.
»Großer Gott, Amélie!«, stieß Alexandre hervor. Er hatte sich nun doch zu Louises Mutter umgedreht. »Das ist erbärmlich. Ich hätte lieber eine andere Erinnerung an dich gehabt als das.« Er wies auf das Bett, auf dem der Umschlag lag. »Das bringt euch die nächsten sechs Monate durch. Bis dahin wirst du eine Lösung gefunden haben. Leb wohl, Amélie.« Er bückte sich unter der Tür durch und nickte Louise zu, die voller Panik mit dem Rücken an der Wand entlangglitt, um Distanz zwischen ihn und sich zu bringen.
»Es tut mir leid«, murmelte er. »So hätte es nicht sein sollen. Kümmere dich um deine Mutter.« Er schlüpfte in den Mantel, ohne die Weste anzuziehen oder sein Hemd in die Hose zu stopfen, öffnete die Tür nach draußen und floh förmlich aus der Wohnung.
Amélie starrte ihm blicklos hinterher, dann wandte sie sich so langsam wie jemand unter Wasser Louise zu.
In Louise kämpften Entsetzen, Ekel und Fassungslosigkeit noch immer miteinander und ließen sie keinen Ton hervorbringen. Sie stierte mit der Klarheit, die einem der Schock verleiht, ihre Mutter an – das zerwühlte Haar, den zerlaufenen Kajal, das verschmierte Lippenrot in ihrem Gesicht … das entblößte Weiße ihrer Haut, ihre Brüste, ihren Bauch, ihren Schambereich mit dem üppigen krausen Haar, die allesamt bezeugten, dass Amélie Ferrand noch immer eine schöne Frau, aber kein junges Mädchen mehr war.
Amélie flüsterte: »Warum hast du zugelassen, dass er geht?« Dann sank sie auf den Fußboden, rollte sich dort ein und begann, so heiser zu schluchzen, dass es sich anhörte wie das Heulen eines Hundes.
Louise rutschte an der Wand nach unten, bis sie gegenüber der Schlafzimmertür auf dem Boden saß. Ihre Stimme kehrte zurück. »Maman«, hörte sie sich sagen. »Du wolltest doch nicht wirklich …?«
Sie kam nicht weiter. Eine Reihe von Bildern stieg blitzartig in ihr hoch, eines nach dem anderen – Amélie, die mit Louise sang in den guten Tagen vor dem Selbstmord des Vaters; Amélie, die sich verbissen durch die Katastrophe kämpfte, zu der ihrer beider Leben geworden war, und dabei immer ein aufmunterndes Wort für ihre Tochter hatte; Amélie, die wieder angefangen hatte, zu singen, mit Louise zu scherzen und glücklich zu sein, als ihre Beziehung zu Alexandre DuPlessys eine beruhigende Regelmäßigkeit bekommen hatte …
Amélie, die nackt in ihrem Schlafzimmer stand, blind vor Panik, den Mann zu verlieren, von dem ihrer beider bescheidener Wohlstand abhing.
Amélie, die sagte: Nimm Louise …
Louise wurde übel. Sie kam gerade noch so auf die Beine, rannte in die Küche und übergab sich in eine Waschschüssel.
6
Alvin sah einen dunklen Gang, an dessen Ende eine Treppe ins erste Stockwerk führte. Rechts und links davon war eine lange Reihe von geschlossenen Türen. Die innere Architektur des Rathauses unterschied sich nicht dramatisch von der eines beliebigen Gutshauses, zum Beispiel von Gut Briest. Nur der Geruch war anders – es roch trocken, papieren, nach Bohnerwachs und muffiger Kleidung, nicht nach Pferdedung, nassen Hunden und feuchter Erde wie zu Hause. Eine weitere Geruchsnote erinnerte Alvin jedoch an das Gut, ohne dass er daraufkam, was sie war.
Auf dem Boden stand eine Spur aus geschmolzenem Schnee und Dreck. Sie führte zu einer Tür.
»Die Amtsstube«, sagte Alvin, der in der Vergangenheit bisweilen nach Jerichow ins Rathaus gekommen war. Er flüsterte unwillkürlich. Seit er versucht hatte, sich von draußen bemerkbar zu machen, und keine Reaktion erhalten hatte, hatten weder er noch Otto von Bismarck gesprochen. Alvin fragte sich, warum er flüsterte, und flüsterte gleich darauf noch einmal: »Das ist der Raum, der zu den geborstenen Fenstern gehört. Den Spuren nach sind alle dort drin. Sollen wir …?« Er hob die Hand, um an die Tür zu klopfen.
Bismarck hinderte ihn daran. »Riechen Sie das nicht?«, fragte er.
Alvin konnte die Geruchsnote noch immer nicht einordnen. Direkt vor der Tür zur Amtsstube war sie stärker. »Doch, aber ich komme nicht drauf …«
Bismarck machte ein grimmiges Gesicht. Plötzlich war eine kleine, doppelläufige Taschenpistole in seiner Hand. Die Läufe glommen messingfarben im düsteren Licht. Alvin starrte die Waffe an. Bismarck zögerte einen Augenblick, dann spannte er die beiden Hähne. »Sie stellen sich rechts neben die Tür, ich links«, sagte er leise.
Alvin gehorchte, ohne lange nachzudenken. Zum wiederholten Mal stellte er fest, dass die Ausstrahlung des jungen Bismarck einen instinktiv seinen Anordnungen folgen ließ.
Die Läufe der Perkussionspistole deuteten auf die Klinke, die rechts an der Tür angebracht war. »Öffnen Sie«, befahl Bismarck. »Ganz langsam.«
Alvin drückte die Klinke nach unten. Seine Hand war vollkommen ruhig, obwohl sein Herz bis zum Hals klopfte. Die Tür schwang langsam nach innen auf. Alvin sah einen kurzen Moment des Zögerns über Bismarcks Züge huschen, dann trat der junge Gutsherr in die offene Tür, den Pistolenarm vorgestreckt. Er blieb stehen. Dann senkte er den Arm und verschwand in der Amtsstube.
»Mächtige Schweinerei«, hörte Alvin ihn murmeln. Er folgte ihm in den Raum hinein. Bismarck stand vor der hölzernen Balustrade, die den Amtsbereich von dem der Bittsteller abtrennte, und spähte darüber. Alvin wollte neben ihn treten, da sah er die angelehnte Tür am anderen Ende der Amtsstube und wusste auf einmal, dass sich dahinter schwerbewaffnete Männer versteckten.
»Die Stube des Bürgermeisters!«, stieß er hervor und deutete auf die Tür. Bismarck fuhr herum und hob die Waffe wieder. Sie wechselten einen Blick.
Alvin schritt schnell zur Amtsstube des Bürgermeisters hinüber, bemüht, aus Bismarcks Schusslinie zu bleiben. Er stieß die Tür auf. Die Amtsstube war leer. Der schwere Stuhl des Bürgermeisters lag auf der Seite, überall war Papier verstreut.
»Keiner da«, sagte Alvin über die Schulter.
»Unser Glück«, bemerkte Bismarck. »Hätten uns in aller Seelenruhe durchlöchern können, die Kerle, wenn sie da drin gesteckt hätten. Rechtzeitige Warnung wäre angemessen gewesen, Herr von Briest.« An Bismarcks Grinsen konnte Alvin erkennen, dass der Vorwurf nicht übermäßig ernst gewesen war.
»Dieser Geruch …«, sagte Alvin, der ihn mittlerweile wiedererkannt hatte.
»Kommt von ihm dort«, erklärte Bismarck und deutete über die Balustrade.
Der Amtsbereich zwischen den Fenstern und der Balustrade war noch schlimmer verwüstet als die Stube des Bürgermeisters. Die Stühle der Schreiber waren umgefallen, Papier und Glasscherben bedeckten die Tische und den Boden. Es schienen etliche Schüsse gefallen zu sein, wenn man nach den Einschusslöchern in den Möbeln und den zerschmetterten Tintenfässern ging. Schwarzblaue Tinte hatte Rinnsale über die Tischplatten gezogen, Dokumente durchtränkt oder war auf den Boden getropft, wo weiteres Papier die Schwärze aufgesaugt hatte.
Der Mann lag mitten in Papier und Glassplittern, auf der Seite, mit ausgestreckten Beinen; sein Kopf lehnte an der Balustrade. Der Geruch ging von ihm aus. Es war der Geruch von Blut und Exkrementen. Alvin hatte sich an ihn erinnert, weil der Stall von Gut Briest auch immer so gerochen hatte, wenn im Frühjahr und im Herbst die Schlachtungen vorgenommen wurden. Es war ein Geruch, der einem in der Kehle kleben blieb und den Magen umdrehte.
Der Mann auf dem Boden war tot. Er war einer der Gemeindeschreiber. Die Seite seines Gesichts, die er ihnen zuwandte, war voller Blut, das aus einem daumendicken Loch in seiner Schläfe gelaufen war. Unter ihm und um ihn herum war noch viel mehr Blut, hatte das Papier braun verfärbt und sich an manchen Stellen mit der Tinte zu einem kranken Violett vermischt.
»Haben ihn kaltgemacht«, sagte Bismarck. Seine kratzige Stimme schwankte kurz. »So viel dazu, dass der Idiot von Lieutenant keine Schüsse gehört hat. Haben hier rumgeballert wie wild, offensichtlich.«
Alvin schaute von der ausgestreckten Gestalt zu dem Fenster, neben dem der tote Schreiber gesessen hatte. Er sah die Menge draußen, die stumm und erwartungsvoll am Rand des Platzes stand, ohne sie wahrzunehmen. Er beugte sich über die Balustrade und erkannte ein paar Einschusslöcher darin. Dann wandte er sich um und blickte über die Schulter zu der vertäfelten Wand gegenüber den Fenstern, in der ebenfalls zwei, drei Einschusslöcher zu sehen waren. Die Löcher in der Wand des Rathauses, die wie Pockennarben ausgesehen hatten, fielen ihm ein.
Er ahnte, dass er den Grund wusste, warum der Polizeilieutenant nichts gehört hatte. Gehört haben wollte, berichtigte er sich.
Bismarck sah sich um, die Pistole erhoben. »Wo stecken die Kerle?«, knurrte er.
»Kommen Sie mit«, sagte Alvin. »Ich hab so eine Ahnung.«
»Und wo?«
»Kommen Sie mit.«
Alvin sah, dass Bismarck Einspruch erheben wollte, doch dann fügte sich der hochgewachsene junge Mann schulterzuckend und folgte Alvin, der wieder in den Gang hinaustrat. Gemeinsam verließen sie das Rathaus durch die Hintertür und betraten einen ungepflasterten Hof, der an einer Seite ein großes, mit einer Kette versperrtes Tor in der Mauer aufwies und an der anderen ein langgezogenes Stallgebäude.
Alvin marschierte zielstrebig auf den Stall zu. Er drosch mit der flachen Hand gegen die Stalltür, deren Flügel geschlossen waren.
»Macht auf und kommt raus!«, rief er. Sein Herz klopfte immer noch wie wild, und ihm war übel vom Anblick des toten Mannes in der Amtsstube, aber er war sicher, dass er das Richtige tat. »Wir tun euch nichts zuleide«, fügte er hinzu.
Drinnen scharrte ein Riegel, dann öffnete sich ein Flügel der Stalltür einen Spalt. In der Dunkelheit dahinter war nur das Glitzern von zwei Augen zu sehen, die Alvin musterten. Dann wurde der Türflügel ruckartig weiter geöffnet, und ein Mann sprang heraus. Alvin prallte zurück. Der Mann fiel vor Alvin auf die Knie und umarmte seine Beine; er roch nach Stall, Schweiß und Angst, sein graues Haar und sein Bart waren zerzaust. Bismarck, der ebenso überrascht worden war wie Alvin, hob verspätet seine Pistole und drückte dem Mann den Lauf gegen die Schläfe. Der beachtete sie nicht. Er stierte zu Alvin nach oben. In seinen Augen standen Tränen.
»Dank sei Gott dem Herrn!«, sagte der Mann und schluchzte auf. »Der junge Herr von Briest. Bei der Liebe Jesu, Herr von Briest, retten Sie uns!«
»Ist das der Bürgermeister?«, fragte Bismarck und nahm die Pistole weg. Sein Mund verzerrte sich verächtlich.
»Nein«, sagte Alvin. Er hatte den Mann erkannt, weil er früher einmal auf Gut Briest gearbeitet hatte. »Das ist einer der mörderischen, kaltblütigen, aufständischen Pächter.«
7
Das Militär traf ein, als die Pächter – fünf Mann, allesamt nur mit einer von ihnen und ihren Nachbarn unterschriebenen Petition bewaffnet – sowie der unversehrte Bürgermeister, seine Frau, seine Tochter und zwei Gemeindeschreiber von Alvin und Otto von Bismarck auf den Platz geführt wurden.
Die Menge stieß Rufe und Pfiffe aus, sobald sie aus der Tür traten. Aus einer der Kutschen ertönte ein barscher Befehl. Der Lieutenant und seine Gendarmen lösten sich aus der Menge und trabten auf Alvin und die anderen zu. Sie stockten, als sie das Hufgetrappel vernahmen, und sahen sich unsicher um. Im nächsten Moment kamen Reiter aus einer der Gassen zum Vorschein. Die Menge teilte sich hastig. Es war eine kleine Gruppe Landwehrkavallerie unter Führung eines Wachtmeisters. Sie trugen dunkelblaue, tressenbehangene Uniformen und schwarze Tschakos und hatten ihre Lanzen senkrecht in die Steigbügelköcher gestellt. Ihre Gesichter waren grimmig. Otto von Bismarck trat vor, bevor Alvin oder jemand anderer ihn daran hindern konnte. Er starrte schweigend zu dem berittenen Wachtmeister hoch, bis dieser sicherheitshalber salutierte. Bismarck erwiderte den Salut.
»Gerade noch rechtzeitig eingetroffen«, schnarrte der junge Gutsbesitzer. »Gratuliere zu Ihrem … hmmmm … Zeitgefühl, Wachtmeister.«
»Wir wurden durch einen Boten alarmiert. Darf man fragen, was hier los ist, Herr …?« Der Wachtmeister schien zu fühlen, dass er es mit einem ehemaligen Offizier zu tun hatte. Er blieb trotzdem knapp und bestimmt.
»Otto von Bismarck, ehemals Jägerbataillon Nummer zwei in Greifswald. Ich habe die Lage im Griff, Wachtmeister, keine Sorge.«
»Wer ist das?« Der Wachtmeister deutete auf den Polizeilieutenant.
Dieser salutierte, dann schien ihm einzufallen, dass er trotz allem einen höheren Rang hatte als der Wachtmeister. Sein Gesicht lief rot an, und er holte Atem.
»Können Sie vergessen«, sagte Bismarck. »Örtliche Polizei. Vollkommen inkompetent. Sie und ich, wir regeln das jetzt, Wachtmeister.«
Der Polizeilieutenant schnappte nach Luft. Aus der Menge ertönte Gekicher. Bismarck hatte laut gesprochen; und die Gendarmen besaßen nicht allzu viele Sympathien in der Bevölkerung. Der Lieutenant blickte sich hilfesuchend um. Aus dem hinteren Bereich der Menge löste sich eine Kutsche und rollte durch die nächstgelegene Gasse davon. Alvin musste nicht zweimal hinschauen, um zu wissen, wer in der Kutsche saß: der Gutsherr, von dessen Besitz die Pächter gekommen waren. Der Lieutenant, seines bisherigen Stichwortgebers beraubt, fiel in sich zusammen und wurde noch roter im Gesicht.
Alvin wandte sich an den Bürgermeister, der mit offenem Mund neben ihm stand. Der Bürgermeister hatte das Wort ergreifen wollen, als die Kavalleristen auf den Platz geritten waren, doch Bismarck war ihm zuvorgekommen. »Ergreifen Sie die Initiative«, raunte Alvin dem Bürgermeister zu und dachte amüsiert daran, dass Bismarck ihm vor einer knappen halben Stunde noch dasselbe geraten hatte. »Sonst meinen die Leute am Ende noch, er sei der Bürgermeister.« Er deutete auf Bismarck.
Der Bürgermeister setzte sich in Bewegung und stellte sich dem Wachtmeister vor. Bismarck wandte sich um und funkelte in Richtung Alvin. Dieser lächelte und zuckte mit den Schultern. Nach ein paar Sekunden weiterer finsterer Blicke zuckte Bismarck ebenfalls mit den Schultern und grinste zurück. Er trat beiseite und ließ den Bürgermeister reden.
Alvin hörte nicht zu. Er kannte die Geschichte – die Pächter und der Bürgermeister hatten sie gemeinsam erzählt, nachdem Bismarck und er den Stall betreten hatten, die sprichwörtlichen rettenden Engel in der Stunde der Not. Vielmehr dachte er an das Auftreten Otto von Bismarcks. Ohne Zweifel, der junge Gutsherr hatte dafür gesorgt, dass Alvin sich heute einen Namen gemacht hatte; ohne die Aufforderung und die Unterstützung Bismarcks wäre Alvin nie auf die Idee gekommen, das Rathaus zu betreten und die Lage zu klären. Zugleich hatte Bismarck schamlos alle Lorbeeren für sich beansprucht, sowohl im Gespräch mit dem Bürgermeister als auch jetzt mit den Kavalleristen. Er hatte die Lage im Griff? Schon möglich, aber ohne das Vertrauen, das die Aufständischen Alvin entgegenbrachten, nachdem der ehemalige Pächter von Gut Briest für ihn gesprochen hatte, hätte er sie nie in den Griff bekommen.
Alvin grinste in sich hinein. Sollte er sich darüber aufregen? Bismarck hatte ihm heute, aus Kalkül, aus Menschenfreundlichkeit oder aus einer Laune heraus, einen großen Gefallen getan. In diesem Licht besehen, war es zweitrangig, dass der junge Gutsbesitzer sich mit fremden Federn schmückte und sich vor den Kavalleristen aufgeplustert hatte, als gehöre ihm die ganze Gegend. Bismarck hatte Alvin mehr geholfen als die meisten Männer, die er als seine Freunde betrachtete. Vielleicht sollte er Bismarck ebenfalls als Freund betrachten – und Freunden vergab man ihre Macken und lächelte sie weg.
Die Pächter steckten die Köpfe zusammen. Der Mann, den Alvin kannte, fragte ihn schüchtern: »Was wird nun aus uns, Herr von Briest?«
»Mit der Fürsprache des Bürgermeisters? Ihr werdet sicher eure Pacht verlieren und von eurem bisherigen Gutsherrn verjagt werden, aber sonst … Mein Bruder ist seit heute der neue Herr auf Briest. Geht zu ihm und sagt, dass ich euch geschickt habe. Weitere fleißige Hände kann er sicher gut gebrauchen.«