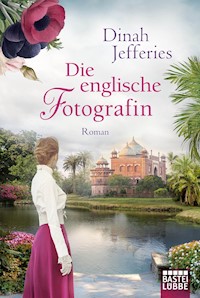9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei starke Frauen. Ein geheimer Plan. Eine Liebe gegen alle Widerstände.
Im Jahr 1943 setzt die Ankunft deutscher Soldaten in der Toskana dem friedlichen Leben im Castello der Contessa Sofia de' Corsi ein jähes Ende. Ein verwundeter britischer Funktechniker bittet um Asyl, und Sofia versteckt ihn - wohl wissend, dass sie damit das Leben ihrer Familie aufs Spiel setzt. Als die junge Maxine vor ihrer Tür steht und ihr ein gefährliches Geheimnis anvertraut, schmieden die Frauen einen riskanten Plan. Werden sie die retten können, die sie am meisten lieben, ohne entdeckt zu werden?
"Dinah Jefferies versteht es meisterhaft, vergangene Zeiten kraftvoll und bildhaft heraudzubeschwören. Ihre Figuren sind lebensecht, und man fühlt mit ihnen - ein Leseerlebnis von unglaublicher Emotionalität" KATE FURNIVALL
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Zwei starke Frauen. Ein geheimer Plan. Eine Liebe gegen alle Widerstände.
Im Jahr 1943 setzt die Ankunft deutscher Soldaten in der Toskana dem friedlichen Leben im Castello der Contessa Sofia de' Corsi ein jähes Ende. Ein verwundeter britischer Funktechniker bittet um Asyl, und Sofia versteckt ihn – wohl wissend, dass sie damit das Leben ihrer Familie aufs Spiel setzt. Als die junge Maxine vor ihrer Tür steht und ihr ein gefährliches Geheimnis anvertraut, schmieden die Frauen einen riskanten Plan. Werden sie die retten können, die sie am meisten lieben, ohne entdeckt zu werden?
»Dinah Jefferies versteht es meisterhaft, vergangene Zeiten kraftvoll und bildhaft heraudzubeschwören. Ihre Figuren sind lebensecht, und man fühlt mit ihnen – ein Leseerlebnis von unglaublicher Emotionalität« KATE FURNIVALL
Über die Autorin
Dinah Jefferies wurde 1948 im malaiischen Malakka geboren. Acht Jahre später übersiedelte die Familie nach England. Dinah Jefferies studierte Theaterwissenschaft und Englische Literatur und arbeitete als Lehrerin, Fernsehmoderatorin und Künstlerin. Heute lebt sie mit ihrem Ehemann in Gloucestershire. Die Frau des Teehändlers ist ihr zweiter Roman.
Dinah Jefferies
Die toskanische Contessa
Roman
Übersetzung aus dem Englischen von Angela Koonen
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Tuscan Contessa«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020 by Dinah Jefferies
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München unter Verwendung von Illustrationen von © shutterstock.com: Pasko Maksim, Zeynep Dogan | Dzha33 | DiegoMariottini | StevanZZ | Hintau Aliaksei | Grischa Georgiew | kavram; © trevillion.com: Rekha Garton
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-1001-5
luebbe.de
lesejury.de
Zur Erinnerung an das italienische Volk,dessen Tapferkeit und Mut mich zu diesem Buch angeregt haben.
1
In dem Burgdorf Castello de’ Corsi in der Toskana29. Juni 1944, 19.15 Uhr
Auf der kleinen Piazza zwischen Ziegeldächern, Balkonen und geschlossenen Fensterläden herrscht eine drückende Hitze, und die Luft riecht nach Rauch. Die Bewohner schlafen oder halten sich im Verborgenen. Die einzigen Stimmen, die man hört, sind die der kleinen Schwalben. Als eine große schwarze Krähe von den Zinnen des Turms herabfliegt, übertönt sie das Gezwitscher mit ohrenbetäubendem Kreischen. Eine zweite Krähe folgt der ersten. Und eine dritte.
Drei Krähen, denkt die alte Frau. Drei bedeuten den Tod. Sie zählt sie an den Fingern ab. Im Eingang des Hauses, das einmal ihrem Sohn gehört hat, sitzt sie auf einem Stuhl und nippt an ihrem verdünnten Wein. Sie unterdrückt ein Gähnen und zieht sich trotz des warmen Abends den zerschlissenen Wollschal enger um die Schultern. »Alte Knochen«, murmelt sie.
Rings um den Platz leuchten die jahrhundertealten Mauern im goldenen Sonnenschein: Wohnhäuser, zwei Läden, das Herrenhaus mit seinen hohen Flügelfenstern und dem breiten Dachvorsprung, von dem im Winter das Wasser tropft. Und der einzige Torbogen in der Wehrmauer, breit und hoch genug für Pferd und Kutsche. Ungepflegte karminrote Rosen, die aus einem Tontopf bis zum ersten Stock des Herrenhauses klettern, verströmen ihren berauschenden Duft in die Abendluft. Die Sonne, gegenwärtig noch ein mild scheinender Ball im azurblauen Himmel, wird bald zum Horizont sinken und ihn rot färben.
Es ist eine selten friedliche Stunde, doch die Ruhe wird gestört, als ein Schrei über den Platz gellt. Ein paar dunkle Fensterläden klappern. Einer fliegt auf, und eine junge Frau schaut erschrocken heraus, den Blick nach unten auf die Piazza gerichtet. Was ist los? Was kann da passiert sein? Die alte Frau blickt nach oben, als könnte sie es bereits wissen, obwohl nichts zu sehen ist außer einigen Tauben, die zur Zisterne flattern.
Der Wind streicht durch die Blätter des Feigenbaums, und ein kleiner Junge kommt durch das Dorftor gerannt und kreischt erneut, denn er jagt einem weißen dreibeinigen Hund nach, der offenbar seine Brotrinde im Maul hält. Sie rennen um die Zisterne, bis der Junge auf einer Feige ausrutscht und der Hund entkommt.
Die alte Dame lacht. »Gut für dich, mein dreibeiniger Freund«, flüstert sie, obwohl sie den Jungen und auch seine Großmutter kennt.
Eine Frau in Blau überquert den Platz in Richtung des Turms und bleibt stehen, um einer anderen ein Zeichen zu geben. Sie deutet nach rechts. Nachdem die andere durch einen Hauseingang verschwunden ist, setzt die blau gekleidete Frau ihren Weg fort, hält aber noch einmal inne, weil sie ein Auto hört. Sicher nicht die Deutschen, nicht jetzt. Alliierte also? Sie bekreuzigt sich und geht weiter.
Doch in dem Moment, und in ihrer Erinnerung wird er sich zu einer Ewigkeit dehnen, hört sie einen erstickten Schrei. Die Hand über den Augen, blickt sie zum Turm hoch und sieht es mit ungläubigem Schrecken: Auf den Zinnen sitzt eine Frau mit dem Rücken zum Abgrund. Mit gesenktem Kopf hockt sie da, rührt sich nicht, dreht sich nicht um. Einige Sekunden vergehen. Ein Windstoß fegt über den Platz, und die Frau in Blau schaut stirnrunzelnd nach oben, unsicher, was sie gesehen hat. »Sei vorsichtig!«, ruft sie hinauf.
Eine Antwort bleibt aus. War es nur ein Schatten, oder waren da zwei Leute auf dem Dach des Turms? Sie ruft erneut, und auf einmal passiert alles so schnell. Die Frau auf dem Turm neigt sich gefährlich weit zurück, und etwas fällt herab, bauscht sich, treibt im Wind. Die Frau in Blau rennt los, so schnell wie noch nie, und stolpert ein paarmal über ihre Füße. Sie sieht den Seidenschal am Boden liegen, und mit hämmerndem Herzen läuft sie auf die Turmtür zu.
2
Castello de’ CorsiSieben Monate zuvor – November 1943
Sehnsüchtig hoffend schaute Sofia über das Val d’Orcia, wo die dunkelbraunen Hänge Tal um Tal bildeten. Der violette Himmel, der von der untergegangenen Sonne noch schwach beleuchtet wurde, schien den Atem anzuhalten. In der Ferne wachte der grüblerische, einsame Monte Amiata, während die rotgoldenen Weinstöcke und Eichen in ihren letzten Augenblicken trotzig leuchteten und Sofias Verlangen, das Verlorene zurückzugewinnen, noch einmal steigerten. Der Winter rückte näher, doch sie sehnte sich zurück nach den diesigen Sommerabenden, an denen sie die nackten Zehen im trockenen Gras krümmte und spreizte, sie beide den Glühwürmchen zusahen und Rotwein aus der Flasche tranken.
Seit jeher liebte sie solche Übergänge, wenn die Welt für wenige Momente dunstig, märchenhaft, unwirklich wurde, wie auch die Minuten zwischen Schlafen und Wachen, weil sie weder dem einen noch dem anderen unterworfen war. Sie konnte sich einbilden, sie gingen noch Hand in Hand in den diesigen Olivenhainen spazieren und schmiedeten Zukunftspläne, ohne zu wissen, was auf sie zukam.
Als die Nacht allmählich schwarz wurde und in den kleinen Salon vordrang, warf sie die knarrenden Läden zu, dass sie in den Rahmen zitterten, dann schloss sie die Fensterflügel und wandte sich dem Raum zu, um den Anblick in sich aufzunehmen.
Sie roch den satten, tröstlichen Geruch von Lorenzos Zigarren, als sie vor dem Kamin in die Hocke ging und ein Scheit ins Feuer legte. Dabei blickte sie kurz über die Schulter zu dem verschossenen blauen Samtsofa, wo er saß und die beiden Hunde zu seinen Füßen dösten.
Die stillste Zeit im Haus war auch die dunkelste, und dann verfolgten sie ihre Befürchtungen. Die Schatten im Raum veränderten sich mit dem Flackern des Feuers. Lebendig und unförmig fuhren sie bis zur Decke hoch, um wieder zu schrumpfen, wenn sich die Flammen legten. Aber Lorenzos freundliche graue Augen schimmerten weiter im Feuerschein. Was er dachte oder empfand, wusste sie nicht. Trauer, ja, doch diese Gereiztheit an ihm war neu. Er klopfte neben sich auf das Sofa, und sie streckte sich, bevor sie zu ihm ging und sich an ihn schmiegte.
Gerade als er ihr die Haare aus dem Gesicht strich, hatte sie das Gefühl, etwas von sich zu verlieren und auch etwas von ihm.
»So, jetzt kann ich dich sehen«, sagte er.
»Du hast mich immer gesehen«, erwiderte sie und erzählte dann, dass sie an die Mohnfelder gedacht hatte.
»So?«
»Ich wünschte, es wäre Mai und all das läge schon hinter uns.«
Er machte ein nichtssagendes Gesicht. »Wird es vielleicht nicht.«
»Ich habe davon geträumt. Von den Mohnblumen.« Sie sagte nichts von dem fleckigen Rot der Blüten und dem herabtropfenden Blut.
Er hob ihre Hand an, um ihre abgebrochenen Fingernägel zu betrachten. »Das ist keine Farbe unter deinen Nägeln, nicht wahr?«, meinte er sanft.
»Das kommt von der Gartenarbeit.«
»Ach so. Nun, ich habe gerade an Florenz gedacht.«
»Du meinst, an früher?«
»Als du noch an der Kunstakademie warst und ich an der Landwirtschaftlichen Fakultät.«
Lächelnd dachte sie an ihr sorgloses neunzehntes Lebensjahr zurück.
»Das war neunzehnhundertzwanzig, und du siehst noch genauso aus wie damals.«
»Schmächtig? Blass? Runzlig?«
»Wohl kaum.« Seine Augen funkelten belustigt. »Elegant. Schön wie immer. Aber ich werde schon grau und du nicht.« Er fuhr sich über die grau melierten Haare.
»Mir gefällt das.«
»Aber du malst in letzter Zeit nicht mehr so viel, nicht wahr?«
»Ja, seit dem Krieg. Doch neulich habe ich die Pinsel wieder in die Hand genommen.«
Sie verfielen in Schweigen, und jeder hing seinen Gedanken nach. Wie gern hätte sie weiter mit ihm in Erinnerungen geschwelgt, sich vor Augen geführt, wer er eigentlich war, und auch, wer sie selbst war, aber sie fand nicht die richtigen Worte. Sie blickte ihn aufmerksam an, doch er lächelte nur, und so fragte sie sich, ob sie wohl beide an dasselbe dachten. In der Stille hörte sie neben dem Knacken der brennenden Scheite die Standuhr ticken, die die Sekunden abzählte, und je länger sie schwiegen, desto weiter entfernten sie sich voneinander.
»Denkst du …«, begann er schließlich, als hätte er ihre Gedanken erraten.
»Was?«
»Ach, nichts.« Er schüttelte den Kopf. »Ich dachte nur …«
»Woran?«
»Na ja … du weißt schon …«
Was? Unsicher runzelte sie die Stirn.
»An uns«, antwortete er.
»O ja …«
Sie beließen es bei dem seltsamen Gesprächsfetzen, und sie hoffte, sie würden sich wieder auf ungefährlicheres Terrain begeben. Am Ende war er es, der den Faden wieder aufnahm.
»Sofia, ich wollte sagen … Tja, ich habe auf den passenden Moment gewartet, aber … eigentlich gibt es den nicht. Deshalb sage ich es jetzt einfach.«
»Nur zu.« Sie hörte den Anflug von Angst in ihrer Stimme und sah, dass Lorenzo sich nachdenklich das Kinn rieb.
»Die Sache ist die, ich muss für eine Weile weg.«
Sie löste sich von ihm und setzte sich auf das Chintzsofa gegenüber, schlug die Beine unter und versuchte, nicht gekränkt zu erscheinen. »Was ist daran neu? Du bist immer weg.«
Er verzog das Gesicht. »Und ich komme immer zurück.«
»Das heißt, diesmal nicht?« Die Vorstellung, das Gut ganz allein verwalten zu müssen, erschreckte sie.
»Nein, doch es könnte diesmal etwas länger dauern. Aber ich muss nicht sofort weg.«
»Was wirst du tun?«
»Nichts Schwieriges. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.«
Sein Tonfall war zu unbekümmert. Sie war überzeugt, dass er log. »Erzähl es mir«, verlangte sie.
Er seufzte. »Man hat mich gebeten, den Alliierten Informationen zu übermitteln, die sie vielleicht nützlich finden.«
»Ist das nicht furchtbar gefährlich?«
Er hielt ihren Blick fest, und sie las es in seinen Augen. Selbstverständlich war das gefährlich.
»Du wirst trotzdem weiter im Ministerium arbeiten?«
»Sicher.« Er stand auf.
Aus dem Augenwinkel sah sie ihn ein kleines, unförmiges Päckchen aus der Tasche nehmen und hochhalten. Sie deutete mit dem Kopf auf den Sofatisch, damit er es dort hinlegte.
»Willst du es nicht auspacken?«, fragte er.
»Später.«
»Werdet ihr hier im Castello sicher sein?«, wollte er wissen, und sie las in seinen Augen, wie bewegt er war.
Das war eine ernste Frage. Er sah die hohen Mauern und ihr Zuhause vor sich, nicht gerade eine Festung, aber das Herrenhaus ihres kleinen, befestigten Dorfes aus dem dreizehnten Jahrhundert, in das man nur durch ein einziges Tor gelangte und dessen Wehrmauer noch kein Feind überwunden hatte. Bisher.
»Sicher? Wir? Vielleicht.« Aber nicht unsere Schweine, dachte sie. So wenig wie die Puten, Hühner, Enten, Perlhühner, Wildschweine und Rinder. Es ärgerte sie, dass ihre zweiunddreißig Bauernhöfe immer wieder bestohlen wurden, und sie dachte daran, wie einsam sie lagen, alle außerhalb der Mauer. Eine leichte Beute. »Dieses Jahr wird es keine Würste geben.« Falls sie gerade verbittert klang, war ihr das gleichgültig.
»Aber du hast doch Vorräte versteckt?«
»Ein paar, doch für uns und die Bauern wird es kaum Fleisch geben. Was glaubst du, warum wir ständig Kaninchen essen?«
Er lächelte und gab sich unbeschwert. »Ich mag Kaninchen.«
»Dann ist es ja gut.«
Einen Moment lang betrachtete sie ihre Hände.
»Was ist?«, fragte er.
»Nichts.« Und mit den Gedanken bei dem Brief, den sie ihm bisher verschwiegen hatte, sprach sie ihn auf etwas anderes an. Denn wahrscheinlich würde es gar nicht dazu kommen, und dann würde sie froh sein, ihn nicht beunruhigt zu haben. »Was wirst du mit deinem Parteiausweis machen?«
Er holte scharf Luft und blickte sie enttäuscht an. »Das schon wieder?«
Sie wurde ungehalten. »Nun, seit dem Waffenstillstand mit den Alliierten …«
Erneut schwiegen sie, aber nur kurz.
Sie führte den Satz zu Ende. »Die Lage ist doch jetzt anders, nicht wahr?«
Lorenzo neigte den Kopf hin und her, wie um seinen Nacken zu lockern. »Sie ist kompliziert.«
Er hatte recht. Da sie unter deutschem Kriegsrecht lebten, musste er zu seiner Sicherheit den Parteiausweis bei sich tragen.
»Nicht im Süden, wo die Alliierten sind«, fügte er hinzu. »Aber du weißt, wie es seit der Besatzung ist: Entweder du machst bei ihnen mit, oder sie betrachten dich als Feind. Dazwischen gibt es nichts.«
»Also werden sie weiterhin glauben, dass du zu ihnen gehörst.«
Sie hoffte nur, dass er den Ausweis versteckt bei sich trug. Und sie verstand ihn. Das tat sie wirklich. Er wollte nicht darüber reden. Das war ein wunder Punkt zwischen ihnen, seit 1932, als alle Staatsangestellten der faschistischen Partei hatten beitreten müssen. Andernfalls hätte man ihnen gekündigt.
Sofia hatte seine Entscheidung eigentlich nie verstanden, denn er war auf die Stelle nicht angewiesen, da sie durch das Gut und ihre Wertpapiere genügend Einkommen hatten. Aber er arbeitete im Landwirtschaftsministerium, und seine Leidenschaft für den Landbau trieb ihn an. Von Mussolinis Bonifica integrale, der Urbarmachung von Brachflächen und unbrauchbarem Land, war er begeistert gewesen. Man musste sich nur das Val d’Orcia ansehen. Mit Lorenzo als Vizepräsident des örtlichen Konsortiums war es in visionärer Weise kultiviert worden. Eine öde Landschaft hatte sich in fruchtbares Land verwandelt, auf dem Getreide und Obstbäume üppig gediehen.
Dennoch kam ihr unweigerlich ihr gebildeter, schrecklich kluger Vater in den Sinn, der sich geweigert hatte, den Faschistenausweis zu unterschreiben, und jetzt mit ihrer Mutter in einer Wohnung in einem Renaissance-Palazzo in Rom lebte und kaum genug zum Leben hatte.
»Ich weiß, was du denkst«, sagte Lorenzo mit einem traurigen Lächeln.
Sie erwiderte es. »Wirklich?«
Er stand auf und streckte die Hände nach ihr aus. Sie ging zu ihm, und sie wiegten sich in einer Umarmung.
»Also, was ist in dem Päckchen?« Sie schaute zum Sofatisch, wo es lag.
Er sah ihr in die Augen. »Eine kleine Pistole.«
»Cristo!« Sie war ziemlich erschrocken. »Die brauchst du jetzt?«
»Tatsächlich habe ich schon eine. Diese ist für dich.«
»Du glaubst, ich brauche sie?«
»Könnte sein.«
»Und du wolltest sie mir überreichen wie eine Schachtel Pralinen?«
Er gab keine Antwort. Eine Pistole, um Himmels willen! Sie beschloss, sich später darüber Gedanken zu machen.
Lorenzo beugte sich zurück, um ihr ins Gesicht zu sehen. »Du hast die dunkelsten Augen und die schönste Stimme von allen.«
Sie lachte. »Du wechselst das Thema … und überhaupt sagst du das immer.«
»Und ich sage auch immer, dass ich mein ganzes Leben damit verbringen könnte, sie zu ergründen und dir zuzuhören.« Er löste die Kämme aus ihrem Haar, sodass es wie ein Schleier zur Taille herabfiel. »Deine Eltern könnten zu uns kommen. Ich hätte nichts dagegen. In Rom wird es schlimmer.«
»Du weißt, das werden sie nicht tun.«
Das stimmte. Ihre Eltern erzählten ihr nicht alles, aber soweit sie wusste, waren sie an irgendetwas beteiligt. Und in Rom an etwas beteiligt zu sein wurde von Tag zu Tag riskanter.
»Ist Carla noch da?«, flüsterte er an ihrem Ohr, dann nahm er das Ohrläppchen zwischen die Zähne.
Sie verspürte das gewohnte Kribbeln. Wenigstens das war ihnen geblieben. »Sie ist zu ihrer Tochter gegangen, um den kleinen Alberto ins Bett zu bringen. Sie wird ein paar Stunden weg sein. Und wer weiß, was ihr danach noch einfällt«, sagte sie, obwohl sie das wusste.
Einen Moment lang sah sie Carla auf der Kopfsteinpflastergasse mit eingezogenem Kopf durch den Regen eilen, zu den kleinen Häusern am Glockenturm. Die Dorfmauer drückte dort die Wohnhäuser zusammen, sodass es aussah, als stützten sie sich gegenseitig, so wie sie es jetzt alle tun mussten.
»Und Giulia?«, fragte Lorenzo.
»Ist nach Hause gegangen. Wir haben das Haus für uns allein.«
Sein Blick wurde sanfter. »Dann werde ich noch ein Holzscheit aufs Feuer legen, und du ziehst das Kleid aus. Ich muss deine Haut spüren.«
Sie lachte. »Vor dem Kamin?«
Und ihr Verlangen nach ihm verdrängte die Gedanken an alles andere, an den Krieg, das Überleben, ans Siegen oder Verlieren oder an die Sorge, was sie noch zu essen haben würden. Das war das Einzige, was all dies erträglich machte, denn sie fürchtete den Morgen, an dem sie ihrem Mann beim Malzkaffee gegenübersitzen würde und nicht mehr wusste, wer er noch war.
Sie nahm zwei Kissen vom Samtsofa und auch die alte Chenille-Decke, die die kahl gesessene Stelle kaschierte. Dann zog sie sich aus und legte sich auf dem alten Fliesenboden auf den Teppich, um Lorenzo zu betrachten, während er seine Kleidung ablegte. Groß und schlank war er, und seine Schultern schimmerten im Feuerschein. »Die Socken auch«, verlangte sie.
Er lachte, gehorchte aber, dann legte er sich zu ihr unter die Decke. Sie erschauderte. Draußen vor den starken Mauern sammelten sich die Geister dieses Krieges und wurden immer zahlreicher. Beobachteten sie ihr Tun jetzt voller Neid? Sehnten sie sich danach, einen Rückweg in ihr warmes Leben zu finden? Schauderte sie deshalb oder nur, weil es im Zimmer kalt war? Es war November, und das Feuer wärmte bloß eine Seite ihres Körpers.
Lorenzo rieb ihr kräftig den Rücken, und sie lachte wieder.
»Ich bin kein Hund, weißt du?«
Er küsste sie auf die Stirn und auf die Nasenspitze. »Ist mir schon aufgefallen.«
Sobald ihnen warm war, liebten sie sich leidenschaftlich. Wie schon immer. Sie waren den Gefahren der Gewöhnung und gedankenlosen Trägheit, die zu Untreue führen konnte, nicht erlegen. Vielmehr brannte das Feuer in ihnen heißer und schmiedete ein stärkeres, tief reichendes Band. Und sie wussten beide, dass menschlicher Kontakt, Verbundenheit, Liebe, wie immer man es nennen wollte, genau das war, was sie durchbringen würde.
Sofia seufzte, und bei jeder Berührung seiner Lippen wurden ihre Gedanken blasser, bis sie sich ihren Empfindungen und dem natürlichen Agieren ihrer Körper überließ. Alles würde wieder gut werden. Das musste es.
3
Rom
Maxine Caprioni nahm ihre Reisetasche und verließ das düstere Zimmer in der Via dei Cappellari. Draußen klappte sie den Wollkragen gegen die Kälte hoch. Sie trug einen Männermantel in unansehnlichem Braun mit großen Taschen, den sie mithilfe eines Gürtels eng um sich gezogen hatte.
Sie eilte die unbeleuchtete Straße entlang, die Augen auf das Trottoir gerichtet, um Pfützen auszuweichen. Wegen eines Kratzgeräusches schaute sie hinter sich. Stinkender Müll, der nicht abgeholt worden war, lag in Haufen an der Straße, und angewidert sah sie ein paar Ratten durch den Unrat huschen.
Maxine ging weiter durch die schmalen Straßen des Viertels, über kleine Plätze und an alten Kirchen vorbei zum Campo de’ Fiori. Von dort hielt sie auf die Via del Biscione zu, unweit des gespenstischen Jüdischen Ghettos.
Ein Schrei nahe der Straßenecke ließ sie abrupt anhalten. Sie atmete tief durch, doch dann versteckte sie die Tasche, ohne weiter zu überlegen, in der dunklen Gasse neben sich und eilte auf die Stimmen zu. Hatte sie ein Talent, in Schwierigkeiten zu geraten? Schon möglich – aber viel eher hatte sie, wie ihre Mutter sagen würde, einen starken Drang, in Not geratene Kätzchen und Kinder zu retten.
Als sie um die Ecke bog, wäre sie fast in zwei Männer hineingerannt, die an Ärmeln, Kragen und Brust allerhand Abzeichen hatten. Unter ihren Jacken trugen sie die verräterischen schwarzen Rollkragen. Das waren Schwarzhemden, und sie traten einen alten Mann, dessen Gehstock ein Stück entfernt am Boden lag. Voller Zorn und mit Herzklopfen beobachtete Maxine, wie die Schwarzhemden den wehrlosen Mann mit kräftigen Tritten quälten. Dann hob einer seinen Kopf an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Ein Dritter – wie die anderen kaum älter als siebzehn Jahre – hob den Gehstock auf und zerbrach ihn lachend über dem Knie.
Der alte Mann, der nun blutend in der Gosse lag und wimmernd mit den Armen seinen Kopf zu schützen versuchte, flehte um sein Leben. Maxine schätzte die Chancen ab. Wenn sie eingriff, könnte ihr die gleiche Behandlung zuteilwerden, aber wenn sie sich nicht einmischte, würde der Mann wahrscheinlich sterben.
Die Schläger hatten freie Hand, die Straßen vor und während der Ausgangssperre zu durchstreifen, und drangsalierten, wen sie wollten. Maxine sah auf ihre Uhr. Noch eine Viertelstunde bis zur Ausgangssperre.
»He, Jungs!« Sie öffnete ihren Mantel, warf den Kopf zurück und schwang ihre langen rotbraunen Locken, sodass sie verführerisch über eine Schulter nach vorn fielen. »Wollen wir was trinken gehen?«
Die jungen Männer hielten inne, um sie zu mustern.
»Du bist spät unterwegs«, sagte einer kurz angebunden.
»Keine Sorge, ein bisschen Zeit bleibt noch.« Sie war gebürtige Italienerin, und wegen ihres dunklen Teints und der ausdrucksvollen braunen Augen hielt man sie auch dafür. Sie hoffte nur, dass der Einfluss ihrer Kindheit in New York sich nicht auf ihren toskanischen Akzent niederschlug. Sie öffnete die obersten zwei Knöpfe ihrer Bluse und schlenderte auf einen der Männer zu. »Schau, die Bar da drüben ist noch offen.« Sie zeigte zur Ecke gegenüber.
Die Kerle zögerten, dann streckte einer die Hand aus. »Papiere?«
Sie wühlte in ihrer Handtasche und holte den neuen Ausweis und eine Lebensmittelkarte heraus. Den amerikanischen Pass hatte sie bei ihrem britischen Führungsagenten lassen müssen.
»Die Getränke gehen auf mich.« Hüftenschwingend machte sie ein paar Schritte und blickte über die Schulter zurück, um sie anzulächeln. Sie war froh, dass sie roten Lippenstift trug. Da sie in Little Italy und East Harlem aufgewachsen war, hatte sie im Laufe ihrer neunundzwanzig Jahre schon einige Erfahrung mit solchen Schlägern gesammelt.
Einer von ihnen nickte, vielleicht der Anführer, und nachdem er den still daliegenden Mann noch einmal getreten hatte, schloss er sich ihr an. Die anderen beiden schlenderten hinterher.
So betraten die drei mit ihr die Bar und bestellten Wein. Was jetzt? Sie riss einen Witz, mit dem sie für Gelächter sorgte, und währenddessen schätzte sie ihre Begleiter ein.
Du bist zu impulsiv, Maxine, hörte sie ihre Mutter in Gedanken sagen. Du denkst nie auch nur einen Augenblick nach.
Ihre Mutter hatte recht. Einer der Kerle legte den Arm um ihre Schultern und zog sie an seine Seite, um ihren Nacken zu liebkosen, während seine andere Hand schwer auf ihrem Oberschenkel lag. Wahrscheinlich hielten sie sie für eine Hure.
Sieh zu, dass du da wegkommst, flüsterte ihre Mutter.
Sie bestellte eine zweite Runde und dazu für jeden einen Brandy. Dabei blickte Maxine verstohlen zu der Uhr an der Wand. Die Minuten vergingen zäh.
Morgen würde sie in die Toskana reisen, um sich dort mit wichtigen Widerstandskämpfern in Kontakt bringen zu lassen – sofern es verlässliche Partisanengruppen überhaupt gab. In England war man sich da nicht sicher gewesen. Wenn sie zu dem Urteil kam, dass die Leute vertrauenswürdig waren, würde sie zwischen den Alliierten und dem Widerstandsnetz als Verbindungsperson fungieren.
Das war eine hochriskante Operation, und für die Briten war es praktisch unmöglich gewesen, Italiener zu finden, die bereit waren, als SOE-Agenten nach Italien zurückzukehren und sich an Sabotageakten, Spionage und Aufklärung zu beteiligen. Maxine dagegen hatte die Chance sofort ergriffen und würde nun die strategischen Fähigkeiten der Resistenza auskundschaften.
Im Gegensatz zu den Agenten, die die SOE nach Frankreich schickte, war sie nur geringfügig ausgebildet worden. Ronald, ihr Führungsagent, hatte sich sehr bemüht, ihr das klarzumachen. Schließlich war Italien seit Anfang September lediglich besetzt, und das Anwerbungsgespräch mit Ronald hatte bereits im Oktober stattgefunden. Zugegeben ein hastiges Vorgehen, aber sie brauchten schnellstmöglich Leute vor Ort.
Jetzt drückte der Kerl ihren Oberschenkel. Sofort fing sie im Plauderton von etwas Belanglosem an und wand sich aus seinen Armen. Dabei lächelte sie so verführerisch, wie sie konnte. Das Bild des alten Mannes in der Gosse und ihr Zorn über seine Erniedrigung spornten sie an. Ihr kam eine Idee. Die könnte funktionieren, und das war vielleicht die einzige Gelegenheit. Der Kerl starrte sie an. Deshalb nahm sie ihren Mut zusammen und strich ihm über die Wange. »Ich will mich nur rasch frisch machen.«
Sein Blick wurde misstrauisch.
Sie hatte es sich zur Aufgabe gemacht, den Hinterausgang jeder Bar auszukundschaften – für den Fall, dass sie plötzlich einen Fluchtweg brauchte. Und sie war so klug, die Gegend rings um die Via Tasso zu meiden, wo SS und Gestapo ihr Hauptquartier hatten. Die Bar lag eine Dreiviertelstunde von dort entfernt.
Maxine schlüpfte an den Toiletten vorbei in den Hinterhof, kletterte über die niedrige Mauer in den Nachbarhof und stieg durch einen zerbrochenen Zaun, sodass sie in die Gasse gelangte, die parallel zur Straße verlief. Sie holte die Reisetasche aus dem Versteck und rannte zu dem alten Mann. Während sie ihm half aufzustehen, erfuhr sie, in welchem Palazzo er wohnte. Zum Glück lag der auf ihrem Weg.
»Wir müssen uns beeilen«, flüsterte sie drängend. »Die Schwarzhemden werden uns gleich suchen.«
Sie gingen los, aber der Mann war so schwach auf den Beinen, er konnte nur schlurfen und stöhnte in einem fort, sodass sie ihn eindringlich bitten musste, still zu sein. Quälend langsam bogen sie um die nächste Ecke und Gott sei Dank in die Straße, die sie selbst entlangmusste.
Irgendwo hinter ihnen ertönte ein Ruf. Er hallte durch die menschenleere Straße. O Gott! Männerstimmen. Konnten das schon die drei Kerle sein?
Sie passierten mehrere Häuser und näherten sich einem Palazzo mit der typischen reich verzierten, beschlagenen Holztür. Waren sie am Ziel? Wenn nicht, konnte es nicht mehr weit sein. Doch da ihnen die Schwarzhemden dicht auf den Fersen waren, drückte sie kurzerhand gegen die Tür. Zum Glück war sie unverschlossen. Halb zog, halb schleppte sie den wimmernden Mann in den Durchgang zum Innenhof, schloss die Tür und lehnte sich dagegen.
Maxine hielt ihm den Mund zu, denn er atmete zu schnell und zu laut, und daraufhin blickte er sie mit großen Augen flehend an, offenbar unsicher, ob sie ihm etwas antun wollte. Sie schüttelte den Kopf und kniff die Lippen fest zusammen, weil sich draußen energische Schritte näherten. Aufs Äußerste angespannt lauschte sie und hörte lautstarken Streit. Die drei Schläger gingen sich gegenseitig an die Gurgel. Einer bestand darauf umzukehren; der Anführer war sich jedoch sicher, auf der richtigen Spur zu sein.
Mit zusammengebissenen Zähnen hörte sie sich an, welche abscheulichen Dinge sie ihr antun wollten, wenn sie sie in die Finger bekämen. Wie lange würde sie den alten Mann dazu bewegen können, still zu sein?
Sie roch Rauch – nicht den, der in Rom ständig in der Luft hing – und hielt den Atem an. Die Kerle hatten sich Zigaretten angezündet und lungerten herum, um zu sehen, ob ihnen noch mehr »Spaß« über den Weg lief. Oder wussten die etwa, dass sie hinter der Tür stand? Sie würde den alten Mann nicht mehr lange aufrecht halten oder am Stöhnen hindern können. Sie wagte nicht, sich zu bewegen, denn auf der Straße war es zu still. Die Kerle würden sie hören.
Vom angespannten Warten bekam sie Kopfschmerzen, aber sie zwang sich zu langsamen, tiefen Atemzügen. Nach fünf Minuten etwa beschlossen die Schläger, woandershin zu gehen. Im Innenhof brachte sie den Mann zu der Tür, auf die er deutete.
Eine Frau öffnete und unterdrückte einen Aufschrei, als sie das Blut an seinem schäbigen Mantel und die Platzwunden und Blutergüsse in seinem Gesicht sah.
»Dio mio! Ich sage ihm immer, er soll im Dunkeln nicht mehr aus dem Haus gehen, aber er ist ein sturer alter Narr. Danke, dass Sie ihn zurückgebracht haben.«
»Das ist nicht der Rede wert«, murmelte Maxine und fragte dann: »Wissen Sie, wo Roberto und Elsa Romano wohnen?«
»Nebenan im obersten Stock.«
Vorsichtig schlüpfte Maxine nach draußen und in das Nachbarhaus, dann lief sie die Marmortreppe hinauf.
Rom war seit dem elften September von den Deutschen besetzt. Sie hatten die Telefonzentrale und den Rundfunksender übernommen, und weil Benzin schon knapp war, fürchteten die Leute, bald ohne Strom dazustehen. Zwar war Rom schon im August zur offenen Stadt erklärt worden, die nicht verteidigt wurde und deshalb nicht angegriffen werden durfte, doch Maxine hatte die Deutschen trotzdem einmarschieren sehen. Sie waren über die Via del Corso marschiert mit dem einzigen Zweck, die Menschen einzuschüchtern.
Als sich die Tür einen Spaltweit öffnete, flüsterte Maxine die Losung und wurde von einer älteren Frau mit angegrauten Haaren in einen dunklen Flur gewinkt. Die stellte sich als Elsa vor und führte Maxine in einen Raum, in dem Kerzen und Öllampen brannten. Der warme Lichtschein ließ ihn trotz der hohen Decke und der Kälte behaglich erscheinen.
Maxine überlief ein Schauder. Das war mal ein vornehmer Salon gewesen. Die Möbel sahen zwar schäbig aus, hatten aber einmal viel Geld gekostet. Sie blickte sich um. Fünf Augenpaare musterten sie argwöhnisch. Es war nur natürlich, dass die Leute ihr erst einmal misstrauten.
»Guten Abend«, sagte sie, stellte die Tasche ab und band sich die Haare zusammen. Sie setzte sich auf den freien Platz an den großen Esstisch, auf dem Stöße von bedrucktem Papier lagen.
»Was ist mit Ihren Händen?«, fragte Elsa.
Maxine sah jetzt erst, dass sie sich an der Mauer die Handflächen aufgeschürft hatte, und wischte sie an der Hose ab. »Das ist nichts. Entschuldigen Sie, dass ich zu spät komme. Ich habe es gerade so geschafft, aus einer heiklen Situation zu entkommen. Ich heiße Maxine. Ich …« Sie war im Begriff, von dem Vorfall zu berichten, besann sich aber noch rechtzeitig. Es war besser, darüber zu schweigen.
Zwei der versammelten Männer und Frauen nickten.
Ein vornehm wirkender älterer Herr lächelte sie an, doch als er sprach und ihr die Hand gab, bemerkte sie, dass er zitterte. »Ich bin Roberto, Elsas Mann. Das ist unsere Wohnung. Sie wurden uns nachdrücklich empfohlen. Darf ich annehmen, dass Sie unbemerkt hierhergelangt sind?«
Maxine antwortete vage. Elsa strahlte ruhige Zuversicht aus, doch ihrem Mann zitterten erneut die Hände, als er ein Blatt Papier vom Tisch nahm. Im nächsten Moment war Maschinengewehrfeuer zu hören, und alle wechselten angstvolle Blicke.
Elsa schüttelte den Kopf. »Das ist weit weg.«
Vielleicht, doch Maxine war heilfroh, dass sie schon am nächsten Morgen in die Toskana aufbrechen würde.
Auf dem Tisch lägen die fertigen Flugblätter, erklärte Roberto, verfasst und gedruckt von Mitgliedern des Nationalen Befreiungskomitees, zu denen auch er gehöre.
»Nachdem die Deutschen unsere Truppen bei Porta San Paolo vernichtet hatten und anschließend ihr Kriegsrecht verhängten, haben wir das Komitee gegründet.«
»Und nun verbreiten wir Nachrichten von Radio London«, fügte Elsa hinzu. »Sie wissen, dass das verboten ist?«
Maxine nickte.
»Und wir informieren unsere Partisanen mithilfe von Untergrundzeitungen wie der L’Unità und L’Italia Libera.«
»Und die Druckmaschine?«
»Diese Information bekommen nur wenige.«
Maxine schaute in die Runde. Die Leute sahen aus wie Intellektuelle, bis auf einen langhaarigen, unrasierten Mann. Seine Erscheinung wies ihn als Partisanen aus, obwohl er einen förmlichen Anzug trug. Oder war er Soldat gewesen? Der Mann ertappte sie bei ihrer Musterung, zog die Brauen hoch und zwinkerte ihr zu. Sie hielt seinem Blick stand. Er hatte außergewöhnliche Augen von hellbrauner Farbe, die vor Klugheit und Lebendigkeit leuchteten. Gefährlich aufregende Augen, dachte sie. Sein Gesicht war kantig, und neben seinem Stuhl lehnte ein Spazierstock.
In Rom versteckten sich so viele verlorene Seelen, darunter auch britische Kriegsgefangene, die entweder geflohen oder von italienischen Soldaten, die nicht mehr aufseiten der Deutschen kämpften, freigelassen worden waren. Der Mann musterte sie nun seinerseits, und dabei kam er ihr nicht vor wie ein britischer Soldat.
Nach ein paar Augenblicken merkte sie, dass Roberto auf eine Antwort wartete, oder darauf, dass sie etwas tat. Hatte er überhaupt eine Frage gestellt?
»Entschuldigung«, sagte sie und nahm sich ein Flugblatt, um die ersten Abschnitte zu überfliegen, dann blickte sie Roberto an. »Sie wollen, dass ich die mitnehme?«
»Nun, das wäre praktisch, da Sie ohnehin nach Norden fahren.«
»Lieber ich als eine Staffetta?«
»Im Augenblick ist es für unsere Kuriere zu schwierig. Geben Sie die Flugblätter an die Partisanen weiter, die verteilen sie, wo es möglich ist. Sie wissen, wohin Sie gehen müssen?«
»Noch nicht. Mein Führungsagent hat mir Ihre Adresse gegeben, die Uhrzeit des Treffens genannt und gesagt, dass ich die weiteren Anweisungen von Ihnen bekomme.« Sie erwähnte nicht den britischen Funker, mit dem sie in der Toskana Kontakt aufnehmen sollte. Diese Informationen durften nicht unnötig weitergegeben werden. Und Ronald hatte ihr eingeschärft, dass die Widerstandsgruppen anders als in Frankreich weit verstreut waren, sodass es außerordentlich schwierig war, sie zu finden und mit Waffen und Munition zu versorgen.
»Sie müssen nach Castello de’ Corsi«, erklärte Roberto. »Im Herrenhaus fragen Sie nach Sofia de’ Corsi. Sagen Sie, dass wir Sie geschickt haben, dann wird sie Sie aufnehmen. Ihr Mann könnte auch da sein, Lorenzo de’ Corsi. Sie dürfen auch mit ihm sprechen, doch reden Sie möglichst zuerst mit Sofia.«
»Weiß sie nicht, dass ich komme?«
»Nicht genau. Erklären Sie ihr, welchen Auftrag Sie haben, aber außerhalb ihres Hauses wahren Sie Stillschweigen. Ihr können Sie sagen, wie Sie wirklich heißen, ansonsten benutzen Sie Ihren Decknamen. Sie haben doch eine Legende ausgearbeitet?«
»Ja. Ich hatte mir überlegt, mich als Journalistin auszugeben, die einen Artikel darüber schreiben will, wie sich der Krieg auf die normale Bevölkerung auswirkt. Ich habe bei einer Zeitung gearbeitet, wissen Sie? Doch mein Führungsagent hat mir die Idee ausgeredet.«
»Das ist auch besser so, würde ich meinen, vor allem wenn Sie mal Deutschen in die Arme laufen. Die würden Sie sofort für eine Spionin halten. Von Marco wissen wir«, er deutete auf den jungen Mann mit den hellbraunen Augen, »dass die Partisanen in der Toskana ein bunt zusammengewürfelter Haufen sind, ohne Ausbildung, aber rücksichtslos und zornig.«
Marco nickte bekräftigend, und sie lächelte ihn an. Also war er tatsächlich ein Partisan.
»Sie werden mit ihm zusammenarbeiten, und er wird Sie bei allem unterstützen«, fuhr Roberto fort. »Sobald klar ist, wie arbeitsfähig die Gruppen wirklich sind, wie viele Männer sie haben, wo sie sich verstecken und wer sie anführt, können wir die Information an Ihren Führungsagenten weitergeben oder, falls Sie den Kontakt herstellen können, ihm das direkt in die SOE-Station im Süden funken.«
»Wir vermuten, dass in Kürze an verschiedenen Stellen britische Funker und Funkgeräte abgeworfen werden«, sagte Marco. »Wir müssen unser Kommunikationsnetz schleunigst ausbauen, denn die Alliierten brauchen uns.«
Sie nickte. »Ich werde mein Bestes tun.«
»Und Ihre Familie stammt woher?«, fragte Roberto.
»Aus der Toskana. Zu Hause haben wir immer Italienisch gesprochen, in der Schule Englisch.«
»Ihre Aussprache ist recht gut. Kein Deutscher wird merken, dass Sie aus New York kommen, aber vielleicht die Einheimischen.«
Sie lächelte ihn an. Dass sie sich nach ihrer Mutter sehnte, sobald sie an die Toskana dachte, behielt sie für sich. Sie seufzte tief und hoffte, dass sie sich richtig entschieden hatte. Obwohl ihre ganze Familie es ihr hatte ausreden wollen, war sie als akkreditierte Korrespondentin der Vereinigten Staaten nach England gereist.
Doch in einem schäbigen Hotelzimmer in Bloomsbury hatte sich für sie alles geändert. In der Presseagentur, in der sie arbeitete, bekam sie einen Brief, in dem ihr Zeit und Ort und der Name der Person mitgeteilt wurden, mit der sie sich treffen sollte. Ein gewisser Ronald Carter. Im Briefkopf stand Inter Services Research Bureau. Das sagte ihr nichts, und auch während sie zum ersten Mal von dem großen, dunkeläugigen und ziemlich nobel gekleideten Ronald befragt wurde, blieb ihr das ein Rätsel.
Er sagte, er habe ihre Unterlagen vom Einwanderungsamt bekommen, das die ins Land drängenden heimatlosen Ausländer kontrollierte, Flüchtlinge überprüfte, Ausreisegenehmigungen erteilte und dergleichen mehr. Er blickte sie kritisch an und sagte: »Ich will mehr über Sie wissen.«
Sie hatte gedacht, ihre Erlaubnis, in England zu arbeiten, würde widerrufen und man würde sie in Kürze nach Hause schicken. Doch während des zweiten langen Gesprächs mit Ronald, bei dem es um ihre Persönlichkeit, ihre Loyalitäten und ihre Kenntnis von Italien ging, wurde ihr klar, was er tatsächlich wollte. Er war selbst zweisprachig aufgewachsen, und sie führten das halbe Gespräch auf Italienisch.
»Wir sind zurzeit dabei, junge, in Italien geborene Amerikaner und Briten anzuwerben, die die richtige Haltung und Persönlichkeit besitzen, um von uns ausgebildet zu werden, damit wir sie rasch in Italien als Agenten einsetzen können«, sagte er ernst.
Wenn sie sich dazu bereit erklärte, würde sie mit britischen Truppen zusammen per Schiff nach Süditalien fahren, wie er auch. Danach würde sie mit dem Fallschirm bei Rom abgesetzt werden. Partisanen würden sie in die Stadt bringen, und von da an wäre sie auf sich allein gestellt.
Nach dem Treffen mit ihm wurde sie für zwei Wochen in eine Fallschirmspringerschule zur Ausbildung geschickt, wo sie nach drei Absprüngen ihre Prüfung mit Bravour bestand. Es war beängstigend, aber auch erhebend. Es folgten weitere Lehrgänge, bei denen sie Geheimaufträge auszuführen hatte. Sie behielt dabei die Nerven, und nun war sie hier, und ihre Eltern wussten nicht das Geringste davon.
»Übrigens«, sagte Roberto gerade und holte sie damit in die Gegenwart zurück. »Sie müssen ein Kleid tragen.«
»Warum? Ich werde mit dem Motorrad fahren.«
»Trotzdem müssen Sie aussehen wie eine Toskanerin. In Hosen fallen Sie auf«, sagte er. »Elsa?«
Als seine Frau aufstand und hinausging, hatte Maxine Mühe, sich ihren Ärger nicht anmerken zu lassen. Obwohl sie groß und langbeinig und mit einer Figur gesegnet war, für die manche Frau sterben würde, hatte sie ein Talent dafür, unter Menschen nicht aufzufallen, und fühlte sich dabei in Hosen am wohlsten.
Elsa kam mit einem Stapel Kleidungsstücken zurück.
Roberto packte Flugblätter in eine abgenutzte Umhängetasche.
Als er damit fertig war, nahm Maxine sie zusammen mit der Kleidung entgegen. Elsa sagte, sie solle sich im Schlafzimmer umziehen, und während Maxine sich das Kleid anzog, bekam sie mit, dass die Leute nebenan miteinander flüsterten. Sie schlich zur Tür, konnte aber nicht verstehen, was gesprochen wurde. Sie band sich gerade das Kopftuch um, als von unten Stiefelschritte zu hören waren, die die Treppe heraufkamen, dann fielen Schüsse, und es wurde laut an Wohnungstüren geklopft.
»O Himmel. Was in Gottes Namen?«
Elsa stürmte herein. »Schnell. Nehmen Sie die Feuertreppe, und bitte geben Sie Sofia dieses Kästchen. Sie ist unsere Tochter. Sie lebt in Castello de’ Corsi in der Villa. Sagen Sie ihr, dass ihre Eltern sie an die Pralinen erinnern. Das ist wichtig.«
»Sicher. Aber werden Sie hier klarkommen?«
Elsa machte eine unbestimmte Handbewegung. »Ich glaube, die Nazis beschlagnahmen unser Haus.«
»Sie wussten davon?«
»Wir wurden gewarnt.«
»Meine Güte, warum sind Sie nicht geflohen?«
»Ich habe es nicht glauben wollen. Keiner von uns will das alles glauben.«
Sie hörten lautstarke deutsche Befehle und das Jammern der Frauen, wenn die Türen unter der Gewalt nachgaben.
»Springen Sie über die Fensterbrüstung auf die Terrasse unterhalb unseres Schlafzimmers, da befindet sich die Feuertreppe.« Sie drückte Maxine die Umhängetasche in die Arme. »Da ist auch Geld drin.«
»Und das Motorrad?«
»Das ist ziemlich ramponiert, steht jedoch am vereinbarten Platz. Gehen Sie zuerst zum Castello, aber vergessen Sie nicht: Sie müssen in zehn Tagen in Montepulciano im Caffè Poliziano sein und sich mit Marco treffen. Seien Sie um zehn Uhr morgens dort.« Dann flüsterte sie ihr die neue Losung ins Ohr, und Maxine reckte den Daumen.
»Benzin?«, fragte sie.
»Ja. Los jetzt!«
Maxine warf sich Umhängetasche und Reisetasche über die Schulter und rannte zum Fenster. Dabei packte sie eine seltsame Erregung, die ihr kribbelnd in alle Glieder fuhr.
4
Castello de’ Corsi
Während Sofia den Abend mit ihrem Mann verbrachte, zog Carla, ihre Köchin, sich den Schal zurecht, um sich warm zu halten, und setzte sich in der Dunkelheit auf den Stuhl neben der Tür. Acht Frauen hatten sich heimlich im Haus ihrer Tochter versammelt, in einem der zwei kalten Zimmer im oberen Stock.
Da der dreijährige Alberto endlich eingeschlafen war, konnten die Frauen fleißig sein. Sara saß in der Ecke am Spinnrad, Federica wickelte die Wolle von der Spindel, und die übrigen saßen um den Tisch und strickten Socken und Decken. Eine Öllampe spendete Licht, und eine Decke am Fenster sorgte dafür, dass kein Schimmer durch die Lamellen der Läden nach außen drang.
Die Stricknadeln klapperten, das Rad schnurrte, und Sara stimmte leise ein Lied an. Weil sie allein waren, ihre Männer und Söhne am Krieg teilnahmen und keine von ihnen wusste, wo sie waren, empfanden sie diese gemeinsamen Abende als tröstlich. Das Stricken, das Zusammensitzen machte sie untereinander solidarisch, wenn sie sich trotz der Ausgangssperre zu dieser Arbeit trafen. Denn täten sie das nicht, würden die Männer in ihren Verstecken im Wald frieren, und der Winter würde hart werden.
Sobald der Waffenstillstand unterzeichnet worden war, hatten die Soldaten, die nicht mehr gegen die Alliierten kämpfen mussten, ihre Posten verlassen und ihr Leben riskiert, um heimzukehren. Doch dann besetzten die Deutschen Italien und wollten die Männer zu ihren Soldaten, ihren Arbeitern, ihren Sklaven machen, hier oder in Lagern in Deutschland.
Daher waren viele in die Wälder gezogen und hatten sich den Partisanen angeschlossen. Manche hatten nie auf deutscher Seite kämpfen wollen, waren aber zwangsweise eingezogen worden. Manche wollten auf gar keiner Seite kämpfen, und andere hatten schlichtweg genug vom Faschismus. Landarbeiter unterstützten in wachsender Zahl die kommunistische Bewegung, und so fand neben dem Weltkrieg auch ein Bürgerkrieg zwischen den Unterstützern der Faschisten und ihren Gegnern statt.
Carla schaute zu Anna hinüber, ihrer fünfundzwanzigjährigen Tochter. Ihre Älteste war groß und stark und auch schlank, im Gegensatz zu ihr selbst. Carla ging auf die fünfzig zu, und das sah man ihr an. Doch Luigi, Annas Mann, war schon tot, 1941 beim Untergang der Zara ertrunken. Er hatte an Einsätzen teilgenommen, die britische Konvois im Mittelmeer abfangen sollten, so teilte man ihr später mit. Die Zara, ein schwerer Kreuzer der Regia Marina, war durch einen britischen Luftangriff kampfunfähig geschossen und später in der Nacht bei einem schweren Gefecht von der britischen Mittelmeerflotte versenkt worden.
»Ist Gabriella auf dem Posten?«, fragte eine der nervöseren Frauen.
Carla sah ihre hübsche, kurvige, sechzehnjährige Tochter vor sich, die jetzt mit Beni, dem kleinen dreibeinigen Hund, in der Küche zusammengekauert vor dem Kamin saß, dem einzigen im Haus, in dem ein Feuer brannte. Gabriella hatte ihr in den Ohren gelegen, damit sie ihr erlaubte, Wache zu schieben, und weil sie so laut durch die Finger pfeifen konnte, dass es selbst Tote aufschreckte, hatte Carla nachgegeben.
»Hast du Nachricht von den Männern, Anna?«, fragte eine.
Die Frauen wussten, dass Anna eine Staffetta, eine Kurierin der Partisanen, war, auch wenn Carla und Anna kaum darüber redeten. Obwohl die Frauen des Dorfes miteinander befreundet waren, konnte man nie ganz sicher sein. Zum Beispiel bei Maria, der alten Klatschtante, die an der Ecke des Platzes wohnte, die, deren Enkel Paolo kürzlich weggezogen war, um Mussolinis Schwarzhemden beizutreten. »Freiwillige Miliz für die nationale Sicherheit« nannten die sich.
Niemand wusste mehr, wo Paolo jetzt war. Zu Beginn des Krieges meldeten sich viele Männer zum Militärdienst, und die Leute akzeptierten die Einberufung mehr oder weniger, aber die Brutalität der faschistischen Schwarzhemden gegen das eigene Volk stieß auf Ablehnung. Sie wurden vom Großteil der toskanischen Landbevölkerung verabscheut.
»Keine«, antwortete Carla, bevor Anna etwas sagen konnte, und dämpfte ihre raue Stimme.
»Wen hasst ihr mehr?«, wollte Federica wissen. »Die Deutschen oder die Schwarzhemden?«
Für ein paar Augenblicke wurde es still.
»Die Schwarzhemden«, antwortete Sara. »Ich habe sie in der Stadt gesehen. Sie stoßen jeden in die Gosse, den sie nicht leiden können. Sogar schwangere Frauen. Ob alt oder jung, das ist ihnen ganz egal.«
»Sie denken, sie können tun und lassen, was sie wollen.«
»Weil sie das tatsächlich können. Aber ich sage euch, die schlimmste Seite der Nazis haben wir noch gar nicht kennengelernt.«
Während die Frauen flüsterten, richteten sich Carlas Gedanken wie so oft aufs Essen. Sie wollte am nächsten Morgen Pilze sammeln gehen für ein Kastanien-Risotto. In den mageren Zeiten hielt sich die Landbevölkerung auch mit wilden Zwiebeln, Kräutern und Beeren über Wasser. Und ihr Sohn Aldo würde in ein paar Stunden aufbrechen, um ein Wildschwein zu erlegen, von denen es allerdings nicht mehr viele gab.
Es klopfte laut an der Haustür, dann ertönte ein durchdringender Pfiff.
»Rasch, löscht die Lampe«, zischte eine.
Carla spürte die Angst der Frauen, während sie im Stockdunkeln saßen und lauschten. Mit trockenem Mund und zugeschnürter Kehle hörten sie barsche Männerstimmen von der Straße. Zweifellos Schwarzhemden, die sich vergnügen wollten, denn die Deutschen trauten sich nachts nicht in die Gassen toskanischer Dörfer.
Aber wenn Schwarzhemden ins Haus drangen und jemanden erwischten, der Partisanen unterstützte …
Carla hörte die Haustür aufgehen und ins Schloss fallen, danach von draußen lautes Männerlachen, dem das Lachen einer Frau folgte. Gabriella? Sicher nicht.
5
Ein paar Tage waren vergangen, und Sofia verabschiedete sich von Lorenzo, da er wahrscheinlich für einige Nächte fort sein würde, dann pfiff sie die Hunde herbei – zwei hübsche braun-weiße Italienische Pointer, auch »Bracco Italiano« genannt, die für die Jagd jedoch schon zu alt waren.
Gerade hatten sie erfahren, dass das alte Chiusi, ein Dorf an der Grenze zu Umbrien, von den Alliierten bombardiert worden war, und das löste Untergangsgefühle aus, die sich nicht abschütteln ließen. Es lag über fünfzig Kilometer weiter südlich, aber trotzdem.
Es war kalt, der Himmel klar und so hell, dass einem die Augen wehtaten. Der Boden knirschte unter Sofias Sohlen, als sie die Dorfmauer und die zankenden Tauben hinter sich ließ und dem kurvigen Weg in den Wald folgte. Ein weißes Nebelmeer verdeckte die Sicht ins Tal, sodass die Hügelkuppen wie bewaldete Inseln erschienen.
In den Kastanienwäldern wurde zurzeit geerntet. Die Zweige bogen sich unter den reifen Früchten, die jetzt ein Hauptnahrungsmittel waren. Die Frauen trockneten sie und mahlten sie zu Mehl, um daraus mit Wasser und Hefe pane d’albero zu backen, Baumbrot. Und sie rösteten sie und mengten sie in den Gerstenkaffee, um ihm mehr Aroma zu geben. Caffè d’orzo. Sofia schmeckte er besser als Kaffee aus Zichorien.
Niemand hatte mehr echten Kaffee im Haus, seit die Regierung die Einfuhr nach Kräften verhinderte, doch manche behaupteten, der Kaffee sei durch das Völkerbundembargo knapp geworden. Aber wie auch immer, das Kastanienlaub wurde an die Schweine und Hühner verfüttert, die wenigen, die es noch gab.
Carla und sie hatten einen Teil ihrer Vorräte versteckt, nicht nur für sich selbst, sondern auch, um den Dorfbewohnern notfalls auszuhelfen, hielten das jedoch geheim.
Nachdem Sofia den Brief vom Ortskommandanten bekommen hatte, hatte sie Aldo gebeten, hinten in der großen Vorratskammer eine dünne Wand einzuziehen. Seit er von der Schule abgegangen war, erledigte er Gelegenheitsarbeiten für sie. Und nun lagerten hinter der Wand getrocknete Bohnen, eingemachtes Obst, Salami und Käse, Dörrfleisch und Getreide. Sollten deutsche Soldaten bei ihnen einquartiert werden, würden sie ihnen nicht alles wegessen können.
Sofia dachte an ihre Einmachwoche im Sommer, der einzigen Zeit, da Carla ihr erlaubte, in der Küche mitzuhelfen, zusammen mit ihren Töchtern Anna und Gabriella. Für Sofia war das eine Gelegenheit, mit anzupacken. Und wie könnte sie das besser tun, als Nahrungsmittel für sie alle herzustellen? Ihre gesellschaftliche Stellung war dann aufgehoben, und durch die Arbeit wurde sie eine der Ihren.
Zwar blieb sie in der übrigen Zeit die »Contessa« und tat ihr Bestes, um die Rolle auszufüllen, aber sie liebte es, auch mal ihre Zurückhaltung aufzugeben. Sie freute sich an der Kameradschaft, wenn sie Feigen, Pfirsiche, Kirschen und Tomaten zum Einkochen vorbereiteten.
Lorenzo wusste davon nichts. Er entstammte dem alten Landadel und war mit der Überzeugung groß geworden, dass jeder seinen Platz in der Gesellschaft zu kennen hatte. Obwohl er nicht auf Förmlichkeiten bestand und außerdem ein durch und durch guter Mensch war, hatte er ein bisschen mehr Standesbewusstsein als sie. Da sie nicht zur Adligen erzogen worden war, empfand sie anders.
Sie hatten auch Paprikaschoten, Möhren und Kohl eingemacht, in einer Küche voller Dampf, leuchtender Farben und satter Gerüche, und während dieser paar Tage lachten und sangen sie und vergaßen beinahe, dass Krieg herrschte.
Als sie nun den Kastanienwald erreichte, war die Ernte schon im Gange. Da die Männer fort waren, mussten die Frauen mit der Hilfe der Greise und der Jungen die harten Arbeiten verrichten.
Sara, eine der Bauersfrauen, winkte sie heran und fragte, ob sie wohl einen Sack Kastanien für Carla zum Haus hinaufbringen würde. Sofia kannte die Frau gut. Sie hatte zwei Briefe erhalten, in denen ihr mitgeteilt wurde, dass ein Bruder und ein Sohn gefallen waren. Saras Schmerz war unvorstellbar, und dennoch arbeitete sie weiter. Manchmal hat es Vorteile, kinderlos zu sein, dachte Sofia bitter. Dann drückte sie kurz Saras Hand, nahm den Sack und ging.
Wieder oben am Castello, schlüpfte sie an der Seite des Hauses vorbei und ging durch den Teil des Gartens, der mit Zitronenbäumen und Oleanderbüschen gesäumt war, zur Küchentür, neben der ein kleiner Granatapfelbaum wuchs. Dort empfing sie der Duft von frisch gebackenem Brot. Gewöhnlich betrat sie die Küche nicht vom Garten aus, tat das inzwischen aber häufiger, da sie sich um die Gemüsebeete kümmerte, um Kohl, Zwiebeln, Spinat und Fenchel.
Carla kam ihr schon seit ein paar Tagen unruhig vor, doch vielleicht würde der neue Vorrat Kastanien sie aufmuntern.
Die Küche, die von Anfang an entspannend und tröstlich auf Sofia gewirkt hatte, war ein großer, hoher Raum mit Eichenbalken unter der Decke, alten Steinfliesen, hellgrünen Schränken und einem großen gescheuerten Tisch in der Mitte. Zwei lederbezogene Lehnstühle standen in den beiden Nischen rechts und links des Herdes, und da die Läden nicht ganz geöffnet waren, sah sie nicht gleich, dass dort jemand saß.
Carla stand mit finsterem Gesicht neben dem Herd, die Haare zusammengebunden, die gewohnte weiße Schürze über ihrem formlosen grauen Wollkleid.
Da auf dem Bord über dem Backofen ein Klumpen Teig zum Aufgehen ruhte, vermutete Sofia, dass die Köchin darauf brannte, ihn durchzukneten. Sie war eine große Frau, die ihre Haltung ohne viel Worte deutlich machte. Ihre verschränkten Arme sagten alles, und auf Sofias fragenden Blick rollte sie nur die Augen.
Derweil stand Aldo neben der Tür und kratzte sich am Kopf. »Ich habe ihn draußen vor dem Dorf in dem Holzschuppen gefunden. Er hat nur ›Castello‹ gesagt und dann sinnloses Zeug gebrabbelt, bevor er ohnmächtig wurde.«
»›Castello‹? Wir? Er meinte uns?«
Carla rümpfte die Nase. »Wen sonst?«
Sofia sah Aldo an und dachte wie so oft in letzter Zeit, dass er sich zu einem wahren Herzensbrecher gemausert hatte. Ein gut aussehender Bursche mit schwarzen Augen, langen Wimpern, vollen Lippen und dunklen Brauen. Er war auch zupackend und fröhlich, und Sofia fühlte sich neu beschwingt, wann immer sie ihn sah.
Er strich sich die braunen Locken aus der Stirn. »Ich dachte, er kann nur unser Dorf meinen.«
Sofia ging zu dem Mann, um sich sein Gesicht näher anzusehen. Die Hunde liefen einen Schritt vor ihr her und beschnupperten ihn eingehend, verloren aber das Interesse, weil er nicht auf sie einging, und trotteten weg.
Der Mann hielt die Augen geschlossen, seine Haare waren verfilzt, die rechte Wange rings um eine Wunde feuerrot und geschwollen. Dann bemerkte Sofia seine blutgetränkte Jacke. Als sie ihn nach seinem Namen fragte, flatterten seine Lider, und dann blickte sie in die blauesten Augen, die sie je gesehen hatte.
»Wer sind Sie?«, fragte sie noch einmal.
Er griff sich an die Kehle.
»Wasser, Carla. Holen Sie ihm Wasser.«
Widerwillig füllte die Köchin ein Glas und hielt es ihm an die rissigen Lippen. Während er schluckte, schoss Sofia ein Gedanke durch den Kopf. Was, wenn er ein deutscher Deserteur war? Doch dann überraschte er sie mit einer Antwort in akzentfreiem Englisch.
»James«, sagte er schwach. »Mein Name.«
»Können Sie uns erzählen, was Ihnen passiert ist?«
Seine Lider sanken herab. War er eingeschlafen?
»Er ist Engländer«, erklärte sie Carla.
»Das hat uns noch gefehlt. Wie gesagt, er hat nur unverständliches Zeug gemurmelt, als Aldo ihn hinter dem hohen Stapel im Holzschuppen fand. Es klang nicht nach Deutsch, meinte Aldo, aber er war sich nicht sicher.«
»Er braucht einen Arzt.«
Carla verzog das Gesicht.
»Ich weiß, ich weiß.«
Die Köchin blickte Sofia stur an, lenkte dann jedoch ein. »Ich denke, wir können ihn erst mal in Gabriellas Zimmer legen. Und sie kann bei mir schlafen. Die Tür lässt sich abschließen, sodass er keinem von uns etwas tun kann. Aldo wird wie immer bei Anna schlafen. Sie ist froh, nicht allein zu sein.«
Sofia lächelte sie verständnisvoll an. Zu Anfang hatte Carla als Frau eines Bauern den eigenen Haushalt geführt, war aber später jeden Tag ins Herrenhaus gekommen, um für sie zu kochen. Als Carlas Mann, Enrico, krank wurde und nicht mehr arbeiten konnte, nahm Sofia sie auf und gab ihnen vier ansehnlich große Zimmer, eines im Erdgeschoss, das Gabriella gehörte, und drei im ersten Stock des teilweise ungenutzten Seitenflügels, der eine eigene Treppe hatte.
Dort hatte vorher die Haushälterin gewohnt, doch die hatte geheiratet und war ins Dorf gezogen, sodass die Zimmer dann leer standen. Natürlich brachte Carla damals ihre drei Kinder mit, und jetzt arbeitete Anna stundenweise als Haushälterin, wohnte jedoch woanders.
Enrico war ein großer, leutseliger Mann gewesen, der es nicht verdient hatte, so jung zu sterben. Ein Jahr lang war er damals krank gewesen, und Sofia hatte geholfen, ihn zu pflegen. Danach überschüttete sie, weil sie selbst keine hatte, Carlas Kinder mit ihren mütterlichen Gefühlen, besonders Aldo, den der Tod seines Vaters sehr mitgenommen hatte.
Trotz ihrer manchmal barschen Art war Carla eine freundliche, großzügige Seele, die sich auch mal ungezwungen geben konnte, wenn sie wollte. Sofia kamen Erinnerungen an ihr Festessen im September in den Sinn. Lorenzo und sie hatten kräftig mit angepackt, bevor die schwarzen Regenwolken übers Land gezogen waren, und am Ende der Woche hatten sie sich erschöpft und mit schmerzenden Gliedern von der Traubenernte in ihr Haus zurückgeschleppt.
Aldo in seinem leuchtend weißen Hemd, das seine schöne braune Haut hervorhob, deckte die Tische im Hof mit den blau karierten Tischdecken, die Carla gewaschen und gebügelt hatte. In dem Monat, das war kurz bevor die Deutschen kamen, hatten sie noch reichlich Schinken, Mortadella, Salami und Schafskäse zu ihrem Brot und Wein.
Als jemand anfing, Geige zu spielen, fiel die Müdigkeit von ihnen allen ab, und sie tanzten unter dem sternenklaren Himmel. Sogar Lorenzo. Strahlend vor Freude, Ausgelassenheit und Liebe, drehte und wirbelte er sie herum, bis ihr schwindlig wurde. Carla lachte lauter und freier denn je und tanzte länger als alle anderen. Schließlich musste Aldo sie von der Tanzfläche schleifen, aber sein sanfter Charme genügte, um sie zur Vernunft zu bringen und ins Haus zu geleiten.
Sofia löste sich von den Erinnerungen, um sich wieder dem Mann im Lehnstuhl zuzuwenden. »Er macht mir nicht den Eindruck, als könnte er gegen jemanden Gewalt anwenden oder auch nur irgendwohin gehen.«
In Gedanken wog sie die Möglichkeiten ab, sah jedoch, dass er ohne Hilfe vermutlich sterben würde. Lorenzo würde erst in ein paar Tagen von Florenz zurückkommen. Wenn sie also einen Platz für den Mann fänden, wo er in den nächsten achtundvierzig Stunden bleiben konnte, sollte es gut gehen. Sie wollte Lorenzo nicht in die Sache hineinziehen. Er hatte schon genug zu tragen und würde ihr Tun vielleicht auch nicht billigen.
Carla lächelte sie schief an.
»Sind Sie wirklich bereit, Gabriellas Zimmer herzugeben?«
Carla nickte. »Aldo wird helfen, ihn in das Bett zu legen, nicht wahr, mein Sohn?«
Der Junge nickte. Sofia musterte den Fremden von Neuem. Seine Haare waren zwar schmutzig, aber so blond, dass man ihn für einen Deutschen halten konnte. Groß genug war er auch. Seltsam, wie großgewachsen die alle waren. Ein Volk von Riesen. Andererseits, wenn er wirklich Engländer war und kein Deutscher, war er vielleicht ein geflohener Kriegsgefangener.
Er sah verloren aus. Woher war er gekommen? Hatte er Familie? Eine Frau? Kinder? Sie kam nicht umhin, diesen gut gebauten Mann mit ihrem großen, schmalen, aristokratischen Ehemann zu vergleichen. Seine Kleidung war unauffällig und stark verschmutzt, die Farben waren kaum zu erkennen, aber die Jacke schien grau und die Hose dunkelgrün zu sein.
Als sie die Jacke mit spitzen Fingern aufknöpfte, kam darunter ein blutdurchtränktes Hemd zum Vorschein. Er hatte so viel Blut verloren, dass Sofia erschrocken aufkeuchte.
Sie schritt sofort zur Tat und erklärte, was zu tun war. Carla schnalzte mit der Zunge und brummte skeptisch, doch Aldo, obwohl erst siebzehn und kein muskulöser Typ, hatte viel Kraft, und zu dritt schafften sie es, den stöhnenden Mann durch den großen Flur und in das seitlich gelegene Zimmer zu schleppen.
Carla nahm Gabriellas Bettzeug weg und breitete auf der Matratze eine alte Decke aus, dann legten Aldo und Sofia den Mann aufs Bett. Der stöhnte, öffnete die Augen aber nicht.
»Wird Gabriella damit einverstanden sein?«
Es verwirrte Sofia, dass Carla keine Antwort gab, sondern zu Boden sah. Dafür schenkte Aldo ihr sein süßes, entschuldigendes Lächeln, mit dem er sich als Kind vor Schelte bewahrt hatte. Wie kraftvoll das Leben in seinen dunklen Augen leuchtet!, dachte sie. Schon immer. Dann sah sie, wie er Carla anstupste.
»Erzähl der Contessa, was passiert ist«, sagte er. »Los.«
Sofia schaute zwischen den beiden hin und her. »Was denn?«
»Es geht um Gabriella«, erklärte er betroffen und besorgt. »Wir glauben, dass sie eine Stunde mit einem der Schwarzhemden zusammen war, die neulich die Frauen in Annas Haus aufgeschreckt haben.«
Carla blickte auf und sah Sofia an, als träfe sie eine Entscheidung, bevor sie sich dazu äußerte. »Das ist jetzt nicht der richtige Moment dafür.«
»Gut, dann erzählen Sie es mir später, und jetzt holen Sie mir eine Schüssel mit heißem Wasser, bitte, und ein paar saubere Lappen.« Sofia kniete sich neben das Bett. »Aldo, kannst du mir helfen, ihn auszuziehen?«
»Contessa!«, rief Carla aus.
Sofia drehte den Kopf nach ihr. »Seien Sie doch nicht so puritanisch. Ich will bloß wissen, wo er verwundet ist.« Carla war trotzdem entsetzt, dass ihre Herrin das Entkleiden übernahm, und Sofia musste lachen.