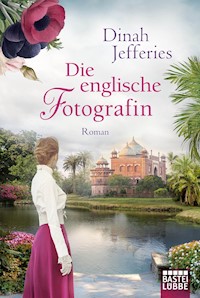
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Indien, 1930. Als die junge Fotografin Eliza im Auftrag der britischen Krone nach Indien entsandt wird, um die Familie des Maharadscha von Rajputana zu porträtieren, kann sie ihr Glück kaum fassen. Nach dem freundlichen Empfang holt sie jedoch bald die Wirklichkeit ein. Intrigen und Streitigkeiten im Palast halten sie auf Abstand, ihr einziger Lichtblick ist Jay, der Bruder des Fürsten. Trotz ihrer unterschiedlichen Herkunft fühlen Eliza und Jay sich zueinander hingezogen. Doch diese Liebe darf nicht sein. Denn Jay ist einer indischen Prinzessin versprochen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Dinah Jefferies
Die englische Fotografin
Roman
Übersetzung aus dem Englischen von Andrea Koonen
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der englischen Originalausgabe:
»Before the Rains«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2017 by Dinah Jefferies
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau Unter Verwendung von Motiven von © Ildiko Neer/Arcangel, © Anemone: Simple, from ›Les Choix des Plus Belles Fleurs‹, Redouté, Pierre-Joseph (1759-1840) / Lindley Library, RHS, London, UK/Bridgeman Images und © shutterstock: Rostislav Glinsky | Franck Boston | valipatov | Lev Kropotov | Somboon Bunproy | V. S. Anandhakrishna | gan chaonan
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-5582-6
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Richard
Delhi, 23. Dezember 1912
Anna Fraser wartete auf dem Balkon eines der vielen Havelis entlang der Route, die der Zug des Vizekönigs nehmen würde. Es war elf Uhr am Vormittag. Die Straßen waren gereinigt und mit Öl besprüht, und dennoch reizte vom Wind aufgewirbelter Staub die Augen der versammelten Menschen. Die ausladenden Neem- und Peepalbäume in der Mitte des alten Chandni Chowk rauschten wie zum Hohn, und hoch über den Gassen, die von dem Platz abgingen, krächzten Krähen.
Anna hielt ihren weißen Schirm über sich und schaute vom Balkon des prächtig ausgestalteten Wohnhauses unruhig zu den Ständen der Händler hinunter. Dort gab es alles Mögliche zu kaufen, Speiseeis und Bratfisch mit Chili, exotische Früchte, Chiffonsaris, Bücher und Schmuck, und hinter hübsch vergitterten Fenstern saßen Frauen mit schwindendem Augenlicht und bestickten zarte Seidenschals. Wo der Geruch von Sandelholz durch die Luft zog, verdienten Apotheker ein Vermögen an Ölen und Tränken in eigentümlichen Farben. »Schlangenöl« nannte David sie, obwohl manche, wie Anna gehört hatte, aus zerdrückten Eidechsen gewonnen wurden und die Farbe von Granatäpfeln stammte. Am Chandni Chowk bekommt man alles, was das Herz begehrt, so hieß es.
Was das Herz begehrt? Welche Ironie!, dachte sie.
Sie wandte den Blick zu der Stelle, wo der Vizekönig bald erscheinen musste, auf einem Elefanten und in Begleitung seiner Gemahlin. David hatte ihr mit stolzgeschwellter Brust erzählt, er werde als der stellvertretende Distriktleiter ebenfalls auf einem Elefanten reiten, einem der dreiundfünfzig des Zuges, und zwar unmittelbar hinter dem Vizekönig. Delhi sollte Kalkutta als Regierungssitz ablösen, und dies war der Tag, da der Vizekönig Lord Hardinge die Ankündigung wahrmachte, indem er vom Hauptbahnhof an der Queen’s Road aus prunkvollen Einzug in die alte ummauerte Stadt hielt.
Anna hörte unten die Kanarienvögel und Nachtigallen singen, die in unzähligen Käfigen die Ladenfronten zierten, und weiter entfernt das schrille Geräusch einer elektrischen Straßenbahn. Dann schaute sie wieder auf das Meer orientalischer Farben hinunter, wo sich immer mehr Menschen einfanden. Schließlich rief sie ihre Tochter Eliza.
»Komm jetzt, mein Engel. Sie werden gleich hier sein.«
Eliza hatte gelesen, um sich die Zeit zu vertreiben, und eilte nun auf den Balkon. »Wo? Wo?«
»So zappelig? Schon wieder? Du musst Geduld haben«, sagte Anna und sah erneut auf ihre Uhr. Halb zwölf.
Eliza schüttelte den Kopf. Sie war so aufgeregt wie noch nie und wartete nun schon so lange. Da fiel es schwer, Geduld zu haben, zumal mit zehn Jahren. »Es muss doch fast so weit sein«, sagte sie.
Anna seufzte. »Sieh dich an. Dein Kleid ist schon verknittert.«
Eliza schaute an ihrem rüschenbesetzten weißen Kleid hinab, das eigens für diesen Tag genäht worden war. Sie war äußerst behutsam damit umgegangen, doch Kleider und sie vertrugen sich schlecht. Sie versuchte durchaus, sie sauber zu halten, aber es gab ständig etwas Interessantes zu tun. Zum Glück nahm ihr Vater es nie übel, wenn sie sich schmutzig machte. Er war ihr Ein und Alles, ein stattlicher, lustiger Mann, der immer eine herzliche Umarmung für sie hatte und vom Grund seiner Hemdtasche ein Bonbon hervorzaubern konnte.
Die Briten, die entlang der Straße hinter den Einheimischen auf Tribünen saßen, wirkten in ihrer hellen Baumwoll- und Leinenkleidung vergleichsweise blass. Von den Indern sahen trotz des prächtigen Wetters viele lustlos aus, wie Anna fand. Das mochte aber an dem bitterkalten Wind liegen, der vom Himalaya her wehte. Wenigstens strahlten die Briten angemessene Freude aus. Anna rümpfte die Nase, weil es von unten nach Ingwer und Butterschmalz roch, und trommelte mit den Fingern auf der Balkonbrüstung. David hatte ihr so viel versprochen, als er vorgeschlagen hatte, sie solle mit ihm nach Indien gehen, aber jedes Jahr war der Zauber des Landes schaler geworden. Unten machten sich die ersten zappeligen Kinder von ihren Eltern los. Ein sehr kleiner Junge war zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurch auf die Straße gelaufen, wo der Zug seinen Weg zur Festung nehmen würde.
Anna versuchte, die Mutter des Jungen auszumachen. Wie unachtsam, ein so kleines Kind von der Hand zu lassen, dachte sie. Sie entdeckte eine Frau in einem smaragdgrünen Rock und passendem Schal, die gedankenverloren zum Balkon hinaufstarrte, und Anna kam der Gedanke, sie könnte die Mutter sein. Fast schien es, als schaute die Frau zu ihr, und als sich ihre Blicke tatsächlich trafen, zeigte Anna auf die Straße, um sie auf das Kind aufmerksam zu machen. Just in dem Moment senkte die Frau den Kopf, bemerkte ihren Jungen und holte ihn zurück.
Während Anna die heranströmenden Menschen beobachtete, war sie froh, oben auf dem Balkon zu stehen, ohne Berührung mit den zahnlosen, alten, verschleierten Weibern, den einsamen Bettlern in fadenscheinigen Decken, den Straßenhändlern und ihren Kindern und den in Schals gehüllten Anwohnerinnen, die sich allesamt anzuschreien schienen. Katzen streiften die Straße entlang und reckten den Kopf nach den vielen Tauben im Geäst der Bäume. Selbstgefällige Männer mittleren Alters warfen ab und zu Blicke auf die sogenannten Tanzmädchen, und irgendwo sangen Kinder, was Annas Stimmung ein wenig hob.
Sie kam nicht umhin, die Vergangenheit des Landes wahrzunehmen, von der jeder Zoll des historischen Platzes durchdrungen war. Hier hatten bekanntlich die Triumphzüge der Mogulkaiser stattgefunden, hier hatten die Mogulfürsten auf ihren tanzenden Pferden paradiert und die Briten ihre Pläne für ein mächtiges, neues, glanzvolles Delhi ausgestellt. Seit der König vor einem Jahr nach Delhi gekommen war, hatte der Frieden obsiegt, ganz ohne politische Morde. Deshalb war es unnötig erschienen, für den heutigen Tag besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.
Anna hörte die Salutschüsse, die die Ankunft des Vizekönigs verkündeten. Die Kanonen feuerten zum zweiten Mal, und von der Menschenmenge stieg tosender Stimmenlärm auf. Nun lehnten sich die Leute aus den Fenstern und von den Balkonen und drehten den Kopf nach dem Kanonendonner. Anna durchfuhr ein unerklärliches Gefühl, eine dunkle Vorahnung, sollte sie hinterher denken, doch in dem Moment schüttelte sie nur den Kopf. Nach einem erneuten Blick auf die Uhr sah sie endlich einen ungeheuer großen Elefanten die Straße entlangkommen. In dem prächtigen silbernen Howdah auf dem Rücken des Tieres saßen Lord Hardinge und seine Frau. Der Elefant war nach traditioneller Art farbenprächtig geschmückt, mit bunten Mustern bemalt und einem Prunkgeschirr aus Samt und Gold versehen. Die Queen’s Gardens, wo sich kein Publikum hatte aufstellen dürfen, hatte der Zug bereits durchquert. Jetzt, da er in den Chandni Chowk einbog, steigerte sich der Jubel.
»Ich kann Daddy noch nicht sehen«, rief Eliza über den Lärm hinweg. »Er ist aber doch dabei?«
»Meine Güte, bist du denn das ungeduldigste Kind von allen?«
Eliza schaute zur Straße hinab, wo überall Mädchen und Jungen versuchten, sich in die vorderste Reihe zu drängen. »Bin ich nicht. Schau dir die dort unten an, und ihre Väter reiten nicht mal in dem Festzug mit.«
Eine Hand um das Balkongitter geklammert, beugte sie sich so weit hinaus, wie sie es eben wagte, und hüpfte dabei vor Aufregung, und als die lange Reihe Elefanten nach und nach in Sicht kam, konnte sie ihre Freude nicht mehr für sich behalten.
»Sei vorsichtig«, mahnte ihre Mutter. »Wenn du weiter so hüpfst, wirst du noch hinunterfallen.«
Hinter dem Vizekönig ritten zwei ausgewählte Distriktbeamte, hinter diesen, auf noch kunstvoller geschmückten Elefanten, die Fürsten von Rajputana und die Oberhäupter des Punjab, umgeben von den eigenen heimischen Soldaten, die Säbel und Lanzen und die übliche zeremonielle Rüstung trugen. Diesen wiederum folgte die übrige britische Regierung auf schlichter ausstaffierten Elefanten. Eliza kannte die Reihenfolge auswendig. Ihr Vater hatte ihr den Ablauf des Einzugs in die Stadt in allen Einzelheiten erklärt, und sie hatte beharrlich gebettelt, er solle kurz anhalten, um zu ihr hochzuschauen und zu winken, wenn er mit seinem Elefanten an ihrem Balkon vorbeizog. Der Wind hatte sich gelegt, die Sonne war herausgekommen. Es war doch noch ein sehr schöner Vormittag geworden. Und nun war der Augenblick endlich da.
Anna schaute auf die Uhr. Viertel vor zwölf. Auf die Minute. Auf der anderen Straßenseite hielt die Frau im grünen Rock ihr Söhnchen jetzt auf dem Arm, damit es etwas sehen konnte. So ist es besser, dachte Anna.
Unter den Briten brach lauter Jubel aus, man rief »Hurra!« und »Gott schütze den König!«.
Während Lord Hardinge nach beiden Seiten grüßte, entdeckte Eliza ihren Vater. Sie winkte freudig, und als der Elefant des Vizekönigs wieder ein paar Schritte voranging, hielt David Fraser sein Tier an, damit er seiner Tochter den Wunsch erfüllen konnte. Gerade als er zu ihrem Balkon heraufblickte, gab es einen lauten Knall wie von einem Kanonenschuss, der die Hauswände erzittern ließ. Die Menschen verstummten, die Prozession kam zum Stehen. Anna und Eliza starrten erschrocken hin, als Splitter durch die Luft sausten und weißer Rauch aufquoll. Eliza rieb sich die tränenden Augen und sprang vom Geländer weg. Sie konnte nicht sehen, was passiert war, doch sowie sich der Rauch ein wenig verzog, hörte sie ihre Mutter erschrocken Luft holen.
»Mummy, was ist denn?«, fragte Eliza drängend. »Was ist passiert?«
Keine Antwort.
»Mummy!«
Doch ihre Mutter schien sie nicht zu hören. Eliza war ratlos. Da war etwas durch die Luft geflogen, mehr wusste sie nicht. Verwirrt schaute sie zu den entsetzten Leuten hinunter. Warum gab ihre Mutter keine Antwort? Sie zupfte sie am Ärmel und bemerkte, dass sie sich mit aller Kraft am Geländer festhielt.
Unten waren alle auf die Straße gelaufen, und durch die Staubschleier sah Eliza Soldaten zum Vizekönig rennen. Ein stechender Geruch stieg ihr in die Nase, der das Atmen schwer machte. Sie hustete, und dann zog sie erneut ihre Mutter am Ärmel.
»Mummy!« Sie kreischte jetzt.
Doch ihre Mutter starrte kreidebleich und mit großen Augen vor sich hin und war wie versteinert.
In einem sonderbaren Zustand der Leblosigkeit nahm Anna lediglich wahr, dass die Frau in Grün ohnmächtig geworden war. Eliza sah sie auch, verstand aber nicht, warum ihre Mutter in einem fort auf die Frau zeigte. Stattdessen spürte sie ein entsetzliches Gefühl im Magen und den Drang zu weinen.
»Daddy ist nichts passiert, oder, Mummy?«
Endlich wurde Anna auf ihre Tochter aufmerksam. »Ich weiß es nicht, mein Engel.«
Und obwohl es schien, als hätte sie nur Augen für die Frau auf der anderen Straßenseite, hatte Anna ihren Mann in seinem Howdah taumeln und nach vorn rucken sehen. Einen Moment lang schien er sich aufzurichten und Eliza anzulächeln, dann aber sackte er in sich zusammen und rührte sich nicht mehr. Der Diener, der den Schirm über den Vizekönig gehalten hatte, war zur Seite gekippt und hing halb in den Seilen des Elefantensitzes.
In der Zwischenzeit war Eliza nur zu einem Gedanken fähig: Ihrem Vater war nichts passiert. Ihm durfte nichts passiert sein! Plötzlich wusste sie, was sie tun musste. Sie ließ ihre Mutter auf dem Balkon zurück und rannte die Treppen hinunter nach draußen, wo sie mit einem indischen Jungen zusammenstieß. Er war vielleicht ein bisschen älter als sie. Ungläubig und nach Worten ringend, blickte sie ihn an. »Mein Vater«, wisperte sie.
Der Junge nahm sie bei der Hand. »Bleib da weg. Du kannst nichts tun.«
Eliza wollte ihren Vater unbedingt sehen. Sie machte sich von dem Jungen los und drängte sich durch die Menschenmenge. Als sie ins Freie brach, hielt sie entsetzt inne. Der Elefant war so verschreckt, dass er sich weigerte, auf die Knie zu gehen. Eliza sah tief bestürzt zu, wie von einem nahen Laden eine Packkiste herbeigeholt und eine Leiter darauf zurechtgerückt wurde, damit man ihren Vater herunterheben konnte. Nachdem das geschehen war, legte man ihn auf den Boden. Auf den ersten Blick wirkte er unverletzt, obwohl sein Gesicht kreidebleich und seine Augen weit aufgerissen waren. Eliza stolperte über ihre Füße und fiel beinahe, als sie zu ihm rannte. Tief entsetzt fiel sie neben ihm auf die Knie und schlang die Arme um ihn. Ihr Kleid saugte sich mit dem Blut voll, das jetzt aus seiner Brust quoll, aus der Brust des einen Menschen auf der Welt, den sie über alles liebte.
»Ich fürchte, er hatte keine Chance, der arme Kerl«, sagte jemand. »Schrauben, Nägel, Grammofonnadeln, Glasscherben. Das haben die Bastarde offenbar in die Bombe gepackt. Ihm ist etwas in die Brust gedrungen. Fast ein Glücksfall, würde ich sagen, denn so musste er wenigstens nicht mehr lange leiden. Aber wir werden diese sogenannten Freiheitskämpfer schnappen, und wenn wir dafür den ganzen Chandni Chowk abreißen müssen.«
Eliza hielt ihren Vater an sich gedrückt und flüsterte ihm ins Ohr: »Ich hab dich lieb, Daddy.« Und von da an sollte sie sich immer wieder sagen, er habe sie noch gehört.
Durch das Raunen der Umstehenden drang die freundliche Stimme des indischen Jungen zu ihr. »Bitte, Miss, lassen Sie sich aufhelfen. Er ist tot.«
Als Eliza zu ihm aufblickte, kam ihr alles unwirklich vor.
ERSTER TEIL
Im Traum und weit entfernt von uns gehört Indien zum alten Orient unserer Seele.
André Malraux, Anti-Memoiren, 1967
1
Fürstenstaat Juraipur in RajputanaNovember 1930
Eliza erhaschte einen Blick auf die Fassade des Palastes und war verblüfft, wie stark sie flimmerte – wie ein Trugbild, beschworen aus dem Dunst der Wüste, fremd und ein bisschen Furcht einflößend. Der Wind legte sich kurz und frischte wieder auf, und für einen Moment schloss sie die Augen, um diesen flimmernden Auswuchs des Sandes auszublenden. So fern von daheim sie auch war und sowenig sie erahnen konnte, wie sich die Dinge entwickeln würden, es gab kein Zurück, und Eliza fühlte die Angst in der Magengrube. Sie war jetzt achtundzwanzig und dies ihr größter Auftrag, seit sie sich als Fotografin betätigte, auch wenn ihr noch unklar war, warum Clifford Salter sie ausgewählt hatte. Allerdings hatte er erklärt, sie sei eventuell die bessere Wahl, um die Frauen des Palastes zu fotografieren, da diese Fremden, insbesondere Männern gegenüber nervös seien. Und der Vizekönig habe ausdrücklich um einen britischen Fotografen gebeten, weil er einem Loyalitätskonflikt vorbeugen wollte. Eliza sollte monatlich bezahlt werden und bei erfolgreichem Abschluss eine Pauschalsumme erhalten.
Sie öffnete die Augen in der staubigen Luft und der vom Sand gleißenden Helligkeit. Der Palast war wieder hinter Sandschleiern verborgen und der endlos blaue Himmel über ihr gnadenlos in seiner Hitze. Ihr Begleiter auf dem Kutschbock drehte sich um und sagte, sie solle sich beeilen. Eliza stieg zurück in seinen Kamelkarren, den Kopf gegen den stechenden Flugsand gesenkt und die Fototasche an die Brust gedrückt. Ihr kostbarer Apparat durfte auf keinen Fall Schaden nehmen.
Nachdem sie ihrem Bestimmungsort ein Stück näher gekommen waren, schaute sie unter der Plane hervor und sah eine Festung auf einem Berg liegen, ein Bild wie aus einem Traum. Mindestens hundert Vögel kreisten an einem lila Horizont, und darüber bildeten rosa Wolkenstreifen ein zartes Muster. Von der Hitze halb betäubt, musste Eliza sich zusammennehmen, um dem Zauber nicht zu erliegen. Schließlich war sie zum Arbeiten hier. Aber sie war ohnehin nicht ganz bei der Sache. Entweder erinnerte sie der starke Wind an die ferne schmerzliche Vergangenheit, oder sie dachte an die jüngeren Ereignisse, die zu der Reise geführt hatten.
Ihre Mutter hatte mit Clifford, einem reichen Patensohn, kürzlich Kontakt aufgenommen, weil er mit seinen Verbindungen ihrer Tochter sicherlich eine Stellung in einer Anwaltskanzlei beschaffen könnte, so dachte sie, in Cirencester etwa. Anna hoffte, ihre Tochter daran zu hindern, eine Laufbahn als Fotografin einzuschlagen. Wer würde denn dafür eine Frau beauftragen wollen?, hatte sie immer wieder bemerkt. Doch jemand wollte das, und zwar Clifford. Sie, Eliza, sei ideal, für seine Zwecke genau die Richtige, hatte er zu ihrer Mutter gesagt, die ihm freilich nicht widersprechen konnte. Schließlich war er Repräsentant der Krone und nur dem Leiter der Rajputana-Behörde unterstellt, der indirekt über alle zweiundzwanzig Fürstenstaaten regierte. Er, die Residenten und die Regierungsbeamten der kleineren Staaten gehörten alle zum Exekutivrat des Vizekönigs.
So sah Eliza nun einem Jahr in einem Palast entgegen, in dem sie niemanden kannte. Ihr Auftrag lautete, das Leben im Fürstenstaat zu fotografieren, für ein neu gegründetes Archiv am Sitz der britischen Regierung, die endlich von Kalkutta nach Delhi umzog.
Der Bau von Neu-Delhi hatte viel länger gedauert als erwartet, und der Krieg hatte alles verzögert, aber jetzt war die Zeit gekommen.
Die Sätze ihrer Mutter im Ohr, die sie auf die Leiden des Volkes vorbereitet hatte, sah sie unterhalb der Palastmauern Kinder im Dreck spielen. Eine Bettlerin hockte im Schneidersitz neben einer schlafenden Kuh und stierte mit leerem Blick vor sich hin. Das Bambusgerüst, das neben ihr an der Mauer lehnte, schwankte bedenklich im Wind, wobei sich über einem nackten, am Boden sitzenden Kind zwei Bretter lockerten.
»Halt!«, rief Eliza, und sowie der Wagen stand, sprang sie hinaus, während eines der Bretter sich schon aus den Halterungen löste. Mit klopfendem Herzen erreichte sie das Kind und zog es in dem Augenblick, bevor das Brett auf den Boden prallte, unter dem Gerüst weg. Das Kind rannte davon, und ihr Begleiter zuckte mit den Schultern. Kümmert so etwas niemanden?, wunderte sie sich, als sie die Rampe zum Tor hinauffuhren.
Einige Minuten später stritt ihr Begleiter mit den Wachen vor dem Festungstor. Sie kamen seiner Bitte nicht nach, obwohl er ihnen die Papiere gezeigt hatte. Eliza schaute an der abweisenden Fassade und dem enormen Tor hinauf, das breit genug war, um ein Heer durchzulassen, ganz zu schweigen von Pferden, Kamelen und Kutschen. Der Fürst besitze sogar mehrere Automobile, hatte sie gehört. Das Fahrzeug, mit dem sie selbst bislang gereist war, war mit einem Motorschaden liegen geblieben, und nachdem sie mit einem Kamelkarren hatte weiterfahren müssen, war sie nun müde, durstig und schmutzig vom Straßenstaub. Er brannte in ihren wunden Augen und juckte auf der Kopfhaut. Sie kratzte sich immer wieder, obwohl es dadurch nur schlimmer wurde.
Endlich erschien am Tor eine Frau mit einem langen, dünnen Schal vor dem Gesicht, der nur ihre dunklen Augen frei ließ. »Ihr Name?«
Eliza sagte, wer sie war.
»Kommen Sie mit.«
Die Frau nickte den Wachen zu, die verdrossen schauten, aber sie und den Kamelkarren durchließen. Achtzehn Jahre war es her, seit Eliza mit ihrer Mutter von Indien nach England gezogen war. Achtzehn Jahre schwindender Möglichkeiten für Anna Fraser. Doch Eliza hatte sich entschieden, frei zu sein. Ihr kam es vor wie eine zweite Geburt, so als hätte eine geheimnisvolle Hand sie zurückgeführt – obwohl es natürlich Clifford Salters Hand gewesen war, der zudem nichts Geheimnisvolles an sich hatte. Wäre das anders, hätte er vielleicht anziehend wirken können, so aber war er ein ganz und gar durchschnittlicher Mann, und sein schütteres rotblondes Haar und die feuchten, kurzsichtigen hellblauen Augen verstärkten noch den Eindruck von Langweiligkeit. Eliza war ihm jedoch zu Dank verpflichtet, weil er ihr diesen Auftrag verschafft hatte, im Land der Adels- und Kriegerkaste der Rajputen, einer Traube von Fürstenstaaten in der Wüstenregion Britisch-Indiens.
Eliza klopfte sich notdürftig den Staub ab, bevor sie durch eine Reihe herrlicher Torbögen ging. Ein Eunuch führte sie durch ein Labyrinth gekachelter Räume und Flure zu einem Vestibül. Sie hatte von den kastrierten Männern in Frauengewändern schon gehört und schauderte. Das Vestibül war bewacht von Frauen, die Eliza feindselig anblickten und ihr den Weg durch die breiten, mit Elfenbein ausgelegten Sandelholztüren versperrten. Als sie ihr nach einigen Erklärungen seitens des Eunuchen schließlich Eintritt gewährt hatten, ließen sie Eliza allein, damit sie dort wartete.
Das Vestibül war von oben bis unten in reinem Coelinblau gestrichen und mit Goldfarbe bemalt. Blüten, Blätter, filigrane Schnörkel stiegen an den Wänden hinauf und zogen sich an der Decke entlang. Selbst auf dem Steinfußboden lagen Teppiche in demselben Blauton. So kräftig die Farbe war, bewirkte sie doch eine zarte Schönheit. In all dem Blau kam sich Eliza fast vor wie ein Teil des Himmels.
Erwartete man von ihr, dass sie sich bemerkbar machte? Sich höflich räusperte? Rief? Sie wischte sich die feuchten Hände an den Hosenbeinen ab und stellte ihre schwere Fototasche hin, um sie nach einem Moment der Unsicherheit wieder aufzuheben. Eliza fühlte sich deplatziert. Ihre im Nacken zerzausten Haare, die triste Khakihose und die verschwitzte weiße Bluse verstärkten dieses Gefühl noch. Sie würde nie zu solch verlockenden Farben und Mustern passen. Die meiste Zeit ihres Lebens hatte sie so getan, als passte sie dazu, indem sie über unwichtige Dinge plauderte und Interesse an Leuten heuchelte, die sie nicht mochte. Sie hatte sich große Mühe gegeben, zu sein wie die anderen jungen Mädchen und später wie die anderen Frauen. Doch das Gefühl, unpassend zu sein, war ihr selbst noch in der Ehe mit Oliver erhalten geblieben.
Hinter dem blauen Vestibül lag ein leuchtend orangefarbener Raum, wo vor einem kleinen Fenster Staubpartikel in der Sonne tanzten. Dahinter war wiederum die Ecke eines Zimmers zu sehen, das tiefrot gehalten war und wo die filigran gemeißelten Wände der Zenana, der Frauengemächer, begannen. Männer, die nicht der Herrscherfamilie angehörten, durften sie nicht betreten. Laut Clifford herrschten dort – im Harem, wie er es nannte – Geheimnisse und Intrigen, Gerüchte und zügellose Erotik. All diese Frauen seien ausgebildet in den sechzehn weiblichen Künsten. Ein Hort mannigfacher Kopulation und sittlichen Verfalls, fügte er augenzwinkernd hinzu, und sogar mit den Priestern oder vielleicht gerade mit den Priestern, obwohl seine Vorgänger sich dafür eingesetzt hatten, die übelsten geschlechtlichen Praktiken in den Zenanas abzuschaffen.
Eliza fragte sich, was diese sechzehn Künste wohl sein mochten. Hätte ich sie beherrscht, wäre meine Ehe vielleicht ein Erfolg gewesen, überlegte sie, aber eingedenk ihres einsamen Lebens mit Oliver tat sie den Gedanken schnaubend ab.
Ein aufdringliches orientalisches Parfüm – es roch nach Zimt, ein wenig nach Ingwer und dabei berauschend süß – wehte aus dem roten Raum heran und bestätigte alles, was sie über die Zenanas gehört hatte. Dadurch fühlte sie sich wie eingesperrt und sehnte sich danach, ans Fenster zu treten, den weißen wehenden Vorhang beiseitezuziehen und sich in die frische Luft hinauszulehnen.
Da ihre Arme allmählich schmerzten, stellte sie erneut die schwere Tasche auf den Teppich, diesmal an der Wand neben einer Marmorsäule, auf der eine Pfauenlampe stand. Als sie ein tiefes Räuspern hörte, blickte Eliza auf. Hastig straffte sie die Schultern und strich sich die Haare glatt, die doch aus den sorgfältig platzierten Spangen gerutscht waren. Ihre dicken langen Haare, die zur Krause neigten, waren höchst widerspenstig und mühsam zu frisieren. Erschrocken sah sie im Gegenlicht vor dem Fenster einen sehr großen Mann stehen.
»Sind Sie Britin?«, fragte er. Verblüfft über sein makelloses Englisch, blickte sie ihn stumm an.
Er trat einen Schritt vor, sodass das Licht in sein Gesicht fiel. Der Mann war Inder und sah enorm kräftig aus. Seine Kleidung war mit rötlichem Staub bedeckt, und auf seinem rechten Unterarm saß ein Falke mit einer Haube über dem Kopf.
»Dürfen Sie hier sein?«, erwiderte sie. »Ist dies nicht der Eingang zur Zenana?«
Sie blickte in tief liegende, bernsteinbraune Augen und fragte sich, warum er keinen Turban trug. Trugen nicht alle Rajputen einen? Seine dunkle Haut glänzte, und seine dunkelbraunen Haare waren in einer lockeren Welle aus dem Gesicht gekämmt.
»Ich denke, Sie sollten nach dem Lieferanteneingang suchen«, fügte sie hinzu, da sie ihn für einen Händler hielt und wollte, dass er ging. Eigentlich sah er sogar mehr wie ein Zigeuner oder ein fahrender Musikant aus. Ihr lief ein Schweißtropfen aus der Achselhöhle, und nicht nur ihre Hände fühlten sich klebrig an.
In dem Moment kam eine ältere Inderin herein, traditionell bekleidet mit einem langen weiten Rock, einer eleganten Bluse und einem breiten Schal, der bei jeder Bewegung wehte. Das Kolorit aus Zinnoberrot, Smaragdgrün und Himbeerrot mit Gold war eine grelle Mischung, die dennoch schön aussah. Sie verströmte Sandelholzduft und ruhige Gelassenheit, und als sie hinter einer Marmorsäule an einer Schnur zog, leuchtete die Pfauenlampe auf und warf einen blaugrünen Schein auf ihre Hände. Dann ging sie ein paar Schritte auf Eliza zu und verbeugte sich leicht, wobei sie die Handflächen vor der Brust aneinanderlegte. An ihren Fingern steckten etliche mit Edelsteinen besetzte Ringe, und die Nägel waren silbern lackiert.
»Namaskar. Ich heiße Laxmi. Sie sind die Fotografin, Miss …«
»Eliza Fraser.« Sie neigte den Kopf, unsicher, ob ein Knicks angebracht wäre. Schließlich war diese Frau die ehemalige Maharani und Mutter des Fürsten von Juraipur. Ihre Schönheit und Intelligenz seien legendär, hatte Clifford gesagt, und zusammen mit ihrem verstorbenen Gemahl, dem Maharadscha, habe sie die Sitten ihres Landes modernisiert. Sie trug die Haare geflochten und vom Nacken abwärts in ein Tuch gewickelt, ihre Wangenknochen waren markant, und ihre dunklen Augen funkelten. Sie war tatsächlich so schön, wie behauptet wurde. Eliza wünschte, sie hätte Clifford nach den Benimmregeln gefragt. Er hatte ihr lediglich geraten, sich vor Motten und weißen Ameisen zu hüten, da die einen ihre Kleider, die anderen die Möbel fräßen.
Laxmi wandte sich dem Mann zu. »Und du? Wie ich sehe, hast du den Vogel schon wieder mit hereingebracht.«
Der Angesprochene zuckte mit den Schultern, und das auf eine Art, die ein vertrautes Verhältnis vermuten ließ. »Du meinst Godfrey«, sagte er.
»Das soll ein Name für einen Falken sein?«, erwiderte sie.
Der Mann lachte und zwinkerte Eliza zu. »Mein Altphilologielehrer in Eton hieß so. Er war ein guter Mann.«
»Eton?«, fragte Eliza überrascht.
Laxmi seufzte tief. »Darf ich vorstellen? Mein zweiter und höchst eigensinniger Sohn, Jayant Singh Rathore.«
»Ihr Sohn?«
»Wiederholen Sie stets nur, was man zu Ihnen sagt, Miss Fraser?«, fragte Laxmi mit einem recht schalkhaften Blick. Doch dann lächelte sie. »Sie sind nervös, daher ist das verständlich. Ich bin froh, dass Sie hier sind und unser Leben dokumentieren werden. Die Fotos sind für ein neues Archiv in Delhi bestimmt, wie ich höre.«
Sowie es um ihre Arbeit ging, fand Eliza aus ihrer Befangenheit und antwortete lebhaft: »Ja. Mr. Salter möchte ungezwungene Aufnahmen, die zeigen, wie das Leben wirklich ist. So viele Menschen sind von Indien fasziniert, und ich hoffe, einige Fotografien in guten Fachzeitschriften zu veröffentlichen. In der Photographic Times oder im Photographic Journal, das wäre wunderbar.«
»Ich verstehe.«
»Es geht um eine vollständige Darstellung des Lebens in einem Fürstenstaat im Jahreslauf. Also freue ich mich auf meinen Aufenthalt. Vielen Dank für die Einladung. Ich verspreche, nicht im Weg zu sein, aber es gibt so vieles, das ich sehen möchte, und das Licht ist fantastisch. Darauf kommt es am meisten an: auf den Kontrast von Licht und Schatten, Sie wissen, das sogenannte Chiaroscuro. Und ich kann hoffentlich …«
»Ja, ja, gewiss doch. Was meinen Sohn betrifft, werden Sie feststellen, dass er nicht mehr so abschreckend aussieht, wenn er sich erst einmal den Wüstenstaub aus den Kleidern gebürstet hat.« Laxmi lachte. »Geben Sie es zu: Sie dachten, er sei ein Zigeuner, nicht wahr?«
Peinlich berührt wegen ihrer eigenen staubbedeckten Erscheinung, spürte Eliza, dass ihr die Röte ins Gesicht stieg, und fand es auf einmal unangenehm warm.
»Machen Sie sich deswegen keine Gedanken. Jeder denkt das, wenn Jayant tagelang in der Wüste gewesen ist.« Laxmi rümpfte die Nase. »Mit seinen fast dreißig Jahren ist er süchtig nach Gefahr und zieht die Wildnis uns zivilisierten Leuten vor. Da nimmt es einen nicht wunder, dass er noch unverheiratet ist.«
»Mutter«, sagte er mit einem warnenden Unterton. Danach ging er ans Fenster, zog den Vorhang beiseite und lehnte sich mit einem Ausdruck trägen Desinteresses hinaus.
Laxmis Frustration über ihn äußerte sich im Zittern ihres Kinns, doch sie fasste sich rasch und wandte sich Eliza zu. »Nun, das ist Ihre Ausrüstung?«
»Ein Teil davon. Das Übrige befindet sich noch im Wagen.« Eliza deutete vage in die Richtung, wo sie den Kamelkarren vermutete.
»Ich lasse Ihr Gepäck in Ihre Zimmer bringen. Sie werden hier wohnen, wo wir Sie im Auge behalten können.«
Plötzlich eingeschüchtert, machte Eliza offenbar ein ängstliches Gesicht, denn Laxmi lachte. »Ich scherze nur, meine Liebe. Es steht Ihnen frei, zu kommen und zu gehen, wie es Ihnen beliebt. Wir haben die Wünsche des Residenten bis ins Einzelne erfüllt.«
»Das ist sehr freundlich.«
»Mit Freundlichkeit hat das nichts zu tun. Vielmehr liegt es in unserem eigenen Interesse, der britischen Regierung gefällig zu sein, wenn wir können. Die Beziehungen waren in der Vergangenheit heikel, gebe ich zu, aber ich versuche, meinen Einfluss auf gewisse Interessengruppen innerhalb des Palastes zur Geltung zu bringen. Ihnen steht eine abgedunkelte Werkstatt zur Verfügung, wo Sie auch Zugang zu Wasser haben, und Sie werden feststellen, dass Ihre privaten Räume sehr komfortabel sind und auf einen schönen Hof mit Topfpalmen hinausgehen.«
»Ich danke Ihnen. Mr. Salter sagte mir, er habe mit Ihnen die Vereinbarungen getroffen. Ich habe jedoch … nun ja, ein kleines Haus für mich allein erwartet.«
»Das wäre überhaupt nicht angemessen. Unser Gästehaus in der Stadt wird ohnehin derzeit renoviert. Und der Hauptgrund ist: Wir mögen in Juraipur die Absonderung der Frauen abgeschafft haben, dennoch halten viele sie nach wie vor für richtig. Wir können Sie nicht allein in der Wildnis umherziehen lassen.«
»Ich käme ganz bestimmt zurecht«, erwiderte Eliza, obwohl sie sich dessen gar nicht sicher war.
»Nein, meine Liebe. Die Briten denken, es sei allein ihre Leistung, uns Frauen an die Öffentlichkeit zu bringen, doch um ganz offen zu sein, ich habe für die Purdah-Regeln von jeher nur Lippenbekenntnisse abgelegt. Mein Gemahl hat sich nach dem Tod seiner Mutter bereitwillig meiner Bitte gefügt, sie abzuschaffen. Den meisten Männern gefällt es, Frauen zu unterdrücken und zu ignorieren. Zum Glück hatte ich solch einen Mann nicht.«
»Wie werde ich mich außerhalb des Palastes bewegen?«
»Immer in Begleitung natürlich. Und das bringt mich zu Ihrer ersten Aufgabe. Da der Monat Kartik schon weit fortgeschritten ist, hat Jayant freundlicherweise angeboten, Sie bei einer Fahrt zum Chandrabhaga-Markt zu begleiten. Übermorgen. Sie werden auch Diener bei sich haben. Mein Sohn wird sich gewiss freuen, Englisch sprechen zu können, und Ihnen wird der Markt gefallen. Soweit ich weiß, gibt es dort Kamele in vielen Farben und interessante Gesichter zu sehen. Und morgen werden Sie Mr. Salter zu einem Polospiel begleiten.«
Eliza wurde allmählich ärgerlich. Sie war nicht erpicht auf ein Polospiel oder einen Kamelmarkt. Sie wollte sich in ihrer neuen Umgebung einrichten und Fuß fassen, anstatt sofort woandershin zu fahren, noch dazu in Begleitung des Prinzen, falls er wirklich einer war. Sie wollte lächeln, doch das misslang. »Ich hatte gehofft, zunächst mehr vom Palast zu sehen«, entgegnete sie. Dabei fiel ihr auf, dass der Prinz sie neugierig betrachtete.
»Mutter, mir scheint, du hast deinen Meister gefunden«, sagte er.
Dabei glaubte Eliza einen neuen Unterton bei ihm zu hören. Machte er sich etwa über sie lustig? Oder über seine Mutter?
Laxmi prustete auf eine sehr damenhafte Art. Offenbar sah sie, was ihr Sohn unterstellte, als höchst unwahrscheinlich an. »Sie werden noch reichlich Zeit haben, sich den Palast anzusehen. Den Markt dürfen Sie nicht auslassen. Sie werden einiges von der Landschaft sehen und dort auch Indira kennenlernen. Ich lasse Kiri holen, Ihre Dienerin, damit sie Sie zu Ihrem Quartier bringt.«
»Du hast Indira erlaubt vorauszufahren? Wer weiß, was sie wieder anstellt!«
»Ich habe ihr einen verlässlichen Mann und eine Dienerin mitgegeben. Auf jeden Fall versteht sie etwas von Kamelen.«
Die Sonne war ein Stück weitergezogen und warf nun lange Strahlen über den Fußboden. Laxmi hatte sich offen und liebenswürdig gezeigt, doch Eliza spürte, dass man sich besser nicht mit ihr anlegte. Als die ältere Dame hoheitsvoll hinausging, machte ihr Sohn eine formelle Verbeugung. Eliza nahm die Gelegenheit wahr, ihn zu betrachten, besonders sein markantes Gesicht, das wie das seiner Mutter von ausgeprägten Wangenknochen beherrscht wurde, aber sehr maskulin war, ebenso die hohe Stirn, die weit auseinanderstehenden bernsteinbraunen Augen und den Oberlippenbart. Als er streng zu ihr herübersah, senkte sie den Blick.
»Wir haben Sie nicht eingeladen«, sagte er ganz ruhig. »Wir befolgen die Anordnung, Sie in den Palast zu lassen und überallhin zu begleiten. Wir bekommen viele solcher Anordnungen von den Briten.«
»Von Clifford Salter?«
»So ist es.«
»Und Sie kommen ihnen stets nach?«
»Ich …« Er stockte, dann wechselte er das Thema, doch sie glaubte, ihm habe zu dem vorigen noch etwas auf der Zunge gelegen. »Meine Mutter möchte ein schokoladenbraunes Kamel.«
»Es gibt schokoladenbraune Kamele?«
»Hauptsächlich auf dem Chandrabhaga-Markt. Es wird Ihnen gefallen. Wenige Briten fahren dorthin. Und mit Ihren kamelfarbenen Haaren werden Sie gut dazupassen.«
Er lächelte, doch sie versteifte sich und strich sich über das Haar. »Ich bezeichne meine Haare lieber als honigfarben.«
»Nun, wir sind in Rajputana.«
»Und diese Indira, darf ich fragen, wer sie ist?«
»Die Antwort ist nicht leicht … gerade einmal neunzehn Jahre alt und tut stets, was sie will. Sie werden sie sehr fotogen finden.«
»Ihre Schwester?«
Er drehte sich zum Fenster, um hinauszuschauen. »Wir sind nicht verwandt. Sie ist eine sehr begabte Miniaturmalerin. Eine Künstlerin. Sie lebt im Palast unter dem Schutz meiner Mutter.«
Durch das Fenster hörte man Kinder lachen und kreischen.
»Meine Nichten«, sagte er und winkte ihnen, bevor er sich wieder zu Eliza umdrehte. »Ich habe drei davon, aber keine Neffen, zur ewigen Schande meines Bruders.«
Eine junge Frau kam herein und bedeutete Eliza, ihr zu folgen. Eliza nahm ihre Tasche. Sie war verärgert. Wie konnte er so etwas zu ihr sagen? Hielt er es wirklich für eine Schande, nur Töchter zu haben?
»Lassen Sie die Tasche stehen. Man wird sie Ihnen bringen.«
»Auch wenn ich nur eine Frau bin, trage ich sie doch lieber selbst.«
Er neigte den Kopf. »Wie Sie wünschen. Seien Sie übermorgen um sechs Uhr zum Aufbruch bereit. Das ist hoffentlich nicht zu früh für Sie?«
»Selbstverständlich nicht.«
Er musterte sie von oben bis unten. »Haben Sie auch Frauenkleider?«
»Falls Sie Röcke meinen, ja, aber beim Arbeiten haben sich Hosen als praktischer erwiesen.«
»Nun, es wird mir eine Freude sein, Sie näher kennenzulernen, Miss Fraser.«
Sein nachsichtiges Lächeln irritierte sie unnötig stark. Wer war dieser arrogante Mann, dass er sich ein Urteil erlaubte? Zweifellos war er träge, verwöhnt und lebte ziellos in den Tag hinein wie alle indischen Adligen. Und je mehr sie darüber nachdachte, desto gereizter wurde sie.
Am nächsten Tag wachte sie früh auf. Durch die dünnen Vorhänge schien grell die Sonne. Eliza musste die Augen beschirmen, als sie aus dem Bett sprang und zum Fenster ging, um hinauszusehen. Ihr war, als strömte trotz all der Jahre in England etwas von diesem orientalischen Land durch ihre Adern, als wäre sie ihm tief im Innern verbunden geblieben. Schon der Geruch der Erde rührte an ferne Erinnerungen, und während der Nacht war Eliza mehrmals mit dem Gefühl aufgewacht, als riefe etwas nach ihr. In der Luft hing der Geruch von Wüstensand, und sie atmete die Morgenkühle ein, beschwingt und zugleich unruhig.
Wie versprochen ging ihr Zimmer auf einen begrünten Innenhof hinaus. Sie lächelte über die Affen, die von Baum zu Baum sprangen und auf den Schaukeln spielten, den größten, die sie je gesehen hatte. Da der Palast, der nur ein Teil der gigantischen Festung war, hoch auf dem schroffen Sandsteinfelsen über der goldenen Stadt lag, war die Aussicht über die flachen Dächer atemberaubend. Eliza strahlte vor Entzücken. Kleine würfelförmige Häuser standen dicht an dicht und leuchteten in einem dunklen Ockerton. Mit zunehmender Entfernung verblassten sie in einer fein gestuften Farbpalette von Rotgold bis zu zartestem Gelb, bis sie mit dem hellgrauen Horizont verschwammen, wo die Stadt an die Wüste grenzte. Vereinzelt reckten sich staubige Bäume dem Licht entgegen, und über der Stadt stiegen große Vogelschwärme kreisend auf, um sich kurz darauf erneut irgendwo niederzulassen.
Es war jetzt kühl. Bis zum Nachmittag aber würde die Temperatur auf vierundzwanzig Grad und höher steigen, und regnen würde es höchstwahrscheinlich nicht. Eliza überlegte, was man wohl zu einem Polospiel anzog, und entschied sich für eine langärmlige Bluse und einen schweren Gabardinerock. Schon wochenlang bevor sie das Schiff nach Indien bestiegen hatte, hatte die Frage sie beschäftigt, welche Kleidung sie einpacken sollte. Ihre Mutter war ihr dabei keine Hilfe und erinnerte sich offenbar nur an die Abendkleider, die sie damals getragen hatte, bevor ihr Mann dem Attentat zum Opfer gefallen war. Eliza wusste kaum noch etwas aus jener Zeit, aber selbst jetzt spürte sie einen Kloß im Hals, wenn sie an ihren Vater dachte.
Das Leben in England war nicht leicht gewesen, und später, nach dem Tod ihres Mannes Oliver, war Eliza wieder zu ihrer Mutter gezogen, wo sie immer wieder unter dem Bett oder der Spüle auf einen geheimen Gin-Vorrat gestoßen war. Anna leugnete das unentwegt und konnte sich mitunter nicht einmal an ihre Alkoholexzesse erinnern. Am Ende gab Eliza die Hoffnung auf. Dass sie Clifford Salter kannten, war eine glückliche Fügung, und mit ihrer Reise nach Indien wollte Eliza nach vorn blicken. Dennoch stand sie jetzt hier und blickte zurück, und ihre Gedanken galten nicht nur ihrer Mutter.
Sie betrachtete ihr Zimmer. Es war groß und luftig, das Bett hinter einem Wandschirm verborgen. Ein leicht erhöhter Teil, der mit einem großen Lehnstuhl und einem bequem wirkenden Sofa ausgestattet war, diente als Wohnbereich. Daran grenzte, durch einen Mauerbogen getrennt, ein kleiner Speiseraum. Von Motten oder Ameisen war nirgends eine Spur. Ein zweiter hübscher Mauerbogen in der Wand gegenüber dem Himmelbett führte in ein großzügiges Bad. Die Tür zu ihrer Dunkelkammer befand sich außerhalb des Zimmers in dem dämmrigen Korridor. Eliza war froh, dass man ihrer Bitte entsprochen hatte und sie allein über den Schlüssel verfügen durfte.
Während sie ihre Kleidung herauslegte, dachte sie an ihre gestrige Ankunft bei läutenden Tempelglocken und einem strahlenden Sonnenuntergang, der den Himmel rot gefärbt hatte. Zwei kreischende und kichernde Mädchen auf Rollschuhen hatten sie beinahe umgefahren und sich auf Hindi entschuldigt. Eliza freute sich, weil sie sie einigermaßen verstand, und war ihrer alten Kinderfrau dankbar, von der sie die Sprache damals erlernt hatte. Auch die Unterrichtsstunden, in denen sie ihre Kenntnisse kürzlich aufgefrischt hatte, erwiesen sich als hilfreich.
Kurz nach Einbruch der Dunkelheit brachte ihr ein Diener in weißer Livree und mit rotem Turban auf einem Silbertablett Schüsseln mit Reis, Früchten und Dhal, einem Gericht aus Hülsenfrüchten, und nach dem Auspacken ging Eliza früh zu Bett. Wäre es nicht ungewöhnlich laut gewesen, wäre sie sofort eingeschlafen, müde von der Schiffsreise und der Fahrt nach Delhi, auf die eine weitere Tagesreise nach Juraipur gefolgt war. Aber ein vielfältiger Lärm drang von draußen in ihr Zimmer. Musik, Gelächter, zwitschernde Vögel, quakende Frösche, spielende Kinder, die endlos lange aufbleiben durften, und die schreienden Pfauen, die sich fast wie jaulende Katzen anhörten, störten immer wieder ihren Schlaf.
Lange lag sie wach, hilflos im Hochgefühl einer indischen Nacht, hörte die Trommeln, die Rohrflöten, roch den Rauch in der Luft. Vor allem aber spürte sie das Leben, das trotz Armut und feindseliger Wüstenlandschaft von den Menschen voll ausgekostet wurde.
Dabei dachte Eliza immer wieder an ihren Vater und ihren Ehemann. Würde sie sich jemals verzeihen können, was passiert war? Sie würde es müssen, wenn sie aus dieser einmaligen Gelegenheit das Beste machen wollte. Denn keinesfalls wollte sie kleinlaut zu ihrer Mutter zurückkehren müssen. Zumal sie in sich gerade etwas wiederentdeckte, das sie damals bei der Abreise nach England verloren hatte.
2
Draußen war es heiß, und Eliza fühlte sich bald zu warm angezogen und verschwitzt. Das war ein Tag für Musselinkleider, nicht für schweres Leinen, wenngleich Clifford einen Leinenanzug mit Kragen und Krawatte trug. Die Veranstaltung war kleiner als erwartet, mehr eine Gartenparty als etwas anderes. Die Unterstützer beider Seiten fanden sich ein – einige saßen bereits verstreut auf Stühlen –, und man spürte deutlich ihre Vorfreude. Eliza war noch nie bei einem Polospiel gewesen, und das von Bäumen und einem Eisenzaun umgebene Gelände mit den Bergen im Hintergrund kam ihr idyllisch vor.
»Wenigstens ist es hier trocken«, sagte Clifford. »Ganz anders als in England, wo morastiger Rasen das Spiel behindert.«
Die britische Mannschaft bestand aus Offizieren der 15th Lancers, wie Clifford erzählte. Offenbar hatten sie eine Schar lautstarker Anhänger mitgebracht, von denen viele bereits betrunken wirkten. Auch Offiziere anderer Regimenter waren gekommen, jeder mit seinem Diener, und auch einige voll ausgerüstete Ersatzspieler, für den Fall, dass sie gebraucht wurden.
Eliza wartete neben Clifford und beobachtete die Leute. Gleich hinter der Hauptgruppe britischer Unterstützer standen Arm in Arm ein Mann und eine hochgewachsene Frau, die gerade herüberschaute und lächelte. Als Clifford sie bemerkte, flüsterte er, das sei Dottie Hopkins, die Frau des Arztes. »Du wirst sie beide später kennenlernen«, fügte er hinzu. »Sie sind gute Leute.«
Die Frau wirkte freundlich, und Eliza freute sich darauf, dem Paar vorgestellt zu werden. In der anderen Richtung sammelte sich eine große, lärmende Gruppe indischer Zuschauer, begleitet von einem Schwarm Diener in förmlicher Kleidung. Eliza beobachtete sie und konnte kaum wegsehen.
»Obwohl Polo als das Spiel der Könige gilt, nimmt Fürst Anish selten daran teil«, bemerkte Clifford. »Prinz Jayant lässt sich dagegen häufig sehen. Er ist ein exzellenter Reiter und ein großartiger Mannschaftsspieler. Wenn er heute mitspielt, wird es für uns schwierig zu gewinnen.«
»Finden oft Polospiele statt?«
»Die großen im Rahmen regelmäßiger Wettkämpfe, aber dieses ist nur ein kleines Freundschaftsspiel zur Unterhaltung. Jaipur hat den besten Ruf, weißt du? Hat dieses Jahr die indische Meisterschaft gewonnen. Doch Juraipur liegt in der Tabelle schon dicht hinter ihnen.«
»Das ist prima.«
»Und wir streben weiterhin den Sieg an. Für unser Land, wie man so schön sagt.«
Kurz darauf kamen die Spieler elegant und stolz aufs Feld gelaufen. Dann führten die Pferdepfleger die Ponys heran, und die Zuschauer klatschten. Clifford erklärte rasch, dass das keine echten Ponys, sondern Vollblüter seien.
»Das ist ein furchtbar kostspieliger Sport. Die Pferde verschlingen Tausende von Pfund.«
Die Spieler, die alle ungeheuer kraftvoll wirkten, saßen auf, und gerade als Eliza unter ihnen Prinz Jayant entdeckte, schwang er sich in den Sattel eines herrlichen Rappen. Nun stieg Stimmenlärm von der hocherfreuten Menge auf, gefolgt von anhaltendem Jubel und Pfeifen der indischen Unterstützer.
Clifford rückte näher an Eliza heran. »Er zieht immer Zuschauer an. Und sein Pony hat ein großartiges Temperament. Der Spieler muss sich auf sein Tier verlassen können, es muss starke Nerven haben. Siehst du die beiden Burschen dort drüben?«
Eliza schaute in die Richtung, in die Clifford zeigte.
»Die Schiedsrichter. Es gibt auch einen Oberschiedsrichter, der entscheidet, falls die beiden differieren. Im Polo wird Fairness großgeschrieben.«
So weit war das sehr unterhaltsam, und Eliza freute sich, im Freien zu sein und etwas Neues zu erleben. Die Unlust, die sie am Vortag noch empfunden hatte, war verschwunden. Die beiden Mannschaften stellten sich mit dem Schläger in der Hand einander gegenüber in einer Reihe auf, und mit dem Einwurf des Balles begann das Spiel. Während die Spieler hin und her galoppierten und von dem harten Boden Staub aufwirbelte, entwickelte sich eine gespannte Atmosphäre. Nach kurzer Zeit fiel das Pony des Prinzen durch eigenwilliges Verhalten auf.
»Soll das so sein?«, fragte sie.
Clifford runzelte die Stirn. »Es wirkt tatsächlich ein wenig ausgelassen.«
Sie sah weiter den Spielern und ihren Ponys zu, und dann, als sie zu den indischen Zuschauern hinüberblickte, bemerkte sie zwei förmlich gekleidete, Säbel tragende Männer, die erwartungsvoll vorgetreten waren. Eliza hielt den Atem an, doch es passierte nichts, und das Spiel ging weiter. Fasziniert schaute sie zu und hörte kaum hin, als Clifford ihr die Poloregeln und deren Begriffe erklärte.
Erst einige Minuten später wurde offensichtlich, dass mit dem Pferd des Prinzen etwas nicht in Ordnung war.
»Mein Gott!«, rief Clifford aus, als es hin und her tänzelte und dann sogar buckelte.
Eliza beobachtete Jayants Mienenspiel, der zunächst verärgert, dann verwundert und ratlos wirkte. Als sein Sattel zur Seite rutschte, ging ein Raunen durchs Publikum, dann wurden erstaunte Rufe laut. Zwei Augenblicke später lag Jayant am Boden, und sein Pferd ging durch. Die übrigen Spieler standen völlig still, und jeder beobachtete erschrocken, wie zwei Pferdepfleger hinter dem panischen Pony herrannten. Eliza hielt den Atem an und packte Cliffords Arm, denn es rannte in die Menge der indischen Zuschauer hinein. Die schrien auf und rissen entsetzt die Arme hoch oder flüchteten. Plötzlich gellte ein Schrei, und eine Frau fiel rücklings gegen den Zaun. Das Pferd trat immer wieder aus, während die Leute rannten, um den Hufen auszuweichen. Die getroffene Frau lag jedoch reglos am Boden.
Eliza sah den Arzt, auf den Clifford sie vorhin aufmerksam gemacht hatte, zu ihr laufen. Er beugte sich über sie und ging neben ihr in die Hocke.
Nachdem das panische Pony eingefangen und beruhigt worden war, kamen zwei Männer mit einer Trage und brachten die Frau in Begleitung des Arztes weg. Der Prinz war inzwischen aufgestanden und klopfte sich Jacke und Hose ab. Er war offenbar unverletzt, aber leichenblass und verließ schließlich das Spielfeld zusammen mit seinem Pferd. Die beiden Säbel tragenden Männer folgten ihm. Seine Leibwächter, begriff Eliza.
Als Fotografin war sie darin geübt, die Details einer Szene wahrzunehmen, und so fiel ihr ein Inder auf – vermutlich ein Stallbursche –, der sich von den Ställen entfernte. Er schien sich geradezu fortzustehlen und ging im Rücken der indischen Zuschauer zu einem Mann. Dieser war groß und von majestätischer Haltung. Er klopfte dem Stallburschen breit lächelnd auf den Rücken. Das kam ihr sonderbar vor, nachdem doch der indische Prinz gerade vom Pferd gestürzt war. Außerdem sah sie zwei Anhänger der britischen Mannschaft, die einander zuzwinkerten, obwohl die angespannte Atmosphäre noch anhielt.
»Solche Idioten! Da gibt es überhaupt nichts zu lachen«, empörte sie sich. »Die Frau hätte dabei sterben können.«
»Ich werde bald von Hopkins hören, wie es ihr geht«, sagte Clifford.
Inzwischen plauderten die Briten weiter; sie waren nicht annähernd so bestürzt, wie es angemessen gewesen wäre, und keiner von ihnen machte Anstalten, sich zu verabschieden. Nur die Unterstützer der indischen Mannschaft schüttelten noch den Kopf und raunten, einige kehrten dem Spielfeld den Rücken und gingen davon.
»Also wird das Spiel abgebrochen?«, fragte Eliza.
»Nein«, sagte Clifford. »Schau. Da kommt schon ein Ersatzspieler. Im Falle einer Verletzung ist das erlaubt.«
»Wirklich? Ist das nicht ziemlich gefühllos?«
»Das Leben geht weiter, Eliza.«
Als sie sich umsah, stellte sie fest, dass sich die Aufregung gelegt hatte. Eliza hoffte, die Frau würde überleben.
»Aber das war durchaus merkwürdig«, meinte Clifford. »Sehr sonderbar. So etwas habe ich noch nicht erlebt. Da der Prinz ausgeschieden ist, werden wir aber wohl gewinnen. Das ist doch erfreulich. Ich bezweifle, dass er nach dem Vorfall ein anderes Pony reiten wird.«
3
Am folgenden Tag verließen Eliza und Jayant Singh die Marmorhallen und gingen hinaus in die Höfe aus rosa Sandstein, der in der frühen Morgensonne leuchtete, und weiter durch mehrere Pavillons in einen duftenden Garten, wo ein erfrischender Wind wehte. Obwohl Eliza mit den Gedanken noch bei dem Polospiel war, bewirkte die Herrlichkeit ihrer Umgebung, dass sie sich aufrechter hielt, den Hals reckte und einen stolzen Gang annahm. Als sie sich den Schal über den Kopf warf, bauschte er sich im Wind. Bei dieser einfachen weiblichen Handlung fühlte sie sich, als wäre sie soeben in die bestickten Schuhe einer Maharani getreten.
»Die Mauern sehen aus wie aus Holz geschnitzt«, bemerkte sie, als sie in einen geometrisch angelegten Garten gelangten. Dort stolzierten die Übeltäter der vergangenen Nacht umher. Die Pfauen! Sie lachte, weil einer von der Mauerkrone abhob und auf den Boden plumpste. Wer hätte gedacht, dass ein schönes Geschöpf so ungraziös sein konnte?
»Dieser Garten wurde im achtzehnten Jahrhundert angelegt«, erklärte der Prinz und deutete mit ausholender Armbewegung auf Rosenbüsche, Zypressen, Palmen und Orangenbäume.
Sie verließen den Palast über eine Rampe, die durch sieben Torbögen führte. In einem davon entdeckte Eliza fünf Reihen Handskulpturen an der Wand.
»Die sind aus den Handabdrücken der Sati entstanden«, erzählte Jayant völlig unbekümmert. »Auf dem Weg zu ihrer Verbrennung tauchten die Witwen die Hände in rotes Pulver und drückten sie gegen die Wand, um ihrer Hingabe Ausdruck zu verleihen. Später wurden sie zu Halbplastiken gemeißelt.«
Eliza stieß erschrocken den Atem aus. »Das ist entsetzlich.«
»1829 wurde das in Britisch-Indien verboten, danach auch in den Fürstenstaaten, und 1861 wurde es von Königin Viktoria für ganz Indien unter Strafe gestellt. Aber dennoch …«
Sie wusste bereits von der rituellen Selbstverbrennung der Witwen in den Fürstenhäusern und auch unter den einfachen Frauen, aber ihr wurde übel, wenn sie daran dachte. Konnten sie wirklich geglaubt haben, das sei ein ehrenvoller Tod? Das Denken dieser Frauen war ihr unbegreiflich.
Sie schaute auf die sandigen Gassen der mittelalterlichen Stadt, in der alle Arten von Handwerkern dicht an dicht lebten, und dachte an den Moment zurück, als sie die immensen Mauern mit den Bastionen und Türmen zum ersten Mal gesehen hatte. Eliza blickte zur Festung hinauf. Unbezwingbar erhob sie sich auf einem schroffen Berg, aus demselben Stein wie dieser erbaut. Wie viele Frauen mochten in diesen Mauern schon den Feuertod gestorben sein?
Sie stiegen in das Auto, und nach einer Weile, als sie die Stadt hinter sich gelassen hatten, schaute Eliza über die Wüste, wo der Wind den sengend heißen Sand durch die Luft wehte. Kilometerweit zog sich die Straße durch eine sonnengebleichte Landschaft mit vereinzelten Akazien und Dornbüschen. Ganz selten sah man einen Flecken üppiges Grün. Das war eine einsame Gegend, und Jayant Singh war schweigsam und konzentrierte sich auf das Fahren, da die Straße nur schwer zu erkennen war. Eliza entschuldigte sein Schweigen. Ein Mann, der geistig und körperlich so viel Raum beanspruchte, war jedoch niemand, den man so ganz ignorieren konnte. Sie spürte etwas Unbändiges in ihm, das sie beunruhigte. Angespannt, wie sie war, versuchte sie, Konversation zu machen. Angesichts seiner einsilbigen Antworten beschloss sie schließlich zu schweigen, gab sich den Sinneseindrücken hin und ließ ihrer Fantasie freien Lauf. Gerade als sie in einen neuen Tagtraum mit Palastgärten und schaukelnden Affen hineinglitt und das Gesicht ihres Vaters darin erschien, entschloss Jayant sich zu einer Unterhaltung.
»An meinem Sattel hatte sich jemand zu schaffen gemacht.« Beim warmen, rauchigen Klang seiner Stimme schreckte Eliza hoch. »Ich habe Sie gestern beim Polospiel gesehen. Sicher fragen Sie sich, was den Vorfall herbeigeführt hat.«
»Es tat mir leid, dass Sie ausscheiden mussten. Woher wissen Sie das mit dem Sattel?«
»Ein Riemen war gerissen. Am Tag zuvor hatte ich ihn geprüft, bin aber vor dem Spiel zu spät gekommen und konnte das nicht mehr wiederholen. Der Sattelgurtriemen ist das heikelste Teil beim Sattelzeug. Ich hätte noch einmal nachsehen sollen.«
»Und deswegen hat das Pferd gebuckelt?«
»Nein, das lag an den Akaziendornen, die jemand unter den Sattel gelegt hatte.«
»Oh Gott! Dann war es also Sabotage.« Sie dachte an die beiden Inder, die ihr verschlagen vorgekommen waren. »Sie hätten sich den Hals brechen können.«
Er lächelte. »Allenfalls einen Arm, aber wie Sie sehen, bin ich unverletzt. Mein Pferd hätte es allerdings das Leben kosten können. Darüber kann ich nicht hinwegsehen, und was die arme Frau betrifft …«
»Wie geht es ihr?«
»Sie hat eine Gehirnerschütterung, soweit ich weiß. Zum Glück nichts Schlimmeres.«
»Das macht mich wirklich wütend. Empörend, dass das jemand mit Absicht getan hat.«
Er senkte die Stimme. »Kindisch ist das. Mein Pferd ist eine Schönheit, ausdauernd, wendig und schnell. Es liegt mir am Herzen, und den Zuschauern hätte wer weiß was passieren können. Das rückt den Polosport in ein schlechtes Licht.«
»Was können Sie deswegen unternehmen?«
»Ich habe mich bei Mr. Salter und den Veranstaltern beschwert. Leider können wir nicht beweisen, wer das getan hat. Ich habe einen Verdacht, doch die gegnerische Mannschaft war bunt zusammengewürfelt und ist inzwischen abgereist.«
Eliza behielt für sich, was sie beobachtet hatte. Nachdem der Prinz bei dem Vorfall recht aufgebracht gewirkt hatte, schien er jetzt relativ gelassen zu sein.
»Welches Interesse haben Sie an uns, Miss Fraser?«
»Das wissen Sie. Ich habe einen Auftrag angenommen.«
»Sonderbar, dass Mr. Salter eine unbekannte Frau engagiert hat.«
Eliza reagierte ungehalten. »Ich bin nicht gänzlich unbekannt.«
Es folgte ein kurzes Schweigen, während sie innerlich schäumte.
»Wir werden mehrere Tage unterwegs sein«, sagte er sorglos.
»Nun, ich wünschte, das hätten Sie mir vorher mitgeteilt. Ich habe nur eine Garnitur zum Wechseln dabei.«
»Ich auch.«
»Waschen Sie sich etwa nicht?«
Er lachte schallend. »Bekäme ich nur jedes Mal ein Pfund, wenn mich das ein Europäer fragt! Heute übernachten wir im Zelt und morgen auch. Also nein.«
»So habe ich das nicht gemeint.« Sie war überzeugt, dass er sie richtig verstanden hatte, ließ es aber dabei bewenden. »Wo zelten wir?«
»In der Wüste. Aber keine Sorge, Sie werden nicht allein schlafen. Eine Dienerin wird bei Ihnen sein. Sie und andere folgen uns mit etwas Abstand.«
»Und die Zelte?«
»Alles ist vorbereitet. Ich habe Männer vorausgeschickt, die sie aufbauen. Der Chandrabhaga-Markt findet jedes Jahr im Monat Kartik statt. Dies ist eine von den Briten weitgehend unerforschte Gegend. Deshalb meinte meine Mutter, Sie sollten sie sehen.«
»Wie steht es mit Benzin für den Wagen?«
Er nahm eine Hand vom Lenkrad und deutete in die freie Natur. »Gibt es ab und zu. Da halten wir an. Alles ist arrangiert.«
»Fahren Sie oft so weit wegen Ihrer Kamele?«
»Nein, die kaufen wir in Pushkar oder Nagaur.«
»Also?«
»Ich habe etwas zu erledigen. Während des Marktes versammeln sich Pilger am Ufer des heiligen Chandrabhaga. Sie werden außerdem Festungen, Paläste, wilde Tiere und einen friedlichen See zu sehen bekommen, wo ein Sommerpalast steht, den uns ein Cousin hinterlassen hat. Dort werden wir schließlich bleiben. Sie werden sicher auch die alte Stadt der Tempelglocken besichtigen wollen.«
»Ich bin keine Touristin, ich möchte die Menschen fotografieren«, erwiderte sie gereizt. »Und genau darum hat der Vizekönig schließlich gebeten. Keine Amateurfotos. Wir bauen in Neu-Delhi ein Archiv auf. Laut Clifford geht es darum, das Leben in den Fürstenstaaten mit dem Leben in Britisch-Indien zu vergleichen.«
»Zu unserem Nachteil zweifellos.«
»Überhaupt nicht«, widersprach sie heftig. »Wie auch immer, ich hoffe, meine Fotos in einer Ausstellung zu zeigen, wenn ich einen Förderer finde.«
»Nun, seien Sie vorsichtig. Chatur wird Sie bestimmt für eine Spionin halten.« Er lachte. »Sind Sie eine?«
»Natürlich nicht. Und wer ist überhaupt Chatur?«
»Unser Dewan, der oberste Hofbeamte. Er kümmert sich um alles.«
Sie schwieg.
»Händler aus fernen Teilen von Rajputana, Madhya Pradesh und Maharashtra kommen zu dem Markt. Da werden Sie allerhand Menschen fotografieren können.«
»Und Indira?«
»Ja, die auch.«
»Möchten Sie mir von ihr erzählen?«
»Am besten, Sie lernen sie selbst kennen. Übrigens nehme ich zurück, was ich über Ihre Haare gesagt habe. In der Sonne sind sie rötlich oder golden, nicht kamelfarben.«
»Honigfarben«, murmelte sie, musste aber lächeln.
Sie fuhren an einigen Siedlungen mit einem Brunnen vorbei und ab und zu an kleinen Dörfern, wo Mais, Linsen und Hirse angebaut wurden. Als sie grasende Ziegen-, Schaf- und sogar Kamelherden sahen, deutete der Prinz nach draußen. »Wo diese Gräser wachsen, Khimp und Akaro, gibt es tief im Boden Wasser. Manchmal große Reservoirs. Es kann jedoch über dreihundert Fuß tief liegen.«
»Brunnen zu bohren ist sicher kostspielig, nehme ich an.«
Er nickte. »Manche Frauen laufen jeden Tag kilometerweit zu den großen Wasserspeichern. Das Thema Wasser interessiert mich. Wir sind abhängig vom Monsunregen, der die Vorratsbehälter füllt, und dieses Jahr hat es wenig geregnet, voriges Jahr auch. Das Leben ist mitunter hart. Man kann eine Wüste nicht erobern, man kann nur sein Möglichstes tun, um sie zu schützen.«
»Ich brauche Wasser, um meine Fotografien zu entwickeln.«
»Und das könnte Ihre Pläne vereiteln.«
Am Abend saßen Eliza und der Prinz im Schneidersitz am Lagerfeuer zwischen würdevollen Männern mit bunt gemustertem Turban. Es war kühl, die Luft angenehm. Ein leichter Wind trug den Geruch von Wüstensand heran, und aus dem Topf über dem Feuer duftete es nach Gewürzen. Eliza war überrascht, dass sie so bereitwillig akzeptiert wurde, erkannte dann aber, dass sie das nur Jayant verdankte. Als er ihr ein großes Glas Milch anbot, fiel ihr auf, wie seine Haut im Feuerschein glänzte.
»Kamelmilch«, sagte er. »Sehr nahrhaft und erfrischend. Kosten Sie.«
Sie trank und stimmte ihm zu, dass sie guttat.
»Aber trinken Sie niemals Asha.«
»Was ist das?«
Er lachte. »Ein starkes Getränk. Das haut Sie um. Ich spreche aus Erfahrung.«
Einer der Männer begann zu trommeln, ein anderer schlug leise Gebetsglöckchen an, und als Rauch aufstieg, war Eliza wie berauscht von der Zeitlosigkeit der Szene. Das Dienstmädchen saß neben ihr und würde auch bei ihr im Zelt schlafen. Dadurch fühlte sich Eliza nicht bedroht, obwohl sie ein bisschen nervös war, weil sie mit so vielen Männern in der Wildnis übernachtete.
Am nächsten Tag, nach einer überraschend kühlen Nacht auf einem traditionellen Charpai, erwachte Eliza in der grauen Dämmerung vom Klang von Stimmen. Sie reckte sich und wollte den Augenblick noch ein wenig genießen, aber die Gerüche des Frühstücks waren verlockend, und sie hatte einen Bärenhunger. Außerdem war auch das Mädchen schon aufgestanden. Daher warf Eliza die Decke zurück, und ohne einen Gedanken ans Waschen zu verschwenden, verließ sie das Zelt. In den wenigen Momenten hatte sich das Licht bereits verändert. Ein außerordentlich schöner Morgen empfing sie. Am Horizont färbte sich der Himmel rotviolett und ging nach oben hin in ein blasses Pfirsichgelb über. Nirgends war eine Wolke zu sehen. Das zarte Licht warf einen sanften Schein über das flache Land, das sich scheinbar endlos erstreckte. In einiger Entfernung entdeckte Eliza einen provisorischen Stall, gebaut aus Holzpfählen und einer Zeltplane, die Schatten spenden sollte, und eine Herde Ziegen, die von den spärlichen Büschen fraßen. Das Nomadenleben musste sehr einsam sein, auch wenn es vielleicht manche Entschädigung bereithielt.
Eliza war angenehm überrascht, von einem lächelnden Prinzen begrüßt zu werden. Sein stolzes Gesicht sah weicher als gewöhnlich aus. Es war aber nicht nur das. Er wirkte insgesamt anders als bisher, und sie erkannte, dass dieser neue, entspannte Mann bei einem Leben unter freiem Himmel in seinem Element war. Jayant trug eine dunkle europäische Hose und darüber ein dunkelgrünes Oberhemd mit offenem Kragen. Sie nahm sich vor, ihn später zu fragen, ob sie ihn fotografieren dürfe.
Während einer sättigenden Mahlzeit aus Hülsenfrüchten und Reis, die einer der Männer über dem Feuer zubereitet hatte, lachte er und scherzte mit den anderen. Er verzichtete auf Förmlichkeit und war offensichtlich gutgelitten. Eliza bemerkte seine Lachfältchen und dachte, dass die nachgewachsenen Bartstoppeln ihn zugänglicher erscheinen ließen.
»Zelten Sie häufig?«, fragte sie.





























