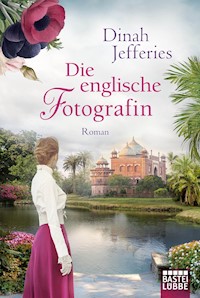9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine emotionale Familiengeschichte voller Geheimnisse vor der exotischen Kulisse Sri Lankas
Sri Lanka in den 1920er Jahren. Die junge Engländerin Gwen Hooper trifft mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Laurence in der familieneigenen Teeplantage ein. Dort bezieht das Paar eine traumhafte Villa, und Gwen fühlt sich wie im Paradies. Doch warum verhält sich ihr eigentlich sehr liebevoller Ehemann bisweilen so seltsam? Und warum macht er ein Geheimnis um seine verstorbene erste Ehefrau? Als Gwen schließlich Zwillinge zur Welt bringt, wird sie mit einer entsetzlichen Wahrheit konfrontiert, die sie zu zerstören droht ...
Eine fesselnde Geschichte um die Selbstfindung einer jungen Frau, um Schuld, Verrat und wohlgehütete Geheimnisse
Platz 1 der Sunday Times Bestsellerliste
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Dinah Jefferies
Die Frau des Teehändlers
RomanÜbersetzung aus dem Englischen von Angela Koonen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Tea Planter’s Wife«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by Dinah Jefferies
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Kirstin Osenau
Umschlagmotiv: © Masterfile/Robert Harding Images; Peonies, engraved by Prevost (colour litho), Redoute, Pierre Joseph (1759–1840) (after)/Private Collection/Photo © Christie’s Images/Bridgeman Images; © Arcangel Images/CollaborationJS; © shutterstock: tommaso lizzul | vectorkat | 06photo
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-1309-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
PROLOG
Ceylon, 1913
Die Frau hob den schmalen weißen Briefumschlag an die Lippen und zögerte. Während sie ihre Entscheidung überdachte, lauschte sie den lieblichen Tönen einer fernen singhalesischen Flöte und drehte den Umschlag spielerisch zwischen den Fingern. Dann klebte sie ihn zu und lehnte ihn gegen die Vase, in der die roten Rosen welkten.
Am Fußende des Himmelbetts stand der alte Diwan. Dunkles Holz und Seidenmoiré mit lederner Sitzfläche, unter der sich Stauraum verbarg. Sie hob sie an, nahm ihr cremeweißes Hochzeitskleid heraus und drapierte es über die Rückenlehne eines Stuhls. Naserümpfend nahm sie den Geruch von Mottenkugeln wahr.
Sie wählte eine Rose aus, brach die Blüte ab und schaute zu ihrem Kind, dankbar, dass es noch schlief. Vor der Frisierkommode hielt sie sich die Blüte an die blonden Haare. So fein und seidig, hatte er immer gesagt. Kopfschüttelnd warf sie die Rosenblüte beiseite. Nicht heute.
Auf dem Bett lagen die Säuglingssachen in wahllosen Häufchen. Mit den Fingerspitzen berührte sie ein frisch gewaschenes Wolljäckchen. Stundenlang hatte sie daran gestrickt, bis ihr die Augen brannten. Daneben lag das weiße Seidenpapier bereit. Ohne weiteres Zögern faltete sie das blaue Jäckchen zusammen, hüllte es in das dünne Papier und trug es zum Diwan, um es hineinzulegen.
Jedes einzelne Kleidungsstück wurde zusammengelegt, in Papier eingeschlagen und hineingepackt, zu den Wollmützen, Babyschühchen, Nachthemdchen und Strampelanzügen. Blau, weiß, blau, weiß. Zuletzt kamen die Mulltücher und Frotteewindeln, die sie Kante auf Kante faltete. Als sie fertig war, betrachtete sie prüfend die Arbeit ihres Vormittags. Der Anblick ließ keinen Zweifel mehr in ihr aufkommen, trotz allem, was er bedeutete.
Rasch sah sie nach dem Kind. Die flatternden Lider kündigten sein Aufwachen an. Sie musste sich beeilen. Das Kleid, für das sie sich entschieden hatte, war aus Seide, leuchtend seegrün, nicht ganz knöchellang und hatte eine hoch sitzende Schärpe. Es war ihr Lieblingskleid und stammte aus Paris. Sie hatte es bei der Abendgesellschaft getragen. In dieser Nacht war sie schwanger geworden, dessen war sie sicher. Sie hielt inne. Würde es als verletzende Anspielung verstanden werden, wenn sie es trüge? Das ließ sich schwer einschätzen. Mir gefällt die Farbe, sagte sie sich. Ich trage es vor allem der Farbe wegen.
Das Kind wimmerte und fing an, sich zu beschweren. Sie schaute auf die Uhr, hob es aus der Wiege und setzte sich in den Stillsessel am Fenster, wo ein wenig Zugluft ihr kühlend über die Haut strich. Die Sonne stand hoch am Himmel, und es wurde bereits heiß. Irgendwo im Haus bellte ein Hund, und vom Küchentrakt wehten Essensgerüche heran.
Sie knöpfte ihr Nachthemd auf, um eine blasse geäderte Brust frei zu machen. Das Kind fing an zu saugen. Es hatte kräftige Kiefer. Ihre Brustwarzen waren rissig und wund, und um den Schmerz auszuhalten, musste sie sich auf die Lippe beißen. Sie lenkte sich ab, indem sie ihren Blick durch das Zimmer wandern ließ. Alles war mit Erinnerungen verbunden: der geschnitzte Schemel aus dem Norden, die Nachttischlampe, für die sie den Schirm genäht hatte, der Teppich aus Indochina.
Als sie dem Kind über die Wange streichelte, hörte es auf zu saugen, hob das Händchen und griff nach ihrem Gesicht. Ein tief berührender, inniger Moment. Das wäre der Augenblick für Tränen gewesen.
Nach dem Wickeln legte sie es auf das Bett und hüllte es in ein weiches Häkeltuch. Als sie fertig angekleidet war, nahm sie es in einen Arm und schaute noch ein letztes Mal durch das Zimmer. Sie schloss den Deckel des Diwans, warf die Rosenblüte in den Papierkorb und strich über die Rosenköpfe in der Vase, die dabei Blätter verloren. Sie fielen an dem Briefumschlag vorbei und landeten wie Blutspritzer auf dem dunklen Holzboden.
Sie zog die französischen Fenster auf, um einen Blick in den Garten zu werfen, und sog die von Jasminduft geschwängerte Luft ein. Der Wind hatte sich gelegt. Die Flöte war verstummt. Sie hatte mit Angst gerechnet, stattdessen fühlte sie sich erleichtert. Das war alles, und es war genug. Entschlossen ging sie hinaus, tat einen unvermeidlichen Schritt nach dem anderen, und als sie das Haus hinter sich ließ, stellte sie sich das zarteste Lila vor, die Farbe der Gelassenheit.
ERSTER TEIL
Das neue Leben
1
Zwölf Jahre später, Ceylon, 1925
Den Sonnenhut in der Hand, lehnte sich Gwen an die salzverkrustete Reling und schaute wieder nach unten. Sie hatte die wechselnde Farbe des Meeres seit einer Stunde beobachtet und Papierschnipsel, Orangenschalen und Gemüseabfälle vorbeitreiben sehen. Da die Farbe von Dunkeltürkis zu Grau übergegangen war, wusste sie, dass es nicht mehr lange dauern würde. Sie beugte sich ein Stückchen hinaus, um einem silbernen Stück Stoff hinterherzusehen.
Als das Schiffshorn tutete, laut, anhaltend und sehr nah, ließ sie erschrocken die Reling los. Dadurch glitt ihr das Satintäschchen mit dem feinen Perlenzugband, das Abschiedsgeschenk ihrer Mutter, vom Handgelenk und fiel über Bord. Hastig griff sie danach, aber zu spät. Es wirbelte in die Tiefe und versank im schmutzigen Wasser. Mitsamt ihrem Geld und Laurence’ Brief.
Sie blickte sich um, und in ihr regte sich das Unbehagen, das sie seit der Abreise von England nie ganz hatte abschütteln können. Du kannst von Gloucestershire kaum weiter weg sein als in Ceylon, hatte ihr Vater gesagt. Während sein Satz in ihrem Inneren nachhallte, drang überraschend eine andere Stimme an ihr Ohr, die eindeutig zu einem Mann gehörte, aber ungewöhnlich schmeichelnd klang.
»Neu in Asien?«
Mit ihren violetten Augen und dem blassen Teint zog sie viel Aufmerksamkeit auf sich, daran war sie gewöhnt. Sie drehte sich um und musste in die Sonne blinzeln.
»Ich … Ja. Ich reise zu meinem Mann. Wir haben kürzlich geheiratet.« Sie stockte und konnte sich gerade noch besinnen, nicht weiterzuplappern.
Vor ihr stand ein mittelgroßer, breitschultriger Mann mit einer kräftigen Nase und hellbraunen Augen. Seine schwarzen Brauen und die dunkle, glänzende Haut machten sie sprachlos. Ein bisschen nervös starrte sie ihn an, bis er sie freimütig anlächelte.
»Sie haben Glück. Im Mai ist die See viel rauer. Ich nehme an, er ist Plantagenbesitzer, Ihr Mann«, sagte er.
»Wie kommen Sie darauf?«
»Es gibt gewisse Typen.«
Gwen schaute an sich hinunter auf ihr beigefarbenes Kleid. Es hatte eine tiefe Taille, war aber langärmlig und hochgeschlossen. Sie wollte kein »gewisser Typ« sein, sah aber ein, dass sie, abgesehen von dem Chiffonschal, trist erscheinen könnte.
»Ich habe Ihr Missgeschick gesehen. Der Verlust Ihrer Tasche tut mir leid.«
»Das war dumm von mir«, sagte sie und hoffte inständig, nicht zu erröten.
Wäre sie mehr wie ihre Cousine Fran, würde sie jetzt eine Unterhaltung mit dem Fremden anfangen. Stattdessen betrachtete sie den kurzen Austausch als beendet und drehte sich wieder zur Reling hin, um zuzusehen, wie sich das Schiff Colombo näherte. Über der flimmernden Stadtkulisse erstreckte sich ein kobaltblauer Himmel bis zu fernen violetten Bergen. Es gab Schatten spendende Bäume, und Schwärme von Möwen kreisten schreiend über unzähligen Booten. Kribbelnde Erregung erfasste sie. Laurence hatte ihr gefehlt, und einen Moment lang erlaubte sie sich, von ihm zu träumen. Träumen konnte sie mühelos, aber die Wirklichkeit war aufregend genug und verursachte ihr Schmetterlinge im Bauch. Sie atmete tief die Hafenluft ein, und statt des erwarteten salzigen Geruchs nahm sie andere kräftige Aromen wahr.
»Wonach riecht es hier?«, fragte sie und drehte den Kopf nach dem Mann, der noch an derselben Stelle stand.
Er schnupperte. »Zimt und wahrscheinlich Sandelholz.«
»Es ist etwas Süßes dabei.«
»Jasmin. In Ceylon gibt es viele blühende Pflanzen.«
»Wie hübsch!«, sagte sie. Aber zu den angenehmen Gerüchen gesellte sich ein abstoßender.
»Ich fürchte, es riecht auch nach Abwasser.«
Sie nickte. Vielleicht war es das.
»Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Mein Name ist Savi Ravasinghe.«
»Oh.« Sie stutzte. »Sie sind … Ich habe Sie beim Dinner nicht gesehen.«
Er wurde ernst. »Kein Passagier der ersten Klasse, wollten Sie wohl sagen? Ich bin Singhalese.«
Jetzt erst bemerkte sie, dass er hinter dem Seil stand, das die Reisenden der ersten Klasse von den anderen trennte. »Es freut mich, Sie kennenzulernen.« Sie zog sich den weißen Handschuh aus. »Ich bin Gwendolyn Hooper.«
»Dann müssen Sie Laurence Hoopers neue Frau sein.«
Sie nickte verblüfft und fasste an den großen Ceylon-Saphir an ihrem Ring. »Sie kennen meinen Mann?«
Er neigte den Kopf. »Ich bin ihm begegnet, ja. Aber jetzt muss ich mich verabschieden.«
Erfreut über die Begegnung, streckte sie ihm die Hand hin.
»Ich hoffe, Sie werden in Ceylon sehr glücklich, Mrs. Hooper.« Er ignorierte ihre Geste und legte die Hände vor der Brust aneinander, wobei er eine Verbeugung andeutete. »Mögen sich Ihre Träume erfüllen!« Mit geschlossenen Augen hielt er einen Moment lang inne, dann entfernte er sich.
Gwen war ein wenig befremdet. Da sie jedoch an Wichtigeres zu denken hatte, ging sie schulterzuckend darüber hinweg. Sie sollte sich lieber ins Gedächtnis rufen, welche Anweisungen Laurence ihr in dem Brief gegeben hatte.
Zum Glück gingen die Passagiere der ersten Klasse zuerst von Bord und damit auch sie. Dabei kam ihr der Singhalese wieder in den Sinn. Sie empfand eine gewisse Faszination. Einen so exotischen Menschen hatte sie noch nicht kennengelernt, und es wäre sicher unterhaltsam gewesen, wenn er ihr weiterhin Gesellschaft geleistet hätte. Aber natürlich durfte er das nicht.
Die glühende Hitze war ein Schock. Darauf war sie nicht vorbereitet gewesen. Ebenso wenig auf die vielen leuchtenden Farben und den Kontrast zwischen greller Sonne und schwarzem Schatten. Lärm drang auf sie ein: Glockengebimmel, das Hupen der Schiffshörner, die Stimmen der Passagiere und das Summen von Insekten, die sie umschwirrten. Im Strom der Leute fühlte sie sich wie das Treibgut auf dem Wasser. Als sich lautes Trompeten in die Geräuschkulisse mischte, blickte sie staunend zum Frachtkai, wo ein Elefant den Rüssel in die Höhe reckte.
Nachdem sie sich sattgesehen hatte, betrat sie das Hafenamt und traf Vereinbarungen für ihren Schrankkoffer. Dann setzte sie sich in der feuchtheißen Luft auf eine Bank, wo ihr einzig ihr Sonnenhut Schatten spendete. Ab und an verscheuchte sie damit die Fliegen, die ihr über das Gesicht krabbeln wollten. Laurence hatte versprochen, am Passagierkai auf sie zu warten. Bisher war jedoch nichts von ihm zu sehen. Sie versuchte, sich zu erinnern, was er ihr für den Notfall geraten hatte, und entdeckte Ravasinghe, der soeben am Ausgang der zweiten Klasse das Schiff verließ. Sie vermied es, zu ihm hinzusehen, und hoffte, seiner Aufmerksamkeit zu entgehen, da sie gerade aus Verlegenheit über ihre peinliche Lage errötet war. Gwen drehte sich weg und beobachtete, wie am anderen Ende des Kais Teekisten auf einen Lastkahn geladen wurden.
Der Abwassergestank hatte die angenehmen Düfte längst überlagert, und nun kamen andere üble Gerüche hinzu: von Fett, Ochsenkot, verwesendem Fisch. Und während sich der Kai mit verdrossenen Passagieren und aufdringlichen Straßenhändlern füllte, die wertlose Edelsteine und minderwertige Seide an den Mann bringen wollten, wurde ihr vor Nervosität schlecht. Was sollte sie tun, wenn Laurence ausblieb? Er hatte versprochen, sie abzuholen. Sie war erst neunzehn Jahre alt, und er wusste, dass sie ihr Zuhause auf Owl Tree Manor bisher nur ein, zwei Mal verlassen hatte, um mit Fran nach London zu fahren. Sie fühlte sich allein und mutlos. Zu schade, dass ihre Cousine nicht mit ihr zusammen gereist war, sie war gleich nach der Hochzeit von ihrem Anwalt weggerufen worden. Obwohl Gwen großes Vertrauen zu Laurence hatte, war sie doch unangenehm überrascht.
Eine Schar halb nackter brauner Kinder flitzte durch die Menschenmenge, bot Zimt an und bettelte mit großen, Mitleid heischenden Augen um Rupien. Ein Junge, der höchstens fünf Jahre alt war, streckte Gwen ein Bündel Zimtstangen hin. Sie hielt es sich schnuppernd an die Nase. Der Junge sprach mit ihr irgendein Kauderwelsch. Leider besaß sie keine einzige Rupie, und ihr englisches Geld hatte sie verloren.
Sie stand auf und schlenderte umher. Kurz kam ein wenig Wind auf, und irgendwo setzten beunruhigende, dunkel dröhnende Schläge ein. Trommeln, dachte sie. Recht laut, aber nicht so laut, dass sich der Rhythmus erkennen ließ. Sie wollte sich jedoch nicht weiter von ihrem Handkoffer entfernen, den sie bei der Bank gelassen hatte. Plötzlich hörte sie Ravasinghe rufen, und ihr brach der Schweiß aus.
»Mrs. Hooper! Sie dürfen Ihr Gepäck nicht unbewacht lassen.«
Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Ich habe es im Auge behalten.«
»Die Menschen hier sind arm und stehlen gelegentlich. Kommen Sie, ich werde Ihren Koffer tragen und Ihnen einen kühleren Platz zum Warten zeigen.«
»Das ist sehr freundlich von Ihnen.«
»Nicht der Rede wert.« Er nahm sie nur mit den Fingerspitzen beim Ellbogen und bahnte ihr einen Weg durch das Hafengelände. »Das ist die Church Street. Schauen Sie, da drüben am Rand von Gordon Gardens, da steht ein Suriya, auch bekannt als Tulpenbaum.«
Der dicke Stamm hatte tiefe Furchen wie die Falten eines weiten Rockes und ein Blätterdach, das mit seinen leuchtend orangen, glockenförmigen Blüten einen rötlichen Schatten warf.
»Darunter ist es ein wenig kühler. Auch wenn Sie bei der Nachmittagshitze kurz vor dem Monsun wenig Linderung verspüren werden.«
»Wirklich, Sie brauchen nicht bei mir zu bleiben.«
Er lächelte skeptisch. »Ich kann Sie in unserer Stadt nicht allein lassen. Sie sind hier fremd und ohne einen Penny.«
Sie nickte freundlich, denn im Grunde war sie froh über seine Gesellschaft.
Sie gingen zu dem bezeichneten Baum und verbrachten dort eine weitere Stunde. Gwen stand an den Stamm gelehnt, und unter ihrem Kleid tropfte der Schweiß. Worauf hatte sie sich nur eingelassen, als sie sich bereit erklärt hatte, in Ceylon zu leben? Der allgemeine Lärm war angeschwollen. Ravasinghe musste sehr laut reden, obwohl er nahe bei ihr stand.
»Sollte Ihr Mann bis drei Uhr nicht kommen, werden Sie es mir hoffentlich nicht übel nehmen, wenn ich vorschlage, dass Sie im Galle Face Hotel warten. Dort ist es luftig. Es gibt Ventilatoren und Getränke, und Sie werden es entschieden kühler finden.«
Es behagte ihr nicht, sich vom Hafen zu entfernen. »Aber wie soll Laurence wissen, dass ich dort bin?«
»Das wird er sich denken können. Jeder angesehene Brite geht ins Galle Face.«
Sie schaute zur imposanten Fassade des Grand Oriental. »Nicht in dieses?«
»Nein, bestimmt nicht. Glauben Sie mir.«
Ein Windstoß blies ihr eine Sandwolke ins Gesicht, und ihre Augen begannen heftig zu tränen. Hastig blinzelnd rieb sie sich die Lider und hoffte, dass er wirklich vertrauenswürdig war. Vielleicht hatte er recht. In dieser Hitze konnte man umkommen.
Ein Stück von ihnen entfernt, unter flatternden weißen Bändern, die in mehreren Reihen über die Straße gespannt waren, hatte sich ein kleiner Menschenauflauf gebildet. In der Mitte zwischen bunt gekleideten Frauen stand ein Mann in brauner Kutte und gab hohe, sich ständig wiederholende Töne von sich. Ravasinghe bemerkte Gwens Neugier.
»Der Mönch vollführt eine Reinigungszeremonie«, erklärte er. »Die Pirith wird oft am Totenbett verlangt, es verspricht einen guten Übergang. Er tut es vermutlich, weil an dieser Stelle etwas Schlimmes passiert ist, oder zumindest ist dort jemand gestorben. Der Mönch will den Ort von verbliebener Bosheit reinigen, indem er den Segen der Götter erbittet. In Ceylon glauben wir an Geister.«
»Sind die Leute hier Buddhisten?«
»Ich bin einer, aber es gibt auch Hindus und Mohammedaner.«
»Auch Christen?«
Er nickte.
Als sie um drei Uhr immer noch warteten, trat Ravasinghe einen Schritt weg und streckte auffordernd die Hand aus. »Nun?«
Da sie nickte, rief er einem Rikscha-Fahrer etwas zu, der nur mit einem Turban und einem schmutzig erscheinenden Lendentuch bekleidet war.
Schaudernd sah sie, wie mager der Mann war. »Ich werde doch sicher nicht da einsteigen müssen?«
»Wäre Ihnen ein Ochsenkarren lieber?«
Errötend sah sie zu einem Karren mit riesigen Holzrädern und einem Sonnendach aus Schilfmatten, unter dem ovale, orangefarbene Früchte aufgehäuft waren.
»Ich bitte um Vergebung, Mrs. Hooper. Ich sollte Sie nicht necken. Ihr Mann lässt mit solchen Karren Teekisten transportieren. Wir fahren gewöhnlich in einem kleinen Buggy mit nur einem Ochsen und einem Dach aus Palmblättern.«
»Wie heißen diese Früchte?«
»King Coconuts. Man verwendet nur ihren Saft. Haben Sie Durst?«
Sie hatte Durst, schüttelte aber den Kopf. Auf der Mauer hinter Ravasinghe klebte ein Plakat mit einer dunkelhäutigen Frau im gelb-roten Sari, die einen Korb auf dem Kopf balancierte. Sie war barfuß und hatte goldene Ringe an den Fußgelenken und einen gelben Schal über dem Kopf. Mazzawattee Tea stand auf dem Poster. Gwen bekam feuchte Hände, und ihr wurde plötzlich schummrig vor Angst. Sie war wirklich sehr weit von zu Hause weg.
»Wie Sie sehen, gibt es hier nur wenig Automobile«, sagte Ravasinghe gerade. »Und eine Rikscha ist sicherlich schneller. Wenn Ihnen dabei unwohl ist, können wir weiter warten, und ich versuche, einen Pferdewagen zu bekommen. Oder ich begleite Sie in der Rikscha, wenn Ihnen das angenehmer ist.«
In dem Moment fuhr ein großes schwarzes Automobil hupend zwischen den Fußgängern, Radfahrern und Ochsenkarren hindurch und verfehlte nur knapp etliche schlafende Hunde. Laurence, dachte Gwen erleichtert, doch als sie durchs Fenster des vorbeirollenden Fahrzeugs spähte, sah sie, dass zwei Europäerinnen darin saßen. Eine schaute Gwen an und verlieh ihrer Missbilligung regen Ausdruck.
Das trieb Gwen zur sofortigen Entscheidung. Gut, dann eben eine Rikscha, dachte sie.
Vor dem Galle Face Hotel standen dünne Palmen, die im Wind schwankten, und das Haus selbst wirkte an seinem Platz am Meer sehr britisch. Als Ravasinghe sich mit dem einheimischen Gruß herzlich lächelnd von ihr verabschiedet hatte, tat es ihr leid, ihn weggehen zu sehen. Aber sie begab sich an den zwei geschwungenen Treppen vorbei in den einigermaßen kühlen Palmensaal und ließ sich dort nieder. Sie fühlte sich augenblicklich wie zu Hause. Froh, sich von dem Ansturm der Eindrücke erholen zu können, schloss sie die Augen. Sollte Laurence jetzt eintreffen, böte sie ein jämmerliches Bild, und das wollte sie keinesfalls. Sie nippte an ihrer Tasse Ceylon-Tee und ließ den Blick über die Sitzgruppen schweifen. In einer Ecke wies ein diskretes Schild den Weg dorthin, wo sich Damen die Nase pudern konnten.
In dem süß duftenden, mit vielen Spiegeln versehenen Raum spritzte sie sich Wasser ins Gesicht und legte einen Tropfen Après L’Ondée auf, das sie zum Glück in den Handkoffer und nicht in ihr Seidentäschchen gepackt hatte. Gwen fühlte sich klebrig. Der Schweiß rann ihr die Arme hinunter. Sie steckte sich die Haare neu hoch, sodass sie im Nacken ordentlich saßen. Sie seien die krönende Pracht an ihr, hatte Laurence gesagt. Wenn sie die Haarnadeln herauszog, hatte sie lange dunkle Locken. Als sie einmal bemerkt hatte, sie überlege, sie nach der Flapper-Mode kurz zu tragen wie Fran, hatte er ein entsetztes Gesicht gemacht, im Nacken eine Locke herausgezupft und sich über Gwen geneigt, um sein Kinn an ihrem Scheitel zu reiben. Danach legte er die Hände an ihre Wangen und blickte sie an.
»Schneide dir nie die Haare ab! Versprich mir das!«
Sie nickte nur und sagte nichts, weil die Berührung ein köstliches Kribbeln und alle möglichen, unbekannten Empfindungen auslösten.
Ihre Hochzeitsnacht war wundervoll gewesen und ebenso die Woche danach. In ihrer letzten gemeinsamen Nacht waren sie beide nicht zum Schlafen gekommen, und er hatte vor Morgengrauen aufstehen müssen, um rechtzeitig nach Southampton und an Bord des Schiffes zu gelangen, das ihn nach Ceylon bringen würde, wo er geschäftlich zu tun hatte. Er war enttäuscht, weil sie ihn nicht begleitete, aber sie versicherten einander, die Zeit werde schnell vorbeigehen, und er nahm es ihr nicht übel, dass sie auf Fran warten wollte. Sowie er fort war, bedauerte sie die Entscheidung und wusste nicht, wie sie die Trennung ertragen sollte. Als Fran dann wegen einer Immobilie, die sie vermieten wollte, noch länger in London aufgehalten wurde, entschied sich Gwen, allein zu reisen.
Mit ihrem bezaubernden Aussehen hatte Gwen keinen Mangel an Kavalieren gehabt, doch sie hatte sich auf den ersten Blick in Laurence verliebt. Fran hatte sie zu einem Musical-Abend nach London mitgenommen, und als Laurence Hooper sie angegrinst hatte und auf sie zugestürmt war, um sich vorzustellen, war sie verloren gewesen. Danach sahen sie sich jeden Tag, und als er ihr den Heiratsantrag machte, sah sie mit glühendem Gesicht zu ihm auf und sagte ohne Zögern Ja. Ihre Eltern waren nicht besonders erfreut, dass ein siebenunddreißig Jahre alter Witwer ihre Tochter heiraten wollte. Ihr Vater brauchte ein bisschen Überredung, war aber beeindruckt, als Laurence anbot, die Leitung der Plantage einem Verwalter zu übertragen und wieder in England zu leben. Gwen wollte davon jedoch nichts hören. Wenn sein Herz an Ceylon hing, dann wollte sie mit ihm dort leben.
Als sie die Tür der Damentoilette hinter sich schloss, sah sie Laurence mit dem Rücken zu ihr in der großen Eingangshalle stehen, und ihr stockte der Atem. Sie fasste an die Perlenkette in ihrem Nacken, rückte den blauen Tropfenanhänger zurecht, sodass er in der Mitte saß, und blieb, beeindruckt von der Intensität ihrer Empfindungen, still stehen, um Laurence’ Anblick in sich aufzunehmen. Er war groß und breitschultrig, hatte kurzes hellbraunes Haar, das an den Schläfen grau war. Als ehemaliger Zögling des Winchester College sah er aus, als strömte ihm Selbstvertrauen durch die Adern, wie ein Mann, den Frauen bewunderten und Männer respektierten. Doch er las Robert Frost und William Butler Yeats. Dafür liebte sie ihn – und weil er bereits wusste, dass sie weit entfernt war von dem sittsamen Mädchen, das die Leute in ihr sehen wollten.
Als hätte er ihren Blick gespürt, drehte er sich um. Sie sah seine Erleichterung und das breite Lächeln, mit dem er auf sie zuschritt. Er hatte braune Augen und ein markantes Kinn. Das Grübchen daran und die Art, wie seine Haare sich an der Stirn wellten und an dem zweifachen Wirbel am Hinterkopf abstanden, fand sie unwiderstehlich. Weil er Shorts trug, konnte sie sehen, wie braun seine Beine waren, und hier wirkte er viel rauer als im kühlen England auf dem Land.
Übermütig rannte sie ihm entgegen. Einen Moment lang hielt er sie von sich weg, dann zog er sie in die Arme, drückte sie an sich, dass sie kaum noch Luft bekam, und drehte sich mit ihr im Kreis. Ihr Herz raste noch, als er sie endlich losließ.
»Du ahnst nicht, wie sehr ich dich vermisst habe«, sagte er. Seine Stimme klang tief und ein bisschen schroff.
»Woher wusstest du, dass ich hier auf dich warte?«
»Ich habe den Hafenmeister gefragt, wohin die schönste Frau Ceylons gegangen ist.«
Sie lächelte. »Wie schmeichelhaft, aber das bin ich natürlich nicht.«
»Das Hinreißendste an dir ist, dass du nicht weißt, wie schön du bist.« Er nahm ihre Hände. »Es tut mir sehr leid, dass ich zu spät gekommen bin.«
»Das ist nicht schlimm. Ich hatte einen Aufpasser. Er sagte, er kennt dich. Ravasinghe heißt er, glaube ich.«
»Savi Ravasinghe?«
»Ja.« Sie fühlte ein Kribbeln im Nacken.
Er zog die Brauen zusammen. Zu gern hätte sie die Fältchen berührt, mit denen er älter aussah, als er war. Er hatte schon ein bewegtes Leben hinter sich, und das machte ihn für sie umso anziehender.
»Nun gut«, sagte er und gewann seine gute Laune rasch zurück. »Jetzt bin ich hier. Das verflixte Auto hat Schwierigkeiten gemacht, aber zum Glück konnte McGregor es reparieren. Ich werde uns hier ein Zimmer besorgen. Zum Zurückfahren ist es jetzt zu spät.«
Nachdem die Formalitäten an der Rezeption erledigt waren, zog er sie an sich, und als seine Lippen ihre Wange streiften, ging ihr Atem unwillkürlich heftiger.
»Dein Schrankkoffer wird mit dem Zug transportiert«, sagte er. »Jedenfalls bis Hatton.«
»Ich weiß. Ich habe mit dem Mann im Hafenbüro gesprochen.«
»Richtig. McGregor wird einen Kuli anweisen, ihn am Bahnhof mit dem Ochsenkarren abzuholen. Kommst du mit den Sachen in dem Handkoffer bis morgen aus?«
»Einigermaßen.«
»Möchtest du Tee?«, fragte er.
»Du?«
»Was denkst du wohl?«
Vor Freude hätte sie am liebsten laut gelacht, grinste aber still, während Laurence an der Rezeption bat, ihnen das Gepäck sofort hinaufbringen zu lassen.
Arm in Arm gingen sie nach oben. Hinter der Biegung der Treppe überkam Gwen eine unerwartete Scheu. Er ließ sie los, um selbst voranzugehen und aufzuschließen, dann stieß er die Tür auf.
Sie nahm die letzten paar Stufen und schaute in das Zimmer.
Durch die hohen Fenster fiel die Abendsonne herein und färbte die Wände rosa. Die Nachttischlampen brannten bereits, und es duftete nach Orangen. Alles sprach deutlich von Intimität. Vor Verlegenheit wurde ihr heiß. Der Augenblick, den sie herbeigesehnt hatte, war da, und nun stand sie zögernd in der Tür.
»Gefällt es dir nicht?«, fragte er mit erwartungsvollem Blick.
Ihr schlug das Herz bis zum Hals.
»Liebling?«
»Es ist wunderbar«, brachte sie hervor.
Er kam zu ihr und löste ihr die Haare. »So ist es schöner.«
Sie nickte. »Sie werden jeden Moment das Gepäck hereinbringen.«
»Ein paar Augenblicke sind uns wohl vergönnt«, widersprach er und berührte mit der Fingerspitze ihre Unterlippe. Doch wie aufs Stichwort klopfte es an der Tür.
»Ich gehe das Fenster öffnen«, sagte sie, froh über einen Vorwand, dem Zimmer den Rücken zukehren zu können, damit der Hoteldiener ihre törichte Angst nicht sah.
Das Zimmer ging aufs Meer hinaus. Sie drückte das Fenster halb auf und schaute über das Wasser, das silbrig und golden in der Sonne schimmerte. Auch in England hatten sie schon eine Woche zusammen verbracht, aber England war weit weg, und bei dem Gedanken fühlte sie sich den Tränen nahe. Sie schloss die Augen und hörte, wie der Diener das Gepäck abstellte. Sowie sich die Tür hinter ihm schloss, drehte sie sich zu Laurence um.
Er grinste schief. »Stimmt etwas nicht?«
Sie senkte den Kopf und starrte auf den Boden.
»Gwen, sieh mich an!«
Sie blinzelte hastig. Es wurde still. Ihre Gedanken rasten. Wie sollte sie erklären, was in ihr vorging, nachdem sie in einer Welt angekommen war, die sie nicht verstand? Aber es war nicht nur das. Unter seinem Blick fühlte sie sich nackt, und das verunsicherte sie. Damit es nicht noch peinlicher wurde, hob sie den Kopf und ging sehr langsam ein paar Schritte auf ihn zu.
Er wirkte erleichtert. »Jetzt war ich einen Moment lang beunruhigt.«
Ihre Beine fingen an zu zittern. »Ich bin bloß töricht. Alles ist noch so neu … Du bist so neu.«
»Wenn das alles ist, das lässt sich leicht beheben«, meinte er und kam lächelnd auf sie zu.
Sie lehnte sich an ihn, und ihr wurde schwindelig, als er sich an dem Knopf ihres Kleides zu schaffen machte.
»Lass mich dir helfen.« Sie griff hinter sich und schob den Knopf durch die Schlinge. »Da gibt es einen Trick.«
Er lachte. »Den muss ich unbedingt lernen.«
Eine Stunde später war Laurence eingeschlafen. Nach der langen Wartezeit war die Leidenschaft groß gewesen, intensiver als in der Hochzeitsnacht. Gwen dachte an die ersten Augenblicke ihrer Ankunft. Es war ihr vorgekommen, als saugte die Hitze ihr die Kraft aus. Ein Irrtum. Sie hatte reichliche Kraftreserven gehabt, auch wenn sich ihre Arme und Beine jetzt schwer anfühlten. Schläfrig lauschte sie den Geräuschen der Außenwelt, die durchs Fenster hereinwehten. Neben Laurence zu liegen kam ihr schon ganz natürlich vor, und sie schmunzelte über ihre Nervosität. Sie beugte den Kopf ein wenig in den Nacken, damit sie ihn betrachten und zugleich weiter seinen kräftigen Körper spüren konnte. Der Moment war vollkommen. Von allen anderen Empfindungen befreit, fühlte sie reine Liebe. Alles würde gut werden. Ein paar Minuten noch genoss sie seinen Geruch und sah zu, wie die Schatten im Zimmer länger wurden und die Dunkelheit hereinbrach. Dann schloss sie tief seufzend die Augen.
2
Zwei Tage danach wachte Gwen früh auf. Die Sonne schien durch die Musselinvorhänge. Sie freute sich darauf, mit Laurence zu frühstücken und sich von ihm herumführen zu lassen. Schnell setzte sie sich auf, um ihre Zöpfe zu lösen, dann schwang sie die Beine aus dem Bett und stellte die Füße auf das glatte, weiße Fell des Bettvorlegers. Spielerisch schob sie die Zehen hinein und fragte sich, von welchem Tier es wohl stammte. Auf dem Stuhl am Bett hatte jemand einen hellen seidenen Morgenmantel bereitgelegt. Sie stand auf und zog ihn sich über.
Am vergangenen Abend waren sie bei Sonnenuntergang auf der Plantage angekommen, die in einer hügeligen Landschaft lag. Gwen hatte vor Müdigkeit Kopfschmerzen gehabt, und das kräftige Rot-Violett des Abendhimmels hatte ihr in den Augen wehgetan, sodass sie kurz nach der Ankunft zu Bett gegangen war.
Jetzt tappte sie ans Fenster und zog die Vorhänge zur Seite. Mit einem tiefen Atemzug schaute sie in den ersten Morgen in ihrer neuen Welt und blinzelte in die Helligkeit. Der Lärm, der ihr entgegenschlug, war erstaunlich: ein fortwährendes Summen, Pfeifen und Zwitschern.
Ein lieblicher, blühender Garten senkte sich in drei Terrassen zum See hin ab, mit Pfaden, Stufen und Bänken, die geschickt darin verteilt standen. Der See war eine silberglänzende Pracht. Die gestrige Autofahrt, die furchterregenden Haarnadelkurven, Schluchten und holprigen Straßen, auf denen sie mit Übelkeit gerungen hatte, waren augenblicklich vergessen. Rings um den See erstreckte sich ein samtig grüner Gobelin aus Teesträuchern, symmetrisch und schnurgerade, zwischen denen die Pflückerinnen in ihren leuchtend bunten Saris wie hineingestickte Vögel erschienen.
Vor ihrem Schlafzimmerfenster wuchs ein Pampelmusenbaum, daneben ein ihr unbekannter Baum, der voll kirschenartiger Früchte hing. Sie beschloss, sich welche zum Frühstück zu pflücken. Auf dem Tisch draußen saß ein kleines Tier, halb Affe, halb Eule, wie es schien, und starrte sie mit tellergroßen Augen an. Sie hatte in einem riesigen Himmelbett geschlafen, das von einem Mückennetz umgeben war. Das Laken war noch fast glatt. Sie fand es sonderbar, dass Laurence nicht die Nacht bei ihr verbracht hatte. Er hatte ihr wohl nach der Reise ungestörten Schlaf gönnen wollen und war in sein eigenes Zimmer gegangen. Als sie die Tür knarren hörte, fuhr sie herum. »Oh, Laurence, ich …«
»Lady, ich bin Naveena, ich soll Ihnen aufwarten.«
Gwen betrachtete die gedrungene kleine Frau, die in einem langen, blau-gelben Wickelrock und einer weißen Bluse vor ihr stand. Ihr rundes Gesicht war runzlig, und die dunklen verschatteten Augen gaben nicht das Geringste preis. Ein langer grauer Zopf hing ihr den Rücken hinunter.
»Wo ist Laurence?«
»Mr. Hooper ist zur Arbeit. Schon seit zwei Stunden.«
Ernüchtert setzte Gwen sich auf das Bett.
»Sie wünschen das Frühstück hier?« Naveena deutete auf den kleinen Tisch am Fenster. Einen Moment lang sahen sie einander schweigend an. »Oder auf der Veranda?«
»Ich möchte mich vorher waschen. Wo ist das Bad?«
Die Dienerin ging zur anderen Seite des Zimmers. Dabei verbreitete sie einen ungewöhnlich würzigen Duft.
»Hier, Lady. Hinter dem Wandschirm ist Ihr Badezimmer, aber der Latrinenkuli kommt noch.«
»Der Latrinenkuli?«
»Ja, Lady, er kommt bald.«
»Ist das Wasser heiß?«
Die Dienerin wackelte mit dem Kopf. Gwen wusste nicht recht, ob das Ja oder Nein bedeuten sollte, und ihre Verständnislosigkeit war ihr wohl anzusehen.
»Es gibt einen Holzheizkessel. Albezia-Holz. Heißes Wasser haben wir morgens und abends eine Stunde lang.«
Gwen nahm das gefasst auf und versuchte, selbstsicherer zu klingen, als sie sich fühlte. »Also gut. Ich werde mich waschen und dann draußen frühstücken.«
»Sehr wohl, Lady.«
Die Dienerin zeigte auf die französischen Fenster. »Die Tür zur Veranda. Ich werde gehen und wiederkommen. Bringe den Tee für Sie nach draußen.«
»Was für ein Tier ist das da?«
Die Dienerin schaute zum Fenster, doch das Tier war verschwunden.
Nach der feuchten Hitze in Colombo empfand Gwen den strahlenden, aber leicht kühlen Morgen als angenehm. Gleich nach dem Frühstück pflückte sie sich eine Kirsche von dem Baum, eine hübsche dunkelrote, und biss hinein. Doch sie schmeckte sauer, und Gwen spuckte sie aus. Sie zog sich ihren Schal um die Schultern und machte sich auf, das Haus zu erkunden.
Als Erstes ging sie den breiten, hohen Gang entlang, der von einem zum anderen Ende des Hauses führte. Der dunkle Holzboden glänzte, und an den Wänden hingen Öllampen. Sie schnupperte. Mit dem Zigarrengeruch hatte sie gerechnet, aber es roch auch stark nach Kokosöl und Politur. Laurence bezeichnete das Haus als »Bungalow«, doch es gab eine geschwungene Treppe, die von dem luftigen Flur in den ersten Stock führte. Gegenüber stand ein schöner Chiffonnier mit Einlegearbeiten aus Perlmutt, und daneben entdeckte Gwen eine Tür. Sie drückte sie auf und betrat einen geräumigen Salon.
Überrascht von der Größe, öffnete sie einen der vielen braunen Fensterläden und sah, dass man auch von hier auf den See blickte. Nachdem sie Licht hereingelassen hatte, schaute sie sich um. Die Wände waren in dem denkbar hellsten Blaugrün gestrichen und strahlten erfrischende Kühle aus. Es gab bequeme Sessel und zwei helle Sofas voller Kissen, die mit Vögeln, Elefanten und exotischen Blüten bestickt waren. Über der Rückenlehne des einen lag ein Leopardenfell ausgebreitet.
Den Boden bedeckten zwei Perserteppiche in Marineblau und Creme. Gwen streckte die Arme aus und drehte sich schwungvoll im Kreis. Hier gefiel es ihr. Sehr sogar.
Ein tiefes Knurren erschreckte sie, und sie stellte fest, dass sie einem schlafenden Hund auf die Pfote getreten war. Ein schwarzer Labrador?, überlegte sie. Vielleicht kein reinrassiger. Sie wich einen Schritt zurück und fragte sich, ob er wohl bissig war. In dem Moment kam ein Mann herein, der sich fast lautlos bewegte. Er war im mittleren Alter, hatte schmale Schultern, ein längliches, gelbbraunes Gesicht und trug einen Sarong, eine Jacke und einen Turban, alles in Weiß.
»Der alte Hund heißt Tapper, Lady. Mr. Hoopers Lieblingshund. Ich bin der Butler, und hier ist ein leichtes Mittagessen.« Er hob demonstrativ sein Tablett und stellte es auf einen Satz Tische. »Unser eigener Broken Orange Pekoe.«
»Tatsächlich? Ich habe gerade erst gefrühstückt.«
»Mr. Hooper wird nach zwölf zurückkommen. Sie werden das Pausenhorn hören, und dann kommt er.« Er deutete auf ein Regal beim Kamin. »Da liegen Zeitschriften für Sie.«
»Danke.«
Es war ein großer, mit Bruchsteinen eingefasster Kamin, daneben standen Zange, Schaufel und Schürhaken aus Messing und ein Korb mit Holzscheiten. Sie lächelte. Das versprach gemütliche Abende zu zweit am Feuer.
Bis zu Laurence’ Rückkehr blieb ihr noch eine Stunde. Darum ließ sie den Tee stehen und beschloss, sich draußen umzusehen. Da sie erst in der Abenddämmerung angekommen waren, hatte sie vom Haus wenig erkennen können. Sie ging zurück in den Eingangsflur, drückte einen der dunklen Türflügel auf, über denen ein hübsches Lünettenfenster Licht hereinließ, und fand sich auf der Treppe unter einem schattigen Vordach wieder. Ein kiesbestreuter Fahrweg, an dem abwechselnd blühende Tulpenbäume und Palmen standen, führte vom Haus weg und wand sich die Hügel hinauf. Einige Blüten lagen am Rand im Gras.
Gwen hatte Lust auf einen Spaziergang, ging aber zunächst um die Seite des Hauses zu einer überdachten Veranda, von der man ebenfalls auf den See blicken konnte. Sie hatte acht dunkle Holzpfeiler, einen Marmorboden und Korbmöbel, und der Tisch war bereits für den Lunch gedeckt. Entzückt beobachtete sie, wie ein gestreiftes Eichhörnchen an einem Pfeiler hinaufhuschte und hinter einem Deckenbalken verschwand.
Sie kehrte zurück zur Front des Hauses und wanderte den Fahrweg hinauf. Je höher sie kam, desto klebriger fühlte sie sich, aber sie wollte erst beim zwanzigsten Baum zurückblicken. Während sie zählte und den Rosenduft einatmete, wurde es heiß, doch zum Glück nicht so wie in Colombo. Zu beiden Seiten gab es breite Rasenstreifen mit Büschen, die große herzförmige Blätter und rosa-weiße Blüten hatten.
Beim zwanzigsten Baum zog sie sich das Tuch von den Schultern und drehte sich um. Alles flimmerte, der See, das rote Dach des Hauses, sogar die Luft. Sie atmete tief ein, als könnte sie die Schönheit in sich aufnehmen: die duftenden Blüten, die hinreißende Aussicht, das leuchtende Grün der Plantage, das Zwitschern der Vögel. Es war berauschend. Nirgends war es still, überall schwirrte, summte und raschelte es.
Von ihrem erhöhten Aussichtspunkt aus war der Grundriss des Hauses zu sehen. Die Rückseite verlief parallel zum See mit der überdachten Veranda zur Rechten, und an einer Seite war ein Anbau erfolgt, der den kurzen Schenkel eines L bildete. Daneben lag ein Hof, und ein Weg führte zu einer Wand hoher Bäume, wo er verschwand. Gwen atmete ein paar Mal tief die saubere Luft ein.
Das hässliche laute Tuten des Pausenhorns unterbrach die Ruhe. Sie hatte nicht bemerkt, wie die Zeit vergangen war. Ihr Herz schlug höher, als sie Laurence neben einem anderen Mann von den hohen Bäumen her zum Haus schreiten sah. Er war sichtlich in seinem Element, wirkte zupackend und dominant. Sie warf sich den Schal um die Schultern und sauste los. Aber den steilen Fahrweg hinunterzurennen war schwieriger, als ihn hinaufzuwandern, und nach ein paar Minuten rutschte sie auf den losen Kieseln aus, blieb mit dem Fuß an einer Wurzel hängen und stürzte. Der Aufprall trieb ihr den Atem aus der Lunge.
Als sie wieder Luft bekam und aufstehen wollte, konnte sie mit dem linken Fuß nicht auftreten. Sie rieb sich die aufgeschrammte Stirn, und ihr war so schwindlig, dass sie sich erst einmal hinsetzte. Es kündigten sich Kopfschmerzen an, die von der Sonne herrührten. Da es vorhin noch kühl gewesen war, hatte sie nicht an den Sonnenhut gedacht. Hinter den Bäumen war ein schriller Schrei zu hören, wie von einer Katze oder einem Kind, das sich wehgetan hatte. Oder vielleicht von einem Schakal. Sie wollte nicht abwarten, ob er zum Vorschein kommen würde, und zwang sich aufzustehen. Diesmal ließ sie sich vom Schmerz nicht beeindrucken und humpelte zum Haus zurück.
Als sie ins Blickfeld der Haustür gelangte, kam Laurence heraus und eilte ihr entgegen.
»Ich bin so froh, dich zu sehen!«, rief sie außer Atem. »Ich war dort oben, um die Aussicht zu genießen, und bin gestürzt.«
»Schatz, das ist gefährlich. Da gibt es Schlangen. Grasschlangen, Baumschlangen, die den Garten von Ratten freihalten. Und alle möglichen beißenden Ameisen und Käfer. Du solltest nicht allein spazieren gehen. Noch nicht jedenfalls.«
Sie zeigte zur Plantage hinüber. »Die Frauen dort sind auch im Freien, und ich bin nicht so zart besaitet, wie ich aussehe.«
»Die Tamilen kennen das Land«, hielt er ihr entgegen. »Aber egal. Halte dich an meinem Arm fest, dann bringe ich dich ins Haus. Ich werde Naveena bitten, dir den Knöchel zu verbinden. Ich kann auch den Arzt aus Hatton rufen, wenn du möchtest.«
»Naveena?«
»Die dir das Frühstück gebracht hat.«
»Ach, ja.«
»Sie war früher mein Kindermädchen, und ich mag sie. Wenn wir mal Kinder haben …«
Gwen zog die Brauen hoch und lächelte. Er grinste, dann beendete er den Satz. »… wird sie auf sie aufpassen.«
Sie streichelte über seinen Arm. »Und was werde ich dann tun?«
»Hier gibt es jede Menge Arbeit. Das wirst du bald sehen.«
Auf dem Weg ins Haus spürte sie seinen warmen Körper an ihrer Seite. Trotz des schmerzenden Knöchels setzte das vertraute Kribbeln im Unterleib ein, und sie fasste Laurence am Kinn und legte den Daumen in das Grübchen.
Nachdem ihr Fuß bandagiert war, setzten sie sich zusammen auf die überdachte Veranda.
»Und?«, fragte er mit einem Funkeln in den Augen. »Gefällt es dir hier?«
»Es ist wunderbar, Laurence. Ich werde hier sehr glücklich sein mit dir.«
»Ich mache mir Vorwürfe, weil du gefallen bist. Ich wollte gestern Abend noch mit dir gesprochen haben, aber deine Kopfschmerzen waren so schlimm, da habe ich es aufgeschoben. Es gibt ein paar Dinge, die du wissen musst.«
»So?« Sie blickte auf.
Er zog die Stirn kraus, und als er die Augen zusammenkniff, war klar, woher er die Runzeln hatte.
»Zu deiner Sicherheit: Halte dich aus den Angelegenheiten der Arbeiter heraus. Du brauchst dich um die Hütten nicht zu kümmern.«
»Die Hütten?«
»Da leben die Plantagenarbeiter und ihre Familien.«
»Aber das klingt interessant.«
»Ehrlich gesagt, gibt es da nicht viel zu sehen.«
Sie nahm das schulterzuckend hin. »Was noch?«
»Am besten gehst du nie ohne Begleitung irgendwohin.«
Sie schnaubte.
»Nur bis du mit allem vertraut bist.«
»Na gut.«
»Gestatte nur Naveena, dich im Nachthemd zu sehen! Sie wird dir jeden Morgen um acht den Tee ans Bett bringen.«
Gwen lächelte. »Und wirst du diesen Tee mit mir gemeinsam trinken?«
»Wann immer ich kann.«
Sie hauchte ihm einen Kuss entgegen. »Ich kann es kaum erwarten.«
»Ich auch nicht. Und nun mach dir keine Sorgen! Du wirst bald verstanden haben, wie hier alles abläuft. Morgen wirst du die Frauen anderer Plantagenbesitzer kennenlernen. Vor allem Florence Shoebotham. Sie ist ein komischer alter Vogel, könnte dir aber eine große Hilfe sein.«
»Ich habe gar nichts anzuziehen.«
Er grinste. »So gefällst du mir. McGregor hat schon jemanden zum Bahnhof geschickt, damit er deinen Koffer abholt. Und später werde ich dir das Hauspersonal vorstellen. Offenbar ist auch von Selfridges eine Kiste für dich gekommen. Mit Dingen, die du vor der Abreise bestellt hast, nehme ich an.«
Sie streckte die Arme über den Kopf. Bei dem Gedanken an das Waterford-Kristall und das schöne neue Abendkleid bekam sie augenblicklich gute Laune. Das Kleid war der letzte Schrei, kurz, mit gestuften Fransenbordüren in Silber und Rosa. Sie musste an den Tag in London denken, als Fran darauf bestanden hatte, dass sie es kaufte. Nur noch zehn Tage, dann würde Fran auch eintreffen. Eine Elster schwebte über den Tisch und schnappte sich ein Brötchen aus dem Korb. Gwen lachte, und Laurence fiel mit ein.
»Hier gibt es viele Tiere. Ich habe ein gestreiftes Eichhörnchen unters Dach flitzen sehen.«
»Es sind zwei. Sie haben da oben ein Nest. Sie tun aber nichts.«
»Mir gefällt das.« Gwen griff nach seiner Hand, und als er ihre an die Lippen zog, durchlief sie ein wohliger Schauder.
»Nur eins noch, Liebling. Fast hätte ich es vergessen, aber es ist wahrscheinlich das Wichtigste. Der Haushalt ist allein deine Angelegenheit. Ich werde mich in nichts einmischen. Das Personal hat dir zu gehorchen und nur dir.«
Er überlegte kurz.
»Du wirst feststellen, dass sich einige Missstände eingestellt haben. Die Dienerschaft konnte zu lange frei schalten und walten. Es mag ein wenig mühsam werden, sich durchzusetzen, aber du wirst sie dir schon erziehen.«
»Laurence, das wird mir Freude bereiten. Aber du hast mir noch gar nichts über die Plantage erzählt.«
»Nun, wir beschäftigen Tamilen. Das sind ausgezeichnete Arbeiter, im Gegensatz zu den Singhalesen. Hier wohnen gut fünfzehnhundert. Wir haben eine kleine Schule eingerichtet und gewähren Medikamente und ärztliche Behandlung. Sie bekommen diverse Zusatzleistungen und verbilligten Reis und haben einen Laden.«
»Und wie wird der Tee hergestellt?«
»In unserer Teefabrik. Das ist ein aufwendiges Verfahren. Irgendwann werde ich dich herumführen, wenn du möchtest.«
»Das wäre schön.«
»Gut. Nachdem das besprochen ist, schlage ich vor, du hältst ein Mittagsschläfchen«, sagte er und stand auf.
Die Arme um sich geschlungen, schaute Gwen über die Reste des Mittagessens. Sie holte tief Luft und atmete langsam aus. Das war der passende Moment. Als Laurence sich hinabbeugte, um sie auf die Stirn zu küssen, schloss sie die Augen und konnte ein freudiges Grinsen nicht unterdrücken, doch als sie die Augen öffnete, war er schon vom Tisch weggetreten.
»Wir sehen uns heute Abend«, sagte er. »Es tut mir sehr leid, Liebling, aber ich muss jetzt mit McGregor sprechen. Die Fabriksirene heult um vier, und ich werde außer Haus sein, doch schlaf ruhig weiter!«
Sie spürte, wie heiße Tränen ihr in die Augen stiegen, und tupfte sie mit ihrer Serviette weg. Laurence hatte viel Arbeit, das wusste sie, und natürlich ging die Plantage vor. Aber bildete sie sich das bloß ein, oder war ihr schöner, einfühlsamer Mann ein klein wenig distanziert?
3
Am nächsten Abend stand Gwen an ihrem Fenster und schaute in den Sonnenuntergang. Himmel und Wasser hatten fast den gleichen Goldton angenommen, und der See lag zwischen Hügeln in verschiedenen Sepiaschattierungen. Sie wandte sich ab und kleidete sich sorgfältig an, dann betrachtete sie sich im Spiegel. Die Dienerin hatte ihr geholfen, silberne Perlenschnüre durch die schwere Haarrolle im Nacken zu fädeln, und jetzt zupfte Gwen ein Löckchen daraus hervor. Laurence gab eine kleine Abendgesellschaft, um sie als die neue Hausherrin vorzustellen. Dafür wollte sie blendend aussehen, hatte sich aber entschieden, das neue Kleid für einen Abend mit Fran aufzuheben. Dann könnten sie zusammen Charleston tanzen.
Diesen Abend trug sie das Kleid aus hellgrüner Seide mit der Spitze am Ausschnitt, der ein wenig gewagter als bei ihren übrigen Kleidern war. Natürlich hatte es eine tief sitzende Taille und Chiffongodets, die am gefährlich kurzen Saum spitz herabhingen. Es klopfte an der Zimmertür.
»Herein.«
Laurence öffnete schwungvoll die Tür und blieb wie angewurzelt stehen, um sie anzustarren.
Er trug einen schwarzen Abendanzug mit weißem Hemd, weißer Weste und weißer Fliege und hatte sich offenbar an einem Scheitel versucht. Gwen zitterte unter seinem langen bewundernden Blick und hielt den Atem an.
»Ich … du … meine Güte, Gwendolyn!« Er schluckte.
»Du siehst auch sehr gut aus, Laurence. Ich hatte mich schon beinahe an deine Shorts gewöhnt.«
Er kam zu ihr, legte einen Arm um sie und gab ihr einen Kuss auf den Haaransatz im Nacken. »Du siehst hinreißend aus.«
Sie war ganz vernarrt in das Gefühl, wenn sein warmer Atem über ihre Haut strich, und wusste, die Nacht würde wundervoll werden. Sobald sie in seiner Nähe war, fühlte sie sich begehrt und war restlos überzeugt, dass nie etwas schiefgehen würde.
»Im Ernst. In dem Kleid wirst du alle anderen in den Schatten stellen.«
Sie sah an sich hinunter. »Es ist recht kurz.«
»Vielleicht brauchen wir alle ab und zu ein bisschen frischen Wind hier. Vergiss nicht deine Stola! Nach Sonnenuntergang kann es trotz Kaminfeuer ein bisschen kühl werden, wie du gestern Nacht wahrscheinlich bemerkt hast.«
Den Abend zuvor hatte Laurence sich mit geschäftlichen Dingen befassen müssen, sodass es nicht zur Zweisamkeit am Kamin gekommen war. Um neun Uhr hatten die Diener, einzeln und streng nach ihrer Wichtigkeit geordnet, ihr ihre Aufwartung gemacht. Zuerst der Butler, der die übrige Dienerschaft unter sich hatte, dann der Chefkoch, allgemein Appu genannt, der entweder eine Glatze hatte oder sich die Haare bis zur Kopfmitte wegrasierte. Das übrige Haar war zu einem ausgefallenen Knoten zusammengebunden. Er hatte leicht asiatische Züge, als hätte er Vorfahren aus Indochina, und er trug eine lange weiße Schürze über einem blau-goldenen Sarong. Nach ihm kam Naveena und brachte heiße Ziegenmilch, die mit Honig gesüßt war – nicht mit Palmzucker, wie sie erklärte, bevor sie ihr mit einem charmanten Lächeln eine gute Nacht wünschte. Die Nächsten waren die fünf Hausdiener. Sie reihten sich vor ihr auf und sagten ihr im Chor Gute Nacht. Zuletzt kamen die Küchenkulis, die bloß auf ihre nackten Füße starrten und sich verbeugten. Bald nach dem ausgefeilten Vorstellungsritual schützte Gwen Schmerzen im Fußgelenk vor und ging allein zu Bett.
Jetzt schmunzelte sie über das sonderbare Erlebnis.
»Was ist so lustig?«, fragte Laurence.
»Ich dachte nur gerade an die Dienerschaft.«
»Du wirst dich bald an sie gewöhnt haben.«
Laurence küsste sie auf die Lippen. Er roch nach Seife und Zitrone. Arm in Arm verließen sie das Schlafzimmer, um sich zum Salon zu begeben, wo vor dem Dinner Cocktails serviert werden sollten.
»Was für ein Duft ist es, den die Dienerin verströmt?«, fragte sie.
»Du meinst Naveena?«
»Ja.«
»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich riecht sie nach Kardamom und Muskat. Das ist schon so, solange ich denken kann.«
»Seit wann arbeitet sie hier?«
»Seit meine Mutter sie aufgestöbert und als Kindermädchen eingestellt hat.«
»Die Ärmste. Ich kann mir gut vorstellen, wie du als Junge hier herumgetobt bist.«
Er lachte. »Mutter hat so etwas wie eine Familienchronik zusammengestellt, mit Briefen, Fotografien, Geburtsurkunden, Eheschließungsdokumenten, lauter solchen Dingen. Jedenfalls glaube ich, es könnten auch einige Fotos von Naveena dabei sein, als sie noch jünger war.«
»Die würde ich sehr gern sehen. Ich will alles über dich wissen.«
»Ich habe mir das selbst noch gar nicht angesehen. Verity hat das ganze Zeug in England in einem Karton. Übrigens freue ich mich sehr darauf, dass du sie kennenlernst.«
»Schade, dass deine Schwester nicht zur Hochzeit kommen konnte! Aber vielleicht kann sie die Familienalben mitbringen, wenn sie uns besucht.«
Er nickte. »Natürlich.«
»War Naveena auch Veritys Kindermädchen?«
»Nein, meine Schwester hatte eine jüngere, das heißt, bis sie dann ins Internat ging. Es war schlimm für sie, als unsere Eltern starben. Da war sie erst zehn, das arme Mädchen.«
Gwen nickte. »Was wird aus Naveena, wenn sie zu alt zum Arbeiten ist?«
»Dann sorgen wir für sie«, sagte er und öffnete die französischen Fenster. »Lass uns über die Veranda gehen!«
Sie trat ins Freie und musste lachen. Es herrschte ein ohrenbetäubender Lärm – rat-tat-tat, twii-twii, tepp-tepp. Rascheln, Pfeifen und raue Kehl- und Klopflaute steigerten sich und verebbten, um sogleich wieder anzuschwellen. Dazwischen kurzes Wasserrauschen, begleitet von durchdringendem Scrii-scrii-scrii, und bei alldem zirpten die Grillen in einem fort. Drüben im dunklen Gebüsch tanzten Dutzende leuchtende Punkte.
»Glühwürmchen«, sagte er.
Unten am See brannten Fackeln.
»Ich dachte, wir könnten hinterher einen Nachtspaziergang unternehmen«, meinte Laurence. »Bei Fackelschein und Mondlicht ist der See fantastisch.«
Sie lächelte und freute sich über die exotische Geräuschkulisse.
»Und nachts läuft man nicht Gefahr, einem Wasserbüffel zu begegnen. Die können im Dunkeln schlecht sehen und ziehen sich nachmittags, wenn es am heißesten ist, ins Wasser zurück.«
»Ach, tatsächlich?«
»Täusche dich nicht! Sie sind gefährlich und durchbohren oder zertrampeln dich, wenn sie gerade angriffslustig sind. Keine Sorge, hier gibt es nicht viele. Aber oben auf den Horton Plains sind sie zahlreich.«
So traten sie von draußen in den Salon. Florence Shoebotham und ihr Mann Gregory waren die ersten Gäste. Mr. Shoebotham fing mit Laurence am Barschrank ein Gespräch an. Gwen nippte an einem Sherry und unterhielt sich mit seiner Frau, die die breiten Hüften und schmalen Schultern der typischen Engländerin hatte und recht groß war. Sie trug ein hellgelb geblümtes Kleid, das fast bis zu den Knöcheln reichte, und hatte eine piepsige Stimme, was bei einer Frau ihrer Größe befremdlich klang.
»Nun, Sie sind noch ein junges Ding, nicht wahr?«, meinte Florence, deren Kinnwülste beim Sprechen wackelten. »Ich hoffe doch, Sie werden die Sache meistern.«
Gwen musste sich ein Lachen verkneifen. »Meistern?«
Florence schüttelte sich das Sofakissen in ihrem Rücken auf und nahm es auf den Schoß, während sie näher an Gwen heranrückte. Sie hatte eine niedrige Stirn. Ihre Haare waren grau meliert und wirkten störrisch. Sie roch ein wenig nach Gin und Schweiß.
»Ich bin sicher, Sie werden sich bald an unsere Lebensweise gewöhnen. Nehmen Sie einen Rat von mir an, Mädchen, und seien Sie nie unnötig freundlich zu den Dienern! Das ist nicht gut. Sie mögen es nicht und werden Sie dafür nicht respektieren.«
»In England war ich zu unserem Hausmädchen immer freundlich.«
»Hier ist das anders. Die dunklen Rassen sind nun einmal nicht so wie wir. Freundlichkeit hilft ihnen nicht. Überhaupt nicht. Und die Mischlinge sind noch schlimmer.«
Während weitere Gäste eintrafen, saß Gwen betroffen auf dem Sofa. Sie fand es abscheulich, Menschen als »Mischlinge« zu bezeichnen.
»Behandeln Sie sie wie Kinder und schauen Sie Ihrem Dhobi auf die Finger. Erst letzte Woche habe ich bemerkt, dass mein chinesischer Seidenpyjama gegen einen alten Fetzen ausgetauscht worden ist, der ganz sicher vom Straßenmarkt in Hatton stammt.«
Gwen kam völlig ins Schwimmen und wurde aufgeregt. Wie sollte sie dem Dhobi auf die Finger sehen, wenn sie nicht einmal wusste, was ein Dhobi ist?
Sie schaute sich im Salon um. Eine kleine Abendgesellschaft hatte es werden sollen, aber es waren schon mindestens ein Dutzend Paare gekommen, und noch war reichlich Platz für weitere. Sie versuchte, den Blick ihres Mannes aufzufangen. Als es ihr gelungen war, musste sie lachen. Laurence unterhielt sich mit einem kahlköpfigen Mann, dessen Ohren rechtwinklig abstanden.
»Vermutlich sprechen sie über die Teepreise«, sagte Florence, die ihrem Blick gefolgt war.
»Gibt es ein Problem damit?«
»Oh, nein, Liebes! Ganz im Gegenteil. Wir alle machen glänzende Geschäfte. Der neue Daimler Ihres Gatten sollte Sie davon überzeugen.«
Gwen lächelte. »Er ist wirklich famos.«
Der Hausdiener an der Tür schlug einen Gong.
»Nun machen Sie sich keine Sorgen! Falls es etwas gibt, fragen Sie nur! Ich werde Ihnen sehr gern helfen. Ich weiß noch gut, wie es ist, jung und frisch verheiratet zu sein. Da hat man so viele neue Eindrücke zu verkraften.« Florence legte ihr Kissen beiseite und hielt ihr die Hand hin. Gwen begriff, dass das ein Befehl war, und erhob sich, um ihr aufzuhelfen.
Im Speisezimmer brannten die silbernen Leuchter. Es sah sehr hübsch aus. Alles glänzte und funkelte, und es duftete nach den Wicken, die überall in den Vasen standen. Gwen bemerkte eine herausgeputzte, ziemlich junge Frau, die Laurence anstrahlte. Sie hatte grüne Augen, elegante Gesichtszüge und einen langen Hals. Ihre blonden Haare sahen von vorn wie ein wogender Bob aus, doch als sie sich zur Seite drehte, erkannte Gwen, dass sie einen raffinierten Knoten trug. Sie war mit Rubinen behängt, trug dazu aber ein schlichtes schwarzes Kleid. Gwen hoffte, sie könnten Freundinnen werden, und versuchte, sie auf sich aufmerksam zu machen.
Der freundliche Brillenträger, der zu ihrer Linken saß, stellte sich als John Partridge vor. Sie musterte sein leicht fliehendes Kinn, den kleinen borstigen Schnurrbart und die freundlichen grauen Augen. Er hoffe doch, sie lebe sich gut ein, und sie solle ihn John nennen.
Als sie sich ein wenig länger unterhielten, waren alle Blicke auf Gwen gerichtet, aber bald fingen die Leute wieder an, den neusten Klatsch aus Nuwara Eliya auszutauschen, wer wer sei und was wer wem getan habe und warum. Das meiste verstand Gwen nicht, da sie die Betreffenden nicht kannte, und außerdem fiel es ihr schwer, dafür Interesse aufzubringen. Erst als es still wurde und der Mann mit den Segelohren auf den Tisch schlug, merkte sie auf.
»Eine verdammte Schande, wenn Sie mich fragen! Man hätte den ganzen Haufen erschießen sollen.«
Von dem einen oder anderen hörte man ein »Bravo!« und »Sehr richtig!«, während der Mann seine Hetzrede fortsetzte.
»Worüber sprechen sie, John?«, flüsterte Gwen.
»In Kandy hat es neulich einen Tumult gegeben. Wie es scheint, ist die britische Regierung ziemlich brutal mit den Schuldigen umgegangen. Das hat jetzt einen Aufruhr nach sich gezogen. Aber es geht das Gerücht, dass das gar kein Protest gegen die Briten war, sondern etwas mit Gedenkblumen zu tun hatte.«
»Also sind wir nicht in Gefahr?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Das nehmen nur ein paar alte Colonels zum Anlass, sich darüber auszulassen. Das Ganze hat vor zehn Jahren angefangen, als die Briten auf eine Versammlung von Mohammedanern schossen. Das war eine ziemlich unüberlegte Handlung.«
»Das hört sich nicht zufriedenstellend an.«
»Nein. Wissen Sie, der Ceylonesische Nationalkongress verlangt eigentlich nicht die Unabhängigkeit, sondern nur mehr Autonomie.« Er schüttelte den Kopf. »Aber wenn Sie mich fragen, müssen wir vorsichtiger auftreten. Bei allem, was in Indien vorgeht, wird es nicht lange dauern, bis auch Ceylon davon erfasst wird. Die Entwicklung steckt noch in den Anfängen, doch glauben Sie mir, da braut sich was zusammen.«
»Sagen Sie, sind Sie Sozialist?«
»Nein, meine Liebe, ich bin Arzt.«
Sie lächelte angesichts seines belustigten Blickes, doch dann wurde er ernst.
»Das Problem ist, nur drei Kandyer wurden in den Rat gewählt. Folglich verließen dieses Jahr einige von ihnen den Ceylonesischen Nationalkongress und haben die Kandyer Nationalversammlung gegründet. Auf die sollten wir ein Auge haben, auf die und die Young Lanka League, die inzwischen zur Auflehnung gegen die Briten aufruft.«
Gwen schaute zum anderen Ende des Tisches, wo Laurence saß, und hoffte auf das vereinbarte Zeichen, damit die Damen sich zurückziehen konnten. Doch er blickte gerade missmutig ins Leere.
»Wir ernähren sie, kümmern uns um sie, geben ihnen ein Dach über dem Kopf«, sagte einer der Herren. »Die Vorschriften werden mehr als erfüllt. Was wollen sie denn noch? Ich persönlich …«
»Wir können sehr wohl mehr tun«, unterbrach Laurence ihn sichtlich ungehalten. »Ich habe eine Schule eingerichtet, doch kaum ein Kind besucht sie. Es ist Zeit, dass wir eine Lösung finden.«
Seine Stirnlocke stand ab, ein sicheres Zeichen, dass er sich mit den Fingern durch die Haare gefahren war. Das tat er immer, wenn ihm unbehaglich zumute wurde. Er sah damit jungenhaft aus und weckte in Gwen das Verlangen, ihn zu umarmen.
Der Arzt tippte ihr auf die Hand.
»Ceylon ist … nun ja, Ceylon ist Ceylon. Sie werden bald zu einem eigenen Eindruck kommen«, sagte er. »Der Wandel ist noch fern, aber wir werden vor Gandhis Botschaft von der Swaraj nicht ewig sicher sein.«
»Swaraj?«
»Nationale Selbstregierung.«
»Aha. Wäre das denn schlecht?«
»Zu diesem Zeitpunkt, wer weiß?«
Nachdem die Gäste gegangen waren und sie sich in ihr Zimmer begeben hatte, freute sie sich, als Laurence hereinkam und sich aufs Bett fallen ließ. Da im Kamin ein Feuer brannte, war es zu warm. Würden sie jetzt zusammen an den See gehen?
»Komm her, Liebling!«, sagte er. »Leg dich zu mir!«
Sie kam seiner Bitte nach und streckte sich angezogen auf der Tagesdecke aus. Er stützte sich auf einen Ellbogen und lächelte sie an.
»Mein Gott, bist du schön!«
»Laurence, wer war die Blonde in Schwarz? Ich hatte keine Gelegenheit, mich mit ihr zu unterhalten.«
»Schwarz?«
»Ja. Es gab nur eine.«
Er runzelte die Stirn. »Du meinst wohl Christina Bradshaw. Ihr Mann war der Bankier Ernest Bradshaw. Daher der viele Schmuck.«
»Sie sieht nicht aus wie eine trauernde Witwe.« Nach kurzem Schweigen sah sie ihn forschend an. »Laurence, du liebst mich doch, oder?«
Er wirkte überrascht. »Wo kommt das jetzt her?«
Sie biss sich auf die Lippe und überlegte, wie sie sich ausdrücken sollte. »Aber du hast nicht … Also, ich will sagen, dass ich mich ein bisschen einsam fühle, seit wir hier sind. Ich möchte mit dir zusammen sein.«
»Wir sind gerade zusammen.«
»Das meine ich nicht.«
Als er nichts darauf sagte, wurde Gwen unsicher. »Was für ein Baum ist das, der vor meinem Fenster steht? Er sieht aus wie ein Kirschbaum.«
»Ach du je, du hast doch keine der Früchte gegessen, oder?«
»Doch.«
»Die sind ungenießbar. Man macht Chutney daraus. Ich rühre das Zeug nicht an.« Plötzlich rollte er sich auf sie, hielt ihre Arme fest und küsste sie. Sie mochte den leichten Alkoholgeruch seines Atems. Ihr wurde heiß. Erwartungsvoll öffnete sie die Lippen. Er zog den Umriss ihres Mundes mit der Fingerspitze nach, und sie spürte, wie ihr ganzer Körper nachgab. Aber dann passierte etwas Seltsames. Er holte Luft und wurde starr, und sein Blick bekam etwas Erschreckendes. Sie berührte ihn an der Wange, um diesen verstörenden Ausdruck zu vertreiben, doch Laurence starrte sie an oder blickte durch sie hindurch, als wüsste er nicht, wer sie war. Dann schluckte er, stand auf und ging hinaus.
Einen Moment lang war sie wie gelähmt, dann rannte sie zur Tür und rief nach ihm. Doch nach ein paar Schritten auf dem Flur sah sie, dass er bereits auf der Treppe nach oben war. Es kam nicht infrage, dass die Diener sahen, wie sie ihrem Mann hinterherrannte. Daher kehrte sie in ihr Zimmer zurück. Noch atemlos lehnte sie sich von innen gegen die Tür, schloss die Augen und überließ sich dem Gefühl der Einsamkeit. Damit war auch ihr Traum vom Spaziergang am nächtlichen See geplatzt. Was war nur mit Laurence los?
Sie zog sich aus und legte sich ins Bett. Da sie an unkomplizierte Gefühle gewöhnt war, fand sie das alles sehr verwirrend. Mit der Sehnsucht nach Laurence’ Umarmung überkam sie schweres Heimweh. Ihr Vater würde ihr jetzt die Hand tätscheln und sagen: Kopf hoch, und ihre Mutter würde ihr wahrscheinlich eine Tasse Kakao bringen und mitfühlende Blicke zuwerfen. Cousine Fran würde ihr nach dem hoffnungslosen Versuch, ein ernstes Gesicht zu machen, raten, sich ein dickeres Fell zuzulegen. Gwen wünschte, sie wäre mehr wie Fran. Niemand billigte es, wenn Fran zu diesem Medium ging, dieser Madame Sostarjinski, und trotzdem tat sie es ständig. Und wer wollte es ihr verübeln, nachdem ihre Eltern beim Untergang der Titanic umgekommen waren?
Gwen war so aufgewühlt, dass sie nicht einschlafen konnte. Vermutlich würde sie die ganze Nacht wach liegen. Sie drehte sich auf den Rücken und starrte an die Decke. Laurence muss seine Gründe haben, dachte sie, aber für diesen sonderbaren Ausdruck in den Augen fiel ihr kein vernünftiger ein.