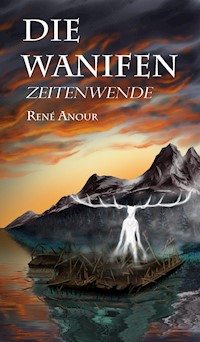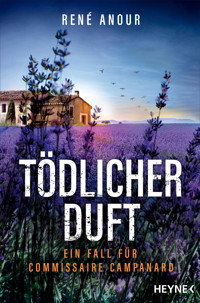Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Totenärztin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Mord und eines der berühmtesten Gemälde der Welt: Gustav Klimts «Der Kuss» Wien, 1908. Fanny Goldmann sucht keine Abenteuer. Sich gegen ihre männlichen Kollegen in der Gerichtsmedizin zu behaupten, die in ihr mehr Assistentin als fähige Ärztin sehen, ist nervenaufreibend genug. Doch in dem Versuch, einen Mord aufzuklären, ist sie in Kontakt mit der Wiener Unterwelt gekommen. Und die lässt sie nun nicht mehr los. Graf Waidring, ein ebenso gefährlicher wie mächtiger Mann, erpresst Fanny. Sie soll für ihn einen seiner Männer obduzieren, der tot aufgefunden wurde. Hat der Mord etwas mit dem neuen Gemälde von Gustav Klimt zu tun, dem sogenannten Kuss? Und was macht Fanny, wenn sie den Mörder tatsächlich findet? Liefert sie ihn aus? Oder verbündet sie sich mit ihm gegen Waidring?
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
René Anour
Die Totenärztin: Goldene Rache
Roman
Über dieses Buch
Die Geheimnisse der Toten …
Wien, 1908. Die junge Gerichtsmedizinerin Fanny Goldmann liebt ihren Beruf. Auch wenn die Vorstellung, tote Menschen aufzuschneiden – oder die Tatsache, dass sie als Frau überhaupt arbeitet –, für viele ein Graus ist, fühlt sie sich nirgends so wohl wie am gerichtsmedizinischen Institut. Doch ihr neuester Fall gibt ihr ein Rätsel auf. Sie findet eine geheime Botschaft an der Leiche. Ist die für sie bestimmt? Stammt sie vom Mörder? Fanny ahnt noch nicht, dass dieser Mord der Auftakt zu einem Machtkampf zwischen zwei sehr gefährlichen Männern ist. Dass nicht nur sie selbst, sondern auch ein Künstler namens Gustav Klimt hineingezogen wird. Und dass sie unmögliche Entscheidungen treffen muss, um die Menschen, die sie liebt, zu beschützen …
Medizin, Geschichte, Mord und eines der berühmtesten Gemälde der Welt: Gustav Klimts «Der Kuss». Ein neuer Fall für Totenärztin Fanny Goldmann.
Vita
René Anour lebt in Wien. Dort studierte er auch Veterinärmedizin, wobei ihn ein Forschungsaufenthalt bis an die Harvard Medical School führte. Er arbeitet inzwischen bei der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und ist als Experte für neu entwickelte Medikamente für die European Medicines Agency tätig. Sein historischer Roman «Im Schatten des Turms» beleuchtet einen faszinierenden Aspekt der Medizingeschichte: den Narrenturm, die erste psychiatrische Heilanstalt der Welt. Sein zweiter Roman bei Rowohlt ist der Auftakt zu einer Reihe um eine junge Gerichtsmedizinerin in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: «Die Totenärztin – Wiener Blut». Mit «Die Totenärztin – Goldene Rache» wird diese Reihe nun fortgesetzt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Ulrike Brandt-Schwarze
Kartenillustration Christl Glatz, Guter Punkt, München, unter Verwendung von Motiven von iStock/Getty Images Plus
Covergestaltung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Magdalena Russocka/Trevillion Images; Hauptmann & Kompanie
ISBN 978-3-644-00910-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Die Tage, in denen man ihn wegen seiner oft exzentrischen Kleidung angestarrt hatte, waren lange vorüber. Mittlerweile konnte er tragen, was er wollte, tun, was er wollte, und es wurde nur als Ausdruck seines Genius gefeiert. Er war nicht sicher, ob es überhaupt noch etwas gab, mit dem er schockieren könnte. Vielleicht in einer feinen Gesellschaft wie dieser aufspringen, alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen – und auf einen Tisch kacken.
Ja … das vielleicht. Die Vorstellung nötigte ihm ein Schmunzeln ab.
Gott sei Dank war ihm das Schockieren nie Selbstzweck gewesen. Manche Dinge, die ihm als ganz natürlicher Teil seines künstlerischen Schaffens erschienen waren, hatten eben in manchen Kreisen Empörung hervorgerufen. Vor allem die nackte Schwangere, die er damals gemalt hatte.
Er war nicht ganz sicher, was es war, das die Menschen an dem Bild so gestört hatte. Nicht unbedingt die Nacktheit, die hatte in der Kunst eine zu lange Tradition und gehörte beinahe zum guten Ton. Schließlich galt eine nackte Venus als erhaben, ein schwangeres Mädchen allerdings, das war doch schlichtweg vulgär, als würde uns der Anblick mit der Brechstange an unsere tierische Natur erinnern. Und das sollte er auch.
Die Gesellschaft und die gegenseitigen Lobpreisungen in dem edlen Saal nahm er kaum wahr.
In eine nachtblaue Kutte gekleidet, stand er vor seinem eigenen Gemälde, unfähig, sich abzuwenden.
Wie konnten nur alle hier von einem Meisterwerk sprechen, wenn es für ihn noch so unvollkommen wirkte!
Er hatte die Liebe selbst malen wollen. Ein junges Paar, in fließendes Gold gekleidet. Sie an seine Brust geschmiegt, er über sie gebeugt, ihr Kinn und ihre Wangen kosend.
Es hatte ihn an seine eigene Liebe erinnern sollen. Die Liebe zu seiner stolzen Emilie. Eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit in diesem Märchenschloss von einer Villa an den Ufern des Attersees.
Aber so angetan die Gäste der Wiener Kunstschau von dem Gemälde auch sein mochten, so viele Angebote er bereits erhalten hatte, es konnte nicht über eine essenzielle Wahrheit hinwegtäuschen: Das Bild, das er bisher einfach Das Liebespaar genannt hatte, war noch nicht fertig. Und er konnte nicht in Worte fassen, aus welchem Grund. Selbst der Name des Bildes klang noch nicht richtig.
«Zu schade!» Ein eleganter Herr stand neben ihm, bärtig wie er selbst, doch in jeder Hinsicht gepflegter. «Ich verstehe, warum Sie nicht zufrieden sind.»
«Verzeihen Sie?», erwiderte der Maler, ungehalten, dass ihn schon wieder jemand aus seinen Gedanken riss.
«Sie scheinen nicht gerade angetan von Ihrem eigenen Bild.»
Der Maler hob eine Augenbraue. «Spielt das eine Rolle? Die meisten hier sind es.»
Der Mann wandte sich um und bedachte die Festgesellschaft mit einem Lächeln. «Oh, nichts als Beifallklatscher und höfliche Kollegen, so scheint es.»
«Was von beidem sind Sie?»
«Nichts davon.» Der Mann lächelte freundlich. «Jemand, der ein wahres Wort für Sie übrig hat.» Selbst das eingestreute Grau in Haar und Bart wirkte gewollt. Seine Haut verriet entweder regelmäßige Sonne oder einen von Natur aus dunkleren Teint. Der Mann wandte sich dem Bild zu. «Ein Versprechen von Vollkommenheit wohnt diesem Bild inne. Aber noch tritt sie nicht zutage.»
Der Maler interessierte sich so gut wie ausschließlich für weibliche Modelle, zugegebenermaßen, weil das Abbilden ihrer delikaten Gestalten ein ganz eigenes Liebesspiel für ihn bedeutete … und gar nicht selten in den ganz klassischen Lüsten endete. Aber dieser Mann. Diese schwarz glänzenden Augen wirkten zwar wohlwollend – doch auf den zweiten Blick geradezu beängstigend. So etwas auf die Leinwand zu bannen, wäre virtuos.
«Hören Sie auf meinen Rat», erklärte der Mann mit freundlicher Eindringlichkeit. «Und hören Sie nur auf sich. Arbeiten Sie an diesem Gemälde, bis Sie es selbst vollkommen finden!»
«Mein Herr, ich glaube, das ist meine Sache.»
Der Mann starrte ihn für einen Moment auf eine Weise an, die ihm eine Gänsehaut bescherte. Schließlich lächelte er. «Natürlich.» Er hob einen Zeigefinger. «Aber sollten Sie aufgeben, sprechen wir uns wieder.»
Der Maler schüttelte verwirrt den Kopf. War das eine Drohung gewesen? Die Worte hatten so freundlich geklungen, als hätte man ihm zum Geburtstag gratuliert.
«Es ist das Gesicht der Frau», raunte ihm sein Gesprächspartner über die Schulter zu, ohne sich umzudrehen, bevor er in der Menge verschwand.
Der Maler wollte sich wieder seinem Bild zuwenden, als er einen hünenhaften, breitschultrigen Kerl bemerkte, der mit starrer Miene auf ihn herabblickte.
Hatte dieser Mann während des Gesprächs die ganze Zeit hinter ihnen gestanden? Er hatte jedenfalls keinen Laut von sich gegeben.
Er wollte gerade etwas sagen, den Riesen nach seinem Anliegen fragen, als dieser sich betont langsam abwandte und dem Gesprächspartner des Malers folgte wie ein Schatten.
Der Fremde hatte anscheinend seinen Leibwächter mit auf die Kunstschau genommen. Dem Maler fiel kein plausibler Grund ein, warum das nötig sein sollte, es sei denn, man wollte etwas demonstrieren … Macht.
Er suchte die Gesellschaft noch eine Weile nach dem seltsamen Herrn und seinem Leibwächter ab, konnte die beiden aber nicht mehr entdecken, zu viele Leute drängten sich mittlerweile um die ausgestellten Gemälde, während die Garçons mit verblüffender Flinkheit zwischen den Gästen hindurchmanövrierten und ihnen Schaumwein anboten.
Stattdessen zog eine Frau am anderen Ende des Saals seinen Blick auf sich. Sie bewegte sich Richtung Ausgang. Verstohlen, würde der Maler meinen. Ihr waldgrünes Seidenkleid mit dem dezenten Spitzensaum und die stolze Figur zeugten von ausreichend finanziellem Pouvoir, um hierher geladen zu werden. Dennoch huschte sie an der Wand entlang wie eine Diebin, die die Gunst der Stunde genutzt hatte, um … nun, viel mehr als teure Gemälde gäbe es hier nicht zu stehlen, es sei denn, sie hätte dem ein oder anderen Herrn die Börse gezogen …
Die Frau wandte sich um. Ihr Gesicht wirkte ansprechend, von blondem Haar umrahmt, frisch wie die kleinen Sonnenblumen in den Bauerngärten, die er so gern malte. Ein Gesicht, das jeden Mann verzaubern könnte, trotz der Furcht in ihrer Miene.
Die Frau verschwand über die Treppe. Schade, er wäre einem kleinen Flirt nicht abgeneigt gewesen, besonders, da die verbliebenen Damen hier allesamt recht blutleer wirkten.
Er wollte sich gerade wieder dem Gemälde zuwenden, als ein spitzer Schrei die Luft durchschnitt und Gelächter und Plaudereien in einem einzigen Moment verstummen ließ.
Bewegung kam in die Menge, und dann sah er, wie die Kellner etwas Massiges durch die Gesellschaft trugen.
Schreckensschreie wurden im Saal laut.
Der Maler kniff die Augen zusammen, während die Garçons an ihm vorbeiächzten. Es war die reglose Gestalt des Leibwächters, der sich gerade noch so bedrohlich vor ihm aufgebaut hatte. Und er wirkte nicht besonders lebendig.
1. Kapitel
Fräulein Doktor
«Sie meinen also, Ihre Freundin wäre verschwunden, und Sie vermuten, sie wurde getötet, von einem Grafen … Weydrich?»
«Waidring», korrigierte Fanny leise.
«Der Graf Waidring war bereits Gegenstand interner Untersuchungen … vor dieser Angelegenheit. Ich habe Ihnen die Akte zukommen lassen.»
Der Polizeiwachmann warf Max einen Seitenblick zu, mit dem man eher eine störende Fliege als einen Kollegen bedachte.
Es war derselbe Oberleutnant, der Fanny schon einmal befragt hatte, über die Ermordeten am Institut, den Mörder, den sie gefunden hatte, gemeinsam mit Max … gemeinsam mit Tilde.
Das alles schien ihr so unendlich fern, dabei waren seither nur ein paar Wochen vergangen.
«Ist das der besagte Brief, von dem Sie behaupten, ihn im Stadthaus von Fräulein Waring gefunden zu haben?»
Behaupten … Das klang, als hätte sie es sich eingebildet. Wie seltsam, dass sie sich genau das wünschte. Lieber sollte man sie für ein hysterisches Fräulein mit einem Nervenleiden halten, wenn sie danach die k.u.k. Polizeiwache verlassen konnte, nur um zu sehen, wie Tilde ihr fröhlich von der anderen Straßenseite aus zuwinkte.
Der Gedanke trieb ihr die Tränen in die Augen.
«Ja», wisperte sie.
Der Polizist musterte den Brief mit gerunzelter Stirn, als sähe er ihn zum ersten Mal, dabei hatte Max ihn seinem Kollegen schon vor Tagen zukommen lassen.
Die Blutstropfen am oberen Eck schien er gar nicht zu bemerken.
Wie mussten Waidrings Zeilen an Fanny wirken, wenn man die ganze Geschichte dahinter nicht kannte?
Die Höflichkeit seiner Worte, die seine Grausamkeit kaschierten. Die Erinnerung an den Abend, an dem Tilde und sie sich unter falschen Namen auf sein Fest im Palais Coburg eingeschlichen hatten, um mehr über den Mörder und den Stern der Kaiserin herauszufinden. Waidring hatte mit ihr gespielt, sich jovial gegeben und Fanny alles erzählt, was er wusste. Erst allmählich hatte sich offenbart, was für ein Mann er wirklich war, dass er Menschen von sich abhängig machte, um sie dann seine Macht spüren zu lassen. Mit Fanny hatte er Ähnliches im Sinn gehabt, als er über sie hergefallen war – das heißt, unmittelbar bevor sie ihm mit einem marmornen Aschenbecher niedergestreckt und in die Lenden getreten hatte.
Tilde und sie waren geflüchtet und hatten nicht mehr zurückgeschaut, in der Hoffnung, ihre falschen Namen hätten ausreichend Schutz geboten.
Was für ein Trugschluss! Ihr Instinkt hatte sie davor gewarnt, dass dieses Scheusal niemals aufhören würde, nach ihnen zu suchen, aber sie hatte die warnende Stimme in ihrem Inneren beiseitegeschoben.
Gott, es war ja auch alles so schön gewesen. Sie hatte endlich eine Jungassistentenstelle an der Gerichtsmedizin erhalten, war endlich mehr als eine Prosekturgehilfin, die den Medizinern hinterherputzen musste. Und Tilde … sie hatte sich endlich getraut, mehr aus ihrer Leidenschaft fürs Theater zu machen. Sie hatten so wunderbare Abende mit Fannys Cousin Schlomo verbracht, der als Maskenbildner am Burgtheater arbeitete. Und er hatte seine Beziehungen genutzt und für Tilde ein Volontariat am Theater in der Josefstadt aus dem Hut gezaubert: Assistentin der Regie. Fanny hatte Tilde noch nie so strahlen sehen wie in diesem Moment.
Wahrscheinlich würde Tilde diese Stelle niemals antreten. Ob Schlomo schon an den Regisseur geschrieben hatte? Wenn ja, welche Worte hatte er gefunden, um zu erklären, dass der wunderbarste Mensch auf dem Erdenrund einfach verschwunden war?
Der Polizeibeamte schnupfte, was seinen überdimensionierten Schnauzer zittern ließ, sonst regte sich nichts in seiner Miene, während er den Brief las.
Den Brief, in dem Waidring darlegte, dass er Fanny Tilde für immer genommen hatte. Und dass Fanny ab nun «sein» wäre mit Haut und Haaren. Natürlich, es musste ja nicht bei Tilde enden. Ihr Vater, Max, Schlomo …
Jetzt beginnt das Spiel.
Mit diesen Worten endete das Schreiben.
Nach einer gefühlten Ewigkeit seufzte der Polizist und legte den Brief auf seinem Schreibpult ab.
«Haben Sie den Grafen in der Nähe von Fräulein Warings Haus gesehen?»
Fanny schüttelte den Kopf, dann fiel ihr etwas ein.
«Aber bevor ich hineinging … Da war ein Mann mit Hut auf der Straße. Er grüßte mich mit Namen, obwohl ich ihn nicht kannte.»
Der Polizist seufzte. «Ein Mann mit Hut?»
Fanny nickte.
«Ich kenn ja keinen einzigen Mann, der ohne Hut außer Haus geht.»
Sie schwieg.
«Schauen S’, Fräulein …»
«Doktor», zischte Max.
«Fräulein Doktor.»
Konnte der Polizist sich wirklich nur so ungenau an sie erinnern? Er musste doch wissen, dass sie die Medizinerin war, die vor ein paar Monaten geholfen hatte, die ungewöhnlichen «Morphin-Morde» aufzuklären.
Er schob ihnen das Blatt hin, als wäre es ein Antragsformular, das Fanny falsch ausgefüllt hatte.
«Da hat sich jemand einen üblen Scherz mit Ihnen erlaubt.»
«Wie bitte?», flüsterte Fanny. «Eine Frau ist verschwunden. Wie können Sie das einen Scherz nennen?»
Der Polizist beugte sich über den Tisch und versuchte seine beste Imitation einer verständnisvollen Miene.
«Natürlich hab ich Verständnis. Ein zartes Fräulein, das ein paar wahrhaft grausliche Dinge gesehen hat, das hinterlässt Spuren. Natürlich hat Sie das erschüttert.»
Fannys Gestalt versteifte sich bei zartes Fräulein. Sie spürte, wie Max ihr beruhigend die Hand tätschelte.
«Und weil Ihre Beobachtungen einem Polizisten beim Aufdecken einiger Gräueltaten geholfen haben, spielen Ihnen die Nerven jetzt halt ein bisserl einen Streich, und Sie sehen hinter jeder Ecke die fürchterlichsten Verbrechen. Na, und dann kommt auch noch so ein Schelm daher und hält Ihnen so ein Schreiben unter die Nase, sogar ein bisserl Blut hat er drauf getropft. Da müssen ja die Pferde mit Ihnen durchgehen.»
Fanny sog scharf die Luft ein.
«Bei allem Respekt, Oberleutnant Reiterer», kam ihr Max zuvor. «Ich glaube ebenfalls, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. Die Vermisste, das Fräulein Mathilde Waring, ist sehr eng mit der Frau Doktor Goldmann, und wie gesagt, der Verdächtige scheint kein unbeschriebenes Blatt zu sein. Ich schlage vor, den Beschuldigten zu verhören und sein Anwesen nach Hinweisen auf den Verbleib der L… von Fräulein Waring zu durchsuchen.»
«Hören S’ mir doch zu. In diesem Fall gibt es keinen Verdächtigen. Und selbst wenn, stellen Sie sich vor, wir würden einen Adeligen dieses Ranges festnehmen? Wir müssten uns selbst auf eine Interrogation der Beamten aus der Hofburg gefasst machen … Gott sei Dank steht das alles eh außer Frage. Ein Missverständnis, wie gesagt. Nichts als ein Streich.»
Fanny sprang auf, bevor Max es verhindern konnte, und schlug mit der flachen Hand auf Oberleutnant Reiterers Schreibpult.
«Dann erklären Sie mir, wo meine Freundin ist!»
Ihre Brust hob und senkte sich rasch. Wenn man sie jetzt verhaftete, dann wäre wenigstens bewiesen, dass sie kein zartes Fräulein war.
Reiterer lehnte sich zurück, sah zu ihr hinauf und setzte seine Brille ab. «Hören Sie! Eines sag ich Ihnen aber schon.» Er hob einen Zeigefinger. «Es wird Sie sicher keiner heiraten, wenn Sie sich so aufführen!»
Fanny knurrte, aber Max zog sie so sanft wie möglich wieder zurück auf den Stuhl.
Immerhin … Wut fühlte sich besser an als Verzweiflung.
«Was gedenken Sie in der Sache zu unternehmen? Die Frau ist verschwunden», sagte Max. Seine Stimme mochte ruhig klingen, aber Fanny konnte seine Anspannung spüren. Das hier war ihm genauso wenig egal wie ihr.
«Nix!», erwiderte Reiterer leicht entnervt. «Wenn Sie mich meine Gedanken einmal, ohne mich ständig zu unterbrechen, ausführen ließen, Inspector Meisel, dann würden Sie längst verstehen, warum ich diese Sach eher gemächlich angeh.» Er setzte seine Brille wieder auf und sah Max und Fanny abwechselnd über deren Rand hinweg an.
«Wissen S’, ich hab auch einen Brief!», erklärte er.
«Wie bitte?»
Er hob die Hände, wie um Fannys Aufbegehren abzublocken.
«Wir haben nach Ihrer Anzeige natürlich Informationen eingeholt und die Eltern der Vermissten kontaktiert.»
Der Oberleutnant öffnete eine Ledermappe auf seinem Tisch und blätterte ein paar Momente darin.
Tildes Eltern, die ständig irgendwo auf Kur weilten und so gut wie nie zu Hause waren und denen völlig gleich zu sein schien, was ihre Tochter tat oder nicht.
«In ihrem Schreiben bestätigen die Eltern, dass sie kürzlich einen Brief von ihrer Tochter erhalten haben. Freundlicherweise haben sie zugestimmt, uns den Inhalt des Briefes per Telegramm zu übermitteln. Das Originalschreiben ist noch bei den Eltern, aber sie haben keinen Zweifel, dass es sich um die Schrift ihrer Tochter handelt.»
Ein Brief? Fanny fehlten die Worte. Soweit sie wusste, schrieb Tilde ihren Eltern nur höchst selten. Auch, weil sie meistens gar nicht so genau wusste, wo diese sich gerade aufhielten.
«Der Brief ist auf den 15. Juni 1908 datiert.»
«Der Tag vor ihrem Verschwinden», murmelte Fanny. «Einen Tag davor haben wir uns das letzte Mal gesehen.»
«Ich darf zitieren», erklärte Reiterer und räusperte sich. «Liebste Mama, liebster Papa, ich hoffe, ihr seid bei bester Gesundheit. Ich schreibe, da ich ebenfalls zu verreisen gedenke. Gewiss werde ich einige Monate fortbleiben. Ihr müsst euch nicht sorgen, da ich stets in Häusern von Verwandten oder Hotels mit unzweifelhaftem Ruf, in denen ihr auch selbst schon logiert habt, absteigen werde. Beginnen werde ich meine Reise in Triest. Den weiteren Verlauf werde ich unterwegs planen. In tiefer Verbundenheit, eure Mathilde.»
Fanny schüttelte Kopf. «Das hat sie nicht geschrieben.»
«Ihre Eltern behaupten etwas anderes.»
«Dann kennen sie ihre eigene Tochter nicht.»
«Fanny!», zischte Max, aber sie konnte sich nicht mehr halten.
«Seit sie schreiben kann, hat sie keinen Brief mehr mit Mathilde unterzeichnet. Sie würde nie länger verreisen, ohne es mir zu erzählen. Der Brief ist eine Fälschung!»
«Erlauben Sie?»
Fanny presste die Lippen zusammen. «Sie hat er auch in der Hand. Und Sie decken ihn auch noch, diesen Verbrecher!»
Dem Oberleutnant stieg die Zornesröte ins Gesicht. Er sprang so heftig auf, dass der Stuhl hinter ihm umfiel. «Jetzt reicht’s aber!», brüllte er. «Glauben Sie, ich lass mir von Ihnen ewig auf der Nase rumtanzen? Meisel, Sie nehmen jetzt dieses hysterische Weibsbild mit, oder sie kann die Nacht in einer Zelle verbringen.»
«Jawohl, Herr Oberleutnant», erwiderte Max gepresst. «Bitte sehen Sie es ihr nach, sie ist nur besorgt.»
Er hatte Fanny am Ellenbogen gepackt, zog sie in die Höhe und vom Pult des noch immer weiterschimpfenden Oberleutnants fort.
«Bist du wahnsinnig?», zischte Max, als er sie aus der Polizeiwache auf die geschäftige Josefstädterstraße hinausbugsierte. Das helle Sonnenlicht blendete Fanny für einen Moment. Hufklappern und der Gesang eines Obdachlosen, der seiner Ziehharmonika ein paar gequälte Töne entrang, drangen an ihr Ohr. Für einen Moment hoffte sie tatsächlich, Tilde auf der anderen Straßenseite zu erblicken. In einem ihrer farbenfrohen Kleider, freudig winkend.
Aber da war niemand. Vielleicht würde da nie wieder jemand sein.
Max’ graue Augen glitten forschend über ihr Gesicht. Die dunkle Polizeiuniform mit dem schwarz glänzenden Helm passte zwar zu ihm, aber sie ließ ihn auch ein wenig fremd wirken.
«Was, glaubst du, erreichst du, wenn du unseren diensthabenden Offizier beleidigst?»
Fanny riss sich los und funkelte ihn an. «Nicht weniger als durch dein Schweigen. Er weiß, dass wir recht haben, er weiß, dass sie entführt wurde, aber er will es vertuschen!»
«Das muss nicht so sein», erwiderte Max. «Vielleicht ist er einfach nur ein fauler Mensch. Waidring mag an vielen Orten seine Spitzel haben, das heißt aber nicht, dass ihm jeder gehört.»
Fanny schloss für einen Moment die Augen. «Die Polizei wird uns nicht helfen … wieder einmal.»
«Das letzte Mal hast du sie gar nicht um Hilfe gebeten, du hattest Angst, deine heimlichen Obduktionen würden auffliegen», erinnerte sie Max.
«Und ich hatte recht damit, immerhin war dein Kollege Kaltenecker alles andere als vertrauenswürdig.»
Max setzte zu einer Antwort an, nahm sie dann aber einfach in den Arm. Es fühlte sich gut an. Für einen Moment schien sie vergessen zu können, was Tilde widerfahren war.
«Ich hätte ihn töten können», flüsterte Fanny nach einer Weile. «Als er bewusstlos vor mir lag im Palais Coburg. Er war wehrlos. Aber es wäre mir nicht in den Sinn gekommen.» In ihrem Inneren verhärtete sich etwas. «Hätte ich es doch nur getan. Niemand hätte ihn vermisst, und Tilde …» Sie konnte nicht weitersprechen.
«Vergangen ist vergangen», sagte Max. Fanny war angenehm überrascht, dass er ihr nicht einzureden versuchte, dass es richtig gewesen war, Waidring leben zu lassen. «Und was es mit dir gemacht hätte, könnte ich nicht ertragen.»
Also doch noch eine Beschwichtigung. Fanny löste sich langsam aus seiner Umarmung. «Du weißt, dass diese Geschichte nicht abgeschlossen ist. Er hat Tilde verschwinden lassen, um mir zu zeigen, dass ich ihm gehöre, dass er mir alles nehmen kann, wenn er will.»
«Hat er Kontakt zu dir aufgenommen?»
Fanny schüttelte den Kopf. Es passte zu Waidring, sie im Ungewissen zu lassen, sie dadurch noch mehr seine Macht spüren zu lassen.
«Irgendwann wird er es. Und ein zweites Mal werde ich nicht den gleichen Fehler begehen.»
«Fanny.» Max schien einen Moment nach den richtigen Worten zu suchen. «Was glaubst du denn, wie ein zartes … Ich meine, wie du Waidring überwältigen willst? Er würde dich umbringen.»
Natürlich hatte Max recht, aber im Moment war ihr das gleich. Sie konnte diesen Mann doch nicht einfach so davonkommen lassen, wenn niemand sonst einen Finger rührte.
«Komm, lass uns irgendwo einen Kaffee trinken», schlug Max vor. «Ins Korb vielleicht, wo wir uns kennengelernt haben.»
Für einen Moment konnte sie nicht anders, als sein Lächeln zu erwidern, und der Gedanke, dort mit ihm zu sitzen, während er ihre Hand hielt, wärmte sie ein wenig. Aber dann dachte sie an Tilde. Würde sie je wieder verliebt sein, je wieder lachen oder mit ihr Kaffee trinken?
«Ich kann nicht … Ich bin noch nicht so weit.» Fanny senkte den Blick.
Max’ Miene wirkte beinahe gequält. «Ich weiß, was es bedeutet, wenn man von Rache beseelt ist. Es führt an keinen guten Ort.»
Fanny hob den Blick. «Wir werden sehen …»
Als sie sich abwandte, glaubte sie für einen Moment, in einer Seitengasse eine dunkel gekleidete Gestalt mit einer weißen Maske zu erkennen. Ein Blinzeln später war da nichts mehr. Vielleicht wurde sie einfach verrückt und bildete sich all die furchtbaren Dinge, die ihr gerade widerfuhren, nur ein.
Wenn es doch nur so wäre …
«Du schaust schon wieder so grantig aus der Wäsche», bemerkte Franz, als sie den Seziersaal betrat, ihre Schürze umband und wortlos begann, Instrumente aus den Holzregalen an der Wand herauszusuchen. «Dabei ist das eigentlich meine Aufgabe.»
«Alles in Ordnung», erwiderte sie kurz. Sie hätte Franz gern von Tildes Verschwinden erzählt, aber die Arbeit war der einzige Ort, wo sie ihrer Trauer entkommen konnte.
«Haben wir etwas hereinbekommen?», fragte sie.
Franz schüttelte den Kopf. «Den Duellanten von gestern haben s’ schon abgeholt. Hab aber vielleicht was, damit du nicht ganz so finster aus der Wäsche schaust.»
«Ah ja?»
«Ziehl-Neelsen-Färbung von der kurzatmigen Madame von letzter Woche!»
Fanny sah auf. «Du hast die Schnitte ihrer gangränösen Lunge gefärbt?»
Sie hatten die ältere Dame vor einigen Tagen obduziert.
Sie war aus dem Fenster ihres Stadtpalais gestürzt und hatte nicht überlebt. Bei der Obduktion hatten sie ein gebrochenes Rückgrat, ein zertrümmertes Becken und innere Blutungen festgestellt. Sie war mit dem Rücken zuerst aufgeprallt, aber ob sie jemand gestoßen hatte oder sie einfach auf ihrem Zierbalkon ausgerutscht war, ließ sich durch die Sektion nicht feststellen. Die Gerichtsmedizin brachte leider nicht auf jede Frage eine Antwort, diesmal dafür einen interessanten Lungenbefund. Denn das Atmungsorgan war mit Bereichen abgestorbenen Gewebes, sogenannten Granulomen durchsetzt gewesen, die Fanny und Franz an Schwindsucht hatten denken lassen. Sie wollten Gewebsschnitte anfertigen und diese färben, um zu sehen, ob sie richtiglagen. Aber dass Franz die Extraarbeit auf sich nehmen würde, hätte Fanny nicht gedacht. Er war und blieb ihr Lieblingskollege, der einzige, der ihr etwas beigebracht hatte, sogar als sie noch «Mädchen für alles» gewesen war. Sein Kollege, Dr. Valdéry, behandelte sie noch immer wie seine Handlangerin, Professor Kuderna, der Leiter des Instituts, ignorierte sie, und der einzig verbliebene Prosekturgehilfe, Gert, ein gelernter Metzger, erzählte Fanny zwar gern Geschichten aus dem Schlachthof, doch er wäre auch nie auf die Idee gekommen, ihr zu assistieren.
«Ah, da leuchten die Augerln wieder!» Franz grinste.
Zum ersten Mal an diesem Morgen betrachtete sie ihn genauer. Seine Haare standen ihm so zu Berge wie immer, aber sein Hemd, seine Schürze, ja, sogar sein Gesicht … Alles war von unzähligen leuchtend roten Punkten bedeckt. Fanny dachte instinktiv an Blut, aber die Farbe war eindeutig heller.
«Wie siehst du denn aus?», lachte sie.
«So leicht ist das mit dem Färben halt nicht», knurrte Franz. «Man muss die Schnitte erhitzen, weil die Mykobakterien, die die Tuberkulose auslösen, sonst die Farbe nicht aufnehmen. Ich hab mich verbrannt und die Küvette mit dem Fuchsinrot umgeschmissen. Jetzt schau ich aus wie eine Bachforelle.»
«Nicht jeder kann das tragen», gluckste Fanny. Es tat gut, wieder ein bisschen zu lachen. «Zeigst du mir die Schnitte?»
«Von mir aus, aber kein Gelächter mehr!»
«Natürlich nicht.»
Die Mikroskopierkammer befand sich im Obergeschoss des Instituts, in dem Fanny nur selten zu tun hatte. Mehrheitlich diente es als Lager und zur Sammlung von Präparaten. Da die Gerichtsmedizin erst nach dem Großbrand des Ringtheaters vor über zwanzig Jahren in den Fokus des Interesses gelangt war, präsentierte sich die Sammlung noch entsprechend dünn – kein Vergleich zur pathologischen Sammlung im gegenüberliegenden Narrenturm.
Die Tür knarzte, als sie eintraten. In der Kammer standen zwei glänzende Messingmikroskope aus den Werkstätten von Carl Zeiss. Wahrhafte Wunderdinger mit automatischer Beleuchtung. Während Professor Kuderna sonstige Ausgaben für das Institut eher scheute, hatte er sich hier nicht lumpen lassen. Wahrscheinlich der Hauptgrund, warum er es nicht gern sah, wenn Fanny sich hier oben aufhielt. Tatsächlich hatte sie den Raum zum ersten Mal nach Antreten ihrer Assistentenstelle vor ein paar Wochen betreten dürfen, und da hatte Kuderna schon gemeckert.
«Sie fassen mir dort oben nichts an, Fräulein Goldmann. Die Apparaturen sind viel zu kostbar, als dass ich sie mir von Ihnen ruinieren lassen werde.»
Das «Fräulein» war im Übrigen eine kleine Verbesserung. Früher hatte er sie trotz ihres Doktortitels meist mit «Schwester Goldmann» angesprochen. Es war auch nicht so, als hätte er sie freiwillig befördert. Da hatte Fanny etwas, nun ja, nachgeholfen. Während ihrer Nachforschungen zu den «Morphin-Morden» war Fanny, als Mann verkleidet, in ein Bordell eingedrungen – und hatte den Professor in einer sehr prekären Situation angetroffen.
Die Mikroskope begannen leise zu summen, sobald Franz ihre Beleuchtung anschaltete. Er öffnete eine Mappe, in deren Inneren sich kleine Glasplättchen in heillosem Durcheinander stapelten.
Fanny schenkte Franz einen vielsagenden Blick. «Ich sortier sie dir nachher.»
Franz zuckte mit den Schultern, nahm ein paar der gläsernen Objektträger heraus, auf denen sich blasse Organschnitte abzeichneten, und spannte sie auf Fannys und seinen Objekttisch.
«Einfach an der Schraube drehen, bis es scharf ist», brummte er.
Fanny nahm ihre Lesebrille ab und sah durch das Okular.
An manchen Stellen erkannte sie gesundes Lungengewebe, mit den Lungenbläschen, den Alveolen, die von einer schmalen Zellschicht ausgekleidet waren, und dann fand sie sie: Granulome. Totes Gewebe, umgeben von mehreren Wällen aus Immunzellen. Auf diese Weise versuchte der Körper, die Infektion einzugrenzen, vielleicht auch ein Grund, warum die Tuberkulose, die Schwindsucht, ein so langsames Dahinsiechen bedeutete.
«Kannst du sie sehen?», fragte Franz.
Fanny brauchte nicht lange zu suchen. Die Färbung war unglaublich. Viel, viel kleiner als die Zellen im Inneren der Granulome leuchteten ihr rotviolette, stabförmige Gebilde entgegen.
«Ja», wisperte sie. «Mykobakterien. Wir hatten recht!» Sie schüttelte ungläubig den Kopf. «Ich … ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Bakterien sehe.» Sie sah Franz an. «Ich liebe Wissenschaft!»
«Dann war die Patzerei wenigstens nicht umsonst», brummte er.
«Die sind wunderschön!»
«Nicht, wenn sie sich’s in deiner Lunge gemütlich …»
Die Tür wurde aufgerissen. Fanny zuckte zusammen und fuhr herum. Professor Kudernas Bart und Augenbrauen bebten, das sicherste Anzeichen für einen bevorstehenden Tobsuchtsanfall.
«Warum …», knurrte er, nur mühsam beherrscht, «… versteckt sich der diensthabende Gerichtsmediziner mit dem werten Fräulein Goldmann hier oben, wenn unten die Polizei mit einem Mordopfer wartet, dass ihnen ENDLICH EINER DIE TÜR AUFMACHT!»
Sein Brüllen hallte in der kleinen Kammer wider, sodass es Fanny in den Ohren weh tat.
«Wir … lieben Wissenschaft?», versuchte es Franz. Fanny wünschte, er hätte es nicht gesagt.
«Sie beide sind EINE SCHANDE!», schrie Kuderna und wandte sich Fanny zu. «Und Ihnen hab ich überhaupt untersagt, dass Sie mir die Mikroskope angrapschen.»
Fanny konnte nicht anders. Sie senkte verschämt den Blick. Seit sie ihn in dem Bordell erwischt hatte, sah sie seine eiförmige Gestalt immer splitterfasernackt vor sich. Hoffentlich musste sie ihn nicht noch einmal daran erinnern, um ihre Stelle zu behalten.
«Wir gehen schon, Professor!», murmelte sie.
«Wenn’s sein muss!», brummte Franz.
«Sie nicht, Kollege Wilder, Sie sehen ja aus wie ein Clown, der eine Sau geschlachtet hat.»
«So fühl ich mich auch.»
«Sie sind …»
«… eine Schande. Ja eh. Fanny, gehst du, bitte?»
Fanny schlüpfte an Professor Kuderna vorbei, der Franz noch weiter beschimpfte, was dieser in aller Ruhe über sich ergehen ließ. Franz mochte oft miese Laune haben, aber Kuderna konnte verdammt froh sein, dass er hier arbeitete. Der Professor hatte seit Ewigkeiten keine Leiche mehr angerührt und schrieb nur noch an seinem Buch, und Dr. Valdéry interessierte sich mehr dafür, seinen Namen in irgendwelchen Artikeln zu lesen, als für die Wissenschaft dahinter.
Auf der Treppe rieb Fanny sich die Wangen. Sie hatte sich gerade so lebendig gefühlt, wie lange seit Tildes Verschwinden nicht mehr. Einfach wunderbar.
Das kann er dir auch wegnehmen, wenn er will.
Sie atmete tief durch. Nicht der versteckteste Winkel ihres Lebens war sicher, seit Waidring herausgefunden hatte, wer die mysteriöse Dame war, die ihn niedergeschlagen hatte.
Morgen könnte Franz verschwunden sein, und sie würde in der Arbeit einen Brief von Waidring vorfinden, der ihren Verdacht bestätigte. Nun, Franz wäre wohl nicht unbedingt der Erste, den Waidring sich vornehmen würde. Ihr Vater … oder Max.
Es fühlte sich an, als würde sich ihr Kehlkopf verengen, während Panik in ihr emporschwappte. Das wiederholte Klingeln der Polizisten vor dem Eingangstor riss sie aus ihren finsteren Gedanken.
Fanny öffnete das Tor und blickte in das rundliche Gesicht von Inspector Slanec.
«Grüß Gott, Herr Inspector», sagte sie ehrlich erfreut.
«Frau Doktor Goldmann!» Slanec war immer freundlich und respektvoll zu ihr gewesen. Sein ehemaliger Kollege Kaltenecker weniger. Dieser war, höflich ausgedrückt, aus vielen Gründen höchst ungeeignet gewesen, um als Polizeiinspector zu arbeiten.
«Ein neuer Kollege?», fragte Fanny, als sie den jungen Polizisten sah, der gerade die Hecktür des Automobils öffnete, mit dem sie vorgefahren waren.
«Ja, brandneu ist er, Frau Doktor», erwiderte Slanec.
Kaum hatte der Junge die Hecktür des Austrodaimlers geöffnet, rutschte ihm eine Trage mit einer massigen Leiche darauf entgegen und stieß gegen sein Schienbein.
Der Junge jaulte kurz auf und hob dann die Trage an.
«Ich werde wohl gebraucht», meinte Slanec, lief hinüber und half seinem Kollegen, die Trage aus dem Wagen zu hieven.
Die Leiche darauf war riesig. Ein Mann in einem Frack, der stehend fast zwei Meter groß gewesen sein musste.
Slanec und der junge Polizist konnten ihn kaum tragen und taumelten mit der Trage Richtung Eingang.
Fanny sprang zur Seite und ließ sie passieren. Eine betörende Mischung aus Verwesung und Kölnischwasser stieg ihr in die Nase.
«Inspector Hufnagel, Frau Doktor, stets zu Diensten», sagte der Junge gepresst, als er an ihr vorbeilief.
Für einen Moment schien er seinen Helm lüften zu wollen, besann sich aber noch rechtzeitig, da die Trage gefährlich absackte.
Sie lächelte ihm zu, was ihn ein wenig zu verunsichern schien.
«Wo wurde er gefunden?»
«Mitten auf der Wiener Kunstschau, können Sie sich das vorstellen?»
Fanny ließ einen ersten Blick über die Leiche huschen, während sie den beiden Polizisten die Stiegen hinauf folgte. Die linke Seite seines Kragens war blutgetränkt, aber nicht übermäßig stark. Sonst konnte sie nichts entdecken.
«Das Personal hat ihn in den Waschräumen gefunden, er saß auf einer Toilette.»
«Ein ungewöhnlicher Ort, um ermordet zu werden», meinte Fanny.
Sie beschloss, die Polizisten nicht weiter mit Fragen zu bestürmen, da sie ihren Atem für den Aufstieg zu brauchen schienen.
Der Seziersaal war verwaist, als Fanny mit den Polizisten eintrat, wahrscheinlich erlaubte der Professor Franz erst runterzukommen, wenn die Beamten wieder fort waren.
Mit einem Stöhnen hoben sie die Leiche auf den erstbesten Tisch und wälzten ihn von der Trage.
Slanec wischte sich den Schweiß von der Stirn und strich sich die Uniform über seinem vorstehenden Bauch glatt.
«So … Hufnagel, gib der Frau Doktor bitte die Obduktionsanforderung.»
In der Miene des Jungpolizisten breitete sich blanker Terror aus. «Ich … ich hab sie unten …»
«Dann hol sie, geschwind!» Slanec schmunzelte, während der Junge hinauslief. «Er ist mir um einiges lieber als der Kaltenecker.»
«Verstehe ich gut», erwiderte Fanny.
«Kommt aus ganz zerrütteten Verhältnissen, der Arme, strengt sich aber weiß Gott an, um etwas aus sich zu machen.»
«Dann freut es mich, dass er an jemanden geraten ist, der so wohlmeinend ist wie Sie!»
«Ich bemühe mich zumindest.»
«Ich habe Sie ein paar Wochen nicht gesehen, hatten Sie Urlaub?»
Slanec senkte den Kopf und wich ihrem Blick aus. «Nein, leider nichts derart Erfreuliches … Mein Bruder ist unerwartet verstorben, wissen Sie? Ich musste helfen, seine Angelegenheiten zu regeln.»
«Das tut mir leid, ich verstehe, wie schwer das sein muss.»
Für einen Moment schienen seine Augen zu glitzern. Fanny streckte die Hand aus, um ihn an der Schulter zu berühren, als er in die Hände klatschte. «Jetzt bin ich ja wieder hier.» Er zwang sich zu einem Lächeln, das Fanny erwiderte.
«Erzählen Sie mir ein bisschen von unserem Gast?»
«Gibt nicht viel», meinte Slanec. «Angeblich heißt er Helmut Anka, das steht zumindest auf seiner Einladung. Aber genau da beginnt die Sache seltsam zu werden. Dieser Herr Anka ist in der Wiener Kunstszene völlig unbekannt.»
«Er wirkt nicht unbedingt wie ein Maler», gestand Fanny mit einem Blick auf Ankas riesenhafte Gestalt. «Vielleicht war er selbst als Interessent dort … oder er hat jemanden vertreten?»
«Könnte sein, wir wissen nicht einmal, wie er an die Einladung gekommen ist. Keiner der Organisatoren schien ihn auf seiner Liste zu haben.»
«Sehr seltsam. Und er wurde in den Waschräumen gefunden?»
«Ja, in einem der vielen Klosetts. Ein Kellner sah einen Blutstrom daraus hervorrinnen und öffnete die Tür … da hockte er dann.»
Fanny berührte den blutigen Kragen des Mannes und zog ihn ein wenig herunter. Es war eine Stichwunde, aber eine so feine, dass man sie ohne das Blut gar nicht so leicht bemerkt hätte.
«Scheint, als hätte ihn zumindest einer dort gekannt», murmelte Fanny.
Der junge Inspector Hufnagel kam keuchend zurück in den Sektionssaal gesprintet und überreichte Fanny die Obduktionsanforderung.
«Vielen Dank! Wir übermitteln den Bericht so schnell wie möglich!»
«Vielen Dank, Frau Doktor», meinte Slanec, lüftete kurz den Helm. «Vergiss die Trage nicht», sagte er an Hufnagel gewandt, der kaum Atem geschöpft hatte.
Wenige Augenblicke später war Fanny mit dem Toten allein.
«Also, Herr Anka», seufzte Fanny. «Schlechten Tag gehabt, würde ich sagen.»
Irgendwie fiel es ihr schwer, sich vorzustellen, dass er zu Lebzeiten ein freundlicher Mensch gewesen war. Ein bisschen fühlte sie sich schlecht, weil diese Annahme nur auf dem Äußeren des Mannes beruhte. Seine fliehende Stirn, das platt gedrückte Haar und ein Kiefer, das aussah, als könne er Ziegelsteine zerkauen. Noch einmal berührte sie den Hemdkragen. Darunter raschelte etwas. Verwirrt zog Fanny ein kleines Stück Papier darunter hervor, das wie durch ein Wunder unblutig geblieben war.
Fanny rückte ihre Lesebrille zurecht und runzelte die Stirn.
Einer von Dreien. Keiner ist allein.
Was sollte das denn bedeuten? Und vor allem, warum steckte der Papierfetzen in seinem Kragen? Sie faltete den Zettel und steckte ihn in die Tasche ihrer Schürze.
«So, hoffentlich niemand mehr da, der sich an meinem Anblick stoßen könnte», erklärte Franz, als er den Saal betrat. Er hatte die Zeit genützt, um sich zu waschen und einen frischen Mantel anzuziehen, wobei Fanny noch immer ein paar rote Spritzer unter seinem Ohr ausmachen konnte.
Sie erklärte ihm, was Slanec über den Toten erzählt hatte, während er sich die Obduktionsanforderung durchsah.
«Na dann …» Er klatschte in die Hände. «Fröhliches Schnippseln!»
2. Kapitel
Die lebende Leber
Sie entkleideten den Toten und führten die äußere Inspektion durch. Der Grad der Totenflecken und der Totenstarre sowie der geringe Verwesungsgrad deckten sich mit Slanecs Angaben. Der Mann war wohl tatsächlich auf der Kunstschau ermordet worden.
Die Todesursache war eindeutig die Stichwunde am Hals. Die rötlichen Verfärbungen rundherum wiesen darauf hin, dass das meiste Blut ins Gewebe geronnen war, anstatt nach außen zu sprudeln.
«Rücksichtsvoll», bemerkte Franz. «Das Putzpersonal wird’s dem Mörder danken.»
Er begann, mit Schere und Skalpell den Verlauf der Stichwunde freizulegen. Eine heikle Arbeit, die Fanny noch nicht verrichten durfte, aber sie notierte sich jeden noch so kleinen Handgriff.
«Der Stichkanal ist makellos», sagte Franz. «Der Angriff muss sehr schnell und gezielt ausgeführt worden sein, sonst hätte das Opfer den Kopf zur Seite geworfen, und die Mordwaffe hätt viel umfassendere Verletzungen verursacht. Das war präzise, Stich und weg.»
«Der Kanal ist so klein», murmelte Fanny. «Was kann das gewesen sein? Eine Stricknadel?»
«Ein bisserl dicker schon.»
Sie folgten dem Weg der Stichwaffe, die durch Haut und Fett elegant zwischen den Halsmuskeln durch die sogenannte Drosselrinne hindurchgeglitten war, um dann die Drosselvene, die Halsschlagader sowie die Luftröhre zu perforieren.
«Der war wahrscheinlich hinüber, bevor er bemerkt hat, wer’s war. Der Gert hat mir erzählt, dass sie genau an der Stelle am Hals die Sauen abstechen», meinte Franz kopfschüttelnd. «Ich werd nie wieder sorgenfrei aufs Häusl gehen.»
Fanny fertigte ein paar Skizzen an und legte sie zu ihren Notizen. Später, wenn sie den Bericht schrieb, würden sie ihr helfen, sich zu erinnern.
«So», meinte Franz. «Der kritische Teil ist erledigt. Der Rest gehört dir, Fräulein Jungassistentin.»
«Du meinst, ich darf ihn allein …»
«Sicher, sonst machst du’s sowieso nur heimlich.» Er blinzelte ihr zu. «Ich beginn derweil mit dem Bericht.» Er riss Fanny die Skizzen und Notizen aus der Hand und schlurfte aus dem Sektionssaal.
Fanny wartete, bis er fort war, dann klatschte sie begeistert in die Hände. Sie räusperte sich und besann sich einen Moment.
Mittlerweile kannte sie den Ablauf einer Obduktion im Schlaf. Das hieß nicht, dass sie nicht jedes bisschen Praxis aufsaugte, als wäre es ein Lebenselixier.
«Na dann, Herr Anka, lassen Sie uns nachsehen, ob Sie uns noch ein bisschen weiterhelfen können.» Sie zog sich ihre Kautschukhandschuhe an und berührte den Toten ermutigend an der Schulter.
Sie genoss jeden Schritt, vor allem, da sie nichts überhasten musste, weil sie jemand erwischen könnte.
Die Eröffnung der Körperhöhlen funktionierte schon wunderbar. Fanny geriet in eine Art Rausch, in dem sie alles andere vergaß. Es war dieses Gefühl, das sie mehr als alles andere an ihrer Arbeit liebte, die Ruhe, das völlige Fokussiertsein auf das, was ihr eine Leiche zu erzählen hatte. Helmut Anka war im Tod allerdings relativ zurückhaltend mit Informationen, sein Herz wirkte normal und gesund. Die Farbe seiner Lungen verriet ihn als Gelegenheitsraucher. Einen so stark bemuskelten Körper wie den seinen hatte Fanny noch nie unter das Skalpell bekommen. Die Kollegen an der Anatomie hätten ihre Freude mit ihm gehabt und ihre Studenten jeden Muskelstrang, jeden Nerv und jedes Gefäß freipräparieren lassen, um seine Gliedmaßen zu Anschauungszwecken zu konservieren.
Nur ein Organ bereitete Fanny Sorgen. Es passte so gar nicht zu dem vor Gesundheit strotzendem Rest Helmut Ankas: die Leber.
Fanny betastete das Organ mit gerunzelter Stirn. Es wirkte angeschwollen, als hätte sich darin Blut oder Flüssigkeit gestaut. Gleichzeitig war sie von harten, bindegewebigen Strängen durchzogen, wie man es oft bei starken Trinkern beobachtete.
Dabei war der Mann zumindest in den Stunden vor seinem Tod abstinent gewesen. In seinem Magen war nur Wasser gewesen.
Sie entnahm die Leber, wog sie auf der Organwaage, nur um festzustellen, dass sie mit eins Komma sieben Kilo erstaunlich schwer war, und legte sie in eine der vorbereiteten Schalen.
Fanny starrte das Organ ratlos an … blinzelte – und stieß ein erschrockenes Keuchen aus.
Die Leber, sie … sie bewegte sich. Fanny schüttelte ungläubig den Kopf, aber sie hatte sich nicht getäuscht.
Das Organ neigte sich mal in die eine, dann wieder in die andere Richtung, als ob es sich überlegen würde, auf welcher Seite es besser aus der Schale kriechen konnte.
Fanny suchte eine Weile nach Worten und hob schließlich zitternd den Zeigefinger. «H-hör auf damit!», stotterte sie dann.
Ihr Befehl ließ die Leber ziemlich unbeeindruckt. Fanny schnappte sich ein Skalpell und hielt das Organ mit der anderen Hand fest. Unter ihrer Handfläche fühlte es sich an, als würden sich winzige Maulwürfe durch die Leber graben.
Sie presste die Lippen zusammen und teilte es der Länge nach durch. Die Ausgänge der größeren Gallengänge traten im Schnitt zutage. Und im Inneren dieser Gänge bewegte sich etwas.
Fanny griff mit zitternden Fingern nach einer Pinzette, fuhr in einen größeren Gallengang hinein und zog etwas daraus hervor. Was zum Vorschein kam, war vielleicht drei Zentimeter lang, weißlich und wand sich wütend unter dem festen Griff von Fannys Pinzette.
Fanny rückte ihre Brille mit dem Ellenbogen zurecht.
«Was bei allen guten Geistern ist das?», hauchte sie.
Das Ding vor ihr entschied, nicht zu antworten.
«Franz?», rief sie.
Nach einer Weile erklangen seine schlurfenden Schritte im Gang.
«Fast hätt ich ein wohlverdientes Nachmittagsschläfchen gehalten. Ich hoffe, du hast einen guten Grund.»
Fanny wandte sich ihm zu und streckte ihm die Pinzette hin.
Franz’ schläfrige Augen wurden mit einem Mal so groß, wie Fanny sie nur selten zu Gesicht bekam. Er entrang ihr die Pinzette und hielt die sich windende Kreatur unter die Lampe über dem Sektionstisch.
«Unglaublich!», wisperte er. «So einen wollt ich immer schon mal sehen.»
«Wie bitte?»
«Ist das der Einzige?»
«Ich fürchte, nein!»
Ein kurzes Lachen entfuhr Franz.
«Die sind sogar noch besser als die Filzläuse damals», meinte er. «Fasciola hepatica. Der große Leberegel. Den kriegen sonst nur Veterinäre zu Gesicht.»
«Leberegel?»
«Die befallen hauptsächlich Wiederkäuer … und alle heiligen Zeiten erwischt’s auch mal einen Menschen.»
Er legte den Leberegel beiseite und wandte sich dem aufgeschnittenen Organ zu. Geschickt holte er weitere Parasiten aus den krankhaft verdickten Gallengängen.
«Für die war das das Paradies», meinte Franz. «Ein wohltemperiertes Haus, dessen Wände man essen kann, mit reichlich weiblicher Gesellschaft.»
«Wie hat er sich die bloß eingefangen?», wunderte sich Fanny. «Scheint nicht der Kerl zu sein, der viel mit Kühen und Schafen zu tun hatte.»
«Interessante Frage», meinte Franz. «Er müsste aus Kuhtränken oder Ähnlichem getrunken haben, um die Larven zu sich zu nehmen.»
«Hmh.» Fanny runzelte die Stirn, dann half sie Franz, die Leberegel in Alkohol einzulegen. Ein paar fixierte er in Formalin, damit sie später daraus mikroskopische Schnitte anfertigen konnten.
Eine seltsame Leiche … und ein seltsamer Mord. Auf jeden Fall hatten sie ihre Schuldigkeit getan, sie würde den Bericht später fertigschreiben.
Der Mord an dem Riesen Helmut Anka beschäftigte Fanny noch auf dem Heimweg. Ein Mord dieser Art wollte geplant sein, der Mörder musste also gewusst haben, dass Anka auf der Kunstschau sein würde. Und wie hatte er das wissen können, wenn Anka überhaupt keinen Bezug zur Welt der Kunst zu haben schien, zu Klimt, Otto Bauer oder Kokoschka?
Über den Mord nachzudenken, bewahrte sie kurzfristig davor, das klaffende Loch in ihrer Brust zu spüren. Es war ein warmer Juniabend von der Art, wie Tilde ihn geliebt hatte. Sie hätte sie gedrängt auszugehen. Vielleicht gäbe es irgendwo eine Freiluftaufführung, die sie nicht verpassen durften. Oder ein Konzert im Schlosspark des Belvedere?
Du hast überhaupt keinen Grund, schüchtern zu sein, Fanny, weißt du, jeder Fremde ist ein potenzieller Freund!
Es war einer dieser Sätze, durch die man Tilde für einfältig halten mochte – aber nur, wenn man sie nicht kannte. Für Fanny war er Ausdruck ihrer Herzlichkeit. Tilde besaß eine Art leutseligen Scharfsinn, mit dem sie Menschen leicht aus dem Gleichgewicht bringen konnte, die sie für ein naives Fräulein aus gutem Hause hielten. Wie damals, als sie blitzschnell kombiniert hatte, dass es unter dem Burgtheater einen Zugang zur sogenannten Unterstadt geben musste, wo sie hinuntergestiegen waren, um Max zu retten.
Sie schüttelte den Kopf und presste die Lippen zusammen.
Nicht schon wieder weinen, Fanny!
Sie erreichte ihr Wohnhaus in der Josefstädterstraße, wo sie gemeinsam mit ihrem Vater eine Wohnung im Mezzanin bewohnte. Sie hatte ihm erzählt, dass Tilde vermisst wurde, als sie mit Prinzi, Tildes Perserkater, im Arm nach Hause gekommen war. Es war auch für ihn ein schwerer Schlag gewesen, da Tilde sie so oft besucht hatte, dass sie ihm fast so vertraut war wie seine Tochter. Immerhin musste er sich nicht damit herumschlagen, dass Tildes Verschwinden seine Schuld sein könnte. Wenn Fanny damals nicht beschlossen hätte, sich mit der Freundin in Waidrings Salon einzuschleichen, dann würde …
Stopp.
Diese Gedanken führten zu nichts. Sie taten nur weh. Bei dieser Art von Überlegungen spielte die Zeit einfach nicht mit, die sich aus irgendwelchen Gründen entschlossen hatte, sich nur in eine Richtung zu bewegen, da konnte H.G. Wells noch so viele Romane schreiben.
Sie hoffte nur, dass sie heute Abend nicht schon wieder weinend in den Armen ihres Vaters landen würde.
Doch als sie die Wohnungstür öffnete, dachte sie für einen Moment, sie hätte die falsche Tür erwischt. Aus dem Wohnsalon drang das laute Gelächter ihres Vaters.
«Was …»
Fanny hängte ihren Hut an die Garderobe, während sie hörte, wie ihr Vater langsam aufhörte zu lachen. Tabakrauch schlug ihr entgegen, den sie vergeblich versuchte mit der Hand fortzuwedeln.
«I-ich glaube … sie kommt.»
Seit seinem Anfall im letzten Jahr fiel ihrem Vater das Sprechen schwerer als früher, obwohl er in der letzten Zeit – seit er sich regelmäßig mit Max’ Mutter traf – immer schneller Fortschritte machte.
«Ausgezeichnet.»
Fanny erstarrte. Ihr Vater hatte ihr gar nicht erzählt, dass er an diesem Abend Besuch erwartete. Sie hätte ihre Köchin Grete gebeten, länger zu bleiben, und wäre vielleicht etwas früher heimgekommen.
Die Stimme klang eindeutig männlich. Es kam höchst selten vor, dass einer seiner pensionierten Beamtenkollegen zu ihnen in die Wohnung kam. Sie trafen sich lieber in größeren Gruppen beim Heurigen auf das ein oder andere Glas Wein, besonders, wenn man draußen sitzen konnte.
Sie schritt durch den länglichen Flur in den hell erleuchteten Wohnsalon hinein. Ihr Vater saß am Esstisch, mit vom Wein geröteten Wangen und seiner Pfeife im Mundwinkel. Als Fanny hereinkam, wandte er sich ihr zu und hob die Hand zum Gruß. Ihm gegenüber saß ein elegant gekleideter Herr, dessen schwarzer Bart schon etwas mit Silber …
Waidring.
Fanny öffnete den Mund, aber kein Laut kam über ihre Lippen. Waidring wandte sich ihr ebenfalls zu und lächelte breit. Er hielt eine brennende Zigarre in der Hand und ließ sie spielerisch durch seine Finger gleiten, wie um sie daran zu erinnern, wie er Fannys Hand bei ihrem letzten Treffen damit verbrannt hatte.
Sie fuhr sich erschrocken über die weißliche Narbe auf ihrem Handrücken, die sie davon zurückbehalten hatte.
Die beiden Männer standen auf, Waidring mit einer fließenden Bewegung, ihr Vater deutlich langsamer.
Der Graf kam auf sie zu. Sie wusste nicht, wie ihr geschah. Neben ihr, auf dem Beistelltisch des Fauteuils, lag der Brieföffner ihres Vaters.
Hastig griff sie nach der Waffe, doch Waidring fing ihren Arm am Handgelenk ab und küsste ihr die Hand, als hätte sie sie ihm zum Kuss hingestreckt, nicht um ihn zu durchbohren.
«Guten Abend, Fräulein Goldmann», sagte er freundlich.
Das Hämatom an seiner Schläfe war völlig verblasst.
Sie starrte ihn nur an, während er sich aufrichtete und sich offensichtlich an ihrem Schrecken weidete.
Das passte alles nicht zusammen. Genau wie in den Albträumen, die sie immer wieder heimsuchten, in denen Waidring in ihr normales Leben hereinbrach wie eine ansteckende Seuche.
«G-grüßen», zischte ihr Vater ihr zu.
«Guten Abend», erwiderte sie knapp.
«Ich habe Ihrem Vater eben die guten Neuigkeiten berichtet, da Sie leider noch nicht daheim waren.» Er nahm einen langsamen Zug von seiner Zigarre, sodass deren Ende aufglühte.
Sie sollte um Hilfe schreien, aber was würde das schon bringen. Ihm an die Gurgel gehen wäre besser.
Ihr Vater und Waidring schienen auf eine Antwort zu warten, aber sie hatte keine. Der Brieföffner in seinem Hals wäre die einzig passende gewesen, aber Waidring war wie zufällig zwischen sie und die Waffe gedriftet.
«Sie kann es noch immer nicht fassen, Ihr Goldmädel», meinte er an Fannys Vater gewandt. «Ich gratuliere Ihnen, Sie sind die erste Stipendiatin der Von-Waidring-Stiftung für exzeptionelle Frauen. Unter all den Damen, die im Beruf Herausragendes leisten, haben Sie den bleibendsten Eindruck bei mir hinterlassen.» Er strich sich wie zufällig über die Schläfe.
Hinter Waidring ballte ihr Vater die Fäuste, um eine kleine Jubelgeste zu signalisieren.
«Stipendium?», wiederholte Fanny. Waidring hatte sie mit seinem unerwarteten Auftreten völlig aus der Balance gebracht.
«Ihre Bewerbungsschrift war geradezu inspirierend, so voller Courage, so voller Dankbarkeit für die Menschen, die Sie auf Ihrem Weg unterstützt haben.»
Er starrte die fassungslose Fanny einen Moment aus seinen schwarzen Augen an, dann lächelte er. «Verzeihen Sie, wo habe ich meinen Kopf!»
Er lief zurück in den Flur und kam mit einem schwer aussehenden, ledernen Aktenkoffer zurück. Er legte ihn auf dem Beistelltisch neben dem Fauteuil ab und öffnete ihn so, dass Fanny den Inhalt nicht erkennen konnte.
«Ich dachte, nachdem es sich um einen Preis handelt, sollte es auch eine Trophäe geben.» Er förderte eine vergoldete Statue des Walzerkönigs Johann Strauß zutage und reichte sie Fanny.
«Einer der größten Wiener für eine außergewöhnliche Wienerin. Ich hoffe, sie gefällt Ihnen?»
Es war seine Art, sie zu quälen. Sie hatte sich auf seinem Fest als mysteriöse Meisterdiebin, die Walzerkönigin, ausgegeben. Zum Beweis hatte sie ihm die kleine Johann-Strauß-Statuette gezeigt, die sie bei der Leiche des echten Diebs gefunden hatte.
Fanny nahm ihm die Figur aus der Hand. «Sie ist wunderschön», erwiderte sie kühl. «Ich sollte sie nicht zu oft betrachten. Sonst bilde ich mir viel zu viel auf meine Leistung ein. Wer zu überzeugt von sich ist, fällt schnell … und tief.»
«Und so bescheiden, es ist eine Zier», meinte Waidring freundlich. «So, lassen Sie uns nun die Formalitäten besprechen …» Er ging zum Esstisch zurück und machte eine einladende Handbewegung.
«I-ich verabschiede mich. S-Studierzimmer», erklärte ihr Vater und erhob sich umständlich aus seinem Sessel. Sein teilweise lahmes Bein zu kontrollieren, gelang ihm immer besser.
«Alles g-gut?» Er bedachte Fanny mit einem Blick, der nicht mehr ganz so heiter wirkte. Wahrscheinlich verriet ihm sein Instinkt, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Fanny hätte es ihm gern gesagt, aber sie musste ihn aus der Schusslinie haben, weg von Waidring.
Sie lächelte. «Aber natürlich, Papa, ich bin nur so aufgeregt.»
Er lächelte zurück und deutete Waidring gegenüber eine Verbeugung an, die dieser erwiderte.
«Herr Goldmann, es war mir eine große Freude. Sie müssen mir bei Gelegenheit noch mehr Geschichten aus Fannys Kindheit erzählen, gewiss sind Sie nicht unbeteiligt daran, dass so eine formidable Frau aus ihr geworden ist.»
Ihr Vater winkte ab und humpelte in Richtung seines Schlafzimmers. Studierzimmer nannte er es nur, wenn er Fremden gegenüber besser dastehen wollte, da die Wohnung der Goldmanns viel zu klein für ein Arbeitszimmer war.
Fanny rührte sich nicht, bis sie sicher war, dass ihr Vater sich mit einem Buch auf sein Bett gelegt hatte und nicht mehr hörte, was sie besprachen.
«Setzen Sie sich!», sagte Waidring mit einer Mischung aus Freundlichkeit und Befehl, die er so meisterhaft beherrschte wie kein anderer.
Fanny blieb stehen.
«Wollen Sie wirklich, dass ich mich wiederholen muss?»
Sein Blick glitt wie zufällig zur Schlafzimmertür ihres Vaters. Bei ihm musste man nicht hinterfragen, ob ein Blick, eine Geste oder ein Wort eine Drohung gewesen war. Es war immer eine.
Fanny trat an den Tisch und ließ sich auf dem Stuhl nieder, den Waidring ihr bereitgestellt hatte.
«Wieso töten Sie mich nicht einfach?», flüsterte Fanny.
Waidring selbst machte noch keine Anstalten, sich zu setzen, sondern ging hinter Fanny auf und ab, ließ seine Finger über die Lehne ihres Stuhls streichen und berührte dabei einmal wie zufällig die Haare in ihrem Nacken.
«Erinnern Sie sich an unsere erste Begegnung?»
Fanny spürte, wie sie zu zittern begann. Sie ballte ihre Fäuste unter dem Tisch, damit er es nicht sah.
«Ein ziemlich unangenehmes Erlebnis … mit einem süßen Ende, wenn ich es bedenke», erklärte sie und war froh, dass ihre Stimme weniger heftig zitterte, als sie befürchtet hatte.
Er wollte sie ängstlich und weinerlich sehen, aber diese Genugtuung würde sie ihm nicht geben.
«Hmh», machte er nur. Dann beugte er sich langsam zu ihr herunter, bis sein Kopf sich direkt neben ihrem befand.
«Erinnern Sie sich, was ich Ihnen über das Leben und das Sterben sagte?»
«Sie sagten, Sie erlauben jemandem nur zu leben, wenn er Ihnen lebendig mehr nutzt.»
Waidring richtete sich auf. «Ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Kein Wunder, dass Sie zu den Preisträgerinnen gehören.»
Fanny schloss die Augen und bohrte ihre Fingernägel in die Handflächen. «Und Tilde? Ist sie Ihnen nützlich? Oder haben Sie zu wenig Potenzial für Betrug und Gewalt in ihr gesehen? Oder wollten Sie sich einfach nur an mir rächen?»
«Oh, Sie sind wütend.» Waidring nahm auf dem Stuhl neben ihr Platz. «Das gefällt mir. Ihre Wangenknochen treten dann deutlicher zutage.»
«Was haben Sie ihr angetan?», wisperte Fanny, ohne ihn anzusehen.
Waidring sah sie an und seufzte. «Das Mädchen hat den Fehler begangen, mich zu brüskieren, indem sie sich für meine jüngst ermordete Madame Adoria ausgab. Ich weiß, im Grunde waren Sie die treibende Kraft hinter dieser Unternehmung, aber …» Er sah Fanny an und leckte sich über die Lippen. «Sie sind mir im Moment noch auf andere Weise nützlich.»
Fanny sah ihn mit unverhohlener Abscheu an.
«Und genau dafür musste ich dieses bezaubernde Ding aus dem Spiel nehmen, damit Sie sehen, was passiert, wenn Sie mir nicht gehorchen.»
Eine lähmende Furcht machte sich in Fanny breit. Sie wollte ihn anflehen, ihr zu sagen, ob Tilde noch lebte … oder noch besser, ihn an der Gurgel packen und die Wahrheit aus ihm herausquetschen.
Nein. Selbst wenn nur eine winzige Chance bestand, dass die Freundin noch am Leben war, musste sie Stärke zeigen. Waidring wollte etwas von ihr, und sie musste wissen, was es war.
Waidring beobachtete ihre Reaktion genau.
«Damit wir uns verstehen», meinte Fanny, «Ich werde Ihnen ähnlich nützlich sein wie ein Lungenabszess.»
Waidring lachte leise und hustete. «Aber wir beide wissen, dass das nicht stimmt, nicht wahr? Es steht zu viel für Sie auf dem Spiel.»
Er ließ sich nicht dazu herab zu erörtern, was das war.
«Also …» Er beugte sich vor, streckte seine Hand aus und strich ihr über die Wange. «… werden Sie jedem meiner Wünsche entsprechen, ganz gleich, was es auch sein mag? Verstehen wir uns?»
Fanny hätte ihm am liebsten den Finger abgebissen und ihn ihm vor die Füße gespuckt. Aber sie blieb ruhig, sperrte ihre Wut ein, ließ sie ihn nicht sehen.
«So ist’s brav», meinte Waidring und setzte sich wieder auf.
«Ich hörte, ich darf gratulieren, die erste Jungassistentin an der Gerichtsmedizin, wie Sie das nur angestellt haben. Die Person, die Sie auf dem Weg dorthin vor ein paar Monaten ausgeschaltet haben – Sie wissen, wen ich meine –, damit war ich allerdings nicht einverstanden.
«Wie kann Sie das stören?», zischte Fanny.
«Sie war mein Opfer. Ich wollte sie töten!»
Für einen Moment war Waidring so laut geworden, dass Fanny fürchtete, ihr Vater könnte etwas gehört haben. Sein Atem ging heftig, während er seine Contenance wiedererlangte.
«Verzeihen Sie, ich schweife ab», sagte er, nun wieder freundlich. «Ich war dabei, zur neuen Stelle zu gratulieren, und zu Ihrem Glück sind Sie mir in dieser Position ausgesprochen nützlich.
«Ich glaube, Sie überschätzen meinen Einfluss. Suchen Sie sich etwas, um Professor Kuderna unter Druck zu setzen. Sollte nicht schwer sein, wenn ich es bedenke.»
«Ich besitze genau, wen ich brauche.»
«Sie besitzen nicht, Sie erpressen!»