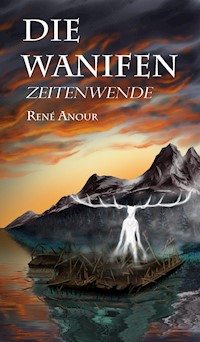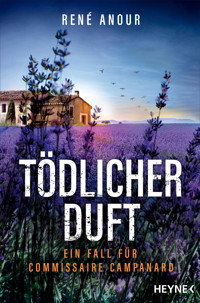Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Totenärztin-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine atemberaubend spannende Mischung aus Medizinhistorie und Krimi Wien, 1909: Die Gerichtsmedizin ist eine noch junge Wissenschaft, die sich ständig weiterentwickelt. Fanny Goldmann treibt diesen Fortschritt normalerweise mit voran, doch jetzt ist die sonst unerschrockene Ärztin zwiegespalten. Fanny und ihre Kollege Franz werden erstmals zu einem Tatort gerufen, um die Leichenbeschau vor Ort vorzunehmen. Und obwohl Fanny ziemlich abgehärtet ist, fährt selbst ihr ein Schauer über den Rücken, als sie sich in den dunklen Wäldern der Donauauen einem Mehrfachmord gegenübersieht. Sechs Tote, offenbar qualvoll gestorben, doch ohne erkennbare Todesursache. Ein grausiges Rätsel, das Fanny nicht ruhen lässt. Egal wie gefährlich die Ermittlung wird … Wissenschaftliche Fortschritte, soziale Umwälzungen, kuriose Fakten: René Anour verbindet fundierte historische Kenntnisse mit einem spannenden Kriminalfall und charmantem Wiener Schmäh. Band 3 der österreichischen Bestseller-Reihe um die Totenärztin Fanny Goldmann.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René Anour
Die Totenärztin
Donaunebel
Roman
Über dieses Buch
Als die Toten sprechen lernten …
Wien, 1909: Die Gerichtsmedizin ist eine noch junge Wissenschaft, die sich ständig weiterentwickelt. Fanny Goldmann treibt diesen Fortschritt normalerweise mit voran, doch jetzt ist die sonst unerschrockene Ärztin zwiegespalten. Fanny und ihr Kollege Franz werden erstmals zu einem Tatort gerufen, um die Leichenbeschau vor Ort vorzunehmen. Und obwohl Fanny ziemlich abgehärtet ist, fährt selbst ihr ein Schauer über den Rücken, als sie sich in den dunklen Wäldern der Donau-Auen einem Mehrfachmord gegenübersieht. Sechs Tote, offenbar qualvoll gestorben, doch ohne erkennbare Todesursache. Ein grausiges Rätsel, das Fanny nicht ruhen lässt. Egal wie gefährlich die Ermittlung wird …
Hochspannung vor historischer Kulisse.
Ein neuer Fall für Totenärztin Fanny Goldmann.
Vita
René Anour lebt in Wien. Dort studierte er auch Veterinärmedizin, wobei ihn ein Forschungsaufenthalt bis an die Harvard Medical School führte. Er arbeitet inzwischen bei der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und ist als Experte für neu entwickelte Medikamente für die European Medicines Agency tätig. Sein historischer Roman «Im Schatten des Turms» beleuchtet einen faszinierenden Aspekt der Medizingeschichte: den Narrenturm, die erste psychiatrische Heilanstalt der Welt. Sein zweiter Roman bei Rowohlt ist der Auftakt zu einer Reihe um eine junge Gerichtsmedizinerin in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts: «Die Totenärztin – Wiener Blut». Mit «Die Totenärztin – Donaunebel» liegt inzwischen der dritte Band der Reihe vor.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion Ulrike Brandt-Schwarze
Kartenillustration Christl Glatz, Guter Punkt, München, unter Verwendung von Motiven von iStock/Getty Images Plus
Zitat Seite 224 f. aus: «Eine Nacht in Venedig», Operette von Johann Strauß, Text: Richard Genée, Camillo Walzel, Mainz 1992
Zitat Seite 366 aus: «Der Graf von Luxemburg», Operette von Franz Lehár, Text: Robert Bodanzky, Alfred Maria Willner, Wiesbaden 1937
Zitat Seite 390 aus: «Wiener Blut», Operette von Johann Strauß, Text: Victor Léon und Leo Stein, Mainz 1992
Covergestaltung HAUPTMANN & KOMPANIE Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung Magdalena Russocka/Trevillion Images; ullstein bild
ISBN 978-3-644-01413-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
«Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Kreis herum, fidebum, es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann in unserm Haus herum.»
Marie blieb stehen, bückte sich und schob einige der schlammigen Flusssteine an eine andere Stelle. Sie richtete sich wieder auf und betrachtete den Parcours, den sie sich zurechtgelegt hatte, mit einem zufriedenen Lächeln.
Dann stellte sie sich wieder auf ein Bein, sodass ihre nackten Zehen sich ein Stück weit in den Schlamm gruben, und begann, den Steinpfad entlangzuhopsen.
«Es … tanzt … ein … Bi … Ba … Butzemann …»
Wind kam auf und fuhr durch die Kronen der uralten Schwarzpappeln, die die Lichtung begrenzten. Ein Schwarzspecht flog lärmend auf. Marie zuckte zusammen und kämpfte einen Moment mit dem Gleichgewicht. Erschrocken folgte sie dem dunklen Vogel mit ihrem Blick, bis dieser im undurchdringlichen Grün des Waldes verschwunden war.
Sie atmete tief durch. Dass sie so schreckhaft geworden war, daran war nur Matzl schuld.
«Irgendwann holt er dich, dein Butzemann, wenn du immer dieses Lied singst!», hatte ihr Bruder sie ständig gewarnt. «Von der anderen Hütte hat er schon zwei Mädel gefressen. Oder was glaubst, warum’s dort keine Kinder mehr gibt? Immer wenn der Nebel aufzieht, dann kommt er aus seiner Höhle.»
Matzl hatte mehrmals versucht, ihr zu verbieten, allein herumzustreunen. Da das nicht geholfen hatte, versuchte er es jetzt mit Angstmachen. Marie wäre ja gern ein braves Mädchen gewesen. Aber manchmal hielt sie die Enge der Lehmhütte einfach nicht mehr aus, die faulige Luft, die krächzende Stimme ihrer Mutter.
Der Wald hingegen war ihr Rückzugsort, ihr Revier. Ein paar Schritte von der Hütte entfernt war nichts weiter als das Singen der Vögel und das Brummen der Insekten zu hören. Manchmal ein Platschen, wenn der Biber am nahen Altarm ihre Gegenwart bemerkt hatte und Alarm schlug.
«Es gibt überhaupt keinen Butzemann!», hatte sie Matzl entgegengebrüllt.
Dass es nur noch wenige Kinder in der Siedlung gab, konnte viele Gründe haben, und obwohl Marie erst acht Jahre alt war, fielen ihr auf Anhieb ein paar ein. Die Kinder könnten weggelaufen sein, weil sie das Leben im Wald nicht mehr ertrugen. Marie hatte selbst schon oft darüber nachgedacht. Aber wo hätte sie denn hinsollen?
Vielleicht waren sie auch einfach im letzten Winter gestorben, als die halbe Siedlung Blut gehustet hatte.
«Wirst schon sehen!», hatte Matzl entgegnet. «Er kommt immer von hinten. Wennst gar nicht damit rechnest, verschlingt er dich mit Haut und Haaren.»
Obwohl ihr Bruder sie nur erschrecken wollte, ertappte Marie sich immer wieder dabei, wie sie einen hektischen Blick über die Schulter warf. Der Wind schien wieder einzuschlafen. Stattdessen begannen Nebelschwaden vom nahen Fluss aufzusteigen und trieben durch den Wald auf sie zu wie formlose Ungeheuer, die es auf sie abgesehen hatten.
Nichts Ungewöhnliches um diese Jahreszeit, genau darum hatte Matzl ja auch behauptet, dass der Butzemann den Nebel liebe – damit Marie sich immer fürchtete.
Sie spürte kühle Feuchte auf ihrer Haut, sobald die Schwaden sie eingehüllt hatten. Alles schien mit einem Mal gedämpft, die Farben des Laubs, der Pilze und der Beeren. Um sich herum sah sie nichts als dunkle Umrisse, als wären die Bäume nur noch die Geister ihrer eigentlichen Gestalt.
Vielleicht sollte sie heimlaufen. Natürlich nicht, weil sie Angst hatte. Aber vielleicht würde sich irgendjemand fragen, wo sie war. Nicht dass sie das für wahrscheinlich hielt. Bis auf Matzl interessierte sich niemand dafür, wo sie sich herumtrieb.
Wenn der Vater nächtens heimkam, war er nur müde und blaffte jeden an, der ihn ansprach. Und die Mutter? Im letzten Jahr, als Marie krank gewesen war, hatte sie einmal gesagt: «Der Herrgott gibt’s, und der Herrgott nimmt’s. Nimmt er das Mädel, gibt er vollere Teller!»
«Bei dem Spatzenmagen», hatte Matzl gebrummt. «Schau lieber, dass sie gesund wird, Mutter, dann kannst sie bald betteln schicken.»
Marie schüttelte die Erinnerung ab und lief los.
Der Schatten der knorrigen Silberweide, an der sie sich immer orientierte, tauchte so plötzlich aus dem Grau auf, dass sie beinahe dagegengelaufen wäre.
Sie schlug einen Haken und behielt gerade noch das Gleichgewicht. Sobald die kegelförmigen Umrisse der Lehmhütten vor ihr auftauchten, verlangsamte sie ihren Schritt. Wenn ihr Bruder sie so ängstlich sah, würde er sie den ganzen Abend lang hänseln. Wenigstens schützte sie der Nebel vor seinen Blicken, bis sich ihr Atem beruhigt hatte.
Sie wartete ein paar Momente in der wogenden Stille, dann schlenderte sie weiter auf die Hütten zu.
Außer dem Geruch nach Unrat stieg ihr nichts in die Nase. Schade. Sie hatte gehofft, dass ihre Mutter heute etwas Brotsuppe aufkochen würde, aber wahrscheinlich gab es wieder nur etwas Kaltes. Was auch immer der Vater mitgebracht hatte. Manchmal auch gar nichts, und dann war das Geschrei und Geheule ihrer Mutter sogar noch schwerer zu ertragen als der Hunger.
Sie seufzte und trat einen rostigen Topf weg, der scheppernd zur Seite rollte. Dann stieg sie über einen im Schlamm liegenden Spaten auf den schmalen Platz zwischen den Behausungen. Insgeheim nannte sie es ihr Dorf, aber in Wahrheit waren die fünf Hütten weit davon entfernt, eine Art Ansiedlung zu sein.
Für die Tageszeit war erstaunlich wenig los, obwohl der Nebel noch immer zu dicht war, um viel erkennen zu können. Normalerweise war hier immer jemand, da in den Hütten zu wenig Platz war, um sich ständig darin aufzuhalten. Jetzt machte Marie nur die Umrisse seltsam unförmiger Holzstämme auf der Lichtung aus. Vielleicht hatte ihr Vater oder der kräftige Ludwig von der Hütte nebenan sie hergeschleift, damit sie später Brennholz daraus machen konnten.
Nur an kalten Wintertagen, wenn das Ofenfeuer brannte, kauerten sie sich oft alle im Inneren zusammen und stopften alle Ritzen zu, damit sie nicht erfroren. Marie hasste diese Zeit. Wenn sie sich etwas wünschen könnte, dann, dass es nie wieder Winter werden und der Altweibersommer sogleich in einen warmen Frühling übergehen würde.
Etwas Helles am Eingang ihrer Hütte zog ihre Aufmerksamkeit auf sich. Marie runzelte die Stirn und ging darauf zu. Vielleicht ein alter Suppenknochen. Auch wenn sie sich nicht erinnern konnte, dass sie in den letzten Tagen einen gehabt hätten.
Aber je näher sie kam, desto weniger sah das Ding aus wie ein Knochen – und desto menschlicher wirkte es.
Es war ein Arm, der da am Boden lag. Die Handfläche zeigte nach oben. Die dazugehörige Schulter und der Oberkörper waren im Dunkel der Hütte verborgen.
Marie neigte den Kopf zur Seite. Diese länglichen Finger, die Schwielen, die raue, sommersprossige Haut …
Sie wusste, wie es sich anfühlte, wenn diese Hand über ihre Stirn strich. Sie wusste, wie es brannte, wenn sie ihr eine Ohrfeige verpasste. Jetzt lag die Hand einfach ganz ruhig da.
«Mutter?», wisperte Marie in den Nebel hinein.
Die Hand blieb reglos. Vielleicht hatte die Mutter sich neben dem Eingang zum Schlafen hingelegt, obwohl es ziemlich dumm wäre, das zu tun, weil es dort so zog.
Der Nebel schien sich endlich ein wenig zu lichten. Marie fand immer, dass er sich wie ein widerspenstiges Tier verhielt, genauso unvorhersehbar wie die Ringelnatter, die sie einmal gefangen hatte, die manchmal zischend nach ihr geschnappt hatte, nur um sich im nächsten Moment tot zu stellen und dann wieder einen Fluchtversuch zu wagen.
Endlich konnte sie ein wenig mehr erkennen.
Die Holzstämme, die auf dem Platz lagen, das waren überhaupt keine …
Marie sog erschrocken die Luft ein. Es waren Leute. Ihre Leute. Sie hatten so unförmig auf sie gewirkt, weil sie in so seltsamen Positionen dalagen.
Aber wieso taten sie das überhaupt?
«Matzl?», flüsterte sie und machte einen Schritt auf ihren Bruder zu. «Was machst du denn?»
Bestimmt würde er aufspringen und sie erschrecken. Aber wie hatte er es nur angestellt, dass die Erwachsenen bei seinem Schabernack mitspielten? Normalerweise hätte er sich dabei nur eine Kopfnuss eingefangen.
«Du kannst mich nicht erschrecken!»
Sie ging langsam auf ihn zu.
Er lag gekrümmt da, so wie er sich manchmal auf ihrem gemeinsamen Bett zusammenrollte, wenn er schlief.
«Matzl?»
Sie beugte sich zu ihm hinunter, jederzeit bereit zurückzuspringen, wenn er sie anfiel. Wie schaffte er es nur, so reglos dazuliegen?
Sie rüttelte ihn vorsichtig an der Schulter.
Sein Körper kippte auf den Rücken.
Marie starrte in sein Gesicht. Es erinnerte an einen Karpfen, der nach dem Hochwasser in einem viel zu warmen Überschwemmungstümpel zurückgeblieben war und panisch nach Luft schnappte.
Marie prallte erschrocken zurück und stieß ein heiseres Schluchzen aus.
«Matzl?», wimmerte sie. «Mutter?»
Keine der Gestalten auf dem Platz regte sich. Nur ein paar letzte Schwaden strichen an den runden Mauern der Hütten entlang.
Marie vernahm ein leises Knacken.
Er holt dich, wenn du es am wenigsten erwartest. Am liebsten kommt er von hinten.
Ein weiteres Knacken ertönte. Marie erstarrte.
Langsam wandte sie sich um … und stieß einen schrillen Schrei aus. Der letzte Gedanke, den sie zu fassen vermochte, war, dass ihr Bruder recht gehabt hatte … mit allem.
1. Kapitel
Trockener Humor
«Ich hab nicht die geringste Ahnung, wieso du dir das antust.»
Fanny ignorierte ihren Kollegen Franz und ging in Gedanken noch einmal die Reihenfolge der Instrumente durch.
Drei Größen von Skalpellen, zwei scharfe Messer, eine Gewebsschere, die Sternumschere, eine Sonde … verdammt, wollte er die Sonde lieber links von der Sternumschere oder rechts von ihr liegen haben?
Fanny seufzte und wandte sich dem zweiten Gerichtsmediziner im Seziersaal zu. «Dr. Valdéry, soll ich die Sonde links oder rechts von der Sternumschere hinlegen?»
Valdéry ließ seine Ausgabe des medizinischen Fachjournals sinken und warf Fanny einen entnervten Blick zu.
«Wenn Sie das nicht wissen, Fräulein Goldmann …», er seufzte und strich sich eine blonde Locke aus der Stirn, «dann sehe ich heute wirklich schwarz für Sie.»
Dass weder Valdéry noch Professor Kuderna sie jemals Doktor nennen würden, damit hatte Fanny sich mittlerweile abgefunden.
«Es ist komplett wurst», zischte Franz. «Bei uns verblutet keiner, wenn du die Sonde eine halbe Sekunde später findest.»
«Es geht doch nicht um mich», murmelte Fanny, ohne ihren Blick von den Instrumenten zu nehmen. Sie hatte sie säuberlich auf einem weißen Tuch am Rand des metallenen Sektionstischs aufgereiht.
Aus irgendeinem Grund musste sie dabei an ihre Tante Agathe denken. So gut wie immer, wenn sie bei ihnen zu Hause hereinschneite, musste sie sich das Gleiche anhören. «Das Entrée, Kind! Das, was dein Gast beim Hereinkommen sieht, muss perfekt wirken, merk dir das! Sonst ist schon der erste Eindruck miserabel.»
«Das Entrée», murmelte Fanny.
Vorsichtig fasste sie das blasse Bein der Leiche auf dem Tisch beim Sprunggelenk und schob es ein wenig zur Mitte, damit der Fuß nicht an dem Tuch streifte.
Besser …
Hoffentlich zumindest.
«Franz, schau dir das bitte an, fehlt was?»
Ihr Kollege verschränkte trotzig die Arme. «Bei dem Blödsinn mach ich nicht mit», erklärte er.
«Weil du’s nicht genau weißt, oder?»
«Auch.»
Valdéry seufzte hörbar und ließ seine Fachzeitschrift erneut sinken.
«Ich bin einfach zu gut. Aber so ist das nun einmal, die Kompetentesten werden halt immer gefragt.»
Er stolzierte zu Fanny hinüber und betrachtete ihr Assortiment. «Ts, ts, ts … Fräulein Goldmann, wenn der Professor diese Schlamperei sieht, wird er toben, das sag ich Ihnen.»
«Danke für deine Hilfe, Clemens», brummte Franz.
Fanny hätte gern etwas Ähnliches entgegnet, aber es war, wie es war. Valdéry hatte als Einziger von ihnen Professor Kuderna, dem Leiter ihres Instituts, früher mehrmals assistiert, bevor dieser sich endgültig davon verabschiedet hatte, Obduktionen durchzuführen. Franz hingegen war sich mit Kuderna so oft uneins gewesen, dass die beiden wohl ziemlich rasch dazu übergegangen waren, sich aus dem Weg zu gehen.
«Anstatt dass du dich freust, dass der alte Grantleruns nicht mehr dreinpfuscht, kitzelst du den schlafenden Drachen, bis er Gift und Galle spuckt … oder Grappa, auf den steht er momentan ganz besonders.»
Fanny versuchte, Franz zu ignorieren. Allein die Vorstellung, Professor Kuderna irgendwo zu kitzeln … Sie schüttelte sich. «Was stimmt denn nicht?», fragte sie, an Valdéry gewandt.
«Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll … Zuerst einmal besteht er immer auf dem dunkelblauen Tuch als Unterlage, damit ihn der scharfe Kontrast nicht zu sehr von der Leich ablenkt.»
«Der scharfe … wie bitte?»
«Außerdem ist die Reihenfolge der Instrumente ganz falsch. Zudem fehlen der Spatel und seine beiden Lieblingspinzetten, die scharfe und die breite.»
«Ich …»
Schritte ertönten im Gang und näherten sich dem Seziersaal.
«Schau mich nicht an, das Süppchen hast du dir ganz allein eingebrockt», sagte Franz und kratzte sich hinter dem Ohr. «Wieso musstest du dem Alten auch so lang auf die Nerven gehen, bis er mit dir obduziert?»
Fanny wollte gerade etwas entgegnen, da betrat Professor Kuderna den Seziersaal. Sein Rauschebart reichte beinahe bis zu den Knöpfen seines Tweedsakkos, das sich über seinen enormen Bauch spannte. Fanny versuchte, seine Laune am Ausdruck seiner Augen abzulesen, aber so gut sie auch darin geworden war, seine Wutausbrüche vorauszuahnen – diesmal vermochte sie nicht zu sagen, was sie erwartete.
Kuderna ging an Franz vorbei, ohne ihn eines Blickes zu würdigen. Dann nahm er wortlos die Kautschukhandschuhe, die Fanny für ihn bereitgelegt hatte, und streifte sie sich über.
Sobald er fertig war, hob er die Arme und verharrte in der Position, als wolle er die Leiche vor ihm auf dem Tisch segnen.
Fanny warf Franz einen fragenden Blick zu, aber der zuckte nur ratlos mit den Schultern. Warum zum Teufel bewegte sich der Professor nicht mehr? Ihr Blick glitt weiter zu Valdéry. Der starrte sie mit weit aufgerissenen Augen an und nickte hektisch in Richtung der Tür.
Professor Kuderna räusperte sich ungehalten. Und jetzt konnte Fanny das gefährliche Beben seiner buschigen Augenbrauen erkennen, das üblicherweise seinen Wutausbrüchen vorausging.
Ah! Die Schürze. Die Arbeitsschürzen hingen direkt neben der Tür. Kuderna erwartete vermutlich, dass sie ihm eine holte.
Fanny huschte an ihm vorbei, nahm eine möglichst sauber aussehende Schürze vom Haken und lief hastig zurück. Es war ihr, als höre sie ein spöttisches Schnauben, während sie sich an Franz vorbeidrückte.
«Hier bitte», keuchte sie und hielt Kuderna die Schürze hin.
«Nein», zischte Valdéry kaum hörbar. Fanny betrachtete Kuderna, der noch immer mit erhobenen Armen dastand, dann Valdéry hinter ihm, der so tat, als würde er ein Fass umarmen.
Fanny sah ihn ungläubig an. Konnte er das ernst meinen?
Valdéry nickte bedeutungsschwanger.
Jetzt hatte sie sich Franz’ Kichern mit Sicherheit nicht eingebildet. Sie spürte, wie sie rot wurde. Sie hätte die Schürze am liebsten einfach vor Kuderna auf den Tisch geworfen, aber sie war nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugeben.
Sie biss sich kurz auf die Lippen, dann machte sie einen Schritt nach vorn und hängte die Schlaufe der Schürze über den krausen Haarschopf des Professors und seinen kaum vorhandenen Hals. Die Vorstellung, es wäre ein Galgenstrick, half ihr ein wenig dabei. Dann fasste sie so rasch wie möglich um seinen ausladenden Rumpf, ergriff die Stoffbänder und verknotete sie hinter seinem Rücken.
Er behandelt nicht nur dich so, sagte sie sich. Auch Valdéry musste da durch.Dummerweise machte das die Vorstellung nicht unbedingt besser.
Endlich ließ Kuderna seine Arme sinken.
«Ich glaube, ich habe noch nie eine schlampigere Vorbereitung gesehen», verkündete er und streifte die Instrumente mit einem beiläufigen Blick. «Aber was hab ich auch erwartet?» Er betrachtete Fanny von der Seite. «Ein wirklich wohlgemeinter Rat, Fräulein Goldmann, kein Mann schätzt eine schlampige Ehefrau. Keiner.»
«Na, da haben S’ aber Glück, dass die selige Madame Kuderna bei Ihnen nicht so streng war», kommentierte Franz. «Mit ihrer ganzen Südamerika-Sammlung.»
«Wilder, Sie haben dieses Wochenende übrigens Bereitschaft, falls ich Ihnen das noch nicht mitgeteilt habe!», erwiderte Kuderna trocken.
«Oho!», rief Valdéry erfreut. «Das heißt, ich kann doch auf das Diner der Pathologengesellschaft gehen. Danke, Franz!»
«Glaub ich eh, dass du da hingehen kannst. Wenn man so schleimig ist wie du, flutscht man auch durch den engsten Türspalt.»
«Ruhe!», zischte Kuderna. «So!» Er schien nun mit Fanny zu sprechen, obwohl er sie nicht ansah. «Also, was haben wir hier? Anamnese!»
Fanny brauchte einen Moment, um sich wieder zu konzentrieren. Dann räusperte sie sich und wandte sich der Leiche auf ihrem Tisch zu. Es war ein etwas korpulenterer Herr, dessen Augen nach oben gerichtet waren, als würde er gerade etwas besonders genießen.
«Lukas Andertaler, Mitte sechzig, die Inspectoren fanden ihn …»
«Falsch, falsch, falsch!», unterbrach sie der Professor ungehalten. «Wie beginnen wir richtig? Laut der von mir entwickelten Wiener Obduktionsabfolge?»
«Ähm …» Fanny blinzelte. Sie wusste, dass Kuderna an seinem eigenen Buch über forensische Medizin schrieb. Da sie seine Notizen aber nie zu Gesicht bekommen hatte, hielt sie sich an die Standardwerke der gerichtlichen Medizin und das, was sie von Franz gelernt hatte.
Valdéry seufzte und vergrub das Gesicht in den Händen.
«Vielleicht beschreiben wir mal die Leiche … oder ist der Anblick Ihrem zarten Gemüt zu grauslich?»
Fanny spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. «Aber dazu wäre ich doch gleich …»
«Keine Ausreden! Also.» Kuderna machte eine einladende Geste in Richtung des toten Mannes.
Fanny atmete tief durch und drängte die Wut in ihrem Inneren zurück. Ihr Blick fokussierte die Leiche auf dem Tisch vor ihr. Wie immer, wenn sie das tat, schien es, als würde alles andere um sie herum gedimmt.
«Der Tote ist männlich und geringgradig adipös.» Sie fixierte die dunklen Totenflecken an der rechten Körperseite. «Großflächige Livores, rechte Körperhälfte, mittelgradiger Rigor mortis in allen Gliedmaßen feststellbar.»
«Das wissen Sie, weil …?»
«Na, weil ich es gerade eben …», sie wollte nach dem Arm des Toten greifen, um Kuderna zu beweisen, dass der Rigor, die Totenstarre, tatsächlich eingesetzt hatte, aber er klopfte ihr auf die Finger.
«Weil Sie wahrscheinlich wieder mal den Dr. Wilder bezirzt haben, dass er Ihnen die Antworten vorsagt.»
Franz stieß ein lautes Lachen aus. «Schauen Sie sich dieses Gesicht an, Herr Professor», sagte er, mit einem Mal wieder todernst, und zeigte auf seine Miene. «Sieht das für Sie bezirzt aus?»
«Ich habe die Leiche selbst untersucht», erklärte Fanny so gelassen, wie sie konnte. «Und bin in der Lage, den Grad der Totenstarre festzustellen.»
«Jaja, also weiter.»
Ausnahmsweise stimmte sie Kuderna zu. Einfach weitermachen! Konzentriert bleiben.
«Der Körper wirkt hochgradig dehydriert. Etwa fünfzehn Zentimeter lange und vier Zentimeter breite Wunde im Bereich des Brustbeins, ziemlich genau an der Grenze zwischen Brustkorb und Bauch. Die Sicht auf die Wunde ist verdeckt durch … durch …»
Kuderna stöhnte leise.
«… eine Art Spieß.»
«Wie man sieht, fehlt Ihnen der Blick für das große Ganze.» Kuderna wandte sich lächelnd zu Valdéry um, als erwarte er Beifall.
«Das sage ich auch immer, Herr Professor», erwiderte dieser, als hätte man bei ihm einen natürlichen Reflex ausgelöst.
«Und können Sie dem Fräulein auch sagen, warum?», fragte Kuderna.
«Ja, Clemens, kannst du?» Franz grinste und hüstelte.
«Selbstverständlich», erwiderte Valdéry mit erhobenem Zeigefinger. «Nur dass bei mir Kollegialität vor Angeberei kommt, Franz, daran solltest du dir ein Beispiel nehmen! Ich würde niemals das arme Fräulein Goldmann brüskieren.»
«Da wird der respektabelste Doktor zum Depp, nur weil ein Weibsbild anwesend ist», seufzte Kuderna.
«Sie finden mich respektabel?», sagte Valdéry und klang erfreut.
«Das ist ein Speer, Fräulein Goldmann, nicht irgendein Spieß», erklärte Kuderna und betrachtete den mannslangen Holzstiel, der aus der Brust des Toten ragte, voller Bewunderung.
Der junge Inspector Hufnagel und sein Kollege hatten die größte Mühe gehabt, den Toten mitsamt der Mordwaffe durch die Tür zum Seziersaal zu tragen, ohne irgendwo gegenzuschlagen.
«Siebzehntes Jahrhundert, würde ich sagen», raunte Kuderna bewundernd. «Aber von so etwas versteht ein Fräulein natürlich nichts.»
«Im Fach Speerkundehab ich auch geschlafen», murmelte Franz.
«Gut», fuhr Fanny fort. «Die Spitze des Speers hat den gesamten Brustkorb durchschlagen. Am Rücken des Toten tritt sie gerade noch zutage.»
«Wie lautet die genaue Beschreibung der Austrittswunde?»
Fanny ballte die Fäuste. «Risswunde, etwa in der Größe eines Ein-Heller-Stücks. Eine Handbreit seitlich des vierten Brustwirbels. Umgeben von flächigen Hämatomen.»
«So könnte meine siebenjährige Nichte eine Wunde beschreiben.»
«Die muss ja besser sein als Sie!»
«Wilder, auch der übernächste Bereitschaftsdienst muss besetzt werden. Danke für Ihre Meldung.»
«Oh, danke, Franz», jauchzte Valdéry.
«Fein!» Franz winkte ab. «Jetzt geh ich.» Er warf Fanny einen langen Blick zu. «Hab eh keine Ahnung, warum ich mir so was anschau.»
«So!» Kuderna wirkte mit einem Mal zufrieden. «Und jetzt zu den persönlichen Details, die Ihnen so wichtig sind.»
«Ludwig Andertaler, Anfang sechzig, die Inspectoren fanden ihn im Heizraum von Schloss Neuwaldegg. Er hat dort als Aufseher gearbeitet und anscheinend gerade den großen Kohleofen des Schlosses befüllt, als … Die Polizei verdächtigt die Köchin, die derzeit abgängig ist.»
Laut Polizeibericht hatten andere Bedienstete ausgesagt, dass Andertaler der jungen Köchin auf unangenehme Weise nachgestellt hatte. Warum haben sie der Frau nicht beigestanden? Jetzt ist ihr Leben genauso zerstört wie seines,dachte Fanny.
«Ich habe mich gefragt, ob …»
«Nicht fragen, Fräulein Goldmann, obduzieren!», befahl der Professor streng.
«In Ordnung.» Fanny griff zu einem der Messer, um einen ersten Schnitt in der Grube zwischen den Schlüsselbeinen zu setzen.
«Sie filetieren doch hier keinen Karpfen!», brüllte Kuderna. Er packte Fanny am Handgelenk und korrigierte ihre Fingerhaltung, sodass ihr Zeigefinger auf dem Rücken der Klinge lag, als hielte sie einen Bleistift.
Ein Teil von ihr bekam plötzlich Lust, Kuderna wie einen Karpfen zu filetieren, aber sie ignorierte den Wunsch für den Moment.
Vorsichtig setzte sie den ersten Schnitt. Kein Blut, gar nichts. Der Mann war vermutlich gegen Ende seiner Schicht gestorben und hatte dann ein paar Tage unentdeckt im Heizraum gelegen.
«Hmh!» Kuderna berührte den Schaft des Speers und schob mit der anderen Hand seine Brille ein wenig hinunter. «Was für ein interessantes Exemplar. Wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, werd ich mal mit dem Herrn Oberst reden, ob das gute Stück zu haben ist. Haben Sie eine Ahnung, was so eine Antiquität wert ist?»
Fanny rollte mit den Augen und konzentrierte sich, den Schnitt entlang der Körpermitte zu führen. Sie durchtrennte die Haut und die oberen Muskelschichten. Nur den Bereich um die Wunde ließ sie frei, um ihn mit feineren Instrumenten genauer inspizieren zu können.
«Das Unterhautgewebe wirkt …» Fanny suchte nach den richtigen Worten. Franz hätte sie genau erklärt, was sie sich dachte, nämlich dass es sich so anfühlte, als würde sie durch eine Räucherspeckschwarte schneiden. «… ziemlich ausgetrocknet. Vermutlich war er deutlich länger dort unten als bloß zwei Tage.»
«Das würde ein Student aus dieser Beobachtung schließen», bemerkte Kuderna und hob den Zeigefinger. «Der erfahrene Forensiker bildet sich aus allen vorhandenen Details sein Urteil. Der Mann wurde in einem Heizraum entdeckt. Könnte es sein, dass die Ofentür geöffnet war? Was, glauben Sie, würden ein, zwei Tage hohe Temperatur und Kohlendampf mit einem Körper anstellen?»
«Vermutlich genau das», musste Fanny einräumen.
Sie legte das Messer beiseite und nahm die Sternumschere zur Hand. Vorsichtig bohrte sie die Spitze der Schere in das Gewebe und setzte den ersten Schnitt. Das vertraute Knacken des Brustbeins erklang, dann folgte ein seltsames Geräusch, als wäre jemand gerade auf eine Nacktschnecke gestiegen, und plötzlich sah Fanny etwas durch die Luft spritzen …
Erschrocken sah sie auf.
Professor Kuderna stand reglos da. Der Eiter aus dem zerschnittenen Abszess klebte auf seiner Brille und tropfte langsam auf seine Wange.
«O mein Gott. Verzeihung, ich war überzeugt, dass da drin nichts mehr flüssig sein könnte, ich …»
Kudernas Gesichtszüge begannen zu beben.
«Himmel!», wisperte sie, legte die Instrumente hin und hastete zu den Regalen am Rand des Seziersaals hinüber. Einen Moment später reichte sie Kuderna ein paar Stofftücher, um sich das Gesicht abzuwischen. Der Professor riss sie ihr aus der Hand und wandte sich ab.
«Wenn ich mich gewaschen habe», zischte er nur mühsam beherrscht, «kommen Sie dem Toten nicht näher als drei Schritte, SIE WANDELNDE KATASTROPHE!»
Damit stampfte er hinaus. Fanny hörte ihn noch länger schimpfen, «… so eine Impertinenz … dieses unmögliche Weibsbild!»
Die Tür zu den Waschräumen knallte lautstark zu.
«Na, hoppala!», kommentierte Valdéry kopfschüttelnd. «Ich glaub, so wütend hat ihn noch keine Obduktion gemacht!» Er zuckte mit den Schultern.
Fanny atmete tief durch und wandte sich dem Toten zu.
«Nun, das ist nicht ganz so gelaufen wie gedacht», erklärte sie ihm. Vielleicht hatte ihre Tante Agathe wirklich recht, und ein schlampiges Entrée vermasselte einfach alles.
2. Kapitel
Eine explosive Mischung
Etwas später verließ Fanny das Institut und trat missmutig auf die Sensengasse hinaus. Franz hatte recht. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Dass Kuderna plötzlich ihre Kompetenz anerkennen und ihr seine geheimen Tricks beibringen würde? Jetzt konnte sie von Glück sagen, wenn er nur wieder anfing, sie zu ignorieren.
Zumindest der Rest der Obduktion war interessant verlaufen. Kuderna zuzusehen – leider aus ziemlich großer Entfernung –, wie er die Wunde freilegte, die der Speer in den Körper geschlagen hatte, war durchaus lehrreich gewesen. Er benutzte eine Sonde gemeinsam mit einer schmalen Skalpellklinge auf eine Art, die einen genau erkennen ließ, welche Gefäße durchtrennt und welche heil geblieben waren.
«Grüß dich, Frau Doktor!»
Fanny sah auf.
«Max!»
Er trug einen eleganten schwarzen Anzug und einen Hut, als plane er auszugehen. Ein Lächeln lag auf seinen Lippen, während er auf Fanny zuhumpelte. Die Verletzung, die er sich vor ein paar Monaten bei der Auseinandersetzung mit einer üblen Geheimgesellschaft zugezogen hatte, war immer noch nicht ganz verheilt.
Fanny lief auf ihn zu, ließ sich von ihm an den Händen fassen, ehe er ihr einen Kuss auf die Lippen drückte.
«Gott, ich rieche sicher noch nach Formalin.»
«Nicht mehr als sonst!», erwiderte Max.
Fanny hätte ihm gern gestanden, dass der Geruch nach Formaldehyd, in dem sie Organproben fixierten, für sie schon fast heimelig wirkte, aber es schien ihr ratsam, ihm ihre Seltsamkeit in kleinen Häppchen zu servieren.
«Lieb, dass du mich abholst», meinte sie. «Hattest du auf der Polizeiwache heute früher Schluss?»
Seine Miene verfinsterte sich. «Man glaubt es kaum, aber mir ist die Zettelarbeit ausgegangen. Und nachdem mich der Herr Oberst für noch nicht gesund genug hält, um in den aktiven Dienst zurückzukehren …»
Fanny strich ihm zärtlich über die Wange. Sie wusste, wie sehr er darunter litt, noch nicht völlig einsatzbereit zu sein. Manchmal erinnerte er sie an ein Rennpferd, dass man zu lange in die Box gesperrt hatte, so rastlos war er geworden.
«Aber egal! Was hältst du davon, wenn ich dich ausführe?»
«Charmant! Wohin denn?»
«Ganz in deine Nähe, ins Café Eiles!»
«Oh!» Fanny runzelte die Stirn.
«Oh?»
«Weißt du, tagsüber wirkt das Eiles wirklich reizend. Aber immer, wenn ich abends vorbeigehe, wird da so wild politisiert. Ich weiß nicht, ob es der richtige Ort für ein ruhiges Abendessen ist.»
«Ach, keine Sorge, der Ferdinand, dem das Etablissement gehört, sorgt schon für Ordnung. Und schließlich bist du in Begleitung eines Polizeiinspectors.»
«Das hab ich ganz vergessen», kicherte sie. «Dann braucht sich ein Fräulein wie ich wahrlich nicht fürchten.»
«Als ob», lachte Max. «Ich darf dich erinnern, dass du mit mehr zwielichtigen Gestalten zu tun hattest als die meisten meiner Kollegen.»
«Deshalb weiß ich, dass man sein Glück nicht herausfordern darf.»
Für einen Moment schwiegen sie beide. Fanny hatte es scherzhaft gemeint, aber es erinnerte sie daran, wie knapp sie vor einigen Monaten dem Tod entronnen waren. Sie waren in einen Machtkampf zwischen Kriminellen geraten, den manipulativen Grafen Waidring auf der einen Seite und die Gesellschaft, einen obskuren Geheimbund, dessen Mitglieder weiße Venezianermasken trugen, auf der anderen Seite.
«Übrigens …», Max bot ihr seinen Arm an und überbrückte damit die bedrückende Stille, die sich zwischen ihnen ausgebreitet hatte, «… möchte ich dir einen guten Freund vorstellen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn er uns heute Gesellschaft leistet.»
«Einen Freund?» Fanny versuchte, nicht zu überrascht zu klingen. Max und Freunde, das passte nicht sonderlich gut zusammen. Seine manchmal harsche Art und seine finstere, brütende Miene machten ihn nicht unbedingt zu einer Person, mit der andere Männer gern einen feuchtfröhlichen Abend verbrachten – das vermutete Fanny jedenfalls. «Wie schön!»
«Soll ich uns eine Kutsche anhalten?»
«Lass uns lieber hinspazieren.» Fanny schmiegte sich an seine Schulter. «Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen auslüften, bevor wir essen gehen.»
«Wie Sie meinen, Madame!» Max lächelte. Für einen winzigen Moment fühlte sich Fanny wie eine Figur in einem dieser dussligen Liebesromane, die sie sich manchmal von Tilde lieh.
Seit sie Max kennengelernt hatte, war er für sie immer ein Wunschtraum gewesen, manchmal näher, manchmal ferner. Dass er sie nun von der Arbeit abholte, sie Arm in Arm durch die Josefstadt flanierten, erschien ihr noch immer nicht real, als würde Max zerplatzen wie eine Seifenblase, wenn sie ihn in den Arm kniff.
«Au!», zischte er.
«Verzeihung, ein Versehen.» Fanny wandte sich ab, um ihr Grinsen zu verbergen.
Das Eiles war ein im modernen Jugendstil eingerichtetes Caféhaus hinter dem Wiener Rathaus. Es lag genau am Beginn der Josefstädter Straße, in der auch Fanny und ihr Vater lebten, wenn man weiter stadtauswärts spazierte.
Die rot bezogenen Sitzbänke und Holzstühle waren in Logen angeordnet, auf denen sich rauchende und energisch diskutierende Männer zusammendrängten, deren Gespräche wie das Summen eines wütenden Bienenschwarms nach draußen drangen.
Frauen konnte Fanny nur vereinzelt ausmachen.
«Komm!» Max führte sie durch die Glastür. Im Inneren des Cafés war es warm und dampfig, wegen der vielen transpirierenden Körper. Die Luft war so verraucht, dass Fanny husten musste. Max zog sie hinter sich her, durch den weitläufigen Sitzbereich in den hinteren Teil des Gastraumes. Ein paar Männer warfen ihr lüsterne Blicke zu.
Ein bisschen verhielt es sich mit Männern so wie mit dem Kapitalismus – bei geringem Angebot stieg die Nachfrage.
Max lotste sie an einen kleinen Tisch mit einer gemütlich gepolsterten Sitzbank im Eck und atmete tief durch. «Ziemlich belebt, was?»
«Oh ja!», erwiderte Fanny lächelnd, während ein Kellner im Frack heransauste und ihnen zwei Karten reichte. Das schlechte Gewissen plagte sie ein wenig, als sie sich etwas aussuchte. Da Max sie überrascht hatte, war leider keine Zeit geblieben, zu Hause Bescheid zu sagen, wo ihre Köchin Grete bestimmt ein Nachtmahl für ihren Vater und sie zubereitet hatte. Zumindest war sie sich einigermaßen sicher, dass ihr Papa sich ihretwegen keine Sorgen machen würde. Da er selbst eine Liaison mit Max’ Mutter, der Witwe Maria Meisel, pflegte, war den beiden natürlich nicht entgangen, dass ihre Kinder letzthin begonnen hatten, mehr Zeit miteinander zu verbringen.
«Sie wünschen?»
«Den Kaiserschmarrn mit Zwetschkenröster bitte», sagte Fanny und spürte, wie ihr das Wasser im Mund zusammenlief.
«Und einmal das Gulasch! Aber scharf bitte, Wenzel», ergänzte Max.
Der Kellner betrachtete die beiden über den Rand seiner Brille hinweg. «Rindsgulasch und Kaiserschmarrn. Eine explosive Mischung. Da wird’s wohl nicht so schnell fad bei den Herrschaften.»
Er wandte sich ab, ohne ihre Antwort abzuwarten, und verschwand in der Menge.
Max warf Fanny einen entschuldigenden Blick zu. «Es gibt lauschigere Plätze für ein Abendessen, aber …» Er sah sich um. «Weißt du, weil ich in den letzten Wochen oft früh Schluss hatte, bin ich einige Male hier gelandet und habe ein paar wirklich spannende Gespräche geführt.» Er wandte sich wieder Fanny zu und verschränkte die Finger. «Hier kann jeder seine Ideen äußern, hier ist nichts verboten.»
«Du weißt schon, wer es normalerweise wäre, der es Ihnen verbieten würde, Herr Inspector», sagte Fanny lächelnd.
«An einer guten Diskussion ist nichts Verbotenes», erwiderte er schulterzuckend. «Und hier geht’s nicht um Attentate oder Umstürze. Hier werden Ideen geboren, wie unsere Welt einmal aussehen könnte … wie sie aussehen sollte.»
Ein paar Männer grölten laut auf, als sich die Tür des Kaffeehauses öffnete und ein elegant aussehender, junger Mann eintrat. Unter seiner Melone kam ein hellblonder Schopf zum Vorschein. Er lächelte freundlich, als ihm die johlenden Männer zum Gruß ihr Bier entgegenhoben, und ging zu ein paar von ihnen hin, um ihnen die Hand zu schütteln.
«Ah, da ist er ja!» Max wandte sich nach dem Neuankömmling um.
«Das ist dein Freund?», fragte Fanny und musterte den Mann genauer. Wenn man versucht hätte, Max mit seinem kantigen Gesicht, den ernsten, eisgrauen Augen und dem schwarzen Haar ins Gegenteil zu verkehren, wäre vermutlich dieser Mann dabei herausgekommen. Er war kleiner als Max, von rundlicherer Gestalt, und jedes Mal, wenn er lächelte, hoben sich seine ausgeprägten Backen wie zwei reife kleine Äpfel.
«Sieht aus, als wäre er recht beliebt!», meinte Fanny, während Max’ Freund sich näherte.
Max hob eine Augenbraue. «Wäre ich auch, wenn ich doppelt so viel reden würde.»
«Das will ich gar nicht!» Fanny drückte seine Hand. «Dafür hab ich doch Tilde.»
«Mein lieber Max!» Der Fremde breitete die Arme aus, als sich Fanny und Max erhoben. Er umarmte einen etwas steifen Max kurz.
«Georg.»
«Schön, dich zu sehen! Schön, dich zu sehen!» Er klopfte Max auf die Schulter, ehe er sich Fanny zuwandte.
«Oh!» Er schenkte Max einen vielsagenden Blick. «Ist das etwa …»
Max räusperte sich. «Fanny, darf ich vorstellen, mein Freund Georg Hörmann. Georg, das ist …»
«Fanny Goldmann!» Es fiel ihr schwer, Georgs Strahlen nicht zu erwidern, als er sie ansah. «Verzeih bitte, hätte ich gewusst, dass Max dich heute mitbringt … Die Dame begrüßt man natürlich zuerst.»
«Keine Sorge», kicherte Fanny. «Übersehen zu werden, ist eine meiner großen Stärken.»
Georg lachte laut auf und hob den Zeigefinger. «Als wenn das jemand könnte! Max, du Schlawiner, du hast zwar erzählt, dass sie klug und hübsch ist, aber witzig hast du mir verschwiegen.» Während er ihre Hand küsste, hoffte Fanny inständig, dass die Seife am Institut den Leichengeruch von ihrem Handrücken gespült hatte.
«Setz dich doch zu uns!», sagte sie.
Um ehrlich zu sein, war sie angenehm überrascht. Georg wirkte zwar etwas überschwänglich, aber Fanny hatte nicht damit gerechnet, dass es sich bei Max’ Freund um einen so offenherzigen Charakter handeln würde.
«Mit dem größten Vergnügen!» Er zog sein braunes Jackett zurecht. «Habt ihr schon bestellt? Ich hab richtig Kohldampf! Eh, Wenzel!» Er winkte den Kellner heran.
Kohldampf … Wohl kein Wiener, eher ein Preuße. Als er hereinkam, hatte er allerdings kaum anders geklungen als jeder andere im Café Eiles.
«Und noch zwei Krügerl Bier, für meine Freunde!», erklärte er dem Kellner, nachdem er sich ebenfalls ein Gulasch bestellt hatte. «Also, Fanny!» Er stützte seine Ellenbogen auf den Tisch und legte sein Kinn auf die Hände. «Eine … Gerichtsmedizinerin, nicht wahr?»
Fanny warf Max einen überraschten Blick zu, aber der tat, als würde er gerade die Jugendstillampen an den Wänden bewundern. Was hatte Max ihm von ihr erzählt?
«Mein Institutsleiter würde dir nicht recht geben, aber ja.»
Der Kellner brachte ihnen die bestellten Bierkrüge, und sie stießen an. «Ah, der alte Kuderna … Auf euer Wohl!» Er nahm einen Schluck und wischte sich den Schaum von der Oberlippe.
«Du kennst den Professor?», fragte Fanny erstaunt.
«Ist ewig her. Ein Bekannter meiner Eltern.» Er lachte, drückte sich mit dem Zeigefinger gegen die Nasenspitze, um den näselnden Tonfall des sogenannten Schönbrunndeutsch der Wiener Oberschicht zu imitieren. «Sehr angesehen in der Gesellschaft, die Kudernas, eine vorzügliche Familie, vor allem sehr wohlhabend.»
Fanny lachte, und sogar Max entfuhr ein Kichern.
Georg nahm einen weiteren Schluck Bier und schüttelte den Kopf. «Ihn konnte ich nie leiden, aber seine Frau … Die war eine echte Erscheinung. Schade um sie.» Er runzelte die Stirn. «Wie ist sie noch mal gestorben? Sie hat sich vergiftet, oder?»
«Keine Ahnung», antworteten Fanny und Max hastig.
Georg blickte grinsend zwischen den beiden hin und her. «So verliebt, dass ihr schon mit einer Stimme sprecht?»
Fanny räusperte sich. «Das heißt, du kommst auch aus Wien, Georg? Ich muss gestehen, ich habe dich kurz für einen Preußen gehalten.»
«Hab ich ein wenig adaptiert. Sagen wir mal so, auf der Universität Wien war man nicht allzu begeistert von mir … also bin ich eine Zeit lang nach Berlin gegangen und hab dort mein Studium beendet.»
«Ein neues Leben in einer fremden Stadt, das klingt aufregend», kommentierte Fanny, streng darauf bedacht, das Thema nicht wieder auf Madame Kuderna zurückkommen zu lassen.
«Ach, die Berliner sind witzig. Unterscheiden sich nicht allzu sehr von den Wienern, aber während du hier den Schmäh mit Zuckerguss serviert bekommst, klatscht ihn dir der Berliner direkt in die Fresse. Beides hat was. Dort traut man sich jedenfalls, viel moderner zu denken als bei uns.»
«Moderner?»
«Man spricht gewisse Wahrheiten offener aus, so wie das auch hier im Eiles gern gemacht wird.»
Der Kellner kam und servierte ihnen das Essen. In Fannys Nase mischte sich die schwere Süße des Kaiserschmarrns mit dem würzig-scharfen Geruch von Rindsgulasch.
«Ich bin nicht sicher, ob ich dich verstehe.»
«Doch, ich bin sicher, das tust du.» Georg wirkte auf einmal erheblich ernster als noch gerade eben. «Sieh mich genau an, Fanny, was denkst du über mich?»
«Ähm.» Sie warf Max einen Hilfe suchenden Blick zu, aber der lächelte nur.
«Keine Scheu! Sprich es aus! Ein privilegierter Bonvivant. Ein höherer Sohn, den die Eltern nach Berlin geschickt haben, nachdem er in Wien das Studium geschmissen hat.»
«Das hab ich nicht gedacht», murmelte Fanny, wobei sie fand, dass «Bonvivant» ihren ersten Eindruck von ihm tatsächlich gut zusammenfasste.
«Jedenfalls ist es so», meinte er pragmatisch und stocherte in seinem Gulasch herum. «Und das ist furchtbar. Es gibt so viele solcher Leute … und sie leben davon, dass andere Leute Dreck fressen.»
«Nun, das stimmt natürlich. Ich für meinen Teil hoffe, dass die Wissenschaft eines Tages dazu führen wird, dass alle Menschen eine Chance bekommen, ihr Glück zu finden.»
«Oh, eine Idealistin!» Georg deutete mit der Gabel auf Fanny. «Und das würde funktionieren, in einer Welt, die von hundert Fanny Goldmanns regiert würde.»
Max lachte kurz. «So eine Welt würde mir gefallen. Ich würde jeden Tag mit einer anderen von euch ausgehen.»
Fanny versetzte ihm einen kleinen Tritt gegen das Schienbein. «Ich denke nicht, dass es meine Hilfe braucht, damit das passiert.»
«Wissenschaft ist ein Werkzeug, keine Ideologie, Fanny. Man kann sie auf unterschiedlichste Weise anwenden, auch um Leute arm zu halten und sich selbst zu bereichern.»
«Das mag sein, aber es ist eine zynische Art, die Welt zu betrachten. Für mich ist die Wissenschaft schon mehr als nur ein Werkzeug. Sie soll Erkenntnis bringen, sie hilft, die Wahrheit aufzudecken.»
«Stimmt natürlich», nuschelte Georg mit vollem Mund. «Und verzeiht meinen Zynismus, ich habe einfach schon zu oft erlebt, wozu die Gier Menschen treiben kann.»
Dem hatte Fanny leider nichts entgegenzusetzen. Sie war froh, dass die Diskussion kurz in die Pause ging, damit sie sich endlich ihrem Kaiserschmarrn widmen konnte. Er war luftig leicht, süß von Staubzucker und Rosinen und dem Zwetschkenröster. Über so ein Sinnesfest konnte sie für einen Moment alles vergessen, selbst die missglückte Obduktion mit dem Professor.
«Womit verbringst du deine Zeit, jetzt, wo du wieder zu Hause bist, Georg?», fragte sie schließlich.
Er grinste und nahm einen Schluck Bier. «Arbeiten. Als Assistent an der Fakultät für Geschichte. Gott sei Dank hatten die schon vergessen, wie ich damals als Student war.»
Max beugte sich vor. «Georg hat eine kleine Gruppe gegründet. Ein paar junge Leute, die sich politisch interessieren. Wir treffen uns einmal die Woche hier.»
«Wir diskutieren, tauschen Ideen aus … Du wärst stets willkommen, eine neue Zeit sollte im gleichen Ausmaß von Frauen gestaltet werden.»
Max nickte. «Ganz genau!»
«Ich werde euch gern mal einen Besuch abstatten», sagte Fanny, obwohl sie es nicht wirklich vorhatte. Dass Max etwas gefunden hatte, was ihn in seiner erzwungenen Untätigkeit aufheiterte, war großartig. Sie gedachte nicht, ihn dabei zu stören.
«Wie findest du ihn?» Max musterte Fanny ernst, während sie die Josefstädter Straße hinaufspazierten.
«Unterhaltsam», erwiderte Fanny lächelnd und spürte die Wärme, die von seinem Körper abstrahlte, als sie sich bei ihm einhängte.
Max hob eine Augenbraue. «Aber?»
«Kein Aber. Er ist sympathisch, aber entschuldige, wenn ich es nicht ganz ernst nehmen kann, wenn jemand, der so privilegiert ist wie er, sich über die Leiden der kleinen Leute beschwert.»
Max schüttelte den Kopf. «Du verkennst ihn.»
«Tu ich das?»
«Georg hat sich von seinen Eltern losgesagt.»
«Losgesagt? Das klingt ja fast wie in der Kirche.»
«Bloß mit einer realen Konsequenz. Er nimmt keinen Heller mehr von ihnen an. Und was er auf der hohen Kante hatte, hat er an eine Wohlfahrtsstiftung zur Unterstützung von Arbeiterwitwen gespendet. Er mag ein wenig überschwänglich wirken, aber er hat das Herz am rechten Fleck.»
«Oh, das ist … konsequent. Vielleicht hätte ich mir nicht so ein schnelles Urteil bilden sollen.»
«Auch eine Frau Doktor darf sich einmal irren.»
Eine elektrische Tram ratterte an ihnen vorbei, während die beiden langsamer wurden und vor Fannys Wohnhaus stehen blieben.
«Danke, dass du heute mitgekommen bist», sagte Max und strich ihr übers Haar.
«Hat Spaß gemacht!», murmelte Fanny und spürte, wie sie ein wenig rot wurde. Die Wahrheit war, dass sie sich sogar darüber freuen würde, wenn Max ihr Steuerberichte vorlas, so sehr genoss sie seine Gegenwart. Ob das wohl immer so bleiben würde? Welche Auswirkungen hatte diese ständige biochemische Überreizung auf den menschlichen Organismus? Vielleicht sollte sie …
Max küsste sie, bevor sie den Gedanken zu Ende denken konnte. Er fasste ihre Hände und drückte sie gegen die Hausmauer. Wie schwindelerregend sich das anfühlte! Wie viel schwindelerregender, wenn es nicht hier enden müsste, sondern wenn die beiden einen Ort für sich hätten, wo sie …
«Unerhört!», zischte ein älterer Herr mit Gehstock, der an ihnen vorbeihumpelte. In einer gutbürgerlichen Gegend wie der Josefstadt gehörte das wilde Küssen auf offener Straße nicht unbedingt zum gern gesehenen Benehmen.
Max zog sich von ihr zurück und klopfte ihr lächelnd den Mantel ab, wo er von der Hausmauer etwas weiß geworden war.
«Wir sehen uns morgen.»
«Ich wünschte, du müsstest nicht gehen.»
«Sollten wir deinen Papa wecken?»
«Wir könnten doch zu deiner Wohnung in Hernals …»
«Fanny», für einen Moment wirkte seine Miene beinahe gequält. Sie schätzte, er war ähnlichen körperlichen Turbulenzen ausgesetzt wie sie. «Ich will das hier richtig machen, verstehst du?»
«Du machst doch alles richtig», antwortete sie und legte ihm die Hand an die Wange.
«Du verstehst mich nicht. Ich will dir etwas bieten! Jemand werden, es wert sein, dass du dich für mich entscheidest.»
«Aber das bist …»
«Nein», er lächelte, «noch nicht! Aber ich verspreche dir, ich werde alles dafür tun!»
Er drückte ihr noch einen kurzen Kuss auf die Lippen, dann zog er sich den Hut in die Stirn und ging rasch die Straße hinunter.
Fanny blickte ihm kopfschüttelnd nach.
Sie hatte Männer immer ein bisschen um die Einfachheit ihres Lebens beneidet, aber in Wahrheit waren sie genauso komplizierte Wesen wie Frauen, die zwar nicht den gleichen, dafür aber ihren eigenen Zwängen ausgesetzt waren.
3. Kapitel
In den Wald
Am nächsten Morgen war Fanny etwas spät dran. Ihr Vater war ein wenig enttäuscht gewesen, da er ohne Nachricht mit dem Abendessen auf sie gewartet hatte, ehe er seinen Altwiener Suppentopf, den Grete, wie angekündigt, aufwendig aus Rinderbrühe mit Fleisch, Gemüse und Fadennudeln zubereitet hatte, schließlich allein gelöffelt hatte.
«Es tut mir leid! Max hat mich überrascht …», hatte sie entschuldigend gesagt, als ihr Vater sich in der Früh geweigert hatte, seine Zeitung zu senken, um sie anzusehen. Mit Luxus konnte Fanny zwar nicht viel anfangen, aber ein eigenes Telefon, wie es ein paar wenige Haushalte in Wien bereits hatten, das wäre wirklich etwas Praktisches.
Fanny war hinunter zum Bäcker gelaufen und hatte neben den üblichen Kaisersemmeln auch zwei Nusskipferl gekauft.
Nachdem sie Kaffee gekocht und in das Häferl ihres Vaters gefüllt hatte, schwenkte sie es vor ihm, sodass ihm der Kaffeeduft in die Nase stieg. Seine gute Hand schoss hinter der Zeitung hervor und schnappte sich die Tasse mit erstaunlichem Geschick.
Mit einem Grinsen auf den Lippen drückte Fanny die Zeitung hinunter. «Vielleicht reden wir beim Frühstück weiter.»
Die Mundwinkel ihres Vaters zuckten. «I-ich war … b-besorgt!»
Seit dem Schlaganfall vorletztes Jahr fielen ihm Sprechen und Gehen etwas schwerer, doch langsam wurde es besser.
Er erhob sich mithilfe seines Gehstocks und kam zum Esstisch herüber.
«Aber das musst du nicht. Wenn ich nicht heimkomme, kannst du davon ausgehen, dass ich mit Max unterwegs bin. Oder mit Tilde und Schlomo.»
Ihr Vater schnaubte und biss von seinem Nusskipferl ab. Schon von Kindesbeinen an hatte Fanny gelernt zu unterscheiden, ob er wirklich wütend war oder nur das Gefühl hatte, es sein zu müssen.
«Wie g-geht’s Tilde?»
Fanny brach eine Ecke von ihrem Kipferl ab und tauchte es gedankenversunken in ihren Kaffee.
Ihre beste Freundin. Der farbenfrohe Wirbelwind … Monatelang war sie nach ihrer Entführung verschwunden gewesen, ohne dass Fanny gewusst hatte, ob sie noch lebte oder tot war.
Erst als Mitglieder der Gesellschaft ihnen schon auf den Fersen gewesen waren, war es Fanny gelungen, Tilde zu finden und mit ihr zu fliehen. Die weißen Venezianermasken der Gesellschaft, die Fanny eine Zeit lang so gut wie überall zu sehen geglaubt hatte, hatten sich seither in das Reich ihrer Albträume zurückgezogen.
«A-also?»
«Es wird.» Fanny biss in den kaffeegetränkten Kipferlzipfel. «Ich glaube, sie ist bald wieder die Alte. Wir haben uns gemeinsam ein kleines Appartement angesehen. Neben dem Theater an der Josefstadt. Sie wird dort einziehen, denke ich.»
Ein gutes Zeichen. Das riesige Stadthaus von Tildes Eltern, die so gut wie nie zu Hause waren, hatte immer nur einsam und leer gewirkt und so gar nicht zu Tilde gepasst. Nachdem sie die erste Zeit nach der Entführung bei Fanny und ihrem Vater gewohnt hatte, war in ihr der Entschluss gereift, diesem bedrückenden Ort den Rücken zu kehren. Und dass Tilde und sie dann beinahe Nachbarn sein würden, war das Allerbeste daran.
«Was liest du da eigentlich?», fragte Fanny, als ihr Blick auf die gefaltete Zeitung neben ihrem Vater fiel.
Die Auwaldbestie geht um!, titelte das Blatt.
Ihr Vater zuckte mit den Schultern. «N-noch nicht gelesen.»
Während er sich seine Pfeife anzündete, stand Fanny auf, lief um den Tisch und küsste ihn auf die Wange. «Hab einen schönen Tag, Papa. Triffst du dich heute mit deiner Frau Meisel?»
Ihr Vater zuckte mit einer Schulter. «W-wirst schon s-sehen.» Er warf ihr einen bedeutungsschwangeren Blick zu. «O-oder … auch nicht.»
Fanny grinste, schlüpfte in ihren Mantel und verließ die Wohnung.
Auf dem Weg ins Institut musste sie an die verpatzte Obduktion mit Kuderna denken. Der Abend mit Max und das Gespräch mit ihrem Vater hatten sie beinahe vergessen lassen, wie sehr sie sich gestern selbst geschadet hatte. Franz’ Worte drangen ihr wieder ins Gedächtnis.
Ich weiß nicht, warum du dir das antust!
Ja, warum? Sie hatte sich so mühevoll zuerst als Prosekturgehilfin im Institut durchgebissen und sich dann eine Jungassistentenstelle erkämpft. Warum hatte sie sich nur in diese blöde Lage gebracht?
Wann immer es Professor Kuderna jetzt einfiel, aus seinem Studierzimmer zu kommen, würde er dafür sorgen, dass Fanny nichts mit den spannenderen Fällen zu tun bekam. Dabei hatte sie sich bei ihm schon von Abneigung zu Gleichgültigkeit hochgearbeitet. Jetzt konnte sie wieder von vorn beginnen.
Als sie das Institutsgebäude in der Sensengasse betrat und in den ersten Stock hinaufstieg, atmete sie tief durch. Nicht das erste und nicht das größte Hindernis, das sie auf ihrem Weg hatte überwinden müssen. Sie würde auch das schaffen. Irgendwie.
Sie war so sehr in ihre finsteren Gedanken verstrickt, dass ihr die aufgeregten Stimmen erst auffielen, als sie oben im Stock angelangt war.
«Unter gar keinen Umständen. Ich bin Mediziner.»
«Exakt!», krächzte eine raue Stimme, die Fanny nicht kannte. «Und genau deshalb brauchen wir Sie ja!»
Eine Polizeiwache stand vor Kuderna. Der junge Inspector Hufnagel, der seit einiger Zeit immer die Leichen ans Institut brachte.
Den anderen Mann kannte Fanny nicht. Es war ein älterer Herr mit schwarzem Mantel und blassem, faltigem Gesicht. Er hielt Kuderna gerade eine aufgeschlagene Ledermappe entgegen, deren Inhalt der Professor mit offensichtlichem Widerwillen studierte. Franz stand mit verschränkten Armen ein wenig abseits und beobachtete die Szene mit unbewegter Miene.
«Eine Sauerei», zischte Kuderna. «Zu glauben, man könnte ausgebildete Forensiker auf diese Weise herumkommandieren.» Er schnippte mit dem Finger. «Dr. Wilder, Sie übernehmen das!»
«Ja, wirklich, eine Sauerei», murmelte Franz.
Kuderna wandte sich zu ihm um, um etwas zu entgegnen, als er Fanny im Gang stehen sah. «Fräulein Goldmann», er deutete auf Fanny, «Sie brauchen sich gar nicht erst umzuziehen.»
Sie legte erschrocken die Hand auf die Brust. «Entlassen Sie mich etwa? Schon wieder?»
«Sie gehen mit, sonst stehen Sie mir hier eh nur die ganze Zeit im Weg.»
«Das ist nichts für ein junges Fräulein», brummte der Mann im dunklen Mantel und musterte Fanny.
«Die Frau Doktor Goldmann ist Gerichtsmedizinerin», erklärte ihm Inspector Hufnagel, was Kuderna mit einem spöttischen Schnauben quittierte.
«Was is eigentlich mit dem Clemens?», fragte Franz, an Kuderna gewandt. «Der würd Ihnen doch für eine so besondere Gelegenheit die Stiefel sauber lecken.»
«Der Dr. Valdéry ist krankgemeldet. Herpes oralis … Bläschen auf der Zunge.»
«Ah ja, verstehe! Quasi … Valdéritis.»
«Also.» Kuderna wandte sich wieder dem Mann mit der Ledermappe zu. «Da bitte, Sie wollten ja zwei.» Er wies auf Fanny und Franz. «Die können Sie von mir aus mitnehmen … und ich brauche sie nicht so bald zurück!»
Er wandte sich ab, verschwand in seinem Büro und schloss demonstrativ die Tür.
Der Mann im schwarzen Mantel schnaubte und wandte sich dann den beiden Gerichtsmedizinern zu. «Kriminalinspector Czerny», stellte er sich mit seiner rauen Stimme vor. «Sie kommen mit mir!»
«Verzeihung», flüsterte Fanny. «Aber wohin?»
Czerny schenkte ihr einen Blick, der sorgenvoll und traurig zugleich wirkte. «Packen Sie alles ein, was Sie zum Arbeiten brauchen.»
«Sie wissen aber schon, was wir machen?»
«Ich kann es mir vorstellen. Aber mir geht es mehr um das, was Sie tun, bevor Sie tun, was Sie tun.»
Franz nickte langsam und wandte sich Fanny zu. «Im vorderen Kasten links steht eine schwarze Ledertasche. Pack Handschuhe, ein paar Obduktionsberichte und zwei Schürzen ein. Zur Sicherheit noch ein paar Instrumente – Scheren, Pinzetten, achtzehner Skalpell, das sollte reichen.»
«Ja, Franz!»
Fanny hastete an den Männern vorbei in den Seziersaal, schnappte sich die etwas verstaubte Ledertasche und befüllte sie mit der Ausrüstung, zusätzlich packte sie noch ein Klemmbrett und zwei Bleistifte hinein. Sobald sie zurück war, nickte Inspector Czerny, dann gingen sie los.
Unten vor dem Institut parkte der Austrodaimler der Polizeiwache. Fanny musste so sehr in Gedanken versunken gewesen sein, dass er ihr beim Hineingehen gar nicht aufgefallen war.
Inspector Hufnagel öffnete ihr die Autotür. Der junge Polizist hatte normalerweise ein Lächeln auf den Lippen, aber jetzt wirkte er ungewöhnlich still und blass.
Die beiden Gerichtsmediziner nahmen auf der Rückbank Platz, während Hufnagel sich auf den Fahrersitz setzte.
«Was machen wir hier?», flüsterte Fanny Franz zu.
Er zuckte mit den Schultern. «Nähere Informationen hat wohl nur der Professor … Sie wollen uns bei irgendwas ‹vor Ort› haben.»
Hufnagel startete den Motor, der ohrenbetäubend laut losratterte. Benzingeruch stieg Fanny in die Nase, während sich der Wagen in Bewegung setzte.
Eine Automobilfahrt war noch immer ein außergewöhnliches Erlebnis für sie. Mittendrin zu sitzen, wie es sich zwischen Kutschen und Trams hindurchschob und Fußgängern auswich, die über die Straße liefen, fühlte sich an, als hätte man eine Eintrittskarte in die Zukunft gebucht.
Sie fuhren am Schottentor vorbei auf die Ringstraße. Vor dem Backsteingebäude der Börse hatten sich ein paar Männer mit Schirmmützen und dunklen Mänteln versammelt.
«Schon wieder ein Arbeiterprotest», brummte Czerny. «Wo sind unsere Kollegen, um das aufzulösen? Hufnagel, Zeit, dass wir das neue Ding ausprobieren … Betätigen Sie dasKlaxon!»
Der junge Inspector bremste das Automobil und betätigte einen kleinen Hebel unter einem messingfarbenen Metalltrichter.
Ein schrilles Hupen erscholl und ließ Fanny und Franz im gleichen Ausmaß zusammenzucken wie die Männer auf der Straße.
Czerny hielt den Arm aus dem Wagen und deutete den Protestierenden mit seiner schwarz behandschuhten Hand, dass sie aus dem Weg gehen sollten.
Der Doppeladler, der ins Metall der schwarzen Karosserie gestanzt war, tat seine Wirkung. Widerwillig wichen die Arbeiter zur Seite und verfolgten mit finsteren Mienen, wie das Automobil an ihnen vorbeirollte.