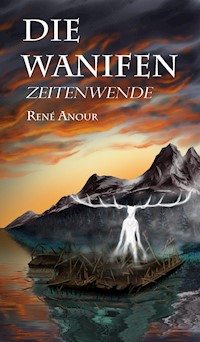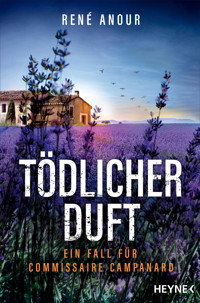9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hinter den Mauern des Narrenturms, der ersten psychiatrischen Heilanstalt der Welt ... Ein hervorragend recherchierter und extrem spannender Roman, der ein außergewöhnliches Stück Medizinhistorie vor der Kulisse weltgeschichtlicher Ereignisse erzählt. Wien, 1787. Der Medizinstudent Alfred ist fasziniert vom sogenannten Narrenturm. Hier werden erstmals die Irrsinnigen behandelt, ein ganz neuer Zweig der Medizin. Doch die Zustände sind erbarmungswürdig. Und der Anblick einer jungen Frau mit seltsamen Malen auf den Armen lässt ihn nicht los. Die junge Adlige Helene war noch nie am Wiener Hof. Ihr Vater hält Schönbrunn für eine Schlangengrube und will seine Tochter möglichst lange von dort fernhalten. Doch er kann sie nicht beschützen. Der Student, der zu viel sieht. Und die Adlige, die frei sein will. Zwei Menschen, ein Schicksal – das sich im Schatten des Turms entscheiden wird … Ein großes historisches Panorama: vom Narrenturm bis nach Schönbrunn, vom idyllischen Jagdschloss bis in die Türkenkriege.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
René Anour
Im Schatten des Turms
Ein Wien-Roman
Über dieses Buch
Hinter den Mauern des Narrenturms, der ersten psychiatrischen Heilanstalt der Welt ...
Wien, 1787. Der Medizinstudent Alfred ist fasziniert vom sogenannten Narrenturm. Hier werden erstmals die Irrsinnigen behandelt, ein ganz neuer Zweig der Medizin. Doch die Zustände sind erbarmungswürdig. Und der Anblick einer jungen Frau mit seltsamen Malen auf den Armen lässt ihn nicht los.
Die junge Adlige Helene war noch nie am Wiener Hof. Ihr Vater hält Schönbrunn für eine Schlangengrube und will seine Tochter möglichst lange von dort fernhalten. Doch er kann sie nicht beschützen.
Der Student, der zu viel sieht. Und die Adlige, die frei sein will. Zwei Menschen, ein Schicksal – das sich im Schatten des Turms entscheiden wird …
Vita
René Anour lebt in Wien. Dort studierte er auch Veterinärmedizin, wobei ihn ein Forschungsaufenthalt bis an die Harvard Medical School führte. Er arbeitet inzwischen bei der österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und ist als Experte für neu entwickelte Medikamente für die European Medicines Agency tätig. Sein historischer Roman «Im Schatten des Turms» beleuchtet einen faszinierenden Aspekt der Medizingeschichte: den Narrenturm, die erste psychiatrische Heilanstalt der Welt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Zitat Seite 102/103 frei übersetzt aus Ovid, Metamorphosen, Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Stuttgart 2010
Zitat Seite 148 und 639 aus Friedrich Schiller, Gedichte, hrsg. von Norbert Oellers, Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Stuttgart 2009
Nachweis Abbildung Innenteil © De Agostini Picture Library/Getty Images
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung akg-images; Erich Lessing/akg-images
ISBN 978-3-644-40665-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Personenverzeichnis
Alfred Wagener, Medizinstudent
Komtesse Helene Amalia von Weydrich, Erbin eines bedeutenden Adelsgeschlechts
Ein Namenloser, Insasse
Dr. Clemens Ofczarek, Irrenarzt
Wolfgang, Wärter
Josef, Wärter
Konrad, Insasse
Ein stummes Mädchen, Insassin
Karli, Insasse
Weitere Insassen: der lustige Ferdl, Madeleine, August, der Muselmann
Prof. Leopold Auenbrugger, Erfinder der Perkussion (hist. belegt)
Aigner und Mayerhofer, Alfreds Kommilitonen
Professor Joseph Quarin, Direktor des Allgemeinen Krankenhauses (hist. belegt)
Rupert, sein Assistent
Ravnicek, arbeitet im Waschhaus
Graf Georg von Weydrich, einflussreicher Adliger
Frantisek, Haushofmeister, ein Böhme
Adelheid, Helenes Gouvernante
Gertraud, eine Zofe aus Mähren
Hannerl, eine junge Zofe
Wolfgang, ein junger Page
Karl, Gärtnerssohn
Kathie, eine Küchenmagd
Johann, ein Kutscher
Joseph II. von Habsburg-Lothringen, Kaiser des Hl. Römischen Reichs, Erzherzog von Österreich (hist. belegt)
Erzherzog Franz von Habsburg-Lothringen, sein Neffe und Thronfolger (hist. belegt)
Gräfin Grazia von Karschka-Weydrich, Helenes Tante väterlicherseits
Heinrich, ihr Haushofmeister
Graf Severin von Auring, ein hochbegehrter Junggeselle
Graf Franz von Walsegg, ein Mann vieler Geheimnisse (hist. belegt)
Graf von Khevenhüller, Herr von Schloss Kammer am Attersee (hist. belegt)
Eugénie von Maybach, Helenes Freundin
Aurelian alias «Der Pirol»
Feldwebel Stephan Jägerstedt alias «Die Elster»
Der Adler
Der Kuckuck, ein ausländischer Agent
Weitere: der Sperber, der Neuntöter, die Dohle und die Möwe
Jägersmann Gerwald Piruwetz
Major von Klippfels, Befehlshaber des Jägerregiments
Maître LeBrus, Tanz- und Benimmlehrer
Direktor Maximilian Hell, Leiter der Wiener Sternwarte (hist. belegt)
Andreas, ein Linieninfanterist
Wolfgang Amadeus Mozart, Komponist (hist. belegt)
Giacomo Casanova, ältlicher Autor und Frauenheld (hist. belegt)
Prolog
1788
Blut strömte über seine Finger und tropfte auf die Erde.
Er stand inmitten toter Soldaten, in einem Meer aus leeren Mienen und grotesk verrenkten Gliedmaßen.
Eine Frauenstimme rief seinen Namen. Als er sich in ihre Richtung wandte, sah er sie zwischen den Toten stehen, in einem tiefroten Kleid, mit wehendem Haar und traurigen Augen. Sie schien etwas sagen zu wollen, doch in diesem Moment sprossen Federn aus ihrer Haut, und ihre Stimme verwandelte sich in ein Zwitschern. Eine Nachtigall spreizte ihre Schwingen und erhob sich in den Himmel.
«Komm zurück!», brüllte er ihr nach.
Unter ihm bewegte sich etwas. Die toten Soldaten hatten begonnen, auf ihn zuzukriechen. Ihre blutigen Mienen starrten ihn unverwandt an, während sie mit eiserner Kraft nach ihm griffen. Er wollte sich wehren, aber ihre schiere Masse drückte ihn nieder. Klamme Finger tasteten nach seinem Hals – und drückten zu.
Er erwachte mit dem Gefühl zu ersticken. Der Versuch zu schreien verkümmerte zu einem heiseren Krächzen. Für einen Moment schnappte er nach Luft, doch dann löste sich der quälende Druck von seiner Kehle, und er konnte wieder frei atmen.
Heftig keuchend sah er sich um. Es war dunkel, und die Luft roch nach feuchtem Stein. Er spürte die Kälte des Bodens durch sein dünnes Gewand hindurch. Sein Gesicht brannte, als hätte er auf Brennnesseln geschlafen, und dort, wo seine Arme sein sollten, fühlte er nur das taube Echo von Schmerz.
Die Umrisse eines gemauerten Raums zeichneten sich im Dämmerlicht ab. Ihm gegenüber befand sich eine Tür mit einem Guckloch, der einzigen Lichtquelle.
Wo war er, und warum war er hier? Er versuchte, sich an irgendetwas zu erinnern, aber es fühlte sich an, als wäre sein Verstand von einem dichten Nebel durchdrungen.
«Wie heiß ich?», murmelte er verwirrt. Zumindest der Klang seiner Stimme war ihm vertraut. Er strengte sich an, wollte nach seinem Namen greifen, doch er schien ihm immer wieder zu entgleiten.
Er stieß ein verzweifeltes Knurren aus. Was war man denn, ohne Namen? Ein Niemand, nichts.
Ein seltsames Gefühl auf seiner Wange riss ihn aus seinen Gedanken. Als würde sich dort etwas bewegen …
Er versuchte, sich ins Gesicht zu greifen, aber sein Arm wurde mit einem lauten Klirren zurückgerissen. Kaltes Metall glitt über die Haut auf seinem Hals. Er keuchte erschrocken auf.
Angekettet, wie in einer Kerkerzelle … Deshalb fühlten sich seine Arme so taub an. Verzweifelt stemmte er sich gegen die Ketten, um sie aus der Verankerung zu reißen.
«Ist da jemand?», brüllte er aus Leibeskräften. Was, wenn man ihn an diesem Ort zurückgelassen hatte, damit er qualvoll verendete?
Mit einem Mal glaubte er, Stimmen hinter der Tür zu hören. Sofort hörte er auf zu toben.
«Viecherl ansaugen … ans Ketterl … Schwarze Galle ausdünsten.»
«Hallo!», brüllte er und schlug mit den Ketten gegen die Mauer, um sich bemerkbar zu machen.
Stille … Hatte er sich die Stimmen vielleicht nur eingebildet?
Ein Schatten verdunkelte das Guckloch. Dann klickte es im Schloss, und die Tür schwang nach innen auf. Das hereinfallende Licht schmerzte in seinen Augen. Als er blinzelte, erkannte er den Umriss einer Gestalt in der Tür. Die Miene des Fremden blieb dunkel gegen das Licht, nur ein Monokel blitzte auf, als er ihm den Kopf entgegenneigte.
«Bitte, wer immer Ihr auch seid, helft mir!», hauchte er verzweifelt. Wieder fühlte er, wie sich etwas Glitschiges auf seiner Wange bewegte, und nicht nur dort, auf seiner Stirn, an seinem Hals … als würden Nacktschnecken über seine Haut kriechen.
«Aber wir helfen dir doch, armer Junge», erwiderte der Monokelträger. Sein Umriss verriet edle Kleidung, ein Justaucorps und Kniebundhosen. Der Hauch eines Colognes mischte sich mit dem modrigen Geruch der Zelle. Zumindest schien das kein Kerkermeister zu sein. Der Mann wandte sich ab und sprach mit jemandem außerhalb seines Sichtfeldes. «Leider noch immer tobend. Morgen noch einmal ans Ketterl, bitte …» Der Monokelträger verschwand. An seiner Stelle betraten zwei breitschultrige Gestalten – möglicherweise Wächter – die Zelle und kamen auf ihn zu. Ihre gleichgültigen Gesichter beugten sich zu ihm herab.
Einer griff nach seiner Wange … ein kurzer Schmerz durchzuckte ihn, dann sah er zwischen Zeigefinger und Daumen des Mannes ein schwarz glänzendes Ding zappeln.
«Hat sich an dir satt gefressen», murmelte der Wächter und hielt ihm das Ding direkt vors Gesicht. «Soll er dir das Aug auslutschen?» Er lachte und schleuderte den Blutegel achtlos zu Boden. Der andere Mann zupfte ihm zwei weitere Blutegel von der Haut und zertrat sie.
Einer der Wächter schloss die Ketten um seine Handgelenke auf, ehe sie ihn gemeinsam unter den Schultern packten. Sofort breitete sich ein schmerzhaftes Kribbeln in seinen Armen aus, das ihm bis in die Fingerspitzen fuhr.
Die Wächter zerrten ihn hinaus in einen lichtdurchfluteten Gang. Sofort drang eine Kakophonie von Stimmen auf ihn ein. Manche schrien, andere murmelten nur vor sich hin oder stöhnten.
Ein kahlköpfiger Junge in fleckigem Leinengewand torkelte auf sie zu. Er schielte so stark, dass man nicht sagen konnte, wohin er blickte. Der Junge bellte ihm so heftig ins Gesicht, dass er von seinem Speichel getroffen wurde. Einer der Wächter stieß den Jungen grob gegen die Mauer. Sein klägliches Wimmern folgte ihnen noch eine Weile. Der Gang schien nie zu enden, als würden sie ewig im Kreis laufen. Seine Kleidung … jetzt im Licht erkannte er, dass er die gleichen Fetzen trug wie der schielende Junge. Sie schleiften ihn eine Treppe hinunter. Irgendwo schrie eine Frau nach der heiligen Gertrud.
Der Wächter zu seiner Linken stieß geräuschvoll auf. Scharfer Knoblauchgestank stieg ihm in die Nase und bereitete ihm Übelkeit. Wo war er hier nur? War das die Hölle?
Am Treppenabsatz rempelten sie einen am Boden hockenden Greis an. Dieser reagierte überhaupt nicht, sondern schlug seinen Kopf gegen die Wand, immer und immer wieder … Man hatte ihm ein kleines Kissen auf die Stirn gebunden, aber es war ihm an einer Seite über das Auge gerutscht, sodass seine blanke Stirn von den vielen Stößen blauschwarz angelaufen war.
«Da muss wieder jemand den Muselmann reparieren», stöhnte der Wächter zu seiner Rechten.
«Ich sicher nicht», erwiderte der andere.
Hinter einer offenen Zellentür sah er eine Frau mit rotem Haar. Sie stöhnte etwas auf Ungarisch, während sie von zwei bärtigen Männern festgehalten wurde. Einer ihrer Bändiger stieß ein Grunzen aus. «Schau ma mal, ob du da unten auch so schön rot …»
Eine Welle der Wut durchzuckte ihn. Er drehte sich um, wollte der Frau helfen, aber die beiden Wächter schleiften ihn weiter. Auf der anderen Seite des Gangs zogen schmale Fenster an ihm vorbei, aber draußen war es zu trüb, um mehr erkennen zu können als ein paar kahle Äste.
Einer seiner Träger stieß eine hölzerne Zellentür und ein dahinterliegendes Gitter auf. Fauliger Geruch schlug ihm entgegen. Wieder versuchte er, sich zu wehren, doch sie zerrten ihn in den Raum hinein und ließen ihn achtlos auf eine Strohmatratze fallen. Im nächsten Moment hörte er, wie die Tür wieder geschlossen und ein Schlüssel im Schloss herumgedreht wurde.
Das Stöhnen und Schreien der anderen Insassen drang wie ein fernes Echo an sein Ohr.
Er presste stöhnend die Hände auf die Augen.
Wo bin ich?
Wer bin ich?
Der Nebel um seinen Verstand schien sich etwas gelichtet zu haben, aber seine Erinnerungen wirbelten durcheinander wie ein Haufen Daunen nach einem Windstoß.
«Bist du Soldat, mein Freund?», hörte er eine Stimme sagen.
Panik durchzuckte ihn. Er sah blutige Finger, die nach seiner Kehle griffen, leere Augen … Er presste sich an die Wand hinter ihm, aber der Anblick vor ihm war nicht allzu bedrohlich. In ein paar Schritten Entfernung lag noch eine weitere Strohmatratze, auf der sich eine Gestalt abzeichnete. Es war ein Mann, der die gleichen Leinenfetzen trug wie er selbst. Der Mann hatte sich auf seinem Lager aufgestützt und sah aus glänzenden Augen zu ihm herüber. Obwohl er jung aussah, schimmerte ihm ein schlohweißer Haarschopf entgegen.
«Mein Name ist Konrad.» Die Stimme des Weißhaarigen klang angenehm, als würde jemand eine Samtdecke über seine wunde Seele breiten. «Ich habe gesehen, wie sie dich hergebracht haben. Du trugst eine Offiziersuniform …»
Sein Atem beschleunigte sich. Kalter Schweiß brach ihm aus den Poren. Er erkannte sie ganz deutlich: Soldaten, unzählige von ihnen … Alle tot! Und er lag zwischen ihren klaffenden Wunden, in einem Haufen von Leichen, erstickte fast an ihrem Gestank …
«Wo bin ich?», stieß er gepresst hervor.
«Vor den Toren Wiens!», erklärte der Mann namens Konrad und richtete sich ein wenig weiter auf.
«Wien …», wiederholte er und blinzelte. In seinen Gedanken sah er glitzernde Kuppeln im Sonnenlicht, hörte Hufklappern auf Kopfsteinpflaster, roch Lindenblüten und Pferdemist auf den Straßen … «Was ist das für ein Ort?», fragte er.
Sein Zellennachbar antwortete nur zögernd. «Man bringt Menschen hierher … und behandelt sie.»
«Das hier ist der Narrenturm», stellte er fest, ohne sich erklären zu können, woher er das wusste.
«Kennst du diesen Ort?» Neugier klang aus Konrads Worten heraus.
Vor seinem inneren Auge sah er ein wuchtiges, rundes Gebäude emporragen, hörte eine Stimme, eine wütende Stimme: «Was passiert hinter diesen Mauern?» Er richtete sich kerzengerade auf und fasste sich mit den Fingern an den Hals. «Ich will hier raus!»
«Das wollen wir alle», erwiderte Konrad ruhig.
Er seufzte resigniert und legte den Kopf in den Nacken. Der Raum war hoch. An der Wand hing eine erloschene Öllampe. Die Rußspuren am Mauerwerk darüber erinnerten ihn an einen schwarzen Heiligenschein. Das einzige Fenster war mit Brettern zugenagelt, die Tür war verschlossen.
«Bist du schon einmal hier drin gewesen?», fragte sein Mitinsasse weiter.
«Ich weiß es nicht …», hauchte er mit rauer Stimme. «Aber ich habe mich eben an jemanden erinnert. Er … er hat sich für die Irren eingesetzt, glaube ich.»
Konrad lachte bitter. «Diesem Jemand bin ich hier noch nich begegnet.»
Er lächelte Konrad vorsichtig an, obwohl es das Brennen auf seiner linken Gesichtshälfte verschlimmerte. «Hörst dich nicht an wie ein Wiener, Konrad … eher wie ein Preuß.»
«Ich komme aus Mainz», erwiderte Konrad. «Unser Schutzherr ist der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Dein Herrscher ist – so wie du redest – der Erzherzog von Österreich. Und das ist dieser Tage ein und derselbe Mann.»
Kaiser … Erzherzog von Österreich …
Mit einem Mal sah er sich in einem Wald aus endlos hohen Bäumen. Ein Mann in prächtiger Uniform kauerte über einem Baumstumpf und richtete eine Pistole auf ihn … Er schüttelte die Erinnerung ab. Was hatte er getan? Verdiente er es vielleicht sogar, hier eingesperrt zu sein?
«Hast du auch einen Namen?», fragte Konrad.
«Ich weiß es nicht», erwiderte er kopfschüttelnd. Wie erbärmlich, nicht einmal das über sich zu wissen …
«Ich kann mir vorstellen, wie es dir geht», erklärte Konrad. «Du bist nicht der einzige Soldat hier drin. Jeden Tag kommen bemitleidenswerte Seelen an, deren Verstand in Scherben liegt. Die Erinnerung kommt wieder … meist kein Grund zur Freude.»
«Herrgott, wieso fällt mir nichts ein?», zischte er und schlug mit der Faust gegen die Mauer.
«Quäl dich nicht, das erledigen hier ohnehin die anderen …»
Konrad hatte recht, es würde nichts ändern, wenn er herumtobte wie ein … Der Gedanke ließ ihn bitter lächeln, was erneut ein heftiges Brennen zur Folge hatte. Vorsichtig berührte er die Haut in seinem Gesicht und ertastete eine verschorfte Wunde, die sich vom Haaransatz seiner linken Schläfe über die Wange bis zum Kinn zog.
«Was haben die mit meinem Gesicht gemacht?», fragte er alarmiert.
Konrad runzelte mitfühlend die Stirn. «Du warst schon so übel zugerichtet, als sie dich hergebracht haben.»
«Wie lange ist das her?», murmelte er.
«Vor drei Tagen hab ich gesehen, wie sie dich über den Gang geschleppt haben», meinte Konrad.
«So lange schon», erwiderte er nachdenklich.
«Du hast gesagt, du kennst jemanden, der sich für die Irren eingesetzt hat», meinte Konrad vorsichtig. «Wenn er hier ist, könnte er dir weiterhelfen.»
«Vielleicht.» Er setzte die löchrigen Schuhe, in denen seine Füße steckten, auf den Boden, stützte sich an der feuchten Steinmauer ab und stand auf. Seine Beine fühlten sich zittrig an, aber sie trugen ihn. Er wankte ein paar Schritte an der Mauer entlang, hielt inne, ging wieder zurück. Die Bewegung half ihm, die Erinnerung heraufzubeschwören.
«Ich weiß, wie er aussah … Ein junger Mann mit dunklen Locken. Und …» Er verharrte abrupt. «Da war noch jemand …» Er runzelte die Stirn. Es gelang ihm nicht, die Erinnerung an die zweite Person zu greifen, nur manchmal blitzte ein Gesicht auf … das Gesicht einer Frau mit grünen Augen.
«Weißt du, wer er ist?», fragte Konrad neugierig.
Er stützte sich mit beiden Händen an der feuchten Steinmauer ab. Das Echo von Schreien drang an sein Ohr, für einen Moment war er nicht sicher, ob sie aus dem Narrenturm oder seiner Erinnerung stammten.
Das Bild des dunkelhaarigen Mannes und der grünäugigen Frau zeichnete sich deutlich vor seinem inneren Auge ab.
Es löste etwas in ihm aus, einen tiefen Schmerz, Trauer um etwas, das unwiederbringlich verloren war.
«Dieser Mann …» Er schüttelte den Kopf und drängte die Tränen zurück. «Ich glaube, ich habe ihn getötet.»
1. Kapitel
Wien, 1787 Etwa ein Jahr zuvor …
Das morgendliche Sonnenlicht ließ das Herbstlaub der Linden und Kastanien aufleuchten, die in den Höfen des Allgemeinen Krankenhauses wuchsen. Ein Lindenblatt löste sich von einem Zweig, schwebte kurz durch die Luft und blieb auf der Brust der Kaiserstatue haften, die man in der Mitte des Hofs errichtet hatte. Alfred verharrte für einen Moment und musterte das erhabene Antlitz der Statue, ehe er sich mit einem verächtlichen Schnauben abwandte.
«Nicht trödeln, junger Wagener», rief Professor Auenbrugger. Alfred beeilte sich aufzuholen. Wieder einmal zu spät … Seine Studentengruppe hatte bereits den Torbogen erreicht, der aus den Krankenhaushöfen herausführte. Über ihnen auf der Mauer prangte ein riesiger Schriftzug: Saluti et solatio aegrorum. Zum Heil und Trost der Kranken. Wie oft hatte Alfred früher dort gestanden und davon geträumt, selbst jemand zu sein, der den Kranken Heil und Trost spendete, ein großer Mediziner zu werden …
«Aaaachtung, da Engerlwagen!», hörte er eine Stimme schreien.
Alfred sprang zur Seite und ließ eine Kutsche passieren, die von einem mächtigen Kaltblüter gezogen wurde. Der Kutscher nickte ihm kurz zu und trieb das Ross durch den Torbogen hinaus auf die Straße. Neben dem Pferdegeruch stieg Alfred ein Hauch von Verwesung in die Nase. Auf der Ladefläche waren Dutzende Jutesäcke übereinandergestapelt. Aus einem der Säcke ragten ein paar blutunterlaufene Finger hervor, aus einem anderen eine blasse Stirn und ein grauer Haarschopf. Der Engerlwagen fuhr die im Krankenhaus Verstorbenen ein- bis zweimal am Tag zu den Friedhöfen der Vorstadt, wo sie in Massengräber geworfen wurden.
«Wagener, wo bleibst du denn?», rief ihm sein Kollege Aigner ungeduldig gestikulierend zu. Die anderen hatten den Torbogen noch vor der Kutsche passiert.
Alfred holte rasch auf und marschierte mit den anderen Studenten einen gepflasterten Weg entlang, der von herbstlich bunten Büschen und Bäumen bewachsen war. Nach einer Weile hob Professor Auenbrugger die Hand und ließ seine Studenten anhalten. «So, werte Kollegen.» Sein Mund verzog sich zu einem verschwörerischen Lächeln. «Die heutige Stunde verbringen wir in der Irrenklinik.»
Ein aufgeregtes Raunen ging durch die Gruppe, gefolgt von vereinzeltem Gekicher.
Alfred riss überrascht die Augen auf. Er spürte, wie sein Herz schneller zu schlagen begann. Der Narrenturm … Normalerweise hatten Studenten keinen Zutritt. Er ließ seinen Blick über den Scheitel von Auenbruggers Perücke schweifen und fixierte das wuchtige Gebäude, das in etwa hundert Schritten Entfernung in den Himmel ragte. Es sah eigentlich nicht aus, wie Alfred sich einen Turm vorstellte, sondern breiter, als hätte man einen riesigen Topf mit nassem Sand gefüllt und dann umgestülpt.
«Seine Kaiserliche Majestät höchstpersönlich hat die Klinik errichten lassen. Es ist die erste ihrer Art weltweit, gedacht für die Wahnwitzigen, die aus den Augen der Menschen entfernt werden müssen.» Auenbrugger ließ seinen Blick prüfend über die Mienen seiner Studenten wandern. «Bevor hier aber zu große Euphorie aufkeimt, nein, ihr werdet heute nicht die Pioniere sein, die erstmals den Irrsinn heilen …»
Enttäuschtes Murren wurde laut, das Auenbrugger mit einer gebieterischen Handbewegung abstellte. «Für euch, meine ach so grünen Buben, gibt’s dort eine Patientin, an der ihr das richtige Untersuchen üben werdet.»
«Na, hoffentlich beißt sie nicht», kicherte Aigner und schnappte unvermittelt in Richtung seines Nachbarn, der erschrocken zusammenzuckte.
Professor Auenbrugger stöhnte indigniert, während Alfred ein Augenrollen unterdrückte. «Gehen wir!»
Schon nach ein paar Schritten bergauf hatte man eine großartige Aussicht auf das Glacis, den breiten Grünstreifen, der die Vorstädte, wo auch das Krankenhaus und der Narrenturm lagen, von der eigentlichen Stadt Wien trennte. Hinter den Wiesen und Bäumen erhoben sich die mächtigen Stadtmauern mit ihren Basteien. Die im Sonnenlicht funkelnden Kuppeln und Kirchtürme Wiens drängten sich so dicht an die Mauer, als wollte die Stadt einen zu eng gewordenen Gürtel sprengen.
Alfred wandte sich wieder dem Narrenturm zu. Wie ein verbannter König thronte er auf einem kleinen Hügel vor der Stadt. Auf der Wien zugewandten Seite war er von Bäumen umgeben, wohl um ihn vor ungewollten Blicken zu schützen. Auf der anderen Seite, vor dem Tor des Turms, erstreckte sich eine sanft abfallende Wiese, die irgendwann an die gepflasterten Wege und Straßen grenzte, die in die Vorstädte führten.
«Schau dir das an», raunte Aigner ihm zu. «Da haben ein paar Freigang.»
Alfreds Blick folgte Aigners ausgestrecktem Arm. Auf der Wiese vor dem Turm standen zwei kräftig aussehende Wärter. Sie plauderten entspannt miteinander. Jeder von ihnen hielt eine Kette in der einen und einen schulterlangen Stock in der anderen Hand. Vor ihnen im Gras, am anderen Ende der Ketten, hockten zwei junge Männer in fleckigen Leinengewändern.
Der etwas beleibtere der beiden Patienten ließ seinen Kopf unablässig kreisen und klatschte sich immer wieder mit der Hand gegen die Stirn, sodass man den eisernen Ring um sein Handgelenk erkennen konnte. Der zweite saß aufrecht da und spähte zu den Studenten herüber. Für einen Moment trafen sich ihre Blicke. Alfred erstarrte. Wie wach dieser Blick war, es schien kein Anzeichen von Irrsinn in der Miene des Manns zu liegen. Doch dann verzerrte sich dessen Gesicht mit einem Mal.
«Freches Gesindel, Hurenbastard!», brüllte der Irre zu ihnen herüber. Professor Auenbrugger hob verwirrt den Kopf, während die Studenten loslachten. «Grindsau, Franzosengfries, Fetzenschädl, Schweinef…»
«Oho, bettelt da einer um Satisfaktion?», lachte Aigner.
«Halt dich zurück», zischte Alfred, während er die Miene des schimpfenden Anstaltsinsassen fixierte. Sie wirkte gequält, als versuche der Mann mit aller Macht, die Beschimpfungen abzuwürgen, die sich seiner Kehle entrangen.
Einer der Wärter, ein Mann mit dichtem Vollbart und Spitzbauch, grinste breit und wandte sich an seinen Kameraden.
«Grindsau, das g’fällt mir. Von dem lern ich immer was Neues, hast immer die besten Ideen, gell, Hansi!» Er zog so fest an der Kette, dass der schimpfende Irre nach hinten gerissen wurde und abrupt verstummte.
Alfred zuckte unwillkürlich zusammen. Weiter unten auf den Wegen hatten ein paar Spaziergänger angehalten und sahen zum Narrenturm hinauf. Ein Vater beugte sich zu seinen beiden Kindern hinunter und deutete amüsiert in Richtung der beiden Irren.
«Na geh, Karli», meinte einer der Wärter zu dem dickeren Mann, der gerade wieder gegen seine Stirn klatschte, «sei doch ein bisserl lustig für die Leute, komm!» Er stieß den Irren vor ihm mit seinem Stock in die Seite, bis dieser begann, eine Melodie zu grölen, die Alfred nur zu gut kannte, die Spittelbergmarie[*], ein derbes Wienerlied über eine Dirne. Alfreds Kommilitonen gaben es gerne in der Wirtsstube zum Besten.
«O meine Spittelbergmarie, hör meinen Liebesschwur.
A Herz wia a Mastochs – was für a Hur’.
A Mund wia zwei Weichseln – zwei wunderbare Brüst.
Die hat selbst der Kaiser Joseph schon mit Wonn’ geküsst.
O meine Spittelbergmarie …»
Aus der Kehle des Mannes hörte sich das heitere Lied seltsam traurig an. Die Spaziergänger klatschten begeistert in die Hände, während der Wärter so tat, als würde er den Gesang dirigieren.
«Kommt weiter, Kollegen», rief Auenbrugger, «wir sind ja schließlich keine dummen Gaffer, nicht wahr?» Er bedachte Aigner mit einem scharfen Blick.
Alfred nickte und wandte sich ab. War es wirklich das, was der Kaiser unter Heil und Trost verstand? In Wahrheit war das Volk selbst vielleicht auch nicht viel besser dran als dieser Irre. Unter dem Deckmantel des eigenen Wohls wurde es so lange mit dem Stock geschlagen, bis es das Lied sang, das die hohen Herren hören wollten.
Alfred schüttelte den Gedanken ab und ließ seinen Blick über die Fassade des Turms nach oben gleiten. Was war …? Für einen kurzen Augenblick meinte er, etwas Dunkles auf dem Dach des Narrenturms zu erkennen. Alfred blinzelte, konnte aber nichts mehr entdecken. Wie eine Gestalt, die zu uns herabschaut, hat es ausgesehen …
Er folgte seinen Kollegen durch das Tor ins Innere des Turms. Sofort wurde es dunkel … und laut. Ein Chor aus Stöhnen und Schreien ließ Alfred zusammenfahren.
«Es ist bald Visite, da geht’s immer besonders zu!», erklärte die Wache am Eingang entschuldigend. Alfred sah sich neugierig um. Schon ein paar Schritte weiter trennte ein Gittertor den Eingangsbereich vom Rest des Turms und damit von seinen Insassen.
«Dr. Ofczarek ist von mir höchstpersönlich angewiesen worden, uns eine Patientin bereitzustellen», erklärte Auenbrugger. Irrte sich Alfred, oder bemerkte er in der sonst so selbstsicheren Stimme des Professors einen Hauch von Unbehagen?
Die Wache nickte in Richtung einer Holztür mit einem rechteckigen Guckloch, die gleich schräg gegenüber vom Eingang lag. «Die Studenten haben keinen Zutritt zu den anderen Bereichen des Turms. Anweisung von Dr. Ofczarek.»
«Den brauchen wir auch nicht», erklärte Auenbrugger verschnupft und ließ sich die Tür von der Wache öffnen.
Alfred und seine Kollegen strömten in eine enge Kammer, in der es nach Schweiß und fauligem Stroh roch. In der Mitte stand ein einfaches Bett, auf dem eine ausgemergelte Gestalt lag. Es war eine junge Frau mit dunklem Haar, das so kurz geschnitten war, dass Alfred sie im ersten Moment für einen Jungen gehalten hatte. Obwohl sie sehr schwach wirkte, hatte man sie mit Hanfseilen an den Bettrahmen gebunden. Die Frau sagte nichts, als die Studenten um sie herum Aufstellung nahmen, aber aus ihrer Kehle drangen langgezogene, heisere Laute, die die Angst unterstrichen, die sich in ihrer Miene beim Anblick der vielen Fremden ausbreitete.
Auenbrugger bedachte den erbärmlichen Zustand der Patientin mit einem Stirnrunzeln, wandte sich aber sofort wieder den Studenten zu. «So, werte Kollegen. Unsere heutige Patientin ist, wie man unschwer erkennt, Insassin des Turms.»
«Sind Sie sicher, dass das ein Weib ist, Professor?», fragte einer von Alfreds Kollegen, ein stämmiger Kerl mit roten Locken. Er griff nach der kleinen Brust der Frau und drückte sie zwischen drei Fingern zusammen. «Schauen S’, wie winzig!»
Das Mädchen stieß ein klägliches Heulen aus. Irgendjemand kicherte.
«Contenance, Mayerhofer, ich bin sicher!», erwiderte Auenbrugger. «Das Mädel ist für euch das ideale Untersuchungsobjekt. Warum? Das arme Ding ist stumm von Geburt an und kann sich kaum verständlich machen. Ein wahrer Diagnostiker findet die Krankheit, auch ohne dass der Patient sie ihm nennt. Hier und jetzt wird sich also zeigen, wer von euch wirklich imstande ist zu untersuchen.» Professor Auenbrugger wippte aufgeregt auf und ab und blickte erwartungsvoll in die Runde. «Na, wer traut sich? Wer will mir sagen, woran die Patientin leidet?»
Für einen Moment konnte man nur die klagenden Laute der Frau und das etwas leisere Schreien der anderen Patienten hören. Die eben noch ausgelassenen Studenten wichen dem Blick des Professors aus. Auenbrugger war einer der angesehensten Mediziner im Habsburgerreich, ein begnadeter Diagnostiker. Niemand wollte sich vor seinen Augen blamieren. «Und? So still auf einmal, Aigner und Mayerhofer?», fragte Auenbrugger deutlich ernster.
«Darf ich es versuchen, Professor?», bat Alfred und trat einen Schritt vor.
«Ah, Wagener», meinte Auenbrugger erfreut, «bitte.»
Alfred trat näher an das Bett heran und sah zu der Frau herab. Sie wandte ihm das Gesicht zu und sah ihn an. Ihre heiseren Laute klangen mit einem Mal etwas höher.
«Ich tu dir nichts», flüsterte er. Dann legte er den Handrücken auf die Stirn des Mädchens, während er den anderen auf seine eigene legte. Ihre Haut fühlte sich feuchter an – und wärmer.
«Leichtes Fieber», murmelte Alfred. Er hob eine Hautfalte auf der Hand des Mädchens und runzelte die Stirn, als sie nicht verstrich. Sie muss lange nichts getrunken haben …
Er wandte sich Auenbrugger zu. «Ich kann keinen korrekten Untersuchungsgang durchführen, wenn die Patientin ans Bett gefesselt ist.»
«Ganz richtig, mein Junge», bestätigte der Professor, «aber wie so oft müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben.»
Alfred nickte abwesend und wandte sich wieder dem Mädchen zu. Behutsam tastete er ihren Körper ab. Als er bemerkte, wie sich ihre Gestalt unter seinen Händen verkrampfte, hörte er sofort auf. Abgemagert, ausgedörrt, Fieber. Kein Krebsgeschwür, das ich tasten kann, und niemand in der Nähe, den ich fragen könnte, ob sie isst, ob sie Stuhlgang hat oder ob sie Schmerzen leidet …
«Lässt du mich in deinen Mund schauen?», fragte er sanft.
Der Atem des Mädchens beschleunigte sich, während Alfred seine Hände nach ihrem Kinn ausstreckte.
«In Ordnung», beschwichtigte sie Alfred und ließ seine Hände sinken. «Wir machen es anders … Sieh her!»
Er streckte seine Hand aus und klopfte sich mit den Fingern der anderen Hand auf das letzte Fingerglied des Mittelfingers. «So werde ich dich abklopfen. Es tut nicht weh …»
«Verschwende nicht deine Zeit, die Frau hat keinen Verstand», brummte Mayerhofer ungeduldig.
«Lass ihn, der Wagener macht ihr gerade Avancen», unterbrach ihn Aigner. Auenbrugger brachte die beiden mit einem lauten Räuspern zum Schweigen.
Die Frau starrte Alfred ängstlich an, aber als er seine Handfläche auf ihren Brustkorb legte, versuchte sie nicht auszuweichen.
«Vergiss nicht, Wagener», flüsterte Auenbrugger, «die Perkussion funktioniert, als würde man dem Klang von Instrumenten lauschen. Den hellen und den dumpfen, den lauten und den leisen Tönen. Du weißt, wie sie klingen müssen, jetzt such das Verstimmte!»
Alfred lächelte verstohlen. Auenbrugger hatte nicht nur die Perkussion als neue Untersuchungsmethode entdeckt, er hatte vor einigen Jahren – wie er nicht müde wurde, in seine Vorlesungen einzustreuen – das Libretto einer Salieri-Oper geschrieben.
Alfred atmete aus und schloss die Augen. Dann begann er, die Frau abzuklopfen, zuerst ihren Brustkorb, dann ihren Bauch. Er tat nichts anderes, als dem Klopfgeräusch zu lauschen, seiner Dämpfung über Herz und Leber, seinem hellen Laut über der Lunge und einem fast schon hallenden Klang über dem leeren Magen der Frau. Über einer Stelle verharrte Alfred und klopfte immer wieder darüber …
«Das klingt doch alles gleich! So ein Humbug», flüsterte jemand hinter ihm, aber Alfred ließ sich nicht beirren. Immer wieder klopfte er über die gleiche Stelle. Plötzlich begann die junge Frau, wild zu husten. Ihr Körper verkrampfte sich, während sie verzweifelt nach Luft rang und immer wieder ausspucken musste.
Alfred richtete sich auf und wartete, bis die Frau sich beruhigt hatte, dann wandte er sich zu Auenbrugger und seinen Kollegen um. «Sie leidet unter einer Inflammatio, einer Entzündung der Bronchien, die sich im unteren linken Lungenflügel eingenistet hat. Sie ist so ausgetrocknet, dass sie nicht mehr husten konnte. Durch die Perkussion hat sich ein wenig gelöst, aber sie muss trinken, viel trinken, dann kann sie das gestaute Sekret abhusten.»
Auenbrugger starrte ihn aus großen Augen an, dann breitete sich ein Grinsen auf seiner Miene aus. «Exzellente Diagnose, Herr Kollege.» Er klopfte Alfred auf die Schulter, während seine Kollegen anerkennend applaudierten. Alfred spürte, wie ihm die Schamesröte ins Gesicht stieg.
«Ohren wie ein Luchs», konstatierte Auenbrugger begeistert.
Die Tür wurde ruckartig aufgerissen, und ein Wärter mit pockennarbigem Gesicht betrat die Kammer. «Verzeihung, Doktor», erklärte er mit böhmischem Akzent. «Der Dr. Ofczarek braucht die Patientin oben für die Visite.»
Alfred sah, wie Auenbrugger die Lippen schürzte. Für einen Moment war Alfred sich sicher, er würde den Wärter anschreien.
«Sagen Sie dem Herrn Doktor, er soll gefälligst darauf achten, dass seine Patientin ausreichend trinkt – und mehr essen könnte sie auch», erklärte er mühsam beherrscht. Er wandte sich halb den Studenten zu. «Ich werde ihm die empfohlene Therapie für die Patientin übermitteln: Thymianauszug und eine Campher-Einreibung dreimal täglich.» Er seufzte. «Kommt!»
Die Studenten strömten schweigend aus der Kammer hinaus. Alfred drehte sich noch einmal kurz nach der Patientin auf dem Bett um. War sie wirklich so wahnsinnig, dass man sie festbinden musste? Würde sie sich sonst verletzen? Oder vielleicht jemand anderen? Vor allem Letzteres schien Alfred schwer vorstellbar.
Er seufzte und wandte sich ab. Doch als er einen Schritt Richtung Ausgang machte, griff die Frau nach seinen Fingern.
Alfred fuhr erschrocken herum. Die Patientin umklammerte seine Hand. Ihre dunklen Augen schienen ihn anzuflehen. Ein kaum hörbares Wimmern drang aus ihrer Kehle.
«Keine Sorge, dir wird jetzt gehol…» Alfred runzelte die Stirn. Der Ärmel der Frau war heruntergerutscht und entblößte ihre weiße Haut … und ein paar seltsame Wunden auf ihrem Handgelenk. Ihre Nasenflügel blähten sich, als sie Alfred ansah. Die Wunden bestanden aus nässenden Blasen, fast wie eine …
«Jetzt raus da», maulte der Wärter und zog ihn von dem Bett weg. Alfred riss sich los und funkelte den Wärter an.
«Ihr werdet sie anständig behandeln, verstanden», erklärte er mit eisiger Stimme.
«Ja, ja, Burschi», meinte der Böhme und schob Alfred aus der Kammer. Für einen winzigen Moment sah er noch das Gesicht der jungen Frau, wie sich ihr Mund öffnete, als wollte sie ihm hinterherrufen …
«Auf ein Wort, Professor», bat Alfred, sobald sie wieder die Höfe des Allgemeinen Krankenhauses erreicht und seine Kollegen sich in Richtung der Studiensäle verabschiedet hatten. «Ich mache mir Sorgen um unsere Patientin. Ich glaube, sie wird im Narrenturm nicht anständig behandelt. Ihre Arme waren …»
«Wagener», unterbrach ihn Auenbrugger. «Um die Frau wird man sich kümmern. Du solltest dir lieber um deinetwillen Sorgen machen!»
«Um meinetwillen, Professor?», fragte Alfred überrascht.
Auenbrugger bedachte ihn mit einem strengen Blick. «Du hast Potenzial, Bursche, da schmerzt es mich umso mehr, dass du so vielen Lektionen unentschuldigt fernbleibst.»
Alfred presste für einen Moment die Lippen zusammen. Wie hatte Auenbrugger bloß davon erfahren? «Ich besuche die wichtigsten», erwiderte er. «Ich war in jeder einzelnen Ihrer …»
«Die wichtigsten?» Auenbrugger schüttelte den Kopf. «Ein Medizinstudium ist kein Marktstand, von dem man sich aussucht, worauf man gerade Lust hat. Begreifst du den Ernst deiner Lage nicht? Man wird dich exmatrikulieren, Junge, wenn du dein Verhalten nicht änderst.»
Alfred reckte trotzig das Kinn vor. «Ich lerne mehr als alle anderen, ich bestehe jede Prüfung mit Bravour. Es ist ungerecht, wenn jemand behauptet, dass ich …»
«Es reicht.» Auenbruggers Miene schien mit einem Mal ungewohnt streng. «Noch bist du kein Arzt, und wenn du so weitermachst, wirst du auch keiner werden.» Damit wandte sich Auenbrugger ab und verschwand kurz darauf in Richtung des Geburtensaals.
Alfred ballte die Fäuste so fest zusammen, dass ihm die Nägel in die Handflächen schnitten.
«He, Wagener!» Aigner und ein paar andere warteten am Ende des Hofs auf ihn. «Komm endlich!» Seine Taschenuhr glitzerte im Sonnenlicht, als er auf das Ziffernblatt tippte. «Unsere Lektion zur Säftelehre beginnt gleich!»
«Geht nur, der Blödsinn interessiert mich eh nicht», rief er zurück. Gott sei Dank standen sie zu weit weg, um zu sehen, wie ihm Tränen der Wut in die Augen stiegen.
Aigner winkte lachend ab und schüttelte den Kopf über Alfreds Verwegenheit. Alfred wartete noch, bis sie im Klinikgebäude verschwunden waren, dann machte er kehrt und rannte los, so schnell er konnte.
«Spät bist», kommentierte Ravnicek, der Oberwart des zum Krankenhaus gehörenden Waschhauses und kratzte sich am Bauch, während Alfred sich seinen schmierigen Arbeitskittel überwarf. «Wenn das noch mal vorkommt, hol ich mir irgendeinen von der Straße, der die Arbeit besser macht als du.»
Alfred hatte gelernt, nicht einzuatmen, wenn Ravnicek direkt mit ihm sprach. Sein fauliger Atem verursachte ihm Übelkeit, und das, obwohl Alfred beileibe einiges gewohnt war.
«Was ist zu machen?», fragte er nüchtern.
«Die Bettpfannen haben sich noch nicht selbst gereinigt. Stehen schon seit zwei Stunden da und verseuchen mir die Luft. Wennst fertig bist, hilfst den Schwestern mit den Instrumenten.»
Alfred nickte und ging wortlos an Ravnicek vorbei. Der Gestank im Spülraum ließ ihn kurz innehalten. In den ersten Wochen hatte er sich mehrfach übergeben müssen. Mittlerweile konnte er wenigstens das vermeiden, allerdings ohne den Gestank erträglicher zu finden. Die vollen Bettpfannen stapelten sich auf einem hölzernen Karren, direkt neben einer Wasserpumpe und dem großen Waschzuber. Alfred leerte die erste Schüssel in einen Bottich und begann, sie im grauen Wasser des Zubers zu schrubben. Von den vielen Arbeiten, die Alfred schon gemacht hatte, war diese mit Abstand die schlimmste – aber so war er wenigstens immer in der Nähe des Krankenhauses und verpasste weniger Lektionen, als es bei jeder anderen Stelle der Fall gewesen wäre. Offensichtlich leider immer noch zu viel.
Noch bist du kein Arzt, und wenn du so weitermachst, wirst du auch keiner werden … Die Erinnerung an Auenbruggers Worte ließen Alfred so kräftig schrubben, dass seine Knöchel weiß hervortraten.
2. Kapitel
«Die feindlichen Armeen sind in Stellung gebracht und halten dich in eiserner Umarmung. Deine Truppen sind in der Minderzahl, wurden in den Wirren der Schlacht aufgerieben. Jeder Schritt, den du jetzt tust, entscheidet über Sieg oder Niederlage, über Tod und Leben. Was wirst du tun? Was tust du, Helene?»
Helene hob den Kopf und sah in die süffisante Miene ihres Vaters. Seine hellen Augen musterten sie aufmerksam, während sie sich wieder dem Schachbrett vor ihr zuwandte. Ihre Finger streichelten gedankenverloren durch das sonnenwarme Fell ihres Drahthaarrüden Raubart, der seinen Kopf auf ihren Schoß gebettet hatte.
Es war schwer, sich an so einem prachtvollen Tag mit Leib und Seele in die Schachpartie zu vertiefen. Die Buchen der Wienerwaldhügel und die herbstlichen Weingärten leuchteten mit der weißen Fassade von Schloss Weydrich um die Wette, und die Stadt unter ihnen schien heute so nah, als könnte man direkt in die kaiserlichen Appartements der Hofburg blicken.
«Du konzentrierst dich nicht», zog ihr Vater sie auf.
Helene ignorierte ihn und atmete tief durch. Ihre Lage war ziemlich trostlos. Sie war schon seit fünf Zügen nur noch damit beschäftigt, sich gegen seine Angriffe zu verteidigen – und das mehr schlecht als recht. Neben dem Spielfeld standen bereits ihr weißer Springer, ein Turm, ein Läufer und vier Bauern, während sie ihm bis jetzt nur seine zwei Läufer und einen mageren schwarzen Bauern abgeluchst hatte.
Ich muss etwas Unerwartetes tun. Er wird damit rechnen, dass ich mich auf eine sichere Position zurückziehe … Ihr Blick glitt forschend über das Brett. Ja … das sah gut aus … Warum war ihr das nicht früher aufgefallen?
Helene griff entschlossen nach ihrer Dame und zog vier Felder vor.
«Schach!», erklärte sie triumphierend.
«Oh.» Ihr Vater runzelte die Stirn, während Helene sich zufrieden lächelnd zurücklehnte. «Da hast du mich tatsächlich für einen Moment in Schwierigkeiten gebracht …»
Er griff zielsicher nach seiner schwarzen Dame, zog schräg über das Spielfeld und schlug Helenes Dame.
«Schachmatt!»
«Was?» Raubart hob alarmiert den Kopf und wuffte leise. Helene starrte mit aufgerissenen Augen ihre umgeworfene Dame an. «Das ist nicht … das ist …»
«Schachmatt», wiederholte ihr Vater mit einem spöttischen Gesichtsausdruck.
Helene knurrte und schubste ihren eigenen König um, da ihr Vater dummerweise recht hatte. Dann vergrub sie das Gesicht in ihren Handflächen.
«Kränk dich nicht», meinte ihr Vater. «Du hast zwei Runden länger durchgehalten als der Kaiser bei unserer letzten Partie. Und du wirst von Mal zu Mal raffinierter.»
«Es macht keinen Spaß, gegen dich zu spielen, Papa», seufzte sie und ließ die Hände wieder sinken.
Die dichten Brauen ihres Vaters zogen sich zusammen. Die Grübchen in seinen Mundwinkeln vertieften sich, als könnte er sich nur mühsam das Lachen verkneifen. «Schach ist wie das Leben, Kind. Man verliert … so lange, bis man gewinnt.»
«Leicht zu sagen, wenn man immer gewinnt.» Sie streckte sich und blinzelte ins Sonnenlicht.
«Wie überaus … komtessenhaft», lachte ihr Vater.
«Eine wohlerzogene Komtesse würde sich wohl kaum im Schachspiel mit ihrem Vater messen», kommentierte Helene und strich sich eine honigfarbene Haarsträhne aus dem Gesicht.
«Aha. Aber lernt die junge Komtesse etwas aus ihrer Niederlage, oder läuft sie zu ihren Pferden und macht das nächste Mal genau den gleichen Fehler?» Ihr Vater lachte auf.
«Sie lernt», erwiderte Helene augenrollend. «Und ich bin nicht jung, ich werde in ein paar Wochen siebzehn.»
«Na dann! Schauen wir doch mal, was ich dir noch beibringen kann. Zeig mir deine mächtigste Figur!»
Helene dachte kurz nach, dann griff sie nach ihrer geschlagenen Dame und hielt ihm die weiße Elfenbeinfigur unter die Nase.
«Ausgezeichnet! Für die Macht der Dame gibt es kaum Grenzen. Du hast nur einen einzigen Fehler gemacht, Kind.» Ihr Vater nahm ihr die Dame aus der Hand und stellte sie wieder auf ihre letzte Position – weit vor ihre anderen Figuren.
«Du hast sie zu früh entblößt und sie dadurch angreifbar gemacht. Siehst du, wo meine Dame stand?» Ihr Vater stellte die schwarze Dame wieder auf die Position, von der aus sie zugeschlagen hatte, in der hintersten Reihe, neben dem König.
«Die Dame nutzt ihre Macht am besten im Verborgenen, aus dem Schutz ihrer Verbündeten heraus zieht sie die Fäden. Erst wenn sie den Todesstoß versetzt», ihr Vater wiederholte seinen letzten Zug, «offenbart sie sich und zeigt ihre wahre Macht.» Ihr Vater hob die weiße und die schwarze Dame neben sein sonnengebräuntes Gesicht. «Begreifst du jetzt, wie man gewinnt?»
Helene lächelte. Sie nahm ihrem Vater die schwarze Dame aus der Hand und drehte sie nachdenklich zwischen ihren Fingern. «Findest du das nicht komisch, Papa? Ein Spiel, in dem die Dame die mächtigste Figur ist, während die meisten Frauen im wahren Leben nicht mehr tun, als zu heiraten und Nachkommen zu gebären …»
«Ah ja. So wie Maria Theresia, meinst du?»
«Wenn deine Erzählungen über sie stimmen, war das Herrschen eher ein Zeitvertreib neben dem Gebären.»
Ihr Vater runzelte die Stirn. «Deine Leutseligkeit ist gefährlich, Kind», erklärte er. «Außerhalb von Schloss Weydrich kann eine lustige Bemerkung wie diese dich schnell in Schwierigkeiten bringen. Wer die Gunst der Habsburger verwirkt, dem nutzt ein adliger Name nicht mehr als das Papier, auf dem er geschrieben steht.»
«Ich dachte, du bist ein Freund des Kaisers, Papa.»
Ihr Vater lächelte schief. «Joseph hat keine Freunde, lediglich Menschen, die er respektiert.»
Helene wusste, dass ihr Vater im bayrischen Erbfolgekrieg für den Kaiser gekämpft hatte. Doch während er sonst das meiste mit ihr besprach, schwieg er sich über dieses Thema beharrlich aus. Helene betrachtete ihn nachdenklich, sein gefurchtes Gesicht, das dunkelgraue Haar, das er im Nacken mit einem Samtband zusammengebunden hatte …
Ihre Gouvernante, Adelheid, sagte, dass sie von ihrem Vater nur die Mundpartie geerbt habe, Lippen, die von Grübchen begrenzt wurden, als würde sie stets ein kleines Lächeln tragen. Bei ihrem Vater hatte sie gelernt, trotzdem zu erkennen, wenn er ernsteren Gedanken nachhing – so wie jetzt.
«Spazierst du ein wenig mit mir?», fragte er.
Helene nickte. Sie zupfte ein paar Ahornsamen von ihrem weißen Spitzenkleid und erhob sich. Raubart kam unter dem Tisch hervor und trottete neben ihnen her.
Als sie die Kieswege im Schlossgarten entlangspazierten, entdeckte Helene Karl, den Sohn des Gärtners. Er begann gerade damit, die Rosenstöcke einzuwintern. Er schnitt die letzten Blüten ab und zog einen Jutesack über die Pflanze vor ihm.
«Karl, lass die Rosen doch, sie blühen noch so schön!»
«Im Oktober ist der Nachtfrost nicht mehr weit, Komtesse.»
«Lass dich nicht stören, Karl», rief ihr Vater zu ihm herüber.
«S’recht, Herr Graf!»
Helene betrachtete die ausladende Rosenlaube hinter dem Schlossteich, der das Zentrum des Gartens bildete, und seufzte. Sie liebte es, unter den sattroten Blüten zu sitzen und zu lesen. Damit würde es jetzt wohl für einige Monate vorbei sein.
Ein Stockentenpaar schwamm auf dem Teich und gründelte nach Wasserpflanzen.
Helene reagierte einen Wimpernschlag zu spät. «Raubart, nein!»
Doch der Drahthaarrüde jagte bereits auf den Teich zu, stieß sich ab und landete mit einem lauten Platschen im Wasser.
Seine Zähne schnappten nach den Enten, die lärmend aufflogen. Ihr vorwurfsvolles Quaken war noch in der Ferne zu hören, als Raubart schon ans Ufer gepaddelt war und sich heftig geschüttelt hatte. Mit immer noch triefendem Fell trottete er zu ihnen zurück.
Ihr Vater bedachte sie mit einem strengen Blick.
«Er ist ein Jagdhund», meinte Helene entschuldigend.
«Ein verhätschelter Jagdhund. Dass er in deinem Zimmer schläft und nicht bei den anderen im Zwinger, bekommt ihm nicht. Wie alt ist er jetzt?», fragte ihr Vater.
«Fünf», erwiderte sie.
«Schon fünf», wiederholte der Vater gedankenverloren. Er hatte ihn ihr geschenkt, als Spielgefährten, damit Helene nicht so einsam war, wenn er verreiste. Kaum zu glauben, dass der kräftige Rüde damals nur ein kleiner Welpe gewesen war, der ständig über seine zu großen Pfoten zu stolpern schien.
«Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast, Kind, über das Heiraten und das Gebären. Deine Mama und ich haben uns bei deiner Geburt versprochen, alles für dein Glück zu tun, egal, welches Opfer wir dafür bringen müssen. Ich vermisse sie! Sie liebte unseren Garten genau wie du …»
Helene hängte sich bei ihrem Vater ein und schmiegte den Kopf an seine Schulter. Sie konnte sich kaum an ihre Mutter erinnern, aber der Schmerz ihres Verlusts war etwas, das sie mit ihrem Vater teilte.
Eine Weile flanierten sie schweigend nebeneinanderher, entlang eines Wegs, der von violett blühenden Astern gesäumt wurde, und sahen auf das im Sonnenlicht funkelnde Wien hinunter.
«Du bist wie sie, weißt du? Dein Verstand ist zu scharf für dein eigenes Wohl. Ich will nicht, dass du zu einer dieser dressierten Puppen verkommst, die bei Hofe artig den Kotillon tanzen, um einem hohlen Jüngling schöne Augen zu machen.»
«Du hast gesagt, irgendwann muss ich mich bei Hofe zeigen …»
«Das stimmt. Aber in diese Schlangengrube nehme ich dich so spät wie nur möglich mit», erwiderte ihr Vater kühl. «Vorher will ich, dass du dich mit anderen Dingen beschäftigst. Du bekommst einen Lehrer, der dich in den Naturwissenschaften ausbilden soll. Und in Latein.»
«Latein?», entfuhr es Helene entgeistert.
«Ganz genau! Meine Tochter soll mit jedem Gelehrten auf Augenhöhe sprechen können.»
«Papa, du weißt, ich liebe die Naturwissenschaften, aber Latein ist doch nun wirklich nicht …»
«Keine Widerrede, Helene.» Er hüstelte, als hätte er einen Frosch im Hals. «Ich habe auch schon einen geeigneten Lehrer für dich ausgesucht, einen treuen Freund, der mir selbst in deinem Alter schon Unterricht gegeben hat.»
Bestimmt irgendein verstaubter Uhu, dachte sie, aber diesmal verbiss sie sich den Widerspruch.
«Ich werde dir das Rüstzeug geben, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Mehr steht nicht in meiner Macht.»
Helene schloss die Augen und lächelte. Der Unterricht war ein kostbares Geschenk – dafür waren die Lateinlektionen ein kleiner Preis.
«Danke, Papa!» Sie küsste ihn auf die Wange. Sie flanierten wieder zurück in Richtung Rosengarten, als sich die Grübchen um Helenes Lippen vertieften.
«Du möchtest also, dass ich selbstbestimmt werde, so wie … die Tante?»
Ihr Vater hob die Augenbrauen. «Wenn du dich je entscheiden solltest, in ihre Fußstapfen zu treten, enterbe ich dich auf der Stelle.»
Helene kicherte. Ihr Vater sprach nicht oft über seine Schwester, die allein eine riesige Grafschaft im östlichen Mähren unterhielt und nur den Winter in Wien verbrachte.
Bei ihrem letzten Besuch war Helene noch ein kleines Mädchen gewesen. Trotzdem konnte sie sich noch deutlich an die schwarzhaarige Schönheit mit den tiefgrünen Augen erinnern. Die Tante hatte damals nicht viel mit ihr gesprochen, aber Helene immer wieder genau beobachtet. Bevor sie in ihre von zwei Friesenpferden gezogene Kutsche gestiegen war, hatte sie sich noch einmal zu Helene heruntergebeugt und ihr etwas zugeflüstert: «Glaub kein Wort von dem, was sie dir versprechen, mein Täubchen. Sie lügen alle!»
Jedenfalls hatten sich ihr Vater und die Tante seither immer weiter auseinandergelebt, und Helene war nicht sicher, ob sich die Kluft zwischen den beiden je wieder schließen würde.
Sie bekam mit, wie ihren Vater die Gerüchte, die ihm über die Tante zu Ohren kamen, verärgerten – und manchmal besorgten. So wie einmal, als der Baron Maybach ihn aufgesucht und Helene hinter der Salontür den ein oder anderen Wortfetzen aufgeschnappt hatte: … brach nach Mähren auf, um Eure Schwester zu interrogieren … Auf dem Rückweg verschwunden …
«Ich habe Adelheid gesagt, sie soll dir für morgen deine Jagdkleider vorbereiten», unterbrach ihr Vater ihre Gedanken. «So viele Haselhühner und Fasane haben wir im Revier schon lang nicht gehabt. Liegt wohl daran, dass ich den Vorstadtburschen eine Belohnung für jedes tote Raubzeug gegeben habe.»
«Hast du gehört, Raubart?», fragte Helene und tätschelte den nassen Kopf des Drahthaars, der merklich die Ohren gespitzt hatte. «Aber wirst du damit leben können, dass ich mehr Fasane schieße als du, Papa?»
«Spätestens, wenn sie auf meinem Teller liegen.» Das Lachen ihres Vaters ging in ein Husten über, das er im Ärmel seines schwarz-goldenen Gehrocks erstickte.
«Dann muss ich noch einen der Burschen bitten, die Büchsen vorzubereiten», erwiderte Helene.
«Der Frantisek kümmert sich schon drum, dass sie’s erledigen. Die neuen Pagen brauchen die Übung wie ein Hungernder einen Bissen Brot, sie sind noch recht schlampig. Wie wär’s …» Ihr Vater hustete erneut und räusperte sich. «Wie wär’s, wenn wir ausreiten? Ich war vorhin hinten bei den Ställen, dein Eugenio braucht frische …»
Helene runzelte die Stirn. Es sah aus, als wäre ihr Vater mitten im Reden zu Eis erstarrt.
«Papa?», fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen. «Treibst du einen Scherz mit mir?»
Seine Miene sah plötzlich aus, als hätte sie jemand mit Mehl angestaubt.
«Papa, ist alles in Ordnung?»
Ein Pfeifen drang aus seinem leicht geöffneten Mund, das Helene an das Geräusch des kleinen Blasebalgs erinnerte, mit dem Adelheid das Kaminfeuer anfachte.
«Sag doch was!», rief sie und packte ihren Vater an der Schulter. Ihr Vater schien atmen zu wollen, aber es gelang ihm kaum. Für einen Moment schwankte er. Helene sah seine Gestalt erschlaffen, und dann brach er zusammen. Geistesgegenwärtig versuchte sie, ihn aufzufangen, und kippte selbst nach hinten in die Blumenbeete. Ihr Kleid verfing sich in den Rosensträuchern. Dornen bohrten sich in ihre Haut und hinterließen Blutflecken auf dem weißen Stoff.
«Papa, was ist mit dir?»
Seine Hand klammerte sich so fest um ihre, dass es schmerzte.
«Frantisek, Adelheid, helft mir!», brüllte Helene. Was würde ein Arzt in so einer Situation tun? Sie fächelte ihrem Vater mit der freien Hand Luft zu, während sie zusah, wie seine Miene auch den letzten Rest an Farbe verlor.
«Sag was», wimmerte sie.
Aber ihr Vater antwortete nicht – und vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte Helene sich hilflos … und allein.
3. Kapitel
«Kommst du noch mit ins Nussgartl, Wagener? Die haben einen neuen Wein … und eine neue Servierdame.» Aigner verdeutlichte die Vorzüge der neuen Kellnerin mit seinen Händen.
Alfred wäre gern mitgegangen. Er wusste nicht mal mehr, wann er zuletzt Zeit gehabt hatte, einfach ein Glas Wein zu genießen. Der Waschdienst am Vortag hatte ihn so ermüdet, dass er heute während der Anatomielektion fast eingeschlafen wäre. Lange würde er das nicht mehr durchhalten. Vielleicht sollte er den absurden Traum, ein großer Medikus zu werden, lieber heute als morgen begraben und zu seiner Mutter nach Prag ziehen. Sein Stiefvater konnte bestimmt Hilfe in seinem Krämerladen gebrauchen.
«Tut mir leid!» Alfred wedelte entschuldigend mit einem Brief. «Ich habe noch eine Verabredung in der Stadt.»
«Ah …» Aigner beäugte den Brief neugierig. «Ein geheimes Tête-à-Tête mit einem edlen Fräulein?»
Alfred lächelte und hob die Augenbrauen. «Warum nicht gleich mit mehreren?»
Aigner lachte auf. «So wie dir die Weibsbilder hinterherschauen, könnt man’s glauben. Bloß scheint dir keine recht zu sein. Was war denn mit dieser Advokatentochter?» Aigner schnippte mit den Fingern. «Wie hieß sie noch? Genau, Marie …»
Marie hat bei unserem einzigen Treffen über nichts anderes gesprochen als über ein Kleid, das sie in einer Auslage der Kärntner Straße gesehen hat. Und ihr Vater wollte mich nach diesem Treffen zu meinen Vermögensverhältnissen befragen.
«War nichts für mich», erwiderte Alfred schlicht. «Also dann …»
«Grüß dich», meinte Aigner, hob die Hand und verschwand zwischen den herbstlichen Linden des Krankenhaushofs.
Auch Alfred verließ das Krankenhaus kurz darauf und nahm einen Wagen in Richtung Stadt. Die Kutsche rumpelte die Alser Straße hinunter über das Glacis. Der Grünstreifen zwischen Wien und den Vorstädten hatte lange als Exerzierplatz gedient, doch der Kaiser hatte vor ein paar Jahren Bäume pflanzen und Laternen aufstellen lassen und das Glacis in einen riesigen Park verwandelt, den die Wiener gerne zum Lustwandeln nutzten. Nur ein kleiner Platz vor der weitläufigen Josefstadtkaserne, die direkt neben dem Krankenhaus lag, wurde noch zum Exerzieren verwendet. Ein gutes Zeichen, wenn Soldaten nur noch für Paraden und Ehrengeleite gebraucht wurden. Vielleicht war das Bündnis, das der Kaiser mit Katharina der Großen geschlossen hatte, entgegen allen Erwartungen eine kluge Entscheidung gewesen. Seit Österreich sich auf Russlands Seite geschlagen hatte, verhielten sich die Franzosen und Preußen auffällig ruhig.
Alfred besah sich den Brief in seiner Hand. Wenn er ihn einlud, konnte Alfred nicht ablehnen. Er wusste, wie beschäftigt Alfred war, und würde ihm die Zeit nur dann stehlen, wenn es um etwas Wichtiges ging. Lächelnd las er die letzte Zeile …
Und nimm dir einen Wagen, um Himmels willen, ich weiß, dass du sonst immer rennst. Ich lade dich ein!
Alfred faltete den Brief wieder zusammen und verwahrte ihn in der Tasche seines Rocks. Das Rütteln der Kutsche und das monotone Hufgeklapper ließen seine Gedanken abschweifen. Das Mädchen im Narrenturm wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Immer wenn er sich gerade nicht konzentrierte, tauchte ihre verzweifelte Miene vor seinem inneren Auge auf. Die Wunden, die auf ihren blassen Armen aufgeblitzt waren … Hatte sie sie sich selbst zugefügt? Wollte sie ihn wirklich um Hilfe bitten, als sie ihn festgehalten hatte, oder krallte sie sich in ihrem Wahn an jedem fest, der sie freundlich behandelte?
Ich könnte hingehen und nach ihr fragen … Schließlich habe ich ihre Krankheit diagnostiziert. Ich könnte sagen, dass Auenbrugger mich schickt. Der Gedanke beruhigte Alfred etwas. Warum machte er sich überhaupt Sorgen? Ein Mädchen wie sie würde in der rauen Welt hier draußen kaum überleben. In der Irrenklinik hatte sie wenigstens ein Dach über dem Kopf, und es gab Menschen, die sich um sie kümmerten. Hatte sie im Grunde genommen nicht sogar Glück, wenn man an die Heerscharen von Bettlern und Landstreichern dachte, die man in der Stadt sah?
Ein Brüllen ließ Alfred die Stirn runzeln. «Kompanie! Im Schritt – marsch!»
Alfred sah aus dem Kutschenfenster. Auf der Grünfläche des Glacis marschierte eine Abordnung Hunderter Soldaten hinter ein paar Trommlern her, die ihnen den Takt vorgaben.
Das schien weder eine Übung zu sein noch ein Ehrengeleit. Die Soldaten trugen neben Säbel und Bajonett voll bepackte Ranzen auf dem Rücken. Fünf Pferdefuhrwerke, die mit Fässern und Kisten beladen waren, folgten dem Zug. Auf einem der Wagen erkannte Alfred eine Kanone. Es sah aus, als würde die ganze Josefstadtkaserne ausrücken.
«He, Kutscher», fragte Alfred und klopfte an den Rahmen der Kutsche. «Weißt du, wohin die marschieren?»
Der Kutscher zügelte die beiden Schimmel, die das Trommeln nervös zu machen schien, und ließ sie im Schritt gehen.
«Wenn ich das wüsst», erwiderte er ungehalten. «Überall in Wien leeren s’ die Kasernen aus. Nirgends kann man mehr hinfahren, ohne dass sie einem vor die Kutsche rennen.»
Alfred sah den Soldaten hinterher, bis das Trommeln verklang.
«Bestimmt zündelt der Türk wieder irgendwo und braucht eine Abreibung», brummte der Kutscher, als sie endlich auf die breite Promenade bogen, die zum Schottentor führte, dem mächtigsten der Wiener Stadttore.
Hier war von Soldaten nichts mehr zu sehen. Edel gekleidete Spaziergänger aus der Stadt genossen das milde Herbstwetter und besahen sich die Waren fahrender Händler, die entlang der Promenade tagsüber Quartier bezogen.
Alfred starrte abwesend aus dem Fenster, während sie die Mauer und die mächtige Bastei passierten und in die eigentliche Stadt eintauchten. In dem Getümmel aus Reitern, Fußgängern und anderen Kutschen kam Alfreds Fiaker nur mühsam voran, doch der Kutscher steuerte den Wagen immer wieder geschickt in ruhigere Gassen, wo er seine Schimmel antraben lassen konnte.
Am hohen Markt herrschte reges Treiben. Karren voller Kürbisse, Äpfel und Rüben wurden gerade von den umliegenden Feldern angeliefert und die Preise so laut herausgerufen, dass sie von den kunstvoll verschnörkelten Häuserfronten widerhallten.
Neben dem wuchtigen Jesuitenkolleg ließ Alfred den Kutscher anhalten und bezahlte ihn mit den Münzen, die dem Brief beigelegen hatten.
Alfred lief am Kolleg vorbei auf den Universitätsplatz. Das neue Universitätsgebäude wirkte neben den weitläufigen Klosteranlagen geradezu freundlich mit seiner verspielten Fassade. Er atmete tief durch. Es fühlte sich gut an, wieder hier zu sein, als wäre seither keine Zeit vergangen …
Alfred nickte dem Portier am Eingang zu, verschwendete keinen Blick an die prachtvollen Deckenfresken der Halle und stieg die Marmortreppen empor. Im letzten Stockwerk öffnete er eine Tür aus schwerem Eichenholz. Ein kühler Windhauch schlug ihm entgegen. Alfred stieg eine hölzerne Wendeltreppe dahinter hinauf, bis er einen weitläufigen Dachboden erreichte. Hier oben gab es keine Tür, aber er hatte sich angewöhnt, einfach an den Holzbalken über dem Treppenabsatz zu klopfen.
«Junge, schön, dass du die Zeit gefunden hast.»
Ein schmales Gesicht tauchte hinter einem Stapel Bücher auf.
Alfred deutete eine Verbeugung an. «Herr Direktor …»
«Lass die Förmlichkeiten, nimm Platz. Willst ein Schluckerl Kaffee, oder kann ich dir sonst was anbieten?»
Alfred sah sich um. Von der Pracht des Gebäudes war hier oben wenig zu erkennen. Es war deutlich kühler und roch nach Holz. Trotzdem war Alfred von dem schmucklosen Kuppeldach immer schon beeindruckter gewesen als von der marmornen Pracht der Eingangshalle. Überall stapelten sich Bücher und Schriftrollen. Alfreds Finger glitten liebevoll über das riesige Messingteleskop, das den Raum beherrschte.
«Nein, danke», erwiderte er lächelnd. Er durchquerte den Raum und setzte sich dem Mönch gegenüber, der seinen Schreibtisch in der hintersten Ecke der Sternwarte eingerichtet hatte.
Direktor Hell war ein mageres Männlein, das Alfred mit seinen übergroßen Augen schon immer an eine Eule erinnert hatte. Heute trug er schwarze Ordenstracht und ein Birett auf seinem ergrauten Haupt. Alfred war nie daraus schlau geworden, warum er sich an manchen Tagen weltlich und an anderen in Jesuitenhabit kleidete. Vielleicht war es Ausdruck für seinen ständigen Balanceakt zwischen Naturwissenschaft und Glauben – oder einfach abhängig von seiner morgendlichen Laune.
«Ihr meintet, Ihr hättet wichtige Neuigkeiten …»
Direktor Hell lächelte, was man mehr an seinen Eulenaugen als seinem Mund erkennen konnte. «Immer gleich zur Sache kommen, gell, Alfred?» Er hob tadelnd den Zeigefinger. «Ich habe dir geschrieben, weil ich eine Anstellung für dich habe. Gute Arbeit, nicht diese … Frondienste, die du sonst annimmst.»
Alfred runzelte die Stirn.
«Was? Glaubst du, ich weiß nicht, wie’s um dich steht? Du brauchst ein Auskommen, bis du ein Arzt bist, oder wovon willst du leben?»
«Ich komme über die Runden …»
«Du vielleicht … aber dein Rock hat ein Loch an der Schulter. Und an den Ellenbogen ist er schon ganz abgewetzt. Kann es sein, dass du nur einen besitzt?»
Alfred schwieg und verdeckte die abgewetzten Stellen mit den Händen. Genaue Beobachtung war das tägliche Brot seines ehemaligen Arbeitgebers. Vermutlich bestand gar nicht so viel Unterschied darin, ob man den Himmel oder einen Menschen studierte.
Direktor Hell seufzte. «Ein alter Freund hat mir geschrieben, niemand anderer als der Graf von Weydrich, einer der einflussreichsten Männer Wiens. Als er noch ein Jüngling war, habe ich ihn unterrichtet, in den Naturwissenschaften und Latein. Der Graf ist ein Humanist und glaubt an den Fortschritt. Er hat eine Tochter, sein einziges Kind, und will ihr dieselbe Bildung angedeihen lassen, die ihm selbst zuteilwurde. Deshalb hat er mich gebeten, sie zu unterrichten.»
«Ich gratuliere», erwiderte Alfred trocken.
«Ich habe abgelehnt!» Direktor Hell schob einen Stapel Schriften beiseite, der ihm die Sicht einschränkte, und beugte sich vor. «Du wirst sie unterrichten, Alfred!»
Alfred starrte den Jesuiten an und suchte vergeblich nach einem schalkhaften Blitzen in dessen Augen. «Ich habe für Euch zwei Jahre lang Linsen poliert und Texte kopiert. Das qualifiziert mich kaum für eine Stelle als Lehrmeister.»
«Unsinn!» Der Jesuit trommelte mit seinen spitzen Fingernägeln auf sein Eichenpult. «Dein Beitrag zu meinem Artikel über den Planeten Herschel war nicht unwesentlich. Du bist allemal geeignet, diese Stelle anzunehmen.»
«Danke», erwiderte Alfred schlicht. «Aber ich werde dieses Mädchen nicht unterrichten.»
Hell starrte Alfred ungläubig an und ließ sich zurück in seinen Stuhl sinken.
«Der Graf zahlt zehn Gulden die Stunde. Und die Arbeit lässt dir genug Zeit zum Studieren.»
Alfred wich seinem Blick aus. «Ich lehne trotzdem ab.»
Eine Weile schwiegen sie beide. «Ah …», erwiderte der Mönch schließlich und hob eine Augenbraue. «Dein alter Groll, nicht wahr?»
Alfred starrte stur geradeaus.
«Du kannst nicht alle Adligen für das verantwortlich machen, was dir als Kind passiert ist.»
«Wollt Ihr sie in Schutz nehmen?» Alfred sprang auf und funkelte den Jesuiten wütend an. «Für die meisten von ihnen sind wir von Geburt an Menschen zweiter Klasse! Und wir lassen uns von ihnen rumschieben, auf dem Schachbrett ihrer Beliebigkeiten! Wir buckeln vor ihren Schlössern, wir sterben in ihren Kriegen, und alles, was wir ersehnen, ist von ihrer Gnade abhängig …»
Alfred verstummte. Für eine Weile konnte man nur das Gurren der Tauben auf dem Dach hören. Irgendwo in der Ferne hämmerte jemand.
«Alfred, bitte», erwiderte Direktor Hell schließlich ruhig. Er stand auf und kam zu ihm hinüber. «Mit deiner Wut zerstörst du nichts und niemanden – nur dich selbst.»