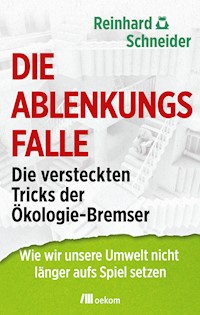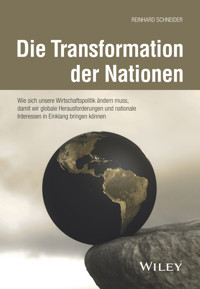
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Jahrzehntelang waren die technologisch fortgeschrittenen Länder des Westens die Nutznießer der Globalisierung auf Basis der von ihnen geschaffenen Wirtschaftsordnung. Jetzt ändern sich die geopolitischen und wirtschaftlichen Verhältnisse mit Wucht. Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, dass wir unsere Wirtschaft auf CO2-freies Wirtschaften umstellen müssen. Zudem altern viele Gesellschaften. Deutschland und Europa tun sich sichtlich dabei schwer, ihre Nationen zukunftsfähig zu gestalten. Gerade bei der passenden Wirtschaftspolitik hakt es. Reinhard Schneiders These ist: Es braucht in Deutschland und Europa dringend einen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel. Diesen schaffen wir aber nur, wenn wir die Grundlagen unseres Wohlstands verstehen. Leider ist das Verständnis der wirtschaftlichen Zusammenhänge in der Politik und der breiten Bevölkerung oft lückenhaft und es kommt zu Fehleinschätzungen. Dies beginnt schon bei der mangelnden Unterscheidung zwischen Tätigkeiten, die Kosten für eine Gesellschaft auslösen, und Tätigkeiten, die Einkommen für eine Gesellschaft generieren. Eine wesentliche Ursache ist die Art, wie wir Wertschöpfung und Einkommen von Nationen bzw. Staaten wie Deutschland definieren und messen. Fest steht: Wenn Nationen ihren Wohlstand halten wollen, müssen sie konkurrenzfähig sein. Attraktive und konkurrenzfähige Produkte werden mittlerweile überall angeboten; bei Amazon ist man nur einen Klick vom weltweiten Angebot entfernt. Während die USA und China verstehen, dass sie ihr Einkommen steigern müssen, wenn sie mehr Wohlstand haben wollen, rümpfen die Europäer die Nase über den Neoliberalismus. Sie rufen lieber nach Geld vom Staat oder der EU zur Steigerung der Nachfrage. Auf diesem Weg werden Deutschland und Europa Gefahr laufen, abgehängt zu werden. Das Buch liefert eine längst überfällige Darstellung der Realität der Wirtschaft. Es soll helfen, richtige Entscheidungen zu treffen. Nur so gelingt uns, vor dem Hintergrund der aktuellen globalen Herausforderungen, der Wandel in eine erfolgreiche Zukunft - die Transformation der Nationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Bücher von WILEY-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
© 2024 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, GermanyAlle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Print ISBN: 978-3-527-51182-2ePub ISBN: 978-3-527-84707-5
Umschlaggestaltung: Susan BauerCoverbild: Matthias Haas – stock.adobe.com
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Teil I: DIE KOMPLEXITÄT DER TRANSFORMATION
1 Einleitung
Anmerkungen
2 Die multiplen Herausforderungen
Anmerkungen
Teil II: GLOBALE WIRTSCHAFT – QUO VADIS?
Notiz
3 Aufstieg und Wandel globalen Wirtschaftens
Anmerkungen
4 Globale Güter- und Arbeitsmärkte
Anmerkungen
5 Globale Finanzmärkte
Anmerkungen
Teil III: DAS ÖKONOMISCHE FUNDAMENT DER TRANSFORMATION – DIE WIRTSCHAFT DER NATIONEN
6 Makroökonomie
Anmerkungen
7 Globale Wertschöpfung – Basis nationaler Einkommen
Anmerkungen
8 Die Neuvermessung von Wertschöpfung, Arbeit und Einkommen der Nationen
8.1 Nationale Wertschöpfung und ihre industrielle Basis
8.2 Das Einkommen der Nationen
8.3 Das Einkommen des Staates – der übermächtige Staatsanteil
8.4 Arbeitsmärkte sind nicht homogen
8.5 Beispiel Deutschland
Anmerkungen
9 Ohne globale Wettbewerbsfähigkeit keine Transformation – die reale Wirtschaft muss Grundlage der Wirtschaftspolitik sein
Anmerkungen
Teil IV: GELD UND SCHULDEN – DIE LEICHTFERTIGE VERSCHULDUNG ERSCHWERT DIE TRANSFORMATION
Notiz
10 Geld
Anmerkungen
11 Ursprung und Rolle der Notenbanken
Anmerkungen
12 Schulden
Anmerkungen
13 Der Eigennutz westlicher Staaten
Anmerkungen
14 Die Saat der Finanzkrisen
Anmerkungen
15 Inflation – veränderte Ursachen und die Hilflosigkeit der Notenbanken
Notiz
Teil V: ZEITENWENDE – DIE HERAUSFORDERUNGEN DER TRANSFORMATION
16 Zeitenwende
17 Die neue Ehrlichkeit – und die künftig notwendige Wirtschaftspolitik
Anmerkungen
18 Digitalisierung und Einnahmen des Staates – Sonderthema Steuern
Notiz
19 Society Change not System Change – der notwendige Wandel in den Köpfen
Anmerkungen
Anhang
Anmerkungen
Der Autor
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Modell vom nationalen Wirtschaftskreislauf
32
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Produktionsfaktoren der global organisierten Wirtschaft
Abbildung 7.2: Dreistufiges Modell vom Wirtschaftskreislauf
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Heute gültige Input-Output-Rechnung (Eigene Darstellung, ange...
Abbildung 8.2: Wirtschaftsprozess fortgeschrittener Volkswirtschaften
Abbildung 8.3: Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft
Abbildung 8.4: Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des BIP je geleisteter ...
Abbildung 8.5: Wirtschaftskreislauf einer geschlossenen Volkswirtschaft
Abbildung 8.6: Wirtschaftskreislauf einer offenen Volkswirtschaft
Abbildung 8.7: Erwerbstätigkeit derivativer Märkte
Abbildung 8.8: Beschäftigung in DeutschlandQuelle: Volkswirtschaftliche Ge...
Abbildung 8.9: Nettocashflow für Deutschland
Abbildung 8.10: Entwicklung des Nettoinlandsprodukts Deutschland nach Märkten...
Abbildung 8.11: Erlöse am Weltmarkt nach Wertschöpfungsgruppen
Abbildung 8.12: Wertschöpfung nach Märkten und Gütergruppen
Abbildung 8.13: Einkommensverteilung 2010, Nation
Abbildung 8.14: Einkommensverteilung 2010, Haushalte
Abbildung 8.15: Offene Volkswirtschaft mit Daten für Deutschland
Abbildung 8.16: Wertschöpfung (Entstehung), Verteilung und Verwendung des In...
Abbildung 8.17: Entstehung, Verwendung und Verteilung des Bruttoinlandsprodu...
Abbildung 8.18: Wertschöpfung, Verteilung, Beschäftigung entwickelter Volksw...
Abbildung 8.19: Das Handwerkerparadoxon
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Einbettung der Nation in die Weltwirtschaft
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Einnahmen und Ausgaben einer Nation
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Prolog
Inhaltsverzeichnis
Anhang
Der Autor
Literaturverzeichnis
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
3
4
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
271
272
273
275
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
295
296
297
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
313
314
315
316
317
318
319
321
323
324
325
326
327
328
Prolog
Die Welt ist in Unruhe. Der brutale Überfall von Putins Russland auf die Ukraine. Der Hamas-Terror in Israel und die Antwort Israels im Gazastreifen. Seit Jahren schwelt zudem der Systemkonflikt zwischen China und den USA. Insbesondere, seitdem US-Präsident Donald Trump China zum Rivalen erklärt hat.
Dies alles geschieht, während der Westen angesichts der von den Menschen zumindest mit verursachten Erderwärmung gerade begonnen hat, von der Nutzung fossiler Energie auf erneuerbare Energieformen umzustellen. Das bedeutet eine enorme Kraftanstrengung in schwieriger Zeit.
Wer ein Haus bauen will, braucht ein solides Fundament. Vor der Behandlung beim Arzt steht eine umfangreiche und verantwortungsvolle Diagnose. Schon seit Jahren frage ich mich, ob die vielen geldpolitischen Programme der Notenbanken und die finanzpolitischen Maßnahmen der Regierenden in den Nationen auf soliden Diagnosen der Ökonomen beruhen. Diese Frage zu beantworten, ist in der jetzigen Zeit der Verschiebung globaler Machtverhältnisse und der von der Digitalisierung getriebenen Transformation der Wirtschaft akuter denn je. Diese doppelte Herausforderung wirkt sich in erster Linie auf die Position der Nationen im weltweiten Wettbewerb aus. Die Transformation betrifft in erster Linie die Nationen. Denn Unternehmen sind den Wandel gewohnt. Neue Wettbewerber, attraktive Konkurrenzprodukte, inflationäre Entwicklungen, sich verändernde Rechtsvorschriften und vieles mehr. Unternehmen haben ein ganzes Handlungsarsenal, um auf neue Herausforderungen zu reagieren. Sie können die eigenen Produkte verbessern und neue Produkte entwickeln. Sie können die Werbung intensivieren, die Produktivität steigern, die Produktion verlagern oder andere Unternehmen übernehmen. Kurz: Sie können die Kosten den Erlösen anpassen oder die Umsätze den Kosten.
Nationen sind hingegen eher mit Immobilien zu vergleichen. Der Standort ist durch die Grenzen definiert. Die Anzahl der Einwohner ändert sich nur geringfügig. Wenn, wie jetzt in vielen Ländern, die Überalterung der Gesellschaften eintritt, ist das ein Jahrzehnte andauernder Prozess. Auch die Unternehmenslandschaft in den Nationen verändert sich nicht von heute auf morgen. Kurz: Nationen sind vergleichsweise immobil. Das Instrumentarium der Ökonomen ist entsprechend überschaubar. Zins- und Geldmengensteuerung bei der Geldpolitik. Konjunkturpakete und Beschäftigungsprogramme bei der Finanzpolitik. Und die Strukturpolitik für den Standort scheitert oft am politischen Klein-Klein oder an der Bürokratie. Angesichts der globalen Herausforderungen muss die derzeitige nationale Sichtweise von Politik und Makroökonomie auf die Gesamtwirtschaft (einer Nation) aufgegeben werden. Vielmehr müssen Aspekte des Wettbewerbs sowohl in Bezug auf lokal ansässige Unternehmen als auch auf den Standort in den Vordergrund rücken. Wir dürfen nicht der Versuchung unterliegen, uns diesem globalen Wettbewerb durch die Forcierung lokal begrenzter Tätigkeiten, etwa aus dem Care-Bereich, entziehen zu wollen. Begünstigt wird diese, für die Nation fatale Sichtweise durch die heutige Berechnung nationaler Wertschöpfung und des nationalen BIP.
Mit der jahrzehntelangen Erfahrung als CFO bin ich es gewohnt, die Entwicklung von Unternehmen zu analysieren und die Steuerung des Unternehmens zu unterstützen. International Accounting Standards (IAS) stellen sicher, dass die Abschlüsse der Unternehmen international gültigen Regeln entsprechen und ein zutreffendes Bild der geschäftlichen Lage zeigen. Ziel ist die Ermittlung eines periodengerechten Ergebnisses nach Abzug der Aufwendungen von den Erlösen.
Die Jahresabschlüsse der Nationen hingegen sind das Ergebnis einer Diskussion unter Ökonomen und Politikern in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts. Dieses Ergebnis ist das so genannte Bruttoinlandsprodukt (BIP). Es gibt wohl kaum jemanden, dem das Wort nicht geläufig ist. Aber ebenso kaum jemanden, der das BIP auf Anhieb erklären könnte. Trotzdem orientieren sich Millionen Menschen bei ihren wirtschaftlichen Handlungen an der Entwicklung der BIP diverser Nationen. Praktisch unverändert wird es seit fast hundert Jahren verwendet. Viele Analysen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sehen aus, als befände sich die Wirtschaft gerade erst am Übergang von der Landwirtschaft zum industriellen Zeitalter, auch wenn wir angeblich schon in der Dienstleistungsgesellschaft angekommen sind.
Anders als gewohnt, geht der Blick in diesem Buch nicht von der hohen Warte der Makroökonomie auf die Gesamtwirtschaft einer Nation, sondern von der Realität wirtschaftlichen Handelns der Wirtschaftsteilnehmer auf die Gesamtwirtschaft. Ein ungewohnter Blick, der viele Überraschungen birgt. Eine Reform der nationalen Rechnungslegung und der Analysetools nationaler Wertschöpfung ist lange überfällig. Die anstehende Transformation der Nationen macht sie unerlässlich.
Reinhard Schneider, im Dezember 2023
Teil IDIE KOMPLEXITÄT DER TRANSFORMATION
1Einleitung
Aus der Atomkraft-Gegner-Szene und der Umweltbewegung heraus haben sich in vielen Ländern die grünen Parteien gebildet. In Deutschland haben die Grünen die Energiewende – die Abkehr von der Nutzung fossiler Energie und die Umstellung auf erneuerbare Energieträger – jahrzehntelang wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Als auf die Stromerzeugung mit erneuerbaren Energieträgern im Jahr 2020 mit 45 %1 nahezu die Hälfte der gesamten Stromerzeugung in Deutschland entfiel, wurde das als Durchbruch der Energiewende gefeiert. Das noch im März 2022 herausgegebene Informationsblatt des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima trägt den Titel: Die Energiewende, Erneuerbare Energien 2021. Der kriegerische Einzug Russlands in die Ukraine und das Vorgehen Putins, Energie als strategisches Druckmittel einzusetzen, haben diesen Selbstbetrug der Grünen und ihrer Gefolgschaft auf brutale Weise aufgedeckt. Denn die über Jahrzehnte mit Dutzenden Milliarden Euro geförderten erneuerbaren Energieträger Wind und Solar lieferten in 2021 gerade einmal 8,2 % bzw. 3,4 % zum Primärenergieverbrauch.2
Auf einen Schlag wurde klar: Kohle, Gas und Atomkraft liefern nicht nur zuverlässig Strom, wenn er gebraucht wird. Viel deutlicher wurde noch, dass ohne fossile Energie die Wohnungen kalt bleiben und den Unternehmen die notwendige Prozessenergie zur Herstellung der Güter fehlt. Wenn aber die Wirtschaft zusammenbricht, bricht auch das Gesellschaftssystem zusammen. Die Fakten waren keineswegs unbekannt. Politisch schien es jedoch erfolgversprechender, die Energiewende nicht auf der Basis vollständiger Information umsetzen zu wollen, sondern so zu tun, als würde der Austausch der ungeliebten Atom- und Kohlemeiler gegen Windräder und Photovoltaikanlagen genügen, die Energiewende herbeizuführen.
Einen ähnlichen Selbstbetrug erleben wir bei dem Maßstab für Einkommen und Leistung einer Nation. »Das Bruttoinlandsprodukt ist das Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Es misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und Dienstleistungen (Wertschöpfung)«, schreibt das statistische Bundesamt in Deutschland.3 Nicht nur lässt diese Definition der wirtschaftlichen Leistung den Wert der nicht bezahlten Leistungen der Bürger, etwa bei der Kindererziehung oder der Pflege, außer Betracht. Auch erhöht die Beseitigung von Umweltschäden das Bruttoinlandsprodukt (BIP), während die Umweltschäden selbst nicht als Malus berücksichtigt werden. Die Berechnung führt entsprechend zu viel Kritik und alternativen Vorschlägen, die regelmäßig in der Forderung nach einer Erweiterung des BIP durch die Erfassung dieser bisher nicht berücksichtigten Leistungen mündet. Die Fixierung des Maßstabs der Wertschöpfung nur auf finanziell entgoltene Leistungen führe zu einer Fehlsteuerung der Wirtschaft und sei mit ursächlich für ökologische und soziale Schieflagen. Manche sehen im BIP gar die Wurzel allen Übels.4 Als Ergebnis der Analyse wird regelmäßig die Forderung nach stärkerer und direkterer Steuerung der Wirtschaft durch den Staat postuliert.
Das wirklich Problematische am heutigen BIP ist aber nicht, dass nicht alle für die Gesellschaft relevanten Leistungen erfasst werden, sondern dass die finanzwirksame Wertschöpfung und damit das volkswirtschaftliche Einkommen zu hoch ausgewiesen wird. Wer in Deutschland ein Auto für 40 000 Euro kauft, muss knapp 48 000 Euro auf den Tisch des Verkäufers legen. Das Unternehmen, das ihm das Auto verkauft, muss die rund 8000 Euro Umsatzsteuer bis zum Zehnten des Folgemonats an das zuständige Finanzamt weiterleiten. Als durchlaufenden Posten bezeichnen die Unternehmen diese Verbrauchssteuer, die in der Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen auf der Einnahmenseite deshalb auch nichts zu suchen hat. Anders beim BIP. Dort ist die Umsatzsteuer Teil der Marktpreise und erhöht das BIP. Dass die Umsatzsteuer keine werthaltige Leistung ist, erkennt man daran, dass sie bei der Wertschöpfung hinzuaddiert werden muss. Und es bleibt auch nicht nur bei der Umsatzsteuer. Beim Kraftstoff betragen die diversen Verbrauchssteuern etwa die Hälfte des Preises oder das Doppelte des Warenwertes. Gütersteuern nennen sich diese Posten, von denen die Umsatzsteuer nur die größte ist. Weiter werden die in den Gütermarktpreisen bereits in der Kalkulation der Bruttolöhne enthaltenen staatlichen Leistungen im BIP noch einmal, also doppelt erfasst. Das erkennt man leicht daran, dass sie auf der Verwendungsseite, also der Erlösseite, als »Staatsverbrauch« hinzuaddiert werden müssen, weil es keine Markterlöse dafür gibt. Denn der Staatsverbrauch ist ja bereits als Steuer und Sozialabgabe in den Löhnen und damit in den Preisen der marktfähigen Güter enthalten. Würden Unternehmen in dieser Art und Weise bilanzieren, erhielten sie niemals das Testat einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, womit diese die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses bestätigen. An der falschen Bilanzierung staatlicher Einnahmen scheint sich hingegen niemand zu stören.
Das BIP führt zu einem zu niedrigen Ausweis der Sozialkosten- und Verschuldungsquoten. So wird die Abgabenquote in Deutschland für das Jahr 2020 mit 41 % vom BIP angegeben. Davon entfallen 23 % auf die Steuern und 18 % auf die Sozialabgaben.5 Die Zahlen suggerieren, dass die Abgabenquote insgesamt nicht überhöht ist und den Einkommensbeziehern immerhin fast 60 % für den privaten Konsum bleiben. Dem ist aber nicht so. Die Abgabenquote für Durchschnittsverdiener, bezogen auf die Lohnkosten – also inklusive der Arbeitgeberanteile –, liegt in Deutschland zwischen 40,8 und 47,8 % laut einer jüngsten Studie des Finanzministeriums.6 Dass Deutschland mit diesen Zahlen in Europa an der Spitze liegt, knapp vor Frankreich und Italien, beunruhigt bereits. Wirklich erschreckend ist jedoch, dass Länder, mit denen Europa konkurriert wie Japan, Kanada, Großbritannien und die USA um 10 – 15 Prozentpunkte darunter liegen.7
Vor allem aber zeigen die Werte des Durchschnittsverdieners nur die halbe Wahrheit. In Deutschland ist man bereits mit 68 210 Euro (rund 4830 Euro pro Monat bei 13 Gehältern) Spitzenverdiener, für die nach der Grundtabelle der Spitzensteuersatz von 42 % beginnt. Im Schnitt beträgt die Steuer bei diesem Einkommen 27,4 %. Zuzüglich 20 % Arbeitnehmeranteil an den Sozialkosten verbleiben dem Arbeitnehmer 53,6 % netto. Da der Arbeitgeber ebenfalls Sozialkosten zahlt, belaufen sich die Lohnkosten, die er kalkulieren muss, auf 81 852 Euro. Davon erhält der Arbeitnehmer einen Nettolohn in Höhe von 35 889 Euro und der Staat erhält 45 963 Euro. Bereits bei qualifizierten Arbeitnehmern, die als Fachkräfte dringend gesucht werden, kassiert der Staat 56 % der Lohnkosten. Beim Konsum des Arbeitnehmers reduzieren Verbrauchssteuern noch einmal deutlich das Nettoentgelt und erhöhen die staatlichen Einnahmen. In diesen Zahlen drückt sich nicht nur das Schröpfen der Arbeitnehmer durch den Staat aus, was dieser durch die Quoten auf das BIP verschleiert. Vielmehr zeigt sich die Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland. Wer will als qualifizierte Fachkraft bei diesen Abzügen noch in Deutschland arbeiten? Dazu noch hohe Energie- und Bürokratiekosten. Da wird es für Deutschland schwierig, Unternehmen vom Standort Deutschland zu überzeugen. Was für Deutschland gilt, gilt in vergleichbarer Weise für andere technologisch fortgeschrittene Länder in Westeuropa, für die die soziale Marktwirtschaft das prägende Wirtschaftssystem des Landes ist.
In der Summe ist das BIP, insbesondere als Maßstab für finanzwirksame Ausgaben, wie Zahlungen für Zinsen, Renten oder vielerlei Sozialleistungen, deutlich zu hoch ausgewiesen. Tatsächlich betragen die realen, konsolidierten Einnahmen für Deutschland lediglich 55 % des BIP.8 Die Verschuldung in Deutschland übersteigt die jährlichen Einnahmen der Nation bereits deutlich. In Italien sind die Staatsschulden fast dreimal so hoch wie die jährlichen Einnahmen. Die Staaten sind also viel weniger leistungsfähig, als die BIP glauben machen wollen. Da die Politiker zwecks Wiederwahl die Bürger mit Leistungen aller Art gerne bedienen, sind die staatlichen Budgets bereits in Boomzeiten am Limit. Die kleinste konjunkturelle Delle führt dazu, dass die Ausgaben die Einnahmen übersteigen.
Bisher gab es dafür einen scheinbar eleganten Ausweg. Unter Führung der Notenbanken und tätiger Mithilfe der Geschäftsbanken wurde Geld in unvorstellbarem Ausmaß geschaffen. In Abhängigkeit von der Umschlagsgeschwindigkeit verschwindet das Geld zum großen Teil wieder, weil es entweder für Investitionen in Produktivkapital oder den Bau von Immobilien verwendet wird. Schulden werden aber auch für Spekulationen oder für vorgezogenen Konsum aufgenommen. Konsum also, der noch nicht durch Einnahmen gedeckt ist. Gerade bei Letzterem tun sich Staaten bzw. die Politiker besonders leicht. Sie nennen das Konjunkturstützung oder Stützung der Nachfrage. Was bleibt von der scheinbar unerschöpflichen Geldvermehrung, sind die Schulden. Der viel bessere Maßstab für die Geldvermehrung als die Geldmenge selbst sind daher die Schulden. Die weltweiten Schulden stiegen in diesem Jahrhundert von Jahr zu Jahr deutlich schneller als das weltweite BIP, obwohl das BIP als Maßstab den Schuldenstand zu gering ausweist. Was passiert, wenn man es mit der Verschuldung übertreibt, erleben meist nur Entwicklungs- und Schwellenländer. Sie werden insolvent. Europa und die USA konnten sich dieser Konsequenz aufgrund der weltweiten Dominanz ihrer Währungen bisher entziehen.
Eigentlich sind die Notenbanken mit ihrer Geldpolitik nur für den Erhalt der Preisstabilität verantwortlich, indem sie die Geldmenge so steuern, damit es nicht zu deren extensiver Ausweitung und zu Inflation kommt. Das passiert, wenn die Nachfrageunterstützung auf ein nicht ausreichendes Angebot trifft. Die Preise steigen dann schneller. Da die Energie- und Rohstoffpreise sowie die Vorleistungen angesichts gestörter Lieferketten massiv gestiegen sind, ist die aktuelle Inflation allerdings stark angebotsseitig bedingt. Die in den Boomjahren nach der Finanzkrise falsche, weil viel zu lockere Notenbankpolitik führt jetzt dazu, dass die wegen steigender Preise anziehenden Löhne auf Zinssteigerungen der Notenbanken und die gleichzeitige Begrenzung der Geldmenge stoßen. Die Unterstützung der Bürger durch die Geld- und Finanzpolitik ist deshalb jetzt sehr begrenzt, weil das Geld schon während der Boomjahre verpulvert wurde. Das kann man nur als Scheitern der Notenbankpolitik der letzten Jahre bezeichnen. Die EZB hat nach Eintritt der hohen Inflation verlauten lassen, dass ihre prognostischen Modelle möglicherweise doch nicht die richtigen Signale lieferten. Das ist besonders fatal, weil jeder informierte Bürger schon länger in der Lage war, zutreffendere Prognosen abzugeben.
Ähnliches wie für die Notenbanken und ihre Geldpolitik gilt für die Nationen selbst. Staaten können die Nachfrage durch extensive Finanzpolitik in konjunkturellen Schwächephasen unterstützen. Die Analysen von Keynes9 und seine Schlussfolgerungen waren durchaus zutreffend. Verfolgt man aber die Politik westlicher Staaten, befinden wir uns seit siebzig Jahren mehr oder weniger im Krisenmodus.
Finanz- und Geldpolitik dienen letztlich der realen Güterwirtschaft. Dort ist die Entwicklung der Weltwirtschaft und die der einzelnen Nationen von Bedeutung. In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg hat die Führung der ehemals oder noch kommunistischen Länder nicht nur die Märkte dieser Länder weitgehend verschlossen, sondern die Zentralverwaltungswirtschaft hat auch verhindert, dass diese Länder konkurrenzfähige Produkte am Weltmarkt anbieten konnten. So konnten sich die marktwirtschaftlich organisierten Länder des Westens ohne Konkurrenz aus diesen Ländern in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg einen immensen technologischen Vorsprung erarbeiten und die Märkte dieser Welt allein bedienen. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Beitritt Chinas zur WTO erschlossen sich für den Westen dann nicht nur weitere große Absatzmärkte. Gleichzeitig stand mit China und anderen Ländern, für die Westeuropäer in Osteuropa direkt vor der Haustüre, ein riesiges Potenzial preiswerter Arbeitskräfte zur Verfügung. Der Wohlstand der Bürger westlicher Länder schien keine Grenzen zu kennen.
Insbesondere durch die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung dieser Pandemie in China kam es zu Verzögerungen und Unterbrechungen der Lieferketten. Die Havarie des Containerschiffs Ever Given im Suezkanal, die einen massiven Stau anderer Schiffe verursachte, machte deutlich, wie fragil die globalen Lieferketten sind. Diese Vorkommnisse haben dafür gesorgt, die Lieferketten und die Art der globalen Arbeitsteilung zu überprüfen und zu verändern. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen wie Nearshoring oder Friendshoring und der beschleunigte Umstieg auf erneuerbare Energien kosten Geld und sind geeignet, den Wohlstand einzuschränken oder jedenfalls seinen Zuwachs zu begrenzen.
Gleichzeitig mehren sich in den entwickelten westlichen Gesellschaften Stimmen, insbesondere in der jüngeren Generation, die die Art und Weise, wie der Westen wirtschaftet, kritisieren. Die Economists for Future, deren Vorbild die Fridays-for-Future-Bewegung ist, beurteilen die Wirtschaftsweise des globalen Nordens als extraktivistisch. Darunter verstehen sie den rücksichtslosen weltweiten Abbau von Rohstoffen, die Nutzung von Anbauflächen anderer Länder sowie das Hinterlassen von Müll oder Emissionen. Diese extraktivistische Lebensweise des globalen Nordens werde auf dem Rücken des globalen Südens ausgetragen. Notwendig sei eine sozial-ökologische Transformation. Weg vom linearen Wirtschaften hin zu nachhaltigem Wirtschaften und zu einer Kreislaufgesellschaft. Das kritisierte Wirtschaften des globalen Nordens (die demokratischen, technologisch fortgeschrittenen westlichen Länder wie Nordamerika, Europa und Australien) wird dem Kapitalismus angelastet. »Fuck the system, not the planet«, skandieren die Mitglieder von Fridays for Future. Einem marktwirtschaftlichen und entsprechend der ökonomischen Prinzipien auf den sparsamen Einsatz von Ressourcen ausgerichteten Wirtschaftssystem die Konsequenzen für die Verhaltensweisen der Gesellschaften anzulasten, ist nicht nur merkwürdig, sondern falsch. So vergeht kaum eine Rede von Politikern westlicher Demokratien, die in guten Zeiten noch mehr Wachstum und noch mehr Wohlstand für ihre Bürger und in schlechten Zeiten Unterstützungen aller Art durch den Staat versprechen. Der Wunsch nach ständig steigenden nationalen Einkommen (BIP) ist kein Merkmal des Kapitalismus, sondern Ziel der Regierenden. Marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaftssysteme sind flexibel, und gut geführte Unternehmen sind auch in stagnierenden Märkten erfolgreich.
Die Notwendigkeit der Menschheit, in Zukunft nachhaltiger zu wirtschaften, um den Planeten lebensfähig für ihre eigene Art zu erhalten, ist unstrittig. Leider verfällt die Politik bei der Propagierung zukünftiger Herausforderungen, wie der Umstellung der Energiegewinnung und dem Umbau von linearer Wirtschaft auf Kreislaufwirtschaft auf die bekannten Muster politischer Versprechungen. Einmal mehr werden die Umstellungen als Wachstumschance propagiert, welche die Wertschöpfung und den Wohlstand der Bürger erhöhen. Zwar mögen sich durchaus Chancen für Europa bei der Transformation der Wirtschaft ergeben. Aber dies ist bei weltweiter Konkurrenz kein Automatismus, was sich schon daran erkennen lässt, dass China längst die führende Rolle bei Windkraft und Photovoltaik übernommen hat. Eher besteht die Gefahr, dass es zumindest in der Übergangszeit zu Einbußen bei den nationalen Einkommen und damit beim Wohlstand kommt.
Eine Entwicklung, die in den technologisch führenden Ländern in ihren Ausmaßen noch nicht verstanden wird, ist die zunehmende globale Konkurrenz. Bei der Diskussion um globale Veränderungen und ihren Einfluss auf Wirtschaft und Wohlstand dominieren zwei Themen. Der Machtkampf zwischen den USA und China um die geopolitische Vorherrschaft und die Erkenntnis der erreichten Abhängigkeit von Rohstoffen und Zulieferern in kritischen Bereichen. Die Einstellung der wohlhabenden Länder des Westens, schmutzige Arbeiten wie Bergbau, Veredlung und arbeitsintensive Arbeiten anderen Ländern zu überlassen, hat diese Abhängigkeit zumindest mit verursacht.
Die zunehmende globale Konkurrenz bedeutet jedoch viel mehr. Ein langwieriger, aber in seinen Auswirkungen für die wohlhabenden Länder des Westens kaum zu unterschätzender Prozess. Dabei gibt es Parallelen aus der Vergangenheit. Das erste Land, das nach dem Zweiten Weltkrieg technologisch aufgeholt hat, war das zunächst isolierte Land Japan. Die Älteren erinnern sich noch an die ersten Autos, die Japan nach Europa exportiert hat. Schlicht in Design und Technologie. Heute ist Toyota das weltgrößte Unternehmen der Automobilindustrie. Es folgten optische Geräte, die Unterhaltungsindustrie und vieles mehr. Südkorea hat den Aufholprozess schneller geschafft. Koreanische Automarken wie Hyundai und Kia sind auf Europas Straßen längst keine Seltenheit mehr. Mit Samsung dominieren die Südkoreaner neben Apple den Smartphone-Markt. Außer VW ist heute kein Hersteller des Autolands Deutschland noch unter den ersten zehn größten Automobilherstellern der Welt. Jetzt schicken sich die Chinesen an, ihre elektrisch betriebenen Fahrzeuge nach Europa zu exportieren. In dem für die CO2-neutrale Mobilität so wichtigen Automarkt sind die Chinesen bereits Marktführer weltweit. In Vietnam steht der hierzulande unbekannte Autohersteller Vinfast in den Startlöchern, um den globalen Automarkt aufzurollen.
Taiwan, die Philippinen, Vietnam, Indonesien; natürlich auch China, Indien, Brasilien und viele andere mehr – sie sind nicht mehr zufrieden mit ihrer bisherigen Rolle als Rohstofflieferanten und als billiges Arbeiterreservoir für den wohlhabenden Westen. Ihre Forderungen nach mehr Anteil an der globalen Wertschöpfung werden deutlicher. Was wir derzeit erleben, ist eine zunehmende Konkurrenz auf den weltweiten Absatz- und Beschaffungsmärkten. Bis vor ein, zwei Dekaden schien es, als hätten die technologisch fortgeschrittenen Länder ein Monopol auf den Verkauf hochwertiger Güter und den Zugriff auf die weltweiten Ressourcen. Wer in Zukunft seinen Wohlstand halten oder fördern will, muss sich der zunehmenden Konkurrenz auf den Weltmärkten bewusst sein. Die Erwirtschaftung nationaler Einkommen auf diesen Märkten wird herausfordernder. Wer glaubt, sich dieser Konkurrenz durch Konzentration auf den Binnenmarkt entziehen zu können, irrt. Die Einsicht, für mehr Wohlstand sein Einkommen steigern und arbeiten zu müssen, ist für Menschen in den Schwellenländern selbstverständlich. Auch in dem, nach Ansicht der Europäer neoliberalen kapitalistischen Amerika ist diese Einsicht noch ausgeprägt. In dem sozialliberalen Europa haben hingegen die Ideen des englischen Politikers und Ökonomen Lord Maynard Keynes die Oberhand gewonnen. Dass dessen auf der Psychologie des Verbrauchs aufbauende These von der Nachfrageunterstützung nur für konjunkturell schwierige Zeiten gilt und dass die dafür notwendige Verschuldung in guten Zeiten wieder zurückgeführt werden soll, wird dabei geflissentlich übersehen. Warum soll der Staat mit dem Geld auskommen, das ihm die Bürger zur Verfügung stellen, wenn sich Geld zur weiteren Verteilung von Wohltaten ganz einfach aus dem Nichts schaffen lässt. Ohne jegliche Leistung?
Die sozial-ökologische Wende ist das neue Schlagwort, das nicht zu einem vorsichtigeren Umgang mit dem Geld der Bürger mahnt, sondern mehr Geld für alle möglichen Zwecke fordert. Strukturförderung, Energiewende, Mindestlohn oder Bürgergeld sind dominierende Themen, wenn es angeblich um Wirtschaftspolitik geht. Die Einsicht, dass das von der Wirtschaft unter globaler Konkurrenz auf den Weltmärkten erwirtschaftete Einkommen die materielle Basis einer Nation bildet, scheint verloren gegangen. Die eigene Wirtschaft zu unterstützen, statt sie zu bekämpfen, sollte eigentlich eine Tugend sein. Wenn die Wirtschaft überhaupt gefördert wird, dann nur, wenn die Investitionen zu einem geringeren CO2-Verbrauch durch Energieeinsparung oder die Nutzung erneuerbarer Energie führen. Erneuerbare Energien brauchen neue Stromtrassen, erhebliche Speicherkapazitäten und das Vorhalten konventioneller Energieerzeuger für die volatilen Energielieferanten Wind und Sonne. Sind sie in der Summe teurer als die bisher auf fossilen Rohstoffen basierende Energieerzeugung, dann erzeugt diese Umstellung kein Wachstum, wie uns die Politiker weismachen wollen, sondern erschwert den Erhalt des Wohlstandsniveaus.
Gleichzeitig greifen die Digitalisierung und die künstliche Intelligenz tief in das Leben der Menschen und den Wirtschaftskreislauf ein. Sie führen zu einer weiteren Automatisierung der Produktionsprozesse. Vor allem aber werden sie viele der heute den Menschen vorbehaltenen Arbeitsprozesse in Dienstleistungsbereichen automatisieren. Damit verändert sie nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die Art, wie der Staat seine Einnahmen generiert. Das geschieht heute, wie oben geschildert, in hohem Maße durch die Besteuerung der Arbeitseinkommen. Wird der Produktionsfaktor Arbeit durch digitale Prozesse ersetzt, muss die Politik andere Wege finden, aus der Wertschöpfung der Nation staatliches Einkommen zu generieren. Die künstliche Intelligenz (KI) erlebt mit ChatGPT und jetzt auf den Markt kommenden anderen Deep-Learning-Produkten gerade einen Höhepunkt. Die schöpferische Zerstörung etablierter Geschäfte durch die Neukombination von Produktionsfaktoren, Innovationen und Absatzmärkten greift tief in das Wirtschaftsgeschehen ein und beeinflusst das Einkommenspotenzial der Nationen.
Wie aber sollen wir diese Veränderungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt in ihren Folgen für das Einkommen einer Nation verstehen, wenn wir schon das Einkommen der Nation falsch berechnen? Ökonomen sollte der Unterschied zwischen BIP und Volkseinkommen klar sein. In der Öffentlichkeit wird allerdings der Eindruck vermittelt, BIP und das Einkommen einer Nation seien identisch. Schließlich beziehen sich die Maßstäbe von Belastungsfaktoren einer Nation, wie Zinsen, Sozialkosten, Staatsanteil usw., auf das BIP und sie werden entsprechend veröffentlicht und kommentiert. Zu diesem falschen Bild trägt auch die Ermittlung der Wertschöpfung einer Nation bei. Ein Wert, der den Bürgern glauben machen will, Dienstleistungen hätten den größten Anteil an nationaler Wertschöpfung.
Arbeitseinkommen, also der Faktor Arbeit dominiert den Wert der Wertschöpfung von Dienstleistungen. Deshalb gilt als positives Signal in der derzeitigen rezessiven Phase, dass die Arbeitsmärkte sich als »robust« erweisen. Dass also die Erwerbstätigkeit hoch bleibt und die Arbeitslosigkeit allenfalls gering zunimmt. Für diese Aussage ist gleichgültig, ob Arbeitsmärkte robust sind, weil die Wirtschaft stabil ist oder weil Überalterung und neue bürokratische Vorschriften Arbeit generieren. Die positive Besetzung der Robustheit wird davon hergeleitet, dass der hohe Beschäftigungsstand für stabilen Konsum sorgt. Dass dieser simple Zusammenhang nur galt, als Nationen ihr BIP in großen Teilen auf dem eigenen Markt erwirtschaftet haben, wird entweder ignoriert oder ist noch nicht in das Bewusstsein eingedrungen. In einer globalen Wirtschaft gilt dieser Zusammenhang nur noch sehr eingeschränkt. Große Teile des Konsums – und auch der Herstellung – werden heute durch Importe befriedigt.
Bei einem solchen Bündel an Fehlinformationen verwundert nicht, dass große Teile der Bevölkerung keine Kenntnis darüber haben, wie ihr Einkommen und ihr Wohlstand gesichert werden. Nur ein kleiner Kreis von Menschen hält sich für ausreichend ausgebildet, die Zusammenhänge nationalen Wirtschaftens zu verstehen. In die Schulen der allgemeinen Wissensbildung findet die Lehre von der Wirtschaft den Weg schon lange nicht mehr. Das unterscheidet uns von unseren Vorfahren. Für diese war es selbstverständlich, ihrem Nachwuchs das Jagen und Sammeln oder nach dem Sesshaftwerden die Fruchtfolge, Zeiten für Säen und Ernten sowie die Bedeutung von Wetterphänomen beizubringen. Heute glauben die meisten Menschen, Einkommen entstehe, wenn sie sich morgens zur Arbeit aufmachen und dafür einen Lohn erhalten. Für den individuellen Haushalt ist das natürlich der Fall. Aber ökonomisch betrachtet entsteht Einkommen dadurch, dass konkurrenzfähige Güter hergestellt werden, die am Weltmarkt Absatz finden. Nur in der einfachen Vorstellung einer geschlossenen, national agierenden Volkswirtschaft gibt es den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Herstellung der Güter, den damit erwirtschafteten Einkommen sowie dem Konsum durch erhaltene Löhne, Gewinne und Pachten.
In einer globalen, nicht national organisierten Wirtschaft sichert hingegen nur die Fähigkeit, für die erstellten Güter hohe Preise am Markt zu erzielen, ein hohes Lohnniveau und damit Wohlstand für ein Land und seine Bürger. Voraussetzung für hohe Preise und hohes Einkommen sind wiederum ein hohes technologisches Niveau und hohe Produktivität, die nur durch den Zugang zu den dafür notwendigen Rohstoffen und mit ausreichender Energie erreicht werden kann. Gerät der technologische Vorsprung in Gefahr, sei es durch mangelnde Bildung, Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, schwindende Standortqualität oder eingeschränkten Zugang zu Beschaffungs- und Absatzmärkten, gerät auch der Wohlstand in Gefahr, und das Gesellschaftssystem droht zu kollabieren.
Nie zuvor in der menschlichen Geschichte war Arbeit humaner und war der Wohlstand höher. Jedenfalls in den technologisch früh entwickelten Ländern. Die immer komplexeren Organisationen in den Unternehmen und den Staaten führten im Verlauf der Entwicklung dazu, dass immer mehr Menschen sich indirekten Aufgaben widmeten. Etwa Aufgaben der Bildung, der inneren Sicherheit, des Rechtswesens, der politischen Führung der Kultur oder der Wissenschaft. Oder Aufgaben, die zu früheren Zeiten in Familien geleistet wurden. Immer größere Teile der Bevölkerung leben zudem von Transfereinkommen und hatten nie oder schon lange Zeit keinen Kontakt zu jeglichen Formen der Einkommenserzielung. Diese Ferne zu direkten Aufgaben des materiellen Überlebens sind der Humus, auf dem lebensferne Ideen des sozial-ökologischen Umbaus oder der Bewältigung der Transformation der Gesellschaft durch falsche Vorstellungen und daraus abgeleiteten politischen Zielen gedeihen.
Die politischen Führungskräfte des technologisch hochentwickelten Westens stehen vor einer Herkulesaufgabe. Sie müssen ihre Bürger darauf vorbereiten, dass das Verteidigen ihres Wohlstands in Zukunft größter Anstrengungen bedarf. Es ist die Transformation der Gesellschaften, der Nationen. Transformationsprozesse sind nicht neu. Einzigartig ist die Gleichzeitigkeit der Herausforderungen, verbunden mit der Wucht einzelner Veränderungen. Diese Gleichzeitigkeit beruht allerdings zu einem Teil auf eigenem Verschulden. Der heraufziehende Klimawandel war absehbar und noch deutlicher die Alterung der Gesellschaften. Offensichtlich wurde immer der Gegenwart der Vorzug gegeben. Der unheilvolle Überfall Russlands auf die Ukraine und das rücksichtslose Erpressen der Weltbevölkerung bei Energie und Nahrungsmitteln durch Putin zeigen deutlich, wie die Menschheit weltweit aufeinander angewiesen und wie fragil die Lebensbasis der mittlerweile acht Milliarden Menschen tatsächlich ist.
Die mangelnde Kenntnis über die wirtschaftlichen Faktoren, die den Wohlstand in den technologisch fortgeschrittenen Ländern ermöglicht haben und sichern können, ist die größte Hürde für die Transformation der Nationen. Insbesondere die Einstellung auf die zunehmende globale Konkurrenz. Die Notwendigkeit, die Kräfte für den zunehmenden weltweiten Wettbewerb zu bündeln, kommt zudem zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Denn tatsächlich müssen vor allem die technologisch fortgeschrittenen Länder einsehen, dass sie nicht weiter wirtschaften können wie bisher. Die Einsicht, dass die Nutzung fossiler Rohstoffe als primäre Energieträger die Erde erwärmt und die Zukunft der Menschheit bedroht, ist nicht zu leugnen. Dazu kommen die Umweltverschmutzung und das Artensterben. Die Umstellung auf CO2-freie Energieerzeugung, eine ressourcenschonende Produktion durch Kreislaufwirtschaft und die Vermeidung der Übernutzung unseres Planeten sind unabdingbar. Zu dieser Umstellung auf ein Ressourcen schonendes Wirtschaften kommt der Fakt, dass viele Gesellschaften altern. Auch in Europa und insbesondere in Deutschland. Dadurch sinkt das Arbeitskräftepotenzial insgesamt, während gleichzeitig die finanzielle Belastung der Nationen durch Renten, Pflegekosten und Gesundheitskosten steigt. Die Rahmenbedingungen verschlechtern sich also oder sind zumindest herausfordernder.
Die Transformation zu meistern, d. h. unter den erschwerenden Rahmenbedingungen des CO2-freien Wirtschaftens und der Überalterung der Gesellschaften, dürfte den Europäern besonders schwerfallen. Der vor allem von ihnen selbst gepriesene dritte Weg des Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, hat statt der Dominanz der Eigenverantwortung den Ruf nach dem Staat gefördert. Die westeuropäischen Staaten haben sich mit enormen Fixkosten belastet. Diskussionen um die Vier-Tage-Woche und eine insgesamt geringere Arbeitsbelastung bei gleichem Lohn sind vor allem Phänomene in Europa. Sie zeigen, dass die Herausforderungen der Zukunft entweder negiert oder nicht verstanden werden. Das bedeutet nicht, dass Europa nicht prinzipiell in der Lage wäre, die künftigen Herausforderungen zu meistern. Ein immer noch hoher Bildungsstandard, führende Forschung auf diversen naturwissenschaftlichen Gebieten, Rechtssicherheit und eine trotz jahrzehntelanger Vernachlässigung immer noch weitgehend intakte Infrastruktur sind gute Voraussetzungen.
So reiht sich das vorliegende Buch keineswegs in die Reihe der Untergangspropheten ein. Vielmehr geht es darum, die Realität des globalen Wirtschaftens und die Bedeutung dieses globalen Wirtschaftens für die Nationen darzustellen. Beim Umgang mit dem globalen Wettbewerb werden andere Wege aufgezeigt, als sie in gültigen makroökonomischen Modellen und gesamtwirtschaftlichen Rechnungen dargestellt werden. So soll ein Fundament des Verständnisses geschaffen werden, auf dem die Transformation gelingen kann. Die Vermittlung der Kenntnis weltweiten Wettbewerbs und der Einbettung nationaler Wertschöpfung in dieser globalen Wirtschaft ist zentraler Inhalt des Buches und nimmt quantitativ den größten Raum ein.
Nach der Einleitung werde ich die Herausforderungen, die auf uns zukommen, näher beleuchten. In Teil II befasse ich mich mit globalen Märkten und ihrer Bedeutung. In Teil III geht es um die Wirtschaft der Nationen. Insbesondere die Wertschöpfung, das Einkommen und die Arbeit werden auf eine neue Grundlage gestellt. Da mir vor allem die Daten zu Deutschland zugänglich und bekannt sind, werde ich diese vornehmlich in Beispielen verwenden. Mit seiner internationalen wirtschaftlichen Verflechtung ist Deutschland dafür gut geeignet. Soweit nicht explizit erwähnt, gelten Analysen und Konsequenzen sinngemäß für alle technologisch hoch entwickelten Länder der westlichen, demokratisch organisierten Länder.
Nicht nur das Verständnis von Wirtschaft im Allgemeinen, sondern auch das Verständnis davon, was Geld, Kapital und Schulden bedeuten und welche Funktion sie jeweils haben bzw. welche Risiken sie jeweils bergen, ist wichtig. Damit befasse ich mich in Teil IV. Wenn die Grundlagen und Parameter wirtschaftlicher Zusammenarbeit in einer globalen Welt im Allgemeinen und die Grundlagen des Wohlstands im Besonderen herausgearbeitet sind, ist das Fundament geschaffen, auf der die Transformation der Nationen erfolgen kann. Die Bewältigung der Transformation ist eine vornehmlich politische Aufgabe, bei der es insbesondere darum geht, die Bevölkerung mitzunehmen. Im vorliegenden Buch geht es bei gleichlautendem Titel um das wirtschaftliche Fundament, auf dem diese Transformation erfolgt und gelingen kann.
Anmerkungen
1
.
In 2021 fiel die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien wegen geringen Windeintrags auf 41 %. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Die Energiewende, Erneuerbare Energien 2021,
www.bmwk.de
, abgerufen am 23.10.2022
2
.
Energieverbrauch Deutschland 2021: Primärenergieträger & Strommix, Tech for Future,
www.tech-for-future.de
, abgerufen am 5.09.2022
3
.
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Bruttoinlandsprodukt (BIP), Statistisches Bundesamt,
destatis.de
, abgerufen am 5.09.2022, kursive Hervorhebung vom Autor
4
.
Raworth, Kate, Die Donat Ökonomie, Hanser Verlag, München 2018, S. 45
5
.
Bundesministerium für Finanzen, Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten,
bundesfinanzministerium.de
., abgerufen am 5.09.2022, vgl. auch
sozialpolitik-aktuell.de
, abgerufen am 5.09.2022
6
.
»Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich«, Bundesfinanzministerium, in: Handelsblatt vom 24.07.2023, S. 8/9
7
.
ebenda
8
.
Siehe Berechnung in
Teil III
, 8.2, S. 158 ff.
9
.
Britischer Ökonom, der die Finanzpolitik als Instrument der Konjunkturpolitik etablierte
2Die multiplen Herausforderungen
Das letztjährige Weltwirtschaftsforum in Davos stand unter dem Motto »Kooperation in einer fragmentierten Welt«. Vom Rückzug der Globalisierung war die Rede. Die Wirtschaftspolitik müsse sich der Geopolitik unterordnen. Der häufig gehörte Spruch von der Dominanz der Wirtschaft über die Politik war allerdings schon immer eine Farce. Festgemacht wurde die Aussage meist am Lobbyismus der Wirtschaftsvertreter und dem daraus abgeleiteten Einfluss auf die Politik. Ganz dem Imperativ der Kapitalismuskritiker folgend wurde der Lobbyismus der Sozial- und Umweltverbände, der Kirchen und vieler anderer Interessenvertreter, wenn schon nicht unterschlagen, dann aber zumindest für gerechtfertigt erklärt. Einfluss auf die Politik nehmen also viele Interessengruppen. Daraus ergibt sich aber nicht zwangsläufig eine Dominanz der Interessenvertreter über die Politik.
Die politischen Machthaber formulieren die Gesetze und bestimmen die Regelwerke, nach denen sich ihre Bürger und auch die Wirtschaft zu verhalten haben. Sie besitzen die physische Macht von Polizei und Militär und setzen sie im böswilligen Fall gegen die eigene Bevölkerung ein. Der Staat eignet sich erhebliche Anteile am Volkseinkommen an, um sie anschließend nach eigener Anschauung zu verwenden oder an die Bevölkerung zurückzuverteilen. Das ist ein ungeheures Machtpotenzial. Das derzeitige geopolitische Fingerhakeln bringt die Dominanz der Politik über die Wirtschaft nur wieder in das allgemeine Bewusstsein zurück. Sie ist aber nichts Neues. Wer nicht Augen und Ohren verschließt, stellt fest, dass die Geschichte voller Beispiele ist, in denen politische Macht und Willkür die wirtschaftliche Basis ihrer Bürger zerstört hat. Politik hat seit jeher einen massiven, nicht selten destruktiven Einfluss auf die Wirtschaft. Die dezentrale Machtverteilung marktwirtschaftlich organisierter Systeme ist demokratischer als viele politische Systeme.
Die wachsende weltweite Konkurrenz und der holprige Weg Europas
Jahrzehnte lang konnte die westliche Welt alle Vorteile der Globalisierung für sich nutzen. Die freien Märkte, die fossile Energie, die Rohstoffe, die billigen Arbeitskräfte. Das, was jetzt entstanden ist, ist schlicht Konkurrenz. Die entstand nicht von heute auf morgen. Nur hat Putins Entscheidung, Russlands Energiereichtum als strategisches Machtmittel einzusetzen, indem er sich weigert, dem Westen weiterhin unbeschränkt Zugriff darauf zu gewähren, schlagartig die Abhängigkeit des Westens von Energie in deren Bewusstsein gebracht. Was, wenn andere, vor allem China, auf ähnliche Ideen kommen? Etwa den Zugriff auf seltene Erden zu verweigern oder zu reglementieren? Oder den Markt deutlich stärker abzuschotten? Neu ist das Potenzial zunehmender Konkurrenz nicht. In der digitalen Welt hat China massiv aufgeholt. Bei 5G, der nächsten Generation der Datenübertragung hat Huawei längst die Nase vorn. Dem Risiko, dass der chinesische Staat unbegrenzten Zugriff auf die Daten bekommen könnte, stellen sich nur die USA und England konsequent entgegen. China mag derzeit der größte Konkurrent aus Fernost sein. Aber es ist längst nicht der einzige. Indiens Wirtschaft ist erwacht und macht Fortschritte. In Südostasien leben mit rund 700 Mio. Menschen bereits deutlich mehr Menschen als in Europa oder den USA. Deren politische Führer wollen ihre eigene Bevölkerung stärker am Fortschritt partizipieren lassen und dem Westen nicht allein die Märkte und den Zugriff auf die weltweiten Rohstoffe überlassen. Sie wollen selbst produzieren und damit ihrer Bevölkerung Wertschöpfung und Wohlstand ermöglichen. Mit dem zunehmenden Wohlstand immer größerer Teile der Weltbevölkerung steigt die Konkurrenz um die Ressourcen der Welt und damit werden auch die Preise langfristig ansteigen. Der zunehmende weltweite Wohlstand bietet aber auch Chancen für alle, indem er weitere Absatzmärkte schafft.
Die Länder des Westens sehen allerdings vor allem die Risiken gestörter Lieferketten und damit einen Angriff auf den Wohlstand ihrer eigenen Länder. Sie werten die daraus resultierende Gefahr für den Wohlstand und ihre eigene Macht höher als die Chancen größerer Absatzmärkte. Im Moment wirkt die Politik, insbesondere in Europa, desorientiert. Ein staatliches Programm jagt das andere. Die Wirtschaft braucht keine Mission-Statements aus der Politik. Die Themen sind längst gesetzt und allgemein bekannt. Digitalisierung, insbesondere KI, neue Materialien, intelligentere Ressourcennutzung, Klima- und Umweltschutz, Biotechnologie, weltweite Nahrungsmittelversorgung, Alternativen zum Fleischverzehr, neue Formen der Mobilität usw. Es ist grundsätzlich nicht falsch, wenn die Politik diese Prozesse durch finanzielle Förderung und den Abbau bürokratischer Hürden unterstützen will. Das Problem ist nur, dass die potenziell vorhandenen finanziellen Mittel längst anderweitig ausgegeben wurden und Unterstützung in der Politik immer nur neue Schulden bedeutet. Und die Verfügung über diese Mittel gehen, jedenfalls in Europa, nicht mit weniger, sondern mit mehr Bürokratie einher.
Europa hat ein weiteres Problem. Während den Weltmächten USA und China sowie ihren Bürgern bewusst ist, dass Innovationen und Wertschöpfung Voraussetzung für prosperierende Nationen sind, ist diese Einsicht in Europa weitgehend verkümmert. Im ökologisch-sozialen Umbau als neue Zielsetzung vieler Länder Europas und bei der EU-Führung ist vom Willen wirtschaftlicher Führung wenig zu spüren. Mit dem »Green-Deal-Industrial-Plan« die Wettbewerbsfähigkeit der Europäer zu verbessern,1 wird das jedenfalls schwierig sein. Schon die Bezeichnung deutet auf die begrenzte Zielsetzung hin, über CO2-freies Wirtschaften und Nachhaltigkeit technologische Führung zu definieren. Abgesehen davon, dass China in wichtigen Bereichen wie Photovoltaik und Windenergie längst die Nase vorn hat, umfasst Wettbewerbsfähigkeit viel mehr als nur den Umbau der Industrie auf Klimaneutralität.
Klima- und Umweltschutz sind notwendige Bedingungen künftigen Wirtschaftens, aber kein Merkmal einer wirtschaftlichen Führung. Sicher ergeben sich auch auf diesem Gebiet wirtschaftliche Chancen. Bei den Klimatechnologien führend zu sein, reicht aber längst nicht, beim weltweiten Wettbewerb bei Zukunftstechnologien und auf künftigen Märkten die Nase vorn zu haben. Und wie bei den definierten Klimazielen so zeigt sich auch bei der von der Politik geforderten Industriepolitik ein weiteres Merkmal. Die von der Politik und Teilen der Ökonomen geforderte Führungsrolle des Staates. Das aber ist der falsche Weg. Wer glaubt, diese Einschätzung mit dem Erfolg des Staatskapitalismus in China begründen zu können, irrt. Den technologischen Vorbildern im Westen nachzueifern, war eine einfache Rolle der politischen Führung Chinas. Die Führung zu übernehmen, ist deutlich anspruchsvoller. Die falsche Corona-Politik und die Bevormundung der Wirtschaftsführer zeigen, wie schnell die politische Führung den falschen Weg beschreiten kann. China ist nicht deshalb ein ernst zu nehmender Wettbewerber für Europa und die USA geworden, weil die Strategie der Politik, Wachstum in erster Linie durch die Förderung von Wohnraum und Infrastruktur zu erzeugen, so erfolgreich gewesen wäre. China ist zu einem Wettbewerber avanciert, weil es zunächst als Werkbank der Welt Millionen von Arbeitskräften qualifizieren konnte und weil die Politik freies Unternehmertum zugelassen hat. Die Sehnsucht der Menschen nach Erfolg und individuellem Wohlstand hat China im Wettbewerb mit einem vergleichsweise trägen Westen in vielen Fällen gleich auf die Überholspur gebracht. Die derzeit exponentiell fortschreitende Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt, der Umstieg auf die Elektromobilität und auf erneuerbare Energien wie Photovoltaik und Windenergie könnte man zudem als günstige Umstände oder das Glück des Tüchtigen begreifen. Aber nicht nur das. China hat zudem Schlüsseltechnologien besetzt bzw. sich Förderung und Veredlung seltener Metalle gesichert, ohne die technologischer Fortschritt heute nicht möglich ist. China hat sich neue Handelswege geschaffen und Zugriff auf die Rohstoffversorgung der Förderländer erlangt. China mag zurzeit der größte Wettbewerber für die technologisch führenden Länder der freien Welt sein. Aber es ist eben nicht nur China. Auch andere aufstrebende Länder wollen sich künftig größere Teile der Wertschöpfung bei der Herstellung von Gütern sichern. Indonesien hat schon deutlich Anspruch auf mehr Wertschöpfung bei der Aufarbeitung geförderter Rohstoffe formuliert. Das Gleiche gilt für die Länder Südostasiens wie etwa Vietnam. In der Summe wird die Konkurrenz weltweit härter. Der Platz an der Sonne ist nicht weiter für den Westen reserviert.
Für Europa war nach dem Desaster um Masken und Schutzkleidung in der Corona-Krise der Stopp der Gaslieferung durch Putin der zweite, deutlichere Weckruf für die Gefährdung von Wirtschaft und Wohlstand. Die Reaktion der Politik in Europa ist allerdings die übliche. Neue schuldenbasierte Programme der Nationen und der EU, sowohl zur Überwindung der Corona-Krise als auch mit den bekannten Zielen wie der Beschleunigung beim Bau neuer Windparks und Batteriefabriken. Das alles ist nicht neu und es sind Ziele des ohnehin Notwendigen. Aber für die EU gleich wieder Anlass für die Forderung nach einem »Souveränitätsfonds«, der jetzt in einen Technologiefonds umgewidmet werden soll.2 Der Souveränitätsfonds bzw. Technologiefonds soll die Antwort der Europäer auf den Inflation Reduction Act der USA sein. Es wird so getan, als hätten die USA das Subventionsrennen eröffnet und als wären Subventionen nicht gerade ein Merkmal der Europäer. Der wirkliche Grund für den Vorteil der USA liegt indes an den weniger bürokratischen Vergaben, den niedrigeren Energiekosten und vor allem daran, dass die amerikanische Politik es den Unternehmen und Unternehmern überlässt, die eingesetzten Mittel zum unternehmerischen Erfolg zu führen. Jedoch mit der Vorgabe, angemessene Teile der Wertschöpfung im eigenen Land zu erzeugen. In Europa indes wollen die Politiker nicht nur mitreden, sondern vorgeben, was genau mit den Mitteln zu geschehen hat. Damit wollen sie nicht nur ihre eigene Bedeutung unterstreichen, sondern lassen die Bürokratie hochleben. In dieser Einstellung liegt die eigentliche Ursache, sich um die Zukunftsfähigkeit Europas Sorgen zu machen.
Geld geben Europas Politiker wahrlich genug aus. Allein Deutschland braucht für seine soziale Sicherung 70 Milliarden – Monat für Monat.3 In den anderen europäischen Ländern sieht es ähnlich aus. Für soziale Ausgaben ist also immer Geld da. Nur nicht für die Sicherstellung künftiger Einnahmen.
Staatshaushalte heißen nicht zufällig Haushalte. Wie private Haushalte haben sie im Vergleich zu Unternehmen recht stabile Einnahmen und Ausgaben. Im Gegensatz zu Unternehmen haben Staaten jedoch keine Möglichkeiten, die Einnahmen schnell und massiv zu steigern. Sie müssen daher mit ihren Ausgaben haushalten. Allerdings müssen sie ihre Einnahmen langfristig sichern, wenn sie die überwiegend fixen Ausgaben künftig decken wollen. Technologisch fortgeschrittene Länder brauchen globalen Handel, globale Wertschöpfungsketten, globale Arbeitsteilung und globale Ressourcen wie die Luft zum Atmen. Jedoch sind die Vorteile der Globalisierung nicht mehr für den wohlhabenden Westen reserviert. Der Wettbewerb wird härter. Markige Sprüche, viel Geld und Bürokratie werden das Problem für Europa nicht lösen. Während ChatGPT, der Chatbot von Open-AI, den Wandel von KI zu einer Grundlagentechnologie für die Allgemeinheit eingeläutet hat, hat LEAM (Large European AI Models) am 24. Januar 2023 eine Machbarkeitsstudie vorgelegt.4 Das Scheitern von TTIP, Vorbehalte gegen die Gentechnik und das Abschalten der CO2-freien Erzeugung von Strom in Atomkraftwerken sind Signale dafür, dass Europa die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt hat.
Klimawandel und Umstieg auf erneuerbare Energien
»Follow the Science« ist der Slogan der Klimaaktivisten. Gemeint sind damit die Wissenschaftler, die vor den Folgen der Erderwärmung warnen und fordern, sie zu bremsen. Zielsetzung ist dabei die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gemäß der Vereinbarung des Pariser Klimaabkommens. Daraus leiten viele Klimaaktivisten, auch im Verein mit Teilen der Wirtschaftswissenschaft, den radikalen Umbau der Art, wie wir heute wirtschaften, ab. In erster Linie gilt das für die Art der Energieerzeugung und den Energieverbrauch, sowohl für die Industrie als auch die privaten Haushalte. Regelmäßig gilt der geforderte Umbau aber auch für das marktwirtschaftlich organisierte Wirtschaftssystem selbst, das sie als Kapitalismus bezeichnen. Denn dieses Wirtschaftssystem des Kapitalismus erfordert nach Meinung der Klimaaktivisten Wachstum und ist für den enormen Ressourcenverbrauch, d. h. für die fossile Energie als auch die Rohstoffe und die Umwelt – Nutzung von Land, Biomasse als auch für die Abfallentsorgung – verantwortlich. Der Denkfehler besteht darin, den Konsum oder Verbrauch an Gütern und Energie, Rohstoffen und Umwelt durch die Gesellschaften sowie den Wachstumswillen der Politik als Merkmal des Wirtschaftssystems anzusehen anstatt als Charakteristikum technologisch fortgeschrittener Nationen.
Aus der Agenda 2030 der UN, in der die Weltgemeinschaft 2015 die 17 Nachhaltigkeitsziele formuliert hat, leiten Länder wie Deutschland die sozial-ökologische Marktwirtschaft ab. Das Wirtschaften der Nationen soll nicht nur finanzwirtschaftlichen Zielen folgen, sondern gleichzeitig eine Wirtschaftsordnung sein, die ökologisch und sozial ausgerichtet ist. Durch das ab 2023 in Deutschland gültige Lieferkettengesetz werden diese Ziele auf die gesamte Wertschöpfungskette ausgedehnt. Betrachten wir zunächst die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft auf ein CO2-freies Wirtschaften.
Bei der Beurteilung des bereits erreichten Fortschritts beim Umbau auf das CO2-freie Wirtschaften beziehen sich Skeptiker auf die verbrauchte Primärenergie. Der Anteil erneuerbarer Energieträger liegt dort bei nicht viel mehr als 10 %. Befürworter kritisieren, dass der Primärenergieverbrauch wegen des deutlich unter 100 % liegenden Nutzungsgrades etwa bei der Kohleverstromung oder bei der Herstellung von Kraftstoffen aus Öl deutlich höher sei als der Endenergieverbrauch. Dieser beträgt nur knapp 70 % des Primärenergieverbrauchs. Entsprechend geben die Befürworter mit 19 % einen deutlich höheren Anteil der erneuerbaren Energieträger für Deutschland an.
In der Tat ist ein objektiver Vergleich diffizil. Im Jahr 2017 etwa betrug der Primärenergieverbrauch 13 594 PJ. Der Endenergieverbrauch war hingegen mit 9327 PJ über 4000 PJ geringer.5 Mit Gas, Öl, Kohle oder Kernkraft betriebene konventionelle Kraftwerke erhitzen mit Hilfe der genannten Energieträger Wasser, bis es in Dampf übergeht und eine Turbine antreibt, die über einen Generator Strom erzeugt. Der Energieinhalt des erzeugten Stroms ist um die für den Stromerzeugungsprozess benötigte Energie geringer. Ähnlich sieht es bei der Umwandlung des Energieträgers Öl mittels Raffinierung in Heiz- oder Kraftstoffe aus. Die mit Hilfe von Solar- oder Windkraftanlagen erzeugte Energie geht hingegen in Höhe des eingespeisten Stroms in die Energiebilanz des Endenergieverbrauchs ein. Der Jahreswirtschaftsbericht 2023 des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für Deutschland bezieht sich auf den Endenergieverbrauch und gibt der Anteil der erneuerbaren Energie von 19 % aus.6 Der Weg zur CO2-freien Wirtschaft ist also demnach bereits deutlich weiter fortgeschritten, als der Anteil bei der Primärverbrauchsbilanz ausweist.
Aber so einfach ist die Sache nicht. Erstens ist in dem Anteil von 19 % für erneuerbare Energien auch Energie aus Biomasse enthalten. Die Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion, etwa beim Anbau von Mais für Biogasanlagen, wird einer ausgedehnteren Nutzung jedoch schnell Grenzen setzen. Wenn, wie in Deutschland, die CO2-freie Nutzung aus Atomenergie abgelehnt wird, bleiben nur die Windenergie und die Solarenergie als maßgebliche CO2-freie Energieträger übrig. Die Nachteile von Wind- und Solarenergie sind allerdings erheblich. Gilt für die fossile Energie der Nutzungsgrad, der den Unterschied zwischen dem Einsatz von Primärenergie und der genutzten Endenergie ausmacht, so gelten für Wind und Sonne die Intensität und die Nutzungsdauer. Fatalerweise sind auf der nördlichen Erdhalbkugel, insbesondere nördlich des 48-zigsten Breitengrades, also in Deutschland, die Tage im Winter, der Heizperiode, am kürzesten. Die Sonne steht schräg und hat wenig Zeit, Energie in den Solaranlagen zu erzeugen. Die Sonne hat auch wenig Zeit, die Erde aufzuheizen, so dass Wind aus Thermik ebenfalls rar ist, auch wenn gelegentlich Winterstürme auftreten. Genau in der Zeit, wenn mehr Strom durch die kurzen Tage und den Aufenthalt der Menschen in Innenräumen besonders gebraucht wird, ist die Nutzungsdauer der Stromerzeuger Wind und Solar also besonders gering.
Betrachten wir einen aktuellen Zeitraum. Die installierte Leistung für die Stromerzeugung betrug 2022 in Deutschland 238,3 Gigawatt.7 Davon entfielen 55,3 % auf die Solar- und Windenergie (Onshore und Offshore). Der erzeugte Strom betrug 2022 in Deutschland insgesamt 491,8 Terrawattstunden.8 Davon entfielen 36,8 % auf Windkraftanlagen. Eine Differenz von 18,5 Prozentpunkten zur installierten Leistung oder ein Nutzungsdefizit von 33 % bei der Windenergie. Die Solarenergie lieferte mit 11,7 % sogar nur 43 % der installierten Leistung. Und das sind nur die Durchschnittsdaten. Am 25.01.2023 z. B. lieferte die Solarenergie sogar nur 2 %. Nur 2,5 % der installierten Leistung. Windenergie trug knapp 9 % zum Stromverbrauch bei. Nur 10 % der installierten Leistung.9 Vor allem die Kohle- und Gaskraftwerke mussten einspringen. Entsprechend schlecht sah die CO2-Bilanz Deutschlands an diesem Tag aus. Während also der Nutzungsgrad bei fossiler Energieerzeugung in die Rechnung einbezogen wird, wird die Nutzungsdauer der erneuerbaren Energien nicht als Delta zwischen Primärenergie oder installierter Leistung und Endenergieverbrauch berücksichtigt. Die Kosten fallen dort jedoch auch für die installierte Leistung an und ebenso der dabei erzeugte CO2-Ausstoß.
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass bisher nur von der Stromerzeugung und vom Stromverbrauch die Rede war. Mit Strom wird bisher aber nur rund 30 % des Primärenergiebedarfs abgedeckt. Dieser Anteil wird jedoch deutlich steigen. Am Ende, so die Vorstellung der Politik, soll sämtliche genutzte Energie aus erneuerbaren Energieträgern in Form von Strom kommen. Die Umstellung von Verbrennerfahrzeugen auf die mit Elektromotor betriebenen Autos und der Einbau von Wärmepumpen werden vom Staat entsprechend gefördert. Auch die Herstellung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen wird zusätzliche Stromerzeugung erfordern. Schon 2030 soll der Bruttostromverbrauch 750 TWh betragen. Fünfzig Prozent mehr als 2022. Davon sollen 600 TWh aus erneuerbaren Energien kommen.10 Zusammen mit Wasserkraft und Biomasse produzierten die erneuerbaren Energien 2021 in Deutschland 225 TWh. Bedenkt man, dass die 63 TWh aus Biomasse und Wasserkraft nur begrenzt steigerungsfähig sind, und nimmt der Einfachheit halber an, dass diese Energieträger 2030 in Deutschland rund 100 TWh liefern können, müssen Wind- und Solarenergie 500 TWh beisteuern. Das ist mehr als doppelt so viel, wie diese Energieanlagen 2022 erzeugt haben. Für die heute installierte Leistung brauchte Deutschland rund dreißig Jahre und es bedurfte massiver Förderung. In den sieben Jahren bis 2030 soll nun mehr Kapazität an Solar- und Windenergie installiert werden als in den dreißig Jahren zuvor. Mehr als 4000 neue Windräder pro Jahr. Derzeit werden rund 500 neue Windräder pro Jahr installiert.
Was sind nun die ökonomischen Auswirkungen dieser geplanten Umstellung? Auch ein deutlich erhöhter Anteil der erneuerbaren Energie wird nicht verhindern, dass parallel Back-up-Lösungen vorhanden sein müssen. Je höher der Stromanteil am gesamten Primärenergieverbrauch, umso mehr Back-up-Energiebereitschaft durch konventionelle Kraftwerke muss vorhanden sein. Denn wie am 25.01.2023 beispielhaft erlebt, kann der Anteil erneuerbarer Energie nahe Null sinken. Diese doppelte Energiebereitstellung verteuert die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen. Dazu kommt der ungeheure Materialbedarf. Die geringe Energiedichte der Stromerzeugung durch Wind- und Solaranlagen kann man nur durch Materialeinsatz ersetzen. Um ein mittleres Kernkraftwerk, das 11 TWh erzeugt, zu ersetzen, braucht es fast 3000 Windkraftanlagen. Allein das Fundament aus Beton ist 1000to schwer. Deren Herstellung ist bisher extrem klimaschädlich. Die Gondel wiegt 700to und die drei Flügel wiegen noch einmal 200to.11 Zusammen mit dem Turm über 2000to. Mehr als 6 Mio. Tonnen Material für den Ersatz eines einzigen Kraftwerks. Bei Solaranlagen sieht es sogar noch schlechter aus. Für Stahl, Glas und sonstige Materialien wie Silizium ist der Materialbedarf je TWh noch rund 50 % höher.12 Hinzu kommt der exorbitante Flächenbedarf. Für die rund 3000 Windkraftanlagen als Ersatz für ein Kernkraftwerk von rund 1,4 qkm Fläche beträgt der Flächenbedarf 750 qkm, wenn man den notwendigen fünffachen Rotordurchmesser zwischen den Anlagen berücksichtigt, damit diese sich nicht gegenseitig den Wind wegnehmen. Diese Nettoflächenberechnung ist zudem eine Illusion. Denn die Windkraftanlagen stehen nicht kompakt. Vielmehr sind Abstandsflächen zu bebauten Gebieten zu berücksichtigen und zudem sind die Standorte vom Interesse der Investoren und lokalen Kommunen abhängig. Berücksichtigt man dann noch besiedelte Flächen, Gewerbegebiete, Infrastruktur und nicht bebaubare Naturschutzgebiete, so sind die windreichen Gegenden an der See und in den Mittelgebirgen heute schon mit Windkraftanlagen bestückt, soweit das Auge reicht.
Aber nicht nur die Bereitstellung der erneuerbaren Energie und des notwendigen Back-ups macht die Energieerzeugung teuer. Der hohe Aufwand an Material, Personal und Kapital zum Ersatz bisher importierter billiger fossiler Energie reduziert das Potenzial an Wertschöpfung, das durch die Produktion von Gütern am Standort Deutschland erzeugt werden kann. Zudem ist nicht klar, wie viel Wertschöpfung aus der Bearbeitung (Raffinerien) und dem Transport von fossiler Energie wegfallen. Auch gehen Zehntausende von Arbeitsplätzen in der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie verloren, weil die vielen Komponenten für Verbrenner nicht mehr benötigt werden. Es ist deshalb fahrlässig von der Politik, den Umstieg von fossiler auf erneuerbare Energieträger pauschal als Wert schöpfend sowie Wachstum und Wohlstand fördernd zu propagieren.
Vor allem ist der Umstieg auf erneuerbare Energieträger ein Risiko für technologisch fortgeschrittene Nationen. Konventionelle Kraftwerke liefern zuverlässig Energie. Vor allem, wenn der Energieträger, wie Kohle, aus dem eigenen Land kommt. Es ist deshalb erstaunlich, wie einerseits apokalyptische Szenarien aufgezeigt werden, die ein totaler Stromausfall von nur wenigen Tagen für ein technologisch fortgeschrittenes Land wie Deutschland verursachen würde. Und andererseits werden stabile Energieerzeuger vom Netz genommen und sollen in ihrer Gesamtheit durch hoch volatile Stromerzeuger ersetzt werden. Mit dem Umbau hält zudem die Netzverteilung wegen der überall neu entstehenden dezentralen Energiequellen nicht Schritt. Entsprechend plant die Bundesnetzagentur, die Stromversorgung von Wärmepumpen und Ladestationen zu rationieren.13 Wie aber kommt der Chirurg morgens an den OP-Tisch, wenn sein Stromer nicht mehr die nötige Reichweite hat, um nur ein Beispiel zu nennen. Vermutlich würde die Politik wieder mit mehr Bürokratie und Tausenden Ausnahmeregelungen für systemrelevante Berufe reagieren, zu denen nicht nur die Feuerwehrleute, Ärzte und Pflegepersonal gehören. Die Bedeutung des Individualverkehrs für das Funktionieren für Wirtschaft und Gesellschaft wird sträflich unterschätzt und zu Unrecht verteufelt. Denn in keinem Land der Welt sind alle Berufsbilder und die Summe der Beschäftigten so nahe an Arbeitsplätzen von Großbetrieben, Kliniken usw. gruppiert, dass der ÖPNV diese Beschäftigten in angemessener Zeit zum Arbeitsplatz oder Einsatzort bringt. Jedenfalls so lange nicht, bis autonom fahrende Fahrzeuge mit selbst lernender KI in der Lage sind, die Beschäftigten an verschiedenen Wohnorten einzusammeln und in angemessener Zeit zum Arbeitsplatz oder Einsatzort zu bringen.
Auch der kontrollierte Lastabwurf, bei dem Großverbraucher wie Aluminiumhütten und ähnliche Industriezweige gezielt vom Netz genommen werden, ist nicht geeignet, die Wertschöpfung im Land zu stabilisieren. Es ist daher völlig unverständlich, dass in Deutschland für die sechs noch vorhandenen Kernkraftwerke nicht neue Laufzeiten vereinbart werden, um zuverlässig CO2-freien Strom zu erzeugen. Unabhängigkeit von Lieferländern und Resilienz sind derzeit propagierte Zielsetzungen. Bei einem für Wertschöpfung und Wohlstand unverzichtbaren Produktionsfaktor wie der Energie geschieht in Deutschland gerade das Gegenteil. Dabei sind neue Abhängigkeiten von Lieferländern für Rohstoffe, die für die Solar- und Windenergie notwendig sind, etwa die derzeitige Abhängigkeit von China, überhaupt noch nicht ins Kalkül einbezogen. Während die meisten Länder der Welt technologieoffen sind bei der Umstellung von Wirtschaft und Gesellschaft auf erneuerbare Energieträger, ist Deutschland ideologisch geprägt. Viele Länder forschen an der Entwicklung von Kernenergie und nutzen diese als CO2