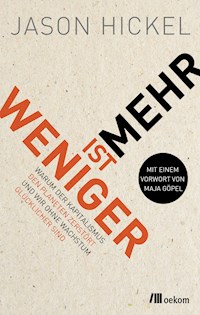24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
»Ein Buch voller Fakten, Zorn und Herzblut.« Anthony Loewenstein Seit Dekaden hören wir, Entwicklung hilft: Die südlichen Länder der Welt schließen zum reichen Norden auf, die Armut hat sich in den vergangenen 30 Jahren halbiert, bis zum Jahr 2030 ist sie verschwunden. Das ist eine tröstliche Geschichte, die von Politik und Wirtschaft gerne bestätigt wird. Aber sie ist nicht wahr. In Wirklichkeit hat sich die Einkommenslücke zwischen Nord und Süd seit 1960 verdreifacht, 60 Prozent der Weltbevölkerung verdienen weniger als 4,20 Euro am Tag. Armut ist kein Naturphänomen, sie wird gemacht. Der Autor entlarvt die Wachstumsideologie und zeigt auf, dass Armut ein politisches Problem ist, für das radikale politische Lösungen erforderlich sind. Voraussetzung ist eine Revolution im Denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Ähnliche
Jason Hickel
Die Tyrannei des Wachstums
Wie globale Ungleichheit die Welt spaltet und was dagegen zu tun ist
Aus dem Englischen von Karsten Petersen und Thomas Pfeiffer
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für die Verdammten dieser Erde
Vorwort: Anfänge
Ich bin in Swasiland aufgewachsen – ein kleines Binnenland nahe der südafrikanischen Ostküste, das an Südafrika und Mosambik grenzt. Es war in vielerlei Hinsicht eine glückliche Kindheit. Als kleiner Junge rannte ich mit meinen Freunden barfuß durch das sandige Grasland, ungehindert von Zäunen oder Mauern. Wenn der Monsunregen einsetzte, ließen wir kleine Rindenschiffchen die Dongas – Erosionsrinnen – hinabtreiben und freuten uns über das viele Wasser. Wir kletterten auf Bäume und pflückten Mangos und Litschis und Guaven, wann immer uns der Hunger überfiel. An langen Nachmittagen wanderte ich manchmal den Hügel hinter unserem Bungalow hinauf und folgte dem Feldweg bis zu der Klinik, in der meine Eltern als Ärzte arbeiteten. Ich kann mich noch gut an die Kühle der spiegelblanken Betonböden und den windigen Schatten des Innenhofes erinnern. Vor allem aber erinnere ich mich an die Schlange – die lange Schlange der Patienten, die sich aus dem Eingang der Klinik hinauswand, an die Menschen, manche auf Holzbänken, andere auf Grasmatten auf dem Boden sitzend, die darauf warteten, aufgerufen zu werden. Mir schien es damals so, als würde diese Schlange niemals enden.
Als ich etwas älter wurde, lernte ich Begriffe wie Tuberkulose und Malaria, Typhus und Bilharziose, Unterernährung und Kwashiorkor kennen – unheimliche Worte, die dennoch vertraut und in unserer Familie häufig zu hören waren. Noch später erfuhr ich, dass um uns herum die schlimmste HIV/Aids-Epidemie auf der ganzen Welt tobte. Die Menschen litten und starben an Krankheiten, die in wohlhabenderen Ländern leicht geheilt, verhütet oder behandelt werden konnten – eine Tatsache, die mich sprachlos machte vor Entsetzen. Und ich lernte die Armut kennen. Viele meiner Freunde kamen aus Familien, die als Kleinbauern auf ein paar Äckern ihren mageren Lebensunterhalt zusammenkratzten und in ständiger Angst vor der nächsten Dürre lebten oder die in notdürftigen Hütten in den Slums rund um Manzini lebten, die größte Stadt des Landes, und immer auf der Suche nach Arbeit waren.
Sie waren – und sind – nicht die Einzigen. Heute leben rund 4,3 Milliarden Menschen – über 60 Prozent der Weltbevölkerung – in auszehrender Armut und kämpfen darum, mit weniger als dem Gegenwert von fünf US-Dollar pro Tag zu überleben. Die Zahl der in absoluter Armut lebenden Menschen ist in den vergangenen Jahrzehnten beständig gestiegen – während zugleich Superreiche Vermögen auf einem historisch beispiellosen Niveau anhäufen. Zu dem Zeitpunkt, da ich diese Zeilen schreibe, hat die Meldung die Runde gemacht, dass die acht reichsten Menschen auf der Welt zusammengenommen ebenso viel Vermögen besitzen wie die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung.
Der Blick auf die unterschiedliche Einkommens- und Vermögensverteilung macht das ganze Ausmaß der globalen Ungleichheit deutlich. Einen noch genaueren Blick aber erhalten wir, wenn wir die Kluft zwischen den einzelnen Regionen der Welt betrachten. Im Jahr 2000 lag das Durchschnittseinkommen eines US-Bürgers rund neunmal höher als das der Menschen in Lateinamerika, 21-mal höher als das der Bewohner des Nahen Ostens und Nordafrikas, 52-mal über dem in Afrika südlich der Sahara und volle 73-mal über dem der Südasiaten. Und auch hier sind die Zahlen immer schlimmer geworden: Der Abstand zwischen dem realen Pro-Kopf-Einkommen im globalen Norden und dem im globalen Süden hat sich seit 1960 ungefähr verdreifacht.
Man könnte leicht den Eindruck gewinnen, die Kluft zwischen Reich und Arm habe schon immer existiert; dass sie sozusagen eine natürliche Eigenschaft der Welt ist. Allein schon das Bild von der Kluft könnte uns unabsichtlich zu der Annahme verführen, dass es einen Bruch – eine fundamentale Diskontinuität – zwischen der reichen Welt und der armen Welt gibt, so als wären sie voneinander getrennte ökonomische Inseln. Falls man, wie viele Wissenschaftler das getan haben, von dieser Annahme ausgeht, erklären sich die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen armen und reichen Ländern schlicht aus ihren jeweiligen inneren Eigenschaften.
Und auf ebendieser Annahme fußt die Geschichte über die globale Ungleichheit, die uns üblicherweise erzählt wird. Entwicklungshilfebehörden, NGOs und die mächtigsten Regierungen behaupten unisono, verantwortlich für das Los der armen Länder sei ein technisches Problem – ein Problem, das gelöst werden kann, wenn sie funktionierende Institutionen aufbauen, die richtige Wirtschaftspolitik verfolgen, hart arbeiten und sich ein bisschen unter die Arme greifen lassen. Würden die armen Länder nur dem Rat der Experten von Institutionen wie der Weltbank folgen, könnten sie Schritt für Schritt die Armut zurückdrängen und die Kluft zwischen Arm und Reich überwinden. Die Story ist wohlbekannt, und sie ist bequem. Wir alle haben zu dem einen oder anderen Zeitpunkt an sie geglaubt und nach ihr gehandelt. Sie erhält eine milliardenschwere Industrie und eine Armada an NGOs, Wohltätigkeitsorganisationen und Stiftungen am Leben, die die Armut durch Entwicklungshilfe und Wohltätigkeit auszumerzen versprechen.
Doch diese Story ist falsch. Die Vorstellung einer natürlichen Kluft zwischen armen und reichen Ländern führt uns von Anfang an in die Irre. Um 1500 herum bestand kein nennenswerter Unterschied in den Einkommen und im Lebensstandard zwischen Europa und dem Rest der Welt. In der Tat ging es, wie wir heute wissen, den Menschen in einigen Regionen des globalen Südens damals deutlich besser als ihren Zeitgenossen in Europa. Dennoch haben sich ihre Lebensstandards in den folgenden Jahrhunderten dramatisch auseinanderentwickelt – und das nicht aus sich selbst heraus, sondern wegen der jeweils anderen.
Wenn wir die Sache von dieser Warte aus betrachten, geht es weniger um die Frage nach den unterschiedlichen Eigenschaften von reichen und armen Ländern – obwohl das, natürlich, mit dazugehört –, sondern vielmehr um die Beziehungen, die zwischen ihnen bestehen. Die Kluft zwischen reichen und armen Ländern ist weder naturgegeben noch unausweichlich. Sie ist von Menschen erschaffen worden. Was hat dazu geführt, dass ein Teil der Welt aufgestiegen und der andere abgestürzt ist? Wie konnte die Dynamik des Wachstums hier und des Niedergangs dort über mehr als ein halbes Jahrtausend hinweg aufrechterhalten werden? Warum nimmt die globale Ungleichheit zu, statt weniger zu werden? Und warum wissen wir nichts davon?
Von Zeit zu Zeit denke ich zurück an die endlose Schlange von Menschen vor der Klinik meiner Eltern. Das Bild ist mir noch so lebendig in Erinnerung, als wäre es erst gestern gewesen. Wann immer ich das tue, werde ich daran erinnert, dass die Geschichte der globalen Ungleichheit nicht von Zahlen und historischen Ereignissen handelt. Sondern vom echten Leben, von echten Menschen. Von den Bestrebungen und Hoffnungen von Gemeinschaften und Nationen und sozialen Bewegungen über Generationen, ja über Jahrhunderte hinweg. Von dem – zweifelsohne von Zeit zu Zeit erschütterten, ansonsten aber festen – Glauben daran, dass eine andere Welt möglich ist.
In einer der erschreckendsten Phasen der Geschichte, in einer Zeit, in der die globale Ungleichheit ein Rekordniveau erreicht hat, Demagogen an die Macht drängen und das Klima unseres Planeten beginnt, sich gegen die industrielle Zivilisation zu wenden, bedürfen wir mehr denn je der Hoffnung. Nur wenn wir verstehen, warum die Welt ist, wie sie ist – indem wir die Ursachen dafür untersuchen –, wird es uns gelingen, echte, wirksame Lösungen zu finden und einen gemeinsamen Weg in die Zukunft zu erdenken. Eins steht auf jeden Fall fest: Wollen wir die großen Probleme der globalen Armut und Ungleichheit, der Hungersnöte und kollabierenden Ökosysteme lösen, dann muss die Welt der Zukunft ganz anders aussehen als die Welt, wie wir sie heute kennen.
Der Bogen der Geschichte neigt sich, wie Martin Luther King jr. einmal sagte, der Gerechtigkeit zu. Das mag sein, aber er wird das nicht von alleine tun.
Erster TeilDie Kluft
1Der Entwicklungswahn
Es begann als eine PR-Masche. Harry S. Truman war gerade für eine zweite Amtszeit zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden und bereitete sich darauf vor, am 20. Januar 1949 seine Antrittsrede zu halten. Seine Redenschreiber waren völlig aufgelöst. Sie mussten sich etwas Überzeugendes ausdenken, was der Präsident sagen konnte – eine kühne und mitreißende Ankündigung. Sie hatten drei Ideen auf ihrer Liste: Unterstützung für die neu gegründeten Vereinten Nationen, Widerstand gegen die sowjetische Bedrohung und die Selbstverpflichtung, den Marshallplan fortzuführen. Aber keiner dieser Punkte konnte wirklich begeistern – eigentlich waren sie sogar ziemlich langweilig, und die Medien würden die Rede wahrscheinlich als »Schnee von gestern« abtun und ignorieren. Sie brauchten etwas anderes, was den Zeitgeist aufgreifen würde – etwas, das die Nation begeistern konnte.
Die Antwort kam aus einer unerwarteten Ecke. Benjamin Hardy war ein junger Beamter auf der mittleren Führungsebene des US-Außenministeriums, doch als ehemaliger Reporter des Atlanta Journal hatte er ein Gespür für eine gute Schlagzeile. Als ihm ein Memo zwischen die Finger kam, in dem händeringend nach neuen Ideen für Trumans Antrittsrede gesucht wurde, entschloss er sich, seinem Chef einen verrückten Einfall zu präsentieren: »Entwicklung«. Warum sollte Truman nicht verkünden, dass seine Regierung den Ländern der Dritten Welt finanzielle Hilfen gewähren würde, um ihre Entwicklung zu fördern und so dem Leid der von bitterer Armut geplagten Menschen ein Ende zu setzen? Hardy hielt das für einen sicheren Sieg – ein einfacher Weg, so schrieb er in seinem Konzept, »die größte emotionale Wirkung« auf die US-Bürger zu erzielen und sich »die allgemeine Sehnsucht nach einer besseren Welt zunutze zu machen und in geordnete Bahnen zu lenken«.
Aber Hardys Chef hielt nichts davon. Es sei eine riskante Idee aus heiterem Himmel, die womöglich zu neuartig sei, um die Leute zu überzeugen; sie sei es nicht wert, damit bei einem so wichtigen Anlass zu experimentieren. Doch Hardy war entschlossen, diese Chance nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. Es gelang ihm, unter einem Vorwand im Weißen Haus vorgelassen zu werden, wo er Trumans Beratern mit glühenden Worten seine Idee anpries. Er konnte einige von ihnen überzeugen, sodass sein Plan – mithilfe gewisser diplomatischer Manöver von Insidern – als eine Art nachträglicher Einfall in Trumans Redemanuskript aufgenommen wurde, als »Point Four«. Truman war einverstanden.
Es war die erste Antrittsrede eines US-Präsidenten, die live im Fernsehen übertragen wurde. Zehn Millionen Zuschauer verfolgten sie an jenem kalten Januarnachmittag vor den Bildschirmen – noch nie hatte ein einzelnes Ereignis ein größeres Publikum gefunden. Bei Trumans Antrittsrede sahen mehr Menschen zu als bei sämtlichen Antrittsreden aller seiner Vorgänger zusammengenommen. Und sie waren begeistert von dem, was er zu sagen hatte. »Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt unter so erbärmlichen Bedingungen, dass man sie geradezu als Elend bezeichnen könnte«, verkündete er. »Sie haben nicht genug zu essen. Sie werden von Krankheiten geplagt. In wirtschaftlicher Hinsicht ist ihr Leben primitiv, und es ist keine Besserung in Sicht.« Aber, so Truman, es bestehe Hoffnung: »Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit haben wir das Wissen und die Fähigkeiten, das Leid dieser Menschen zu lindern. In der industriellen und wissenschaftlichen Entwicklung nehmen die Vereinigten Staaten einen ganz besonderen Platz unter den Ländern der Erde ein … unsere unschätzbaren Ressourcen des technischen Wissens werden ständig erweitert, und sie sind unerschöpflich.« Und dann spielte er seine Trumpfkarte aus: »Wir müssen ein kühnes neues Programm ins Leben rufen, um den unterentwickelten Regionen der Welt den Nutzen aus unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen und aus unserem industriellen Fortschritt zur Verfügung zu stellen, sodass sie sich wirtschaftlich entwickeln und wachsen können … Die ganze Welt muss sich anstrengen, um Frieden, Überfluss und Freiheit zu erreichen.«
Natürlich gab es keinerlei konkrete Pläne für ein solches Programm – nicht einmal ein einziges Dokument. Es wurde ausschließlich als PR-Masche in Trumans Rede aufgenommen – und es funktionierte. Die Medien überschlugen sich vor Begeisterung – sämtliche Zeitungen von der Washington Post bis hin zur New York Times brachten glühende Berichte über Point Four, und der Rest der Rede war schnell vergessen.[1]
Warum konnte Point Four eine so große Faszination auf die amerikanische Öffentlichkeit ausüben? Weil Truman den Bürgern[1] eine neue und machtvolle Perspektive auf die sich abzeichnende Weltordnung eröffnet hatte. Nach den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs glätteten sich die Wogen, der europäische Imperialismus brach zusammen, und die Welt begann sich als Gemeinschaft von gleichberechtigten und unabhängigen Staaten zusammenzufinden. Das Problem war nur, dass sie eigentlich überhaupt nicht gleichberechtigt waren: Es gab riesige Unterschiede zwischen ihnen, wenn es um Macht und Wohlstand ging. Die privilegierten Länder des Globalen Nordens erfreuten sich einer sehr hohen Lebensqualität, während die benachteiligten Länder des Globalen Südens – die Mehrheit der Weltbevölkerung – in lähmender Armut versanken. Wenn die Amerikaner über ihre Grenzen hinausblickten und die brutale Tatsache der globalen Ungleichheit erkannten, brauchten sie dafür eine Erklärung.
Point Four bot ihnen eine überzeugende Perspektive an. Die reichen Länder Europas und Nordamerikas seien »entwickelt«; sie hätten einen Vorsprung auf dem großen Pfad des Fortschritts. Ihnen gehe es besser, weil sie besser seien – intelligenter, innovativer und fleißiger. Sie hätten bessere Werte, bessere Institutionen und bessere Technologien. Dagegen seien die armen Länder des Globalen Südens ärmer, weil sie noch nicht die richtigen Werte und politischen Ziele gefunden hätten; sie seien zurückgeblieben, »unterentwickelt« und darum bemüht aufzuholen.
Aufgrund dieser Geschichte konnten sich die Amerikaner zutiefst bestätigt fühlen; sie vermittelte ihnen ein positives Selbstgefühl, sie machte sie stolz auf das Erreichte und ihren Platz in der Welt. Aber noch wichtiger war vielleicht, dass sie sich auf diese Weise auch nobel fühlen konnten – diese neue Perspektive eröffnete ihnen den Zugang zu einer höheren, beinahe kosmologischen Mission. Die entwickelten Länder konnten sich als Leuchtfeuer der Hoffnung zeigen, als Retter der Bedürftigen. Sie würden ihnen die helfende Hand reichen, sie großzügig an ihren Reichtümern teilhaben lassen und so den »primitiven« Ländern des Globalen Südens dazu verhelfen, ihnen auf dem Weg zum Erfolg zu folgen. Sie würden zu Helden werden, die die Welt zu noch nie dagewesenem Frieden und Wohlstand führen.
Mit anderen Worten: Point Four konnte nicht nur die globale Ungleichheit erklären, sondern auch eine Lösung anbieten, wie sie in einem befreienden Rundumschlag zu beheben sei. Und so dauerte es nicht lange, bis diese Idee auch von den Regierungen in Westeuropa aufgegriffen wurde. Als Großbritannien und Frankreich sich nach und nach aus ihren Kolonien zurückzogen, brauchten sie eine neue Erklärung für die krasse Ungleichheit, die nach wie vor zwischen den eigenen Gesellschaften und den Völkern, die sie so lange beherrscht hatten, existierte. Die Theorie der Entwicklung – dass nämlich die Länder der Welt sich lediglich an verschiedenen Stationen entlang des großen Fortschrittspfads befänden – bot ein bequemes Alibi. Diese Erklärung ermöglichte es ihnen, die Verantwortung für das Elend der Kolonien weit von sich zu schieben, und sie war um einiges akzeptabler als die expliziten Rassetheorien, auf die sie sich vorher gestützt hatten. Darüber hinaus erlaubte sie ihnen, vor den Augen der Welt in eine neue, positive Rolle zu schlüpfen: Wohlwollend gaben sie ihre imperiale Macht auf und besannen sich darauf, ihren Mitmenschen zu helfen.
Für westliche Ohren war das eine unglaublich verlockende Suggestion. Sie war nicht nur eine weitere Geschichte, sondern hatte sämtliche Elemente eines epischen Mythos. Sie bildete das Fundament, auf dem die Menschen ihre Sicht der Welt, vom Fortschritt der Menschheit und ihrer Zukunft, aufbauen konnten.
Diese Geschichte von der Entwicklung der Staaten hat bis heute großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Sie begegnet uns, wohin wir auch sehen, und zwar in Form von wohltätigen Organisationen wie Oxfam und TRAID (Textile Recycling for Aid and International Development), TV-Werbespots für Save the Children und World Vision oder in den Jahresberichten von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF), und jedes Mal, wenn wir eine nach Bruttoinlandsprodukt (BIP) geordnete Länder-Rangliste zu sehen bekommen. Wir hören sie von Rockstars wie Bono und Bob Geldof, von Milliardären wie Bill Gates und George Soros und von Schauspielerinnen wie Madonna und Angelina Jolie, wenn sie sich im zünftigen Kakianzug von eifrigen afrikanischen Kindern bedrängen lassen. Sie begegnet uns in Form von Band-Aid-Konzerten oder Fundraising-Singles, auf denen Popstars Lieder wie »Do They Know It’s Christmas?« singen und die es irgendwie schaffen, jedes Jahr wieder aufzutauchen. Jede größere Universität bietet Entwicklungsarbeit-Studiengänge an, und inzwischen ist eine ganze Branche von Fachkräften entstanden, um die unzähligen NGOs (»non-governmental organizations«, dt. »Nichtregierungsorganisationen«), die in den vergangenen Jahrzehnten wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, mit Personal zu versorgen. Das Thema »Entwicklung« begegnet uns auf Schritt und Tritt. Und die Branche hat ihre eigenen Rituale geschaffen, an denen viele Millionen Menschen teilnehmen können: Sie kaufen TOMS-Schuhe, spenden jeden Monat ein paar Euro, um ein Kind in Sambia zu sponsern, oder sie geben ihren Sommerurlaub auf, um stattdessen ehrenamtlich in Honduras zu arbeiten.
Es wäre wohl nicht übertrieben, wenn man sagen wollte, dass so gut wie jeder Mensch in der westlichen Welt diesem Entwicklungsparadigma irgendwann schon einmal begegnet ist oder gar selbst daran mitgewirkt hat – die Geschichte ist allgegenwärtig. Und sie ist zu einer riesigen Branche herangewachsen, die Hunderte von Milliarden Dollar umsetzt – ebenso viel wie die Gewinne aller Banken der USA zusammengenommen.[2]
Dieses Paradigma von der Entwicklung der Dritten Welt ist so tief in unserer Kultur verankert, dass es für uns beinahe selbstverständlich geworden ist. Es scheint völlig offensichtlich zu sein, dass es wahr ist. Für einen großen Teil meines Lebens als junger Erwachsener habe ich leidenschaftlich daran geglaubt. Als ich Swasiland verließ, um in den USA zu studieren, bekam ich eine Welt zu sehen, die völlig anders ist als die, in der ich aufgewachsen bin: eine Welt des Überflusses, mit überdimensionalen Häusern, riesigen Autos, gepflegten neuen Straßen und monumentalen Shoppingmalls. Aber es gelang mir nicht, Swasiland hinter mir zu lassen. Auf der Suche nach Erklärungen und Lösungen für das Problem der riesigen materiellen Unterschiede zwischen den beiden Welten, in denen ich gelebt hatte, fand ich Antworten – und Hoffnung – in diesem Entwicklungsparadigma.
In meinem letzten Studienjahr zog ich nach Nagaland, einem entlegenen Bundesstaat in einem fernen Winkel im Nordosten von Indien, um dort für eine regionale Mikrofinanzorganisation zu arbeiten. Ich fand es aufregend und befriedigend, in der Entwicklungshilfe zu arbeiten. Es gab mir das Gefühl, etwas Nützliches und Sinnvolles zu tun, weit mehr als alles, was die Geschäftswelt zu bieten hatte, und ein Teil von etwas Wichtigem zu sein. Und sie gab mir das Gefühl, ein guter Mensch zu sein.
Da ich darauf brannte, weiterhin auf diesem Gebiet zu arbeiten, kehrte ich später nach Swasiland zurück und nahm dort einen Job bei World Vision an, einer der größten Entwicklungs-NGOs der Welt. Ich war in dem Dorf Mpaka stationiert, einem staubigen Außenposten an einer Straße, die quer durch das Lowveld zwischen Manzini und der Grenze zu Mosambik führt, und stürzte mich eifrig in eine ganze Reihe von Projekten – alles von Bewässerungssystemen bis hin zu medizinischer Versorgung – und spürte wieder den Kick, der sich bei mir einstellte, wann immer ich mich als Teil des Entwicklungsparadigmas fühlte. Aber als sich meine anfängliche Begeisterung etwas gelegt hatte, sah ich mich vor einige schwierige Fragen gestellt. Wir hatten Dutzende von Projekten in diesem winzigen Land, das Ergebnis von Millionen an Spendengeldern und vielen Jahren Arbeit – und World Vision war nur eine von vielen NGOs, die sich alle mit genau denselben Problemen herumschlugen, unterstützt durch ständig fließende staatliche Entwicklungshilfegelder aus den Geberländern im Globalen Norden. Aber insgesamt schien sich letztlich nichts wirklich zu ändern. Warum blieben die meisten Menschen in Swasiland so arm, trotz all dieser Bemühungen? Es schien beinahe so, als würden wir Sand in ein Fass ohne Boden schaufeln.
World Vision hatte mich angestellt, um zu analysieren, warum ihre Entwicklungshilfeprojekte ihren Versprechen nicht gerecht wurden. Ich erkannte, dass es daran lag, dass ihre Interventionen ins Leere liefen. Ihre Sicht der Welt – die sie mehr oder weniger wörtlich von Truman übernommen hatten – führte sie zu der Annahme, dass alles, was die Swasis brauchten, ein bisschen Mildtätigkeit sei, um ihnen zu helfen. World Vision kümmerte sich um sterbende Aidspatienten, setzte Projekte um, die Arbeitslosen etwas Einkommen verschafften, brachte Kleinbauern neue Anbaumethoden bei und finanzierte Kindern den Schulbesuch. Aber so hilfreich diese Projekte auch gewesen sein mochten, konnten sie doch nichts gegen die eigentlichen Ursachen der Probleme ausrichten. Warum starben so viele Aidspatienten? Im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass es etwas damit zu tun hatte, dass die Pharmakonzerne sich weigerten, Swasiland zu erlauben, generische Versionen von patentierten lebensrettenden Medikamenten zu importieren, was dazu führte, dass deren Preise unerschwinglich blieben. Warum waren die Kleinbauern nicht in der Lage, sich von ihrem Land zu ernähren? Ich erkannte, dass es etwas mit den subventionierten Nahrungsmittelimporten zu tun hatte, die aus den USA und der EU hereinströmten und billiger waren als die Erzeugnisse der lokalen Landwirtschaft. Und warum war die Regierung Swasilands nicht in der Lage, grundlegende soziale Dienste bereitzustellen? Weil sie unter einem Berg von Auslandsschulden begraben war und von westlichen Banken gezwungen wurde, die Sozialausgaben zu kürzen, um vorrangig ihre Schulden bedienen zu können.
Je länger ich recherchierte, desto klarer erkannte ich, dass der Grund, warum die Armut in Swasiland nicht verschwand, eine Menge mit Umständen zu tun hatte, die außerhalb Swasilands zu suchen waren. Allmählich wurde mir klar, dass das globale Wirtschaftssystem so strukturiert ist, dass es eine sinnvolle Entwicklung beinahe unmöglich macht. Diese Erkenntnisse quälten mich. Als ich jedoch verschiedene Manager von World Vision, die hin und wieder aus den USA oder Australien einflogen, darauf hinwies, wurde mir gesagt, das sei zu »politisch«; es sei nicht World Visions Aufgabe, über Dinge wie Pharmapatente oder internationale Handelsregeln oder Auslandsschulden nachzudenken. Würden wir anfangen, solche Probleme anzusprechen, so wurde mir gesagt, würde man uns die Mittel streichen, bevor das Jahr um sei; immerhin sei das globale System von Patenten, Handel und Staatsverschuldung ja das, was unsere Geldgeber überhaupt erst so reich gemacht hätte, dass sie in der Lage seien, für wohltätige Zwecke zu spenden. Es sei besser, darüber den Mund zu halten: Bleib bei deinen Patenschaften für Schulkinder und mach keinen Ärger.
Frustriert und desillusioniert verließ ich World Vision und setzte mein Studium fort. Ich war fest entschlossen, möglichst viel zu lernen über die zugrundeliegenden strukturellen Ursachen von Armut – nicht nur in Swasiland, sondern im gesamten Globalen Süden. Ich wollte verstehen, warum so weite Teile der Welt trotz jahrzehntelanger »Entwicklung« nach wie vor in bitterer Armut leben, während einige wenige Länder einen beinahe unvorstellbaren Reichtum genießen.
Im weiteren Verlauf meines Studiums lernte ich, dass das, was uns über reiche und arme Länder erzählt wurde, nicht die ganze Wahrheit ist. Eigentlich sind die uns vertrauten Erklärungen beinahe das genaue Gegenteil der Wirklichkeit. Dort draußen gibt es eine ganz andere Geschichte, wenn wir denn nur bereit sind, sie zu hören. Sie wird unsere Sicht der Welt völlig verändern. Sie wird unsere Meinung über die Ursachen von Armut verändern. Sie wird verändern, wie wir über Fortschritt denken. Sie wird sogar verändern, wie wir über unsere eigene Zivilisation denken, über unseren alltäglichen Lebensstil und darüber, wie die Welt in Zukunft aussehen sollte.
Die Anthropologen sagen uns: Wenn die Struktur eines zentralen Mythos sich verändert, dann verändert sich rings um ihn herum auch alles andere an der Gesellschaft, und neue Möglichkeiten eröffnen sich, die vorher nicht einmal vorstellbar waren. Wenn Mythen zerfallen, entstehen Revolutionen.
Der Mythos beginnt zu zerfallen
Einer der Gründe, warum das Entwicklungsparadigma so überzeugend für die Menschen ist, liegt darin, dass es in seinem Kern eine Erfolgsgeschichte ist – eine kleine, durchaus ermutigende gute Nachricht in einer Welt voller schlechter Nachrichten. Dank der großzügigen Hilfe der reichen Länder, so lautet die Geschichte, hätten wir bemerkenswerte Fortschritte erzielt in unserem Kampf gegen die Armut in aller Welt, und menschliche Not werde bald auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Dieses hoffnungsfrohe Paradigma hat die Menschen seit vielen Jahrzehnten inspiriert und der Entwicklungsindustrie Millionen von eifrigen Helfern in die Arme getrieben. Aber in den vergangenen Jahren scheint diese öffentliche Begeisterung geschwunden zu sein; die Menschen packen ihre Spruchbänder ein und verlassen leise die Party. Die Entwicklungshilfeorganisationen haben einen Bericht nach dem anderen produziert, voller händeringender Analysen über die Tatsache, dass die Menschen nicht mehr daran glauben, dass Entwicklungshilfe funktioniert. Der britische Entwicklungshilfe-Dachverband Bond hat kürzlich aufgrund von Umfragedaten berichtet, dass »die Anstrengungen, Armut zu beseitigen, für viele Bürger gescheitert zu sein scheinen und dass die Skepsis im Hinblick auf die Effektivität von Entwicklungshilfe und globalen Entwicklungsinitiativen zugenommen hat«.
Hilfsorganisationen tun sich schwer damit, diesen Trend zu verstehen. Aus ihrer Sicht ist Entwicklungshilfe ein glänzender Erfolg gewesen, der Verbesserungen in Bereichen wie Kinder- und Müttersterblichkeit erbracht hat und uns ganz allmählich einer Welt ohne Armut näherbringt. Und tatsächlich hat es einige beeindruckende Erfolge gegeben. So ist zum Beispiel die Zahl der Kinder, die aus vermeidbaren Gründen gestorben sind, von 17 Millionen im Jahr 1990 auf unter 8 Millionen im Jahr 2013 gesunken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mutter bei der Geburt eines Kindes stirbt, hat im selben Zeitraum um 47 Prozent abgenommen. Diese Zahlen sind zweifellos ein Grund zum Feiern.[3] Doch die Entwicklungshilfeindustrie will den öffentlichen Eindruck erwecken, diese Erfolge seien gleichbedeutend mit dem Erfolg des Entwicklungshilfeprojekts insgesamt. Aber die Menschen wollen das einfach nicht glauben. Sie haben vielmehr das Gefühl, dass es zwar hier und da viele kleine Erfolge gegeben hat, die Lage insgesamt jedoch anscheinend kaum besser wird oder gar schlechter. Immer wieder ist es der Entwicklungshilfeindustrie nicht gelungen, ihre großartigen Versprechungen zu halten, den Hunger auf der Welt zu beenden oder die Armut zu einer Anekdote der Geschichte zu machen – warum sollte man ihr also immer weiter Geld geben? Warum sollte man sie falsche Hoffnungen bestärken lassen?
Und die Menschen haben recht. Man nehme zum Beispiel den Hunger. Auf der ersten Welternährungskonferenz der Vereinten Nationen 1974 in Rom hat bekanntlich der US-Außenminister Henry Kissinger versprochen, dass der Hunger innerhalb von zehn Jahren ausgemerzt sein werde. Damals gab es schätzungsweise 460 Millionen Menschen auf der Welt, die unter Hunger litten. Aber anstatt zu verschwinden, wurde der Hunger immer schlimmer – heute gibt es etwa 800 Millionen unterernährte Menschen, selbst nach konservativsten Maßstäben, und realistischeren Schätzungen zufolge sind es eher zwei Milliarden – beinahe ein Drittel der gesamten Menschheit.[4] Der Hunger nimmt zu – ein größeres Symbol des Versagens ist kaum vorstellbar, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir schon jetzt mehr als genug Nahrung produzieren, um sämtliche sieben Milliarden Menschen auf der Welt zu ernähren, wobei sogar noch reichlich übrig bleibt für weitere drei Milliarden.[5]
Und was ist mit Armut? Jahrelang hat die Entwicklungshilfeindustrie behauptet, die absolute Armut nehme stetig ab. Im Jahr 2015 legten die Vereinten Nationen ihren Abschlussbericht über die Millenniums-Entwicklungsziele vor – die erste umfassende Selbstverpflichtung der Welt, Armut zu bekämpfen –, in dem behauptet wird, die Armutsquote sei seit 1990 halbiert worden. Diese offizielle »Good news«-Geschichte schlug hohe Wellen in den Medien und wurde von diversen NGOs endlos wiederholt – aber sie ist ausgesprochen irreführend. Erstens wurden nahezu alle Erfolge bei der Armutsbekämpfung in einem einzigen Land erzielt, nämlich in China, das überhaupt keine westliche Entwicklungshilfe erhalten hat. Und zweitens beruht diese »Good news«-Geschichte auf Quoten statt auf absoluten Zahlen. Wenn wir uns die absoluten Zahlen ansehen – also das Kriterium, auf das sich die Regierungen der Welt ursprünglich geeinigt hatten –, stellen wir fest, dass es heute ebenso viele arme Menschen gibt wie im Jahr 1981, dem Beginn solcher Erhebungen, nämlich etwa eine Milliarde.[6] Es hat keine Verbesserung stattgefunden.
Und diese Zahlen basieren auf der niedrigsten möglichen Armutsgrenze; in Wirklichkeit ist die Lage noch schlimmer. Die Standard-Armutsgrenze erfasst die Anzahl der Menschen, die von weniger als einem Dollar pro Tag leben; doch in vielen Ländern des Globalen Südens reicht ein Dollar pro Tag einfach nicht aus, um eine menschliche Existenz zu führen – ganz zu schweigen von der Würde des Menschen. Heute sagen viele Wissenschaftler, ein Mensch brauche etwa das Vierfache dieses Betrages, um eine akzeptable Chance zu haben, bis zu seinem fünften Geburtstag zu überleben, sich ausreichend ernähren und eine normale Lebenserwartung erreichen zu können.[7] Wie würde es also aussehen, wenn wir die weltweite Armut anhand dieser realistischeren Armutsgrenze quantifizieren würden? Dann würden wir auf etwa 4,3 Milliarden Menschen kommen, die in Armut leben. Das ist mehr als das Vierfache dessen, was die Vereinten Nationen uns weismachen wollen, und über 60 Prozent der gesamten Menschheit. Außerdem würden wir feststellen, dass die Armut im Laufe der Zeit sogar schlimmer geworden ist, da seit 1981 über eine Milliarde Menschen hinzugekommen sind. Stellen Sie sich die gesamte Bevölkerung der Vereinigten Staaten vor, und verdreifachen Sie sie dann; das ist das Ausmaß, um das die globale Armut in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen hat. Diese Zahlen stehen für beinahe unvorstellbares menschliches Leid.[8]
Und in dieser ganzen Zeit hat die Ungleichheit explosionsartig zugenommen. Als 1960 der Kolonialismus endete, war das Pro-Kopf-Einkommen in den reichsten Ländern der Welt 32-mal höher als im ärmsten Land – ein riesiger Unterschied. Die Entwicklungshilfeindustrie sagte uns, dieser Unterschied würde sich verringern, was jedoch nicht geschah. Ganz im Gegenteil, im Laufe der folgenden vier Jahrzehnte vergrößerte sich der Unterschied um mehr als das Vierfache: Im Jahr 2000 war das Verhältnis schon auf 134 zu 1 gestiegen.[9] Aus regionaler Perspektive ist das gleiche Muster zu beobachten; der Unterschied zwischen den Vereinigten Staaten (der dominierenden Weltmacht) und Lateinamerika, Subsahara-Afrika, Südasien und den Entwicklungsländern im Nahen Osten und in Nordafrika hat sich zwischen 1960 und heute etwa verdreifacht.[10] Angesichts dieser Zahlen kann man kaum von »Aufholen« sprechen. Und natürlich ist die weltweite Ungleichheit auf der individuellen Ebene noch schlimmer. Anfang 2014 berichtete Oxfam, dass die wohlhabendsten 85 Personen der Welt mehr Reichtum angesammelt hätten als die ärmsten 50 Prozent der Weltbevölkerung – immerhin 3,6 Milliarden Menschen. Im nächsten Jahr war die Lage noch schlimmer geworden und auch im übernächsten Jahr. Und als Anfang 2017 das Weltwirtschaftsforum in Davos zusammenkam, gab Oxfam bekannt, dass die reichsten acht Menschen der Welt ebenso viel besaßen wie die ärmsten 3,6 Milliarden.
Es ist kaum zu überschätzen, wie verheerend diese Tatsachen für die Erfolgsgeschichte sind, die die Entwicklungshilfeindustrie verbreiten will. Kein Paradigma kann sich lange behaupten, wenn es so offensichtlich der Realität widerspricht – das kann auf Dauer nicht gut gehen.
Die Entwicklungshilfebranche ist sehr bemüht, diese existenzielle Krise in den Griff zu bekommen. Angesichts zurückgehender Spendeneinnahmen arbeiten die NGOs rund um die Uhr, um diese massenhafte Fahnenflucht aufzuhalten. Viele von ihnen haben teure Werbeagenturen engagiert, die ihnen helfen sollen, negative Wahrnehmungen zu bekämpfen und die Menschen mit den alten Erklärungen zurück an Bord zu holen. Es steht viel auf dem Spiel, denn wenn das Entwicklungsparadigma völlig unglaubwürdig wird, ist abzusehen, dass es unseren Gewissheiten über die jetzige Weltwirtschaftsordnung genauso ergehen wird. Wenn die Menschen zu erkennen beginnen, dass ungeachtet vieler Jahrzehnte westlicher Entwicklungshilfe die Armut auf der Welt immer schlimmer wird statt besser und dass die Kluft zwischen reichen und armen Ländern immer breiter wird, anstatt sich zu schließen, wird ihnen klar werden, dass mit unserem Wirtschaftssystem etwas Grundsätzliches nicht stimmt – dass es nämlich den größten Teil der Menschheit links liegen lässt und dringend verändert werden muss. Die Geschichte vom Erfolg der Entwicklungshilfe hat lange dazu beigetragen, dass viele Menschen das heute vorhandene System für richtig halten. Wenn dieses Paradigma unglaubwürdig wird, dann wird auch die Unterstützung dieser Menschen schwinden.
Warum sind arme Länder arm?
Als ich zu unterrichten begann, an der University of Virginia im Jahr 2005, pflegte ich meine Vorlesungen am Anfang eines neuen Semesters damit zu beginnen, dass ich meine Studenten um ein Brainstorming bat, und zwar zu der Frage: »Warum sind arme Länder arm?« Ihre Antworten waren jedes Jahr mehr oder weniger gleich – Sie können sie wahrscheinlich leicht erraten. Es gab immer ein paar Studenten, die meinten, das habe etwas damit zu tun, dass die Menschen dort zu faul seien, zu viele Kinder hätten oder sich an »rückständigen« kulturellen Werten orientierten. Andere vermuteten, dass es etwas mit Korruption oder schlechter Regierungsarbeit oder unfähigen Institutionen zu tun habe; oder vielleicht mit Umweltproblemen wie schlechten Böden, die für produktive Landwirtschaft nicht geeignet seien, und klimatischen Bedingungen, die tropische Krankheiten fördern. Und wieder andere glaubten, die armen Länder seien arm, weil es einfach so ist. Arme Länder seien einfach von Natur aus arm, so nahmen sie an, und daran sei niemand wirklich schuld. Letztlich sei Armut die normale erste Stufe der Entwicklung. Arme Länder seien wie Kinder: Sie seien einfach noch nicht herangewachsen, sie hätten sich noch nicht entwickelt.
Das ist eine Denkrichtung, die direkt aus Trumans Antrittsrede stammt. Immerhin fordert das von ihm in die Welt gesetzte Paradigma von uns, die Länder der Welt als eine Ansammlung unverbundener Individuen zu sehen, die wie Läufer in einem Stadion alle auf ihrer eigenen Bahn um die Wette laufen. Manche Läufer fallen zurück, andere setzen sich an die Spitze, einige sind schnell, andere langsam. Vielleicht mag es an den Institutionen oder der Regierungsarbeit oder am Klima liegen – aber was auch immer die Gründe sein mögen, der springende Punkt ist, dass jedes Land für seine eigenen Leistungen verantwortlich sei. Wenn also die reichen Länder reich sind, liege das an ihren eigenen Fähigkeiten und ihrem Fleiß. Und wenn die armen Länder arm sind, sei niemand daran schuld außer ihnen selbst. Dieser Ansatz motiviert uns dazu, uns an den Thesen einer Art »methodologischem Nationalismus« zu orientieren – also die Geschicke eines Landes zu analysieren, ohne jemals über dessen Grenzen hinauszublicken.
Es war eine etwas seltsame Sicht der Dinge, die Truman damals an den Tag legte. Indem er mit seiner Geschichte die Schicksale von armen und reichen Ländern als separat und unverbunden darstellte, ignorierte er die offenkundigen Beziehungen zwischen ihnen. Er wischte die lange und folgenschwere Historie der Verwicklungen zwischen dem Westen und den anderen Ländern der Welt beiseite und die auf dem Spiel stehenden politischen Interessen gleich mit. Truman kannte diese Historie durchaus; er wusste, dass die Vereinigten Staaten seit dem 19. Jahrhundert in diversen lateinamerikanischen Ländern gewaltsam interveniert hatten, um sich den Zugang zu den Rohstoffen des Kontinents zu sichern. Selbst noch in den 1920er- und 30er-Jahren – als Truman seine politische Karriere begann – war das US-Militär in Länder wie Honduras und Kuba eingefallen und hatte sie besetzt, auf Geheiß von US-amerikanischen Bananen- und Zuckerkonzernen.
Und natürlich wurden riesige Gebiete des Globalen Südens bereits seit 1492 von europäischen Mächten unterworfen. Tatsächlich wurde die industrielle Revolution in Europa nur durch die Rohstoffe ermöglicht, die den Kolonien genommen wurden. Das Gold und Silber, das die Europäer aus den Bergen Lateinamerikas heranschafften, lieferte nicht nur das Kapital für Investitionen in die neu entstehenden Industrien; es versetzte sie auch in die Lage, landwirtschaftliche Erzeugnisse aus dem Osten zu kaufen, wodurch sie ihre eigenen Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft in die Industrie versetzen konnten. Später wurden sie von Zucker und Baumwolle abhängig, die von versklavten Afrikanern produziert und aus den Kolonien in der Neuen Welt nach Europa verschifft wurden, von Getreide aus dem kolonialen Indien und von den Bodenschätzen aus den Kolonien in Afrika. All diese Länder lieferten die Energie und die Rohstoffe, die Europa brauchte, um seine industrielle Vormacht zu sichern. Die Entwicklung Europas hätte ohne die Beute aus den Kolonien nicht stattfinden können.[11]
Aber das hatte verheerende Folgen für die Kolonien. Die Plünderung Lateinamerikas kostete 70 Millionen Ureinwohner das Leben; in Indien verhungerten unter der britischen Kolonialherrschaft 30 Millionen Menschen. Der durchschnittliche Lebensstandard in Indien und China, der vor der Kolonialzeit jenem in Großbritannien entsprochen hatte, verschlechterte sich rapide.[12] Das Gleiche gilt für den Anteil dieser Länder am Bruttoweltprodukt, der von 65 auf 10 Prozent fiel, während Europas Anteil sich verdreifachte. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit wurde Massenarmut zu einem Problem, als der europäische Kapitalismus, getrieben vom Gebot des Wachstums und Profits, Menschen von ihrem Land vertrieb und ihnen dadurch ihre Lebensgrundlage nahm. Entwicklung für einige bedeutete Unterentwicklung für andere. Das alles wurde jedoch sorgfältig getilgt aus dem Paradigma, das Truman uns hinterließ.
Das Point-Four-Programm war ursprünglich für ein westliches Publikum gedacht; es erklärte die globale Ungleichheit auf eine Weise, die die westlichen Staaten von jeglicher Schuld freisprach. Aber in den 1950er- und 1960er-Jahren erkannten die Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs, dass es auch außerhalb ihrer Landesgrenzen als Machtmittel taugt, und so begannen sie, es als Waffe in ihrem außenpolitischen Arsenal einzusetzen.
Sie waren besorgt über die progressiven Ideen, die nach dem Ende des Kolonialismus überall im Globalen Süden um sich griffen. Die politischen Führer der nunmehr unabhängigen Länder im Süden lehnten Trumans Story über die globale Ungleichheit ab. Sie beriefen sich auf die Erkenntnisse von Denkern wie Karl Marx, Aimé Césaire und Mahatma Gandhi und wiesen darauf hin, dass die Unterentwicklung im Globalen Süden keineswegs ein naturgegebener Zustand war, sondern vielmehr eine Folge der Art, wie die westlichen Mächte seit Jahrhunderten die Weltordnung organisiert hatten. Sie wollten die Regeln der Weltwirtschaft ändern, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen für die Mehrzahl der Menschen auf der Welt. Sie wollten ihre Rohstoffe nicht mehr von Ausländern plündern lassen, wollten die Kontrolle über ihre eigenen reichlich vorhandenen Rohstoffe übernehmen und ohne westliche Einmischung ihre eigenen Industrien aufbauen. Kurzum, sie wollten Gerechtigkeit, die sie als eine Grundvoraussetzung für Entwicklung ansahen.
Aus Sicht der westlichen Mächte war dies eine gefährliche Bewegung, die gestoppt werden musste, da sie ihre wirtschaftliche Dominanz gefährdete. Sie brauchten eine Strategie, um den Zorn der Menschen zu zerstreuen, und sie fanden sie in den Arbeiten des US-Ökonomen Walt Whitman Rostow. Rostow – ein Akademiker, der nebenher als außenpolitischer Berater von US-Präsident Dwight D. Eisenhower fungierte – vertrat die Auffassung, dass Unterentwicklung kein politisches Problem sei, sondern ein technisches. Es habe überhaupt nichts mit Kolonialismus oder westlichen Interventionen zu tun, sondern vielmehr mit internen Schwierigkeiten. Wenn arme Länder sich entwickeln wollten, müssten sie nur die Entwicklungshilfe und den guten Rat des Westens annehmen, eine Politik der freien Marktwirtschaft umsetzen und dem Westen auf seinem Weg zur »Modernisierung« folgen. Indem er eine Erklärung für Armut lieferte, die sich auf innenpolitische Aspekte konzentrierte, versuchte Rostow mit seiner Theorie nicht nur, die Aufmerksamkeit der Menschen von den Ungerechtigkeiten des globalen Wirtschaftssystems abzulenken, sondern er ließ dieses System gänzlich unter den Tisch fallen.
Rostow veröffentlichte seine Theorie 1960 in seinem Buch The Stages of Economic Growth (deutsche Ausgabe: Stadien wirtschaftlichen Wachstums). Er pries sein Buch als »nichtkommunistisches Manifest« an, und es erfreute sich enormer Beliebtheit auf den höchsten politischen Ebenen der US-Regierung. In den 1960er- und 70er-Jahren verbreitete die US-Regierung Rostows Theorie als Eindämmungsstrategie im gesamten Globalen Süden – als Weg zur Entpolitisierung der Frage der globalen Ungleichheit. Sie erwies sich als ein so vielversprechendes Werkzeug, dass Rostow von Präsident Kennedy in eine führende Funktion im US-Außenministerium berufen wurde; später ernannte ihn Präsident Johnson zu seinem Nationalen Sicherheitsberater. Nach dem Muster Trumans machte Rostow aus dem Entwicklungsparadigma eine PR-Übung, die sich freilich dieses Mal nicht nur an die US-Öffentlichkeit wendete, sondern auch an den gesamten Rest der Welt.
Freilich funktionierte Rostows Erklärung nicht wie geplant. Überall im Globalen Süden ignorierten Länder, die gerade ihre Unabhängigkeit gewonnen hatten, die guten Ratschläge aus den USA und verfolgten ihre eigene Entwicklungsagenda. Sie bauten ihre Volkswirtschaften mithilfe von Protektionismus und Umverteilung auf – mit Handelszöllen, Subventionen und Sozialausgaben für Gesundheitsfürsorge und Bildung. Und das funktionierte bestens. Seit den 1950er- bis gegen Ende der 1970er-Jahre wuchsen die Einkommen, die Armutsquoten sanken, und zum ersten Mal in der Geschichte begann die Kluft zwischen reichen und armen Ländern sich zu schließen. Und das war auch kein Wunder, denn immerhin setzten die Länder des Globalen Südens genau die gleichen politischen Maßnahmen um, die auch die westlichen Länder während ihrer eigenen wirtschaftlichen Konsolidierung durchgeführt hatten.
Die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Frankreich und andere westliche Mächte waren über diese Entwicklung gar nicht erfreut. Die Politik, die viele Regierungen im Globalen Süden verfolgten, schmälerte die Profite westlicher Konzerne, behinderte ihren Zugang zu billigen Arbeitskräften und Rohstoffen und durchkreuzte ihre weltpolitischen Interessen. Sie reagierten darauf, indem sie heimlich intervenierten, um Dutzende von demokratisch gewählten Staatschefs in diversen Ländern des Globalen Südens zu stürzen und sie durch Diktatoren zu ersetzen, die den westlichen Wirtschaftsinteressen freundlich gesinnt waren und fortan mit Entwicklungshilfegeldern gestützt wurden. Für jeden, der es sehen wollte, widerlegten diese Umstürze die Geschichte, die Figuren wie Truman und Rostow erzählt hatten, und bewiesen, dass die politischen Führer des Globalen Südens, die genau das immer gesagt hatten, völlig im Recht waren. In der Tat hatte der Westen schon in den 1950er-Jahren solche Coups unterstützt – unter anderem im Iran und in Guatemala –, während Rostow damit beschäftigt war, sein Buch zu schreiben. Aufgrund seiner engen Beziehungen zur Eisenhower-Regierung, die diese ersten Coups anrichtete, wusste Rostow ganz genau, was sich abspielte. Vielleicht war er sogar in den von den USA1964 eingefädelten Militärputsch gegen den brasilianischen Präsidenten João Goulart verwickelt, der während seiner Amtszeit im US-Außenministerium stattfand.
Trotz dieser Attacken setzte der Süden seinen Aufschwung fort und drängte weiterhin auf wirtschaftliche Gerechtigkeit. In den Hinterzimmern der Vereinten Nationen setzten sich die Regierungen des Südens für eine gerechtere internationale Ordnung ein, und sie hatten Erfolg damit. Angesichts der neuen Regeln globaler Demokratie schien der Norden nicht mehr die Macht zu haben, dem Aufstieg des Südens Einhalt zu gebieten. Doch Anfang der 1980er-Jahre änderte sich das plötzlich. Die Vereinigten Staaten und Europa entdeckten, dass sie ihre Macht als Kreditgeber nutzen konnten, um verschuldeten Ländern im Süden deren Wirtschaftspolitik zu diktieren und sie praktisch per Fernbedienung zu beherrschen, ohne dass blutige Interventionen notwendig wurden. Sie setzten die Auslandsschulden von Ländern des Globalen Südens als Druckmittel ein, um ihnen sogenannte »structural adjustment programmes« (SAPs, »Strukturanpassungsprogramme«) aufzuerlegen, die sämtliche Wirtschaftsreformen, die diese Länder so sorgfältig umgesetzt hatten, rückgängig machten. Dabei gingen die westlichen Mächte sogar so weit, ihren Schuldnern genau die politischen Maßnahmen zu verbieten, die sie selbst für ihre eigene Entwicklung umgesetzt hatten, wodurch sie ihnen im Endeffekt die Leiter zum Erfolg unter den Füßen wegstießen.
Solche Strukturanpassungsprogramme – eine Art Freie-Marktwirtschaft-Schocktherapie – wurden dem Globalen Süden als notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche Entwicklung verkauft. Aber letztlich bewirkten sie das genaue Gegenteil – die Volkswirtschaften schrumpften, die Einkommen stürzten ab, Millionen von Menschen wurden enteignet, und die Armutsquoten schossen in die Höhe. Während der Strukturanpassungsphase verloren die Länder des Globalen Südens durchschnittlich 480 Milliarden Dollar pro Jahr an potenzieller Wirtschaftsleistung.[13] Heute besteht unter Wissenschaftlern weitgehend Einigkeit darüber, dass diese Strukturanpassungsprogramme eine der wichtigsten einzelnen Ursachen von Armut im Globalen Süden waren, übertroffen nur vom Kolonialismus. Für die Volkswirtschaften der Länder im Norden erwiesen sie sich jedoch als ungemein vorteilhaft.
Während die Strukturanpassungsprogramme offene Märkte in aller Welt erzwangen, entstand Mitte der 1990er-Jahre ein neues System, um die internationale Wirtschaft zu regeln. Nach diesem neuen System – das von der World Trade Organization (WTO, »Welthandelsorganisation«) umgesetzt wurde – sollte der Stimmenanteil eines Mitgliedslandes der Größe seines Marktes entsprechen, sodass die reichen Länder im Norden in der Lage sein würden, politische Maßnahmen durchzusetzen, die ihren eigenen Interessen dienten, selbst wenn das bedeuten würde, den Interessen des Südens aktiv zu schaden. So sollten zum Beispiel die Länder des Globalen Südens Agrarsubventionen aufgeben müssen, während es den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union weiterhin erlaubt sein sollte, ihre eigenen Bauern zu subventionieren. Das bedeutete, den Marktanteil der Erzeuger im Globalen Süden in dem einen Sektor, in dem sie einen natürlichen Wettbewerbsvorteil haben, künstlich zu beschneiden. Heute kosten solche Machtungleichgewichte, die in der Uruguay-Runde der WTO festgeschrieben wurden, die armen Länder schätzungsweise 700 Milliarden Dollar pro Jahr an entgangenen Exporterlösen.[14]
Wenn wir auch wieder historische Aspekte in die Analyse mit aufnehmen, beginnt die Geschichte der globalen Ungleichheit eine wesentlich komplexere und sogar finstere Färbung anzunehmen. Die ganze Idee, dass die reichen Länder die Retter der armen Länder seien, erscheint dann mehr als nur ein bisschen naiv. Das Problem ist ja nicht etwa, dass die armen Länder Schwierigkeiten hätten, sich an der Entwicklungsleiter hochzuhangeln; das Problem ist vielmehr, dass sie aktiv daran gehindert werden. Die Entwicklungshilfeindustrie bezeichnet die armen Länder gern mit dem passiven Adjektiv »unterentwickelt«. Aber vielleicht wäre es treffender, diesen Begriff zu einem transitiven Verb zu machen, nämlich »hinunterentwickelt« – was bedeutet, dass die Entwicklung des jeweiligen Landes von einer fremden Macht absichtlich behindert, zunichte- oder rückgängig gemacht wurde.[15] Denn schließlich existiert Armut nicht einfach nur – sie wird geschaffen.
Entwicklungshilfe im Rückwärtsgang
Wenn ich in meinen Vorlesungen diese historischen Zusammenhänge erkläre, stelle ich fest, dass sie bei manchen Studenten ein Gefühl des Unbehagens erzeugen. Ja, so bekomme ich dann zu hören, in der Vergangenheit seien schreckliche Dinge passiert, aber wir würden heute in einer gerechteren und humaneren Welt leben. Und als Beweis führen sie dann unweigerlich das Entwicklungshilfebudget an und verweisen darauf, dass die reichen Länder den armen Ländern pro Jahr etwa 125 Milliarden Dollar an Hilfen zukommen lassen.[16]
Das sind durchaus beeindruckende Argumente. Zusammen mit den grandiosen Behauptungen über den Rückgang der globalen Armut und der Anwendung des methodologischen Nationalismus bildet das wachsende Entwicklungshilfebudget den Kern des offiziellen Entwicklungsparadigmas. Die Idee von Entwicklungshilfe ist zumindest seit Truman unter uns, aber ihr anhaltender Einfluss in der Welt von heute ist weitgehend das Werk eines einzigen Mannes, nämlich des US-amerikanischen Ökonomen Jeffrey Sachs, des früheren Direktors der Millenniums-Entwicklungsziele und Sonderberaters des UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon. Sachs, umgänglich und gut aussehend – eine erfrischende Abwechslung vom Klischee des trockenen Technokraten –, ist zu einem Entwicklungshilfe-Guru unserer Zeit geworden und zu einer Art Rockstar, der es zweimal in die Liste des Time-Magazins der 100 einflussreichsten Menschen der Welt geschafft hat. In seinem 2005 erschienenen Bestseller The End of Poverty (deutsche Ausgabe: Das Ende der Armut) verkündet er eine einfache und überzeugende Botschaft: Niemand sei schuld an der fortbestehenden Armut der armen Länder. Sie sei schlicht auf natürliche Nachteile wie ungünstige geografische und klimatische Bedingungen zurückzuführen, die ganz einfach zu überwinden seien. Wenn die reichen Länder denn nur ihre Entwicklungshilfebudgets auf 0,7 Prozent ihres BIPs aufstocken würden, könnten wir die globale Armut binnen 20 Jahren beseitigen. Die armen Länder bräuchten nur genug, um sich essenzielle Landwirtschaftstechnologien, medizinische Grundversorgung, sauberes Wasser, Grundschulen und Elektrizität leisten zu können, und schon könnten sie die Entwicklungsleiter aus eigener Kraft hinaufklettern.
Worauf es hier ankommt, ist keineswegs die Substanz dieser Empfehlung (der wohl kaum jemand widersprechen würde), sondern die Geschichte, die sie impliziert. Wie schon Rostow zu seiner Zeit immer wieder betonte, seien die reichen Länder nicht nur unschuldig an den Ursachen der Unterentwicklung in den armen Ländern, sondern sie würden sogar fürsorglich die helfende Hand reichen, um die Kluft zu schließen. Die Auffassungen von Sachs machen das alte Entwicklungsparadigma für eine neue Generation attraktiv und wurden von den Regierungen der meisten reichen Länder der Welt bejubelt – viele von ihnen stockten sogar ihre Entwicklungshilfebudgets entsprechend auf. Seine Publicity war nützlich, weil sie jede Andeutung, dass die Mächte des Westens in irgendeiner Weise für die Ursachen des Leidens im Globalen Süden verantwortlich sein könnten, entkräftete. Die USA und Großbritannien waren gerade im Irak einmarschiert, und zwar unter anderem, um sich den Zugang zu den riesigen Ölreserven der Region zu sichern. Die Bush-Administration hatte gerade geholfen, die progressive Regierung von Jean-Bertrand Aristide in Haiti zu stürzen, und sie hatte heimlich einen Putschversuch gegen Hugo Chávez in Venezuela unterstützt, womit sie die lange Serie der aggressiven Interventionen fortsetzte, die Eisenhower in den 1950er-Jahren in Gang gesetzt hatte. Aber dessen ungeachtet konnte das Fließen der Entwicklungshilfegelder als unwiderlegbarer Beweis für die Mildtätigkeit des Westens herhalten. Es lief auf »perception management« (»Wahrnehmungssteuerung« oder Propaganda) hinaus.
Wenn wir jedoch etwas genauer hinsehen, ergibt selbst dieser Aspekt des Entwicklungsparadigmas keinen Sinn. Das Problem ist keineswegs, dass es diese 125 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe nicht gäbe – es gibt sie durchaus. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten und diesen Betrag in einen breiteren Kontext stellen, werden wir feststellen, dass er bei Weitem übertroffen wird von den Finanzressourcen, die in umgekehrter Richtung fließen. Im Vergleich dazu stellt sich die Gesamtheit der westlichen Entwicklungshilfe als ein winziges Rinnsal dar.
Gegen Ende 2016 veröffentlichten der US-Thinktank Global Financial Integrity (GFI) und das Centre for Applied Research an der Norwegian School of Economics eine Studie, die durchaus geeignet ist, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Die Autoren der Studie saldierten sämtliche Finanzressourcen, die jedes Jahr zwischen reichen und armen Ländern transferiert werden: nicht nur Entwicklungshilfe, Auslandsinvestitionen und Handelsströme, wie es vorher schon in anderen Studien gemacht worden war, sondern auch andere Transfers wie Schuldentilgungen, Überweisungen und Kapitalflucht. Es handelt sich um die umfassendste Erhebung über Ressourcentransfers, die jemals durchgeführt wurde. Die Autoren der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass die Entwicklungsländer im Jahr 2012 gut zwei Billionen Dollar erhalten hatten, einschließlich aller Hilfen, Investitionen und Einkommen aus dem Ausland. Aber mehr als das Doppelte, nämlich etwa fünf Billionen Dollar, flossen im selben Jahr aus diesen Ländern ab. Mit anderen Worten: Die Entwicklungsländer »schickten« drei Billionen Dollar mehr in den Rest der Welt, als sie von dort erhielten. Und wenn wir sämtliche Jahre seit 1980 in Betracht ziehen, kumulieren sich diese Nettoabflüsse auf den schwindelerregenden Betrag von insgesamt 26,5 Billionen Dollar – das ist die Summe, die im Laufe der vergangenen paar Jahrzehnte aus dem Globalen Süden abgezogen wurde.[17] Man bekommt ein Gefühl für die Größenordnung, um die es hier geht, wenn man sich vor Augen führt, dass der Betrag von 26,5 Billionen Dollar ungefähr der Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten und Westeuropas zusammengenommen entspricht.
Wie setzen sich diese enormen Abflüsse zusammen? Nun, eine Komponente davon sind Schuldentilgungen. Heute zahlen die armen Länder jedes Jahr etwa 732 Milliarden Dollar, um ihre Auslandsschulden zu bedienen.[18] Ein großer Teil davon sind Zinseszinszahlungen auf Kredite, deren Nennwert schon mehrfach zurückgezahlt wurde, und ein Teil davon entfällt auf Staatsschulden, die von illegitimen Diktatoren angehäuft wurden. Der Schuldendienst beläuft sich auf beinahe das Sechsfache der gesamten Entwicklungshilfe. Seit 1980 haben die Entwicklungsländer über 4,2 Billionen Dollar nur an Zinsen gezahlt – das sind direkte Cash-Transfers an Großbanken in New York und London.
Eine weitere große Komponente bildet das Einkommen, das ausländische Anleger aus ihren Investitionen in Entwicklungsländern erzielen und dann in ihr Heimatland überweisen. Man denke zum Beispiel an Profite, wie sie Shell aus den Ölreserven Nigerias oder Anglo-American aus den Goldminen Südafrikas zieht. In diese Kategorie fallen aber auch Gewinne, die Normalbürger in Europa und Nordamerika durch Investitionen in Aktien und Anleihen aus dem Globalen Süden erzielen, etwa über ihre Pensionsfonds. Und darüber hinaus gibt es zahlreiche kleinere Abflüsse, etwa die 60 Milliarden Dollar pro Jahr, die die Entwicklungsländer gemäß eines WTO-Abkommens (TRIPS) an ausländische Patentinhaber zahlen müssen, um Zugang zu Technologien und Pharmaprodukten zu erhalten, die in vielen Fällen für ihre Entwicklung oder das öffentliche Gesundheitswesen unverzichtbar sind. (Die Abkürzung »TRIPS« steht für »Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights«, zu deutsch: »Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum«.)[19]
Aber der bei Weitem größte Teil dieser Abflüsse hat etwas mit Kapitalflucht zu tun. GFI hat berechnet, dass die Entwicklungsländer seit 1980 insgesamt 23,6 Billionen Dollar durch Kapitalflucht verloren haben.[20] Ein großer Teil davon wird durch sogenannte »leakages« (»Schwund«) in den Zahlungsbilanz-Ausgleichszahlungen zwischen den Ländern bewerkstelligt, durch welche die Entwicklungsländer jedes Jahr 973 Milliarden Dollar verlieren. Eine andere illegale Praktik ist als »trade misinvoicing« (»falsche Rechnungsstellung«) bekannt. Das bedeutet im Prinzip, dass große Konzerne – in- und ausländische gleichermaßen – falsche Preise auf ihren Handelsrechnungen ausweisen, um Gelder aus den Entwicklungsländern verschwinden zu lassen, die dann wie von Geisterhand in Steueroasen und »secrecy jurisdictions« (Länder, die gezielt Finanzmarktregeln einführen, um ausländisches Kapital anzulocken, etwa ein striktes Bankgeheimnis) wieder auftauchen. Durch falsche Rechnungsstellung verlieren die Entwicklungsländer jedes Jahr 875 Milliarden Dollar. Und weitere 875 Milliarden Dollar pro Jahr fließen durch »transfer mispricing« (»missbräuchliche Verrechnungspreise«) ab, einen Mechanismus, den multinationale Unternehmen einsetzen, um den Entwicklungsländern Geld zu stehlen, indem sie zwischen ihren Niederlassungen in verschiedenen Ländern Gewinne verschieben, was illegal ist.[21] In der Regel ist das Ziel solcher Praktiken, Steuern zu vermeiden, aber hin und wieder werden sie auch für Zwecke der Geldwäsche eingesetzt oder um Kapitelverkehrskontrollen zu umgehen.
Drei Billionen Dollar pro Jahr an Netto-Abflüssen ist der 24-fache Betrag des jährlichen Entwicklungshilfebudgets. Mit anderen Worten: Für jeden Dollar Entwicklungshilfe, den die Entwicklungsländer erhalten, verlieren sie 24 Dollar durch Nettoabflüsse. Dies ist natürlich ein Durchschnittswert; für manche Länder ist dieses Verhältnis höher, für andere niedriger. Aber in allen Fällen nehmen diese Nettoabflüsse den Entwicklungsländern eine wichtige Quelle von Einnahmen und Finanzen, die sie sonst für ihre Entwicklung hätten nutzen können. Die GFI-Studie stellt fest, dass die wirtschaftlichen Wachstumsraten in den Entwicklungsländern durch zunehmende Nettoabflüsse (seit 2009 sind sie jährlich um 20 Prozent gestiegen) zurückgegangen sind, was bedeutet, dass diese Abflüsse direkt zu sinkenden Lebensstandards führen.
Wir können uns diese Nettoabflüsse als direkte Geldzahlungen von armen an reiche Länder vorstellen. Aber wenn wir das Entwicklungshilfebudget im breiteren Kontext betrachten, sollten wir uns dabei nicht nur die Abflüsse ansehen, sondern auch die Verluste und Kosten, die den Entwicklungsländern durch die Politik der reichen Länder entstanden sind. Als zum Beispiel den Ländern des Globalen Südens in den 1980er- und 90er-Jahren Strukturanpassungsprogramme auferlegt wurden, verloren sie dadurch jedes Jahr etwa 480 Milliarden Dollar an potenzieller Wirtschaftsleistung. Das ist beinahe das Vierfache des heutigen Entwicklungshilfebudgets pro Jahr. In jüngerer Vergangenheit haben Ungleichgewichte innerhalb der Welthandelsorganisation zu Verlusten in Form von potenziellen Exporterlösen in Höhe von 700 Milliarden Dollar pro Jahr geführt – immerhin das Sechsfache des weltweiten Entwicklungshilfebudgets.
Doch der vielleicht wichtigste Verlust entsteht durch Ausbeutung beim Handel. Von den Anfängen des Kolonialismus bis hin zur heutigen Globalisierung war das primäre Ziel des Nordens, die Kosten der im Süden eingekauften Arbeit und Waren zu drücken. In der Vergangenheit waren die Kolonialmächte in der Lage, den Kolonien ihre Bedingungen direkt zu diktieren. Heute ist der Handel zwar aus formaler Sicht »frei«, aber dennoch können die reichen Länder ihre Interessen durchsetzen, weil sie in einer wesentlich besseren Verhandlungsposition sind. Darüber hinaus hindern Handelsvereinbarungen arme Länder in vielen Fällen daran, ihre Beschäftigten in ähnlicher Weise vor Ausbeutung zu schützen, wie reiche Länder das tun. Und da die multinationalen Konzerne heute die Möglichkeit haben, den ganzen Planeten auf der Suche nach den billigsten Löhnen und Produkten abzugrasen, sind arme Länder gezwungen, miteinander zu konkurrieren, um die Kosten zu drücken. Das alles führt dazu, dass eine gähnende Lücke klafft zwischen dem »realen« Wert der Arbeit und Waren, die arme Länder verkaufen, und den Preisen, die ihnen tatsächlich dafür gezahlt werden. Diese Lücke wird von Ökonomen als »unequal exchange«, also »ungleicher Tausch«, bezeichnet. Mitte der 1990er-Jahre, auf dem Höhepunkt der Strukturanpassungsära, verlor der Süden durch ungleichen Tausch bis zu 2,66 Billionen Dollar pro Jahr (kaufkraftbereinigt auf 2015)[22] – ein verdeckter Werttransfer, der auf das 21-Fache des heutigen weltweiten Entwicklungshilfebudgets hinausläuft und die Summe aller ausländischen Direktinvestitionen um das Vierfache übertrifft.
Es gibt zahlreiche andere strukturelle Verluste und Kosten, die wir ebenfalls berücksichtigen könnten. Zum Beispiel berichtet ActionAid, dass multinationale Konzerne jedes Jahr etwa 138 Milliarden Dollar in Form von befristeten Steuerbefreiungen aus Entwicklungsländern herausziehen.[23] Schon dieser Betrag allein übertrifft das weltweite Entwicklungshilfebudget. Überweisungen ins Heimatland von Migranten aus dem Globalen Süden, die im Westen arbeiten, werden durch exorbitante Bankgebühren geschmälert, wodurch deren Familien jedes Jahr 33 Milliarden Dollar entgehen.[24] Die Ungleichmäßigkeit von Entwicklungshilfezahlungen, die zu unsicheren Finanzierungen führen, kosten die Volkswirtschaften des Globalen Südens jedes Jahr etwa 27 Milliarden Dollar an entgangenem BIP.[25] Darüber hinaus gibt es noch andere Formen der Extraktion, die schwieriger zu quantifizieren sind, zum Beispiel die 65 Millionen Hektar Land (mehr als das Fünffache der Fläche Englands), die sich westliche Konzerne seit dem Jahr 2000 in Ländern des Globalen Südens widerrechtlich angeeignet haben (als »land grabbing«, »Landraub« oder »Landdiebstahl« bekannt).[26] Und dann sind da natürlich auch noch die Schäden, welche die Entwicklungsländer aufgrund der Klimaveränderung erleiden, die beinahe ausschließlich von den reichen Ländern verursacht wird; diese Schäden werden derzeit auf 571 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt.[27]
Der springende Punkt ist ganz einfach: Das Entwicklungshilfebudget ist verschwindend gering, geradezu lächerlich, wenn man es mit den strukturellen Verlusten und Abflüssen vergleicht, die der Globale Süden erleidet. Ja, durch manche Entwicklungshilfeprojekte wird viel erreicht, um die Lebensqualität von Menschen zu verbessern, aber sie können nicht annähernd die Schäden ausgleichen, die durch die Geberländer verursacht werden. Tatsächlich wird ein Teil dieser Schäden von genau den Organisationen herbeigeführt, die sich die Entwicklungshilfe-Agenda auf die Fahnen geschrieben haben: zum Beispiel die Weltbank, die von der Staatsverschuldung des Globalen Südens profitiert; die Gates Foundation, die von einem Urheberschutzsystem profitiert, das lebensrettende Medikamente und wichtige Technologien hinter rückständigen Patent-Paywalls wegschließt; sowie Bono, der von dem Steueroasen-System profitiert, das Einnahmen aus den Ländern des Globalen Südens absaugt.[28]
Vergleich von Entwicklungshilfe und diversen Abflüssen (dunkelgrau) sowie strukturellen Kosten und Verlusten (hellgrau)[29]
Dies soll keineswegs ein Plädoyer gegen Entwicklungshilfe an sich sein; vielmehr bedeutet es, dass die Diskussion über Entwicklungshilfe uns davon ablenkt, das Gesamtbild zu sehen. Sie verdeckt die Extraktionstatbestände, die heute aktiv die Verarmung des Globalen Südens herbeiführen und aktiv dessen sinnvolle Entwicklung behindern. Das Wohltätigkeitsparadigma verschleiert die realen Probleme, um die es eigentlich geht; es erweckt den Eindruck, als würde der Westen den Globalen Süden »entwickeln«, obwohl in Wirklichkeit das Gegenteil der Fall ist. Es stimmt nicht, dass die reichen Länder die armen Länder entwickeln würden; im Endeffekt entwickeln die armen Länder die reichen Länder – und das schon seit Ende des 15. Jahrhunderts. Das heißt, dass das offizielle Entwicklungsparadigma nicht nur die wahren Ursachen von Armut verkennt, sondern sie sogar auf den Kopf stellt. Wie schon zu Trumans Zeiten dient Entwicklungshilfe als eine Art Propaganda, die die Nehmer als Geber darstellt und verschleiert, wie die globale Wirtschaft tatsächlich funktioniert.
Vielleicht hat es Frantz Fanon, der bekannte Philosoph aus Martinique und Vordenker des antikolonialen Befreiungskampfes von Algerien, am besten ausgedrückt:
Der Kolonialismus und der Imperialismus sind mit uns nicht quitt, wenn sie ihre Fahnen und ihre Polizeikräfte von unseren Territorien zurückgezogen haben … Der Reichtum der imperialistischen Länder ist auch unser Reichtum … Dieses Europa ist buchstäblich das Werk der Dritten Welt. Die Reichtümer, an denen es erstickt, sind den unterentwickelten Völkern gestohlen worden … Deshalb werden wir nicht zulassen, daß die Hilfe an die unterentwickelten Länder als ein Werk der Barmherzigkeit verstanden wird. Vielmehr hat diese Hilfe eine doppelte Bedeutung: sie bestärkt die Kolonisierten in dem Bewußtsein, daß man ihnen etwas schuldig ist, und die kapitalistischen Mächte in der Erkenntnis, daß sie zahlen müssen.[30]
Frantz Fanon hatte erkannt, dass die Armut des Globalen Südens ebenso wenig ein naturgegebener Zustand ist wie der Reichtum des Westens. Armut ist im Grunde genommen nichts anderes als die unvermeidliche Folge von fortgesetztem Plündern – also von Vorgängen, die einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Menschen auf Kosten der weitaus meisten Menschen zugutekommen. Es ist eine Wahnidee zu glauben, dass Entwicklungshilfe eine angemessene oder gar ehrbare und sinnvolle Lösung für solche Probleme sei. Das Entwicklungsparadigma erlaubt es reichen Ländern und Personen, mit der einen Hand vorgeblich das zu reparieren, was sie mit der anderen zerstören. Sie teilen sozusagen Heftpflaster aus, während sie zur gleichen Zeit tiefe Wunden reißen, und nehmen dabei auch noch für sich in Anspruch, moralisch vorbildlich zu handeln.
Vor einigen Jahren hatte ich Gelegenheit, die Westbank in Palästina zu bereisen. An einem besonders heißen Nachmittag fuhren meine Gastgeber mit mir hinunter ins Jordantal, um dort mit einigen Bauern über ihre Probleme mit der Wasserversorgung zu sprechen. Als wir die holprige Schotterstraße entlangfuhren, sahen wir ein großes weißes Schild, das aus dem felsigen Wüstenboden aufragte. Darauf war die Ankündigung zu lesen, dass die United States Agency for International Development (USAID, »US-Behörde für internationale Entwicklung«) dort ein Projekt plane, um die »wiederkehrende Wasserknappheit zu bekämpfen«. Man wollte in dieser Gegend einen neuen Brunnen bauen. Das Schild zeigte die Fahne der Vereinigten Staaten und trug die stolzen Worte: »Ein Geschenk des amerikanischen Volkes an das palästinensische Volk«.
Eine Person, die zufällig dieses Schild sieht, könnte sich davon beeindrucken lassen: eine großzügige Zuwendung aus US-Steuermitteln, um mit einer humanitären Geste den in der Wüste um ihr Überleben kämpfenden Palästinensern eine helfende Hand zu reichen. Aber in Palästina gibt es keinen Wassermangel. Als Israel 1967 mit militärischer Unterstützung der USA die Westbank eroberte und besetzte, übernahm es die totale Kontrolle über die Aquifere in diesem Gebiet. Israel pumpt den Großteil dieses Wassers – beinahe 90 Prozent – ab, um es in seinen Siedlungen zu verwenden und damit große, industriell geführte Farmen zu bewässern. Und weil dadurch der Grundwasserspiegel sinkt, fallen die Brunnen der Palästinenser trocken. Ohne Genehmigung Israels dürfen sie ihre Brunnen nicht vertiefen oder gar neue bohren – und eine solche Genehmigung wird so gut wie nie erteilt. Und wenn sie ohne Genehmigung einen Brunnen bauen, was häufig vorkommt, tauchen am nächsten Tag Bulldozer aus Israel auf und schütten ihn wieder zu. Daher sind die Palästinenser gezwungen, ihr eigenes Wasser zu willkürlich überhöhten Preisen von den Israelis zurückzukaufen.
Und das ist keineswegs ein Geheimnis – es geschieht in aller Öffentlichkeit, und die Bauern, mit denen ich gesprochen habe, wussten es nur allzu gut. Für sie wird durch das USAID-Schild nur noch Salz in die Wunde gestreut. Es fehlt ihnen keineswegs an Wasser, wie USAID es suggeriert; ihr Wasser ist ihnen gestohlen worden. Und dieser Diebstahl wurde von den USA unterstützt. Im Jahr 2012, kaum zwei Monate vor meinem Besuch, verabschiedeten die Vereinten Nationen die Resolution 66/225