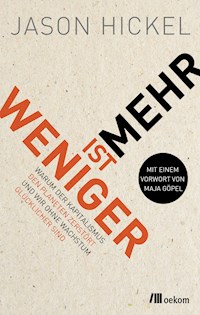Einleitung
Willkommen im Anthropozän
Alles, was ich nicht retten kann, berührt mich. So vieles ist zerstört worden. Ich habe mich mit jenen zusammengetan, die durch alle Zeitalter hindurch, völlig absurd und ohne irgendeine besondere Macht, die Welt wiederherstellen.
Adrienne Rich
Manche Erkenntnisse schleichen sich heimlich ein, wie eine leise Erinnerung – nur ein winzig kleiner Hinweis darauf, dass irgendetwas nicht stimmt.
Als ich in Eswatini aufwuchs, dem kleinen Land im südlichen Afrika, das früher Swasiland hieß, gab es in meiner Familie einen klapprigen alten Toyota Pickup – so einen, wie sie in den 1980er-Jahren in der Gegend üblich waren. Nach längeren Fahrten musste ich immer dabei helfen, den Kühlergrill vorne von all den Insekten zu befreien, die sich dort angesammelt hatten. Manchmal klebten sie dort drei Schichten tief: Schmetterlinge, Falter, Wespen, Heuschrecken, Käfer aller Größen und Farben – Dutzende, wenn nicht Hunderte von Arten. Ich weiß noch, wie mein Vater mir erzählte, die Insekten auf der Erde würden mehr wiegen als alle anderen Tiere zusammen, die Menschen eingeschlossen. Ich staunte über diese Vorstellung und fand sie auch irgendwie ermutigend. Als Kind machte ich mir Sorgen um das Schicksal der lebendigen Welt, wie das wohl viele Kinder tun – und deshalb gab mir diese Geschichte mit den Insekten das Gefühl, es werde schon alles gut ausgehen. Es war beruhigend, an die anscheinend unerschöpfliche Fülle des Lebens erinnert zu werden. Ich musste in warmen Nächten oft daran denken, wenn wir in der Hoffnung auf eine kühle Brise draußen auf der Terrasse unseres kleinen Hauses mit seinem Blechdach saßen und die Falter und Käfer beobachteten, wie sie um das Licht schwärmten und den Fledermäusen auswichen, die manchmal zwischen ihnen durchschossen, um sich eine Mahlzeit zu schnappen. Ich entwickelte eine Begeisterung für Insekten. Es gab eine Zeit, da rannte ich mit Stift und Notizbüchlein in der Hand herum und versuchte all die verschiedenen Arten rund um unser Haus zu bestimmen. Irgendwann musste ich aufgeben. Man konnte sie nicht alle zählen, es waren einfach zu viele.
Ab und zu erzählt mein Vater auch heute noch diese alte Geschichte von den Insekten – immer in diesem begeisterten Ton, den Väter so an sich haben, als habe er gerade etwas vollkommen Neues entdeckt. Aber heute klingt das nicht mehr richtig überzeugend. Irgendwas hat sich verändert. In den letzten Jahren bin ich immer wieder zu Forschungszwecken im südlichen Afrika gewesen. Und jedes Mal ist das Auto selbst nach langen Reisen mehr oder weniger sauber. Allenfalls ein paar Fliegen da und dort, aber mit damals überhaupt nicht zu vergleichen. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass die Insekten in meinen Kindheitserinnerungen eine so große Rolle spielen. Vielleicht ist aber auch etwas anderes im Gange, das mehr Anlass zur Sorge gibt.
*
Gegen Ende des Jahres 2017 gab ein Wissenschaftlerteam merkwürdige und ziemlich alarmierende Befunde bekannt. Jahrzehntelang hatten sie die Zahl der Insekten in deutschen Naturschutzgebieten akribisch gezählt. Für eine solche Arbeit hatten sich bislang nur sehr wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Zeit genommen – wegen der schieren Menge an Insekten scheint eine solche Unternehmung überflüssig –, und deshalb waren nun alle auf das Ergebnis gespannt. Die Befunde waren niederschmetternd. Das Team fand heraus, dass innerhalb von 25 Jahren drei Viertel aller fliegenden Insekten in deutschen Naturschutzgebieten verschwunden waren – zurückzuführen, ihrer Vermutung nach, auf die Umwandlung der umgebenden Wälder in Ackerland und die darauffolgende intensive Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.
Die Studie breitete sich aus wie ein Lauffeuer und produzierte Schlagzeilen rund um die Welt. »Wie es scheint, machen wir große Landstriche unbewohnbar für die meisten Formen des Lebens und befinden uns gegenwärtig auf dem Kurs zu einem ökologischen Armageddon«, stellte einer der Wissenschaftler fest. »Bei dem derzeit eingeschlagenen Weg werden unsere Enkel eine hochgradig verarmte Welt erben.«1 Insekten sind unverzichtbar für die Bestäubung und Reproduktion der Pflanzen, sie wandeln organische Abfälle in Humus um und fungieren als Nahrungsquelle für Tausende andere Arten. So unscheinbar sie aussehen mögen, sind sie doch entscheidende Knoten im Gewebe des Lebens. Wie um diese Befürchtungen zu bestätigen, meldeten wenige Monate später zwei Studien, dass abnehmende Insektenpopulationen zu einem dramatischen Rückgang bei den Vögeln auf Ackerland in Frankreich geführt hatten. Innerhalb von nur fünfzehn Jahren seien die Durchschnittszahlen um ein Drittel gefallen, wobei einige Arten – wie etwa Wiesenpieper und Rebhühner – sogar um 80 Prozent abgenommen hätten.2 Im gleichen Jahr kam aus China die Nachricht, dass das Insektensterben dort eine Bestäubungskrise hervorgerufen habe. Es tauchten unheimliche Fotos von Arbeiter*innen auf, die von Pflanze zu Pflanze gingen und Feldfrüchte von Hand bestäubten.
Das Problem beschränkt sich nicht auf diese Regionen. Insekten verschwinden offenbar überall. Es ist nicht einfach, Trends in einem kontinentaleuropäischen oder globalen Maßstab zu bewerten, aber die Befunde sehen nicht gut aus. Forscher haben festgestellt, dass der Insektenreichtum auf der Erde alle zehn Jahre um rund 9 Prozent abgenommen hat3, und mindestens jede zehnte Spezies ist inzwischen vom Aussterben bedroht.4
Dies weckt Befürchtungen vor einer »kaskadierenden« Auslöschung, wobei die Zerstörung der einen Spezies möglicherweise den Niedergang anderer Spezies auslösen und damit den Verlust an Biodiversität auf unberechenbare Weise verschärfen könnte.5 Die Krise hat sich derart gravierend entwickelt, dass Wissenschaftler im Jahr 2020 zum Thema Insektengefährdung eine »Warnung an die Menschheit« veröffentlichten: »Mit der Auslöschung von Insekten verlieren wir mehr als einfach nur Arten«, schrieben sie. Wir verlieren »große Teile vom Baum des Lebens«, und solche Verluste »führen zum Niedergang lebenswichtiger Ökosystemdienstleistungen, von denen die Menschheit abhängig ist.«6 Aus einer ähnlichen Sorge heraus wurde kürzlich bei einem Symposium weltweiter Experten auf dem Gebiet der Insektendiversität ein Bericht erstellt, der mit einem ebenso simplen wie unheilschwangeren Satz begann: »Die Natur befindet sich im Belagerungszustand.«7
*
Dies hier ist kein Buch über den Untergang. Es ist ein Buch über Hoffnung. Es handelt davon, wie wir uns von einer um Herrschaft und Extraktion organisierten Wirtschaft zu einer Wirtschaftsform hinbewegen können, die in einem wechselseitigen Verhältnis mit der lebendigen Welt verwurzelt ist. Bevor wir uns aber auf diese Reise begeben, müssen wir uns zunächst klar machen, was auf dem Spiel steht. Die ökologische Krise, die sich um uns herum abspielt, ist erheblich gravierender, als wir im Allgemeinen annehmen. Es geht nicht einfach nur um ein oder zwei einzelne Themen, um eine Angelegenheit, die man mit einer gezielten Intervention hier und da in Ordnung bringen kann, während alles andere so weitergeht wie bisher. Was gerade geschieht, das ist der Zusammenbruch multipler vernetzter Systeme – Systeme, von denen die Menschen fundamental abhängig sind. Wer schon weiß, was da gerade passiert, will diesen Teil vielleicht nur überfliegen. Wem das alles neu ist, der muss jetzt ganz stark sein. Denn es geht nicht nur um Insekten.
Leben in einem Zeitalter des Massenaussterbens
Damals schien es eine gute Idee zu sein: das Land an große Unternehmen übergeben, ausreißen, was an Hecken und Bäumen da ist, und alles mit ein und derselben Getreidesorte bepflanzen, von Flugzeugen aus besprühen und mit riesigen Mähdreschern abernten. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts wurden ganze Landschaften nach der totalitären Logik des industriellen Gewinnstrebens neu gestaltet, das meiste für Futtermittel für die Nutztiere, mit dem Ziel, so viel wie möglich aus dem Boden herauszuholen. Man nannte das die Grüne Revolution, aber aus ökologischer Sicht war daran überhaupt nichts »Grünes«. Indem man komplexe ökologische Systeme auf eine einzige Dimension reduzierte, verschwand alles andere aus dem Blickfeld. Niemand bemerkte, was mit den Insekten und den Vögeln geschah. Oder mit dem Boden selbst.
Wer je einmal eine Handvoll reicher, dunkler, duftender Erde aufgehoben hat, der weiß, dass es darin von Leben wimmelt: Würmer, Larven, Insekten, Pilze und Millionen von Mikroorganismen. Es ist dieses Leben, das die Böden resilient und fruchtbar macht. Im Lauf des letzten halben Jahrhunderts hat jedoch die industrielle Landwirtschaft, während sie auf aggressives Pflügen und den Einsatz von Chemikalien setzte, die Ökosysteme des Bodens in rasendem Tempo zerstört. Wissenschaftler der UN haben herausgefunden, dass 40 Prozent der Böden auf dem Planeten inzwischen schwer geschädigt sind. Landwirtschaftlicher Boden geht zehn Mal schneller verloren, als er sich bildet.8 2018 machte sich ein japanischer Wissenschaftler die Mühe, Nachweise von Regenwurmpopulationen aus allen Teilen der Welt durchzusehen. Das Ergebnis war, dass auf industriellen Farmen die Regenwurm-Biomasse um dramatische 83 Prozent gesunken war. In derselben Zeit war der organische Gehalt der Böden um mehr als die Hälfte eingebrochen. Unsere Böden werden in leblosen Dreck verwandelt.9
Die Folgen davon sind, gelinde gesagt, beunruhigend. Die Ernteerträge nehmen derzeit auf einem Fünftel der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzflächen ab.10 Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, so die Warnung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wird die Erde nur noch 60 Jahre lang Ernten liefern können.11 Die Böden, die über Zehntausende von Jahren das Fundament der menschlichen Zivilisation gebildet haben, stehen plötzlich, nach wenigen Jahrzehnten, am Rande des Zusammenbruchs.
Etwas Ähnliches vollzieht sich gerade in unseren Weltmeeren. Wenn wir in den Supermarkt gehen, erwarten wir ganz selbstverständlich, all die Fischsorten vorzufinden, die uns schmecken: Kabeljau, Seehecht, Schellfisch, Lachs, Thunfisch – lauter Arten, die auf dem Speiseplan der Menschen überall auf der Erde einen zentralen Platz einnehmen. Aber diese selbstverständliche Gewissheit fängt an zu bröckeln. Neue Zahlen zeigen, dass rund 85 Prozent der weltweiten Fischbestände erschöpft sind oder kurz vor dem Ende stehen. Der Schellfisch ist auf ein Prozent der früheren Mengen eingebrochen; der Heilbutt, dieser prachtvolle Riese der Meere, auf das Fünftel eines Prozents. Überall auf der Welt nimmt der Fischfang ab, zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen.12 Im asiatischen Pazifik bewegen sich die Fischereierträge auf einen Nullpunkt im Jahr 2048 zu.13
Zum größten Teil ist dies auf aggressive Überfischung zurückzuführen: Genau wie die Landwirtschaft haben Unternehmen die Fischerei in einen kriegerischen Akt verwandelt; mit industriellen Riesentrawlern schleppen sie ihre Netze über den Meeresgrund, auf der Jagd nach dem immer knapper werdenden Fisch. Dabei holen sie Hunderte von Arten hoch, nur um die paar wenigen zu fangen, die einen »Marktwert« haben, und verwandeln dabei Korallengärten und farbenprächtige Ökosysteme in leblose Flächen. Ganze Landschaften auf dem Boden der Ozeane wurden beim Wettlauf um den Profit dezimiert. Es sind aber auch noch andere Kräfte am Werk: Chemikalien aus der Landwirtschaft wie Nitrogen und Phosphor gelangen über die Flüsse ins Meer und verursachen dort gewaltige Algenblüten, die den darunterliegenden Ökosystemen den Sauerstoff abschneiden. Riesige »tote Zonen« erstrecken sich entlang der Küsten industrialisierter Regionen in Europa oder den Vereinigten Staaten. Einst sprudelnd vor Leben erscheinen unsere Ozeane zunehmend geisterhaft leer und mehr von Plastik als von Fischen bevölkert.
Die Ozeane leiden auch unter dem Klimawandel. Mehr als 90 Prozent der Hitze aus der globalen Erwärmung werden vom Meer absorbiert.14 Ozeane wirken wie Puffer, sie beschützen uns vor den schlimmsten Effekten unserer Emissionen. Aber dabei leiden sie selbst: Wenn sich die Ozeane erwärmen, werden Nährstoffzyklen zerstört, Nahrungsketten unterbrochen und weite Teile mariner Lebensräume sterben ab.15 Gleichzeitig führen Kohlenstoffemissionen dazu, dass die Versauerung der Meere zunimmt. Dies ist problematisch, weil die Versauerung der Meere in der Vergangenheit bereits mehrmals Treiber eines Massenaussterbens war. Sie spielte bei dem letzten Massenaussterben vor 66 Millionen Jahren eine Rolle, als der pH-Wert des Meeres um 0,25 sank. Diese kleine Veränderung reichte aus, um 75 Prozent der marinen Arten auszurotten. So wie unsere derzeitige Verlaufskurve bei den Emissionen aussieht, wird der pH-Wert der Ozeane bis zum Ende des Jahrhunderts um 0,4 abfallen.16 Wir wissen, was geschehen wird. Wir können es kommen sehen. Es macht sich ja bereits heute bemerkbar: Meerestiere verschwinden doppelt so schnell wie Landtiere.17 Ausgedehnte Korallenökosysteme bleichen aus zu toten, farblosen Skeletten.18 Taucher*innen berichten, dass selbst entlegene Riffe, die einst voller Leben waren, jetzt vom Gestank verwesenden Fleisches heimgesucht werden.
*
Was als diffuse Ahnung in Bezug auf Falter und Käfer beginnt, als ein Aufflackern von Kindheitserinnerungen, wird zur lähmenden Erkenntnis, wie ein Schlag in die Magengrube. Wir taumeln wie Schlafwandler*innen in ein Massenaussterben hinein – das sechste in der Geschichte unseres Planeten und das erste, das durch wirtschaftliche Aktivitäten von Menschen verursacht wird. Die Aussterberate ist derzeit 1.000‐mal schneller als in der Zeit vor der Industriellen Revolution.
Vor ein paar Jahren sprach praktisch noch niemand über diese Themen. So wie mein Vater mit seinen Insektengeschichten ging jeder davon aus, dass das Gewebe des Lebens immer intakt bleiben würde. Jetzt ist die Lage so ernst, dass die Vereinten Nationen eine eigene Task Force zur Überwachung eingesetzt haben: den Weltbiodiversitätsrat (das Internationale wissenschaftliche Beratungsgremium zur biologischen Vielfalt IPBES). 2019 veröffentlichte er seinen ersten umfassenden Bericht – eine wegweisende Begutachtung der lebenden Arten auf dem Planeten. Der Bericht stützt sich auf 15.000 Studien aus der ganzen Welt und stellt die übereinstimmende Meinung von Hunderten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dar. Der Befund: eine sich beschleunigende Rate beim Niedergang der globalen Diversität, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat. Etwa eine Million Spezies sind heute vom Aussterben bedroht.19
Ich starre ständig auf diese Zahlen, aber sie wollen für mich einfach keinen Sinn ergeben. Das fühlt sich alles so unwirklich an, wie ein Fiebertraum, in dem die Welt seltsam, fremd und außer Proportion erscheint. Robert Watson, der Vorsitzende des IPBES, nannte den UN‐Bericht »unheilvoll«. »Die Gesundheit der Ökosysteme, von denen wir und alle anderen Arten abhängen, verschlechtert sich schneller als je zuvor«, sagte er. »Wir untergraben das eigentliche Fundament unserer Volkswirtschaften und Lebensgrundlagen, unserer Ernährungssicherheit, Gesundheit und Lebensqualität weltweit.« Anne Larigauderie, die Generalsekretärin der IPBES, fand noch klarere Worte: »Wir löschen momentan systematisch alle nichtmenschlichen Lebewesen aus.« Wissenschaftler*innen sind nicht dafür bekannt, dass sie gerne starke Worte verwenden. Sie ziehen einen neutralen, objektiven Ton vor. Aber wenn man diese Berichte liest, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich der eine oder die andere doch veranlasst sah, die Tonlage zu wechseln. Eine neue Studie, die in der angesehenen Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences – einem seriösen, etwas angestaubten Journal – veröffentlicht wurde, beschrieb das drohende Massenaussterben als »biologische Vernichtung« und nannte es zusammenfassend einen »erschreckenden Angriff auf die Grundlagen der menschlichen Zivilisation«. »Die Menschheit wird am Ende einen sehr hohen Preis zahlen müssen«, schrieben die Autoren, »für die Dezimierung der einzigen Ansammlung von Leben, von der wir im Universum wissen.«20
*
Das ist das Besondere bei der Ökologie: Alles ist mit allem verbunden. Wir tun uns schwer damit, zu verstehen, wie das funktioniert, weil wir normalerweise, wenn wir die Welt betrachten, in individuellen Teilen denken und in komplexen Ganzheiten. So hat man uns ja auch beigebracht, von uns selbst zu denken – wie von Individuen. Wir haben vergessen, wie man auf die Beziehung zwischen den Dingen achtet. Insekten, die für die Bestäubung nötig sind; Vögel, die Pflanzenschädlinge in Schranken halten, Larven und Würmer, die für die Bodenfruchtbarkeit unabdingbar sind; Mangroven, die das Wasser reinigen; die Korallen, von denen Fischpopulationen abhängen: Diese lebenden Systeme sind nicht irgendwo »da draußen«, abgetrennt von der Menschheit. Ganz im Gegenteil: Unsere Schicksale sind miteinander verflochten. Sie sind eigentlich wir selbst.
Es ist nicht möglich, unsere ökologische Krise mit dem gleichen reduktiven Denken zu begreifen, das diese überhaupt erst verursacht hat. Beim Klimawandel zeigt sich dies mit besonderer Klarheit. Wir neigen dazu, den Klimawandel vor allem für eine Frage der Temperatur zu halten. Viele machen sich deswegen keine großen Sorgen, weil unsere Erfahrung mit Temperatur im Alltag uns sagt, dass ein paar Grad eigentlich gar nicht so viel ausmachen. Die Temperatur ist aber eigentlich erst der Anfang – sie ist nur ein allererster Hinweis.
Manche Folgen des Temperaturanstiegs sind offensichtlich, da wir sie unmittelbar sehen und erfahren können. Die Zahl der extremen Stürme, die es jedes Jahr gibt, hat sich seit den 1980er-Jahren verdoppelt.21 Sie schlagen nun so häufig zu, dass selbst außergewöhnliche Spektakel in der Erinnerung ineinanderfließen.
Man erinnere sich: Allein im Jahr 2017 wurde Amerika von einigen der verheerendsten Hurrikane seit Beginn der Aufzeichnungen heimgesucht. Harvey verwüstete weite Bereiche von Texas; Irma machte Barbuda praktisch unbewohnbar; Maria warf Puerto Rico in eine monatelange Dunkelheit und vernichtete 80 Prozent der Ernte auf der Insel. Das waren Hurrikane der Kategorie 5 – des schlimmsten Typs. Solche Stürme sollten eigentlich nur einmal in einer Generation vorkommen. Aber im Jahr 2017 kamen sie einer nach dem anderen daher und hinterließen Chaos und Zerstörung.
Die steigenden Temperaturen lösten auch tödliche Hitzewellen aus. Die Hitzewelle, die Europa im Jahr 2003 traf, tötete innerhalb weniger Tage 70.000 Menschen – eine schwindelerregende Zahl. Frankreich war am stärksten betroffen; dort stiegen die Temperaturen mehr als eine Woche lang auf über 40 Grad Celsius. Die Weizenernte brach um zehn Prozent ein, während der Kontinent von Dürre heimgesucht wurde. In Moldawien wurde die gesamte Ernte dezimiert. Drei Jahre später geschah das Gleiche noch einmal; quer durch Nordeuropa wurden Temperaturrekorde gebrochen. 2015 hielten Hitzewellen in Indien und Pakistan die Temperaturen auf über 45 Grad Celsius und kosteten mehr als 5.000 Menschen das Leben. 2017 löste eine Hitzewelle in ganz Portugal Flächenbrände aus, die sich durch die Wälder des Landes fraßen. Straßen wurden zu Friedhöfen, als die Menschen beim Versuch zu fliehen in ihren Autos verbrannten. Der Rauch verdunkelte den Himmel bis nach London. 2020 zwangen Buschfeuer in Australien die Menschen zur Flucht an die Küsten; die Szenen erinnerten an einen apokalyptischen Film. Bis zu einer Milliarde wilder Tiere kamen dabei um. Schreckliche Bilder tauchten auf von Landschaften, die mit verkohlten Kängurus und Koalas übersät waren.
Ereignisse wie diese fühlen sich real und konkret an. Sie liefern Schlagzeilen für die Medien. Den gefährlicheren Aspekten des Klimawandels gelingt das jedoch nicht, zumindest noch nicht. Bislang haben wir die 1‐Grad-Grenze über dem vorindustriellen Niveau noch kaum überschritten. Auf unserem aktuellen Pfad (2020) steuern wir aber auf eine Steigerung von bis zu 4 Grad Celsius bis zum Ende des Jahrhunderts zu. Selbst wenn wir die Zusagen, die die Länder im Rahmen des Übereinkommens von Paris zur Reduzierung von Emissionen gegeben haben, miteinrechnen – die freiwillig und nicht bindend sind –, werden die globalen Temperaturen trotzdem um bis zu 3,3 Grad Celsius steigen. Das sind keine inkrementellen Veränderungen. Auf einem solchen Planeten haben Menschen noch nie gelebt. Jene tödliche Hitzewelle, die 2003 über Europa hereinbrach? Das wird dann ein ganz normaler Sommer sein. Spanien, Italien und Griechenland werden sich in Wüsten verwandeln, mit Klimabedingungen, die eher der Sahara ähneln als dem Mittelmeer, wie wir es kennen. Der Mittlere Osten wird zu permanenter Dürre verdammt.
Gleichzeitig werden die steigenden Meere unsere Welt fast bis zu Unkenntlichkeit verändern. Bis dato hat sich der Meeresspiegel seit 1900 um rund 20 cm gehoben. Schon dieser scheinbar geringe Anstieg hat dafür gesorgt, dass Überschwemmungen häufiger vorkommen und Sturmfluten immer gefährlicher werden. Als Hurrikan Michael 2018 über die Vereinigten Staaten hereinbrach, führte er eine über vier Meter hohe Sturmflut mit sich, die Teile der Küste Floridas in eine apokalyptische Landschaft aus zerschmetterten Häusern und geknickten Strommasten verwandelte. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird das alles noch viel schlimmer. Selbst wenn wir das Pariser Ziel einhalten – Temperaturanstieg nicht über zwei Grad Celsius –, wird sich der Meeresspiegel bis zum Ende des Jahrhunderts aller Voraussicht nach um weitere 30 bis 90 Zentimeter heben.22 Angesichts des Schadens, den schon die 20 Zentimeter verursacht haben, fällt es schwer, sich die Situation vorzustellen, wenn der Anstieg um das Vierfache höher ist als derzeit. Schon allein die Sturmfluten werden katastrophale Ausmaße annehmen. Die vom Hurrikan Michael entfesselte Wellenwand wird im Vergleich geradezu pittoresk aussehen. Und wenn die Temperaturen um drei oder vier Grad Celsius steigen, wird sich der Meeresspiegel um mindestens 100 Zentimeter, möglicherweise 200 Zentimeter erhöhen. Viele Strände auf dem Planeten stehen dann unter Wasser. Große Teile von Bangladesch, der Heimat von 164 Millionen Menschen, verschwinden. Städte wie New York und Amsterdam sind dann dauerhaft überflutet; Jakarta, Miami, Rio und Osaka ebenfalls. Unzählige Menschen müssen ihr Zuhause verlassen und fliehen. Alles noch in diesem Jahrhundert.
So furchtbar dies auch alles sein wird, so betrifft doch die bedrohlichste Auswirkung des Klimawandels etwas viel Alltäglicheres, nämlich die Ernährung. In Asien ist die Hälfte der Bevölkerung auf das Wasser angewiesen, das von den Gletschern des Himalayas herunterkommt – nicht nur für Trinkwasser und andere Nutzungen im Haus, sondern auch für die Landwirtschaft. Seit Jahrtausenden wurde das Schmelzwasser aus diesen Gletschern jedes Jahr wieder durch neues Eis ersetzt. Aber jetzt schmilzt das Eis schneller als neues entsteht. Sollte es zu einer Erwärmung von drei oder vier Grad Celsius kommen, werden bis zum Ende des Jahrhunderts die meisten dieser Gletscher verschwunden sein. Damit reißen sie dem Ernährungssystem der Region das Herz heraus und bringen 800 Millionen Menschen in Not. Im südlichen Europa, Irak, Syrien und großen Teilen des restlichen Mittleren Ostens werden extreme Dürren und Wüstenbildung ganze Regionen für die Landwirtschaft untauglich machen. Auch wichtige Anbaugebiete in den USA und China sind dann betroffen. Nach Aussage der NASA könnten Dürren in den Great Plains und im Südwesten Amerikas diese Gegenden in wüstenartige »dust bowls« verwandeln.23
Die Wissenschaftler*innen warnen mit der leicht verständlichen Faustregel, dass für jedes Grad, um das der Planet zusätzlich aufgeheizt wird, der Ertrag der Hauptgetreidearten um etwa zehn Prozent zurückgeht.24 Bei unserer derzeitigen Verlaufskurve bedeutet das Verluste von bis zu 30 Prozent in diesem Jahrhundert. In manchen Fällen kommt es noch schlimmer: Der indische Weizen und der Mais in den USA könnten um bis zu 60 Prozent einbrechen.25 Unter normalen Umständen können regionale Nahrungsmittelknappheiten durch Überschüsse von anderen Gegenden des Planeten aufgefangen werden. Aber ein Klimakollaps könnte Knappheiten auf mehreren Kontinenten gleichzeitig auslösen. Laut Weltklimarat (IPCC) wird eine Erwärmung von mehr als zwei Grad wahrscheinlich »weltweit anhaltende Störungen im Nahrungsangebot« verursachen. Einer der Hauptautoren des Berichts formuliert das so: »Das potenzielle Risiko eines vielfachen ›Brotkorb‹-Versagens steigt.« Addiert man dies zu Bodenverarmung, Bestäubersterben und Zusammenbruch der Fischerei, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass die Ernährungsprobleme irgendwann völlig aus dem Ruder laufen.
Daraus werden sich ernsthafte Konsequenzen für die weltweite politische Stabilität ergeben. In von Lebensmittelknappheit betroffenen Gegenden wird es zu massenhaften Bevölkerungsverschiebungen kommen, wenn die Menschen auf der Suche nach stabiler Nahrungsversorgung auswandern. Das ist de facto schon im Gange.26 Viele Menschen, die etwa aus Guatemala oder Somalia fliehen, tun dies, weil ihre Farmen nicht mehr lebensfähig sind. Das internationale System steht bereits unter Druck; 65 Millionen Menschen sind derzeit durch Kriege und Dürren aus ihrer Heimat vertrieben – mehr als zu irgendeiner anderen Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Während der Migrationsdruck zunimmt, polarisiert sich die Politik immer mehr, faschistische Bewegungen sind auf dem Vormarsch und internationale Bündnisse beginnen zu zerfasern. Wenn man dann noch die Vertreibung aufgrund von Hungersnot, Stürmen und steigendem Meeresspiegel dazunimmt, plus das schrumpfende Ackerland, dann ist überhaupt nicht mehr vorherzusagen, zu welchen sozialen Flächenbränden das führen könnte.
*
Ökosysteme sind komplexe Netzwerke. Sie können unter Stress enorm resilient sein, aber wenn bestimmte zentrale Knoten zu versagen beginnen, laufen Kettenreaktionen durch das Netz des Lebens. Genauso spielten sich die Massensterben in der Vergangenheit ab. Es ist nicht der Schock von außen, der den Schaden anrichtet – der Meteor oder der Vulkan –, sondern die Kaskade der darauffolgenden internen Störungen. Wie sich so etwas entwickelt, ist ziemlich schwierig vorherzusagen. Faktoren wie Kipppunkte und Rückkopplungsschleifen machen alles erheblich riskanter, als es andernfalls sein müsste. Das ist der Grund, warum ein Klimakollaps so große Besorgnis auslöst.
Nehmen wir zum Beispiel die Polareiskappen. Das Eis funktioniert wie ein riesiger Reflektor, der das Licht von der Sonne wieder in den Weltraum zurückwirft. Das ist der sogenannte Albedo-Effekt. Wenn aber die Eisschilde verschwinden und die darunterliegenden dunkleren Landschaften und Meere zutage treten, wird diese ganze Sonnenenergie absorbiert und in Form von Wärme in die Atmosphäre abgegeben. Dies führt zu weiterer Erwärmung, die wiederum das Eis noch schneller zum Schmelzen bringt – völlig unabhängig davon, wie viele Emissionen wir Menschen dann noch ausstoßen. In den 1980er-Jahren bedeckte das arktische Meereis im Durchschnitt rund sieben Millionen Quadratkilometer. Während ich dies schreibe, ist es auf rund vier Millionen geschrumpft.
Rückkopplungseffekte wirken sich auch auf die Wälder aus. Während sich der Planet erhitzt, werden die Wälder trockener und anfälliger für Waldbrände. Wenn die Wälder brennen, geben sie Kohlenstoff in die Atmosphäre ab und fallen als Senken für weitere Emissionen aus. Dies verstärkt die globale Erwärmung, wirkt sich aber auch unmittelbar auf die Niederschläge aus. Wälder produzieren Regen, im wörtlichen Sinn. Der Amazonas atmet zum Beispiel jeden Tag etwa 20 Milliarden Tonnen Wasserdampf in die Atmosphäre aus, wie ein riesiger Fluss, der unsichtbar in den Himmel fließt. Das meiste davon regnet sich schließlich wieder über dem Wald ab, produziert aber auch viel weiter weg noch Regen – in ganz Südamerika und sogar bis in den Norden nach Kanada. Wälder spielen im zirkulierenden System unseres Planeten eine entscheidende Rolle; sie sind wie riesige Herzen, die das lebensspendende Wasser rund um die Erde pumpen.27 Während die Wälder absterben, kommt es immer häufiger zu Dürren, und die Wälder werden ihrerseits noch anfälliger für Waldbrände. Die Geschwindigkeit, mit der sich dies vollzieht, ist beängstigend. Behalten wir unseren jetzigen Pfad bei, werden die meisten Regenwälder vor dem Ende des Jahrhunderts zu Savanne verdorren.
Manchmal wirken Kipppunkte so schnell, dass ganze System innerhalb kürzester Zeit zusammenbrechen. Wissenschaftler*innen sind insbesondere wegen eines Phänomens besorgt, das als »Instabilität der marinen Eisklippen« bezeichnet wird. In der Vergangenheit gingen die meisten Klimamodelle davon aus, dass sich das komplette Abschmelzen des westantarktischen Eisschilds durch die globale Erwärmung selbst im Worst Case noch über zwei Jahrhunderte hinziehen wird. Im Jahr 2016 veröffentlichten jedoch zwei amerikanische Wissenschaftler – Rob DeConto und David Pollard – einen Artikel in der Zeitschrift Nature, der darauf hinwies, dass sich dieser Prozess auch erheblich schneller vollziehen könnte. Der Grund: Eisschilde sind in der Mitte dicker als an den Rändern, sodass Eisberge, wenn sie abbrechen, zunehmend höhere Eisklippen freilegen. Dies ist deshalb problematisch, weil höhere Eisklippen ihr eigenes Gewicht nicht tragen können: Wenn sie erst einmal freigelegt sind, fangen sie an einzuknicken, eine nach der anderen, in einer Art Dominoeffekt, wie wenn Wolkenkratzer in sich zusammenfallen. Das könnte zur Folge haben, dass Eisschilde nicht innerhalb von Jahrhunderten, sondern innerhalb von Jahrzehnten zerfallen – vielleicht schon in zwanzig bis fünfzig Jahren.28
Wenn das so kommt, könnte der westantarktische Eisschild bereits innerhalb unserer Lebenszeit dem Meeresanstieg einen weiteren Meter oder noch mehr hinzufügen. Sollte das Gleiche in Grönland passieren, würde es noch schlimmer. Die Küstenstädte der Erde würden derart schnell unter Wasser gesetzt, dass für Anpassung kaum mehr Zeit wäre. Kalkutta, Schanghai, Mumbai und London – alle würden sie überflutet, zusammen mit einem großen Teil der ökonomischen Infrastruktur der Erde. Es wäre eine Katastrophe von fast unvorstellbaren Ausmaßen. Und wir wissen, dass es so kommen kann, weil es schon einmal so gekommen ist, und zwar am Ende der letzten Eiszeit. Wissenschaftler*innen, die die Dynamik der Eisklippen erforschen, kritisieren die Regierungen schon seit Längerem laut und deutlich, weil sie dieses Risiko in ihren Klimamodellen nicht berücksichtigen.
Diese ganze Komplexität wirft ernsthafte Fragen dazu auf, ob wir überhaupt in der Lage sind, die globalen Temperaturen zu kontrollieren. Einige Wissenschaftler*innen befürchten, wir könnten den Temperaturanstieg vielleicht doch nicht bei zwei Grad »parken«, wovon das Pariser Abkommen ausgeht. Selbst bei einer Erwärmung von »nur« zwei Grad könnte es sein, dass wir Kaskaden lostreten, die außer Kontrolle geraten und die Erde in einen dauerhaften »Treibhauszustand« versetzen könnten. Die Temperaturen könnten weit über die Zielschwelle hinausschnellen, und wir hätten überhaupt keine Möglichkeit mehr, das zu stoppen.29 Angesichts dieser Risiken kann die einzig vernünftige Reaktion nur sein, alles uns Mögliche zu tun, um die Erwärmung nicht über 1,5 Grad ansteigen zu lassen. Und das bedeutet, die globalen Emissionen viel, viel schneller auf null herunterzufahren, als das irgendjemand derzeit plant.
Hinter den Ökofakten
Dieses Buch ist natürlich nicht der erste Text, in dem diese alarmierende Lage zur Sprache kommt. Wenn Sie dieses Buch lesen, dann wahrscheinlich deshalb, weil Sie sich bereits Sorgen machen. Vielleicht haben Sie schon Dutzende von Berichten über die aktuelle Krise gelesen, die Ihnen den Magen umdrehen. Sie wissen, dass irgendetwas ganz furchtbar schiefläuft. Ich muss niemanden überzeugen. Darum geht es nicht in diesem Buch.
Der Philosoph Timothy Morton hat unsere Sucht nach Ökofakten mit den Alpträumen verglichen, unter denen Menschen in einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden. In PTBS-Träumen durchlebt man sein Trauma erneut und wacht zutiefst entsetzt auf, zitternd und in Schweiß gebadet. Aus irgendeinem Grund kommen diese Alpträume immer wieder. Sigmund Freud war der Meinung, dass die Psyche dadurch versucht, die Angst zu lindern, indem sie einen genau in den Augenblick einblendet, bevor das Trauma geschah. Dahinter steckt die Idee, dass man, wenn man das traumatische Ereignis vorwegnehmen kann, es vielleicht auch vermeiden kann – oder sich wenigstens innerlich darauf vorbereiten. Morton glaubt, dass das ständige Aufzählen der Ökofakten die gleiche Funktion erfüllt. Indem wir angstmachende Ökofakten unendlich oft wiederholen, versuchen wir uns auf irgendeiner unbewussten Ebene in einen fiktionalen Augenblick einzublenden, unmittelbar bevor der Zusammenbruch geschieht, sodass wir ihn kommen sehen und etwas dagegen tun können. Auf jeden Fall sind wir dann vorbereitet, wenn es so weit ist.30
In diesem Sinne vermitteln Ökofakten eine doppelte Botschaft. Einerseits sind sie ein Aufschrei und mahnen uns, aufzuwachen und sofort zu handeln. Gleichzeitig implizieren sie aber auch, dass das Trauma noch nicht ganz da ist – dass immer noch Zeit ist, das Unheil abzuwenden. Deshalb sind sie so verführerisch, so beruhigend, und deshalb wollen wir merkwürdigerweise immer mehr davon haben. Dabei besteht die Gefahr, dass wir uns alle einlullen lassen und einfach abwarten, bis die Fakten noch extremer werden. Wenn wir diesen Punkt erreicht haben, so reden wir uns ein, dann raffen wir uns endlich auf, etwas dagegen zu unternehmen. Die ultimativen Ökofakten werden aber niemals kommen. Es wird nie gut genug sein. Genau wie im PTBS-Traum funktionieren Ökofakten nie so, wie sie eigentlich sollten. Sie lassen uns immer im Stich, und am Ende wachen wir mitten in der Nacht weinend auf, zitternd in unaussprechlicher Angst, weil wir tief im Innersten wissen, dass das Trauma bereits da ist. Wir sind schon mittendrin. Wir leben in einer Welt, die im Sterben liegt.
Die Fakten türmen sich seit Jahrzehnten auf. Mit jedem Jahr, das vergeht, werden sie klarer und genauer und die Besorgnis, die sie erregen, wird größer. Und dennoch waren wir bisher aus irgendeinem Grund unfähig, den Kurs zu ändern. Das letzte halbe Jahrhundert ist übersät mit Meilensteinen der Inaktivität. Mitte der 1970er-Jahre hat sich erstmals ein wissenschaftlicher Konsens zum anthropogenen Klimawandel herausgebildet. Der erste internationale Klimagipfel fand 1979 statt, drei Jahre vor meiner Geburt. 1988 gab James Hansen, Klimawissenschaftler bei der NASA, seine bahnbrechende Aussage vor dem US‐Kongress ab, in der er darlegte, wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe den Klimawandel vorantreibt. 1992 wurde die Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) verabschiedet, um nichtverbindliche Grenzen für Treibhausgasemissionen festzulegen. Seit 1995 wurden jährlich internationale Klimagipfel (COP) abgehalten, um Pläne für Emissionsreduktionen auszuhandeln. Die UN‐Rahmenkonvention wurde drei Mal erweitert, mit dem Kyoto-Protokoll von 1997, dem Copenhagen Accord von 2009 und dem Übereinkommen von Paris 2015. Und trotzdem steigen die globalen CO2-Emissionen Jahr für Jahr, während sich die Ökosysteme in tödlicher Geschwindigkeit auflösen.
Obwohl wir nun schon seit fast einem halben Jahrhundert wissen, dass auch die menschliche Zivilisation auf dem Spiel steht, hat es bei den Bemühungen, den ökologischen Zusammenbruch aufzuhalten, keinen Fortschritt gegeben. Keinen. Das ist ein seltsames Paradox. Zukünftige Generationen werden auf unsere Zeit zurückblicken und nicht begreifen, warum wir ganz genau wussten, was Sache war, bis ins fürchterlichste Detail, und doch bei der Problemlösung versagt haben.
Wie kann man diese Trägheit erklären? Manche werden mit dem Finger auf die Unternehmen der fossilen Energie zeigen, die unsere politischen Systeme eisern im Griff haben. Und da ist sicher etwas Wahres dran. Obwohl sie von der Gefahr einer Klimakrise wussten, lange bevor sie Teil der öffentlichen Debatte wurde, haben viele der größeren Unternehmen Politikerinnen und Politiker finanziell unterstützt, die entweder die wissenschaftlichen Erkenntnisse rundweg abstritten oder sich sinnvollem Handeln, wo immer es möglich war, entgegenstellten. Es ist großenteils ihnen zuzuschreiben, dass die internationalen Klimaabkommen nicht rechtlich bindend sind, weil sie nach Kräften Lobbyarbeit gegen einen solchen Schritt betrieben haben. Zudem führten sie eine außerordentlich erfolgreiche Desinformationskampagne, die die öffentliche Unterstützung für Klimaschutzaktivitäten auf Jahrzehnte unterminierte, vor allem in den Vereinigten Staaten, in dem einzigen Land, das in der Lage gewesen wäre, bei einer weltweiten Wende die Führung zu übernehmen.
Die Unternehmen der fossilen Energie und die von ihnen gekauften Politikerinnen und Politiker tragen einen erheblichen Teil der Verantwortung für unsere schwierige Lage. Aber das allein erklärt nicht, warum wir es nicht geschafft haben zu handeln. Da ist noch etwas anderes – etwas Tieferes. Unsere Sucht nach fossilen Brennstoffen und die Tricks der fossilen Brennstoffindustrie sind in Wirklichkeit nur Symptome eines Problems, das es schon vorher gab. Worum es eigentlich geht, das ist das Wirtschaftssystem, das im Lauf der letzten Jahrhunderte mehr oder weniger den gesamten Planeten unter seine Herrschaft gebracht hat: der Kapitalismus.
*
Man muss nur das Wort Kapitalismus aussprechen, schon sträuben sich den Leuten die Nackenhaare. Der Begriff ist bei allen mit starken Gefühlen besetzt, in die eine oder die andere Richtung, und oft aus gutem Grund. Aber ganz gleich, was wir vom Kapitalismus halten: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir eine klare und genaue Vorstellung davon haben, was er ist und wie er funktioniert.
Wir neigen dazu, den Kapitalismus mit bekannten, abgenutzten Begriffen wie »Markt« und »Handel« zu beschreiben. Das trifft die Sache aber nicht ganz. Märkte und Handel hat es schon Jahrtausende lang gegeben, bevor der Kapitalismus kam, und für sich genommen sind sie eigentlich ganz harmlos. Was den Kapitalismus von den meisten anderen Wirtschaftssystemen in der Geschichte unterscheidet, ist die Tatsache, dass er um den Imperativ einer stetigen Ausweitung beziehungsweise eines »Wachstums« herum organisiert ist: eines ständig steigenden Niveaus von industrieller Produktion und Konsumption, das wir in Gestalt des Bruttoinlandsprodukts (BIP) messen.31 Wachstum ist die wichtigste Direktive des Kapitals. Und was das Kapital betrifft, so ist der Zweck der Produktionssteigerung nicht in erster Linie die Befriedigung bestimmter menschlicher Bedürfnisse oder die Verbesserung der sozialen Verhältnisse. Ziel ist vielmehr, eine stetig wachsende Menge an Profit zu extrahieren und anzuhäufen. Darum geht es in allererster Linie. Innerhalb dieses Systems wohnt dem Wachstum eine gewisse totalitäre Logik inne: jede Branche, jeder Sektor, jede nationale Wirtschaft muss wachsen, die ganze Zeit, ohne dass irgendein Endpunkt auszumachen wäre.
Es ist gar nicht so leicht, die Folgen dieses Imperativs vollständig zu begreifen. Normalerweise nehmen wir die Vorstellung von Wachstum als selbstverständlich hin, weil sie so natürlich klingt. Und das stimmt ja auch. Alle lebenden Organismen wachsen. In der Natur gibt es beim Wachstum aber eine selbstbegrenzende Logik: Organismen wachsen bis zu einem Reifepunkt und behalten dann den Zustand eines gesunden Gleichgewichts bei. Wenn das Wachstum nicht aufhört – wenn die Zellen sich einfach nur immer weiter reproduzieren –, ist dies auf einen Irrtum bei der Kodierung zurückzuführen, wie das etwa bei Krebs der Fall ist. Diese Art Wachstum wird schnell tödlich.
Im Kapitalismus muss das globale BIP um mindestens zwei bis drei Prozent im Jahr wachsen; das ist das Minimum dessen, was große Firmen brauchen, um insgesamt Profit zu machen.32 Das sieht vielleicht nach einer kleinen Zunahme aus, aber man darf nicht vergessen: Es handelt sich dabei um eine exponentielle Kurve, und exponentielle Kurven haben die Eigenschaft, einen in erstaunlicher Geschwindigkeit hinterrücks zu überfallen. Drei Prozent Wachstum bedeutet, die Größe der globalen Wirtschaft alle 23 Jahre zu verdoppeln und dann von diesem bereits verdoppelten Zustand noch einmal zu verdoppeln und dann noch einmal und noch einmal. Das könnte in Ordnung sein, käme das BIP einfach so aus dem Nichts. Aber das ist nicht der Fall. Es ist an Energie und Ressourcenverbrauch gekoppelt und über die gesamte Geschichte des Kapitalismus hinweg auch schon immer gewesen. Es gibt eine gewisse Elastizität zwischen beiden Größen, aber nicht viel. Während die Produktion wächst, wälzt die Weltwirtschaft jedes Jahr immer größere Mengen an Energie, Ressourcen und Abfall um, bis zu dem Punkt, an dem sie jetzt dramatisch über das hinausschießt, was die Wissenschaft als sichere planetare Grenzen definiert hat, mit verheerenden Folgen für die lebendige Welt.33
Am Entstehen der ökologischen Krise sind aber nicht alle Menschen in gleichem Maße beteiligt – auch wenn die Sprache des Anthropozäns das so darstellt. Es ist wichtig, dass man sich das klarmacht. Wie wir in Kapitel 2 sehen werden, bleiben Länder mit niedrigem Einkommen und überhaupt die meisten Länder des globalen Südens durchaus innerhalb ihres gerechten Anteils an den planetaren Ressourcen. In vielen Fällen müssen sie de facto ihren Energie- und Ressourcenverbrauch erhöhen, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Das Problem hier sind die Länder mit hohem Einkommen, in denen sich das Wachstum vollkommen von jeglicher Vorstellung von Bedarf losgelöst hat und sich schon lange weit jenseits dessen bewegt, was man für ein gutes Leben der Menschen braucht. Die globale ökologische Krise wird fast ausschließlich durch exzessives Wachstum in den einkommensstarken Ländern angetrieben, insbesondere durch extreme Akkumulation unter den Superreichen, während die Folgen den globalen Süden und die Armen überproportional treffen.34 Letztendlich handelt es sich hier auch und ganz wesentlich um eine Krise der Ungleichheit.
*
Wir wissen ganz genau, was zu tun ist, um einen Klimakollaps zu vermeiden. Wir müssen aktiv fossile Energie herunterfahren und alles für eine rasche Einführung von erneuerbaren Energien in die Wege leiten – für einen globalen Green New Deal –, um die weltweiten Emissionen innerhalb von zehn Jahren zu halbieren und vor 2050 auf null zu bringen. Dabei muss man immer im Auge behalten, dass es sich bei diesem Ziel um den globalen Durchschnitt handelt. Angesichts ihrer größeren Verantwortung für die Emissionen der zurückliegenden Jahre müssen einkommensstarke Nationen diesen Prozess sehr viel schneller bewerkstelligen und den Nullpunkt bis 2030 erreicht haben.35 Die Dramatik der Situation kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden; es ist die allergrößte Herausforderung, der sich die Menschheit jemals gegenübersah. Die gute Nachricht: Das ist durchaus zu schaffen. Es gibt allerdings ein Problem: Die Wissenschaftler*innen lassen keinen Zweifel daran, dass wir das nicht schnell genug hinbekommen, um die Temperaturen unter 1,5 Grad Celsius oder auch unter 2 Grad Celsius zu halten, wenn gleichzeitig die Wirtschaft der wohlhabenden Staaten weiter wächst.36 Und warum ist das so? Weil mehr Wachstum mehr Nachfrage nach Energie bedeutet, und mehr Energienachfrage macht es erst recht schwierig – in der Tat unmöglich –, in der kurzen Zeit, die uns zur Verfügung steht, ausreichend erneuerbare Energien auf den Markt zu bringen, um die Nachfrage abzudecken.37
Selbst wenn es dieses Problem nicht gäbe, bleibt da doch noch eine Frage: Wenn wir endlich irgendwann 100 Prozent saubere Energie haben, was machen wir dann damit? Wenn wir die Art und Weise nicht verändern, wie unsere Wirtschaft funktioniert, dann werden wir weiterhin genau das Gleiche machen wie mit den fossilen Energien: Wir nutzen sie, um unablässig Extraktion und Produktion voranzutreiben, immer mehr und immer schneller, und setzen dabei die lebendige Welt immer stärker unter Druck, weil es das ist, was der Kapitalismus verlangt. Saubere Energie mag eine Hilfe sein, wenn es um Emissionen geht; aber sie trägt nichts dazu bei, Entwaldung, Überfischung, Bodenverarmung und Massensterben rückgängig zu machen. Eine wachstumsbesessene Wirtschaft wird uns, auch wenn sie von sauberer Energie angetrieben ist, trotzdem in die ökologische Katastrophe stürzen.
Der heikle Punkt dabei ist, dass wir hier offensichtlich kaum eine Wahl haben. Der Kapitalismus ist grundsätzlich von Wachstum abhängig. Wenn die Wirtschaft nicht wächst, rutscht sie in die Rezession: Schulden türmen sich auf, Menschen verlieren Arbeitsplatz und Wohnung, Lebensentwürfe zerbrechen. Die Regierungen haben alle Hände voll zu tun, die industrielle Aktivität am Wachsen zu halten, in einem dauernden Bemühen, die Krise abzuwehren. Wir stecken also in der Falle. Wachstum ist ein struktureller Imperativ – ein stahlhartes Gesetz. Und es kann sich auf stahlharte ideologische Unterstützung verlassen: Politiker*innen der Linken und Rechten mögen sich darum streiten, wie die Früchte des Wachstums zu verteilen sind, aber wenn es um das Streben nach Wachstum selbst geht, dann sind sie sich einig. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Der Wachstumismus, um einmal diesen Ausdruck zu gebrauchen, präsentiert sich als eine der Ideologien mit dem höchsten Führungsanspruch in der modernen Geschichte. Niemand kommt auf die Idee, sie zu hinterfragen.
Weil sie sich dem Wachstumismus verschrieben haben, sehen sich unsere Politikerinnen und Politiker nicht in der Lage, sinnvolle Schritte zu unternehmen, um die ökologische Katastrophe zu stoppen. Wir haben jede Menge Ideen, wie wir das Problem lösen können, aber wir wagen nicht, sie umzusetzen, weil wir damit das Wachstum untergraben könnten. Und in einer wachstumsabhängigen Wirtschaft darf so etwas einfach nicht passieren. Stattdessen berichten die gleichen Zeitungen, die erschütternde Geschichten über ökologische Katastrophen bringen, auch ganz begeistert darüber, wie das BIP in jedem Quartal wächst, und die gleichen Politikerinnen und Politiker, die händeringend die Klimakrise beklagen, rufen jedes Jahr pflichtbewusst nach mehr industriellem Wachstum. Die kognitive Dissonanz hier ist bemerkenswert.
Manche Leute versuchen, dieses Spannungsverhältnis unter einen Hut zu bringen, indem sie sich auf die Hoffnung stützen, die Technologie werde uns retten – die Innovation werde das Wachstum irgendwann »grün« machen. Effizienzverbesserungen werden es ermöglichen, das BIP von den ökologischen Auswirkungen zu »entkoppeln«, sodass wir die globale Wirtschaft auf immer und ewig wachsen lassen können, ohne in Sachen Kapitalismus irgendetwas ändern zu müssen. Und wenn das nicht funktioniert, dann können wir immer noch darauf setzen, dass uns gigantische Geoengineering-Programme zu Hilfe kommen werden, wenn es eng wird.
Das ist eine beruhigende Phantasievorstellung. Ich habe sogar selber einmal daran geglaubt. Aber als ich anfing, die Schichten wohltönender Rhetorik eine nach der anderen abzulösen, stellte ich fest: Es ist genau das – eine Phantasievorstellung. Ein paar Jahre lang habe ich zu diesem Thema geforscht, zusammen mit Kolleg*innen aus der Ökologischen Ökonomie. 2019 veröffentlichten wir einen Überblick über die vorliegenden Erkenntnisse; 2020 führten Wissenschaftler*innen zudem einige Meta-Analysen durch, bei denen sie Ergebnisse aus Hunderten von Studien untersuchten.38 Einzelheiten dazu werde ich in Kapitel 3 erklären, aber das Fazit kann man kurz und knapp zusammenfassen: Beim »grünen Wachstum« steckt nichts dahinter. Es lässt sich empirisch nicht stützen. Diese Befunde waren eine Offenbarung für mich und zwangen mich dazu, meinen Standpunkt zu ändern. In einer Zeit des ökologischen Notstands können wir es uns nicht leisten, eine politische Strategie auf Phantasiegebilden aufzubauen.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Die Technologie spielt eine absolut entscheidende Rolle im Kampf gegen die ökologische Katastrophe. Wir brauchen alles, was wir an Effizienzverbesserungen kriegen können. Aber die Wissenschaft sagt eindeutig, dass diese allein nicht ausreichen werden, um das Problem zu lösen. Und warum nicht? Weil in einer wachstumsorientierten Wirtschaft Effizienzverbesserungen, die eine Möglichkeit wären, unsere Umwelteffekte zu verringern, dann doch dafür eingesetzt werden, um die Wachstumsziele voranzubringen – um immer weitere Bereiche der Natur in die Kreisläufe von Extraktion und Produktion hineinzuziehen. Das Problem ist nicht die Technologie. Das Problem ist das Wachstum.
Erste Regungen
Von Fredric Jameson stammt der berühmte Ausspruch, es sei leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Das ist eigentlich gar nicht so erstaunlich. Schließlich kennen wir nichts anderes als den Kapitalismus. Selbst wenn wir mit ihm irgendwann Schluss machen würden, was käme dann danach? Was würden wir an seine Stelle setzen? Was würden wir tun am Tag nach der Revolution? Als was würden wir das bezeichnen? Unser Denkvermögen – und sogar unsere Sprache – macht an den Grenzen des Kapitalismus Halt, und dahinter lauert ein schrecklicher Abgrund.
Wie merkwürdig. Wir sind eine Kultur, die in das Neue vernarrt ist, besessen von Erfindung und Innovation. Wir feiern angeblich das kreative Denken, das Aufbrechen alter Denkmuster. Mit Sicherheit würden wir niemals über ein Smartphone oder ein Kunstwerk sagen: »Dies ist das beste Gerät oder Bild, das je erschaffen wurde, das lässt sich niemals übertreffen und wir sollten das auch gar nicht erst versuchen!« Es wäre naiv, die Macht der menschlichen Kreativität zu unterschätzen. Wie kommt es dann aber, dass wir, wenn es um unser Wirtschaftssystem geht, die Behauptung so bereitwillig geschluckt haben, der Kapitalismus sei die einzig mögliche Option und wir sollten nicht einmal mit dem Gedanken spielen, etwas Besseres zu erfinden? Warum sind wir so untrennbar mit den verstaubten Dogmen dieses alten Modells aus dem 16. Jahrhundert verbunden, dass wir es verbissen in eine Zukunft mitschleppen, für die es ganz offensichtlich nicht taugt?
Aber vielleicht ändert sich ja gerade etwas. Während einer 2017 im Fernsehen übertragenen Town-Hall-Veranstaltung in New York stand ein junger Student namens Trevor Hill auf und richtete eine schlichte Frage an Nancy Pelosi, die damalige Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses und eine der mächtigsten Persönlichkeiten der Welt. Er zitierte eine Studie der Havard University, die nachwies, dass 51 Prozent der Amerikaner zwischen 18 und 29 nicht mehr hinter dem Kapitalismus stehen, und wollte wissen, ob die Demokraten, Pelosis Partei, in der Lage wären, diese sich rasch wandelnde Realität zu akzeptieren und die Vision einer alternativen Wirtschaft zu entwerfen.39
Pelosi war sichtlich verblüfft. »Ich danke dir für deine Frage«, sagte sie, »aber ich muss leider sagen, wir sind Kapitalisten, und so ist es nun einmal.«
Das Video dieses Gesprächs ging viral. Seine Wirkung war so durchschlagend, weil es in aller Öffentlichkeit vorführte, dass es ein Tabu gibt, was das Hinterfragen des Kapitalismus betrifft. Trevor Hill ist kein hartgesottener Linker. Er ist einfach ein durchschnittlicher Millennial – intelligent, gut informiert, an der Welt interessiert und begierig, eine bessere zu entwerfen. Er hatte eine ernsthafte Frage gestellt, und doch war Pelosi, stammelnd und in der Defensive, nicht in der Lage, sich darauf einzulassen oder auch nur eine sinnvolle Rechtfertigung ihrer Position zu formulieren. Der Kapitalismus wird so selbstverständlich als gegeben hingenommen, dass seine Befürworter nicht einmal wissen, wie sie ihn rechtfertigen sollen. Pelosis Antwort – »so ist es nun einmal« – sollte eigentlich die Frage abwürgen, bewirkte allerdings das Gegenteil. Sie enthüllte die Schwäche einer abgestandenen Ideologie. Es war, als hätte man dem Zauberer von Oz den Vorhang weggezogen.
Das Video regte die Fantasie der Menschen an, weil es zeigte, dass jüngere Leute bereit sind, anders zu denken; dass sie bereit sind, alte Gewissheiten infrage zu stellen. Und sie sind nicht allein. Obwohl die meisten Menschen sich vielleicht nicht als anti-kapitalistisch bezeichnen würden, zeigen Umfrageergebnisse dennoch, dass breite Mehrheiten Kernsätze der kapitalistischen Ökonomie infrage stellen. Eine YouGov-Umfrage fand 2015 heraus, dass 64 Prozent der Menschen in Großbritannien der Meinung sind, der Kapitalismus sei ungerecht. Selbst in den USA sind es 55 Prozent. In Deutschland solide 77 Prozent. 2020 ergab eine Umfrage des Edelman Trust Barometer, dass eine Mehrheit der Menschen auf der ganzen Welt (56 Prozent) folgender Feststellung zustimmt: »Der Kapitalismus schadet mehr, als er nützt«. In Frankreich beträgt die Zustimmung sogar 69 Prozent. In Indien sind es gigantische 74 Prozent.40 Darüber hinaus sagen volle drei Viertel aller Menschen in allen großen kapitalistischen Ökonomien, dass sie Konzerne für korrupt halten.41
Diese Meinungen fallen noch ausgeprägter aus, wenn die Fragen im Zusammenhang mit Wachstum gestellt werden. Eine von der Universität von Yale 2018 durchgeführte Meinungsumfrage ergab, dass ganze 70 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner der Feststellung zustimmen, dass »Umweltschutz wichtiger ist als Wachstum«. Und diese Ergebnisse gelten sogar auch für republikanische Staaten, einschließlich des tiefen Südens. Am niedrigsten fallen die Ergebnisse in Oklahoma, Arkansas und West Virginia aus, aber selbst dort teilt eine überwältigende Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (64 Prozent) diese Meinung.42 Dies stellt langjährige Annahmen, was die Einstellung der Menschen gegenüber der Wirtschaft betrifft, vollkommen auf den Kopf.
2019 hat der European Council on Foreign Relations Menschen in 14 europäischen Ländern diese Frage vorgelegt und sie dabei noch zugespitzt. Die Formulierung lautete folgendermaßen: »Glauben Sie, dass die Umwelt Vorrang haben sollte, selbst wenn dies dem Wirtschaftswachstum schadet?« Man sollte eigentlich erwarten, dass die Leute zögern würden, bei einer solchen Abwägung ihre Zustimmung zu geben. Und doch antwortete in fast allen Fällen eine breite Mehrheit (zwischen 55 Prozent und 70 Prozent) mit Ja. Es gab nur zwei Ausnahmen, bei denen die Zustimmung knapp unter 50 Prozent lag. Ähnliche Ergebnisse finden wir auch außerhalb von Westeuropa und Nordamerika. Eine wissenschaftliche Bewertung von Umfragen stellte fest, dass die Menschen, wenn sie die Wahl haben zwischen Umweltschutz und Wachstum, »dem Umweltschutz in fast allen Umfragen und Ländern den Vorrang geben«.43
In manchen Umfragen wird deutlich, dass die Menschen bereit sind, auch noch weiterzugehen. Eine groß angelegte Verbraucherstudie ergab, dass weltweit im Durchschnitt rund 70 Prozent der Menschen in Ländern mit mittlerem und hohem Einkommen davon überzeugt sind, dass ein Übermaß an Konsum unseren Planeten und die Gesellschaft gefährdet, dass wir weniger kaufen und besitzen sollten und dass Glück und Wohlbefinden dadurch nicht beeinträchtigt würden.44 Das sind frappierende Ergebnisse. Wie auch immer sich diese Menschen politisch einordnen würden, sie artikulieren auf jeden Fall Prinzipien, die der inneren Logik des Kapitalismus diametral widersprechen. Das ist eine außergewöhnliche Story, die bisher fast vollständig im Verborgenen gehalten wurde. Im Stillen sehnen sich die Menschen überall auf der Welt nach etwas Besserem.
Degrowth
Manchmal stehen wissenschaftliche Erkenntnisse im Konflikt mit der vorherrschenden Weltanschauung einer Zivilisation. Ist dies der Fall, müssen wir eine Entscheidung treffen. Entweder wir ignorieren die Wissenschaft oder wir ändern unsere Weltanschauung. Als Charles Darwin erstmals nachwies, dass alle Arten, die Menschen eingeschlossen, sich im Lauf der Tiefenzeit aus gemeinsamen Vorfahren entwickelten, erntete er nur Hohn und Spott. Die Vorstellung, dass Menschen sich aus Nichtmenschen entwickelten und nicht nach dem Bilde Gottes erschaffen wurden, und die Vorstellung, dass die Geschichte des Lebens auf der Erde sich viel weiter zurück erstreckt als die paar Tausend Jahre, von denen die Bibel spricht – solche Ideen waren seinerzeit absolut inakzeptabel. Der eine oder die andere bemühte sich, Darwins Beweise mit abwegigen alternativen Theorien zu entkräften, in einem verzweifelten Versuch, den Status quo zu erhalten. Aber die Katze war aus dem Sack. Es dauerte nicht lange und Darwins Werk war wissenschaftlicher Konsens geworden und veränderte für immer unseren Blick auf die Welt.
Zurzeit vollzieht sich ein ähnlicher Prozess. Während sich die Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen BIP-Wachstum und ökologischem Zusammenbruch zunehmend verdichten, ändern Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt ihren Denkansatz. 2018 appellierten 238 Wissenschaftler*innen an die Europäische Kommission, das BIP-Wachstum aufzugeben und sich stattdessen auf das menschliche Wohlbefinden und die ökologische Stabilität zu konzentrieren.45 Im Jahr darauf veröffentlichten mehr als 11.000 Wissenschaftler*innen aus über 150 Ländern einen Artikel, der die Regierungen der Welt aufforderte, »die Gewichte zu verlagern vom Streben nach BIP-Wachstum und Überfluss hin zum Erhalt von Ökosystemen und der Verbesserung des Wohlbefindens«.46 Noch vor wenigen Jahren wäre dies in Kreisen des Mainstreams undenkbar gewesen, aber gerade formiert sich ein erstaunlicher neuer Konsens.
Vom Wachstum abzulassen, ist nicht so verwegen, wie es vielleicht aussieht. Jahrzehntelang hat man uns erzählt, wir bräuchten Wachstum, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Es zeigt sich aber, dass das eigentlich gar nicht stimmt. Über einen gewissen Punkt hinaus, den die einkommensstarken Länder längst überschritten haben, beginnt sich die Beziehung zwischen BIP und sozialen Auswirkungen aufzulösen. Dies ist eigentlich nicht weiter überraschend. Das BIP ist ein Indikator aggregierter Produktion, gemessen in Form von realen Marktpreisen. Wie wir in Kapitel 4 sehen werden, geht es gar nicht um die steigende gesamtwirtschaftliche Produktion, Was eigentlich zählt, ist die Frage, was wir produzieren, ob die Menschen Zugang zu den Dingen haben, die sie für ein anständiges Leben brauchen, und wie das Einkommen verteilt ist. Die Frage der Verteilung ist hier von besonderer Bedeutung, da das Einkommen derzeit in hohem Maße ungerecht verteilt ist. Man bedenke: Das reichste eine Prozent (allesamt Millionäre) nehmen jedes Jahr etwa 19 Billionen Dollar ein – das ist fast ein Viertel des globalen BIP.47 Das ist erstaunlich, wenn man es sich genau überlegt. Es bedeutet, dass fast ein Viertel der gesamten Arbeit, die wir erbringen, der Ressourcen, die wir extrahieren, und des gesamten CO2, das wir emittieren, dem Ziel dient, reiche Leute noch reicher zu machen.
Wenn wir erst einmal verstanden haben, dass wir das Wachstum gar nicht brauchen, haben wir den Kopf frei, um sehr viel rationaler darüber nachzudenken, wie auf die bevorstehende Krise zu reagieren ist. Die Wissenschaftler*innen haben klargemacht, dass der einzig gangbare Weg, die ökologische Katastrophe abzuwenden und die globale Erwärmung unter 1,5 Grad Celsius oder allenfalls 2 Grad Celsius zu halten, für die einkommensstarken Länder darin besteht, das wahnsinnige Tempo von Extraktion, Produktion und Abfall aktiv zu drosseln.48